Osterinsel (Rapa Nui)
Kaum eine Insel ist so geheimnisumwittert wie das ferne Rapa Nui, der „Nabel der Welt“, wie sie von ihren polynesischen Bewohnern bezeichnet wird. Sie hat nicht nur die Fantasie angeregt, sondern auch die wissenschaftrliche Forschung beflügelt. Viele Erkenntnisse wurden gewonnen - und wieder verworfen. Dass auf dem von den Kolonialherren "Osterinsel" genannten Eiland ein Ökosuizid stattgefunden hätte, gilt mittlerweile als widerlegt. Andererseits haben sich die engen Beziehungen zum südamerikanischen Festland in vorkolonialer Zeit erhärtet. Bei allen immer noch vorhandenen Fragen und Widersprüchlichkeiten hat die Insel ihre Sonderstellung und spirituelle Bedeutung innerhalb der polynesischen Welt behalten.
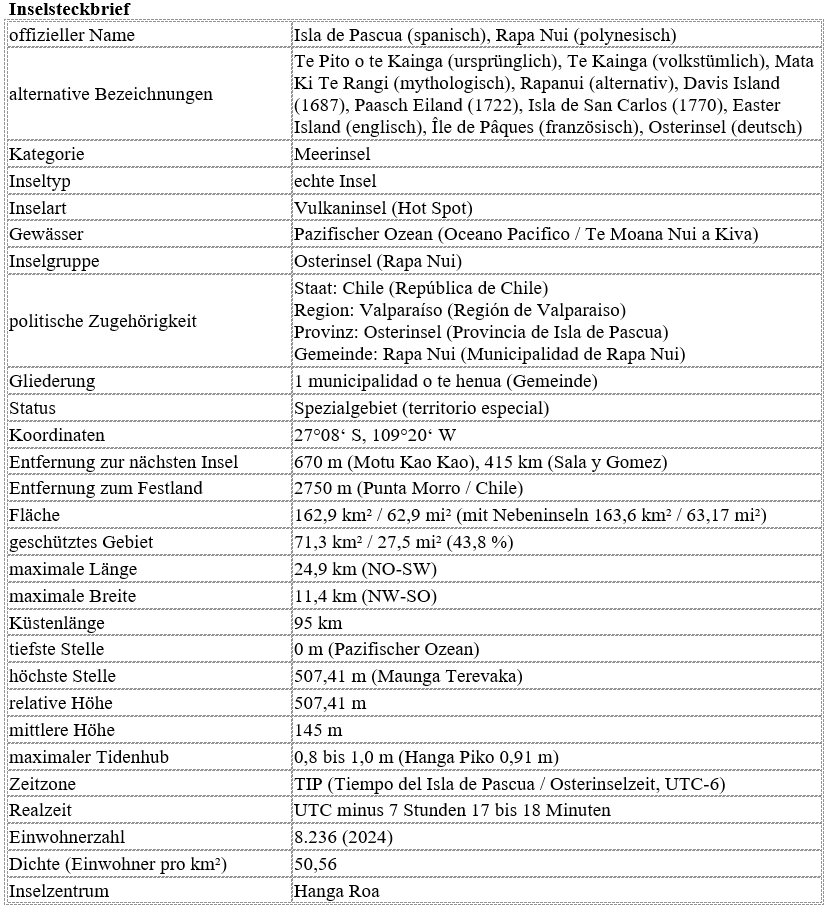
Name
Einem Traumgesicht des Visionärs Hau Maka folgend, segelte Häuptling Hotu Matua (Hotu Matu’a) um die Mitte des 4. Jahrhunderts von der Austral-Insel Rapa, möglicherweise auch von einer der Marquesas-Inseln aus mit 200 Getreuen ostwärts. Dabei stieß die Gruppe auf Te Pito o te Kainga, „ein kleines Stück Land“, und lieeß sich dort nieder. Später nannten die Bewohner ihre Heimatinsel schlicht Te Kainga, „das Land“, oder Te Pito o te Henua, was soviel wie „Mittelpunkt bzw. Nabel der Erde“ bedeutet. Neben diesen beiden gab und gibt es noch eine Reihe weiterer mythisch verwobener Bezeichnungen. So heißt die Insel in spirituell ausdeutbarer Umschreibung seiner einsamen Lage in den Weiten des Ozeans noch heute Mata Ki Te Rangi, „das Auge, das gegen den Himmel sieht“, in profaner Interpretation „die Grenze gegen den Himmel“.
Von alledem wussten die Europäer, die ab dem 17. Jahrhundert hierher gelangten, nichts. Der holländische Bukanier Edward Davis, Kapitän der „Batchelor’s Delight“, ordnete eine 1687 in sein Blickfeld geratene „niedrige, sandige Insel“ - wobei unklar bleibt, ob es das mittlerweile auch polynesischen Kontakten entschwundene Te Kainga war - dem „unbekannten Südland“, Terra Australis Incognita, zu. In den Karten der Folgezeit wurde sie als Davis Land eingetragen und als Ausläufer der Antarctica verzeichnet. Als die Crew des holländischen Kapitäns Jacob Roggeveen am Ostersonntag des Jahres 1722 des entlegenen Eilands ansichtig wurde, gab es keine Zweifel mehr: Es handelte sich um eine Insel weit entfernt von jeglichem Festland. Unter Bezugsnahme auf den Tag der „Entdeckung“ nannte Roggeveen den grasbewachsenen Felsklotz Paasch Eiland, deutsch Osterinsel. Die Engländer machten später daraus in wörtlicher Übersetzung Easter Island, die Franzosen Île de Pâques.
Als Felipe Gonzalez mit seinem Schiff 1772 die Insel anlief, reklamierte er sie sogleich für sein Vaterland und gab ihr zur Unterstreichung dieses Anspruches den Namen seines Königs Isla de San Carlos, „Insel des heiligen Karl“. Erst im Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts übernahmen die spanischsprachigen Südamerikaner die mittlerweile allgemein gebräuchliche Bezeichnung und formten sie zu Isla de Pascua um. Dieser Name ist seit 1888, als die Insel der Republik Chile unterstellt wurde, die rechtsgültige Titulatur des Eilands.
Ein allgemein anerkannter und auch von den Betroffenen selbst akzeptierter Name fehlte, bis im Jahr 1863 tahitianische Seeleute die von den Europäern so genannte Osterinsel mit der Bezeichnung Rapa Nui, gesprochen [ˈɾapa ˈnu.i], bedachten. Rapa, wörtlich übersetzt „Tanzpaddel“, ist zugleich der Name einer Australinsel, heute Rapa Iti, von der Hotu Matua angeblich stammte, und nui das polynesische Wort für „groß“. Europäische Wissenschaftler übernahmen den Ausdruck inzwischen, und auch die chilenische Staatsmacht zeigte sich einsichtig und erlaubte den Insulanern 1993, ihre Insel alternativ-amtlich Rapa Nui - üblich ist auch die Schreibung Rapanui - zu nennen.
- acehnesisch: Pulo Easter
- afrikaans: Paaseiland
- albanisch: Ishulli i Pashkëve
- alemannisch: Ostereiland
- amharisch: የፋሲካ ደሴት [yä-Fasika däset]
- angelsächsisch: Eastre Íeg
- arabisch: جزيرة الفصح [Ǧazīrâtu l-Fiṣḥ]
- aragonesisch: Isla de Pasqua
- armenisch: Զատիկան կղզի [Zatikan kġzi]
- aromunisch: Insula Pastela
- aserbaidschanisch: Пасха адасы [Pasxa adası]
- asturisch: Islla de Pascua
- bairisch-österreichisch: Ostainsl
- baskisch: Bazko Irla
- bikol: Isla nin Pagkabuhay-liwat
- bosnisch: Ycкpшнje ocтpbo [Uskršnje ostrvo]
- bretonisch: Enez Pask
- bulgarisch: Великденски остров [Velikdenski ostrov]
- cebuano: Pulo sa Tśile
- chinesisch: 復活節島 / 复活节岛 [Fùhuó Jié dǎo]
- dari: جزیرۀ پاک [Jazīre-ye Pāk]
- dänisch: Påskeøen
- deutsch: Osterinsel
- englisch: Easter Island
- esperanto: Paskinsulo
- estnisch: Lihavõttesaar
- färösch: Paskoy
- finnisch: Pääsiäissaari
- franko-provenzalisch: Ila de Pâques
- französisch: Île de Pâques
- friesisch, nord: Poosche-eilönj
- friesisch, west: Peaske-eilân
- friulanisch: Isule di Pasche
- gagausisch: Paskellä Adası
- galizisch: Illa de Páscoa
- gälisch: Eilean na Càisge
- georgisch: პასექის კუნძული [Paseḳis kundžuli]
- griechisch: Νησί του Πάσχα [Nīsí toy Pásĥa]
- gudscheratisch: ઈસ્ટર ટાપુ [Īsṭar ṭāpu]
- guyanisch: Zil di Pak
- haitianisch: Ilde Pak
- hakka: Fu̍k-fa̍t-chiet-tó
- hawaiianisch: Lapa Nui
- hebräisch: אי הפסחא [Î ha-Pasḥâ]
- hindi: ईस्टर द्वीप [Īsṭar dvīp]
- ido: Pasko-Insulo
- indonesisch: Pulau Paskah
- interlingua: Insula de Pascha
- irisch: Oileán na Cásca
- isländisch: Páskaeyja
- italienisch: Isola di Pasqua
- jakutisch: Пасха арыыта [Pasȟa aryyta]
- japanisch: イースター島 [Īsutā tō]
- jerseyanisch: Île de Pâques
- jiddisch: קײסעך-אינדזלען [Keyseḫ-Indzlen]
- kabardisch: Пасхэ хы тӀыгу [Pasȟă ȟə ṭəgʷ]
- kambodschanisch: Raphanū
- karelisch: Pææcиæccacapи [Pääsiässasari]
- kasachisch: Пасха аралы [Pasĥa araly]
- katalanisch: Illa de Pasqua
- kirgisisch: Пасха аралы / پاسحا ارالى [Pasha aralı]
- koreanisch: 이스터 섬 [Iseuteo seom], Buhwaljeol seom
- kornisch: Ynys Pask
- korsisch: Isola di Pasqua
- kroatisch: Uskršnji otok
- ladinisch: Insula de Pascua
- lateinisch: Insula Paschalia
- lettisch: Lieldienu sala
- letzeburgisch: Ouschterinsel
- limburgisch: Paoseiland
- litauisch: Velykų sala
- madegassisch: Nosin’i Paska
- makedonisch: Велигденски остров [Veligdenski ostrov]
- malaisch: ڤولاو ڤسكه [Pulau Paskah]
- malayalam: ഈസ്റ്റര് ദ്വീപ് [Īsṟṟar dvīp]
- maltesisch: Gżira ta' l-Għid
- manx: Ellan ny Caisht
- maori: Moutere Aranga
- marathisch: ईस्टर द्वीप [Īsṭar dwīp]
- mindeng: Bô-uăk-cáik-dō̤
- minnan: Koh-oa̍h-cheh-tó
- mirandesisch: Illa de Pascua
- moldawisch: Инсула Паштелуй [Insula Paştelui]
- mongolisch: Улаан өндөгний баярын арал [Ulaan öndögnij bajaryn aral]
- nahuatl: Pascua Tlālhuāctli
- niederländisch: Paaseiland
- niedersächsisch: Oosterinsel
- norwegisch: Påskeøya
- okzitanisch: Iscla de Pasqua
- ossetisch: Куадзӕны сакъадах [Kuadzäny saḳadaȟ]
- pandschabisch: ਈਸਟਰ ਟਾਪੂ [Īsṭar ṭāpū]
- pandschabisch, west: ایسٹر ٹاپو [Īsṫar ṫāpū]
- papiamentui: Isla de Pasku
- persisch: جزیرۀ ایستر [Jazīre-ye Īstar], جزیرۀ پاک [Jazīre-ye Pāk]
- piemontesisch: Isola di Pasqua
- pitkernisch: Iista Ailen
- plattdeutsch: Ostereiland
- polnisch: Wyspa Wielkanocna
- portugiesisch: Ilha de Páscoa
- provenzalisch: Ila de Pâques
- quetschua: Rapanuy, Paskwa wat’a
- rapanui: Rapa Nui, Te Pito O Te Henua, Te Pito o te Kanga
- rätoromanisch: Insla de Pasqua
- romani: Rapanui
- rumänisch: Insula Paştelui
- rundi-rwsndesisch: Rapanuyi
- russisch: Остров Пасхи [Ostrov Pasĥi]
- rwandesisch: Rapanuyi
- samisch: Beassášsuolu
- sardisch: Isula de Pasca
- saterfriesisch: Paasken-Oailound
- schlesisch: Wjelganocno Wyspa
- schottisch: Easter Ilan
- schwedisch: Påskön
- schweizerdeutsch: Ostereiland
- serbisch: Ускршњи острво [Uskršnji ostrvo]
- sizilianisch: Isula di Pasqua
- slovio: Velikonozju Ostrov
- slowakisch: Veľkonočný ostrov
- slowenisch: Velikonočni otok
- sorbisch, ober: Jatšační Kupa
- sorbisch, nieder: Jutriční Kupa
- spanisch: Isla de Pascua
- sudovisch: Paskhā salā
- sundanesisch: Pulo Paskah
- swahili: Kisiwa ya Pasaka
- tadschikisch: Ҷазираи Писҳо [Ǧazirai Pisho], جزیرۀ پسها [Jazīrâ-yi Pishō]
- tagalog: Pulau ng Pasko
- tahitianisch: Rapa Nui
- tamilisch: ஈஸ்டர் தீவு [Īsṭar tīvu]
- tatarisch: Пасха утравы [Pasxa utrawı]
- thai: เกาะอีสเตอร์ [Kɔ Īttə̄r]
- tok pisin: Ista Ailan
- tonganisch: Lapanui
- tschechisch: Velikonoční ostrov
- türkisch: Paskalya Adası
- uigurisch: پاسخا ئارالى / Пасха арали [Pasxa arali]
- ukrainisch: Острів Пасхі [Ostriv Pasĥi], Острів Великдня [Ostriv Velykdnja]
- ungarisch: Húsvét-sziget
- urdu: جزیرہ ایسٹر [Jazīrâ-e Īsṫar]
- usbekisch: Пасха Oроли / پەسخە ئارالى [Pasxa Oroli]
- venezianisch: Ìxoła de Pasqua
- vietnamesisch: Đảo Phục Sinh
- visayan: Rapanui
- walisisch: Ynys y Pâsg
- wallonisch: Iye di Påke
- weißrussisch: Востраў Пасхі [Vostraŭ Paschi], Выспа Вялікдня [Vyspa Vialikdnia]
- winaray: Lalawigan
- yoruba: Erékùṣù Àjínde
Lage
Die Osterinsel liegt weit weg von jeglicher festen Landfläche im Südosten des Pazifischen Ozeans auf durchschnittlich 27°08’ s.B. und 109°20’ w.L.. Sie befindet sich auf der gleichen geografischen Breite wie Cupiapa im Zentrum Chiles, Tucuman im Norden Argentiniens, der äußerste Süden Paraguays, Blumenau im Süden Brasiliens, der Süden Namibias, das nördlich-zentrale Südafrika, Süd-Swasiland sowie Zentral-Australien zwischen Billabong und Brisbane. Nächster Nachbar der Osterinsel ist die über 400 km entfernte Felsinsel Sala y Gómez. Das chilenische Festland ist über 3500 km, die Antarktis rund 5200 km und Neuseeland 6700 km entfernt.
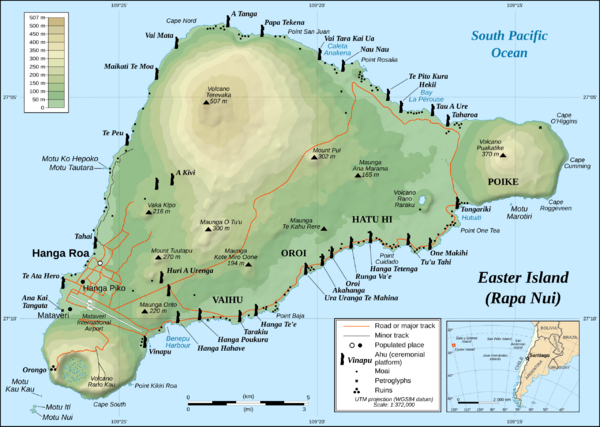
Geografische Lage:
- nördlichster Punkt: 27°03’14“ s.B. (O Taki)
- südlichster Punkt: 27°12’10“ s.B. (Motu Nui)
- östlichster Punkt: 109°13’47“ w.L. (Kava Kava Kioe)
- westlichster Punkt: 109°27’10“ w.L. (Motu Nui)
Entfernungen:
- Sala y Gomez 415 km
- Ducie / Pitcairn 1840 km
- Pitcairn (Saint Paul’s Point) 2078 km
- Mas Afuera / Juan Fernandez 2250 km
- Mangareva (Kouako) 2260 km
- Rapa / Austral-Inseln 3120 km
- Fatu Hiva / Marquesas-Inseln 3240 km
- Caleta El Piure / Chilenisches Festland 3506 km
- Santiago de Chile 3760 km
- Isla Santa Maria / Galapagos (Punta Sur) 3870 km
- Tahiti / Gesellschaftsinseln 4251 km
Zeitzone
Auf der Osterinsel gilt die Tiempo del Isla de Pascua bzw. Easter Island Time (Osterinsel-Zeit), abgekürzt TIP bzw. EAST (OIZ), entsprechend der Tiempo Estándar del Centro (TEC) bzw. Central Time Zone (CTC), 7 Stunden hinter der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ, UTC-6), wobei zwischen September und April die Uhren sommerzeitlich um eine Stunde vorgestellt werden (UTC-5). Die Realzeit liegt um 7 Stunden und 17 bis 18 Minuten hinter der Koordinierten Weltzeit (UTC).
Fläche
Die Osterinsel ist mit Nebeninseln 163,6 km² bzw. 63,17 mi², ohne Nebeninseln 162,9 km² bzw. 62,9 mi² groß. Alternativ werden 162,5 km² bis 179,85 km² bzw. 69,2 mi² angegeben. Von Nordosten nach Südwesten zwischen Kava Kava Kioe und Motu Nui durchmisst sie 24,9 km bei einer maximalen Breite zwischen Punta Vai Mata und Punta Akahanga von 11,4 km. Die Küstenlänge wird auf 60 bis 70 km geschätzt, müsste aber aufgrund der starken Zerklüftung mindstens 95 km betragen. Höchste Erhebung ist der Krater des Maunga Terevaka mit 507,4 m. Die tiefste Stelle liegt auf Meeresniveau mit einem maximalen Tidenhub von 0,8 bis 1,0 m (Hanga Piko 0,91 m). Die mittlere Seehöhe beträgt 145 m.
Flächenaufteilung (um 2000):
Brach- und Ödland 105,8 km² 58,8 %
Agrarland 63,0 km² 35,0 %
Waldland 8,0 km² 4,5 %
Siedlungsland 3,0 km² 1,7 %
Landschaft
Rapa Nui ist ein vulkanisch geprägtes, leicht hügeliges Eiland mit steilen Klippen und kleinen vorgelagerten Felseninseln. Die Insel hat die Form eines rechtwinkligen Dreiecks mit Seiten von 16, 17 und 24 Kilometern „Hypotenuse“, was der Ostküste entspricht. An jedem Scheitelpunkt befinden sich drei schlafende Vulkane. Im Norden befindet sich der Maunga Terevaka, der mit 511 Metern der höchste Punkt der Insel ist; im Südosten liegt die Halbinsel Poike mit ihrem Hauptvulkan Puakatiki, der 377 Meter hoch ist; und im Südwesten befindet sich der 324 Meter hohe Krater des Rano Kau, in dem mehrere Seen liegen. Weitere wichtige Berge sind der Rano Aroi und der Rano Raraku.
Der Rest der Insel besteht aus Hügeln und Hängen. Die Küste ist steil und felsig, mit einer Reihe von kleinen Inseln in der Nähe, wie Motu Nui, Motu Iti und Motu Kao Kao im äußersten Südwesten, Motu Tautara an der Westküste und Motu Marotiri an der Westküste. Die einzigen Ausnahmen sind die Küste vor Hanga Roa und der Sektor Anakena, wo sich der gleichnamige Strand und der Strand Ovahe befinden.
Der Osterinsel vorgelagert sind insgesamt 115 kleine, unbewohnte Felsinseln, darunter im Norden Motu Ru und Motu Kau, im Nordosten Motu Toremo Hiva und Motu Maratmiri, im Süden Motu Marotiri, Motu O Pope, Motu Toe Toe, Roa, Papa Rava, Motu Hitara, Motu Tapu und Motu Taka Taka, im Südwesten Motu Iti, Motu Kau Kau und Motu Nui, im Westen Motu Tautara, Motu Maihoru, Motu Hepo, Motu Ihu o Pare, Motu Taka Rua und Motu Kaviti.
Erhebungen Seehöhe
Maunga Terevaka 507,4 m Terevaka
Maunga Kuma 472,0 m Terevaka
Maunga Puka 469,5 m Terevaka
Maunga Puakatiki 370,0 m Maunga Puakatiki
Rano Aroi 332,5 m Terevaka
Mauna Okoro 326,0 m Terevaka
Vaiatare 324,0 m Rano Kau
Mauna O Tu’u 322,5 m Maunga O Tu’u
Rano Kau 316,0 m Rano Kau
Orongo 307,0 m Rano Kau
Mauna Puii 302,0 m Mauna Puii
Maunga Tangaroa 270,0 m Maunga Tangaroa
Maunga Te Kauhara o Varu 270,5 m Maunga Te Kauhara o Vara
Maunga Vai a Heva 262,5 m Maunga Puakatiki
Maunga Orito 218,0 m Maunga Orito
Maunga Roiho 216,0 m Maunga Roiho
Maunga Kote Miro Oone 194,0 m Maunga Kote Miro Oone
Maunga Vai o Hao 190,0 m Maunga Tangaroa
Maunga Ori 186,0 m Maunga Kote Miro Oone
Maunga Anamarama 167,0 m Maunga Anamarama
Maunga Vaka Kipu te Poko 159,0 m Maunga Roiho
Rano Raraku 141,0 m Rano Raraku
Maunga te Kahu Rere 131,0 m Maunga te Kahu Rere
See Fläche Seehöhe Tiefe
Rano Kao 0,9 ha 56 m 11 m
Inseln Fläche Ausmaße Seehöhe
Rapa Nui 162,9 km² 23,5 x 11,4 km 507 m
Motu Nui 0,039 km² 0,3 x 0,3 km 21 m
Motu Iti 0,016 km² 0,2 x 0,1 km 12 m
Motu Kao Kao 0,001 km² 0,1 x 0,1 km 52 m
Geologie

Die auf dem Ostpazifischen Rücken liegende Osterinsel ist als sogenannter Hot Spot vulkanischen Ursprungs und besteht aus drei zusammenwachsenden Vulkanen. Diese drei Hauptvulkane sind: Terevaka, Poike und Rano Kau. Die Anordnung dieser Vulkane und die starke Erosion, die sie erfahren haben, verleihen der Insel ihre dreieckige Form. Der Vulkan Terevaka dominiert in Bezug auf Volumen und Fläche. In prähistorischer Zeit war der Vulkan Poike eine eigenständige Insel, bis Lava vom Terevaka sie mit der Hauptinsel verband. Neben diesen drei Hauptvulkanen gibt es mehrere kleinere Vulkane und vulkanische Geoformen wie den Krater Rano Raraku, den Schlackenkegel Puna Pau und mehrere vulkanische Höhlen, einschließlich Lavaröhren.
Bei den Gesteinen der Insel handelt es sich hauptsächlich um Hawaiite und Basalte, die beide eisenhaltig und mit den Gesteinen des Kolumbus-Archipels verwandt sind. Außerdem gibt es pyroklastische Gesteine wie den vulkanischen Tuff, aus dem die meisten Moais bestehen. Der Vulkan Terevaka ist jünger als Poike und Rano Kau. Die beiden letztgenannten Vulkane haben ihre Tätigkeit mit der Intrusion von Trachyten und Rhyolithen beendet. Der Vulkanismus auf der Osterinsel ist geologisch gesehen jünger als 0,7 Millionen Jahre. Der jüngste Vulkanismus auf der Insel konzentriert sich auf kleine, über die Insel verteilte Risse. Die jüngsten Laven befinden sich auf Hiva-Hiva, 3 km nördlich von Hanga Roa, und sind weniger als 2000 Jahre alt. Aufgrund der im Holozän, das heißt in den letzten 10.000 Jahren, aufgezeichneten Ausbrüche wird die Insel als aktiver Vulkan im Sinne des Vulkanologen Alexandru Szakács eingestuft.
Die Osterinsel und die benachbarten Inseln wie Motu Nui und Motu Iti bilden die Spitze einer großen Unterwasservulkankette, die sich mehr als 2000 Meter über den Meeresboden erhebt. Die Osterinsel befindet sich im westlichen Teil der Kette, zu der auch die Inseln Salas und Gomez gehören. Die Vulkankette der Osterinsel, auch Salas y Gómez-Kette genannt, verläuft von Westen nach Osten, wo sie sich mit dem unterseeischen Nazca-Rücken63 verbindet, der unter Peru subduziert wird. Die beiden Gebirgszüge liegen innerhalb der Nazca-Platte und durchqueren diese von einer Seite zur anderen. Das westliche Ende der Vulkankette der Osterinsel besteht aus einer Gruppe submariner Vulkane westlich der Osterinsel, wobei die Moai- und Pukao-Berge unter dem Meeresspiegel liegen, sowie aus einigen niedrig gelegenen Vulkanfeldern auf dem Meeresboden. Das westliche Ende der Kette liegt sehr nahe am Ostpazifischen Rücken und der kleinen Osterplatte.
Die Ursache des Vulkanismus auf der Osterinsel und der Vulkane der Vulkankette der Osterinsel ist unter Wissenschaftlern ein heiß diskutiertes Thema. Einige haben die Existenz eines Mantelplumes vorgeschlagen, der einen heißen Punkt unter der Insel erzeugt, andere schlagen die Existenz einer „heißen Linie“ anstelle eines heißen Punktes vor, der durch eine „Mantelrolle“ anstelle eines Mantelplumes erzeugt wurde. Es wurde auch vorgeschlagen, dass die Vulkankette das Ergebnis einer Bruchausbreitung, eines jungen ozeanischen Grabens und eines „Kanal-Plumes“ ist, der sich von Salas y Gómez nach Westen erstreckt.
Yamirka Rojas-Agramonte, Geologin an der Christian Albrechts Universität Kiel, reiste 2019 mit enem internationalen Forschereteam auf die Osterinsel, um ihre Entstehung genauer zu datieren. Auf der Suche nach Gesteinsproben fanden sie im Sand der Insel Hunderte von Zirkonkörnern. Das Material kristallisiert, wenn sich Magma abkühlt … Die Analyse der Zirkonenkörner ergab zum einen ein überraschendes Alter. Zum anderen war auch ihre Zusammensetzung in allen Fällen mehr oder weniger gleich. Sie müssen also alle aus Magma mit der gleichen Zusammensetzung wie die heutigen Vulkane entstanden sein. Diese Vulkane können aber nicht seit 165 Millionen Jahren aktiv sein, da die darunterliegende Platte nicht einmal so alt ist.“ Laut Yamirka Rojas Agramonte kann man „die Ergebnisse nur so erklären, dass diese uralten Minerale an der Quelle des Vulkanismus entstanden sind, im Erdmantel unter der Platte, lange bevor sich die heutigen Vulkane bildeten.“. (https://www.uni-kiel.de/de/detailansicht/news/169-osterinsel) Diese Entdeckung deutet darauf hin, dass der Mantelplume der Osterinsel schon vor 165 Millionen Jahren aktiv war und der Erdmantel sich möglicherweise langsamer bewegt als bisher angenommen.
Flora und Fauna
Die Osterinsel ist vergleichsweise artenarm, hat aber einige endemische Spezies hervorgebracht.
Flora
Die Osterinsel gehört zu den artenärmsten Inseln des Südpazifiks. Es sind weniger als 30 indigene Samenpflanzen (Spermatophyta) bekannt. Das ist hauptsächlich eine Folge der isolierten Lage, die Insel war niemals mit einer kontinentalen Landmasse verbunden. Vögel, Wind und ozeanische Strömungen konnten nur in weit geringerem Maße als bei anderen Inseln Samen eintragen.
Der erfolgreichste Überträger von Pflanzenmaterial dürfte daher der Mensch gewesen sein. Bereits die ersten Siedler haben Nutzpflanzen auf die Insel gebracht, wie die Legende von Hotu Matua berichtet. Die Legende dürfte insoweit auf einem wahren Kern beruhen. Zahlreiche Nutzpflanzen existierten bereits, bevor die Europäer die Insel erreichten, wie mehreren Berichten – zum Beispiel von Roggeveen, Forster und anderen frühen Entdeckern – zu entnehmen ist. Dazu gehörten zum Beispiel: Papiermaulbeerbaum, Süßkartoffel, Yams und Taro. Aber auch die Europäer trugen in umfangreichem Maße Pflanzen ein, zum Beispiel verschiedene Grasarten als Weidepflanzen für die Schafe und Rinder.
Die heute vorherrschende Vegetation entspricht nicht der ursprünglichen. Sie ist das Ergebnis massiver menschlicher Eingriffe in das Ökosystem. Archäobotanische Befunde belegen, dass die Insel einst dicht mit Palmwäldern der Gattung Jubaea, einer nahen Verwandten der Honigpalme Jubaea chilensis, bedeckt war. In Proben von Rano Kao wurde nachgewiesen, dass eine Entwaldung über einen längeren Zeitraum ab dem Jahr 1010 (± 70 Jahre) stattfand. Man schätzt, dass in dieser Zeit mehr als 10 Millionen Palmen auf der Insel gefällt wurden. Der Verlust des Palmenwaldes, der die Kulturpflanzen vor dem ständig wehenden Wind und vor Austrocknung geschützt hatte, führte zu einer umfangreichen Bodenerosion, die wiederum entscheidende Auswirkung auf die Nahrungsmittelversorgung und damit auf den rapiden Rückgang der Bevölkerung gehabt haben dürfte.
Das Totora-Schilf (Scirpus californicus) ist als Rest der ursprünglichen Vegetation in den Kraterseen des Rano-Kao und des Rano-Raraku erhalten. Totora-Schilf wurde von den Ureinwohnern vielfältig genutzt, zum Beispiel zum Bau der charakteristischen bootsförmigen Häuser (Paenga-Haus).
Von großer ritueller Bedeutung war der Toromiro-Baum (Sophora toromiro), ein in der freien Natur ausgestorbener Schmetterlingsblütler. Das harte und feinporige Holz wurde vielfältig genutzt, insbesondere für kultische Schnitzereien. Exemplare dieser endemischen Baumart haben lediglich in Botanischen Gärten (zum Beispiel Göteborg, Bonn, London, Valparaíso) überlebt.
Auffallend ist der geringe Bestand an Farnen. Lediglich 15 Spezies wurden entdeckt, vier davon sind endemisch. Im Vergleich zu anderen Inseln des Südpazifiks (zum Beispiel Marquesas mit 27 Familien, 55 Gattungen und 117 Arten von Farnen) ist das sehr wenig.
Eine weitere indigene Pflanze, die auf der Osterinsel nur noch in wenigen Exemplaren als kleinwüchsiger Busch vorkommt, ist die zu den Lindengewächsen (Tiliaceae) gehörende Triumfetta semitriloba. Pollenanalysen haben ergeben, dass die Pflanze bereits seit 35.000 Jahren auf der Insel wächst. Aus den speziell behandelten Fasern der Rinde knüpften die Rapanui ihre Fischernetze und möglicherweise die Transportseile für die Moai.
Heute ist die Landschaft der Osterinsel überwiegend von ausgedehnten Grasflächen geprägt. Die häufigsten vorkommenden Pflanzenfamilien sind die der Süßgräser (Poaceae), von denen nur vier Spezies indigen sind, und die der Sauergrasgewächse (Cyperaceae). Eine weitere häufige Pflanzenfamilie ist die der Korbblütler (Asteraceae), deren heute vorkommende Arten ausschließlich anthropochore Pflanzen sind. Über größere Bereiche im Südwesten haben sich vom Menschen eingeführte Guavenbüsche ausgebreitet. In den letzten Jahren hat es Aufforstungen mit Eukalyptus gegeben. Bei Anakena ist ein Palmenhain mit der ursprünglich nicht auf der Insel vorkommenden Kokospalme entstanden. Als Nutzpflanzen werden heute für den Eigenbedarf Kartoffeln, Taro, Yams, Zuckerrohr sowie subtropische Früchte angebaut.
Eine wichtige Nahrungspflanze, oft zubereitet in einem Erdofen (umu), ist die ursprünglich aus Mittelamerika stammende Süßkartoffel. Sie ist bereits seit Jahrhunderten in der gesamten Südsee und im südasiatischen Raum verbreitet. Flaschenkürbis, Gemüse- und scharfe Paprika sind weitere südamerikanische Pflanzen, die inzwischen auf der Osterinsel wachsen.
Der Anbau von Kulturpflanzen in historischer Zeit erfolgte nach Berichten der europäischen Entdecker in sorgfältig bearbeiteten und abgegrenzten Feldern. La Pérouse schätzte, dass etwa ein Zehntel des Areales, insbesondere die tiefer gelegenen Bereiche der Küstenregion, mit Nutzpflanzen bebaut waren. Das würde etwa 20 km² Anbaufläche entsprechen und ausreichen, um eine Bevölkerung von mehreren Tausend Menschen zu ernähren. Der Ackerbau erfolgte mit der einfachsten Methode, dem Grabstock bzw. aus Mangel an Holz mit einem entsprechend hergerichteten Stein.
Den vulkanischen Boden der Osterinsel durchziehen zahlreiche Lavaröhren. Durch Erosion stürzte an manchen Stellen die Decke ein, sodass sich dolinenartige Spalten bildeten, die sich allmählich mit Humus füllten. Da die ständig wehenden Winde den Anbau von Nahrungspflanzen erschwerten, nutzte man die Bodensenken als ertragreiche Tiefbeete unterhalb des Bodenniveaus (manavai) für die Kultivierung größerer Pflanzen, insbesondere von Bananen. Einige werden heute noch genutzt, so beispielsweise in der Nähe der Anlage Vinapu.
Fauna
Menschliche Eingriffe blieben auch nicht ohne Folgen für die Fauna. Archäologische Grabungen belegen, dass auf der Osterinsel vor der polynesischen Besiedlung 25 Spezies von See- und 6 Spezies von Landvögeln heimisch waren. Davon sind heute auf der Insel selbst (ohne vorgelagerte Motus) nur drei Seevogelarten und vier Landvogelarten verblieben, keine davon indigen oder endemisch.
Von den Säugetieren kommen lediglich eingeführte Haustiere – Pferde, Schafe, Rinder, Schweine – vor. Die ausgewilderten Pferde haben sich mittlerweile zu einem Problem entwickelt. Sie sorgen für die Verbreitung der Guavenbüsche, indem sie die Früchte fressen und die Samen an anderer Stelle ausscheiden. Außerdem reiben sie sich an den liegengebliebenen Statuen und leisten so der allmählichen Erosion Vorschub. Die Pazifische Ratte (Rattus exulans), die vermutlich als Nahrungstier von den ersten Siedlern mitgeführt wurde, ist inzwischen ausgestorben bzw. von europäischen Rattenarten verdrängt worden. Auf der Osterinsel gibt es keine für den Menschen unmittelbar gefährlichen Tiere oder Überträger von Infektionskrankheiten.
Unter den Reptilien ist die Echse Ablepharus boutonii aus der Gattung der Natternaugen-Skinke erwähnenswert. Ihr Name auf Rapanui ist moko. Das etwa 12 cm lange Tier von goldbrauner Farbe genoss offenbar religiöse Verehrung, denn es sind mehrere, sorgfältig aus Toromiro-Holz geschnitzte, anthropomorphe Figuren als Zeremonialobjekte erhalten (zum Beispiel Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Brüssel). Auf dr Insel vielfach zun finden ist die Grüne Meeresschildkröäte. Auf den vorgelagerten Motus nisten zahlreiche Seevögel, darunter Fregattvögel, Sturmtaucher, Tölpel sowie Ruß- und Feenseeschwalben.
An dem steil abfallenden Lavasockel bildete sich kein Korallensaum. Das vielfältige Ökosystem eines Korallenmeeres mit seiner artenreichen Population von Meereslebewesen konnte sich nicht entwickeln. In der Umgebung der Osterinsel wurden 164 Fischarten gezählt, davon 107 Spezies von Küstenfischen. Das ist vergleichsweise wenig, in den Gewässern rund um die Fidschi-Inseln gibt es mehr als 1000 Fischarten. James Cook schrieb dazu in seinem Logbuch: „Die See scheint wie von Fischen befreit, konnten wir doch nicht einen einzigen fangen und es waren auch nur sehr wenige, welche wir bei den Eingeborenen entdeckten“.
Die relative Artenarmut könnte eine der Ursachen für den Bevölkerungsrückgang und den damit verbundenen Kulturverfall auf der Osterinsel gewesen sein.
Nicht selten sind Pottwale zu beobachten. Man vermutet, dass in den Tiefen auch der Riesenkalmar vorkommt. Die Tiefsee weist die bisher dichteste bekannte Konzentration von Schwarzen Rauchern auf, aktive Vulkanschlote, aus denen heißes, mineralreiches Wasser aus dem Erdinneren sprudelt und um die sich bizarre Lebensgemeinschaften gebildet haben. Im Jahr 2005 wurde 1.500 km südlich der Osterinsel eine neue Spezies entdeckt, die sogenannte Yeti-Krabbe (Kiwa hirsuta).
Von besonderem Interesse ist eine endemische Kaurischnecken-Art, die nach Pater Englert benannte Cypraea englerti, die nur vor der Osterinsel und der unbewohnten Insel Sala y Gómez, 400 km östlich, vorkommt.

Pflanzen-und Tierarten: insgesamt endemisch
Flora
wild wachsende Pflanzen 135 30
davon Blütenpflanzen 30 8
Farne 14 5
Fauna
Fische 164 .
Insekten 105 .
Vögel 15 .
Säugetiere 2 0
Reptilien 2 0
Naturschutz
Der Parque Nacional Isla de Pascua (Nationalpark Ostereinsel) ist 71,3 km² groß (ursprünglich waren es 66,66 km²) und umfasst 43,8 % des Inselterritoriums. Er wurde am 16. Januar 1935 von der chilenischen Regierung gegründet und am 23. Juli gleichen Jahres durch Dekret Nr. 4536 zum Nationalmonument erklärt. Durch Dekret Nr. 147 des Ministerio de Agricultura wurde der Nationalpark der Verwaltung durch die Corporación Nacional Forestal (CONAF) unterstellt. 2014 verzeichnete der Park über 65.000 Besucher. 1995 erhioelt er den Status eines Weltkulturerbes der UNESCO. Der Park sollte den Raubbau an der Natur, insbesondere durch Abholzung der Wälder, eindämmen. Der Toromiro-Baum, auf dessen Stämmen vermutlich die bekannten Moai-Statuen transportiert wurden, galt als ausgestorben, konnte aber revitalisiert werden.
Im Parkbereich befinden sich zahlreiche archäologischen Stätten, darunter ungefähr 900 Moai-Statuen, über 300 zeremonielle Plattformen (ahu) sowie Tausende von Bauten, die mit Landwirtschaft, Bestattungsriten, Behausungen und anderen Aktivitäten zusammenhängen.
Seit 2018 verwaltet die indigene Gemeinschaft der Mau Henua den Park und hat damit die Kontrolle über ihr angestammtes Gebiet erlangt. Dieser Selbstverwaltungsansatz zielt darauf ab, sowohl die natürlichen als auch die kulturellen Ressourcen zu erhalten. Es gibt jedoch weiterhin Herausforderungen für die Erhaltung etwa der vulkanischen Lava samt Tuffstein, der strukturellen Stabilität der Monumente sowie der anthropischen Faktoren und Verwitterungseffekte.
Der Park ist ein beliebtes Touristenziel, 2014 wurden über 65.000 Besucher gezählt. Die Besucher müssen Eintrittskarten kaufen und werden dazu angehalten, den Park verantwortungsvoll zu erkunden und die Vorschriften zum Schutz des natürlichen und kulturellen Erbes einzuhalten.
Klima
Das Klima dere Osterinsel ist subtropisch warm, die Jahreszeiten sind nur gering ausgeprägt. Starke Passatwinde prägen das Wettergeschehen. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt mit 21°C.deutlioch niedriger als auf anderen ozeanischen Inseln. Die kältesten Monate sind Juli und August mit 15 bis 20°C, die wärmsten Januar und Februar mit 19 bis 29°C. Die Wassertemperatur beträgt 18 bis 25°C. Niederschläge gibt es das ganze Jahr über. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge liegt bei 1200 bia 1400 mm pro Jahr. In höheren Lagen bei über 1.600 mm. Die Niederschlagsmengen schwanken von Jahr zu Jahr stark. Es sind daher Mengen von nur 700 mm, aber auch bis zu 2100 mm möglich. Die regenreichsten Monate sind April und Mai, die regenärmsten November und Februar. Tendenziell sind die Sommermonate feuchter, die Wintermonate trockener. Trotz der vielen Niederschläge auf der Insel scheint die Sonne rund 2500 Stunden pro Jahr. Das sind täglich 6,85 Stunden und damit deutlich mehr als in Mitteleuropa. Nach den vielen Regenfällen kommt üblicherweise sehr schnell die Sonne wieder hinter den Wolken hervor. Obwohl die Osterinsel außerhalb der tropischen Wirbelsturmzone liegt, weht ständig ein starker Nordostpassat. Die relative Luftfeuchtigkeit ist mit 70 bis 90 % relativ hoch. Durch die niedrigeren Temperaturen herrscht aber keine Schwüle wie in den anderen Pazifikstaaten.
Selbstverständlich wurde auch die Osterinsel in Forschungen über die „Auswirkungen des weltweiten Klimawandels“ einbezogen. So erschien in der Fachzeitschrift Nature Climate Change eine „Studie“, die bis zum Jahr 2090 eine bedrohliche Dürre auf der Insel prophezeihte (Karnauskas et al. 2016:720ff.). „Einschneidende Klimaänderungen im Südostpazifik sind jedoch kein neues Phänomen. In den letzten 35.000 Jahren war das Klima der Osterinsel, wie man aus palynologischen Untersuchungen schließen kann, nicht immer so wie heute. Das hatte entscheidende Auswirkungen auf die Vegetation. Das Klima vor rund 35 000 Jahren war warm und trocken und förderte den Bewuchs mit krautigen Pflanzen. Von 35.000 bis 26.000 vor unserer Zeitrechnung gab es eine feuchtere und deutlich wärmere Periode, die dichte Palmenwälder und buschige Vegetation gedeihen ließ. Anschließend, bis etwa -12.000, kühlte es ab und es wurde wieder trockener, was das Wachstum der Wälder reduzierte und die Entwicklung von Grasland begünstigte. Von -12.000 bis zur Ankunft der ersten polynesischen Siedler erholten sich die Palmenwälder und bildeten wieder dichte Bestände. Um -4500, noch vor der menschlichen Besiedlung, scheint es eine mehrjährige Trockenperiode gegeben zu haben, Sedimentproben zeigen, dass der Kratersee des Rano Raraku um diese Zeit ausgetrocknet war.
Für die Menschen der Osterinsel blieben die klimatischen Veränderungen nicht ohne Folgen. Der Anthropologe Grant McCall von der University of New South Wales ist der Meinung, dass anhaltende Dürren in der Kleinen Eiszeit wesentlich häufiger waren als heute. Für die Zeit um 1466 haben Sedimentproben aus dem Krater des Rano Kao eine Trockenperiode bestätigt. McCall nimmt an, dass der Klimawandel in der Kleinen Eiszeit mitverantwortlich für die Destabilisation und den Umbruch der Gesellschaft im 17. Jahrhundert war. Die schwieriger werdenden Lebensbedingungen könnten zu Unzufriedenheit, Unruhen und damit zum gesellschaftlichen Wandel beigetragen haben.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Osterinsel)
Klimadaten für Mataveri
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
| Max. Temperatur (°C) | 27,0 | 27,7 | 27,1 | 25,6 | 23,8 | 22,4 | 21,7 | 21,5 | 22,1 | 22,9 | 24,2 | 25,5 | 24,3 |
| Mitteltemperatur (°C) | 23,3 | 23,7 | 23,1 | 21,9 | 20,1 | 18,9 | 18,0 | 17,9 | 18,3 | 19,0 | 20,4 | 21,8 | 20,5 |
| Min. Temperatur (°C) | 19,2 | 19,7 | 19,3 | 18,1 | 17,0 | 15,5 | 14,8 | 14,6 | 14,6 | 15,1 | 16,3 | 18,0 | 16,8 |
| Niederschlag (mm) | 73 | 85 | 96 | 121 | 153 | 106 | 105 | 94 | 87 | 68 | 74 | 86 | 1148 |
| Regentage | 15 | 7 | 16 | 15 | 12 | 16 | 12 | 9 | 14 | 6 | 9 | 9 | 140 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 77 | 77 | 78 | 79,2 |
| Sonnenstunden pro Tag | 8,8 | 8,0 | 7,1 | 6,1 | 5,4 | 4,6 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 6,6 |
| Wassertemperatur (°C) | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 |
Mythologie
Es gab einmal ein Land inmitten der Weiten des Ozeans, dessen Bewohner „böse geworden waren. Da nahm der Riese Uoke einen mächtigen Pfahl und hob damit das Land in die Höhe. Der Pfahl zerbarst unter der riesigen Last, das Land zerbröckelte in zahllose Stücke und fiel ins Meer. Übrig blieb ein Inselchen mitten im Pazifik: Te Pito O Te Henua“, der Nabel der Welt, die heutige Osterinsel (Leopold-Herrmann 1994:36). Über deren Besiedlung berichtet die Legende von Hotu Matua, das zentrale Epos der Osterinsel-Kultur. Sie ist in mehreren Versionen überliefert, die sich an einem einheitlichen Grundgerüst orientieren, in den Details jedoch zum Teil erheblich voneinander abweichen.
Der Einstieg in die Legende ist ein Traum, in dem Hau Maka aus dem Lande „Hiva“ - er wird als „königlicher Tätowierer“ bezeichnet, in Polynesien eine besondere Vertrauensstellung - seine Seele auf eine weite Reise schickt. Sie passiert sieben Inseln, die sich jedoch als wüst und leer herausstellen, bzw. sich hinter Nebelschleiern verbergen. Erst die achte Insel erweist sich als fruchtbar und schön.
Er erzählt dem Häuptling Hotu Matua von seinem Traum, der beschließt, von seiner Residenz „Marae Renga“ ein Erkundungsteam von sechs Jünglingen auszusenden. Sie fahren am 25. April ab und als sie die Osterinsel am 1. Juni erreichen, stellen sie fest, dass sie der Beschreibung aus Hau Makas Traum bis ins Detail entspricht. Sie erkunden die Insel. Als sie eine am Strand liegende, riesige Schildkröte umdrehen, um sie zu kochen und zu verspeisen, wehrt sie sich und verletzt einen der Jünglinge schwer. Die Gefährten lassen ihn sterbend in einer Höhle zurück und brechen zur Rückfahrt auf.
Nach einem Streit mit einem anderen Häuptling namens Oroi (in einigen Versionen Hotu Matuas leiblicher Bruder), dessen Ursache in den verschiedenen Versionen der Legende unterschiedlich geschildert wird, muss Hotu Matua seinen Wohnsitz verlassen. Er rüstet ein großes Doppelrumpf-Kanu aus (in anderen Versionen drei oder sechs Kanus) und segelt am 2. September mit 200 Begleitern (in anderen Versionen 300 oder 600) davon. An Bord sind aber nicht nur die Siedler, sondern allerlei nützliche Pflanzen und Tiere wie Brotfrucht, Yams, Taro, Süßkartoffel, Banane, Zuckerrohr, Papiermaulbeerbaum, Toromiro, Hühner, Schweine und Ratten (die polynesische Ratte wurde als Nahrungstier gezüchtet) sowie eine steinerne Statue (ein Moai mit dem Namen Te Takapau) und Rongorongo-Schrifttafeln. Am 15. Oktober erreicht das Kanu das sogenannte „Achte Land“, die Osterinsel. Die Reise dauert also eine Woche länger als die der Kundschafter. Hotu Matua trennt die beiden Boots-Rümpfe und landet selbst am Strand von Anakena, das andere Kanu fährt zur Nordwestküste. Im Augenblick der Landung gebiert Hotu Matuas Frau einen Jungen. Im zweiten Kanu wird gleichzeitig ein Mädchen geboren. An beiden Landungsstellen lassen sich Siedler nieder, Anakena wird Königsresidenz. Aber auch sein alter Widersacher Oroi erreicht schließlich die Osterinsel und ermordet Hotu Matuas Sohn. Hotu Matua stellt daraufhin Oroi eine Falle und tötet ihn nach langem Kampf.
Als Hotu Matua alt wird, teilt er die Insel unter seinen Kindern auf, ihre Nachkommen bilden die künftigen Stämme der Osterinsel. Er geht zur Kultstätte Orongo (abweichend: auf den Rano Raraku) und sieht gen Westen, in Richtung seiner alten Heimat. Als er den Schrei des Hahnes von Marae Renga von jenseits des Meeres vernimmt, ist sein Tod nahe. Seine Söhne tragen ihn in eine Hütte, in der Hotu Matua stirbt. Er wird allerdings nicht in einem Ahu, sondern in einem Königsgrab, einer mit Stein ausgekleideten Grube, bei Akahanga beigesetzt.
Auf der Osterinsel gab es keine historischen Aufzeichnungen, die Rongorongo-Tafeln sind in dieser Hinsicht unergiebig. Sowohl tatsächliche geschichtliche Ereignisse als auch Legenden wurden von Generation zu Generation mündlich überliefert. Eine klare Trennung ist daher aus heutiger Sicht schwierig.
Europäische Missionare und Forscher begannen ab Mitte des 19. Jahrhunderts mit einer zunächst noch unsystematischen Sammlung und Aufzeichnung der Überlieferungen. Besonders wertvoll sind die Aufzeichnungen des französischen Paters Eugène Eyraud der 1864 als Missionar 9 Monate auf der Osterinsel weilte. Der Einstieg in die systematische Erforschung und Sammlung des Sagenschatzes erfolgte aber erst im 20. Jahrhundert.
Gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlernten die Rapanui in Schulen der Missionare das europäische Alphabet und fingen selbst an, die Gesänge und Geschichten ihrer Kultur niederzuschreiben. Die bekannteste Niederschrift, das sog. Manuskript E, stammt aus dem Besitz der Familie Pakarati, Nachkommen ehemaliger Ariki der Osterinsel. Es wurde vermutlich um 1920 aufgezeichnet. Die obige Inhaltsangabe orientiert sich an dieser Vorlage.
Daneben gibt es – zum Teil abweichende – Wiedergaben der Hotu-Matua-Legende bei Katherine Routledge, Alfred Metraux, Pater Sebastian Englert und Edwin Ferdon, einem Archäologen der Heyerdahl-Expedition. Der Ethnologe Thomas Barthel von der Eberhard Karls Universität Tübingen hat 1974 eine ausführliche Übertragung, Gliederung und Interpretation des Hotu-Matua-Stoffes vorgelegt.
Besiedlungsmythen gibt es auf nahezu allen Inseln des Südpazifiks. Obwohl auf jeder Insel eine eigene Version der Sage überliefert ist, orientieren sie sich an einem einheitlichen Grundgerüst: Der jeweilige Protagonist, ein Gott, König, Häuptling oder mythischer Held, muss ein sagenhaftes Land des Ursprungs verlassen und begibt sich mit einem Floß, Einbaum oder Kanu auf eine lange Reise in unbekannte Regionen. Er führt nicht nur Auswanderer mit sich, sondern auch nützliche Nahrungspflanzen und –tiere sowie kulturelle Errungenschaften, die den Siedlern in ihrer neuen Heimat zugute kommen. Eine solche „Legende des Ursprungs“ gibt es sowohl bei den Maori als auch auf Samoa, Tonga, Mangareva, den Marquesas und der Osterinsel.
Obwohl es sich bei der Geschichte von Hotu Matua unzweifelhaft um eine Legende handelt, lassen neuere Forschungen doch einen wahren Kern vermuten. Allerdings ist stark umstritten, in welchem Umfang die geschilderten Ereignisse mit wahren Geschehnissen übereinstimmen.
Die Besiedlung der Osterinsel erfolgte nach dem früheren Stand der Forschungen in zwei Wellen, beginnend mit der ersten Besiedlungswelle im 4. oder 5. Jahrhundert. Man nahm an, dass die Legende von Hotu Matua die zweite Besiedlungswelle beschreibt, die im 14. Jahrhundert stattgefunden haben soll. Allerdings wird aktuell (wieder) die Monobesiedlungsthese präferiert, mit nur einer Besiedlung von den Marquesas über Mangareva im 5. Jahrhundert. Dies würde bedeuten, dass die Legende von der Besiedlung der Osterinsel mehr als 1500 Jahre im Volksbewusstsein bewahrt wurde.
Der Ausgangspunkt der Besiedlung, das mythische „Hiva“, ist nicht eindeutig zu identifizieren, es kommen mehrere Inseln bzw. Inselgruppen in Frage. Etymologisch sei darauf hingewiesen, dass Hiva als Prä- bzw. Suffix bei mehreren Inselnamen der Marquesas vorkommt (Hiva Oa, Fatu Hiva, Nuku Hiva).
Thor Heyerdahl vermutete die Herkunft von Hotu Matua in Südamerika, was aber dem überlieferten Text widerspricht und nach den heutigen archäologischen, linguistischen und genetischen Forschungen auszuschließen ist. Das Datum von An- und Abfahrt der Kundschafter ist in der Legende genau angegeben (25. April bzw. 1. Juni). Nimmt man die Reisedauer von 38 Tagen für die Erkundung wörtlich, so kommen zunächst die Insel Pitcairn, die Gambierinseln (insbesondere Mangareva), große Teile des Tuamotu-Archipels, aber auch die Marquesas und die Austral-Inseln als Ausgangspunkt in Betracht.
Bereits Roggeveen berichtet, dass zu dieser Jahreszeit im Seegebiet zwischen den Tuamotus und der Osterinsel West- bzw. Nordwestwinde vorherrschen, die Reisebedingungen sind also günstig. Ein Etmal von 100 Kilometern ist, wie Experimente mit Nachbauten erwiesen haben, für polynesische Doppelrumpf-Kanus durchaus realistisch, bei guten Bedingungen sogar 200 km. Die Entfernung von beinahe viertausend Kilometern war kein unüberwindliches Hindernis. Anlässlich des Pacific-Art-Festivals 1995 wurde mit dem Nachbau eines großen Kriegskanus eine Non-Stop-Reise von Hawaii bis Raiatea über eine Entfernung von 4500 Kilometern unternommen.
Polynesische Doppelrumpf-Kanus waren nach Beschreibungen früher europäischer Entdecker (Cook, Beechey, Kotzebue) bis zu 30 Meter lang. Eine Besatzung von 200 Personen erscheint zwar sehr hoch, ist aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Das Mitführen von Sämlingen, Stecklingen und Tieren als Grundlage für eine Besiedlung war nicht unüblich und ist aus anderen Überlieferungen in der gesamten Südsee bekannt. Der Text des Manuskriptes E gibt für die Osterinsel – von „Hiva“ aus gesehen – folgende Beschreibung:
· sie liegt „oben“ (i runga)
· sie ragt über den Horizont empor
· ihre Konturen heben sich am Horizont ab
· inmitten der aufgehenden Sonne (das heißt im Osten)
„Oben“ (runga) und „unten“ (raro) sind in Polynesien in der Navigation gebräuchliche Begriffe und beziehen sich auf die Richtung der Passatwinde. Dies und die Lage im Osten von Hiva lassen eine Fahrt des Hotu Matua von West nach Ost vermuten.
Der Wohnsitz des Königs Hotu Matua auf „Hiva“ heißt in der Legende „Marae Renga“ (übersetzt „der schöne Kultplatz“). Das protopolynesische Wort mala´e oder marae bezeichnet in weiten Teilen Ostpolynesiens (Gesellschaftsinseln, Marquesas, Cookinseln, Austral-Inseln, Tuamotu-Archipel) einen Zeremonialplatz, ist jedoch auf der Osterinsel nicht gebräuchlich. Das entsprechende Wort dafür ist ahu. Die Verwendung dieser nicht üblichen Bezeichnung in einer Legende der Osterinsel lässt ebenfalls Rückschlüsse über die Herkunft zu.
Anakena an der Nordküste der Osterinsel, der Landeplatz von Hotu Matua, ist zweifellos eine exponierte Stelle. Hier liegt der einzig erwähnenswerte Sandstrand der Osterinsel, ein sofort ins Auge fallender natürlicher Hafen für flachgehende Boote. Archäologische Untersuchungen erbrachten den Beweis, dass es sich um einen herausragenden Kultplatz von besonderer Bedeutung handelte. Die Region war immer mit dem Clan der miru verknüpft, die ihre Abkunft direkt auf Hotu Matua zurückführten. Der Clan-Häuptling der miru war zwar nicht der politische Führer im Sinne eines Königs der ganzen Insel, jedoch das geistige und religiöse Oberhaupt, der Inhaber von mana, von höchster spiritueller Macht. (sh. dazu https://www.osterinsel.de/38-die-legende-um-hotu-matua.htm)
Geschichte
Kaum eine menschliche Kultur hat die Fantasie von Völkerkundlern, Geschichtsforschern und Esoterikern so angeregt wie die der Osterinsel. Die Anzahl der sie betreffenden Theorien dürfte die Zahl der heutigen Einwohner Rapa Nuis um etliches übertreffen. Ist das entlegene Eiland der Rest des versunkenen Kontinents Mu? War es Landeplatz außerirdischer Raumschiffe? War es eine Exklave des Inkareichs? Oder war es bloß der südöstliche Eckpfeiler polynesischer Landnahme? Oder war es überhaupt ganz anders?
Ursprünge
Wann die ersten Menschen auf die Insel gelangten und wer konkret diese Menschen waren, darüber gibt es keine gesicherten Daten. "Colin Wilson und Rand Flem-Ath glauben, dass die Osterinsel ein wichtiger Knotenpunkt in einem globalen Raster heiliger Geographie war, das vor den großen Fluten der archaischen Zeit bestand." (Gray 0.J.). Hancock schlägt vor, dass die ursprüngliche Besiedlung der Insel möglicherweise aufgrund ihrer geodätischen Lage erfolgte und nicht, wie von der Mainstream-Archäologie angenommen, durch zufällig verirrte polynesische Seefahrer (Hancock 1998). Dass Menschen früher auf die Insel gelangten als allgemein angenommen, vermutet auch die international renommierte indigene Archäologin Sonja Haoa Cardinali. Sie fand Belege dafür, dass bereits um -1200, also vor mehr als 3000 Jahren, Bananen auf der Insel aufzufinden waren - und die konnten nur von Menschen hierher gebracht worden sein. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass Hotu Matua sein "Erkundungsteam" einfach so ins Blaue losschickte, um irgendwo ein "Traumland" zu suchen. Wie auch immer.
Den ersten historisch fassbaren Niederschlag in den Überlieferungen Rapa Nuis gefunden hat die polynesische Landnahme unter der Führung des "großen Ahnherrn" Hotu Matua. Deren Urheimat war dem Mythos zufolge eine ferne, brennend heiße Insel namens Marae Renga. Über deren Lokalisierung scheiden sich allerdings die Geister. Infrage kommen allen voran das Austral-Eiland Rapa (Rapa Iti), die Marquesas-Insel Hiva Oa, das Atoll Mangareva oder die spätere Meutererinsel Pitcairn (Prachan 1991:114). Mit primitiven kleinen Flotten, orientiert an den Sternen gelangten die Polynesier gängigen Theorien zufolge auf die entlegene Insel.
Ausgehend von dieser These und gestützt auf archäologische, genealogische und sprachwissenschaftliche Befunde konnte sich die Annahme einer Besiedlung im Rahmen der polynesischen Expansion von Westen her durchsetzen. Die Erstbesiedlung könnte im 5. oder 6. Jahrhundert, die zweite Besiedlungswelle im 14. Jahrhundert stattgefunden haben. Die Einbeziehung genetischer Untersuchungen in den 1990er Jahren bewies zweifelsfrei die Herkunft der Osterinsel-Bevölkerung aus dem polynesischen Raum und nicht aus Südamerika. Mittlerweile wird im archäologischen Mainstream (wieder) die Monobesiedlungsthese präferiert, mit nur einer Besiedlung von den Marquesas – eventuell über Mangareva – im 5. Jahrhundert. Völlig anderer Auffassung ist allerdings der amerikanische Archäologe Terry L. Hunt, der, gestützt auf stratigrafische Grabungen am Anakena-Strand, die erste Besiedlung im 13. Jahrhundert annimmt.
Dem steht die These einer Mehrfachbesiedlung gegenüber, wie sie erstmals der norwegische Forscher Thor Heyerdahl vertrat. Er postulierte eine frühe Periode im 1. Jahrtausend und eine mittlere Periode zwischen 1100 und 1600. In beiden Perioden gab es seiner Ansicht nach Einwanderungen mit einem deutlichen Bezug nach Südamerika. Eine weitere Besiedlung soll in der Spätperiode ab 1680 von Polynesien aus erfolgt sein. Dass intensive Kontakte zu Südamerika bestanden, gilt mittlerweile als unumstritten.
Frühzeit
Aber zurück zum Ursprungsmythos der Rapanui. Warum deren Ahnherren die beschwerliche Reise überhaupt antraten, wird wie folgt erklärt: Nach einem Zwist mit seinem Bruder Te Irakatea, einer anderen Version zufolge aufgrund eines durch eine Liebesaffäre ausgelösten Krieges war Häuptling Hotu Matua gezwungen, sein Land zu verlassen. Ein von ihm tatauierter Mann namens Hau Maka gab ihm den Weg in eine neue Heimat zu erkennen. In einem Traum war er mit seiner Seele „über das Meer hin bis zu einer Insel geeilt, auf der es Löcher (Krater) und schöne Gestade gab.“ (Métraux 1989:185) Der Vision folgend wählte Hotu Matua sieben Männer aus, die er auf den Weg schickte zu jenem „schönen Strand“, den Hau Maka im Traum erblickt hatte.
Zusammen mit rund zweihundert Gefährten kam der Häuptling nach langer Fahrt auf der Osterinsel an. Sein Landeplatz soll die Ankerstelle vor Mataveri gewesen sein. Legendären Berichten zufolge soll sich Hotu Matua nach ersten Erkundungen zu Lande bestürzt gezeigt haben über die Kargheit des angeblichen Paradieses und darob einen Fluch ausgestoßen haben. In zwei Abteilungen, deren eine Tuukoihu leitete, umfuhren die Neuankömmlinge die Insel im Norden bzw. Süden und trafen einander in der Bucht von Anakena. Dort kamen kurz nach der Landung zwei Kinder zur Welt: Tuu Maheke, Hotu Matuas Sohn, und Ava Rei Pua Puke, die Tochter seines Gefährten Hineriru und zugleich seine Nichte. In aller Heimlichkeit war indes auch Oroi, der alte Kriegsgegner des Häuptlings, auf die Insel gelangt. Nach ausgiebigem Intrigenspiel tötete er fünf Söhne eines Gefolgsmanns Hotu Matuas. Der rüstete daraufhin zum Kampf gegen den Rebellen und spaltete ihm schließlich in der Nähe von Hangatetenga den Schädel. Einem anderen Bericht zufolge streckte er ihn mit einem Fluch nieder. Aber wie auch immer, Orois Körper wurde zunächst über dem Feuer gedünstet und danach an einem ihm zugedachten Ahu beigesetzt. Von da an herrschte Frieden auf der Insel.
Hotu Matua, der während des ersten Jahres alle Dörfer besucht, an Festen teilgenommen und altüberlieferte Traditionen wiedereingeführt hatte, wurde zum obersten Häuptling bzw. König von Te Pito O Te Henua, dem „Nabel bzw. Ende der Welt“, erhoben, und seine Herrschaft soll eine gute gewesen sein. Hoch betagt „teilte er die Insel unter seinen Kindern auf. Jedes von ihnen wurde der Ahnherr eines Stammes.“ Nach der Regelung dieser weltlichen Angelegenheiten begab er sich auf den Gipfel des Rano Kao, wandte sich in die Richtung seiner alten Heimat, hörte von dorther den Hahn krähen, rief die Schutzgeister an und starb. Nach den Trauerfeierlichkeiten in seinem Haus bestattete man ihn am Ahu Akahanga (Métraux 1989:187-188, Knoche 1911 und Felbermayer 1971).
Bis 1899 soll es, unterschiedlichen Überlieferungen zufolge, 23 bis 57 Inselkönige - eigentlich Großhäuptlinge, „ariki henua“ bzw. „ariki-mau“ - gegeben haben, deren Abfolge jedoch nicht mehr eindeutig eruiert werden kann. Auch sind Abspaltungen konkurrierender Herrscher nicht eindeutig nachvollziehbar. Sicher ist, dass mit Hotu Matuas Ankunft auf Rapa Nui nach alter polynesischer Tradition „ariki“, Adelige die Macht übernahmen und der Miro-Klan dabei den obersten Häuptling stellte. Für die Zeit zwischen etwa 1380 und 1859 lassen sich mit einiger Sicherheit folgende dreißig Inselherrscher festmachen (unter anderem nach Rjabchikov 1994):

- Tu’u Maheke a Hotu Matua
- Miru a Tu’u Maheke
- Hata a Miru
- Miru a Hata
- Mitiake
- Taranga a Miru
- Atuu Raranga
- Te Urua Kikena
- Te Terei Manara
- Te Kura Tahongo
- Taoraha Kaihahanga
- Tukuma
- Kahui Tuhunga
- Te Tuhunga Nui
- Te Tuhunga Roa
- Te Tuhunga Marakapau
- Ahu Arihao
- Nui Te Patu
- Hirakau Tehito
- Tupu Itetoki
- Kura Ta Hongo
- Hiti Rua Anea
- Havi Nikoro
- Te Ravarava
- Te Rahai
- Koroharua
- Te Ririkatea
- Kai Makoi
- Te Hetukarakura
- Huero
- Nga’ara
Als frühester Beleg menschlicher Anwesenheit auf dem entlegenen Eiland werden die Aschenreste einer Feuerstelle aus der Zeit zwischen 400 und 550 angesehen. „Wahrscheinlich fanden in den folgenden Jahrhunderten weitere Einwanderungen kleiner Gruppen statt, die aber, wie auch die Erstbewohner, keine Spuren hinterließen.“ (Gatermann 1996:177) Die nächsten Funde werden in die Zeit um 850 datiert. Die Menschen, die damals auf Rapa Nui lebten, waren hier eingebettet in eine ökologisch weitgehend intakte Welt. Dichte Wälder aus Palmen, Toromiro und Triumfetta, eine beinah paradiesische Pflanzenwelt, Überfluss an Nahrung und ein erträgliches Klima. Bis ins 11. Jahrhundert hinein dürfte die Gesamtzahl der Osterinsulaner kaum die Hundertergrenze überschritten haben.
Die Kultur, die sich in der pazifischen Abgeschiedenheit entwickelte, blieb in ihren Fundamenten polynesisch. Die Siedler errichteten erste Kultplätze, sogenannte „ahus“, bauten eine Art Sonnenobservatorium und begannen kleine Steinfiguren zu formen. Ihre Religion war wohl eine Mischung aus Sonnen- und Ahnenkult mit möglichen Einschüben südamerikanischer Traditionen. Die Spuren, die diese Menschen hinterließen, waren eher dürftig, was auf eine noch recht enge Verbundenheit mit der Natur schließen lässt.
Der nächste Schub an Siedlern traf vermutlich um 1100 auf Rapa Nui ein. Auch diesmal war der Ursprungsort wohl Polynesien, aber auch aus Peru könnten damals Menschen hierher gelangt sein. Die neue Kultur war zweifellos bereits hierarchisch ausgestaltet. Erste Moais, vorerst noch vergleichsweise kleine Steinfiguren, entstanden, in Felsen wurden symbolhafte Bilder eingeritzt, und aus den Zeichen entwickelten sich die Ansätze der für die Insel typischen Rongorongo-Schrift. Der Umgang mit der Natur nahm unterdessen deutlich ausbeuterische Formen an. Zur Ackerlandgewinnung wurden Wälder gerodet, und auch den „ahus“ verschaffte man immer größere Flächen. So jedenfalls stellt sich aus archäologischen Befunden die Situation um die Mitte des 14. Jahrhunderts dar, als mit einem neuerlichen Zustrom an Menschen eine große Wende in der Entwicklung Rapa Nuis eintrat.
Blütezeit der Osterinselkultur
Nicht unerheblich bei der Entwicklung der Gesellschaft der Osterinsulaner dürfte der Kontakt mit Südamerika gewesen sein. Genetische Analysen zeigen, dass die Inselbwohner etwa 8 % indianisch-amerikanisches Erbgut aufweisen. Dieser Kontakt fand wahrscheinlich zwischen 1280 und 1425 statt, also lange vor der Ankunft der Europäer. Konkret gibt es mehrere Hinweise auf diese frühen Kontakte, so zum Beispiel DNA-Analysen. Genomstudien an 27 Osterinsel-Bewohnern bestätigten die Präsenz südamerikanischer Gene. Auch archäologische Funde von Pflanzenresten deuten auf frühe Verbindungen zu Südamerika hin. Im Speziellen ist nicht zuletzt die Verbreitung der Süßkartoffel (Kumara) als Hauptnahrungsmittel auf der Osterinsel auf Kontakte zwischen Polynesien und dem Festland zurückzuführen. Obwohl der genaue Ablauf dieser Beziehungen noch unklar ist, kann davon ausgegangen werden, dass die polynesischen Bewohner der Osterinsel nach Südamerika segelten und zurückkehrten, möglicherweise in Begleitung von Indianern.
Die Reisen der Osterinsulaner führten dazu, dass auch in umgekehrter Richtung Kontakte gesucht wurden. Im zentralen Andenhochland Südamerikas kam es im 13. Jahrhundert zur Herausbildung des Reichs der Inka. Zu deren Opfern gehörten unter anderem die am Ufer des Titicacasees siedelnden Colla, die von den Imperialherren als Baufachleute zwangsrekrutiert wurden. Die Härte, mit der gegen sie vorgegangen wurde, veranlasste viele von ihnen zur Flucht in die Regionen am Pazifik. „Ermutigt durch Berichte der Küstenbewohner, nach denen es weit draußen im Meer in Richtung Sonnenuntergang bewohnte Inseln gäbe, entschlossen sie sich zu dem tollkühnen“ Wagnis einer Seefahrt mit hochseetüchtigen Balsaflößen. Unter der „Führung erfahrener Piloten der Küstenvölker“ erreichte die während der Überfahrt zweifellos stark dezimierte Flotte irgendwann zwischen 1438 und 1450 die Osterinsel (Gatermann 1996:179).
Von den Einheimischen wurden sie nach einigem Zögern akzeptiert und wohl auch respektiert. Man überließ ihnen die Hänge im Südwesten der Insel „und das Plateau des Rano Kau als Siedlungsgebiet. Hier begannen die geflüchteten Colla Bauwerke aus Stein zu errichten, die in Stil und Duktus, in Konstruktion und Materialbearbeitung den Bauten ihrer südamerikanischen Heimat entsprachen. Es handelt sich um die Grottenhäuser von Orongo, den Ahu O Tahiri in Vinapu und später um die ‘tupa’ genannten Türme.“ Im der Folgezeit kam es zu einem regen Kulturaustausch, bei dem sich die südamerikanische Kunstfertigkeit mit polynesischen Grundmustern verknüpfte. „Zur Festigung ihrer Position suchten die Colla zunehmend den Kontakt zur einheimischen Führungskaste.“ In Zusammenhang damit kam es zur Herausbildung einer neuen Elite, die über ein spezielles Wissen verfügte, und zur Entwicklung neuer Rituale wie des Vogelmannkults. Äußerlicher Ausdruck der neuen Führungsschicht war die Verlängerung der Ohrläppchen, ein Brauch, den früher Colla-Häuptlinge früher schon gepflegt hatten (Gatermann 1996:180). So kam es schließlich um 1470/80 zur sichtbaren Spaltung der Osterinselgesellschaft in Hanau Eepe (Langohren) - Leute, die Rituale verrichteten, Ahus bauten und vermutlich die politische Macht innehatten - und Hanau Mimiko (Kurzohren) - Leute, die gewöhnliche Arbeiten durchzuführen hatten und bisweilen wie Sklaven gehalten wurden.
Um etwa 1500 hatten sich auf Rapa Nui zehn Stämme etabliert, die zusammen zumindest 5000 - neuerdings infrage gestellte Schätzungen reichen sogar bis zu 13.000 - Menschen zählten. Je fünf von ihnen teilten jene zwei Großgebiete unter sich auf, in die die Insel damals gespalten war: Ko Tu’u mit den sogenannten „mata nui“, großen Stämmen, im Westen und Hotu Iti im Osten. Der durch das Königtum garantierte Friede wandelte sich langsam in anhaltende Fehden um. Geschichten über den Verlauf dieser Auseinandersetzungen werden in verklärter Form noch heute erzählt. Die gesellschaftlichen Veränderungen, die mit den Konflikten einhergingen waren jedenfalls nachhaltig wirksam. Die Krieger, „mata to’a“, gewannen an Einfluss, während die traditionellen Häuptlinge an Macht verloren. Eroberungen von Ländereien feindlicher Stammesgemeinschaften wechelten mit blutigen Rachefeldzügen mit wechselnden Fronten ab.
Während der Zeit vermehrten Kampfes strandete anno 1536 vor Tahiti das spanische Schiff „San Lesmes“. Einige der Überlebenden scheinen - wie sich aus modernen Genuntersuchungen rückschließen lässt - bis auf die Osterinsel gelangt zu sein. Inwieweit sie dort in die herrschenden Konflikte involviert wurden, kann nicht mehr festgestellt werden. Kulturelle oder gesellschaftliche Veränderungen hatte ihr Erscheinen jedenfalls nicht zur Folge. Zu tief waren bereits die Klüfte zwischen den beiden feindlichen Gruppen, die nun auch die allen Inselbewohnern gemeinsamen Heiligtümer mit jeweils zwei Anbetungsstätten ausstatteten.
Nach 1600 spitzte sich die Lage allmählich zu. Immer mehr Menschen brauchten immer mehr Platz. Der Wald wurde aber nicht nur für Siedlungen und Gärten gerodet, sondern auch für Heiligtümer und die die für die Osterinsel typischen Steinfiguren. Zu Ehren ihrer Ahnen errichteten die einzelnen Stammesgemeinschaften - in Verehrung und Machtdemonstration zugleich - immer kolossalere Moai. Die Ausbeutung der Natur, so die gängige Erzählung, führte schließlich zum Kollaps. An dieser Geschichte mehren sich in letzter Zeit allerdings die Zweifel. So zeigen etwa aktuelle Berechnungen , dass die Insel wahrscheinlich weniger als 4000 Menschen ernähren konnte, nicht bis zu 25.000 wie bisher angenommen. Auch hatten die Bewohner ein effizientes System von Steingärten entwickelt, um mit den kargen Ressourcen der Insel umzugehen. Archäologische Untersuchungen und historische Dokumente deuten zudem darauf hin, dass die Gesellschaft der Rapa Nui bis Mitte des 18. Jahrhunderts intakt war und florierte. Und schließlich zeigen neue Analysen , dass der Bau von Steinplattformen und Moai bis ins 18. Jahrhundert fortgesetzt wurde, was gegen einen früheren Kollaps spricht (zuletzt u.a. Schubert 2024).
Zweifellos aber gab es einen größeren Konflikt, der um 1680 zum Ausbruch kam - und der war schon seit langem vorprogrammiert. Der Legende zufolge sollen die Langohren den Kurzohren zwecks Gewinnung neuen Ackerlandes die Säuberung der Halbinsel Poike von Gesteinsbrocken anbefohlen haben. Letztere aber weigerten sich und zogen gegen erstere zu Felde. Die Langohren verbarrikadierten sich daraufhin auf Poike, hoben einen Graben aus, der die Halbinsel vom Rest Rapa Nuis trennte, und errichteten einen Schutzwall aus Holz, um im Falle eines Angriffs eine feurige Mauer vor sich aufbauen zu können. Die Langohrfrauen verrieten diesen Plan jedoch den Kurzohren und halfen einigen ihrer Krieger, nächtens heimlich auf die Halbinsel zu kommen. Was folgte, war die wohl größte Katastrophe in der Geschichte der Osterinsel. Durch einen Kurzohr-Scheinangriff zum Entflammen ihrer Barrikade veranlasst, wurden die Langohren auch vom Land her in die Zange genommen und in den Feuertod getrieben. Nur drei der Verratenen konnten sich, über unzählige Leichen springend, in eine Höhle retten. Schlussendlich überlebte nur einer, Ororoina, Stammvater der Familie Atan.
Der Blutzoll, den dieser letzte große Krieg gefordert hat, muss auch unter den Kurzohren groß gewesen sein. Allem Anschein nach überlebten nur etwas mehr als tausend Rapa Nui das Gemetzel. Als im Jahr 1687 der holländische Bukanier Edward Davis mit seinem Schiff „Batchelor’s Delight“ an der „niedrigen, sandigen Insel“ vorbeisegelte, befand sich die Rapanui-Kultur an einem Wendepunkt ihrer Geschichte. Die Neuorganisation ihrer weltabgeschiedenen Gesellschaft nahm die Kräfte der Menschen voll in Anspruch. Das Land war entwaldet, der Boden großteils verkommen, und die alten Strukturen, auf denen das Zusammenleben basierte, hatten ihren Wert verloren. In der Ruhe nach dem selbstentfachten Sturm begannen sich die Rapanui-Gemeinschaften neu zu formieren. Keine Moai wurden mehr errichtet und die alten Riten wieder bedächtiger praktiziert. Auf europäischen Karten der Zeit um 1700 erschien die Insel als Vorposten des großen „Terra australis incognita“ unter dem Namen „Insula Davidae“, Davis Island (an. 1770 und Vogler in Zabern 1989:53).
Spätzeit der Osterinselkultur
Die unter den kolonialen Historikern verbreitete Behauptung, dass die Osteerinselkultur bereits vor der Ankunft der Europäer zugrunde ging, ist heute nicht mehr haltbar. Als zu Ostern 1722 ein europäisches Schiff vor dem entlegenen Eiland erschien, dürfte sie ganz im Gegenteil noch intakt gewesen sein. Der holländische Kapitän Jacob Roggeveen war am 1. August 1721 im Auftrag der Westindischen Handelskompanie mit drei Seglern - der Arend, der Thienhoven und der Afrikaansche Galei - aufgebrochen, unter anderem um den von Davis entdeckten Inselvorposten des vermuteten großen Südkontinents wiederzufinden. Am 26. Februar 1722 erreichte die kleine Flotte die Juan Fernandez-Inseln, sechs Wochen später, am Ostermontag, dem 6. April, dann Rapa Nui, das Roggeveen nach dem Tag der Sichtung „Paasch-Eiland“ (Osterinsel) nannte. Der mitreisende Abenteurer Carl Friedrich Behrens hat über die Ereignisse ausführlich Buch geführt und seinen Bericht nach der Reise auch veröffentlicht (Behrens 1738 und 1925).
Der deutschstämmige Weltenbummler beschrieb die Inselbewohner als angenehme Erscheinungen. Die Frauen erschienen ihm besonders interessant, nicht nur wegen ihrer leuchtend roten Gesichtsbemalung, ihrer kleinen Stroh- oder Rohrhüte oder ihrer Deckenkleider. Nein, was ihn bei diesen exotischen Schönheiten besonders verwunderte, war, dass sie sich jederzeit vor den Fremden entkleideten und „sie mit eindeutigen Gesten in ihre Hütten“ winkten. Als bemerkenswerte kulturelle Eigenheiten vermerkte Behrens des weiteren „die ‘Götzenbilder’, die am Strand in großen Mengen aufgerichtet standen, wie Menschen mit langen Ohren, das Haupt mit einer Krone geziert und um sie herum ‘in zwanzig bis dreißig Schritt Breite weiße Steine gelegt’“. Immerhin, das Land schien ihm gut beackerbar, es trug reichhaltige Frucht und war „schön bearbeitet“ (Vogler in Zabern 1989:55). Alles in allem fast ein Paradies, in das die Europäer allerdings mit gewohnter Brutalität eindrangen.
Die Inselbewohner sammelten sich in so großer Zahl um die Europäer, dass diese sich laut Behrens "nicht weiter konnten und sie mit Gewalt auseinander treiben mussten". Als einer der Rapanui versuchte, die Waffe eines Matrosen zu ergreifen, eröffneten die Niederländer das Feuer. Viele Insulaner wurden erschossen, was bei den Rapanui klarerseise Entsetzen auslöste. Roggeveen und seine Mannschaft blieben trotz der nun äußerst angespannten Stimmung etliche Tage auf der Insel. Da sie dort keine für sie wertvollen Ressourcen wie Gold, Gewürze oder Lebensmittel fanden, zogen sie schließlich wieder ab. Die erste Begegnung mit den Europäern war also von Missverständnissen, kulturellen Unterschieden und Gewalt geprägt und markierte den Beginn des kolonialen Einflusses auf die Osterinsel, der später gravierende Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung haben sollte.
In den folgenden Jahren pendelte sich die Bevölkerungszahl bei an die 2000 ein und die gesellschaftliche Lage auf der Insel blieb einigermaßen ruhig. Nach wie vor existierte die Würde eines zentralen, sakral fundierten Herrschers, und auch die Adeligenschicht gab es noch - freilich ohne weitreichende Befugnisse wie ehedem. Genauso wie ihre Vorrangstellung hatte auch die exzessive Erstellung von Moais ein Ende gefunden. Solcherart gestaltet präsentierte sich die Osterinselkultur jenen europäischen Imperialdenkern, die ab 1770 immer massiver in das Geschehen auf dem abgelegenen Eiland eingriffen.
Zeit der europäischen Kontaktnahme
Am 10. Oktober 1770 verließen das Linienschiff „San Lorenzo“ und die Fregatte „Santa Rosalia“ den Hafen der peruanischen Stadt Callao und nahmen Kurs auf die von Roggeveen „entdeckte“ Insel. Die kleine Flotte stand unter dem Kommando des spanischen Kapitäns Don Felipe Gonzales, der vom Vizekönig Perus, Manuel de Amat, den Auftrag erhalten hatte, den vermuteten Vorposten eines großen Südkontinents für die spanische Krone in Besitz zu nehmen. Am 15. November erreichten die angehenden Kolonialherren Rapa Nui, gingen an Land und errichteten auf drei Hügeln im Osten der Insel Kreuze. Zu Ehren seines Königs taufte Gonzales das Eiland auf den Namen „San Carlos“ und erklärte es in einer feierlichen Zeremonie zu spanischem Territorium. Die verblüfften „Eingeborenen“ besiegelten diesen Akt mit geheimnisvollen Zeichen, die ihrer eigenen Schrifttradition entsprangen, deren Bedeutung sie aber wohl auch selbst nicht mehr so ganz wussten.
Nach ihrer formalen Herrschaftsübernahme machten die Fremden die neuen Untertanen der spanischen Krone mit ersten Grundbegriffen der europäischen Zivilisation bekannt, nämlich der christlichen Religion und kolonialen Pflichten. Im Großen und Ganzen hielt man die „wohlproportionierten, schlanken“ Insulaner, die sich „sanftmütig, scheu, aber freundlich zu den Besuchern“ zeigten, trotz ihrer offenkundigen diebischen Ader für gut erziehbar (Vogler in Zabern 1989:55). Nebst naturwissenschaftlichen Erkundungen betrieb die Mannschaft Gonzales’ auch ansatzweise etnografische Studien. So finden sich im Logbuch unter anderem eine Beschreibung der feinen Tätowierungen und der „paina“, menschenähnlicher Puppen aus Rindenbaststoff sowie ein erstes Verzeichnis von insgesamt 95 Wörtern der Eingeborenensprache. Die Moai-Figuren - die zu jener Zeit offensichtlich alle noch aufrecht standen - fanden das besondere Interesse der Spanier. Man versuchte sie mit Hacken zu zerschlagen, um dem im Innern vermuteten Geheimnis auf die Spur zu kommen. Der Versuch misslang, und nach sechs Tagen ausgiebiger Erkunden reisten die Fremden wieder ab, nachdem sie den in ihren Augen vergleichsweise ansehnlichen Wilden noch den Gruß „Ave Maria! Lang lebe Carlos, der König von Spanien!“ beigebracht hatten (Leopold-Herrgott 1994:13).
Etwas mehr als drei Jahre später, am 11. März 1774, betraten neuerlich Europäer die abgelegene Insel. Diesmal war es der englische Weltumsegler James Cook, der mit seinem Schiff „Revolution“ Rapa Nui ansteuerte und sich drei Tage lang dort aufhielt. Während bei den Spaniern noch von 900 bis 1000 „Eingeborenen“ die Rede war, schrieb Cook von etwa 600 bis 700 Osterinsulanern, in beiden Fällen überwiegend Männer. Der Engländer war enttäuscht von der Erbärmlichkeit des Landes, das nicht einmal frisches Wasser zu bieten hatte. „Keine Nation“, notierte er in sein Logbuch, „wird je um die Ehre kämpfen, die Osterinsel erforscht zu haben, zumal es kaum ein anderes Eiland in jenem Meer gibt, welches weniger Erfrischungen bietet und Annehmlichkeiten für die Schiffahrt wie dieses.“ (ebd.) Der mitreisende Naturkundler Johann Reinhold Forster und sein Sohn Georg beschrieben die Insel als „verwüstet“ und „öde“ mit „unfruchtbarem, hartem Boden“, das den auf ihr lebenden Menschen, wie es scheint, nichts zu bieten vermochte. Die Männer wären „mager mit harten und steifen Muskeln“, die Frauen klein und zierlich. „Aus Noth“ gingen sie „mehrenteils nackend“. Immerhin hatten sie, wie die Schreiber vermerkten, „große Statüen“, in ihren Augen „Überbleibsel vormaliger besserer Zeiten“, fabriziert, die, wie sich aus dem Vergleich seiner Darstellung mit jener Gonzales’ schließen lässt, nach dem Besuch der Spanier offensichtlich teilweise umgeworfen worden waren (Vogler in Zabern 1989/57-60).
Die Veröffentlichung der durch William Hodges illustrierten Werke Cooks und Forsters in den Jahren 1777/78 lösten in Europa einen ersten Osterinselboom aus. Was zu jener Zeit auf dem fernen Eiland tatsächlich vorging, lässt sich indes nicht mit Sicherheit feststellen. Möglicherweise hatte 1771/73 ein neuerlicher Krieg getobt, oder es war zu Missernten gekommen. Auffallend blieb jedenfalls der Mangel an Frauen, deren Zahl schon von den Spaniern mit wenigen hundert angegeben worden war und die die Forsters mit 30 (!) wiedergaben. Fazit aus den Berichten der europäischen Besucher von 1770 und 1774: Das Paradies am Ende der Welt erlebte zu Beginn der 1770er Jahre einmal mehr eine Katastrophe. Aber es erholte sich diesmal rascher als nach dem kulturellen Schiffbruch im späten 17. Jahrhundert.
Deutlich wird dies schon beim nächsten europäischen Besucher, dem französischen Weltumsegler J.F.G. de La Pérouse, der die Insel mit seinen Schiffen „Boussole“ und „Astrolabe“ im April 1786 ansteuerte. Während die beiden Fregatten in der „Cook’s Bay“ vor Hanga Roa ankerten, betraten die Franzosen, um sich gehörig Respekt zu verschaffen, mit viel kriegerischem Pomp das Land. Die „Eingeborenen“ kamen, „unbewaffnet und nackt, teils tatauiert und mit gelben oder weißen Umhängen versehen, mit geschrei und ‘freudiger Miene’ den Fremden entgegen“. Anders als die Besucher vor ihm kam La Pérouse mit der „Raubgierde dieser Insulaner“ und der „aufgedrängten Liebkosungen“ ihrer Weiber nicht zurecht. Indigniert beschrieb er sie als sittlich und moralisch verdorben, lehnte es jedoch ab, sie durch Strafaktionen zu „zivilisiertem Verhalten“ zu zwingen. Schon nach einem Tag segelte die kleine Flotille wieder ab. Rund zwei Jahre später zerschellte sie vor der Insel Vanikoro in der Santa Cruz-Gruppe. Auf Rapa Nui kehrte indessen wieder der Alltag ein.
Nebst diversen Abenteurern, Wal- und Robbenfängern kam 1804 eine russische Mannschaft unter dem Kommandanten U.F. Liskanskij in Kontakt mit den Osterinsulanern. Aufgrund schlechten Wetters konnten die Europäer zwar „nicht ankern“, doch brachte ein in einem Boot an Land ruderndes Team „eine wertvolle Sammlung von Schnitzereien mit“, die heute in einem sanktpetersburger Museum zu besichtigen ist (Leopold-Herrgott 1994:15). 1805 erhielten die Rapanui dann erstmals Besuch von Sklavenjägern. Die Besatzung des amerikanischen Schiffs „Nancy“ unter Captain Adams raubte eine Reihe von Kunstgegenständen und entführte zwölf Männer und zehn Frauen von der Insel. Die Gefangenen stürzten sich jedoch ins Meer, und auch der historisch belegte Versuch von Captain Worship im Jahr 1809, Osterinsulaner in die Sklaverei abzutransportieren, schlug fehl. Derartige Übergriffe trugen natürlich nicht gerade zu einer Steigerung des Lustgefühls der Osterinsulaner bei ihren weiteren Begegnungen mit Europäern bei. Dies musste auch die nächste „offizielle Expedition“ feststellen, die zehn Jahre nach Adams vor Rapa Nui ankerte.
Im Auftrag des russischen Kanzlers Graf Romanzow unternahm Otto von Kotzebue, Sohn des Schriftstellers August von Kotzebue, als Kommandant des Kriegsschiffes „Rurik“ von 1815 bis 1818 eine Expedition in die Südsee. Mit an Bord war der Arzt und Schriftsteller Adalbert von Chamisso, dessen Berichte unter dem Titel „Vertraute Briefe aus verschiedenen Weltteilen geschrieben“ 1818 in Kotzebues „Wochenblatt“ veröffentlicht wurden. Darin war die Rede von „mannigfaltigen Gewalttätigkeiten“ seitens der Insulaner. Die unmittelbare Ursache für das gereizte Stimmung war ein Überfall amerikanischer Seehundfänger, die einige Zeit vor der Ankunft der „Rurik“ am 28. März 1816 zwölf Männer und zehn Frauen von Rapa Nui entführt hatten. Chamisso wehrte sich trotz des offenkundigen Misstrauens der Osterinsulaner gegen deren Verunglimpfung als „Wilde“. Lebten sie doch in einer ganz anderen Welt unter einem „sonnigen Himmel ohne Gestern und Morgen“, dem „Momente ... und dem Genusse“ hingetan. Nach der Begrüßung durch zwei Bootsbesatzungen machten die Europäer den Insulanern klar, dass sie in friedlicher Absicht gekommen waren. Nebst diversen Vermessungen des Eilands führten die Forscher auch völkerkundliche Studien durch, wobei sich Chamisso vor allem der Sprache der Eingeborenen annahm und dabei eine starke Ähnlichkeit des Rapanui mit so ziemlich allen Idiomen zwischen Madagaskar und Polynesien feststellte (Vogler in Zabern 1989:66-67). Für genauere Studien blieb freilich keine Zeit, denn schon nach zwei Tagen segelte die „Rurik“ weiter. Geblieben sind vom mitreisenden Maler Louis Choris lithografisch festgehaltene Eindrücke, die nach ihrer Publikation 1826 weiteres Forscherinteresse in Europa weckten.
Unterdessen wurde Rapa Nui immer wieder von üblen Gestalten heimgesucht. 1822 etwa ankerte das amerikanische Walfangschiff „Pindos“ vor der Insel. Bei einem Landgang holte man frisches Gemüse und Frauen zwecks Vergnügung der Matrosen an Bord. Auf die Insel zurück ließ man die „wilden Weiber“ schwimmen, und als sie das Land erreichten, schoss einer der sadistischen Seeleute, „augenscheinlich aus reiner Mordlust“, in die dort versammelte Menge. Ein Insulaner war offensichtlich schwer verletzt, was der Schütze „mit einem Lächeln auf den Lippen“ quittierte (Métraux 1988:38). Andere Besucher verhielten sich rabiater, und immer wieder wurden zu jener Zeit Insulaner in die Sklaverei entführt.
Als am 16. November 1825 der englische Kapitän F.W. Beechey mit der „Blossom“ vor Rapa Nui ankerte, wurde seine Mannschaft zunächst relativ freundlich empfangen. Es fiel dem Besucher schwer, „eine Vorstellung von dem Bild zu geben, das diese Menge bot. Sie wurde von keiner Macht beherrscht [...] Alle brüllten aus ganzer Leibeskraft und drängten sich und drängten sich mit den verschiedenartigsten Grimassen und Bewegungen um die Boote. Man muß sich noch die Bemalung und Tatauierung hinzudenken, welche die Männer wie Clowns oder Dämonen aussehen ließ.“ (Métraux 1988:37) Als die Engländer auf das in ihren Augen rücksichtslose Verhalten der Insulaner gereizt reagierten, wurde dies als mögliche Vorbereitung für einen Angriff ausgelegt. In der Folge gingen ganze „Salven aus Steinen [...] auf die Matrosen nieder, von denen eine große Zahl ernsthaft verwundet wurde.“ (ebd.) Beechey gab daher Befehl, scharf zu schießen, und dabei wurde der Häuptling offensichtlich schwer getroffen. Die ausbrechende Panik nutzten die Engländer zum sofortigen Aufbruch. Der Kontakt war alles in allem recht kurz, und die Schilderungen Beecheys von der Osterinsel beschränkten sich auf oberflächliche Beobachtungen. Diesen zufolge soll die Bevölkerungszahl um die 1500 betragen haben. Weitaus geringer war indes die Zahl der Steinstatuen, deren von früheren Expeditionen festgehaltene große Menge Beechey massiv in Frage stellte.
Nach seiner Abreise scheinen die Menschen kurz noch einmal zur Ruhe gekommen zu sein. 1835 erhielt der holländische Kapitän Moerenhout auf seinem kurz vor der Insel ankernden Boot den Besuch eines Eingeborenen, segelte aber unverzüglich wieder ab. Als Admiral Abel du Petit-Thouars mit seinem Schiff im Jahr 1838 vor der Insel ankerte, sah er zum letzten Mal die Moai noch auf ihren Plattformen stehen. Freilich nur aus der Entfernung, denn einen Landgang wagte er aus Angst vor eventuellen Gewalttätigkeiten nicht. Die Insulaner erwiesen sich indes als äußerst friedlich. Sie segelten auf einem Schilfboot zu seinem Schiff in der Absicht, Handel zu treiben. Petit-Thouars ging auf dieses Anliegen ein und erstand unter anderem eine janusköpfige Figur aus Holz. Als Untermalung zu den Transaktionen führte eine Frau der Besatzung einen Tanz vor. Ihre einladenden Gesten konnten Petit-Thouars nicht dazu verleiten, länger zu bleiben, und er gab noch am Tag des Anlegens den Befehl zur Abfahrt.
1843 segelte der französische Missionar Monsignore E. Rouchouze mit 24 bekehrten Polynesiern von Tahiti aus in Richtung Osterinsel. Man hörte zwar nie wieder von ihnen, aber es gibt durchaus Grund zur Annahme, dass sie ihr Ziel erreichten. und erste christliche Versatzstücke in die Kultur des Eilands einschleusten. Ebenfalls 1843 ankerte das Walfangschiff „Margaret Reit“ vor der Insel. Zu Zwischenfällen kam es dabei aber ebenso wenig wie bei weiteren Ankerungen europäischer oder amerikanischer Schiffe für etwas mehr als ein Jahrzehnt. In der Zwischenzeit tauchte 1851 in Neuseeland ein Rei-Miro-Brett mit Rongorongo-Schriftzeichen auf - offensichtlich eins von vielen derartigen Stücken, die damals bereits in aller Welt verbreitet waren. 1852 entdeckte ein Missionar dann solche Bretter auch auf der Insel selbst und berichtete darüber nach seiner Abreise. Drei Jahre später, 1855, unternahm Schiffskommandant J. Hamilton einen neuerlichen Missionierungsversuch. Die Insulaner setzten sich gegen die Eindringlinge jedoch zur Wehr, töteten den zweiten Offizier des Schiffs, rissen der ganzen Mannschaft die Kleider vom Leib und kaperten das Rettungsboot (Leopold-Herrgott 1994:16). Immerhin aber fand Hamilton Überreste des Beiboots der Missionierungscrew von 1843 und damit einen Beweis zumindest für deren Kontaktaufnahme mit den Osterinsulanern.
Der Beginn der Ausbeutung der Guano-Felder in Peru im Jahr 1859 bedeutete indirekt einen tiefen Einschnitt in der Geschichte der Osterinsel. Denn die Betreiber der Guano-Produktion brauchten Sklaven, und einer der nächst gelegenen Plätze, solche einzufangen, war eben Rapa Nui. Wieviele Insulaner während der nächsten vier Jahre entführt wurden, lässt sich nicht mehr eindeutig ermitteln. Bis 1861 sollen es zunächst 500 gewesen sein, zwischen September 1862 und März 1863 weitere 2225. Einer der schwersten Zwischenfälle ereignete sich am 12. Dezember 1862, als sieben peruanische Schiffe unter dem Befehl von Kapitän Aiguirre vor der Insel ankerten. Die Seeleute lockten zunächst Eingeborene an Bord und überwältigten sie. Anschließend „ruderten etwa 80 Matrosen an Land und breiteten am Strand Geschenke aus. Als die Bewohner kamen, um die Waren zu begutachten, wurden sie überfallen, gefesselt und auf die Schiffe gebracht. Die wenigen, die sich retten konnten, flüchteten mit Frauen und Kindern in ihre Höhlen.“ Unter den Gefangenen befanden sich auch König Kamakoi bzw. Kai Makoi Iti, sein Sohn Maurata. und fast alle Traditionsträger und Gelehrten der Insel.
Binnen weniger Monate starben rund 900 der Entführten auf den Guano-Feldern Perus. Zur selben Zeit gelang es Bewohnern der Tubuai-Insel Rapa, Sklavenjäger zu überwältigen und eines ihrer Schiffe zu kapern. Durch sie erfuhr Monsignore Étienne Jaussen, der Bischof von Tahiti, von dem Menschenraub. Auf seine Veranlassung hin sollten an die hundert Rapanui auf ihre Insel zurückgebracht werden. „Eine Pockenepidemie raffte jedoch schon auf der Überfahrt 85 Menschen dahin. So erreichten nur noch 15 Osterinsulaner ihre Heimat wieder und steckten auch die eigenen Stammesangehörigen mit Pocken an. Nur wenige hundert überlebten die Katastrophe.“ (Hellmich 1996:16) „Die Zahl der Leichen war so groß, daß es unmöglich war, sie in den Familien-Grabanlagen beizusetzen. Man mußte sie in Felsspalten werfen oder in unterirdische Gänge schaffen.“ Neben den Pocken raffte unterdessen auch die 1860 von Fremdarbeitern aus Tahiti eingeschleppte Lepra zahlreiche Menschen dahin. Zu diesen mörderischen Seuchen kamen gegen Ende des Jahres 1863 auch „noch innere Unruhen. Die soziale Ordnung war untergraben worden, die Felder blieben ohne Herren, und man kämpfte um ihren Besitz.“ Und dann folgte auch noch eine Hungersnot (Métraux 1988:39). Die Zahl der Bevölkerung von Rapa Nui sank auf knappe 500 Personen.
Epoche der Missionierung
Die auf der Insel Verbliebenen hatten praktisch alles verloren, ihre materiellen Reichtümer genauso wie ihre kulturellen Wurzeln. Sie waren enttäuscht, verbittert und aggressiv. Ihre Inselkultur war nur noch ein Schatten dessen, was sie einmal dargestellt hatte. In dieser Situation traf am 2. Januar 1864 Pater Eugène Eyraud, gelernter Maschinenschlosser und über über Chile nach Tahiti gelangter Sacré-Cœur-Laienbruder, in der Bucht von Anakena ein. In seiner Begleitung befanden sich der befreite Osterinselsklave Pana und zum Christentum bekehrte Eingeborene aus Mangareva. Letztere weigerten sich zunächst, anbetrachts der feindseligen Stimmung unter den Bewohnern an Land zu gehen. Eyraud aber bestand darauf. Trotz der Diebereien und Tätlichkeiten seitens der Insulaner ließ im Bereich von Hanga Roa eine Hütte errichten. Während der folgenden Wochen und Monate beobachteten die beiden Seiten einander sehr genau und mit stetigem Misstrauen. Die Einheimischen betrachteten den Pater als durchaus mächtigen Mann, und seine Gebetsfloskeln galten bei ihnen als magische Formeln. Dennoch nahmen sie sich alles, wessen sie habhaft wurden. Und Torometi, der „matatoa“, örtliche Kriegshäuptling, ging ihnen dabei mit sichtbarem Beispiel voraus. Eyraud merkte dazu später an: Während „der neun Momnate und neun Tage meines Aufenthaltes auf der Oster-Insel mit beispielloser Beharrlichkeit fort, mich um alles zu erleichtern, was ich mitgebracht hatte und was mich durchaus nicht störte.“ (Métraux 1988:42) Mit der Zeit sank Eyraud, der ethnografisch höchst interessante briefliche Berichte an seine Vorgesetzten schickte, auf den Status eines „kio“, Dieners, Torometis herab. Im Vorfeld des Vogelmannfestes im September eskalierte die Situation jedoch. Der „matatoa“ sah sich dabei nämlich ohne Chance gegenüber seinen Herausforderern und befahl dem Pater, ihn auf seinem Rückzug zu begleiten. Als der sich weigerte, plünderte er dessen Hütte. Eh er sich’s versah, geriet Eyraud zwischen die Fronten, wurde entführt, begab sich wieder in die Hände Torometis und entschloss sich schließlich, die Insel wieder zu verlassen. Ein Zweimaster nahm ihn am 11. Oktober 1864 mit nach Chile.
Der Auftritt des katholischen Missionars scheint bei den Insulanern einige Verwirrung erzeugt zu haben. Einerseits vermisste man den gequälten Gast, andererseits hatten einige vermutlich Angst, dass er eines Tages zurückkehren und blutige Rache nehmen könnte. Und er kehrte tatsächlich zurück, und zwar am 25. März 1866. Diesmal hatte er zur Verstärkung einen missionarischen Begleiter, Pater Hippolyte Roussel, und drei Eingeborene aus Mangareva bei sich. Um neuerlichen Diebstählen vorzubeugen, errichteten die missionierenden Gäste ihre Hütte diesmal aus Wellblech. Und nach einigen Wochen beharrlicher Verkündigung des Wortes ihres Gottes errichteten sie für die ersten Bekehrten eine Kapelle. Nach und nach entstand in Hanga Roa eine kleine Christensiedlung, und schließlich leisteten nur noch einige Häuptlinge Widerstand, und zwar deshalb, weil sie „zögerten sich von ihren Frauen zu trennen, mit denen sie ihr Leben teilten und denen sie in vielen Fällensehr zugetan waren. Oft fürchteten sie auch, ihre Stellung nicht mehr aufrechterhalten zu können“. Schließlich aber gaben auch sie nach, und mit der Huldigung der Missionare durch den „matatoa“ von Hotuiti war der Bann gebrochen. Zur selben Zeit, im Jahr 1867, wurde das Dorf Vaihu gegründet. Im Jahr darauf fanden unter Duldung der ethnografisch höchst interessierten Missionare erste archäologische Untersuchungen durch den Arzt J.L. Palmer statt. Er kam mit dem englischen Linienschiff „Topaze“ und blieb sieben Tage lang auf Rapa Nui. Palmer berichtete später, dass „ihm die Einheimischen eine Menge alter Kultgegenstände aus Holz, die sie teilweise in Rindenbaststoff in ihren Behausungen“ aufbewahrten, zeigten. „Es gäbe auch Figuren aus Stein, die im gegensatz zu den großen Moais ausnahmslos keine langen Ohren hätten, wurde ihm gesagt“ (Leopold-Herrgott 1994:19). Die „Topaze“ nahm schließlich zwei Moais mit.
Am 14. August 1868, dem Vorabend von Mariae Himmelfahrt, wurden die letzten „Heiden“ in der Kapelle getauft. Zufrieden mit der getanen Arbeit legte sich Bruder Eyraud zur Ruhe und starb wenige Tage später. Seine letzte Frage soll gewesen sein: „Sind alle getauft?“ Worauf man antwortete: „Ja, alle.“ (Métraux 1988:46) Unterdessen wurde das Leben auf Rapa Nui radikal umgestaltet. Die alten Sitten hielten sich zwar als untergründiges Kulturgut, aber Gesellschaft und Wirtschaft veränderten sich gewaltig. 1869 importierten die Missionare „200 Schafe, 5 Kühe, 2 Stiere, 4 Schweine, 1 Pferd, 6 Esel, 4 Hunde und 3 Katzen“. Im gleichen Jahr kaufte der aus Tahiti stammende französische Abenteurer und ehemalige Seepirat Jean Onésime Dutroux-Bornier die Grundausstattung für die Errichtung einer Farm auf der Osterinsel. Neben 400 Schafen brachte er zwei Kisten voller Gewehre und Munition mit nach Rapa Nui (Leopold-Herrgott 1994:19). Zusammen mit seinem Kompagnon, dem tahitianischen Plantagenbesitzer J. Brandner ließ sich Dutroux-Bornier in Mataveri nieder. Seine geschäftlichen Praktiken waren die eines bedenkenlosen Kolonialherrn. Er zwang die Einheimischen, ihm Land abzutreten und zu Billigstlöhnen für ihn zu arbeiten. Um seine wirtschaftliche Macht auch politisch abzusichern, verbündete sich Dutroux-Bornier mit Torometi, der seinerseits hoffte, mit Hilfe der Neuankömmlinge ein großer und mächtiger Häuptling werden zu können. In der Folge sammelte sich um die drei eine kleine Bande, die die Bewohner von Hanga Roa terrorisierten und die Insel schließlich ins Chaos stürzte. Die politisch inzwischen relativ bedeutungslos gewordene Funktion des „ariki matua“ übte zu jener Zeit als Nachfolgerin des früh verstorbenen Koreto Puakurunga erstmals eine Frau, Carolina, aus.
1870 ankerte das von I.L. Gana kommandierte chilenische Schiff „O’Higgins“ vor Rapa Nui. Der Kapitän äußerte sich erstaunt darüber, dass die Einwohner immer noch nackt vor den Moais tanzten und die Christianisierung so wenig Wirkung zeigte. Unter seinen Marinekadetten war Policarpo Toro, der für die Entwicklung der Insel noch von großer Bedeutung werden sollte. Fürs erste aber herrschte Bürgerkrieg auf dem abgelegenen Eiland. Am 4. April zerstörte Torometis Bande die Missionsstation und vertrieb die beiden Patres Escolan und Roussel zusammen mit 169 Osterinsulanern von der Insel. Die Emigranten kamen zunächst auf Mangareva unter. Dutroux-Bornier transferierte unterdessen 247 weitere Insulaner nach Tahiti zur Bearbeitung der Plantage seines Partners Brandner in Mahina. Die Nachkommen dieser Arbeiter bildeten eine eigenständige Gemeinschaft, die in der tahitianischen Hauptstadt Papeete ein eigenes Viertel bewohnten und persönliche Kontakte mit ihrer Heimatinsel über Generationen hinweg aufrecht erhielten.
Auf Rapa Nui verblieben zu Ende des Jahres 1870 nur noch 230 Menschen, die der Willkür des Abenteurers und seiner Verbündeten ausgeliefert waren. Wer sich seinem Willen nicht fügte, dessen Haus wurde niedergebrannt und dessen Ernte vernichtet. 1871 versuchte der Inseltyrann etliche der Widerständler auf dem kurz vor der Insel ankernden russischen Segelkriegsschiff „Vitjazi“ unterzubringen. Die Crew war offensichtlich schockiert über die auf der Insel herrschenden Zustände, ebenso wie die von Vize-Admiral F. de Lapelin kommandierte Mannschaft des französischen Kriegsschiffes „La Flore“, das 1872 vor Hanga Roa ankerte. Der mitreisende spätere Schriftsteller Pierre Loti war zwar begeistert von diesem „steinernen Traum“, der Chronist Leutnant Julien Viaud hingegen äußerte sich bestürzt über die „Renaissance der alten Sitten“ und die Verdrängung der christlichen Religion. Vor den Ahus etwa wurden wieder Brandopfer zelebriert (Leopold-Herrgott 1994/20). Dutroux-Bornier, der in der Zwischenzeit seine Frau Pua Akurengo Koreto zur Inselkönigin ausgerufen hatte, beantragte bei de Lapelin französischen Schutz für „seine“ Insel. Das Marineministerium lehnte dieses Anliegen nach längerer Beratung jedoch ab. Umgekehrt verlief auch das eigentliche Anliegen der Expedition de Lapelins, einen Moai nach Frankreich zu schaffen, um ihn im Louvre auszustellen, erfolglos. Die Figuren waren schlicht zu schwer für einen Transport in der „La Flore“. Leichter hatte es da die unter dem Kommando von Lopez stehende „O’Higgins“, die 1875 zum zweiten Mal vor Rapa Nui ankerte. Aufgabe der Mannschaft war es, die 1870 begonnene Sammlung von Steinskulpturen zu vervollständigen. Ihre „Mitbringsel“ sind heute im Meuseo Nacional de Historia Natural in Santiago de Chile zu bewundern (Leopold-Herrgott 1994:21). Schlussendlich erhielt auch ein Pariser Museum noch einiges Material von der Insel, und zwar durch Adolphe Pinart, der mit seinem Schiff „La Seignely“ 1877 Rapa Nui ansteuerte. Zu diesem Zeitpunkt war Dutroux-Bornier, wie Pinart berichtete, schon tot. Im August 1876 war er angeblich betrunken vom Pferd gefallen und dabei gestorben. In Wirklichkeit hatten vermutlich die Inselbewohner ihren Peiniger samt Frau erschlagen. Alles in allem fand Pinart nur noch 111 Inselbewohner an, darunter 26 Frauen und Mädchen. Damit hatte die Entwicklung der Rapanui-Kultur einen neuen Tiefpunkt erreicht.
In dieser Situation traf ein neuer Schafzüchter auf der Insel ein. 1878 übernahm Alexander P. Salmon Kommando über die Farm. Er hatte „bereits die Sprache der Osterinsel gelernt“ und bemühte sich, „den Insulanern ein gerechter Herr zu sein.“ Er gab ihnen angemessenen Lohn und half mit, „die Not auf Rapa Nui zu lindern.“ Im Juni gleichen Jahres kam dann auch Pater Roussel aus Mangareva zurück, „um das soziale Leben [...] neu zu organisieren.“ Nicht ganz in seinem Sinn allerdings verhielt sich der neue Farmmanager Chavez aus Chile. Er ließ „die Bewohner aus Angst oder Respekt“ ihre alten Gebräuche ausüben (Leopold-Herrgott 1994:22). Die Einheimischen machten von dieser Freiheit allerdings nur bedingt Gebrauch und bemühten sich überdies nun auch selbst, wohl unter dem Einfluss von Pater Roussel, französischen „Schutz“ für ihre Insel zu erlangen. 1881 schickten sie eine Delegation nach Tahiti, um einen entsprechenden Vertrag abzuschließen. Das Ansinnen wurde jedoch auch diesmal abgewiesen. Als 1882 das deutsche Schiff „Hyäne“ unter Kapitänleutnant Geiseler der Osterinsel einen Besuch abstattete, war Professor Adolf Bastian vom Deutschen Kaiserlichen Museum mit an Bord. Er führte, unterstützt durch Salmon, umfangreiche Forschungen auf Rapa Nui durch und stellte fest, dass sich die Insulaner schon recht gut auf die zivilisatorischen Bedingungen eingestellt hatten. So berichtete er zum Beispiel von einem ausgiebigen Souvenirhandel.
Das eigentliche Kommando auf der Insel aber führte der Leiter der katholischen Mission, Pater Roussel. 1883 ernannte er Atamu Tekena zum Inselchef und stellte ihm nach bewährtem kolonialen Muster zwei Räte und zwei Richter zur Seite. Die von ihm durchgeführte Volkszählung ergab 157 Einwohner. 1886 unternahm der Zahlmeister des amerikanischen Schiffes „Mohican“ W.J. Thomsons Forschungen auf der Osterinsel, die einen wichtigen Grundstock für spätere wissenschaftliche Untersuchungen legten. Zwei Tage beschäftigte er sich mit der Rapanui-Welt der „Naturgötter, Götzen, Dämonen und Geister“, schrieb Legenden nieder, schoss unzählige Fotos, erwarb Rongorongo-Tafeln und studierte Moais und die Baukunst der Insulaner. Die wiederum erkannten die Gier der Amerikaner nach exotischen Gegenständen und lieferten ihm, zusätzlich angeregt durch Salmon, manche kuriose Stücke, die mit ihrer tradiotionellen Kultur eigentlich nichts zu tun hatten. Im selben Jahr stellten die Inselbewohner ein neuerliches Ansuchen um „Schutz“ durch die französische Regierung. Während auch dieser dritte Anlauf scheiterte, zeigte ein anderer Staat Interesse an der Osterinsel: Chile. José Manuel Balmaceda, ein Cousin von Policarpo Toro und 1886 zum Präsidenten gewählt, wollte sein Land in den Pazifik hinein vergrößern und ließ von daher die Inselwelt in Augenschein nehmen. Unterdessen übernahm 1887 der Laienkatechet Nikolas Pakarati von dem nur kurze Zeit auf dem Eiland weilenden Pater Albert Montiton die Betreuung der knapp 200 Seelen starken christlichen Gemeinschaft von Rapa Nui. Er blieb vierzig Jahre lang bis zu seinem Tod am 12. Oktober 1927 im Amt.
Kolonialzeit
Vom 20. bis 25. September 1882 besuchte das deutsche Kanonenboot SMS Hyäne im Rahmen einer ausgedehnten Südseeexpedition die Osterinsel. Kapitänleutnant Geiseler hatte den Auftrag der kaiserlichen Admiralität, wissenschaftliche Untersuchungen für die ethnologische Abteilung der königlich preußischen Museen in Berlin vorzunehmen. Die Expedition lieferte unter anderem detailgenaue Beschreibungen der Sitten und Gebräuche, Sprache und Schrift der Osterinsel, außerdem exakte Zeichnungen verschiedener kultischer Objekte, von Moais, von Hausgrundrissen sowie einen detaillierten Lageplan der Kultstätte Orongo. Die ersten Fotos der Moais fertigte der Schiffsarzt William Thomson, der 1886 an Bord des US-amerikanischen Schiffes Mohican die Osterinsel besuchte.
Das Jahr 1888 bedeutete einen neuerlichen schweren Einschnitt in der Geschichte der Osterinsel. Ihr Initiator war Policarpo Toro, der Anfang September als Kapitän der Korvette „Angamos“ Rapa Nui besuchte. Im Auftrag Balmacedas sollte er mit den Einwohnern und der Mission verhandeln, und er erwirkte schließlich ihre Zustimmung zu einem Vertrag, der praktisch die Annexion der Insel durch Chile bedeutete. In dem am 9. September durch König Atamu Tekena und die anderen Häuptlinge signierten Dokument hieß es: „Die Unterzeichnenden, Häuptlinge der Osterinsel, geben bekannt, daß sie für immer und ohne Vorbehalt die Souveränität der Insel an die Republik Chile antreten, zur selben Zeit aber darauf bestehen, ihre Titel als Häuptlinge, mit denen sie ausgestattet wurden, zu behalten.“ Ebenso behielten sie ihr Eigentum und das Nutzungsrecht an allen Ländereien. Quittiert wurde der Vertrag von Atamu Tekena durch das Ausreißen eines Grasbüschels und das Überreichen einer Handvoll Erde (Leopold-Herrgott 1994:24). Policarpo Toro machte seinen Bruder Pedro Pablo Toro zum „Verwalter der Kolonialisierung“ und ließ ein erstes Grundbuch der nunmehr offiziell „Isla de Pascua“ genannten Insel anfertigen. Er hoffte wohl, nach der Eröffnung des damals noch im Bau befindlichen Panamakanals hier ein größere Versorgungsstation einrichten zu können.
Daraus sollte freilich nichts werden. Statt dessen wurden die von Salmon an die englische Gesellschaft Williamson & Balfour verpachtete Schaffarm ausgeweitet. An die 60.000 Tiere grasten damals auf der Insel - und brachten das labile Ökosystem endgültig zum Kippen. Die Leitung der Farm lag zwei Jahrzehnte lang in den Händen des Engländers P.H. Edmunds. Für einige Zeit wurde nun aus dem abgelegenen Eiland ein regelmäßig von Versorgungsschiffen angelaufener Außenposten des chilenischen Staats. Die Inselbewohner lebten unter anderem vom Verkauf neu hergestellter „Kultgegenstände“ und huldigten angeblich aller Christianisierung zum Trotz alten wilden Ritualen. 1890 etwa berichtete der Amerikaner V.S. Frank, dass sie eine Zeremonie durchgeführt hätten, „in deren Verlauf gefangene peruanische Seefahrer und Einheimische, vermutlich von einer verfeindeten Sippe, geopfert und verspeist“ worden wären (ebd.). An der Glaubwürdigkeit der Quelle bestehen freilich erhebliche Zweifel, denn der Autor war den Einheimischen nicht grad sonderlich gewogen.
Im Jahr 1892 resignierten die Brüder Toro - weniger wegen der Wildheit der Osterinsulaner, sondern vielmehr aus wirtschaftlichen Gründen. Ihr Schiff sank nämlich der der Insel, und da außerdem auch noch die Panamakanal-Gesellschaft bankrott ging, waren die Zukunftsaussichten nicht gerade rosig. Policarpo Toro empfahl daher der chilenischen Regierung, die Kolonisierung wieder aufzugeben. Unterdessen starb im August gleichen Jahres König Atamu Tekena. Neuer Inselherr wurde der erst zwanzigjährige Simeon Riro aKainga.
Der Staat Chile wartete unterdessen ab und übergab per Vertrag vom 3. September 1895 die Nutzungsrechte auf der Insel für zwanzig Jahre an den in Chile ansässigen französisch-guyanischen Geschäftsmann Enrique Merlet. am 3. September 1896 kam der neue Farmherr selbst auf die Insel und regelte die Betreuung seines Guts. Die Republik Chile ernannte unterdessen Alberto Sanchez Manterola zum offiziellen staatlichen Inselchef. Der hütete sich jedoch zunächst, zwischen den Fronten der Mission, der Gutsverwaltung und den verschiedenen Inselklans stehend, gröber ins Inselleben einzugreifen. Anbetrachts der Vermischung heidnischer und christlicher Überlieferungen fühlte sich Pater Mantilon bisweilen überfordert. So fragte er bei Bischof Jaussen in Tahiti an, ob denn nun gewisse Inselgottheiten den Teufeln oder den Engeln zuzuordnen wären.
1898 kam es zwischen Inselkönig Riro und Verwalter Sanchez zu Unstimmigkeiten bezüglich der Bezahlung der Arbeiter auf der Farm. Da sie sich nicht einigen konnten, traten die Insulaner in Streik - mit schwerwiegenden Folgen. Die Arbeitsunwilligen wurden ihrer Rechte beraubt, enteignet und in Hanga Roa praktisch interniert. Fünfzig der 214 Inselbewohner mussten eine Mauer rund um das Dorf errichten, und fortan durfte niemand mehr ohne ausdrückliche Erlaubnis Merlets oder seines Verwalters das abgesperrte Gebiet verlassen. Alle Männer und Frauen über vierzehn waren zudem zu Zwangsarbeitsleistungen verpflichtet. Gleichzeitig wurden alte Traditionen und die Flagge der Insel verboten. Die Folge dieser Maßnahmen waren tatliche Auseinandersetzungen, die König Riro schließlich durch ein persönliches Gespräch mit dem Präsidenten von Chile lösen wollte. Die Reise aufs Festland im Jahr 1899 verlief jedoch tragisch. Noch bevor Riro in den Präsidentenpalast vorgelassen wurde, starb er unter mysteriösen Umständen - aller Wahrscheinlichkeit nach ist er von Schergen Merlets vergiftet worden. Sein Begleiter Juan Tepano ernannte sich daraufhin selbst zum König und führte den Kampf weiter. Immerhin erreichte er, dass Sanchez die Insel verlassen und einem neuen Verwalter, dem Engländer Horace Cooper, Platz machen musste. Dem gelang es, die Lage fürs erste zu beruhigen. Die Inselbewohner übernahmen in der Folgezeit das europäische Alfabet und begannen ihre mythischen Überlieferungen unter Coopers Aufsicht selbst niederzuschreiben. Abseits dessen aber kam es nach wie vor zu gröberen Zwischenfällen, und 1902 schickte Cooper sechs der Rebellion bezichtigte Insulaner nach Valparaiso ins Exil. Die Verbannten kamen dort jedoch nie an - sie wurden vermutlich auf dem Weg zum Festland ins Meer geworfen. Um die Lage besser in den Griff zu bekommen, versorgten sich die kolonialen Inselherren mit immer mehr Waffen und Munition.
1903 verkaufte er seine Besitzansprüche an das britische Handelshaus Williamson-Balfour. 1911 erreichte eine wissenschaftliche Kommission unter der Leitung des Deutsch-Chilenen Dr. Walter Knoche die Insel, um dort eine meteorologische und seismische Station zu errichten und erstmals fächerübergreifend biologische, ethnologische und archäologische Forschungen zu betreiben. Die verschiedenen europäischen Besucher, aber insbesondere die Rückkehrer aus peruanischer Sklaverei, brachten Infektionskrankheiten auf die Insel, die sich rasch verbreiteten und die Bevölkerung dezimierten. Ab etwa 1900 breitete sich auch die Lepra, vermutlich von Tahiti eingeschleppt, auf der Osterinsel aus. Abseits von Hangaroa wurde daher eine Leprakolonie errichtet, in der – nach Erzählungen der Einwohner – die Firma auch missliebige Personen isolierte, die sich dort erst mit der Krankheit ansteckten.
Die mehr oder weniger gewaltsamen Kolonisierungsversuche zeigten nach und nach Wirkung. „Die Oster-Insulaner von einst kleideten sich nun auf europäische Art und versuchten, die Vergangenheit zu vergessen.“ Allerdings behielten sie einzelne Elemente ihrer traditionellen Kultur und Wirtschaftsweise bei. Feldbau und Fischerei etwa wurden nach alten Methoden praktiziert, Kinder leierten an urtümliche Legenden angelehnte, „kurze, skandierte Melodien bei ihren Fadenspielen“ her, bei Bestattungen wurden wie ehedem die „akuaku“, Totengeister, angerufen, und auch bei Heiraten behielt man herkömmliche Zeremonien bei (Métraux 1988:47). In dieser Haltung traf eine von Walter Knoche geleitete chilenische Expedition die Inselbevölkerung an, als sie 1911 Rapa Nui besuchte. Die Wissenschaftler sammelten vor allem Kultgegenstände aus Holz und errichteten eine meteorologische und seismografische Station auf der Insel. Im gleichen Jahr wurde durch ein Dekret des Papstes die katholische Gemeinde der Osterinsel dem Bischof von Santiago de Chile unterstellt. Damit trennten sich endgültig die kirchlichen und kolonialen Wege der Rapanui-Gemeinschaften von Tahiti und der Osterinsel.
Ansonsten aber lebten die Osterinsulaner nach wie vor fern der Welt. Den Kriegsausbruch im Sommer 1914 bekamen sie nicht mit und versorgten daher beide Seiten mit Proviant. So etwa das deutsche Schiff „Prinz Eitel-Friedrich“ unter Admiral Spee, das unweit der Insel den französischen Frachter „Jean“ versenkte - seine Besatzung fand für kurze Zeit Zuflucht auf Rapa Nui -, ehe es selbst ein tragisches Ende fand (Métraux 1988:47-48).
Von Tahiti kommend traf sich ein Geschwader mit den Panzerkreuzern SMS Scharnhorst und SMS Gneisenau, dem kleinen Kreuzer Leipzig sowie Begleitschiffen mit aus dem Atlantik kommenden Transportschiffen, um Brennstoff und Lebensmittel zu übernehmen. Der Aufenthalt vor der Insel dauerte vom 12. bis 19. Oktober 1914. Am 23. Dezember 1914 versenkte der deutsche Hilfskreuzer SMS Prinz Eitel Friedrich das französische Handelsschiff Jean unmittelbar vor der Bucht von Hangaroa. Die Mannschaft des versenkten Schiffes wurde auf der Insel zurückgelassen. Als der deutsche Hilfskreuzer Seeadler des „Seeteufels“ Felix Graf von Luckner 1917 vor Mopelia (Gesellschaftsinseln) sank, segelte die Mannschaft mit dem gekaperten britischen Schiff Fortuna zur Osterinsel. Das Schiff trieb beim Versuch des Anlandens auf die Klippen und sank. Die Besatzung rettete sich auf die Insel und lebte dort vier Monate, bis sie schließlich im neutralen Chile arretiert wurde.
Unterdessen organisierte Almanzor Hernández den ersten privaten Schulunterricht auf der Insel. Als im Jahr 1914 die erste, von der britischen Völkerkundlerin Katherine Routledge-Scoresby geleitete wissenschaftliche Expedition zur Erforschung der Osterinsel-Kultur ihre für 17 Monate anberaumten Forschungsarbeiten begann, fand sie eine vergleichsweise ruhige Lage vor. Gutsverwalter Edmunds war mittlerweile zum offiziellen Verwalter der Insel ernannt worden. Routledge stellte fest, dass die Rapanui zwar in nach europäischem Muster gefertigten rechteckigen Hütten lebten, aber immer noch alte Zeremonien zelebrierten. Den geringen Lebensstandard der Insulaner führten sie auf deren Neigung zu Diebstählen zurück. Einer anderen Neigung, nämlich der des in die Irre leitenden „Höhlensuchens“, ist sie freilich selber aufgesessen. Und sie hat mit ihrer Arbeit letztendlich auch selbst viel zur Mythisierung der Osterinsel beigetragen. Bei ihrer Abreise notierte sie etwa: „Wer hier lebt [...], der wartet immer auf etwas Unerhörtes, er spürt unbewußt, daß er vor etwas Größerem steht, das seine Fassungskraft weit übersteigt.“ (Leopold-Herrgott 1994:27).
Vor diesem Größeren stand auch die betagte Insulanerin Angata, die 1915 träumte, dass es „40 Tage und 40 Nächte geregnet“ hätte und „die gesamte Welt“ mit Ausnahme der Osterinsel „in dieser neuen Sintflut versunken“ wäre. Da also die restliche Menschheit verschwunden war, läge es an den Osterinsulanern, die Erde neu zu bevölkern. Mit dieser Vision erlangte die Insulanerin großen Einfluss bei ihren Leuten, und binnen kurzer Zeit entstand eine endzeitliche Gemeinschaft, die die Herrschaft über die Insel beanspruchte, Häuptlinge tötete und die Schaffarm angriff. Der Aufstand wurde durch den Einsatz eines chilenischen Kriegsschiffes beendet, dessen Kommandant aber die unerträglichen Verhältnisse erkannte und Kritik an der Verwaltung der Schaffarm übte. An den räumlichen Beschränkungen änderte sich nichts, die Regierung setzte jedoch einen von der Firma unabhängigen Verwalter ein. Bei den Kämpfen kamen aber auch Sektenmitglieder zu Tode, und vermutlich wäre es zu einem blutigen Bürgerkrieg gekommen, hätte nicht die Besatzung eines aus Valparaiso kommenden Schiffes die Inselbevölkerung unmissverständlich darüber aufgeklärt, dass die Welt nicht untergegangen war (ebd.).
1917 verlagerte die Marineverwaltung von Valparaiso Rapa Nui per Gesetz in ihren eigenen Zuständigkeitsbereich, schloss mit den alten Gutsherrn einen neuen, wiederum auf zwanzig Jahre befristeten Vertrag und vergrößerte das den Insulanern zustehende Gebiet von 1000 auf 20000 Hektar. Im selben Jahr weilte ein von Carl Skottsberg und K. Bäckström geleitetes Forschungsteam zehn Tage lang auf der Insel. Neben botanischen Untersuchungen wurde dabei auch ethnografisches Material gesammelt - und wieder ließen sich die Forscher von Insulanern an der Nase herumführen. Zu Anfang des Jahres 1918 geriet die Insel noch einmal in den Strudel der Weltkriegsereignisse, als die Mannschaft des vor Tahiti gestrandeten deutschen Kriegsschiffes „Seeadler“ mit einem gekaperten französischen Zweimaster nach Rapa Nui gelangte. Sie blieben hier mehrere Monate, bis ein chilenisches Schiff sie nach Valparaiso mitnahm. Die enge Verbindung mit dem Festland wurde jedoch gekappt, als 1919 das Regime Balmacedas durch eine Revolution gestürzt wurde. Policarpo Toro, der bis dahin alle Belange Rapa Nuis dem chilenischen Staat gegenüber vertreten hatte, fiel bei den neuen Machthabern in Ungnade - und damit brach für einige Zeit auch der Verkehr zwischen dem Festland und der Insel zusammen. Nicht aber der zu Tahiti, das nun wieder etwas mehr Bedeutung für die Rapanui erlangte. Dies auch in Zusammenhang mit der Bekämpfung der Lepraepidemie, die 1920 ihren Höhepunkt erreichte.
1923 verbrachte der englische Forscher J. Macmillan Brown fünf Monate auf der Insel, die damals - ehenso wie Tahiti - von etwas mehr als 300 Rapanui bewohnt wurde. Als es im Jahr 1928 auf Grund einer Wirtschaftskrise in Chile zu Unruhen kam und in deren Folge revolutionäre Unholde zu entsorgen waren, entsann man sich wieder der fernen Insel und deportierte die Rebellen dorthin. In Mataveri angesiedelt, kam es schon nach kurzer Zeit zu gröberen Auseinandersetzungen zwischen den Exilierten - unter ihnen befand sich auch der Sohn des Präsidenten Alessansdri - und den Marinewachsoldaten. In diesen Konflikt wurden auch die Insulaner mit hineingezogen, die nun anfingen, sich wie in Zeiten der „matatoa“ gegenseitig aufzulauern. Zwecks Klärung der Lage - notfalls auch mit Gewalt - entsandte die chilenische Regierung Señor Cumprido als neuen Verwalter, unterstützt durch eine größere Zahl von Polizisten, auf die Insel. Da sich die Schafzüchter als nicht unbedingt kooperativ erwiesen, kündigte ihnen die Regierung 1929 den Pachtvertrag - vollstreckte diesen Akt aber nicht.
Nach dem Abzug der Rebellen versprach die chilenische Regierung den Bewohnern der Osterinsel 1933 „Rechte auf Bildung, geregelte Arbeitsbedingungen und soziale Mindestversorgung“. Verwirklicht wurde davon freilich nichts, wohl aber die alleinige Eigentümerschaft der Republik über Rapa Nui, die im gleichen Jahr durchgesetzt wurde. Zwischen 24. Juli 1934 und 2. Januar 1935 weilte der berühmte belgische Ethnologe Alfred Métraux zusammen mit dem französischen Archäologen Henri Lavachery auf der Insel. Mit Hilfe der Einheimischen Juan Tepano und Victoria Rapahango erarbeiteten sie eine der bedeutendsten Grundlagenstudien über die Osterinsel. Ihr Hauptforschungsgebiet waren die Steinstatuen, doch beschäftigten sie sich daneben auch mit mythischen Überlieferungen, Sitten und Gebräuchen der Insulaner. Métraux’ Studie darüber wurde 1940 von Bernice P. Bishop Museum in Honolulu unter dem Titel „Ethnology of Easter Island“ veröffentlicht.
Kurz nach der Abreise der beiden Forscher im Frühjahr 1935 kam eine Expedition der Universität von Santagio zwecks Erforschung der Eingeborenensprache auf die Insel. Mit von der Partie war ein deutscher Kapuzinerpater namens Sebastian Englert. Der Priester verstand es, mit den Einheimischen in erstaunlich engen Kontakt zu kommen und sie in kurzer Zeit für die Kirche zurückzugewinnen. Dies veranlasste Militärbischof Edwards dazu, ihm und seinem Orden, den Bayrischen Kapuzinern, die Seelsorge über die Rapanui-Schäfchen zu übertragen. Englert verstand es, „die alte Kultur der Insulaner nicht nur zu respektieren, sondern sie auch in ihren Überresten zu bewahren“, und wurde im Lauf der Zeit „zu einem ungekrönten König von Rapa Nui, jedenfalls zu einer Respektsperson, von der alle Besucher [...] voller Ehrfurcht“ berichteten (Leopold-Herrgott 1994:28-29). Englert lieferte auch ethnografische Grundlagenstudien, lernte die Rapanui-Sprache, in der er auch seine Predigten hielt, und schrieb insgesamt vier Bücher über die Inselkultur, darunter das erste Rapanui-Wörterbuch.
Auf den neuen missionarischen Beziehungen aufbauend, legte das chilenische Verteidigungsministerium 1936 per Dekret die Lebensbedingungen der Rapanui fest. Damit hatten die Osterinsulaner theoretisch die gleichen Rechte wie die Festlandchilenen. Dies betraf die Schulpflicht genauso wie die Teilnahme an Wahlen und die Entlohnung der Arbeiter. Der Staat hatte demnach für schulische Erziehung zu sorgen und forderte neue Arbeitsverträge, die auf eine Deckung des grundlegenden Lebensbedarfs hinzielten. Gleichzeitig wurde auch der Pachtvertrag mit der Schafsfarm erneuert, wobei die Einheimischen das Recht erhielten, „mit vorheriger Erlaubnis der Behörde“ auf dem verpachteten Areal „tierischen Brennstoff“ einzusammeln (Leopold-Herrgott 1994:29). Die Erfolge Englerts riefen auch die Kirchenoberen auf den Plan. 1939 versuchten sie, eine allgemeine Kirchensteuer auf der Insel einzuführen, was jedoch scharfe Proteste zur Folge hatte. Auch Maßnahmen, die den Osterinsulanern ein „mehr katholisch orientiertes Leben“ abverlangten, stießen auf wenig Gegenliebe. Die kirchlichen Kontroversen führten dazu, dass Pater Englert für elf Monate aus Rapa Nui abgezogen und durch Pater Melchior Schwarzmüller ersetzt wurde. Der allerdings kam mit den komplizierten Gegebenheiten nicht zurecht und gab schließlich auf.
1943 verhängte die Regierung offiziell wegen Lepra-Ansteckungsgefahr ein Ausreiseverbot von der Insel. In diesem Zusammenhang wurden immer wieder blinde Passagiere zurückgewiesen. Am 2. Januar 1944 versuchten fünf junge Insulaner mit dem gekaperten Beiboot der „Allipen“, eines Handelsschiffes, von Rapa Nui auf das Festland zu gelangen, um zu „lernen und zurückzukommen“. Nach 24 Tagen wurden sie von einem amerikanischen Schiff halbtot aufgelesen und nach Antofagasta gebracht. Der Fall machte über das Land hinaus Schlagzeilen. Weniger medienwirksam verlief die Übergabe der Schaffarm in private Hände im Jahr 1945. Zwei Jahre später, im Mai 1947, gründeten engagierte Chilenen den bis heute existierenden verein „Los Amigos de la Isla de Pascua“ (Freunde der Osterinsel). Seine Hauptaufgabe war zunächst die Versorgung der Leprastation, ab den fünfziger Jahren die Betreuung von Osterinsulanern, die aus Studien- oder anderen Zwecken auf das Festland kamen, sowie die Organisation von „Patenfamilien“, die Rapanui-Kinder während der Ferienzeit zu sich nahmen. Von der immer noch gesperrten Insel versuchten unterdessen im Jahr 1948 sechs Mitglieder der Familie Pakarati in einem Ruderboot in Richtung Tahiti zu entfliehen. Erst nach dreißig Tagen wurden sie halb verhungert aufgegriffen (ebd.).
1951 landete das erste Wasserflugzeug vor der Küste Rapa Nuis. Es war ein erster zaghafter Versuch, die Insel der großen weiten Welt näherzubringen. Die quasi feudalen Strukturen des insularen Wirtschaftssystems passten allerdings nicht mehr zu den sich wandelnden globalen Verhältnissen. Auf Grund anhaltender Proteste seitens der Bevölkerung löste die chilenische Regierung 1952 den Pachtvertrag mit den Schafzüchtern endgültig auf. Im Jahr darauf übernahm die chilenische Armee im Namen des Staatsunternehmens CORFO die mittlerweile rund 100.000 Schafe und verkaufte sie oder ließ sie schlachten. Damit endete die ökologisch desaströse Schafwirtschaft, und die Inselflora konnte sich langsam wieder erholen. Die Armee übernahm darüber hinaus auch die Verwaltung der Insel, fühjrte ein Ehrenbürgermeisteramt ein und stellte dem jeweils von ihnen ernannten Amtsträger einen praktisch die Macht ausübenden Untersekretär aus der Marine zur Seite. Auch ein Richter wurde auf die Insel beordert, um bei kleineren Vergehen die Deliquenten zur Kahlschur, bei größeren zur Auspeitschung zu verurteilen. Das diese Maßnahmen untermauernde Dekret von 1953 verpflichtete die Bewohner unter anderem auch zur kostenlosen Dienstleistung für die Marine, während gleichzeitig ihr Wahlrecht auf „Ehrenposten“ ohne Machtbefugnisse eingeschränkt wurde. Ein Arzt namens Valenzuela, der zu jener Zeit Rapa Nui einen Besuch abstattete, berichtete davon, dass die Bevölkerung eigentlich nur noch den Wunsch hätte, zu ihren Verwandten nach Tahiti auszuwandern. Was er mit dem Vorschlag quittierte, die Exilierungswilligen statt auf die Gesellschaftsinseln nach Nordchile zu deportieren und ihnen dort kontrolliert bessere Lebensbedingungen zu verschaffen.
Von den insgesamt neun dokumentierten Versuchen, die Osterinsel zu verlassen, war der vom November 1954 sicherlich der spektakulärste. Drei Rapanui - Pedro Chavez, Felipe Teao Arancivia und Aurelio Pons - flohen damals in einem Boot nach Hauehi im Tuamotu-Archipel. Außer dem ihren schafften es auch noch zwei weitere Bootsbesatzungen, nach Polynesien zu gelangen. Unmittelbar nach der Flucht der drei erließen die chilenischen Verwalter Verordnungen, die nicht nur schwere Strafen für Fluchtversuche vorsahen, sondern auch den Bootsbau grundsätzlich unter Kontrolle stellten. Von 27. Oktober 1955 bis 6. April 1956 hielt sich der norwegische Forscher und Querdenker Thor Heyerdahl auf Rapa Nui auf. Seine Arbeit bedeutete den Beginn der moderenen Archäologie auf der Insel und einen Meilenstein in der Aufarbeitung der Inselkultur. Im Jahr darauf begann der Tübinger Völkerkundler Wilhelm Barthel mit der Erforschung der Rongorongo-Schrift. Die folgenden Jahre waren geprägt von Streitigkeiten unter Wissenschaftlern, die auf einem internationalen Kongress im jahr 1961 erstmals feststellen, dass die Besiedlung möglicherweise nicht nur von Polynesien, sondern auch von Südamerika aus erfolgt sein könnte.
Die Einweihung der neuen Pfarrkirche von Hanga Roa am 28. September 1958 sollte eine neue Epoche der Christianisierung und Zivilisierung einleiten. Die Versorgung der Insel ließ indes nach wie vor zu wünschen übrig. Bis weit in die sechziger Jahre hinein kam nur einmal pro Jahr ein Versorgungsschiff „mit Medikamenten, Öl, Zucker, sonstigen Lebensmitteln und Post.“ (Leopold-Herrgott 1994:31) Lediglich das Polizeiwesen wurde ausgebaut, konkret 1962 durch die Einrichtung einer Station in Mataveri. Das zwei Jahre später von einer kanadischen Expedition errichtete Spital verfiel wieder nach dem Abzug der Gründer. Und das von Amerikanern errichtete Flugfeld wurde vorerst nur militärisch genutzt. Die rechtlose Situation der Osterinsulaner - die Kinder durften nicht einmal die eigene traditionelle Sprache sprechen - wurde 1964 durch den Franzosen Mazière der Weltöffentlichkeit bekannt gemacht. Ins Blickfeld rückte damals auch der engagierte Insellehrer, Alfonso Rapu, der von 1956 bis 1959 in Chile ausgebildet worden war. Als ihn die Insulaner zu ihrem Bürgermeister wählten, lehnten dies die chilenischen Behörden ab mit der Begründung, er wäre ein „Kommunist und Separatist“. Als man schließlich auch noch versuchte, ihn zu verhaften, stellten sich 200 Menschen den anmarschierenden Polizisten in den Weg.
Am 21. Mai 1960 verwüstete ein Erdbeben der Stärke 9,5 die Stadt Conception in Chile. Das Beben löste eine Tsunami aus, der die Südküste der Osterinsel traf und den erst einige Jahre zuvor restaurierten Ahu Tongariki völlig zerstörte. Die tonnenschweren Moai wurden mehr als 100 m ins Landesinnere geschleudert. Mit japanischer Unterstützung konnten die Schäden in den Folgejahren beseitigt werden, sodass sich die Anlage heute wieder im ursprünglichen Zustand präsentiert.
1965 schrieb Rapu im Namen der Inselbewohner an den liberalen Präsidenten Chiles, Eduardo Frei. Er protestierte in dem auf das Festland geschmuggelten Schreiben gegen die Unterdrückung seiner Landsleute und forderte mehr Rechte sowie den Ausbau der Infrastruktur auf Rapa Nui. Mit der Veröffentlichung des Briefes in der „New York Times“ entwickelte sich eine internationale Protestbewegung, die schließlich in der Tat eine Veränderung der Situation bewirkte.
Moderne Zeit
Bis zum Jahre 1967 herrschte auf der Insel das chilenische Kriegsrecht. Die Bewohner der Insel unterstanden einer restriktiven militärischen Verwaltung mit einem von Chile eingesetzten Militärgouverneur an der Spitze. Obwohl chilenische Staatsbürger, hatten die Insulaner kein Anrecht auf einen chilenischen Pass und durften die Osterinsel nicht verlassen. Ihr Aufenthalt war auf ein umzäuntes und bewachtes Gebiet um Hangaroa beschränkt, der übrige Teil der Insel durfte nur mit Erlaubnis des Gouverneurs betreten werden. Eigenständige, demokratische Strukturen in der lokalen Verwaltung wurden erst Ende der 1960er Jahre zugelassen.
1966 wurde die Isla de Pascua als „departamento“ der Verwaltung der Provinz Valparaiso unterstellt. Das am 22. Februar erlassene Gesetz sah auch - wieder einmal - eine Gleichstellung der „Pascuenses“ mit den Festlandchilenen. Ausgenommen davon blieb - bis heute - die Steuerpflicht, von der die Osterinsulaner befreit sind. Der Zaun um Hanga Roa, das nun eine eigene Gemeinde bildete, fiel, und das nach wie vor von Schafen begraste Land war nun wieder allen zugänglich. Ein im April des folgendesn Jahres erlassenes Zusatzgesetz sah zudem „die Erhaltung des archäologischen Erbes, der Sprache, der Traditionen und Bräuche“ vor (Leopold-Herrgott 1994:32). Um das alles umzusetzen, wurde zunächst einmal der Beamtenapparat verstärkt.
Der Ausbau der Verwaltung brachte zunächst eine verstärkte Zuwanderung von Chilenen - Anfang 1967 waren es insgesamt 435. 1967/68 errichtete das US-Militär am Rano Kao eine geheime Abhörstation. Mit ihr kamen amerikanische Militärangehörige auf die Insel, die für einen kleinen wirtschaftlichen Aufschwung sorgten. Unter der Regierung Allende wurde die Basis wieder aufgegeben.
Der Lehrer Alfonso Rapu wurde unterdessen zum Bürgermeister von Hanga Roa gewählt - und wie ein Volksheld gefeiert. Er hatte sich in der Folgezeit aber nicht so sehr gegen chilenische Übergriffe zu verteidigen als vielmehr gegen die US-amerikanische Absicht, die Osterinsel zu einer Militärbasis gegen die Sowjetunion auszubauen. Die mit US-Hilfe zustande gekommene Einrichtung eines Radiosenders mit 17. September war wohl auch mehr aus Eigeninteresse denn aus Engagement für die Osterinsulaner.
Die ersten Touristen, die zu jener Zeit auf die Insel kamen, nächtigten in einem kleinen Zeltdorf nahe Hanga Roa. 1969 wurde dann ein Hotel eröffnet, das vorerst freilich nur wenig frequentiert wurde. Der Tod Pater Englerts am 8. Januar dieses Jahres während einer Vortragsreise in New orleans in den USA bedeutete für die Osterinsulaner einen schweren Schock. Sein Nachfolger Pater Melchior Schwarzmüller brachte der Rapanui-Kultur deutlich weniger Verständnis entgegen. Mehr Engagement zeigte unterdessen die neue chilenische Regierung unter dem linken Präsidenten Salvador Allende. 1971 formierte sich in Santiago de Chile eine 23köpfige, den Päsidenten beratende „Kommission zur ökonomischen, politischen, sozialen und kulturlelen Entwicklung der Osterinsel“ (ebd.). Gleichzeitig übernahm der Staat die Leitung der Schule von Hanga Roa mit dem Ziel, die Osterinsulaner näher an die Zivilisation heranzuführen. Einen ähnlichen Zweck erfüllte wohl auch die Öffnung des Flughafens für Passagierflugzeuge im Jahr 1972. Im ersten Jahr kamen fast 6000 Touristen auf die Insel. Alle Versuche, Rapa Nui wirtschaftlich, politisch und kulturell zu stärken endeten jedoch im September 1973, als nach einem Militärputsch Augusto Pinochet an die Macht kam. Der neue diktatorische Machthaber löste alle Inselräte auf und unterstellte die Osterinsel der direkten Kontrolle des Staates. 1974 besuchte er als erster chilenischer Präsident die Insel - und tat dies auch noch zwei weitere Male, 1980 und 1987..
Die Rapanui-Kinder wurden vorerst wieder auf alte koloniale Art in spanischer Sprache unterrichtet. Erst 1976 wurde die eigene traditionelle Sprache wieder zugelassen. Im gleichen Jahr entstand ein eigener Fernsehsender, die „Television Nacional de la Isla de Pascua“, der freilich vorerst ausnahmslos in der Sprache der chilenischen Inselherren sendete. 1978 wurde den „Pascuenses“ immerhin „Ältestenrat“ zugebilligt, der ihren Einfluss auf die Verwaltung erhöhen sollte. Praktische positive Auswirkungen hatte diese Maßnahme freilich keine, im Gegenteil. 1979 erließen die Diktatoren in Santiago ein Gesetz, das den auf der Osterinsel lebenden Festlandchilenen den Erwerb von Grundstückrechten erleichtern sollte. Und 1980 wurde den Einheimischen das Sprechen ihrer Muttersprache verboten. Wer dem zuwider handelte, wurde mit Gefängnis bestraft.
1981 wurde den diskriminierenden Maßnahmen noch eine Nuance beigefügt. Grundbesitz sollte erst nach ausdrücklichem Bekenntnis zum chilenischen Militärstaat durch einen separaten Antrag erlangt werden können. Die Mehrheit der Alteingesessenen verweigerten sich diesem neuen Diskriminierungsgesetz. 1982 wurde die Insel dann auch noch in einen Krieg hineingezogen, nämlich dem um Falkland, als Pinochet den Briten gestattete, auf Rapa Nui einen Versorgungsstützpunkt einzurichten. 1984 übernahm der in den USA ausgebildete Archäologe Sergio Rapu, eine treuer Gefolgsmann Pinochets, das Amt des Inselgouverneurs. Als eine seiner ersten Handlungen eröffnete er in Hanga Roa eine Sport- und Veranstaltungshalle. 1985 wurden Grundstückstransaktionen auf der Grundlage neuer Regelungen durchgeführt, denen zufolge auch staatliche Institutionen Anträge stellen durften. Im gleichen Jahr wurde Ludwig Bertrand Riedl Pfarrer von Hanga Roa. Im November schließlich starb das letzte Schaf, das nocch auf der Insel gezüchtet worden war.
1986 erstellte Georgia Lee das erste Verzeichnis der auf der Insel zu findenden Felszeichnungen. Die amerikanische Völkerkundlerin und Rapanui-Spezialistin hatte zu diesem Thema zuvor dissertiert, zudem eine Arb eit über den Vogelmannkult geschrieben und gibt seit 1987 im kalifornischen Los Osos ein der Insel gewidmetes Magazin heraus, das „Rapa Nui Journal“. Das von ihr geförderte große Interesse der Weltöffentlichkeit an der Rapanui-Kultur förderte das Selbstbewusstsein der Insulaner. Einen wesentlichen Beitrag dazu lieferte nicht zuletzt Thor Heyerdahl, 1988 neuerliche Ausgrabungen durchführte. Im Jahr zuvor hatte die Gemeinde Hanga Roa die Schulverwaltung übertragen bekommen. Als nun die Feiern zum hundertsten Jahrestag der Annexion der Insel durch Chile anstanden, weigerten sich die Insulaner, das Ereignis zu zelebrieren. Statt dessen forderte der Ältestenrat im August 1988 die Rückgabe der Bodenrechte nach dem Stand von 1933. Die von April bis September 1989 im Frankfurter Senckenbergmuseum stattfindende Ausstellung „1500 Jahre Kultur auf der Osterinsel“ machte unter anderem auch auf die nach wie vor schlimme Situation der Rapanui aufmerksam. Im gleichen Jahr wurde bei einem Familienstreit ein Mann erschlagen - der erste tödliche Zwischenfall innerhalb der Rapanui-Gesellschaft seit langer Zeit.
1989 veranstaltete das Senckenbergmuseum in Frankfurt am Main eine richtungweisende Ausstellung, in der erstmals einige der über die ganze Welt verstreuten Relikte der Osterinsel-Kultur zusammen geführt wurden.
Als am 11. März 1990 eine neue demokratische Regierung in Chile gewählt wurde, bewirkte dies auf der Osterinsel eine neue Aufbruchsstimmung, und amn wandte sich sogleich an die neuen Machthaber mit dem Anspruch auf Selbstbestimmung. Mitten hinein in die hoffnungserweckenden Aussichten platzte 1991 die Nachricht vom ersten Aids-Fall auf der Insel. Im Jahr darauf gab es massive Proteste unter anderem gegen massiven Flugpreiserhöhungen und am 8. November 1992 gegen den Plan, „am Rand des Rano Kau-Kraters in Vai Atare einen Leuchtturm zu bauen.“ (Leopold-Herrgott 1994:33). Als Reaktion auf die Demonstrationen erhöhte Chile das Polizeikontingent auf der Insel. Und das hat seither etliches zu tun mit zunehmenden Alkohol- und Drogenproblemen, die im Gefolge der Dreharbeiten zu Kevin Costners „Rapa Nui“-Film 1993 stark zugenommen haben. Im Jahr 1993 unterzeichnete Präsident Alwyn ein Dokument, in dem sich die Republik Chile als Land mit sechs gleichberechtigten Volksgemeinschaften definierte. Eine dieser Gemeinschaften waren die Rapanui.
1994 wurde die Osterinsel durch den 1993 auf der Insel gedrehten Film „Rapa Nui – Rebellion im Paradies“, produziert unter anderem von Hollywood-Star Kevin Costner, weltweit in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt. Der Film zeigt, eingebettet in viele Landschaftsaufnahmen der Insel, in spielfilmtypisch dramatischer Zuspitzung die Errichtung der Moai, die Eingriffe der Menschen in die Natur und die damit verbundenen negativen Folgen. Eine weiteres Filmprojekt, eine Seifenoper von Chiles nationaler Fernsehrstation TVN mit dem Titel: „Iorana, Bienvenido al Amor“, machte die Osterinsel in Chile bekannt. Seit der Ausstrahlung 1997/98 (mit mehreren Wiederholungen) hat sich die Zahl der chilenischen Touristen vervielfacht.
Die Fischer von Rapa Nui haben ihre Besorgnis über die illegale Fischerei auf der Insel zum Ausdruck gebracht. „Seit dem Jahr 2000 haben wir den Thunfisch verloren, der die Grundlage der Fischerei auf der Insel ist, und so haben wir begonnen, den Fisch vom Ufer zu holen, um unsere Familien zu ernähren, aber in weniger als zwei Jahren haben wir alles aufgebraucht“, sagte Pakarati. Am 30. Juli 2007 erhielten die Osterinsel und die Juan-Fernández-Inseln (auch bekannt als Robinson-Crusoe-Insel) durch eine Verfassungsreform den Status von ‚Sondergebieten‘ Chiles. Bis zur Verabschiedung eines Sonderstatuts wird die Insel weiterhin als Provinz der Region V von Valparaíso verwaltet.
Auf der Osterinsel wurden einen Monat lang Fischarten in verschiedenen Lebensräumen gesammelt, darunter flache Lavatümpel und tiefe Gewässer. In diesen Lebensräumen wurden zwei Holotypen und Paratypen, Antennarius randalli und Antennarius moai, entdeckt. Diese werden aufgrund ihrer Merkmale als Froschfische angesehen: „12 Rückenstrahlen, die letzten zwei oder drei verzweigt; knöcherner Teil des ersten Rückenstachels etwas kürzer als der zweite Rückenstachel; Körper ohne auffällige zebraartige Markierungen; Schwanzstiel kurz, aber deutlich; letzter Beckenstrahl geteilt; Bruststrahlen 11 oder 12.“
Im Jahr 2018 beschloss die Regierung, die Aufenthaltsdauer für Touristen von 90 auf 30 Tage zu begrenzen, da die Insel mit sozialen und ökologischen Problemen zu kämpfen hat, um ihre historische Bedeutung zu erhalten. Nach dem Ausbruch des Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai im Jahr 2022 und dem Tsunami wurde eine Tsunami-Warnung für die Osterinsel ausgerufen.
Die Osterinsel war vom 17. März 2020 bis zum 4. August 2022 wegen der COVID-19-Pandemie für Touristen geschlossen. Anfang Oktober 2022, nur zwei Monate nach der Wiedereröffnung der Insel für Touristen, brannte ein Waldbrand fast 60 Hektar der Insel nieder und verursachte irreparable Schäden an einigen Moai. Es wird Brandstiftung vermutet.
Im August 2010 besetzten Mitglieder des indigenen Hitorangi-Clans das Hangaroa Eco Village and Spa. Die Besetzer behaupten, das Hotel sei in den 1990er Jahren von der Pinochet-Regierung gekauft worden, was gegen ein chilenisches Abkommen mit den indigenen Rapa Nui verstößt. Die Besetzer behaupten, ihre Vorfahren seien betrogen worden, um das Land abzugeben. Einem BBC-Bericht zufolge wurden am 3. Dezember 2010 mindestens 25 Menschen verletzt, als die chilenische Polizei mit Luftdruckwaffen versuchte, eine Gruppe von Rapa Nui aus diesen Gebäuden zu vertreiben, die behaupteten, das Land, auf dem die Gebäude standen, sei ihren Vorfahren unrechtmäßig weggenommen worden. Im Jahr 2020 wurde der Konflikt beigelegt. Die Eigentumsrechte wurden auf den Hitorangi-Clan übertragen, während die Eigentümer die Nutzung des Hotels für 15 Jahre beibehielten.
Im Januar 2011 äußerte sich der UN-Sonderberichterstatter für indigene Völker, James Anaya, besorgt über die Behandlung der indigenen Rapa Nui durch die chilenische Regierung und forderte Chile auf, „alle Anstrengungen zu unternehmen, um einen Dialog in gutem Glauben mit den Vertretern des Rapa Nui-Volkes zu führen, um so schnell wie möglich die wirklichen Probleme zu lösen, die der derzeitigen Situation zugrunde liegen“. Der Vorfall endete im Februar 2011, als bis zu 50 bewaffnete Polizisten in das Hotel eindrangen, um die letzten fünf Besetzer zu entfernen. Sie wurden von der Regierung verhaftet, und es wurden keine Verletzten gemeldet.
Aktuelle Situation
Anbetrachts der aussichtslosen Situation auf ihrer Insel hat Rapanui schon seit dem späten 19. Jahrhundert immer wieder in die Ferne getrieben. Französisch-Polynesien, Frankreich, die USA, Deutschland, Australien, Neuseeland und England sind in den letzten Jahren zu gleichsam paradiesischen Zielpunkten geworden. Der chilenische Archäologe Gonzalo Figueroa vermerkte dazu 1993: „Die jungen Leute sehen, wie die vielen Touristen kommen. Sie sehen scheinbar reiche Menschen, die Drogen nehmen, sich mit Alkohol zuschütten“ und herumlungern. „Sie glauben, dass man nur woanders hingehen muss, um Millionär zu werden. Viele versuchen es, können sich [aber] nicht anpassen und kommen aggressiv und frustriert auf die Insel zurück. Der alte Geist lebt nur [noch] in den alten Menschen von Rapa Nui, und von denen gibt es nicht mehr viele.“ Die einzige Lösung: „Sie müssen an das Leben außerhalb der Insel gewöhnt werden, gleichzeitig aber müssen sie in ihrer eigenen Geschichte und Kultur unterrichtet werden, damit sich ein gewisser Stolz entwickelt.“ (Leopold-Herrgott 1994:250)
Tatsächlich ist abseits der Probleme ist das gesellschaftspolitische Selbstbewusstsein der Rapanui im Verlauf der neunziger Jahre deutlich gewachsen. Die Ansichten über zukünftige Wege gehen innerhalb der Inselgemeinschaft aber zum Teil weit auseinander. Abtinio Tepano Hito, „Vorsitzender der Schnitzergemeinschaft und kritischer Vordenker der Osterinsel“, etwa befürwortete Ende 1993 „die Gründung und den kontrollierten Ausbau der Industrie. Seiner Meinung nach könnten eine Konservenfabrik für Fische und Früchte und ein Kühlhaus viel helfen. Dann müßten arbeitswillige Osterinsulaner nicht mehr bei der Verwaltung um von den Chilenen ausgegebene Jobs vorstellig werden, sondern könnten kleine Familienunternehmen gründen und sich wirtschaftliches Selbstbewusstsein erarbeiten.“ (Leopold-Herrgott 1994:246)
Ein Weg, der bereits seit Längerem beschritten wird, ist der der Mythisierung, die sich einerseits als profitables Geschäft erweist, andererseits aber auch neue kulturelle Impulse zu setzen vermag. In der Verklärung ihrer Insel jedenfalls entwickeln Osterinsulaner selbst mitunter die ausgefallensten Ideen. Diese reichen von ufonautischen Zusammenhängen bis zu der bereits im späten 19. Jahrhundert aufgekommenen Theorie, dass Rapa Nui ein Rest des versunkenen Kontinents Mu wäre. Derartige moderne Mythen werden mittlerweile auch von Insulanern selbst über Artikel, Broschüren und das Internet verbreitet.
Auf der rein praktischen Ebene hat sich das Leben auf der Insel in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Seit der Mataveri International Airport in den 1970er Jahren von der NASA zu einem Notlandeplatz für Raumfähren ausgebaut wurde, können dort auch Großraumflugzeuge landen. Der Ausbau hat zu einem deutlichen Anstieg des Tourismus geführt, der heute die Haupteinnahmequelle der Insel ist. Allerdings ist die Zahl der Touristen im Vergleich zu anderen Urlaubsinseln immer noch sehr gering.
Mittlerweile gibt es ein zentrales Wasserleitungssystem, bis dahin war man auf die Vorräte in den Kraterseen bzw. an der Küste aussickerndes Grundwasser angewiesen. An das mit Dieselgeneratoren betriebene Stromversorgungsnetz sind auch im Außenbereich liegende Anwesen angeschlossen. Befestigte Straßen findet man im unmittelbaren Bereich von Hanga Roa und Mataveri. Auch die Strecken von Hanga Roa zum Strand von Anakena und entlang der Südküste zur Halbinsel Poike sind inzwischen geteert.
An der Schule in Hanga Roa können alle Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife (Prueba de Aptitud, entspricht dem deutschen Abitur und der österreichisch-schweizerischen Matura) erworben werden. Ein Fach- oder Hochschulstudium ist jedoch nur auf dem Festland möglich. In der Grundschule gibt es einen von der UNESCO unterstützten Schulversuch bilingualen Unterrichts mit Rapa Nui und Spanisch.
Die Gesundheitsversorgung ist weitaus besser als in anderen abgelegenen Regionen von Chile. Das kleine Krankenhaus hat einen Arzt, einen Zahnarzt, eine Hebamme sowie einen Pflegedienst. Am Krankenhaus ist auch ein Ambulanzwagen stationiert. Die weitere Infrastruktur mit Kirche, Post, Bank, Apotheke, kleinen Geschäften, einem Supermarkt, Snack-Bars und Restaurants hat sich seit den sechziger Jahren erheblich verbessert, nicht zuletzt zur Befriedigung der Bedürfnisse des Tourismus. Satelliten telefon, Internet und E-Mails sind selbstverständlich. Inzwischen gibt es sogar eine Diskothek für die jüngeren Inselbewohner.
Einen tiefen Einschnitt in der Entwicklung der Insel brachte die Corona-Zeit. Im März 2020 wurden die Grenzen für den Tourismus gesperrt. Aufgrund der begrenzten medizinischen Kapazitäten und der großen Entfernung zum Festland blieb die Insel fast zweieinhalb Jahre lang von der restlichen Wel,t weitgehend abgeschottet. Der Tourismus, von dem die Wirtschaft der Insel zu etwa 70 % abhängt, kam zum Erliegen. Die Einheimischen waren gezwungen, sich auf traditionelle Methoden der Selbstversorgung wie Landwirtschaft und Fischfang zurückzubesinnen. Viele Inselbewohner verließen während dieser Zeit die Insel aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Möglichkeiten.
Die lange Isolation hat die Osterinsel zu jenem Ort gemacht, der weltweit am längsten wegen der Corona-Maßnahmen für Touristen geschlossen war. Nach 28 Monaten erst begann man die Isolierung zu lockern, Am 4. August 2022 landete wieder ein Touristenflugzeug auf der Insel. Die Öffnung erfolgte allerdings nur schrittweise mit zunächst zwei Flügen pro Woche, was etwa einem Drittel des früheren Touristenaufkommens entsprach. Eine Rückkehr zum Massentourismus von vor der Coronazeit wird von den Bewohnern indes abgelehnt. Man setzt stattdessen auf "Nachhaltigkeit" und will nicht mehr Menschen ins Land lassen, als dieses aus ökologischer Sicht verträgt.
Chronologie:
um 300 Entdeckung von Rapa Nui durch polynesische Seefahrer
4./5. Jh. Erstbesiedlung durch Marquesaner
ab 5. Jh. Zuzug möglicherweise auch von Südamerika aus
9. Jh. Entwicklung eines ausgeprägten Sonnenkults
um 1100 Neue Siedler aus Polynesien und/oder Südamerika kommen nach Rapa Nui
12. Jh. Erste Moais entstehen, ebenso die Rongorongo-Schrift
um 1200 Intensivierung der Rodungen
nach 1200 Der Sonnenkult wird durch den Ahnenkult abgelöst
1350 König Hotu Matua erreicht mit 200 Stammesangehörigen Rapa Nui
um 1400 Gründung des Dorfes Orongo am Rand des Rano Kao-Kraters
1440/50 Zuzug von Colla-Flüchtlingen aus Peru
um 1500 Auf der Insel haben sich zehn Stämme herausgebildet
16. Jh. Zwischen den Stammesgemeinschaften kommt es zu zahlreichen Kriegen
nach 1536 Spanische Schiffbrüchige der San Lesmes kommen von Tahiti nach Rapa Nui
17. Jh. Auseinandersetzungen zwischen Lang- und Kurzohren
1680 In einem Vernichtungskrieg zerstören die Osterinsulaner ihre eigene Kultur
nach 1680 Die Bevölkerungszahl von Rapa Nui ist auf unter 1000 geschrumpft
1687 Die „Bachelor’s Delight“ unter Kapitän E. Davis fährt an der Insel vorbei
um 1710 Möglicherweise erste Kontakte mit europäischen Schiffsbesatzungen
6.4.1722 Der holländische Kapitän Jacob Roggeveen „entdeckt“ Rapa Nui; er nennt es „Paasch-Eiland“ (Osterinsel)
15.11.1770 Der Peruaner Don Felipe Gonzales nimmt die „Isla San Carlos“ für den spanischen König in Besitz
1771/72 In Stammeskriegen werden mehr als drei Viertel der Bevölkerung getötet
11.3.1774 James Cook hält sich auf Rapa Nui auf
1786 Der Franzose Comte J.F.G. La Pérouse besucht mit zwei Schiffen die Insel
1803 Der tahitianische Klan der Pakarati siedelt sich auf Rapa Nui
1804 Der Russe U.F. Liskanskij landet mit seiner Mannschaft auf Rapa Nui
1805/06 Der amerikanische Sklavenhändler Adams lässt 22 Osterinsulaner entführen
1809 Der amerikanische Captain Windship führt einen Sklavenraubzug durch
28.3.1816 Landgang durch Otto von Kotzebue und Adelbert von Chamisso
1822 Entführung von Osterinsulanern durch amerikanische Walfänger
16.11.1825 Captain Beecheys Leute geraten in einen Hinterhalt, können aber fliehen
1838 Abel du Petit-Thouars ankert vor Rapa Nui, wagt aber keinen Landgang
1843 Monseigneur E. Rouchouze segelt mit 24 Christen nach Rapa Nui, die Leute dürften bei der Landung oder an Land erschlagen worden sein
1851 „Entdeckung“ der Rongorongo-Schrift in Neuseeland
1855 Die Mannschaft von J. Hamilton wird tätlich angegriffen
1858/59 Peruanische Sklavenjäger entführen rund 500 Insulaner
1860 Die Lepra wird durch einen Fremdarbeiter aus Tahiti eingeschleppt
1862 Capitano Aiguirre lässt rund 1000 Personen verschleppen, insgesamt werden 2225 Insulaner werden als Sklaven entführt
1863 Intervention des tahaitischen Bischof Jaussen gegen die Menschenraubzüge; zurückgebrachte Osterinsulaner schleppen die Pocken ein
2.1.1864 Landung des Sacré-Cœur-Laienbruders Eugène Eyraud auf Rapa Nui
11.9.1864 Flucht Eyrauds nach tatkräftigen Auseinandersetzungen
25.3.1866 Rückkehr Eyrauds mit missionarischer Verstärkung
1867 Gründung des Dorfes Vaihu
1868 Erste archäologische Untersuchungen durch den Arzt J.L. Palmer
Aug.1868 Tod Eyrauds; der französische Abenteurer Dutrou-Bronier erlangt die Kontrolle über die Insel
1869 Import europäischer Tiere durch Missionare; Ankunft des Abenteurers Dutroux-Bornier, der die Insulaner zum Bürgerkrieg anstachelt
1870 Ankerung des chilenischen Schiffes „O’Higgins“ vor Rapa Nui
4.4.1870 Zerstörung der Missionsstation und Flucht christlicher Insulaner nachMangareva
1871 Das russische Segelkriegsschiff „Vitjazi“ ankert vor Rapa Nui
1872 Julien Viaud berichtet von einer „Renaissance der alten Sitten“
1875 Die „O’Higgins“ ankert zum zweiten Mal vor Rapa Nui
1878 Alexander P. Salmon übernimmt das Schafzuchtkommando auf Rapa Nui
Juni 1878 Pater Roussel kehrt aus Mangareva zurück
1881 Eine Osterinsulaner-Delegation reist nach Tahiti; sie will dort einen Protektoratsvertrag mit Frankreich abschließen, scheitert aber
1882 Forschungen unter dem deutschen Kapitänleutnant Geiseler
1883 Pater Roussel ernennt Atamu Tekena zum Inselchef
1886 Forschungen W.J. Thomsons und neuerliches Scheitern eines „Schutz“- Ansuchens an die französische Regierung
1887 Der Laienkatechet Nikolas Pakarati übernimmt die Betreuung der christlichen Gemeinschaft von Rapa Nui
9.9.1888 Policarpo Toro annektiert die Isla de Pascua für Chile
1890 V.S. Frank berichtet von einem angeblichen kannibalischen Akt auf Rapa Nui
1892 Die Toros verlassen die Insel; Simeon Riro a’Kainga wird neuer „König“
3.9.1895 Enrique Merlet erhält auf 20 Jahre die Nutzungsrechte für Rapa Nui
1898 Streik der Insulaner und Streit zwischen Merlet, König Riro und Verwalter Sanchez; nach dem Tod Riros ernennt sich Juan Tepano zum König
um 1900 Einführung der europäischen Bildung auf Rapa Nui
1902 Exilierung von 6 Insulanern durch den neuen Verwalter Horace Cooper
1903 Gründung der Compania Explotadora de Isla de Pascua durch Enrique Merlet
1911 Meteorologische Expedition unter Walter Knoche
1914 Expedition der Britin Katherine Routledge-Scoresby; Almanzor Hernández organisiert den ersten Privatunterricht auf Rapa Nui
1914/15 Maria Angata Veriveri löst durch einen Traum eine Endzeitbewegung aus, in deren Verlauf es zu blutigen Auseinandersetzungen kommt
1916 Militärbischof Edwards setzt sich nach einem Besuch für Rapa Nui ein
1917 Neue Pachtbestimmungen und Forschungen von Skottsberg und Bäckström; Errichtung einer Leprastation und Beginn des Schulbaus
1918 Die Besatzung des deutschen ‘Seeadler’ verbringt einige Monate auf der Insel
1919 Nach einer Revolution auf dem Festland bricht der Kontakt zu Rapa Nui ab
1920 Höhepunkt der vermutlich aus Tahiti eingeschleppten Lepra-Epidemie
1923 Der Engländer J.Macmillan Brown hält sich fünf Monate auf Rapa Nui auf
1928 Deportation von Revolutionären samt einer Polizeistreitmacht auf die Insel
1933 Chile nimmt die alleinigen Nutzungsrechte der Insel für sich in Anspruch
1934/35 Forschungen von Alfred Metraux und Henri Lavachery
1935 Der deutsche Kapuzinerpater Sebastian Englert kommt nach Rapa Nui; Gründung des Parque Nacional Isla de Pascua
1936 Verlängerung des Pachtvertrages für einheimische Schafzüchter
1939 Melchior Schwarzmüller löst für elf Monate Englert ab
1943 Verbot der Abreise aus Hanga Roa wegen angeblicher Lepragefahr
1944 Vergeblicher Kaperversuch von fünf Insulanern
1945 Die größte Schaffarm von Rapa Nui wird privatisiert
1948 Sechs Mitglieder der Familie Pakarati fahren in einem Ruderboot nach Tahiti
1951 Erste Landung eines Wasserflugzeugs vor Rapa Nui
1952 Endgültige Kündigung des Pachtvertrages mit einheimischen Schafzüchtern
1953 Die chilenische Armee übernimmt die Verwaltung der Isla de Pascua
Nov. 1954 Drei Insulaner fliehen in einem Boot nach Hauehi im Tuamotu-Archipel
1955/56 Thor Heyerdahl forscht auf Rapa Nui
1957 Forschungen des Tübinger Wissenschaftlers Thomas Barthel
28.9.1958 Weihe der neuen Pfarrkirche von Hanga Roa
1960 Beginn der Wiederanpflanzung von Bäumen und Büschen
1962 Einrichtung einer Polizeistation in Mataveri
1964 Mazière löst mit seinen Medienberichten über die rechtlose Situation der Osterinsulaner ein Umdenken der Behörden aus; Errichtung einer Landebahn durch US-Amerikaner
1965 Beginn der Demokratisierung Rapa Nuis
ab 1965 Verstärkte Zuwanderung von Festlandchilenen
1.3.1966 Die Isla de Pascua wird ein Departamento der Provinz Valparaiso
1967 Eröffnung des Flughafens von Rapa Nui als Stützpunkt der US-Armee
17.9.1967 Ausstrahlung des ersten osterinsulanischen Radioprogramms
8.1.1969 Pater Englert stirbt während einer Vortragsreise in New Orleans
1970/72 Erstellung eines Entwicklungsplans für Rapa Nui unter Präsident Allende
1971 Formierung eines 23köpfigen Entwicklungs- und 14köpfigen Bundesrats; der Staat Chile übernimmt die Leitung der Schule
1972 Öffnung des Flughafens für Passagierflugzeuge
1973 Nach dem Militärputsch Pinochets werden alle Inselräte aufgelöst
25.7.1974 Schaffung der Provincia Isla de Pascua
1976 Die Rapanui-Sprache darf in der Schule gelehrt werden; Gründung der Television Nacional de la Isla de Pascua
1978 Gründung des Ältestenrats der Insulaner; Kauf eines US-Spitals für Rapa Nui
1979 Neue Grundstücksrechte erlauben auch Festlandchilenen Käufe
1980 Verbot der Rapanui-Sprache
1982 Die Osterinsel dient Großbritannien als Stützpunkt im Falklandkrieg
1984 Der Insulaner und Pinochet-Mann Sergio Rapu wird Gouverneur; Eröffnung einer Sport- und Veranstaltungshalle in Hanga Roa
1986 Erstellung eines Petroglyphenverzeichnisses durch Georgia Lee
1987 Die Schulverwaltung wird der Stadtverwaltung von Hanga Roa übergeben
1988 Neuerliche Ausgrabungsarbeiten Thor Heyerdahls
Sept. 1988 Klage des Ältestenrats auf Rückgabe der Bodenrechte
1989 Bei einem Familienstreit wird ein Mann erschlagen
11.3.1990 Vereidigung der neuen demokratisch gewählten Regierung
1991 Erster Fall von Aids auf der Insel
1992 Proteste gegen den Leuchtturmbau und zu hohe Flugtarife
1993 Anerkennung der Osterinsulaner als gleichberechtigtes Volk Chiles; der Dreh des Films „Rapa Nui“ verursacht soziale und ökologische Probleme
1994/95 Ausbau des Straßensystems
30.7.2007 Die Osterinsel erhält des Status eines „Sondergebiets“ der Republik Chile
Aug. 2010 Besetzung des Hanga Roa Eco Village durch Mitglieder des Hitorangi-Clans
2018 Beschränkung des Tourismus
17.3.2020 Sperre der Insel als Covid-Maßnahme
4.8.2022 Beendigung der Inselsperre
Verwaltung
Die am 5. April 1722 von dem Holländer Jacob Roggeveen für Europa „entdeckte“ Insel wurde 1770 von Spanien beansprucht. Von 1868 bis 1876 kontrollierte der französische Abenteurer Dutrou-Bornier das Eiland, ehe es am 9. September 1888 von Chile annektiert wurde. Von 1896 bis 1953 war die Osterinsel Teil der Provinz Valparaiso. Ein Aufstandsversuch im Jahr 1914 scheiterte. Von 1953 bis 1965 verwaltete die chilenische Marine die Insel. Am 1. März 1966 wurde das Departamento Isla de Pascua geschaffen. Aus diesem wurde am 25. Juli 1974 die Provincia Isla de Pascua. Am 30. Juli 2007 erhielt die Osterinsel den Status eines Spezialterritoriums (Territorio Especial de Isla de Pascua).
Gesellschaftspolitische Grundwerte
In der traditionellen Gesellschaft der Osterinsel lag die politische Macht in den Händen der ariki, respektive des ariki-mau. Doch wenn „er auch das höchste zivile Oberhaupt der Miru darstellte, so wurde er von anderen Stämmen doch nur als eine Person von größter Heiligkeit angesehen. Die hohe Achtung, die ihm erwiesen wurde, ersparte ihm nicht das Schicksal eines Gefangenen, als die Miru von ihren Rivalen besiegt wurden. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der König Ngara-ara mehrere Jahre lang der Gefangene der Hotu-iti und wurde gezwungen, in dem Distrikt Nga-ure zu leben.
Die politische Macht scheint in die Hände der Krieger übergagangen zu sein, die eine Aristokratie erfolgreicher Kämpfer bildeten. Die Königswürde wäre zweifellos verschwunden, wenn der König nicht im Besitz des Mana gewesen wäre, das für den Fortbestand der Naturerscheinungen und das Wohlergehen der Insel notwendig“ gewesen wäre (Métraux 1988:80).
Verfassung
Für die Insel gilt die Provinzialverfassung der Republik Chile. Politisch gehört die Osterinsel heute zu Chile. Sie hat den Status eines Departamento der Región de Valparaíso. Das Departamento wird nicht wie die meisten übrigen Departamentos Chiles weiter in Gemeinden untergliedert, sondern entspricht einer Gemeinde. Zu dem Departamento gehört auch die 400 km weiter östlich gelegene winzige Insel Sala y Gomez. Ein bei der chilenischen Regierung akkreditierter Gouverneur verwaltet die Insel. Seit 1984 ist das immer ein Insulaner. Seit 1966 wird alle vier Jahre in der Gemeinde Hanga Roa ein Gemeinderat aus sechs Personen gewählt, einer davon wird zum Bürgermeister ernannt. Auf der Insel sind etwa zwei Dutzend Polizisten stationiert, die auch für die Flughafensicherheit verantwortlich sind. Das chilenische Militär ist insbesondere mit der Marine präsent. Die Marinestation verfügt über ein Patrouillenboot, das auch für die Seenotrettung zuständig ist. Währung ist der Chilenische Peso, der US-Dollar hat sich aber inzwischen zu einer Nebenwährung entwickelt und wird überall akzeptiert. Die Osterinsel ist zollfreies Gebiet, sodass die Einnahmen durch Steuern und Abgaben verhältnismäßig gering sind. Der öffentliche Haushalt wird in hohem Maße von Chile subventioniert.
Herrschaftsgeschichte
- um 300 bis 1902 eigenständige Stammesgebiete mit formalen Oberhäuptlingen
- 1864 bis 1896 lokale Kolonialherrschaft
- 9. September 1888 formale Annexion durch die Republik Chile (República de Chile)
- 15. Juni 1896 bis 9. Februar 1917 Außenterritorium Osterinsel (Subdelegación de la Isle de Pascua) als maritimer Teil des Gouvernorats Valaparaiso der Republik Chile
- 9. Februar 1917 bis 11. November 1933 Maritimes Territorium (Territorio marítimo) von Valparaiso, unterstellt der Marinebehörde der Republik Chile
- 11. November 1933 bis 1. März 1966 Verwaltung durch die Marine der Republik Chile (República de Chile)
- 1.März 1966 bis 8. Juli 1974 Department Osterinsel (Departamento de Isla de Pascua) als Teil der Provinz Valparaiso der Republik Chile
- 8. Juli 1974 bis 30. Juli 2007 Proviz Osterinsel (Provincia de Isle de Pascua) innerh alb der Region Valparaiso der Republik Chile
- seit 30. Juli 2007 Spazielterritorium Osterinsel - Rapa Nui (Territorio Especial de Isla de Pascua - Rapa Nui) innerhalb der Region Valparaiso der Republik Chile
Legislative
Der Insel- bzw.Gemeinderat (Consejo Municipal) bildet das Parlament von Rapa Nui. Die Mitglieder mit Stand 2015 waren:
- Ximena Trengove (PDC)
- Julio Araki (UDI)
- Alberto Hotus (PPD)
- Marta Raquel Hotus (PDC)
- Amelia Olivares (UDI)
- Carlos Mardones (unabhängig)
Inseloberhaupt
Der Legende nach war Hotu Matua der "große Ahnherr" und erste 'Ariki mou (Oberhäuptling bzw. "König") der Insel. ACls Ergänzung dazu entwickelte sich später der Kult des "Vogelmannes", Tangata Manu. Der Sieger eines jährlichen Wettbewerbs, bei dem es darum ging, das erste Ei der Rußseeschwalbe von einer vorgelagerten Insel zu holen, wurde zum obersten Vogelmann und damit zum Repräsentanten seines Clans für das folgende Jahr.
Im späten 19. Jahrhundert übernahmen verschiedene ausländische Akteure die Kontrolle. Missionare wie Eugène Eyraud und Hippolyte Roussel waren zwischen 1864 und 1871 de facto die Herrscher der Insel. Von 1868 bis 1876 errichtete der französische Abenteurer Dutrou-Bornier eine Art Gewaltherrschaft. Mit der Machtübernahme der Chilenen 1877 und de iure im Jahr 1888 wurden "Manager" eingesetzt, die die Vewrwaltung der Insel regelten.
Von 1914 bis 1921 verwaltete ein bei der chilenischen Regierung akkreditierter Gouverneur die Insel. Ab 1984 war dies immer ein Einheimischer. Im Juli 1921 übernahm ein Präsidenzieller Provinzialdelegierter dessen Aufgaben. Wahlen gibt es erst seit 1966. Konkret wird alle vier Jahre ein in Hanga Roa residierender Gemeinderat aus 6 Personen gewählt, einer davon wird zum Bürgermeister ernannt.
Isla de Pascua / Rapanui (Osterinsel):
'Ariki mou (Oberhäuptlinge)
- um 400 Hotu Matu'a
- nach 400 Vakai (seine Frau)
- nach 40 Tu'u ma Heke 'a Hotu Matu'a
- Nuku (Inakura?)
- Miru 'a Tu'u ma Heke (Mirua Tumaheke)
- nach 500 Hata 'a Miru
- Miru 'a Hata
- Hiuariru (Hiu a Miru bzw. Mitiake?)
- Ataranga 'a Miru (Ataraugi)
- Raa
- um 600 Atahega a Miru
- nach 600 Hakapuna?
- Ihu a Aturanga (Oihu?)
- Ruhoi?
- nach 700 Tuu Ka(u)nga te Mamaru
- Takahita
- um 800 Ouaraa
- nach 800 Koroharua
- Mahuta Ariiki
- Atua Ure Rangi (Atua Raranga)
- Atuamata
- nach 900 Uremata
- Te Riri Tuu Kura
- Korua Rongo
- Tiki Te Hatu
- Tiki Tena
- um 1000 Uru Kenu
- nach 1000 Te Rurua Tiki Te Hatu
- Nau Ta Mahiki
- Te Rika Tea
- Te Teratera
- nach 1100 Te Ria Kautahito (Hirakau-Tehito?)
- Ko Te Pu I Te Toki
- Kuratahogo
- Ko Te Hiti Rua Nea
- Te Uruaki Kena (Te Urura Kikena bzw. Urarikena)
- um 1200 Tu Te Rei Manana (Tu Terei Manara)
- nach 1200 Ko Te Kura Tahonga
- Taoraha Kaihahanga
- Tukuma (Tekumakuma)
- Te Kahui Tuhunga
- Te Tuhunga Hanui (Te Tuhunga Nui)
- Te Tuhunga Haroa (Te Tuhunga Roa)
- nach 1400 Te Tuhunga „Mare Kapeau“ (Te Tuhunga Marakapau)
- Toati Rangi Hahe
- Tangaroa Tatarara (möglicherweise Tangaiia auf Mangaia?)
- um 1400 Havini Koro (Havinivini Koro oder Hariui Koro)
- nach 1400 Puna Hako
- Puna Ate Tuu
- Puna Kai Te Vana
- vor 1470 - 1485? Te Riri Katea
- nach 1485 Haumoana, Tarataki und Tupa Ariki (aus Peru)
- nach 1500 Mahaki Tapu Vae Iti (Mahiki Tapuakiti)
- Ngau-ka Te Mahaki (auch Tuu Koiho bzw. Ko-Tuu-ihu?)
- Anakena
- Hanga Rau
- um 1600 Marama Ariki
- nach 1600 Riu Tupa Hotu (Nui Tupa Hotu?)
- Toko Te Rangi (möglicherweise „Gott“ Rongo auf Mangaia?)
- Kao Aroaro (Re Kauu?)
- Mataivi
- Kao Hoto
- nach 1600 Ahu Arihao [alternativ]
- Nui Te Patu
- Hirakau Tehito
- Tupu Itetoki
- Kura Ta Hongo
- Hiti Rua Anea
- Havi Nikoro
- nach 1700 Te Ravarava (Terava Rara)
- Te Hite Huke (Tehitehuke)
- Te Raha'i (Terahai)
- nach 1700 Koroharua [alternativ]
- Te Ririkatea (Riki ka Atea)
- Kai Mako'i
- Te Hetukarakura(Tehetu tara Kura)
- Huero
- Kaimakoi
- um 1750 Te Huke
- um 1770 Tuu (Ko Tuu?)
- um 773 Hotu Iti
- um 1790 Honga
- um 1800 Te Kena
- nach 1800 Te Tite Anga Henua
- 1835 - 1859 Nga'ara
- 1859 - 1862 Maurata († 1862)
- 1862 - 1863 Kai Mako'i iti († 1863)
- 1863 - 1864 Tepito
- 1864 - 1866 Gregorio Rokoroko Hetau († 1866)
- 1868? - 6 Aug 1876 Koreto Puakurunga [w]
- 1869? - 1888? Carolina [w] (Regentin, 1869? - 1888?)
- 1868? - 6 Aug 1876 Jean-Baptiste Onésime Dutrou-Bornier (”Jean I”, 1834 - 1876)
- 1882 - Mar 1892 Atamu Te Kena Maurata (1850 - 1892) - gemeinsam mit -
- 1888? - Mar 1892 Eva Ko Uka ’a Hei ’a ’Arero [w] († 1946)
- 1892 - 1898 Siméon Riroroko (Gregorio bzw. Riro Rokoroko He Tau, 1868 - 1898)
- nach 1892 Rukunga
- um 1898 - um 1900 Enrique Ika a Tu’uhati (nicht anerkannt, um 1859 - nach 1900)
- Jan 1901 - Jul 1902 Moisès Jacob Tu’u Hereveri (um 1873 - 1925)
Religiöse Führer
- 3 Jan - 11 Okt 1864 Eugene Eyraud (1820 - 1868)
- 23 Mar 1866 - 19 Aug 1868 Eugene Eyraud [2]
- 23 Mar 1866 - 6 Jun 1871 Hippolyte Roussel (1824 - 1898)
- 6 Nov 1866 - 9 Mar 1871 Gaspar Zumbohm (1823 - 1887)
- 6 Nov 1866 - 6 Jun 1871 Teodulo Escolán
Administradores
- Apr 1864 - 6 Aug 1876 Jean-Baptiste Onésime Dutrou-Bornier (ab 1871 gobernador)
- Jun 1877 - Nov 1878 Juan Chávez
- Nov 1878 - 1883 Tati Salmon (Alexander Ari’i Paea Salmon, 1855 - 1914)
- 1883 - 1884 Tommi Länder
- 1884 - Dez 1888 Tati Salmon [2]
- 9 Sep 1888 - Sep 1892 Pedro Pablo Toro Hurtado (agente de colonización, 1856 - 1907)
- Sep 1892 - 1894? Charles Higgins
- 1895 - 1896 Alberto Sanchez Manterola (um 1957 - nach 1900)
Agentes de colonzación
- 1896 - 1900 Alberto Sanchez Manterola
- Nov 1900 - 1904 Horace (Horacio) Cooper
- 1905 - 1914 Henry Percy Edmunds (1879 - 1957)
Cazique
- Jul 1902 - 1947? Juan Tepano Rano (1867 - 1947)
Gobernadores (Gouverneure, bis 1966 subdelegado marítimo)
- 1914 - 1917 José Ignacio Vives Solar (1878 - 1930)
- Jun 1917 - 1921 Exequiel Acuña
- 1921 - 1922? Luis Zepeda [interimistisch]
- 1923 - 1925 Exequiel Acuña [2]
- 1926 - 1928 Carlos Recabarren Larrahona (1890 - nach 1930)
- 1928 Carlos Alfredo del Salvador Millan Iriarte [amtierend] (1889 - 1979)
- 1928 – 1930 Carlos Recabarren Larrahona [2]
- 1930 - 12 Feb 1931 Julio Rafael Alberto Cumplido Ducos
- 1931 - Jun 1932 Edgardo Bagolini Cuevas (1886 - 1940)
- Jun - Jul 1932 Guillermo Ernesto Kopaitic O'Neill (subgobernador, 1911 - 1971?)) für Rafael Silva Barboza [nicht im Amt]
- 6 Jul - Okt 1932 Fernando Ugarte Torres (gobernador civil)
- 6 Jul 1932 - 1933 Eduardo Avaios Prado (subgobernador, 1885 - 1919)
- 1933 - 1935 Hernán Cornejo Alemparte
- 1935 - 1936 Manuel Arturo Olalquiaga
- 1937 Hernán Cornejo Alemparte [2]
- 1938 - 1939 Álvaro Gregorio Tejeda Lawrence (1899 - nach 1940)
- 1940 Victor Contreras Figueroa
- 1941 - 1942 Hermann Reid Silva (1888 - 1950)
- 1943 Jorge Señoret Carvallo
- 1944 - 1945 Ricardo Carlos Kompatzki Hornbickel (a.k.a. Contreras, 1913 - 1973)
- Dez 1945 - 1947 Gonzalo Serrano Pellé
- 1948 - 1949 Carlos Pascual Altamirano
- 1950 - 1951 Luis Aceituna Rojas
- 1952 Mario Luis Orellana Lillo
- 1953 - 1954 Carlos Salazar Contreras
- 1955 - 1956 Arnaldo Curti Silva
- 1956 - 1957 Raul Valenzuela Pérez
- 1958 - 1959 Fernando Dorion Nicolet
- 1960 - 1961 Arnt Ernesto Arentsen Pettersen (1907 - 1999)
- 1962 - 1963 John Martin Reynolds
- 1964 - 1965 Jorge Portilla Orego (1929 - 2013)
- 1965 - 1966 Guillermo Rojas Aird
- 15 Aug 1966 - 17 Jul 1967 Enrique Rogers Sotomayor (Zivilgouverneur, 1915 - 1999) PDC
- 17 Jul 1967 - 6 Jun 1968 Alfredo Tuki Pate
- 6 Jun 1968 - Jan 1970 Fernando Silva Molina
- Jan 1970 - 26 Feb 1971 Hernán Rodolfo Perez de Tudela Jimenez († 2018)
- 26 Feb - 30 Apr 1971 Federico Guillerom Blanco Baeza
- 30 Apr - 13 Mai 1971 Caupolicán Valenzuela Torres
- 13 Mai 1971 - 3 Mar 1972 Abel Galleguillos Araya (1925? - 2012)
- 3 Mar 1972 - 13 Sep 1973 Moisés Sudy Castro
- 13 - 25 Sep 1973 Carlos Francisco José Bastias Alvarado
- 25 Sep 1973 - 3 Aug 1974 Omar Jorge Fuenzalida Tobar (* 1931)
- 3 Aug 1974 - 23 Feb 1975 Giuseppe Giorgio Arru Dominguez
- 23 Feb 1975 - 16 Feb 1979 Arnt Ernesto Arentsen Pettersen [2]
- 16 Feb 1979 - 27 Jan 1984 Ariel Gonzalez Cornejo
- 27 Jan 1984 - 11 Mar 1990 Sergio Alejo Rapu Haoa
- 11 Mar 1990 - 1 Sep 2000 Jacobo Urbano Hey Paoa
- 1 Sep 2000 - 11 Mar 2006 Enrique Manuel Pakarati Ika
- 11 Mar 2006 - 18 Mar 2010 Melania Catalina Hotu Hey [w] (* 1959) PDC
- 18 Mar - 9 Aug 2010 Pedro Üablo "Petero" Edmunds Paca (* 1961) PDC
- 9 Aug - 6 Sep 2010 Jorge Fernando Miranda Pacheco [interimistisch]
- 6 Sep 2010 - 11 Mar 2014 Carmen Cardinali Paca [w] (* 1944) PDC
- 11 Mar 2014 - 8 Sep 2015 Marta Raquel Hotus Tuki [w] (* 1969) PDC
- 9 Sep 2015 - 11 Mar 2018 Melania Catalina Hotu Hey [w, 2] PDC
- 11 Mar 2018 - 22 Mai 2021 Laura Tarita Alarcón Rapu [w] (* 1977)
- 22 Mar - 29 Apr 2021 Felipe Elias Cereijo Ceballos [amtierend] RN
- 29 Apr - 14 Jul 2021 René Alberto de la Puente Hey
Delegados Provinciales Presidenciales, Isla de Pascua
- 14 Jul - 1 Nov 2021 René de la Puente Hey
- 1 Nov 2021 - 11 Mar 2022 Mai Teao Osorio
- 11 Mar 2022 - 2 Dez 2023 Juliette Margot del Carmen Hotus Paoa [w]
- seit 2 Dez 2023 Sergio Tepano Cuevas
Alcaldes (Bürgermeister)
| Alcalde | Amtsbeginn | Amtsende | Partei |
| Alfonso Rapu Haoa | 1966 | 17 Mar 1968 | Partido Radical |
| Miguel Teao Riroroko | 17 Mar 1968 | 23 Mai 1971 | Partido Demócrata Cristiano |
| Rafael Tuki Tepihi | 23 Mai 1971 | 1972 | Partido Socialista |
| Ricardo Tuki Hereveri | 1972 | 1973 | |
| Juan Edmunds Rapahango | 22 Okt 1973 | 19 Apr 1979 | Independiente |
| Samuel Cardinali | 19 Apr 1979 | 5 Nov 1985 | Independiente |
| Lucia Tucki Macke | 5 Nov 1985 | 10 Apr 1990 | Independiente |
| Juan Edmunds Rapahango | 10 Apr 1990 | 26 Sep 1992 | Independiente |
| Alberto Hotus Chávez | 26 Sep 1992 | 11 Okt 1994 | Partido por la Democracia |
| Pedro Edmunds Paoa | 11 Okt 1994 | 6 Dez 2008 | Unión de Centro Centro / Partido Demócrata Cristiano |
| Luz Zasso Paoa | 6 Dez 2008 | 6 Dez 2012 | Partido Demócrata Cristiano |
| Pedro Edmunds Paoa | 6 Dez 2012 | 6 Dez 2024 | Partido Progresista |
| Elizabeth Arévalo Pakarati | 6 Dez 2024 | Independiente |
Regierung
Die Insel hat einen direkt gewählten Bürgermeister und einen sechsköpfigen Gemeinderat (Consejo municipal). Der langjährige Bürgermeister Petero Edmunds ist eine prägende Figur. Die Einwohner können an nationalen Wahlen in Chile teilnehmen und wählen Vertreter für den Regionalrat von Valparaíso sowie für die indigene Entwicklungsbehörde CONADI.
Oberste indigene Institution ist der Ältestenrat (Consejo de Ancianos): Ursprünglich eine traditionelle Institution, die Vertreter der 36 einheimischen Familien (Hua'ai) umfasst. In den 1990er Jahren spaltete sich der Rat in zwei Fraktionen: Eine Fraktion kooperiert mit dem chilenischen System und wurde offiziell anerkannt. Die andere Fraktion entwickelte sich zum Rapanui-Parlament.
Letzteres versteht sich als Schattenregierung und vertritt die Interessen derjenigen, die eine vollständige Unabhängigkeit von Chile anstreben. Sie fordert die Rückgabe des Landes, Dekolonisierung und Selbstbestimmung. Das Parlament hat internationale Kontakte geknüpft, unter anderem Beobachterstatus bei der Polynesian Leaders Group, wird jedoch von Chile nicht offiziell anerkannt.
Auf der Insel sind etwa zwei Dutzend Polizisten stationiert, die auch für die Flughafensicherheit verantwortlich sind. Die Osterinsel ist zollfreies Gebiet, sodass die Einnahmen durch Steuern und Abgaben verhältnismäßig gering sind. Der öffentliche Haushalt wird in hohem Maße von der chilenischen Zentralregierung subventioniert.
Politische Gruppierungen und Wahlen
Wahlen finden auf Rapa Nui seit 1966 statt. Der Gemeinderat wird seither im Vierjahreszyklus neu besetzt. Als chilenische Bürger können die Wähler auf Rapa Nui als Teil des Wahlkreises Valparaiso auch an chilenischen Präsidentschafts- und Kongresswahlen teilnehmen sowie außerdem auch an den Wahlen zum Regionalrat von Valparaíso, in dem die Provinz Rapa Nui zwei Vertreter hat. Zu den auf der Insel aktivenb Parteien gehören:
- Partido Demócratica Cristiano de Chile (PDC), christdemokratisch
- Partido por la Democracia (PPD), linkssozialistisch
- Partido Socialista de Chile (PSC), sozialdemokratisch
- Renovación Nacional (RN), moderat rechts
- Unión Demócratica Independiente (UDI), rechtskonservativ
Politische Spaltungen bestehen zwischen jenen, die mit Chile zusammenarbeiten wollen, und jenen, die massive Veränderungen oder Unabhängigkeit fordern. Zusätzlich gibt es Spannungen durch die zunehmende Einwanderung von Chilenen auf die Insel, was Bedenken über den Verlust kultureller Identität und politischer Kontrolle hervorruft. Bezüglich des Inselstatus gibt es moderate Kräfte um den Bürgermeister Petero Edmunds, die für einen Autonomiestatus innerhalb Chiles eintreten. Dem Gegenüber stehen die Befürworter einer vollständigen Unabhängigkeit der Insel..
Gerichtswesen
Die Rapa Nui-Gesellschaft war ursprünglich von einer strengen Hierarchie geprägt, an deren Spitze die Ariki (Stammesführer) standen. Diese legitimierten ihre Macht durch lange, ununterbrochene Ahnenreihen. Die Autorität der Ariki war absolut und umfassend und wurde nicht in Frage gestellt. Dies deutet darauf hin, dass Streitigkeiten und Rechtsprechung wahrscheinlich durch diese Führungspersonen geregelt wurden.
Mit der Ankunft der Europäer im 19. Jahrhundert wurde die traditionelle Gesellschaftsstruktur der Rapa Nui stark erschüttert. 1862 wurden etwa 1700 Rapa Nui, darunter die gesamte Führungsschicht, als Sklaven nach Peru verschleppt, was die soziale Struktur der Insel zerstörte. In den 1870er Jahren errichtete der französische Siedler Dutrou-Bornier eine Art Schreckensherrschaft auf der Insel, bei der die Rapa Nui aus ihren Siedlungen vertrieben und in ein kleines Gebiet verbannt wurden. 1888 wurde die Osterinsel von Chile annektiert, was zur Einführung des chilenischen Rechtssystems führte. Heute untersteht die Osterinsel als Teil Chiles dem chilenischen Rechtssystem. Auf der Insel getroffene Entscheidungen müssen vom Obersten Gerichtshof Chiles abgesegnet werden.
Streitkräfte
Das chilenische Militär ist mit einer Marine-Einheit auf der Insel präsent. Diese verfügt über ein Patrouillenboot, das auch für die Seenotrettung zuständig ist. Dazu kommt eine eine kleine einheimische Polizeitruppe, die in den letzten Jahren in Zusammenhang mit dem Kampf gegen aufmüpfige Inselbewohner durch festländische Einheiten verstärkt wurde. Diese kamen unter anderem im Dezember 2010 zum Einsatz, als mit Gummigeschossen und Tränengas gegen Demonstranten vorgingen. Etwa 20 Personen wurden dabei verletzt und kamen ins Krankenhaus. Zahlreiche weitere wurden inhaftiert (ein Bericht darüber findet sich in Geo = https://www.geo.de/magazine/geo-magazin/15373-rtkl-osterinsel-im-schatten-der-moai, ein anderer in Die Zeit vom 7.12.2010 = https://www.survivalinternational.de/nachrichten/6739).
Unruhen gibt es seither immer wieder. Die Polizei besetzte wiederholt Gebäude und öffentliche Einrichtungen gewaltsam geräumt, was zu Kritik und Besorgnis geführt hat. Der UN-Sonderbotschafter für die Rechte indigener Völker, James Anaya, verurteilte die chilenischen Behörden wegen des brutalen Polizeieinsatzes gegen die Einheimischen. Im Juli 2023 wurden bei einem weiteren Polizeieinsatz mindestens 25 Personen verletzt, als die Polizei indigene Demonstranten aus besetzten Gebäuden räumte. Die Behörden gaben an, dass 17 Polizeibeamte und 8 Zivilisten verletzt wurden, während lokale Zeugen von 19 verletzten Zivilisten und keinen verletzten Polizisten sprachen (survival international berichtete darüber https://www.survivalinternational.de/nachrichten/6739).
Internationale Beziehungen
Archäologische Studien zeigen, dass die Rapa Nui bereits vor der Ankunft der Europäer Kontakt mit indigenen Völkern Amerikas hatten. Dies deutet auf frühe transozeanische Verbindungen hin, die durch DNA-Analysen bestätigt wurden. In den 1990er Jahren suchten Unabhängigkeitsaktivisten Kontakte zu anderen pazifischen Nationen und Organisationen wie PIANGO (Pacific Islands Association of Non-Government Organisations), um Unterstützung für ihre Anliegen zu gewinnen. Für Chile bildet die Insel das "Tor zur pazifischen Welt".
Flagge und Wappen
Die Flagge der Osterinsel (Te Reva Reimiro bzw. Te Reva Rapa Nui) besteht aus einer weißen Fahne mit einem roten Reimiro. Sie wurde erstmals am 9. Mai 2006 zusammen mit der Nationalflagge in der Öffentlichkeit gehisst. Es handelt sich um eine weiße Fahne, die in der Mitte einen Reimiro (ein hölzerner Brustschmuck, der einst von den Bewohnern von Rapa Nui getragen wurde) in Rot (Mana), einem Symbol der Macht, mit zwei anthropomorphen Figuren an den Rändern zeigt, die die Ariki (Adlige) darstellen. Eine Variante zeichnet sich durch vier schwarze Tangata manu (Vogelmenschen) an jeder Ecke der Flagge aus.
Die Flagge wurde 1880 von der einheimischen Bevölkerung geschaffen, damit die Insel den Apparat eines modernen Staates annehmen und einen Dialog zwischen den Staaten mit Chile führen konnte, das die Insel schließlich 1888 annektierte. Viele Jahre lang wurde die Flagge von der polynesischen Bevölkerung der Insel inoffiziell verwendet, um ihre Insel zu repräsentieren, doch die offizielle Flagge war die weiß-goldene Flagge der Gemeinde der Osterinsel. Im Jahr 2006 wurde die Insel zu einem Sonderterritorium aufgewertet, und die Verwendung des Namens Rapa Nui in Regierungsdokumenten wurde zum ersten Mal gestattet, wobei die Reimiro-Flagge als Flagge der Entität angenommen wurde (nach Cornejo/Hotu 2011, Crouch 2014 und https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Easter_Island.). Die Flagge wird bei offiziellen Anläßen neben der Flagge Chiles verwendet. Daneben existiert eine Flagge der einzigen Gemeinde auf der Insel Isla de Pascua. Sie zeigt ein goldenes Emblem auf weißem Grund.
Das Wappen der Osterinsel, auch bekannt als Emblem von Rapa Nui (Emblema de Rapa Nui), ist eine paraheraldische Figur namens Manu Piri, was auf Rapanui "Vereinigung der Vögel" bedeutet. Es zeigt zwei vogelartige Wesen oder Mischwesen aus Mensch und Vogel, die als Manutara oder Tangata manu bezeichnet werden. Diese Figuren sind inspiriert von indigenen Statuen und alten Abbildungen auf der Insel, wie Felsbildern oder den Rongorongo-Schrifttafeln. Das Emblem wurde von der Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua (Gemeindeverwaltung der Osterinsel) ausgewählt und ist in silber-goldenen Farben gehalten. Die genaue Einführungszeit ist unbekannt1. Die Symbolik des Motivs Manu Piri wird oft als Vereinigung zwischen zwei Menschen interpretiert, obwohl die ursprüngliche Bedeutung nicht vollständig geklärt ist.
Nationale Symbole:
- Farbe: rot
- Pflanze: Tiare Tahiti (Gardenia tahitensis)
- Baum: Toromiro (Sophoro toromiro)
- Tier: Manutara (Rußseeschwalbe, Onychoprion fuscatus): signalisiert mit seiner Ankunft den Beginn des Frühlings und somit einer Zeit des Überflusses
- Motto (inoffiziell): „He hanga te Atu‘a he pakea te ma‘eha ote mori nei ite he nua ta‘atoa“ („Möge Gott die Klarheit des lebenswichtigen Lichts auf alle Völker erweitern“)
- Held: Hotu Matu‘a (Begründer der Inselgemeinschaft, um 400)
- Lokaler Feiertag: 9. September (zur Erinnerung an die formale Annexion durch Chile 1888)
Hymne
Die Hymne der Osterinsel trägt den Titel I hē a Hotu Matu‘a. Sie wird oft nach der chilenischen Nationalhymne vor der chilenischen und der Rapa Nui-Flagge gesungen (im Folgenden der Text samt Erläuterung nach https://www.easterisland.travel/easter-island-facts-and-info/i-he-a-hotu-matua-e-hura-nei/)
| Text | Übersetzung | Bedeutung |
| ¡E 'Ira e Rapareŋa ē! | Oh 'Ira und Rapareŋa! | zwei der sieben Entdecker, die ausgesandt wurden, um Rapa Nui auszukundschaften. |
| Ka kimi te ma'ara o te 'ariki | Geh und such das Haus des Königs
Kinder, die aus dem Wasser des Te Ta'aŋa aufsteigen |
Haumaka beauftragt 'Ira, Rapareŋa, 'U'ura 'a Huatava, Riŋi-Riŋi 'a Huatava, Nonoma 'a Huatava, Ku'u-Ku'u 'a Huatava und Mako'i Riŋi-Riŋi 'a Huatava (die die so genannten sieben Entdecker ausmachen), eine neue Heimat für König Hotu Matu'a und ihr Volk zu suchen. |
| Ko ŋā kope tu-tu'u vai 'a Te Ta'aŋa | Als Haumakas Geist im Schlaf die Inselchen Motu Nui, Motu 'Iti und Motu Kao-Kao sieht, erinnert er sich an die drei Kinder seines Sohnes Te Ta'aŋa. Er gibt den Inseln den Namen „Kinder, die aus dem Wasser steigen, von Te Ta'aŋa, von Haumaka aus Hiva“. Dieser Teil des Liedes bedeutet, dass die sieben Entdecker die drei Inselchen und Rapa Nui erreicht haben. | |
| a Haumaka o Hiva | von Haumaka aus Hiva | |
| ¿I hē a Hotu Matu'a e hura nei? | Wo wohnt Hotu Matu'a? | Hotu Matu'a und sein Volk haben sich in ihrem neuen Land niedergelassen; dem Land, das Haumaka gefunden hat. Te Pito o te Henua ist ein anderer Name für Rapa Nui und bedeutet Der Nabel der Welt. |
| I Te Pito o te Henua e hura nei | Er lebt im Nabelö der Welt | |
| I Te Pito o te Henua e hura nei | ||
| a Haumaka o Hiva | Von Haumaka aus Hiva | |
| ¡E Kuihi e Kuaha vārua ē! | Oh, ihr Geister Kuihi und Kuaha! | Als König Hotu Matu'a im Sterben liegt, ruft er seine letzten Worte zum Heimatland Hiva. Er bittet die Geister Kuihi und Kuaha, ihm mit der Stimme eines Hahns etwas vorzusingen. |
| Ka haka o'oa 'iti-'iti mai koe | Singt etwas f ür mich! | |
| i te re'o o te moa o Ariana | durch die Stimme des Hahns von Ariana | |
| O'oa take heu-heu | Singt und nnehmt Heu-heu | Der Legende nach stirbt der König, kurz nachdem Arianas Hahn antwortet: „Take heu-heu“. Die Bedeutung dieser Worte ist heute vergessen. Wahrscheinlich aus diesem Grund wird das Lied heute oft mit O'oa e te 'ariki ē beendet. Die Übersetzung dieses neuen Endes wäre Sing Oh, king!, was bedeutet, dass der Hahn Oh, king! singt, weil der König verstorben ist. |
Hauptort
Hauptort der Osterinsel ist seit 1888 Hanga Roa, die größte Ortschaft des Eilands.
Verwaltungsgliederung
Die Provinz Osterinsel (spanisch Provincia de Isla de Pascua) ist eine von acht Provinzen der chilenischen Región de Valparaíso. Sie ist die einzige Provinz Chiles, die in Polynesien liegt, und zusammen mit der Chilenischen Antarktis die einzige außerhalb Südamerikas. Die Provinz wird nicht wie die meisten übrigen Departamentos Chiles weiter in Gemeinden untergliedert, sondern entspricht einer Gemeinde. Zur Provinz und Gemeinde gehören neben der Osterinsel auch fünf kleine unbewohnte Nebeninseln: Motu Iti, Motu Kau Kau und Motu Nui im Südwesten, Motu Tautara und Motu Ko Hepoko im Westen und Motu Marotiri im Süden der Nordosthalbinsel Poike. Ebenso gehört die 400 km weiter östlich gelegene Doppelinsel Sala y Gómez dazu.
Verwaltungsgliederung:
1 isla (Hauptinsel)
5 motu (Nebeninseln)
1 isla exterior (Außeninsel)
Bevölkerung
Rapa Nui hat ein sehr labiles ökologisches Gleichgewicht. Die Zahl der Menschen, die hier, ohne Schaden anzurichten, leben können, ist begrenzt. Die aus der Überbevölkerung resultierenden Probleme haben im 17. Jahrhundert die sozialen Konflikte so massiv verschärft, dass die Osterinselkultur dadurch in den Niedergang getrieben wurde und beinahe zerbrochen wäre.
Die früheste Besiedlung irgendwann zwischen 300 und 500 brachte nur wenige Menschen, vielleicht 20 oder 30 (Ponting 1992:168), auf das abgelegene Eiland. Bis ins 9. Jahrhundert hinein dürfte die Bevölkerungszahl die Hundertergrenze kaum überschritten haben. Erst danach ist eine größere Einwohnerzunahme festzustellen, und mit dem Zuzug neuer Siedler aus Polynesien, möglicherweise auch aus Südamerika, nach 1100 stieg die Zahl der Menschen auf mehrere Tausend. Zur Siedlungs- und Ackerlandgewinnung wurden damals erste größere Rodungsarbeiten durchgeführt. Nach und nach stieg die Bevölkerungszahl auf weit über 5000, möglicherweise sogar über 10 000. Zur Hoch-Zeit der Osterinselkultur um die Mitte des 17. Jahrhunderts haben rund 9 000 Menschen auf Rapa Nui gelebt, aber es könnten auch bis zu 17 000 gewesen sein.
Zur Frühzeit der Kontakte mit den Europäern schwankte die Bevölkerungszahl um die 1000. Menschenraubzüge peruanischer Sklavenhändler führten ab 1858 zu einer starken Dezimierung. 1863 lebten nur noch knapp 500 Menschen auf der Insel. Nach einer kurzen Erholungsphase kam es mehrmals zu Seuchen und ab 1871 zur Emigrierung christianisierter Osterinsulaner. Die Bevölkerungszahl sank daraufhin neuerlich stark ab. 1877 wurden wiederum nur noch 111 Menschen auf Rapa Nui gezählt. Die erste Volkserhebung aus dem Jahr 1883 ergab dann 157 Seelen. Von da an wuchs die Einwohnerzahl wieder langsam und beständig. Neben eigenem Nachwuchs kamen in diesem Zusammenhang auch Polynesier von anderen Inseln hierher. 1957 wurde nach fast hundert Jahren wieder die Tausendergrenze erreicht, 1982 waren es 1.936. Der Zählung aus dem Jahr 1995 zufolge lebten damals 2.893 Menschen auf Rapa Nui.
Bis 2002 stieg die Zahl der Bewohner Rapa Nuis auf 3.791. Die erhebliche Zunahme innerhalb weniger Jahre beruht hauptsächlich auf der Zuwanderung vom chilenischen Festland. Die Folge davon ist, dass sich die demografiusche Zusammensetzung der Bevölkerung zu Lasten der polynesischen Ureinwohner, der Rapanui, verändert. 1982 waren 70 Prozent der Einwohner Rapanui, im Jahre 2002 betrug ihr Anteil nur noch 60 Prozent. 39 Prozent waren europäischen Typs - vorwiegend zeitweilige Residenten, wie Verwaltungsbeamte, Militärpersonal, Wissenschaftler und deren Angehörige - und 1 Prozent sonstige.
Die Bevölkerungsdichte auf der Osterinsel beträgt nur 23 Einwohner pro qkm (zum Vergleich Deutschland 230, Schweiz 181). Mitte des 19. Jahrhunderts gab es noch sechs Siedlungen (Anakena, Tongariki, Vaihu, Vinapu, Mataveri und Hanga Roa) auf der Osterinsel. Heute konzentrieren sich die Bewohner auf die Dörfer Hanga Roa, Mataveri und Moeroa im Südwesten, die allerdings so zusammengewachsen sind, dass sie allgemein als eine Siedlung angesehen werden.
Zu den auf der Osterinsel verbliebenen Rapanui kommen noch jene, die im 19. Jahrhundert nach Südamerika fortgeschleppt wurden oder nach Französisch-Polynesien ausgewandert sind - insgesamt mehr als 2500 Menschen - sowie deren Nachkommen und moderne Emigranten. In den letzten Jahrzehnten gab es aber nicht nur Zuwanderungen. Einwohner der Osterinsel sind auch zum Festland emigriert. 1998 betrug die Zahl jener, die sich außerhalb Rapa Nuis zu ihrer osterinsularen Herkunft bekannten, rund 2100. Etwa 1700 davon lebten in Chile, 300 auf Tahiti, anderen Gesellschaftsinseln oder einzelnen Tuamotu-Atollen, 50 in den Vereinigten Staaten, 25 bis 30 in Neuseeland und 20 in Europa. Die Gesamtzahl der Osterinsulaner betrug also zur Jahrtausendwende annähernd 4000. Bei der Volkszählung 2002 wurde festgestellt, dass 2.269 Rapanui in Chile außerhalb der Osterinsel lebten. Die Gesamtzahl der Rapanui beträgt demnach bereits deutlich mehr als 5000. Im Folgenden die Entwicklung der Bevölkerungszahl samt Dichte, bezogen auf die Inselfläche von 162,9 km².
Bevölkerungsentwicklung:
Jahr Einwohner Dichte (E/km²)
1100 3 000 18,42
1200 4 000 24,55
1300 4 500 27,62
1400 7 000 42,97
1500 8 000 49,11
1600 8 500 52,18
1680 9 000 55,25
1770 1 000 6,14
1774 750 4,60
1786 1 000 6,14
1804 1 500 9,21
1825 1 600 9,82
1862 2 400 14,73
1866 550 3,38
1868 915 5,62
1870 615 3,78
1871 280 1,72
1877 111 0,68
1883 157 0,96
1886 168 1,03
1888 193 1,18
1900 227 1,39
1911 228 1,40
1917 295 1,81
1922 311 1,91
1934 396 2,43
1935 456 2,80
1936 494 3,03
1946 651 4,00
1947 721 4,43
1949 780 4,79
1950 800 4,91
1951 830 5,10
1952 850 5,32
1953 870 5,54
1954 895 5,49
1955 950 5,83
1956 1 000 6,14
1957 1 025 6,29
1958 1 053 6,46
1959 1 100 6,75
1960 1 155 7,09
1961 1 160 7,12
1962 1 170 7,18
1963 1 160 7,12
1964 1 150 7,06
1965 1 146 7,03
1966 1 200 7,37
1967 1 300 7,98
1968 1 400 8,60
1969 1 500 9,21
1970 1 599 9,82
1971 1 750 10,74
1972 1 866 11,45
1973 1 870 11,48
1974 1 875 11,51
1975 1 880 11,55
1976 1 885 11,57
1977 1 890 11,60
1978 1 900 11,66
1979 1 910 11,72
1980 1 920 11,78
1981 1 930 11,84
1982 1 936 11,88
1983 2 000 12,28
1984 2 100 12,89
1985 2 200 13,51
1986 2 256 13,85
1987 2 500 15,35
1988 2 733 16,78
1989 2 740 16,82
1990 2 750 16,88
1991 2 750 16,88
1992 2 764 16,97
1993 2 774 17,03
1994 2 820 17,31
1995 2 893 17,76
1996 2 980 18,29
1997 3 100 19,03
1998 3 250 19,95
1999 3 350 20,57
2000 3 500 21,49
2001 3 640 22,34
2002 3 791 23,27
2003 3 790 23,26
2004 3 780 23,20
2005 3 790 23,26
2006 4 210 25,84
2007 4 480 27,50
2008 4 752 29,17
2009 4 800 29,47
2010 5 097 31,29
2011 5 035 30,91
2012 5 806 35,64
2013 5 761 35,36
2014 6 050 37,14
2015 6 370 39,10
2016 6 900 42,36
2017 7 322 44,95
2018 7 750 47,58
2019 8 100 50,34
2020 8 277 50,81
2021 8 445 51,84
2022 8 601 52,80
2023 8 743 53,67
2024 8 236 50,56
Die Bevölkerung wuchs von 1981 bis 2001 um durchschnittlich 4,43 % pro Jahr. Die Fruchtbarkeitsrate lag 2008 bei rund 2,5 Kindern pro gebärfähiger Frau, das Durchschnittsalter bei etwa 30 Jahren. Die mittlere Lebenserwartung liegt bei etwa 75 Jahren. Die Zahl der Haushalte beträgt insgesamt rund 1800.
Haushalte: 1992 2002
Gesamtzahl 1065 1515
Personen pro Haushalt 2,6 2,5
Regionale Verteilung
Die Bevölkerung konzentriert sich auf den Westen der Insel, wo sich auch der Hauptort Hanga Roa berfindet.
Volksgruppen
Man schätzt, dass die Osterinsel zur Zeit der Kulturblüte im 16. und 17. Jahrhundert etwa 10.000 Einwohner hatte. Als Folge der vom Menschen ausgelösten ökologischen Katastrophe, der Nahrungsknappheit und kriegerischer Auseinandersetzungen reduzierte sich diese Zahl auf etwa 2000 bis 3000 vor Ankunft der Europäer. Die Deportation als Zwangsarbeiter nach Peru verringerte die Einwohnerzahl auf etwa 900 im Jahre 1868 und die von den wenigen Rückkehrern eingeschleppten Krankheiten führten zu einem weiteren Bevölkerungsrückgang.
Die Ausbeutung der Insel durch die intensive Schafzucht eines europäischen Konsortiums hatte ein Zurückdrängen der Einwohner auf ein Siedlungsgebiet mit geringer Ausdehnung im Nordwesten der Insel zur Folge. Dieser Interessenkonflikt führte dazu, dass 168 Bewohner im Jahr 1871 mit Hilfe von Missionaren auswanderten. 1877 betrug die Einwohnerzahl nur noch 111. Danach erholte sich die Bevölkerung langsam. 1888, im Jahr der Annexion durch Chile, wurden 178 Einwohner gezählt.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es – insbesondere unter der jungen Bevölkerung – den verbreiteten Wunsch, die Insel zu verlassen. Entsprechende Bestrebungen wurden jedoch von der chilenischen Militärverwaltung unterbunden. Erst in den 1950er Jahren besserten sich die Lebensumstände und auch die Einwohnerzahl nahm zu. 1960 wurden bereits über 1.000 Einwohner gezählt.
Nach einer Zählung aus dem Jahr 2002 lebten zum damaligen Zeitpunkt 3.791 Menschen auf der Insel. 1988 waren es lediglich 1.938 gewesen. Die erhebliche Zunahme innerhalb weniger Jahre beruht hauptsächlich auf der Zuwanderung vom chilenischen Festland. Die Folge davon ist, dass sich die demografische Zusammensetzung der Bevölkerung zu Lasten der polynesischen Ureinwohner, der Rapanui, verändert. 1982 waren 70 Prozent der Einwohner Rapanui, im Jahre 2002 betrug ihr Anteil nur noch 60 Prozent. 39 Prozent waren europäischen Typs (vorwiegend zeitweilige Residenten, wie Verwaltungsbeamte, Militärpersonal, Wissenschaftler und deren Angehörige) und 1 Prozent sonstige.
In den letzten Jahrzehnten gab es aber nicht nur Zuwanderungen. Einwohner der Osterinsel sind auch zum Festland emigriert. Bei der Volkszählung 2002 wurde festgestellt, dass 2.269 Rapanui außerhalb der Osterinsel in Chile lebten.
Wann die ersten Menschen auf die Osterinsel kamen, ist ebenso umstritten wie die Frage, von wo aus sie sich hierher auf den Weg machten. Die Mehrzahl der Indizien deutet auf Polynesien als Urheimat der Rapanui. Südamerikanische Einschläge sind zwar mit dabei, aber der Kernschlag dieser Menschen und letztlich auch ihre Sprache sind zweifelsfrei polynesisch. Und diese Zuordnung betrifft sowohl die Erstankömmlinge als auch die nach der Landnahme durch den legendären Rapa-Häuptling Hotu Matua auf die Insel gekommenen Neusiedler. Zuzüge aus Südamerika bilden bei alledem lediglich eine Randerscheinung.
Früheste menschliche Zeugnisse auf der Osterinsel reichen bis ins 5., vielleicht sogar 4. Jahrhundert zurück. Dies bedeutet, dass irgendwann zwischen 300 und 500 erstmals Menschen hier eintrafen. Ihr Herkunftsland waren vermutlich die 4000 km entfernten Marquesas-Inseln. Im Zuge einer großräumlichen Erschließung Rapa Nuis ist aber auch für die früheste Zeit menschlicher Besiedlung der Insel bereits ein Zuzug aus Südamerika nicht ausgeschlossen. Die Bevölkerungszahl war zunächst noch recht dürftig. Erst ab etwa 850 ist eine Zunahme der archäologischen Funde zu beobachten.
Der nächste größere Siedlerstrom kam um 1100 auf die Insel. Von wo, ist auch diesmal unklar. Peru oder die polynesischen Tuamotu-Inseln - vielleicht auch beide - werden als mögliche Herkunftsländer der zweiten Zuzüglerwelle angenommen. Gewagtere Hypothesen lassen auch weiter Gereiste - Europäer oder gar Sternabkömmlinge - auf die Osterinsel triften. „Eingeweihte“ weißer Rasse sollen es gewesen sein, die hier Frieden zu finden hofften (Prachan 1991:207-210). Aber die Annahmen einer solchen Immigration stehen auf so schwachem faktischem Fundament, dass das Gebäude drumherum so glatt im Ozean zu versinken droht wie dereinst angeblich der Kontinent Mu. Unbestritten ist indes, dass um 1350 der letzte größere Menchennachschub die Osterinsel erreichte. Diesmal war es „König“ Hotu Matua, der sich hier, von der Tuamotu-Insel Rapa kommend, mit 200 ausgewählten Siedlern niederließ.
Mit der „Entdeckung“ durch europäische Seefahrer zu Ostern 1722 begann eine neue Ära für das mittlerweile kulturell darniederliegende Rapa Nui. Ab 1805 wurden immer wieder Insulaner zu Sklavendiensten auf südamerikanischen Plantagen verschleppt - 1858/59 waren es insgesamt rund 500, 1862/63 gar über 3000 Rapanui, die in Peru zum Kauf angeboten wurden. Umgekehrt hinterließen Europäer ihre Spuren im indigenen Umfeld. 1870 emigrierten 415 Osterinsulaner nach Tahiti und Mangareva, während Rapa Nui selbst im Jahr 1877 mit 111 Einwohnern die niedrigste je offiziell registrierte Bevölkerungszahl verzeichnete. Das 20. Jahrhundert brachte dann immer mehr Fremde - vor allem aus anderen Teilen Polynesiens sowie aus Chile - ins Land, sodass heute von „Reinrassigkeit“ eigentlich nicht mehr gesprochen werden kann. 1934 wurden auf Rapa Nui offiziell statistisch 159 originale Osterinsulaner und 237 Polynesier anderer Herkunft gezählt.
Die ethnologische Wissenschaft ordnet die Rapanui als Subgruppe der östlichen Polynesier in die ozeanische Völkerfamilie ein. Versuche, sie südamerikanisch zu verankern, scheitern sowohl an der Sprache als auch am Aussehen. Damit erhält das auf die Tuamotu-Inseln hin ausgerichtete mythische Abstammungsverständnis der Rapanui seine akademische Absegnung.
Trotz der Abgelegenheit der Insel gab es aber sicherlich immer wieder Austausch mit anderen Regionen, und zwar sowohl was Handels- als auch was menschliche Beziehungen betrifft. Neben Tuamotu sind hier vor allem die Marquesas-Inseln zu nennen und wohl auch Peru. Im 19. Jahrhundert entwickelten sich zunächst enge Beziehungen zum polynesischen Kernland, später, nach der Annexion durch Chile im Jahre 1888, auch zum neuen südamerikanischen Mutterland. Heute ist die Osterinsel im internationalen Weltgeschehen fest verankert und als exklusives Touristenziel großen Veränderungen ausgesetzt, die auch die alten ethnischen und kulturellen Gegebenheiten betreffen.
Bereits in früher Zeit scheint es auf Rapa Nui verschiedene ethnische Gruppierungen gegeben zu haben. Nach der Ankunft der Gruppe um Hotu Matua im 14. Jahrhundert entstand eine Art Zweiklassengesellschaft mit den „Hanau Eepe“ (Langohren) als überordneter und den „Hanau Mimiko“ (Kurzohren) als unterer Schicht. Die beiden Gruppen waren möglicherweise unterschiedlicher Herkunft - erstere mit markant polynesischen, letztere mit weniger eindeutig fixierbaren Zügen. Die Beziehungen und letzthin Auseinandersetzungen zwischen den Lang- und Kurzohren prägte bis ins frühe 18. Jahrhundert hinein das Leben auf der Osterinsel. Nach der europäischen „Entdeckung“ verwischten sich die Unterschiede allmählich. Neuere polynesische Zuwanderung führte im 20. Jahrhundert zu einer - allerdings rein formalen - Teilung der Inselgesellschaft in originäre und immigrierte Rapanui. Zu diesen beiden kommen als dritte moderne Gruppe die kulturelle außenstehenden chilenischen Osterinsulaner.
Der Gegensatz zwischen Lang- und Kurzohren hat in Mythen ebenso seinen Niederschlag gefunden wie in mehr oder weniger spekulativer wissenschaftlicher Literatur. Thor Heyerdahl etwa deutete Langohrigkeit als Fortsetzung südamerikanischer Ohrläppchendehn-Traditionen und sah von daher in den Kurzohren eine Art polynesischstämmiger Arbeiterklasse. Die Aufteilung der Osterinsel-Gesellschaft in diese beiden Gruppen jedenfalls war ein bestimmendes Element der alten Rapanui-Kultur, trug letztlich aber auch zu ihrem Niedergang bei. Im Gegensatz dazu ist es durch neuere polynesische Einwanderungsströme zu keiner Spaltung der Gesellschaft gekommen. Erst der Zuzug chilenischen Verwaltungspersonals ab 1965 hat eine neue, fremdethnische politische Oberschicht geschaffen.
Sprachen
Offizielle Landessprachen sind Spanisch und Rapanui, die polynesische Ursprache der Insel, die heute von rund 3.500 Menschen gesprochen wird.
Das Rapanui, die Sprache der Osterinsulaner, gehört zum polynesischen Sprachenkomplex, der wiederum der austronesischen Sprachfamilie zugeornet wird. Sie verfügt über keinerlei „Elemente, die einer anderen Sprachfamilie entlehnt wären, und ist dem Mangarevischen und dem Marquesanischen eng verwandt, von denen sie eine archaische Form zu bilden scheint.“ (Métraux 1989:28) Darrell Tyron und Robert Langdon erkannten bei ihren Sprachforschungen etwas vielschichtigere Urelemente des Rapanui, nämlich einen west- und einen ostpolynesischen Dialekt sowie Einflüsse von der 500 km südlich von Tahiti gelenen Insel Raivavae (Leopold-Herrgott 1994:240 und Langdon-Tryon 1973). Nach neuesten linguistischen Untersuchungen ergibt sich eine lexikalische Übereinstimmung von 64 % mit dem Hawaiianischen, Magarevischen und Rarotongischen, 63 % mit der Sprache der ‘Enata/’Enana bzw. Marquesaner sowie 62 % mit dem Tahitianischen und Tuamotuanischen (Jonsson 1999:1).
Seit dem Jahr 2010 wird am 3. November der „Tag der Sprache“ gefeiert. Rapanui ist eine der vielen gemäß UNESCO bedrohten Volkssprachen. Seit 2006 wird sie an der Schule unterrichtet. Als offizielle Sprache der Osterinsel ist Rapanui allerdings nicht anerkannt. In vielen Familien wird nur Spanisch (castelliano) gesprochen. Neuerdings ist „Rapanui“ Pflichtfach in der Schule. Englisch sprechen nur wenige, Deutsch nur vereinzelte. (http://osterinsel-freunde.blogspot.com/2006/11/tag-der-sprache.html 12.7.2011)
Die Sprache der Osterinsulaner verfügt über insgesamt zehn Vokale - a, e, i, o und u in kurzer und gedehnter Form - sowie über zehn Konsonanten - p, t, k, m, n, r, v, h sowie „zwei andere Aussprachearten von n und t. Zwei Konsonanten stehen niemals nebeneinander“, wohl aber Vokale. „Die Zeiten werden nicht durch Endungen der Verben ausgedrückt, sondern durch Zusatzworte, die erkennen lassen, ob die entsprechende Handlung bereits abgeschlossen [ist], noch anhält oder erst kommen wird.“ Der Wortschatz insgesamt ist vergleichsweise beschränkt, wobei die einzelnen Wörter recht komplexe, oft auch „gänzlich verschiedene Bedeutungen haben.“ (Leopold-Herrgott 1994:243) Die zweifache Verwendung ein und desselben Wortes bzw. die Mehrfachnennung der Zentralsilbe eines Ausdrucks bedeutet die Steigerung eines Sachverhalts, umschreibt die Mehrzahl oder abstrahiert einen Begriff. Dieser einfachen Grundstruktur zum Trotz fällt es Europäischsprachigen mitunter recht schwer, Osterinsulanisch zu erlernen.
Das Rapanui hat sich als Minderheitensprache bis heute erhalten, war allerdings immer wieder größeren Veränderungen ausgesetzt. Die erste fand gegen Ende des 19. Jahrhunderts statt, als Polynesier von anderen Inseln einwanderten und einzelne Ausdrücke aus ihrer Herkunftssprache in das Rapanui einfließen ließen. Seit den siebziger Jahren kommt das chilenische Spanisch dazu, das sich im Gebrauch durch Jugendliche mit dem bodenständigen Idiom vermischt, dieses überdies vereinfacht hat und zu einer Art subkulturellem Dialekt geworden ist. Zusätzliche moderne Einflüsse kommen über das durch Touristen importierte Englisch. Das originale Rapanui wurde 1976 zunächst als Schulsprache zugelassen, 1980 verboten und zehn Jahre später wieder offiziell erlaubt. 1976, als durch Nancy und Bob Weber erste Versuche unternommen wurden, die Sprache schriftlich zu fixieren, wurde es noch von rund 70 % der Schulkinder gesprochen, 1989 nur noch von 25 %. Insgesamt verstehen heute wohl zwei Drittel der Bewohner Rapa Nuis und einige wenige Emigranten die alte Sprache der Insel, aber nur ein kleiner Teil davon weist sie als Hauptidiom aus.
Wortliste traditioneller Begriffe - nach https://de.wikipedia.org/wiki/Rapanui_(Sprache)
| Rapanui | Deutsch |
| ahu | zeremonielle Plattform |
| akuaku | Geist, Seele |
| ana hanga koe | bitte |
| ariki | Häuptling |
| henua | Erde, Welt, Land |
| ʻiorana | Willkommen / Auf Wiedersehen (früher ku mao ʻā) |
| ina | nein |
| kāinga | Grundstück |
| Ko āi toʻou ingoa? | Wie heißt du? |
| mahina | Mond |
| maururu | danke |
| Pehē koe? | Wie geht’s dir? |
| raʻā | Sonne |
| rapa | Zeremonialpaddel |
| rangi | Himmel, Wolke |
| rivariva | gut |
| rongorongo | Beter, Bezeichnung für Holzschrifttafeln |
| tangata | Mensch, Mann |
| tapu | heilig, verboten |
| tokerau | Wind |
| vai kava | Meer |
| katahi | 1 |
| karua | 2 |
| katoru | 3 |
| kahā | 4 |
| karima | 5 |
| kaono | 6 |
| kahitu | 7 |
| kavaʻu | 8 |
| kaiva | 9 |
| kaʻangahuru | 10 |
| kahānere | 100 |
| kapīere | 1.000 |
An tonio de Agüera stellte im November 1770 das erste, aus 88 Wörtern bestehende Wörterbuch des Rapanui zusammen. Die folgende Liste gibt die darin enthaltenen Begriffe wieder.
Wortliste - nach https://www.osterinsel.de/35-rapanui-sprache.htm
| Rapanui | Deutsch |
| coojo | Haare |
| geijio | Augenbraue |
| comata | Auge |
| coveque-veque | Wimpern |
| coiju | Nasenloch |
| coaja | Mund |
| corero | Zunge |
| conijo | Zähne |
| conuto | Lippe |
| cococumo | Wange |
| cocoba | Kinn |
| cotarina | Ohr |
| covere | Bart |
| conao | Hals, Nacken |
| coray | Kopf |
| couju | Gesäß |
| cotumo | Muskel |
| coturi | Knie |
| gebae | Bein |
| coique | Wade |
| coreque | Ferse |
| magamaga | Fuß |
| cotajata | Mann |
| cotataqui | junge Frau |
| copocopoco | alte Frau |
| comoa | Huhn |
| cocay | Banane |
| gecoy | Feige |
| moày | Steinidol |
| copeca | Götzenhüll |
| pare | Idol mit bemaltem Körper |
| tequeteque | Oberhäuptling oder Herr |
| cariba | eine gute oder schöne Sache |
| macariba | eine hässliche oder verächtliche Sache |
| comuou | still sein |
| catajuti | jemanden abweisen |
| gecau | schwimmen |
| cogimi | küssen |
| cajai | umarmen |
| geuru | schlafen |
| geura | aufwachen |
| arà | Zuschauen / Zuhören |
| conoro | sich etwas wünschen |
| maconoro | ablehnen |
| cacay | essen |
| tecacai | streiten, kämpfen |
| cauno | trinken |
| tetuba | Luft |
| canocona | Wasser |
| genua | Land |
| cemauma | Hügel |
| cotierpe | Feuer |
| puina | Rauch |
| gerani | Himmel |
| gera | Sonne |
| magin | Mond |
| getu | Sterne |
| geray | das Meer |
| geveca | Hütte oder Wohnung |
| geracona | Kalebasse |
| coano | Speichel |
| coupé | Schleim |
| corima | Waffen |
| comangamanga | Hände |
| comangamanga | Finger |
| comaicucu | Nägel |
| couma | Brust |
| coù | Nippel |
| coqueo | Magen |
| cotino | Bauch |
| cotuorbi | Rücken |
| copito | Nabel |
| coputo | Leiste |
| gemaropao | Genitalien |
| Gebaca | Kanu oder Schiff |
| maca Maca | Priester des Idols |
| viritejue | tanzen |
| toro toro toro | Musik |
| canojo | sich hinsetzen |
| comaro | aufstehen |
| gejaere | spazieren |
| e | ja |
| ma | nein |
| cocoa | du |
| coyana | eins |
| corena | zwei |
| cogojui | drei |
| quiroqui | vier |
| Majana | fünf |
| feuto | sechs |
| fegea | sieben |
| moroqui | acht |
| vijoviri | neun |
| queromata | zehn |
Religion
1843 kamen erstmals katholische Missionare von Tahiti aus nach Rapa Nui. Aufgrund mäßigen Erfolgs kehrten sie zunächst nach Tahiti zurück, kamen aber vier Jahre später wieder, diesmal deutlich besser ausgerüstet. Vom 3. Januar bis zum 11. Oktober 1864 lebte der französische Missionar Bruder Eugenio Eyraud von Chile kommend auf der Osterinsel. In diesen neun Monaten erlebt er, wie die Insulaner an den Pocken sterben und die Leichen an den Stränden liegen, ohne dass sich jemand darum kümmert. Der Rest dieses einst großen Volkes hat komplett das Interesse am Leben, am Überleben, am Landbau, Kultur, Astronomie und allem Schöngeistigen verloren. Die spirituelle Lücke füllte die Römisch-Katholische Kirche, der seit damals fast alle Osterinsulaner angehören. Erst in den letzten Jahren wächst das Interesse an der eigenen alten Kultur wieder.
Religionsbekenntnisse 2001:
Katholiken 3 360 91,5 %
Protestanten 30 0,8 %
Mormonen 5 0,1 %
Naturreligiöse 80 2,2 %
sonstige und Bekenntnislose 165 5,4 %
Traditionelle Religion
In der Welt der Rapanui hatte alles Irdische seine spirituellen Bezugspunkte, ebenso wie jedes menschliche Tun in kosmischen Zusammenhängen gedacht wurde. Jede Handlung hatte demgemäß auch ihre rituellen Aspekte, die wiederum in mythische Grundstrukturen eingebettet waren.
Der Schöpfungsmythos der Inselbewohner lautete in etwa so: Am Anfang der Welt der Rapanui war das Nichts - und Io, der Schöpfergott. Er war es, der Rangi, Vater Himmel, und Henua, Mutter Erde, geschaffen hat. In enger Umschlungenheit zeugten die beiden insgesamt siebzig Kinder, die göttlichen Ahnherren und -frauen der Polynesier. Die Inseln wurden bei den Rapanui aber nicht aus dem Meer gefischt wie in anderen ozeanischen Überlieferungen, sondern gelten als das Produkt eines Zornausbruchs des Riesen Uoke. Durch die Bosheit der Menschen ärgerlich geworden, nahm soll dieser deren Land genommen und es mit aller Gewalt ins Meer geschleudert haben. Übrig blieben bloß einige Inseln - mit dabei Te Pito o te Henua, der „Nabel der Welt“, die Osterinsel.
Ein weiterer Mythos bezieht sich auf die Tatsache, dass in den Kratern Pollen von kiefernähnlichen Bäumen gefunden wurden, Anlaß zu der Spekulation, die Osterinsel wäre nur der obere Teil einer größeren, durch ein Erdbeben oder eine ähnliche Naturkatastrophe versunkenen Landmasse. Auch hierzu soll es Legenden geben, die davon berichten, dass König Hotu Matua einst über ein großes Land namens Hiva geherrscht hätte, das bei einer Art Sintflut versank, so dass nur die eine Insel übrig blieb, um die Überlebenden auf zu nehmen. Eine andere behauptet, der erzürnte Gott Uoke hätte die Landmasse mit einem „Hebelbalken“ zerbrochen.
Neben Io, dem ungeschlechtlichen Schöpfergott, sind es vor allem Rangi, Vater Himmel, und Henua, Mutter Erde, die das Leben der Rapanui bestimmen. „Henua heißt Plazenta und bedeutet Nahrung gebend. Sie ernährt und ist gleichzeitig die Verbindung zweier Generationen, vieler Generationen miteinander.“ Jeder Mensch ist über sie mit seinen Vorfahren, den Tupuna, verbunden. „Henua, das Wort, das gleichzeitig benutzt wird für Erde, nicht dagegen für Welt.“ (Atán-Pauly 1999/32) Denn die Erde ist nur ein winzig kleiner Teil des Universums. Neben der leiblichen ist sie die geistige Mutter der Menschen.
Die Tupuna, Ahnen der Rapanui, sind überall auf der Insel anzutreffen und nehmen, wie es heißt, Einfluss auf die Lebenden, die Makupuna. Zwischen den beiden liegt immer eine Generation, das heißt erst Großeltern werden Tupuna. „Sie haben die Pflicht, dafür zu sorgen, darauf zu achten, dass die Lebenden die Regeln des physischen Seins einhalten. Wenn nicht haben sie die Möglichkeit zu strafen.“ Die im Gebiet ihres Stammes lebenden, hierachisch geordneten Tupuna beobachten alles. Sie können als Geistwesen, aber auch in menschlicher Gestalt auftreten. Die höchsten Tupuna „kämpfen nicht und strafen nicht. In Konfliktsituationen regeln sie die Streitpunkte untereinander, sie verwandeln sich in Vögel oder in Winde, ganz wie es ihnen beliebt.“ Die Zeit ihrer Hauptaktivität liegt zwischen Mitternacht und etwa vier Uhr morgens. Während dieser Zeit „ist Stille, leises Sprechen und leises Lachen angesagt. Sie wollen ungestört und in aller Ruhe ihre Runden drehen und nach dem Rechten sehen.“ Treibt jemand seinen Spaß mit ihnen, werden sie sich dafür rächen. Doch kann man durchaus mit ihnen schimpfen, wenn sie sich einmal irren sollten (Atán-Pauly 1999:54).
Was die göttlichen Ahnherrn und -frauen der alten Inselkultur betrifft, so gibt ein über Generationen hinweg weitergegebener und in Rongorongo-Schrift festgehaltener Text - nach den ersten Worten „Atua-Mata-Riri“ genannt - eine recht profunde Auskunft (nach Thomson 1891:520-522):
„Gott Atua Matariri und Göttin Taporo schufen die Distel.
Gott Ahimahima Marao und Göttin Tahiki Tupufema schufen die Felsen.
Gott Aoevai und Göttin Kava Kohekoe schufen die Heilmittel.
Gott Matua Anua und Göttin Kappipiri Aaitau schufen den Miro-Baum.
Gott Augingieai und Göttin Kia Humutoti schufen den Maulbeerbaum.
Gott Hiti und Göttin Kia Heta schufen die Teepflanze.
Gott Atura und Göttin Katei schufen die Grasbüschel.
Gott Ahen und Göttin Vaua schufen das feine Gras.
Gott Ahekai und Göttin Hepeue schufen den Obsidian.
Gott Viri Koue und Göttin Ariugarehe Uruharero schufen die Morgenglanzpflanze.
Gott Atua Metua und Göttin Kariritunaria schufen die Kokosnüsse.
Gott Atua Metua und Göttin Ki te Vuhi o Atua schufen den Toromiro-Baum.
Gott Atua Metua und Göttin Tapuhavaoatua schufen den Hibiskus.
Gott A Heuru und Göttin Hetomu schufen die blaublättrige Pflanze.
Gott A Taveke und Göttin Pouhutuhututerevaimangaro schufen die weiße Asche.
Gott A Hahamea und Göttin Hohio schufen die Fliegen.
Gott Aukia und Göttin Moremanga schufen die Rotaugen [eine Fischart].
Gott Avia Moko und Göttin Viatea schufen die Tölpel [eine Vogelart].
Gott Tereheue und Göttin Viaraupa schufen die Blätter.
Gott A Heroe und Göttin Unhipura schufen die Ameisen.
Gott Tahatoi und Göttin Kateapiairiroro schufen das Zuckerrohr.
Gott Irapupue und Göttin Irakaka schufen die Pfeilwurz.
Gott Mangeongeo und Göttin Herakiraki schufen den Jams.
Gott Ahen und Göttin Pana schufen den Flaschenkürbis.
Gott Gott Heima und Göttin Kairui Hakamarui schufen die Sterne.
Gott Huruan und Göttin Hiuaoioi schufen die Hühner.
Gott A Hikua und Göttin Hiuaoioi schufen das Zinnober.
Gott Tingahae und Göttin Pararahikutea schufen die Haie.
Gott A Hikue und Göttin Hiuaoioi schufen den Delfin.
Gott Tikitehatu und Göttin Hihohihokiteturu schufen den Felsenfisch.
Gott Tikitehatu und Göttin Hiuapopoia schufen das Leben.
Gott Tikitehatu und Göttin Maea schufen das Glück.
Gott Tikitehatu und Göttin Ruruatiketehatu schufen den Menschen.
Atimoterae schuf den Süßwasserfisch und machte ihn zur Nahrung der Götter.
Gott Takoua und Göttin Tukouo schufen die Milchdistel.
E Toto entdeckte den süßen Geschmack des Jams und machte ihn zur Hauptnahrung der Menschen.
Epuoko schuf die köstliche Banane und machte sie zur Nahrung der Häuptlinge.
Gott Uku und Göttin Karori schufen die Binsen.
Gott Kuhikia und Göttin Taurari schufen die kleinen Vögel.
Gott Kuhikia und Göttin Ruperoa schufen die Seemöwen.
Gott Taaria und Göttin Taaria schufen die weißen Möwen.
Gott Haiuge und Göttin Hatukuti schufen den Wind.
Gott Pauaroroko und Göttin Hakukuti schufen den Schmerz.
Gott Hiuitirerire und Göttin Kanohotatataporo schufen die Weinrebe.
Numia a Tangaire Turuhirohero war der Begründer aller hässlichen und übel riechenden Dinge. [...]
Turuki war der erste, der Steinzäune und Sperren baute.
Kuanuku schuf den Tod durch Ertrinken, den Tod durch Krieg, den Tod durch Unfall und den Tod durch Krankheit.“
Die in Rongorongo-Schrift festgehaltenen mythischen Überlieferungen der alten Inselkultur kreisen wie im vorliegenden Text um Götter- und Ahnenwelten, vermischt mit geschichtlichen Gegebenheiten, wobei um konkrete Übersetzungen freilich gerungen wird. So etwa der Gesang „He Timo te Akoako“, was S.V. Rjabchikov als „Der Stern des Häuptlings“ transferierte. Wie viele andere Erzählungen beginnt auch diese mit einer genealogischen Abhandlung und liefert davon ausgehend eine Kurzbeschreibung der Häuptlinge und ihres Wirkens.
Dreh- und Angelpunkt der meisten mündlich überlieferten Mythen der Rapanui ist - in Aussparung der Fühgeschichte der Insel - die Landnahme des legendären Kulturheroen Hotu Matua. Eine wegweisende Rolle im Grundgerüst der Geschichte (im folgenden nach Barthel 1978, Thomson 1891:447-552, Routledge 1919:277-280 und Métraux 1971:55-75), spielt Hau Maka, der Hotu auf seiner Heimatinsel Hiva oder Rapa tatauiert und als Gegenleistung dafür eine Wunderperle erhalten hatte. Diese Perle entstammte einer Perlmuttmuschel, die durch Tuhu Patoea vermittels eines speziellen Netzes gefangen worden war. Hau Maka nun hatte, so wird berichtet, eines Tages einen Traum, in dem er nach einem neuen Land für Hotu Matua, den Sohn des Häuptlings Matua, suchte. Sein Geist gelangte dabei auf drei kleine Inseln, Motu Nui, Motu Iti und Motu Kaokao, und schließlich an eine „große Aushöhlung“, den Krater Rano Kau im Südwesten des „kleinen Landstückes“, Te Pito o te Kainga. Anschließend umkreiste der Geist Hau Makas die mit einer Straße ausgestattete Insel entgegen dem Uhrzeigersinn und benannte dabei 28 Orte. Einer davon war Anakena, ein Ankerplatz im Norden Rapanuis, der später Hotu Matuas Königssitz werden sollte. Mit diesen Eindrücken im Kopf erwachte Hau Maka und beschrieb den Traum in allen Einzelheiten seinem Bruder Hua Tava. Die Insel, die er „Te Pito o te Kainga a Hau Maka“, „das kleine Stück Land des Hau Maka“, nannte, wäre, wie er sagte, die achte „in der blassen Dämmerung der Morgensonne“. Und Hua Tava eilte sogleich zu Hotu Matua, um ihm von dem Traumeiland zu berichten.
Der Häuptlingssohn zeigte sich beeindruckt und gab seinen beiden Stammhaltern, Raparenga und den Erstgeborenen Ira, gemeinsam mit den fünf Söhnen Hau Makas - Kuukuu, Ringiringi, Nonoma, Uure und Makoi - den Auftrag, ein Kanu zu bauen und die Insel zu suchen. Mit Jams, Süßkartoffeln, Bananen und anderen Nahrungsmitteln versehen, machten sich die sieben Jünglinge auf den Weg „i lunga“, den südöstlichen Passatwinden folgend bis zu „e tau“, wo etwas herausragt, „e revareva ro a“, als dauerhaft sichtbarer Umriss, „i roto i te raa“, in den Mitte der Morgensonne. Fünf Wochen lang segelten sie, genau den Traumanweisungen Hau Makas folgend, über den Ozean, ehe sie am ersten Tag des Monats Maro - also im Juni zu Beginn des Südwinters - die drei kleinen Inseln und das neue Land erreichten. In Hanga Te Pau ging der Trupp an Land, wo Makoi den in Hau Makas Traum vorkommenden Plätzen die dort genanntern Namen gab und Kuukuu damit begann, am Hang des Rano Kau Jams zu pflanzen.
Nach fünfwöchigem Aufenthalt, am fünften Tag des Monats Anakena, also im Juli, machten sich die Entdecker auf einen Erkundungsgang um die Insel. An der Südküste folgten sie den Traumwegen Hau Makas, in der Schilkrötenbucht, Hanga o Honu, fingen sie mit bloßen Händen Fische, kochten und aßen sie. Nahe Anakena trafen sie auf eine Schildkröte, die sie ebenfalls verspeisen wollten, aber unwissend, dass es sich dabei um einen Geist, „kuhane“, handelte, wurde Kuukuu beim Versuch, sie festzuhalten, schwer verletzt. Seine Gefährten brachten ihn daraufhin in eine Höhle am Rand der Ebene von Oromanga. Mit gebrochenem Rückgrat vegetierte er dahin und flehte die anderen an, ihn nicht zu verlassen. Die jedoch wollten die Insel weiter erforschen und ließen ihn sterbend zurück.
Im Westen der Insel entdeckten die sechs übrig gebliebenen Forscher einen Strandfleck, von dem aus sie nach rechts segelten bis Hanga Roa und nach linka bis Apina Iti. Bei ihrem dritten Ausflug gelangten sie Hanga o Rio und ließen sich danach in einer Höhle in Pu Pakakina nieder. Während vier der Inselerforscher am folgenden Tag zu neuen Erkundungen aufbrachen, errichteten Ira und sein Bruder Raparenga in aller Heimlichkeit Steinfiguren, die sie aus ihrer Heimat mitgebracht hatten. Diesen Figuren - Ruhi Hepii zur Rechten, Pu zur Linken und Hinariru in der Mitte, hängten sie Perlmuttketten um, die zum Meer hin strahlten. Als die anderen zurückkamen, sandte Ira Makoi aus, um die wichtigsten Plätze der Insel zum Zwecke der Vorbereitung der Landnahme mit Bezeichnungen aus der alten Heimat zu versehen. Nach Ausführung dieses Auftrags wurde Makoi - nach ihm auch Raparenga - von Ira in der Kunst der Steinsetzung unterwiesen. Das Leben auf diesem fernen Flecken Land wurde den sechs Boten freilich immer beschwerlicher, und als eines Tages ein Mann namens Nga Tavake erschien, der schon früher auf die Insel gelangt war - vielleicht der einzige Hinweis auf eine alteingesessene Bevölkerung -, gestanden sie ihm, dass ihnen dieses Eiland als äußerst übel erschien. „Denn wenn man Jams pflanzt, wächst an dessen Stelle Gras.“ Nga Tavake zeigte ihnen daraufhin, wie man ein Jamsfeld wirklich jätet, dennoch blieben die Fremdlinge skeptisch.
Im Oktober, am 25. Tag des Monats Tangaroa Uri, kehrten Ira, Raparenga Uure, Nonoma und Ringiringi nach Hiva bzw. Rapa zurück, während Makoi auf Te Pito o te Kainga blieb. Auf der Heimatinsel hatten inzwischen gröbere politische Umwälzungen stattgefunden. Die Hanau Momoko, „Kurzohren“, über die Hotu Matua und sein Vater Matua regierten, waren unter den Druck der Hanau Eepe, „Langohren“, geraten, die mehr Land für sich verlangten. Dazu kam eine Flut, die Teile der Insel zerstört hatte. In dieser bedrängten Lage und anbetrachts der nicht ungünstigen Berichte der zurückgekehrten Forscher sah Matua keine andere Möglichkeit mehr, als seinen Sohn mit ausgewählten Leuten auf die ferne Insel zu schicken. Unterstützt durch seine Gehilfen Teke und Oti sammelte Hotu Matua daraufhin Pflanzen und Tiere für die Reise: Bananenstauden, Taro-Sämlinge, Zuckerrohr, Jams, Süßkartoffeln, Hau-, Maulbeer- und Toromiro-Bäume, Farne, Gelbwurzeln, Fliegen, Vögel, Schweine und Hühner. Der Kanubauer Nuku Kehu erhielt unterdessen den Auftrag, ein Boot mit doppeltem Rumpf zu bauen. Elf Monate nach der Rückkehr der fünf Pioniere stand alles für die Abfahrt bereit.
Im September, am zweiten Tag des Monats Hora Nui, segelte Hotu Matua mit seiner Mannschaft los. Nach sechs Wochen erreichten die Flüchtlinge Te Pito o te Kainga. Unmittelbar vor Erreichen der Küste wurden die beiden Teile des Kanus getrennt. Der eine Teil, „Oteka“, mit Hotu Matua, seiner Frau Vakai a Hiva und ihren Leuten, den „Kurzohren“, an Bord steuerte der Süd- und Ostküste entlang bis Anakena im Norden der Insel. Der andere, „Oua“, mit Hineriru, seiner Frau Ava Rei Pua und anderen „Langohren“ stieß über die West- und Nordküste ebenfalls bis Anakena vor. Während Hotu Matua durch das Mana eines gewissen Honga fünf ertragreiche Fischfanggründe erschlossen wurden, erhielt Hineriru die seinen vermittels des in gleicher Weise mana-behafteten Teke.
Kurz nach dem Landgang wurde Hotu Matua ein Sohn geboren, Tuu Maheke, und fast zur gleichen Zeit gebar auch Hinerirus Frau ein Kind, das Mädchen Ava Rei Pua Poki. Nach Abschluss der von Vaka, dem „Meister der Nabelschnur“, durchgeführten Geburtsrituale übernahm der Kanubauer Nuku Keku die Aufgabe, Häuser zu bauen. Anschließend erhielten die Siedler Sämlinge und alles, was sonst zum Überleben wichtig war, ausgehändigt. Die Hanau Eepe, Langohren, wurden nun von Teke auf die Halbinsel Poike im Osten des Landes, geführt, wo Iko, übersetzt „Insekt“, die Häuptlingsrolle übernahm. Hotu Matuas Leute wandten sich unterdessen nach Südwesten, und fürs erste schien Frieden zu herrschen auf Te Pito o te Kainga.
Doch der Schein trog, denn mit den Exilanten war auch Oroi, der alte Kriegsgegner des Häuptlings, auf die Insel gelangt. Er hatte schon auf Rapa bzw. Hiva Söhne des Hotu Matua getötet, und wollte seinen Kampf auch auf der fernen Insel fortsetzen. So überfiel er eines Tages die in Ovahe an der Nordküste die Familie Roros, eines Gefolgsmann Hotu Matuas, und tötete dessen fünf Söhne von hinten. Der mittlerweile in Oromanga in einem Haus mit dem Namen Hare Tupa Tuu residierende Häuptling suchte daraufhin seine Adoptivtochter Veri Hina und ihre Familie auf, um sie in Sicherheit zu bringen. Anschließend versuchte er, Oroi Fallen zu stellen, doch bekam er ihn nicht in seine Gewalt. Erst als Hotu Matua zum Schein so tat, als wäre er über eines der von Oroi ausgelegten Seile gestolpert, gelang es ihm, Oroi zu stellen. Im nachfolgenden Kampf in der Nähe von Hangatetenga spaltete er dem Unruhegeist den Schädel. Oder streckte ihn, einem anderen Bericht zufolge, mit einem Fluch nieder: Spinne! Spinne! Fall und stirb!“ Orois Körper wurde zunächst über dem Feuer gedünstet und danach an einem ihm zugedachten Ahu beigesetzt. Von da an herrschte Frieden auf der Insel.
Nach fünfzehn relativ ereignislosen Jahren kam es zu einem Streit zwischen Hotu Matua und seinem Sohn Tuu Maheke, in dessen Verlauf ersterer letzteren als Bastard bezeichnete. Dies wiederum veranlasste seine eben von der Feldarbeit nach Hause gekommene Frau Vakai zu einer folgenschweren Bemerkung. Nicht Tuu Maheke nämlich wäre ein Bastard, sondern er selbst. Denn Hotu Matuas Vater war, wie sie behauptete, nicht Häuptling Matua, sondern Tai a Mahia. Der Häuptling war ob dieser Offenbarung zutiefst getroffen, zog von seiner Familie fort und baute sich ein neues Haus, Hare Pu Rangi. Nach einem Monat folgte ihm seine Frau und gebar ihm nach entsprechender Zeit einen Buben namens Miru. Wieder zog der Häuptling weg, baute sich das Haus, dem er die Bezeichnung Hare Moa Viviri gab. Ihm folgend, gebar Vakai einen dritten Sohn, Hotu Iti a Hotu. Was Hotu Matua dazu veranlasste, ein drittes Mal wegzuziehen, wobei er sich diesmal ein Haus mit dem Namen Hare Moa Tataka baute. Und Vakai folgte ihm neuerlich und gebar als vierten Sohn Tuu Rano Kau.
Von da blieb die Familie zusammen und übersiedelte nach Te Ngao o te Honu, wo Vakai starb. Ihr Körper wurde nach Akahanga gebracht und dort bestattet. Hotu Matua blieb ein Jahr lang in ihrer Nähe, ehe er sich an der Südseite des Rano Kau, gegenüber von Orongo, niederließ. Von hier aus regierte er mit viel Umsicht das Eiland, nahm sich auch kleinster Dinge an und war allgemein geachtet. Nachdem er dieser seiner letzten Wohnstätte zwei Steine nebeneinander aufgerichtet hatte, legte er sich in seinem Haus zur Ruhe und segnete seine Kinder ein letztes Mal. Noch einmal erhob es sich und wankte nach Orongo, um seinen Tod zu verkünden. In die Richtung seines Heimatlandes blickend, rief er die Schutzgeister Kuihi und Kuaha an: „Lasst die Stimme des Hahns von Ariana sanft erklingen. Der Stamm mit den vielen Wurzeln kommt!“ Daraufhin fiel er nieder und starb.
Seine Kinder brachten Hotu Matua auf einer Trage nach Akahanga und bestatteten ihn in Hare o Ava. Später schnitt sein ältester Sohn Tuu Maheke den Kopf des Leichnams ab, trocknete und reinigte ihn, malte ihn gelb an, hüllte ihn in Tapa un d verbarg ihn in einer Felsspalte. Als Ure Honu in Vai Mata ein neues Haus baute, holte er den Schädel und hängte ihn in seiner Hütte auf. Beim Hauseinweihungsfest rief der zu Gast weilende Häuptling Tuu Ko Ihu erstaunt aus: „Hier sind die Zähne, die noch Schildkröten und Schweine auf Hiva bzw. Rapa aßen!“ Und er nahm den Schädel in aller Heimlichkeit an sich und begrub ihn unter einem Stein nahe seinem eigenen Haus. Als Ure Honu von dem Diebstahl erfuhr, sammelte er seine Getreuen um sich und begab sich zu Tuu Ko Ihu. Er forderte den Schädel zurück, doch der Häuptling weigerte sich. Erst nach langem Suchen entdeckte der Bestohlene das begehrte Objekt und nahm es an sich. Von da an herrschte für einige Zeit wieder Frieden auf der Insel.
Heilige Plätze
Der vulkanische Ursprung der Insel hat zur Folge, dass sich im Gestein zahlreiche Höhlen und Klüfte gebildet haben. Die Höhlen wurden als Kultstätten genutzt, wie zahlreiche Felsmalereien beweisen. Die Motive haben ihren Ursprung überwiegend im Vogelmannkult. Thor Heyerdahlfand in den Höhlen noch zahlreiche steinerne Kleinplastiken mit den unterschiedlichsten Motiven: Vogelmanndarstellungen, Moais, Kopfplastiken, anthropomorphe und zoomorphe Figuren bis hin zu Darstellungen von Segelschiffen. Die geheimen Höhlen sind einzelnen Familien zugeordnet. Das Wissen darüber wurde jeweils mündlich an besonders ausgesuchte Mitglieder der Nachfolgegeneration vermittelt. Knochenfunde beweisen, dass die Höhlen auch als Begräbnisstätten genutzt wurden, jedoch vermutlich nur in der Spätperiode. Der Überlieferung der Inselbewohner nach dienten die Höhlen in der Zeit des Kulturverfalls und der nachfolgenden Bürgerkriege auch als Zufluchtsstätten. Eine von Touristen häufig besuchte Kulthöhle mit zahlreichen Felsbildern ist Ana Kai Tangata, die sogenannte „Menschenfresserhöhle“, bei Mataveri an der Westküste.
Die wichtigste religiöse Stätte der Gegenwart ist die katholische Kirche des heiligen Kreuzes, Iglesia de Santa Cruz. Sie wurde 1964 nach zehnjährigem Bau fertiggestellt. Die Außenfassade ist eine Verschmelzung von christlichen und Rapa Nui-Motiven und Symbolen. Rechts neben dem Eingang befinden sich die Gräber von vier Menschen: Eugene Eyraud (5.3.1820 bis 19.8.1868), Sebastian Englert (1989 bis 8.1.1968), Nicolas Pakarati (1860 bis 10.10.1926) und zuletzt eine Prophetin namens Angata, die eine bedeutende Rolle während der Revolution zur Zeit der Expedition von Katherine Routledge (1914/15) gespielt hat (keine Geburts- und Todesdaten verfügbar). Das Innere der Kirche ist im wesentlichen schmucklos, aber mit faszinierenden Holzschnitzfiguren ausgestattet. In den 1970er Jahren hatte der Ältestenrat beschlossen, die bis dahin üblichen Gesichter von (ausländischen) Heiligen durch Figuren zu ersetzen, die von der Insel stammen. Als erste Figur wurde die „Maria, Madre de Rapa Nui“ von einer Gruppe von Künstlern geschnitzt. Sie hat die üblichen Proportionen der Moais, das heißt mit einem überdimensioniertem Kopf, einer Robe die an Flügel erinnert und eine Krone mit einem Vogelmann. Seit dem Ende der Moai-Herstellung war es übrigens das erste Mal, daß eine Figur von einer Gruppe erstellt worden ist. Eine weitere faszinierende Figur ist die „Espiritu Sanctu“, welche von Juan Haoa erschaffen worden ist. Basierend auf der Form eines Frigatvogels kommen hölzerne Dornen aus dem Körper, welche die Güter der Erde repräsentieren: Stärke, Weisheit, Lernen, Rat, Intelligenz, Gottesfurcht und Frömmigkeit. (http://home.arcor.de/bm-osterinsel/kirche.htm 12.7.2011)
Christentum
"Die katholische Kirche wurde in den 1860er Jahren von französischen Priestern aus Mangareva und Tahiti gegründet, und in den zwei Jahrzehnten vor der chilenischen Kolonisierung waren die meisten Menschen zum Katholizismus übergetreten. Bis zur politischen Liberalisierung der 1960er Jahre erlaubte Chile keine anderen Missionare auf der Insel, doch seitdem haben sich mehrere andere christliche Konfessionen etabliert. Es gibt eine evangelikale protestantische Gemeinde, eine mormonische, eine Gemeinde der Siebenten-TagsAdventisten und eine der Zeugen Jehovas, von denen jede etwa hundert Anhänger gewonnen hat. Unter den jüngeren Generationen gibt es auch Bewegungen, die sich vom Christentum abwenden um die alte indigene Religion wieder zu praktizieren sowie außerdem eine Reihe Agnostiker und Atheisten nach westlichem Vorbild." (Gonschor 2018:18)
Siedlungen
Die typische Siedlung der Osterinsel in klassischer Zeit - etwa von 1000 bis 1650 - lag nahe der Küste, um Zugriff zu der wichtigen Nahrungsquelle Meer zu haben. Sie umfasste Wohnhäuser, Erdöfen (umu), umhegte Gärten (manavai) und Hühnerhäuser (hare moa). Zum Dorf gehörte auch eine Zeremonialplattform (ahu) als religiöses und machtpolitisches Zentrum. Am nächsten zur Küste und prestigeträchtig unweit der Zeremonialplattform, gruppierten sich die Paenga-Häuser, die den Familien des Adels und der Priesterschaft vorbehalten waren. Bei größeren und bedeutenden Siedlungen gab es zudem ein großes Versammlungshaus (hare nui), das in der Bauweise den Paenga-Häusern vergleichbar war. Manche Versammlungshäuser hatten nach zeitgenössischen Berichten eine Länge von über 100 Metern. Weiter zum Inselinnern schlossen sich, inmitten weiterer Gärten und Felder, die schlichter gebauten, meist rechteckigen, aber auch runden oder ovalen Hütten der einfachen Stammesmitglieder an. In unmittelbarer Nachbarschaft lagen die aus Stein errichteten Hühnerhäuser (hare moa). Hühner waren ein wertvolles Gut, sodass dadurch eine ständige Überwachung gewährleistet war.
Mitte des 19. Jahrhunderts gab es noch sechs Siedlungen: Anakena, Tongariki, Vaihu, Vinapu, Mataveri und Hanga Roa. Heute konzentrieren sich die Bewohner auf die Dörfer Hanga Roa und Mataveri im Südwesten, die allerdings so zusammen gewachsen sind, dass sie als eine Siedlung angesehen werden. In den restlichen Regionen der Insel gibt es nur wenige Streusiedlungen.
Ortschaften: 1992 2002
Hanga Roa 2 400 3 304
Mataveri 320 410
Verkehr
Die Insel verfügt über ein ausreichendes Verkehrsnetz. Sie ist nur peripher in den internationalen Flug- und Schiffsverkehr eingebunden.
Straßenverkehr
Von den 96 km Straßen der Insel sind nur etwa 15 km asfaltiert. Die Zahl der Fahrzeuge stieg von 620 im Jahr 1993 auf mittlerweile fast 2000. Viele Bereiche der Insel sind allerdings für Autos nicht zugänglich. Der Großteil der Westküste darf nicht mit dem Auto befahren werden. Einige Inselbereiche wie die Poike Halbinsel und Terevaka sind natürliche Erholungszonen und dürfen nur zu Fuß oder mit dem Pferd betreten werden.
Schiffsverkehr
Der einzige Hafen der Insel befindet sich unterhalb des Hauptortes Hanga Roa in Hanga Piko. Im Februar 1872 begann der französische Siedler Dutrou Bornier mit den ersten Arbeiten, indem er Felsen vor der Küste räumen ließ und eine erste Kai-Mauer zum Anlegen von Booten baute. 1896 ließ der chilenische Kaufmann und Pächter der Osterinsel, Enrique Merlet, die Anlegestelle weiter ausbauen, um eine bessere Frachtabfertigung zu ermöglichen. Die entscheidenden Arbeiten wurden jedoch erst 1920 von der Williamson-Balfour Company durchgeführt. Sie ließen die Bucht von Hanga Piko mit Dynamit bearbeiten, um einen gefahrlosen Eingangskanal und ein geschütztes Hafenbecken zu schaffen.
Der Hafen ist für größere Schiffe nicht geeignet, weshalb Kreuzfahrtschiffe vor der Insel ankern und Passagiere mit kleineren Tenderbooten an Land gebracht werden müssen. Die Nutzung des Hafens kann aufgrund der Wetterbedingungen eingeschränkt sein. Der Hafenmeister kann den Hafen für bestimmte Bootsgrößen sperren, wenn die Brandung zu stark ist. Die Nutzungsgenehmigung kann kurzfristig widerrufen werden. Es gibt keine natürliche Hafenbucht oder geschützte Ankerplätze, was die Zugänglichkeit der Insel auch für Segler erschwert. Diese Faktoren machen den Besuch der Insel oft unberechenbar und können zu Verzögerungen oder sogar zur Absage von Landgängen führen. Die schwierige Hafensituation spiegelt die isolierte Lage der Insel im Pazifischen Ozean wider und unterstreicht, warum Rapa Nui als eine der abgelegensten bewohnten Inseln der Welt gilt
Puerto de Hanga Piko:
- Lage: 27°10‘ S, 109°27‘ W
- maximaler Tidenhub: 0,91 m
- Hafenerrichtung: Februar 1872
- Funktionen: Fischer-, Handels-, Jachthafen
- Hafenfläche: 7.200 m²
- Zahl der Piers: 1
- Kai- und Pierlänge: 80 m
- Anlegestellen: rund 40
- maximaler Tiefgang: etwa 3 m
- Leuchtfeuer: 0
Flugverkehr
Den Flugplatz Mataveri International befindet sich im südlichen Zentrum des Hauptortes Hanga Roa. Die Landebahn verläuft von der Küste im südlichen Zentrum von Hanga Roa rund 3300 m bis an die Ostküste der Insel. Der nächstgelegene Flughafen ist der Totegegie Airport auf Mangareva, einem Teil vonm Französisch-Polyxnesien. Durch die extrem abgeschiedene Lage wurde auf der Osterinsel erst spät mit dem Bau eines Flughafens begonnen.
Der Flugverkehr auf der Osterinsel entwickelte sich ab der Mitte des 20. Jahrhunderts. Davor war die Insel nur per Schiff zu erreichen. Im Jahr 1951 steuerte das erste Flugzeug, ein Wasserflugzeug, welches eigens für diesen Flug umgebaut wurde, die Insel an. Es landete auf einem breiten Weg. Für den 19 Stunden und 22 Minuten dauernden Flug wurde das Flugzeugs eigens mit dem Namen „Manu Tara“ („Vogel des Glücks“) getauft. Zum Erstflug startete es in der chilenischen Stadt La Serena. Die damalige Crew bestand aus 9 Personen, unter ihnen Pilot Roberto Parragué Singer und Major Horacio Barrientos Jofré. Sie trugen die Verantwortung für die abenteuerliche Reise. Beim Rückflug kam es zu einem Unfall und das Flugzeug landete aufgrund der unebenen Piste im Meer. Da der Flug ohne Genehmigung der chilenischen Luftwaffe durchgeführt wurde, kam es zur Degradierung und Strafversetzung des Piloten.
In den 1960er Jahren erkannte Chile die Bedeutung der Osterinsel als Zwischenstation in einem transpazifischen Luftnetzwerk, nicht zuletzt unter militärischen Gesichtspunkten. Nachdem Pläne für einen Neubau bei Anakena als zu teuer verworfen wurden, erweiterte und asphaltierte man die Graspiste in Mataveri. Der Hauptzweck des von der chilenischen Luftwaffe betriebenen Flugplatzes war jedoch die Versorgung der amerikanischen Basis.
Der Bau der ersten Landebahn auf der Osterinsel wurde 1964 demgemäß von 80 US-amerikanischen Bauarbeitern vorbereitet und im folgenden Jahr durch chilenische Firmen fertiggestellt. Diese bekamen Unterstützung durch die USA, da diese als strategisch wichtigen Punkt eine Landebahn im Pazifik benötigten, um die Atomversuche auf dem Muroroa-Atoll besser koordinieren zu können. In den kommenden zwei Jahren landeten auf der Osterinsel allerdings nur chilenische Militärmaschinen. Doch der Bau der Landebahn sorgte nicht bei jedem für Freude. Die Insulaner werfen den Errichtern bis heute vor, beim Bau eine Siedlung und die Zeremonie-Anlage „Ahu Mahave“ zerstört zu haben.
Der Flughafen Mataveri wurde 1967 fertiggestellt, sodass in diesem Jahr auch der Passagierflugverkehr mit DC-6-Maschinen beginnen konnte. Die Flugzeuge erreichten die Osterinsel in rund neun Stunden von Santiago de Chile. Der chilenische Staatschef Salvador Allende verbot den Amerikanern 1970 die Nutzung des Flughafens. Ab 1971 bot die chilenische Fluggesellschaft LAN (heute: LATAM) erste Linienflüge von Santiago de Chile über den Flughafen Mataveri bis nach Französisch-Polynesien an, welche ab 1974 von Strahlflugzeugen durchgeführt wurden. Diese Strecke wird bis heute bedient. Nachdem die Nutzungserlaubnis für die US-Amerikaner in den 1980er Jahren wieder erteilt wurde, plante die NASA den Flughafen als Notlandebahn für das Space Shuttle bei Starts von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien, zu denen es allerdings nie kam. Nachdem ab dem Jahr 1986 auch Großraumflugzeuge den Flughafen ansteuern können, steigen die Zahlen des Tourismus auf der Insel und die Versorgung wurde stabilisiert.
Die chilenische Fluggesellschaft LATAM ist die einzige, welche den Flughafen im regulären Linienbetrieb ansteuert. Sie verbindet den Flughafen Mataveri mindestens einmal täglich mit Santiago de Chile (SCL). Dafür nutzt sie zumeist Flugzeuge des Typs Boeing 787-9, den sogenannten Dreamliner. Der Flug dauert gut viereinhalb Stunden. Zweimal pro Woche gibt es eine Flugverbindung von und nach Papeete auf Tahiti, der Flug dauert rund sechs Stunden.
| Airline | Ziele |
| LATAM Chile | Papeete, Santiago de Chile |
Mataveri International Airport:
- spanischer Name: Aeropuerto Internacional Mataveri / Aeropuerto de Isla de Pascua
- Code: IPC / SCIP
- Lage: 27°099‘53“ S, 109°25‘18“ W
- Seehöhe: 69 m (227 ft)
- Entfernung: unmittelbar südlich von Mataveri
- Inbetriebnahme: 1967
- Betreiber: FACH – Fuerza Aérea de Chile (Chilean Air Force)
- Terminal: 1
- Rollbahn: 1
- Länge der Rollbahn: 3317,5 m (Asfalt)
- Fluggesellschaft: 1
- Flugzeug-Standplätze: rund 20
- jährliche Passagierkapazität: 267.773 abgefertigte Passagiere (2018) bzw. 296.496 Flugplätze (2025)
- jährliche Frachtkapazität: über 100 t
Wirtschaft
Die Insulaner leben hauptsächlich von der Landwirtschaft und vom Tourismus.
Gartenbau
Der Gartenbau lieferte die Grundnahrungsmittel der Osterinsulaner. Angebaut wurden Süßkartoffeln und andere Wurzelfrüchte sowie verschiedene polynesische Gemüsesorten. Heute konzentriert sich der Anbau auf Kartoffeln, Gemüse und ein wenig Obst. „Eine Plantage in der Inselmitte liefert jährlich gegen Ende August Orangen und Ztronen.“ Für den Eigenbedarf bauen die Inselbewohner heute „in ihren eigenen Gärten an: Bananen, Mais, Maniok, Erbsen, Salat, Tomaten, Bohnen, Orangen, Ananas, Zitronen, Cherimoya, Papayas, Wassermelonen, Taro, Süßkartoffeln, Zuckerrohr und Avocados.“ (Leopold-Herrgott 1994:233) Dazu kamen noch Yams und Flaschenkürbis.
Die Inselbewohner entwickelten eine bemerkenswert nachhaltige und innovative Landwirtschaft, die es ihnen ermöglichte, trotz schwieriger Umweltbedingungen zu überleben. Sie legten ausgeklügelte Steingärten an, um die Herausforderungen des trockenen Klimas und der steinigen Böden zu bewältigen. Diese Technik, auch als "Steinmulch" bekannt, beinhaltete:
- Zerbrechen von Steinen und Einarbeiten der Stücke ins Erdreich
- Auslegen von faustgroßen Steinen und größeren Felsbrocken darüber
- Schutz der Pflanzen vor Wind und Temperaturextremen
- Verbesserung der Feuchtigkeitsspeicherung und Nährstoffanreicherung des Bodens
- Eindämmung der Bodenerosion
Entgegen früherer Annahmen eines "ökologischen Suizids" bzw. "selbstverschuldeten ökologischen Kollapses" zeigen neuere Studien, dass die Rapanui ihre Nahrungsressourcen durchaus nachhaltig nutzten. Sie entwickelten eine hochentwickelte Form des Ackerbaus, bei der der Boden gezielt verbessert, stabilisiert und gedüngt wurde. Selbst nach dem Verlust des Baumbestandes auf der Insel konnten die Rapanui ihre landwirtschaftlichen Praktiken anpassen und fortführen. Dies deutet auf ein umfangreiches Wissen über nachhaltige Nahrungsmittelversorgung und die Überwindung schlechter Bodenfruchtbarkeit hin (eine Zusammenfassung dieser Erkenntnisse findet sich in Damals 14.7.2017 = https://www.wissenschaft.de/geschichte-archaeologie/war-die-osterinsel-kultur-oekologischer-als-gedacht/)
Viehwirtschaft
Auf der Osterinsel gab es in traditioneller Zeit nur Schweine und Hunde. Heute werden hier als Nutztiere „Pferde, Hühner, Rinder, Ziegen und Schafe gehalten. Die sparsame Vegetation auf dem vulkanischen Gestein setzt der Tierhaltung natürliche Grenzen. Eine staatlich-chilenische Tierfarm hält rund 3.000 Rinder und beansprucht dafür 40 Prozent der inselfläche, darunter auch Teile des Nationalparks.“ (Leopold-Herrgott 1994:233)
Viehbestand: 1964 1993
Rinder 2 000 3 000
Geflügel 5 000 3 000
Schafe 40 000 300
Pferde 2 000 250
Ziegen 500 250
Schweine 1 000 200
Fischerei
Der Fischfang spielt eine wichtige Rolle in der insularen Kultur und Wirtschaft. Die Gewässer um die Insel beherbergen mindestens 142 Arten von Meerestieren. Traditionelle Fischfangmethoden werden noch heute praktiziert und sind ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes der Rapa Nui. Im Jahr 2017 wurde das Meeresschutzgebiet Rapa Nui Rahui eingerichtet, das gemeinsam durch Chile und die Rapa Nui-Gemeinschaft verwaltet wird. Dieses Schutzgebiet erlaubt den handwerklichen Fischfang für die einheimischen Fischer von Rapa Nui.
Besucher der Osterinsel haben die Möglichkeit, an traditionellen Fischfangexpeditionen teilzunehmen. Bootsexpeditionen mit einheimischen Rapa Nui-Fischern werden angeboten, bei denen Touristen die alten Fischfangtraditionen erleben können Sportangeltouristentouren werden von fachkundigen lokalen Guides durchgeführt, die Besucher zu den besten Angelplätzen bringen. Diese Aktivitäten bieten nicht nur ein einzigartiges kulturelles Erlebnis, sondern tragen auch zum Erhalt traditioneller Praktiken bei.
Handwerk
Zu den bekanntesten Handwerksformen gehören:
- Die Herstellung der monumentalen Moai-Statuen durch spezialisierte "Idolmacher", die hohes Ansehen genossen.
- Das Erschaffen von Petroglyphen, besonders am Vogelmann-Kultort Orongo, oft von ehemaligen Moai-Steinmetzen angefertigt.
- Fein bearbeitete und hochpolierte Holzschnitzereien, die zu den schönsten Kunstobjekten Ozeaniens zählen.
- Herstellung verschiedener Figurentypen wie Moai Kavakava, Moai Tangata, und ritueller Objekte wie Rei Miro und Rongorongo-Tafeln.
- Bootsbau und Netzherstellung, obwohl weniger darüber bekannt ist aufgrund der Vergänglichkeit der Materialien.
- Knüpfen von Knoten nach bestimmten Regeln, wichtig für den Bau von Paenga-Hütten und in der Fischerei.
Die Handwerker der Osterinsel mussten oft mit begrenzten Ressourcen arbeiten, insbesondere nach der Entwaldung der Insel. Sie verwendeten Haifischzähne und Obsidiansplitter als Werkzeuge und nutzten das rare Holz des Toromiro-Baumes optimal aus2. Trotz des Niedergangs der Kultur hinterließen die Rapanui-Handwerker ein reiches Erbe an Kunstobjekten, die heute in Museen weltweit zu finden sind (sh. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Holzschnitzkunst_der_Osterinsel)
Die Handwerker der Osterinsel mussten oft mit begrenzten Ressourcen arbeiten, insbesondere nach der Entwaldung der Insel. Sie verwendeten Haifischzähne und Obsidiansplitter als Werkzeuge und nutzten das rare Holz des Toromiro-Baumes optimal aus2. Trotz des Niedergangs der Kultur hinterließen die Rapanui-Handwerker ein reiches Erbe an Kunstobjekten, die heute in Museen weltweit zu finden sind (sh. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Holzschnitzkunst_der_Osterinsel)
Wasserwirtschaft
Die Osterinsel verfügt über keine Fließgewässer und nur zwei schwer zugängliche Kraterseen. Der vulkanische Boden ist von Lavaröhren durchzogen, die das Regenwasser schnell versickern lassen. Die jährliche Niederschlagsmenge liegt bei bis zu 2.000 mm, aber das Wasser versickert rasch und sammelt sich in unterirdischen Aquiferen.
Die frühen Bewohner nutzten verschiedene Methoden, um das knappe Süßwasser zu sichern. Sie legten Auffangbecken an den Austrittsstellen von Süßwasser an, um die Vermischung mit Meerwasser zu verhindern. Sie nutzten sogenannte "coastal seeps", also Süßwasseraustritte an der Küste, wo Regenwasser aus dem porösen Lavagestein als leicht salziges, aber trinkbares Wasser ins Meer sickerte. Unterwasserdämme und Sickergruben wurden angelegt, um dieses Küsten-Süßwasser zu gewinnen. Manavai, geschützte Kleingärten mit Steinwällen, verbesserten das Mikroklima verbesserten und verringerten den Feuchtigkeitsverlust. Bodensenken und dolinenartige Spalten schließlich dienten als Tiefbeete für den Anbau größerer Pflanzen. Archäologische Funde belegen Wasser- und Fruchtbarkeitsheiligtümer mit künstlichen Kanälen, Becken und Prozessionsstraßen, die an Wasserfälle anschließen. Der Zugang zu bestimmten Wasserressourcen war gesellschaftlich und religiös durch Tabus geregelt, was auf eine starke soziale Kontrolle über Wasser hindeutet.
Seit 1967 existiert eine zentrale Trinkwasserversorgung, die während des Flughafenbaus durch die USA finanziert wurde. Das Wasser stammt heute aus Tiefbrunnen und wird in großen Speichern gesammelt. Die wachsende Bevölkerung und der Tourismus führen zu Umweltproblemen: Müll und Schadstoffe gelangen unkontrolliert ins Lavagestein und bedrohen die Süßwasserreserven. Moderne Forschungen nutzen Drohnen und Wärmebildkameras, um die Küstensickerquellen systematisch zu erfassen, was auch für Dürre-Forschung relevant ist.
Energiewirtschaft
Bis vor kurzem wurde der gesamte Strombedarf der Insel durch Dieselgeneratoren gedeckt. Das staatliche Unternehmen SASIPA betreibt das Kraftwerk Mataveri mit 6 Dieselgeneratoren und einer Gesamtleistung von 5.615 kW. Im Jahr 2017 lag die Stromproduktion bei 13.199 MWh, mit einem jährlichen Wachstum von etwa 5,9%.
Die erste netzgekoppelte Solaranlage "Tama Te Ra'a" wurde von ACCIONA installiert. Sie umfasst 400 polykristalline Solarmodule mit einer Spitzenleistung von 128 kWp. Die jährliche Produktion liegt bei etwa 200 MWh. Dadurch werden 135 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr vermieden. Die Anlage deckt etwa 8 % des bisherigen Dieselverbrauchs für die Stromerzeugung.
Weitere in Bau bzw. Planung befindlijche Solarenergieprojekte sind ein 2,99 MWp Photovoltaik-Kraftwerk nahe dem Flughafen Mataveri und ein netzunabhängiges Hybrid-Microgrid mit 429 kWp Solarleistung, 200 kVA Dieselgeneratoren und 1.152 kWh Batteriespeicher für 120 Häuser in Vai a Repa, Eine Solaranlage für das Krankenhaus Hanga Roa wurde 2009 initiiert. SASIPA plant, die Solarkapazität auf 2,5 MW (44,5% der aktuellen Kapazität) zu erweitern. Darüber hinaus gibt es laut APEC (Asio-Pacific Economic Cooperation) Bestrebungen, die Insel zu 100 % mit erneuerbarer Energie zu versorgen.
Abfallwirtschaft
Die geografische Isolation der Osterinsel erschwert eine nachhaltige und umweltverträgliche Entsorgung von Müll. Die Insel produziert durch Einwohner und Touristen täglich rund sieben Tonnen Abfall, wobei fast alles importiert werden muss. Nur etwa 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung sortieren ihren Müll, und davon wird wiederum nur ein Teil korrekt getrennt. Lediglich etwa 20 Prozent der Abfälle werden recycelt; der Großteil landet auf der lokalen Deponie, wo sich Haushaltsgeräte, Autowracks und Reifen ansammeln. Ein Teil des Abfalls, wie Pappe, Plastik und Aluminium, wird regelmäßig per Frachtflugzeug auf das chilenische Festland transportiert. Dies betrifft jedoch nur einen Bruchteil des gesamten Müllaufkommens. Die Insel ist auf Recyclingfirmen auf dem Festland angewiesen. Die Abfälle müssen dafür sauber und trocken sein, was oft nicht der Fall ist. Freiwilligenaktionen sammeln regelmäßig Müll an den Stränden, doch der gesammelte Müll wird meist auf die Deponie gebracht, da es an lokalen Verwertungsmöglichkeiten fehlt.
Die Gemeinde hat in den letzten Jahren kreative Programme zur Abfallvermeidung und -verwertung entwickelt, insbesondere im Bereich Textilien. Im Abfallverwertungszentrum Orito entstand während der Pandemie ein Kreislaufwirtschaftsprojekt für Kleidung. Getragene Kleidung wird kostenlos weitergegeben und nach Gebrauch zurückgebracht. Kleidung in schlechtem Zustand wird als Füllmaterial für Möbel oder für Kreativworkshops genutzt. Zwischen Januar und August 2023 wurden 8.911 Kilo Kleidung gesammelt, von denen mehr als die Hälfte wiederverwendet oder weiterverarbeitet wurde. Über 600 Kinder wurden in Workshops zu Kunsthandwerk und Umweltschutz geschult.
Die Osterinsel ist stark von Meeresmüll betroffen, insbesondere durch Plastikabfälle, die durch Meeresströmungen angeschwemmt werden. Wissenschaftliche Studien zeigen besonders hohe Konzentrationen von Mikroplastik rund um die Insel. Fast 100 verschiedene Arten sind von Plastikverschmutzung betroffen, entweder durch Verheddern oder Verschlucken. Regelmäßige Küstenreinigungen und das Orito Recycling and Education Centre in Hanga Roa spielen eine zentrale Rolle bei der Sammlung und Trennung des Mülls
Handel
Archäologische Funde belegen, dass die Rapanui bereits vor der europäischen Entdeckung der Insel Kontakt mit Südamerika hatten. Dieser Austausch umfasste nicht nur Handelsbeziehungen, sondern auch genetische Vermischung. Nutzpflanzen wie Süßkartoffeln, Maniok und Canna gelangten von Südamerika auf die Insel. Nach der Entdeckung durch europäische Seefahrer im Jahr 1722 begann eine Phase des Handels und kulturellen Austauschs, die jedoch oft von Ausbeutung und Konflikten geprägt war. Die Rapanui betrieben intensiven Anbau von Süßkartoffeln, Taro, Yams und Zuckerrohr in Steinmulchfeldern und umhegten Gärten. Diese Methoden waren für den Eigenbedarf ausgelegt und zeugen von einer nachhaltigen Nutzung der begrenzten Ressourcen der Insel. Durch systematische Entwaldung und Überweidung (insbesondere durch Schafe in der Zeit nach der chilenischen Annexion 1888) wurden die natürlichen Ressourcen stark beeinträchtigt, was den Handel mit externen Gütern erschwerte. Heute ist Rapa Nui bekannt für den Verkauf von Souvenirs wie Flaschen mit Regenwasser („con gas“) und kunsthandwerklichen Produkten. Der Tourismus spielt eine zentrale Rolle in der Wirtschaft der Insel. Unternehmen wie Rapanui Clothing fördern, inspiriert von der Kultur und Natur der Insel, "nachhaltige Produktion".
Die Infrastruktur der Insel umfasst Kirche, Post, Bank, Apotheke, kleinen Geschäften, einigen kleinen Supermärkten, Snack-Bars und Restaurants hat sich seit den sechziger Jahren erheblich verbessert, nicht zuletzt zur Befriedigung der Bedürfnisse des Tourismus. Die meisten Geschäfte befinden sich in der Avenida Atamu Tekena, der Hauptstraße des Dorfes. Am Hafen wird morgens frischer Fisch verkauft, doch sind Auswahl und angebotene Menge gering. Vor einigen Häusern sind Stände aufgebaut, an denen Einheimische selbst gezogenes Obst und Gemüse feilbieten. Inzwischen gibt es sogar eine Diskothek für die jüngeren Inselbewohner.
Finanzwesen
Die Osterinsel ist in das chilenische Finanzsystem eingebunden. Offizielle Währung ist der Chilenische Peso zu 100 Centavos. Allgemein akzeptiert wird aber auch der US-Dollar.
Auf der Insel gibt es zwei Bankfilialen, die sich beide im Zentrum von Hanga Roa befinden und nur etwa 150 Meter voneinander entfernt liegen. Es sind dies die Banco Estado, die Staatsbank von Chile, und die Banco Santander, eine Privatbank. Erstere ist besonders bei den Einheimischen beliebt, von denen viele dort ein Konto haben. Beide Banken verfügen über Geldautomaten, an denen man mit Kreditkarten wie Visa und Mastercard Geld abheben kann. Die Auszahlung ist jedoch auf etwa 100.000 chilenische Pesos pro Tag begrenzt, was ungefähr 100 Euro entspricht. Besuchern wird empfohlen, genügend Bargeld mitzubringen und Kreditkarten von beiden großen Anbietern (Visa und Mastercard) zu besitzen, da EC-Karten nicht funktionieren.
Soziales und Gesundheit
Die Inselgesellschaft war einst in zwei Gruppen getrennt, die gemeinhin Lang- bzw. Kurzohren genannt werden. „Über den Stämmen, den Unterstämmen und den Großfamilien, die das Gerüst der Gesellschaft bildeten, gab es noch eine größere Organisation politischen Ursprungs. Die zehn Stämme der mata gliederten sich in zwei Gruppen, die wahrscheinlich nichts anderes als zwei feindliche Bünde darstellten. Die Stämme des westesns und Nordwestens wurden in der Regel als die ‘Leute von Tuu‘ bezeichnet – nach dem Namen eines vulkanischen Kegels in der Nähe von Hangaroa. Aus unerklärlichen Gründen waren sie auch als die ‘großen Stämme‘, mata-nui, bekannt. Die Stämme des Ostens oder die ‘kleinen Stämme‘, erscheinen in den historischen Berichten dagegen als ‘Leute von Hotu-iti‘.
In diesem Dualismus drückt sich wahrscheinlich die Folgeerscheinung eines dauernden kriegszustandes zwischen den Stämmen aus, die auf den beiden äußersten Enden der Insel alteingesessen waren. Häufig finden sich in den alten Überlieferungen Anspielungen auf Hassgefühle und Kriege der Tuu gegen die Hotu-iti, deren Kämpfe viele Generationen hindurch mit wechselndem Glück andauerten. Der Sieger einigte die Insel bis zu dem Augenblick, da die Geschlagenen sich wieder stark genug fühlten, um den Kampf von Neuem aufzunehmen. Diese jahrhundertealte Feindschaft trat schließlich auch im religiösen Leben deutlich zutage. Die heiligen Stätten, die allen Stämmen gemeinsam waren, wurden in zwei, den beiden Parteien auf der Insel entsprechende Gruppen gegliedert.“ (Métraux 1988:73-74)
Die sozialen Schichten
Die alten tribalen und hierarchischen Strukturen sind heute vollständig verschwunden. In früheren Zeiten war die Gesellschaft der Rapanui indes streng geschichtet. „An der Spitze befand sich der ariki-mau oder Großhäuptling“, der verschiedentlich auch als „König der Insel“ bezeichnet wurde. Nach ihm kamen „die Priester, ivi-atua, und die ariki-paka oder Adligen.“ Diesen Titel erhielten alle Mitglieder des Stammes der Miru, die somit den „Stamm des Königs darstellten und Nachkommen von Hotu-matua waren“. Viele Priester dürften aus der Adligen-Klasse gestammt haben.
„An vierter Stelle kamen die mata-to’a oder Krieger. Ganz am untersten Ende der sozialen Stufenleiter finden wir die kio. Dieses Wort, das je nach dem Zusammenhang mit ‘Besiegter‘, ‘Diener‘ oder ‘Höriger‘ übersetzt werden kann, wurde für alle Personen in untergoerdneter Stellung angewendet. Künstler, Handwerk oder Spezialisten, die in Gilden zusammengefaßt waren, hatten dagegen eine gehobene Stellung“, deren genaue Struktur allerdings unklar bleibt.„Diese Abstufung in den Gesellschaftsklassen erweist sich aber als hohl, wenn es sich um die politische Macht handelt. Die mata-to’a besaßen, da sie nicht adlig waren, nicht den gleichen Rang wie der König und die ariki, doch hatten sie nicht weniger Autorität.“ (Métraux 1988:74-75)
König
„Wie auf den Marquesas-Inseln und auf Tonga war der König ein heiliges Wesen, dessen magische Kraft die Natur beeinflußte und seinem Volk den regelmäßigen Un terhalt sicherte. Diese Macht, die über die Pflanzen- und Tierwelt gebot, war die mystische Kraft des Königs, sein Mana, das ihm von seinen göttlichen Vorfahren verliehen worden war“, namentglich den Göttern Tangaroa und Rongo (Métraux 1988:75).
„Der ariki-mau war von seinen Untertanen durch zahlreiche Tabus getrennt, die einerseits seine göttliche Natur bekräftigten, andererseits die übrigen Sterblichen vor der Berührung mit seinem Mana schützten. Der Kopf stellte den heiligsten Teil seiner Person dar und war von den allerstrengsten Tabus umgeben. Es konnte genügen, daß er irgendeinen Gegenstand ‘meinen Kopf‘ nannte, um diesen dadurch unbeührbar zu machen. Er trug die Haare lang, denn keine Hand war heilig genug, um sie ihm zu schneiden.“ Dem König war eine Reihe von Tätigkeiten nicht gestattet, und er „lebte allein in seiner Hütte. Er teilte sie nicht einmal mit seiner Gemahlin, die eine Hütte neben der seinigen bewohnte. Zwei Arten von Dienern, die dem Stamme der Miru angehörten, versorgten den Herrscher: die tu’ura bebauten die Felder der königlichen Domäne und begleiteten ihn beim Fischfang, während die haka-papa seine Speseisen zubereiteten und ihm bei den Mahlzeiten aufwarteten. Verließen diese Diener den König, so entfernten sie sich rückwärts gehend. Wer dem König etwas mitzuteilen hatte, vertraute ihnen sein Anliegen an.“ Auch „der komplizierte Charakter und die Ausdehnung seiner Tatauierung“ unterschieden den König von den anderen Osterinsulanern (Métraux 1988:77-78)
Der König entstammte dem Geschlecht der Honga, die in der Bucht von Anakenas residierten. „Die zum Strand herabführenden Wege waren von Stangen flankiert, die mit Federgirlanden geschmückt waren. Nur der König und die Königin – oder die Königinnen – und ihre Dienerschaft hatten das Recht, das Gestade hier zu betreten. Es lag ein Tabu auf ihm und wer sich dorthin wagte, mußte es mit dem Tode bezahlen.“
Einer alten Tradition zufolge wurden die Söhne des Königs in eine Dorf beim ahu Papa-o-pea erzogen. Der frisch ernannte König residierte in Ahu-akapu nahe Tahai an der Westküste. Wenn der alte König dann auf seinen Titel verzichtete, residierte er in Anakena. Traditionellen Vorgaben entsprechend „verlor der König seinen Rang bei der Geburt seines ersten Sohnes. Das in ihm enthaltene Mana ging in das kleine Wesen ein, das nun seinerseits zum Vermittler zwischen dem Stamm und den Göttern wurde. In Wirklichkeit jedoch behielt der König seine Macht als Regent bis zu dem Augenblick, in dem sein Erbe ein Alter erreicht hatte, das ihm die Ausübung seiner Funktionen gestattete. Dieser Zeitpunkt wurde durch seine Heirat bestimmt.“ (Métraux 1988:79)
Priesterschaft
Die Stände der Priester und der Adligen waren eng miteinander verwoben. Die Oberpriester wurden aus der engeren Familie der Königs gewählt. Was die Priester betrifft, so drückte schon deren Name, ivi-atua „Geschlechter der Götter“, ihre Beziehung zu den Gottheiten aus. „Sie bildeten eine Hierarchie, deren Stufen sich aus dem Gedächtnis der christlichen Generationen vollständig verwischt haben.“ Sie wurden in den Berichten über die Insel „bald als gewöhnliche Zauberer, bald als Hilfskräfte im Dienst eines höher entwickelten Kultes bezeichnet … Die Priester, die ihr Amt in den königlichen Heiligtümern ausübten, bewahrten zugleich die heiligen und profanen Überlieferungen.“ Sie waren „zweifellos sehr begütert“ und verfügten „über die Opfergaben an Hühnern, Fischen und Knollenfrüchten, die den Göttern dargebracht wurden. Ihre Macht konnte fürchterlich sein, denn die Hohenpriester bestimmten auch die Wahl der Menschenopfer.“ Mit der Entführung sämtlicher Angehöriger der Priesterkaste im Jahr 1862 endete diese Tradition jedoch (Métraux 1988:81).
Handwerker
Handwerker mussten „altüberlieferte Handgriffe kennen und Riten sowie Zaubermittel wissen, die seine Arbeit glücken“ ließen und sie vor jeder Gefahr bewahrten. Ihre Bezeichnung, tahunga, galt mitunter auch für die Priester. „Die Handwerker bildeten wahrscheinlich Gilden mit altüberlieferten Techniken und Kulten. Ihre soziale Stellung hing natürlich von der Bedeutung ihrer Tätigkeit für das Wirtschaftsleben ab. Eine der wenigen Gilden, deren Existenz als historisch verbürgt gelten kann, ist die der Bildhauer der Statuen“. Ihre Mitglieder waren hoch angesehen, und noch in den 1930er Jahrensprachen osterinsulaner „voll Stolz von ihren Vorfahren, welche die großen Bildwerke hergestellt hatten.“
Eingeweiht wurde der Sohn eines Handwerkers von seinem Vater, doch standen die Gilden allen offen, „die einen Beweis ihres Talentes erbrachten. Der Meister nahm die Bestelllungen entgegen und überwachte deren Ausführung. Es gab auch eine Vereinigung der Hochseefischer, die sich großer Netze bediente und gemeinsame Fahrzeuge besaß.“ (Métraux 1988:81-82)
Krieger
Der Krieger, mata-to’a, verbreiteten oft Angst und Schrecken, und immer wieder gelang es ihnen, über ihren eigenen Stamm und auch „über andere Stämme die Herrschaft auszuüben.Unter diesen großen Kriegern war Kainga der berühmteste. Zuerst Häuptling der östlichen Stämme, konnte er seine Macht dann über die ganze Insel ausdehnen.“ Insgesamt war die politische und geselaslchaftliche Stellung des mata-to’a größer als auf anderen polynesischen Inseln. Einzelne Krieger „ließen sich die Erstlinge des Fischfanges darbringen“. Ihre spirituelle Rechtfertigung erhielten sie durch die Zeremonien von Orongo, „denn der mata-to’a, dessen Sklave das erste Ei des manu-tara entdeckt hatte, wurde zum Gefäß des großen Gottes Makemake.“ (Métraux 1988:82)
Sklaven
„Die Mitglieder eines besiegten Stammes flohen“ und „versteckten sich in felshöhlen. War die kampfeswut verrauscht, so wurden sie geschont, jedoch zu kio gemacht, und die Sieger nahmen sie auf ihre Ländereien mit, die sie nun bestellen mußten. Des Nachts wurden sie – in einer Höhle eingepfercht – streng bewacht.“ Viele wurden wieder in ihr altes Gebiet zurückgeschickt, mussten aber Abgaben leisten.
„Die Bezeichnung kio wurde auch für einen Landeigner verwendet, der sich unter den Schutz eines Kriegeers gestellt hatte und ihm nun als Preis für seine Sicherheit Abgaben leistete. Wurde jemand, der seines eigenen Lebensraumes beraubt worden war, Höriger bei einem reichen Mann, so wurde er der gleichen Kategorie zugerechnet.“ (Métraux 1988:83)
Gesundheitsversorgung
Die Gesundheitsversorgung ist weitaus besser als in anderen abgelegenen Regionen von Chile. 1964 kam eine kanadische wissenschaftliche Kommission (Medical Expedition to Easter Island – METEI) im Auftrag der UN auf die Osterinsel, um in einem Pilotprojekt den Zusammenhang zwischen Vererbung, Umwelt und Krankheiten zu untersuchen. Als sie 1964 die Insel verließ, blieben die in einige Containern untergebrachten modernen medizinischen Einrichtungen zurück. Sie bildeten den Grundstock für die Gesundheitsversorgung der Insel nach neuzeitlichem Standard. Unter Augusto Pinochet wurde 1975 das kleine Krankenhausgebäude errichtet, das heute einen Arzt, einen Zahnarzt, eine Hebamme sowie einen Pflegedienst beherbergt. Dort ist auch ein Ambulanzwagen stationiert. Ein Augenarzt kommt regelmäßig vom chilenischen Festland und hält Sprechstunden ab.
Krankheiten
Die Osterinsel wurde im Laufe ihrer Geschichte von verschiedenen Krankheiten heimgesucht, die oft von außen eingeschleppt wurden und schwerwiegende Folgen für die Inselbevölkerung hatten, mittlerweile aber nicht mehr hier anzutreffen sind:
- Lepra: Diese Krankheit gelangte 1860 mit zurückkehrenden Osterinsel-Fremdarbeitern aus Tahiti auf die Insel. 1920 erreichte die Lepra-Epidemie ihren öhepunkt, und 1917 wurde eine Lepra-Station am nördlichen Rand von Hanga Roa errichtet.
- Pocken: Diese Krankheit wurde von europäischen Entdeckern eingeschleppt und trug zum Bevölkerungsrückgang bei.
- Syphilis: Ebenfalls von Europäern eingeführt, verbreitete sich die Syphilis im 18. Jahrhundert auf der Insel.
- Tuberkulose: Auch diese Krankheit wurde von europäischen Besuchern auf die Insel gebracht.
- Grippe: Die von den Europäern eingeschleppte Grippe tötete viele Bewohner der Osterinsel.
Heute gibt es auf der Osterinsel einige spezifische Gesundheitsrisiken für Reisende:
- Dengue-Fieber: Auf der Osterinsel werden Dengue-Viren durch tagaktive Aedes-Mücken übertragen.
- Hanta-Virus: Diese seltene virale Erkrankung wird meist in ländlichen Gebieten durch Kontakt mit infizierten Nagetieren übertragen.
- Milbenfleckfieber: Im Südsommer 2023 wurde eine hohe Anzahl von Milbenfleckfieberfällen aus der Region Los Lagos im Süden gemeldet, einschließlich Fällen auf der Insel Chiloé
Bildung
An den fünf Schulen in Hangaroa können alle Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife (Prueba de Aptitud, entspricht dem deutschen Abitur und der österreichischen/schweizerischen Matura) erworben werden. Ein Fach- oder Hochschulstudium ist jedoch nur auf dem Festland möglich. In einer der Grundschulen gibt es einen von der UNESCO unterstützten Schulversuch bilingualen Unterrichts mit Rapa Nui und Spanisch. Problematisch ist, dass es auf Rapa Nui keine Druckerei gibt – alle Druckerzeugnisse auf Rapa Nui müssen auf dem chilenischen Festland gedruckt werden, was die Herstellung erheblich verteuert.
Schule 1993:
Lehrer 27
Schüler 779
davon Vorschule (pre basica) 7
Grundschule (basica) 560
Mittelschule (media) 90
Erwachsenenbildung 53
Wissenschaft
Die Osterinselkultur stellt die europäischen und amerikanischen Forscher, die sich seit den ersten Missionaren im späten 19. Jahrhundert mit ihr befassen, noch heute vor viele Rätsel. Am berühmtesten ist wohl der Norweger Thor Heyerdahl, der zu beweisen versuchte, dass die Bewohner der Insel ursprünglich aus Südamerika kamen. Mit seinem nach alten Vorbildern gebauten Floß „Kon Tiki“ gelang es ihm, die Strecke vom Festland bis hin zu einer anderen, 8000 Kilometer entfernten Südseeinsel zu überwinden. Genetische und linguistische Forschungen haben aber heute ergeben, dass die Ursprünge der Bevölkerung der Osterinsel wirklich aus dem polynesischem Raum kam.
Das heutige Inselmuseum sowie die Inventarisierung der Statuen und Bauwerke und eine Erforschung der ursprünglichen Sprache, Grammatik und der alten Legenden ist dem Pater Sebastian Englert zu verdanken, der von 1937 bis 1969 auf der Insel lebte.
Verschiedene Mythen und Theorien ranken sich um die Osterinsel und ihre Bauwerke. So gab die Tatsache, dass in den Kratern Pollen von kiefernähnlichen Bäumen gefunden wurden, Anlaß zu der Spekulation, die Osterinsel wäre nur der obere Teil einer größeren, durch ein Erdbeben oder eine ähnliche Naturkatastrophe versunkenen Landmasse. Auch hierzu soll es Legenden geben, die davon berichten, dass König Hotu Matua einst über ein großes Land namens Hiva geherrscht hätte, das bei einer Art Sintflut versank, so dass nur die eine Insel übrig blieb, um die Überlebenden auf zu nehmen. Eine andere behauptet, der erzürnte Gott Uoke hätte die Landmasse mit einem „Hebelbalken“ zerbrochen.
Nahe liegt es auch, die Steinstatuen und ihren Transport - gerade den bereits angesprochenen durch die beiden Priester, die das Mana beherrschen und die Figuren zum eigenständigen Gehen animieren konnten - mit Außerirdischen in Verbindung zu bringen, die auf der Insel ein Zeichen setzen wollten. Forscher, die sich mit diesem Gebiet beschäftigen, vermuten eine Art Antigravitation, möglicherweise durch Manipulationen am anormalen Magnetfeld der Insel. Ein weiterer Hinweis auf solche „„himmlischen Besucher“ ist in der Legende der Vogelmenschen zu finden, in denen der Gott Make Make Vögel bis zur Insel Matakiterani jagte - der ursprüngliche Name für die Osterinsel, der übersetzt „Auge, das den Himmel sieht“ bedeutet.
Weitere Fragen werfen Parallelen zur Baukunst, wie das mörtellose Mauern von großen Steinkonstruktionen, zu Ähnlichkeiten zwischen geschnitzten Holzskulpturen und auch zu den Überlieferungen der südamerikanischen Hochkulturen auf. Diese möglichen Verwandtschaften könnten sowohl durch das frühere existieren einer Landbrücke als auch durch die Besuche von Außerirdischen in beiden Gebieten erklärt werden. Welche Geheimnisse hinter den Steinköpfen, den Schnitzereien und den Göttersagen stecken, werden wir vermutlich niemals erforschen können, nicht zuletzt, weil die einzigen Schriftzeugnisse - in Rongorongo genannte Holzplatten geschnitzte und bislang noch nicht entschlüsselte Hieroglyphen - im Zuge der Christianisierung zum allergrößten Teil zerstört wurden. Ob die Steinstatuen mehr waren als nur der Ausdruck menschlicher Machtansprüche, werden sie demnach weiterhin für sich behalten. (http://www.osterinsel-info.de/html/osterinsel6.html 12.7.2011)
Kultur
Die Bewohner der Osterinsel haben Objekte sowohl aus Stein als auch aus Holz hergestellt. Die erhaltenen Holzschnitzereien gelangten durch Kauf oder Tausch mit den europäischen Expeditionen in den Bestand der Sammlungen.
Architektur
Das Paenga-Haus (hare paenga) ist ein Haus der klassischen Osterinsel-Kultur, dessen Form an einen umgedrehten Bootsköper erinnert und das der religiösen und politischen Elite vorbehalten war. Das Wort paenga hat in der Sprache der Osterinsel eine Doppelbedeutung, es bezeichnet sowohl den geschnittenen bzw. bearbeiteten Stein, bedeutet aber auch Großfamilie oder Familienverband. Hare Paenga heißt also sowohl Haus für die Großfamilie, das bezieht sich auf die Nutzung, als auch Haus aus Stein, das bezieht sich auf das beim Bau verwendete Material.
Grundlage des Paenga Hauses waren sorgfältig bearbeitete Fundamentsteine aus hartem Basalt, etwa in Größe und Gestalt unserer heutigen Bordsteine, die in Form einer langgestreckten Ellipse ausgelegt und 30 bis 100 cm in den Boden eingegraben wurden. Die Oberseite jedes Steines wies zwei oder mehr Bohrungen auf, in die dünne Äste aus Toromiro-Holz gesteckt wurden. Die Holzstangen zog man als Rahmenwerk kuppelförmig zusammen und band sie an eine lange Firststange, sodass ein länglichrundes, korbförmiges Gebilde entstand.
Die Eindeckung war dreischichtig. Auf den Holzrahmen schnürte man als innerste Schicht geflochtene Matten aus Totora-Schilf. Darauf kam eine Lage aus Zuckerrohrblättern (toa oder rau toa) und als äußerste Schicht dienten Grasbündel (mauku), die an den Querstreben befestigt wurden. Möglich ist auch, aber heute nicht mehr nachvollziehbar, dass man ursprünglich Palmwedel einer Honigpalmenart (der Gattung Jubaea), schuppenartig übereinandergelegt zur Dachdeckung verwendete. Als die Palmwälder durch Raubbau bereits vernichtet waren, musste man nach alternativen Pflanzenmaterialien suchen.
Das Gebäude besaß als Eingang nur einen niedrigen Tunnel, nicht breiter und höher als einen Meter, sodass das Haus nur kriechend betreten werden konnte. An jeder Seite des Eingangstunnels steckte eine kleine Holzfigur im Boden als Schutz gegen „böse Geister“
Der halbkreisförmige Vorplatz war mit Rollkieseln (poro) gepflastert und diente als Aufenthaltsort für die Bewohner und für allerlei Verrichtungen des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Nahrungszubereitung und handwerkliche Tätigkeiten. Unmittelbar daneben lag der Erdofen (umu), eine quadratische oder sechseckige, mit Basaltsteinen ausgekleidete Erdgrube.
Der Innenraum des Hauses war nicht unterteilt und wies, wie Roggeveen berichtet, keinerlei Mobiliar auf, lediglich einige hölzerne Haken, die von der Decke hingen und Kalebassen für die Aufbewahrung von Wasser. Carl Friedrich Behrens, der Kommandeur der Seesoldaten Roggeveens, erwähnt auch geflochtene Schlafmatten und rot-weiß gefärbte Decken aus Tapa-Rindenbaststoff
Hare-Paenga waren durchschnittlich zwischen 10 und 15 Metern lang und etwa 1,5 bis 2 m breit. Es gab aber auch vereinzelt größere Häuser zu Wohnzwecken (bis 40 m Länge). Versammlungshäuser waren noch größer.
Vom europäischen Entdeckern des 18. Jahrhunderts liegen Reiseberichte vor, die noch intakte und genutzte Paenga-Häuser beschreiben: Sie „waren nicht mehr als zehn bis zwölf Hütten zu sehen. Eine der stattlichsten war auf einem kleinen Hügel gebaut, und die Neugier trieb uns hin, aber es war eine elende Wohnung. Wer hinein oder hinaus wollte, musste auf allen vieren kriechen. Das Innere war leer und kahl, und man fand nicht einmal ein Bund Stroh darin. Unser Begleiter erzählte uns, daß sie die Nacht in diesen Hütten zubrächten, allein das muß ein elender Aufenthalt sein, zumal sie wegen der wenigen Hütten einer über dem anderen liegen müssen.“ (Georg Forster)
Da „ich mir beinahe mit Gewißheit zu behaupten getraue, daß sich die sämtlichen Einwohner eines Dorfes, oder Districtes, der Wohnungen gemeinschaftlich zu bedienen pflegten. Ich maß einige dieser Wohnungen, die nicht weit von dem Orte, wo wir Posto gefasst hatten, befindlich war. Sie war 310 Fuß lang, 10 Fuß breit, und in der Mitte 10 Fuß hoch. Ihrer Form nach glich sie einer umgekehrten Pirogue. Sie hatte nicht mehr als zwei Thüren, diese waren nur zwei Fuß hoch, so dass man auf Händen und Füßen hineinkriechen mußte, und das ganze konnte mehr als zweihundert Personen fassen. Dem Oberhaupte dieses Volkes konnte sie keineswegs zum Aufenthalte angewiesen sein, denn es befanden sich keine Geräthschaften darin; auch würde ihm ein solcher Umfang zu nichts gedient haben; sondern sie macht vielmehr, nebst noch zwei oder drei anderen Hütten, welche nicht weit davon liegen, ein ganzes Dorf aus.... andere [Wohnungen] hingegen sind aus Binsen verfertigt, welches zum Beweis dienet, dass es im Innern dieser Insel sumpfige Gegenden giebt. Diese Binsen sind auf eine sehr künstliche Art in einander verflochten, so dass kein Regen durchdringen kann. Das Gebäude selbst ruhet auf einer Grundlage von zugehauenen Steinen, zwischen denen man in abgemessenen Distanzen hie und da Löcher angebracht und Stangen hineingesteckt hat, die an dem oberen Theile bogenförmig gekrümmt sind, und auf diese Art das Sparrenwerk formiren. Die zwischen diesen Stangen befindlichen leeren Stellen, sind mit Matten ausgefüllt, die man aus Binsen zu flechten pflegt.“ (Jean-François de La Pérouse)
„Ihre Häuser sind niedrig, lang und schmal und haben in vielem das Erscheinungsbild eines großen umgekippten Bootes, dessen Kiel gerundet und verbogen ist; das längste von ihnen, welches ich sah, maß 60 Fuß in der Länge, 8 oder 9 in der Höhe im Mittelteil und 3 oder 4 an jedem Ende, ihre Breite indes war nahezu überall gleich; die Tür befand sich inmitten der einen Seite, gebaut gleich einer Veranda, so niedrig und eng, daß es gerade einem einzigen Mann möglich war, auf allen Vieren hindurchzukriechen. Die Wände bestehen aus kleinen Zweigen und die Deckung der Dächer aus Zuckerrohr und Feigenblättern, und reicht von den Grundfesten bis zum Dach, so daß sie kein Licht haben, außer jenem, welches der kleine Eingang gestattet.“ (James Cook)
Diese frühen Berichte sind insoweit interessant, als sie Tatsachen enthalten, die durch archäologische Befunde nicht mehr zu sichern sind, wie zum Beispiel die vergänglichen Materialien zur Dacheindeckung, die Nutzung als Generationenhäuser für die Großfamilie oder das Fehlen jeglicher Inneneinrichtung. Da die ersten europäischen Entdecker sich jeweils nur wenige Stunden auf der Osterinsel aufhielten, sind die Berichte lückenhaft, sie lassen zum Beispiel keine genaueren Rückschlüsse zur Siedlungsstruktur zu.
Paenga-Häuser waren sehr aufwendig gebaut und daher der Machtelite des Stammes, den Familien der Häuptlinge und Priester, vorbehalten. Genutzt wurden sie von der gesamten Großfamilie gemeinsam. Wie bereits die frühen Berichte andeuten, dienten die Häuser nur zum Schlafen und nicht zum ständigen Aufenthalt. Gekocht wurde für die gesamte Familie in dem nahebei gelegenen Erdofen, die Mahlzeiten auf dem gepflasterten Vorplatz eingenommen. Auf dieser Terrasse spielte sich ansonsten auch das gesamte Familienleben ab.
Jede Siedlung umfasste nur wenige Paenga-Häuser, die bisherigen Ausgrabungen deuten selbst bei großen Dörfern auf maximal ein halbes Dutzend hin. Die gewöhnlichen Stammesangehörigen wohnten in einfach gebauten und wesentlich kleineren Hütten, die, mitten in den Anbauflächen versteckt, deutlich weiter von der Küste und der Zeremonialplattform entfernt lagen. Insoweit ist es verständlich, dass die Europäer sie bei ihren Kurzbesuchen nicht wahrnahmen bzw. weitgehend nicht für erwähnenswert fanden.
Es ist einleuchtend, dass die Errichtung eines Hauses von solcher Bedeutung auch besonderer Riten bedurfte. Einen Hinweis darauf gibt der Bericht von Katherine Routledge: „Ngaara [der letzte Häuptling des Miru-Clans, gestorben in peruanischer Sklaverei Mitte 19. Jahrhundert] assistierte selbst bei der Einweihung eines jeden Hauses von Bedeutung. Die hölzernen Eidechsen wurde zu beiden Seiten des Einganges, dem Vorplatz zugewandt, in den Boden gesteckt. Der „ariki“ [Häuptling, Stammesführer und künftige Besitzer des Hauses] und ein „ivi-atua“ [Priester von besonders hohem Rang], der wie ein „tatane“ [Geist, Gespenst] mit ihm ging, waren die ersten, die in dem Haus ihre [wahrscheinlich rituelle] Mahlzeit einnahmen. Nur die Hauser mit Steinfundamenten wurden auf diese Weise beehrt. Der Ariki wurde an einem bestimmten Monat im Jahr von allen Leuten [den Clan-Mitgliedern] besucht, die ihm die Pua-Pflanze [eine zu den Ingwergewächsen gehörende, heute auf der Osterinsel sehr seltene Pflanze] am Ende eines Stockes ins Haus reichten und sich dann rückwärts entfernten.“
Die in dem Bericht genannten hölzernen Eidechsen sind anthropomorphe Figuren, eine Kombination von Mensch und Eidechse. Die aus Holz geschnitzten Statuetten, wie das gleichnamige Tier moko genannt, haben den Kopf und den Körper der auf der Osterinsel häufigen Echse Ablepharus boutonii aus der Gattung der Natternaugen-Skinke. Gleichzeitig besitzen sie aber auch menschliche Attribute wie Rückgrat, Rippen, Arme und Hände. Häufig ist auf dem Körper eine Vulva eingekerbt, auf anderen Exemplaren ein beschnittener Penis. Der Echsenschwanz ist unnatürlich verlängert und läuft in einer Spitze aus, was die Beschreibung Routledges, die Figur habe im Boden gesteckt, bestätigt. Nach dem Bericht von Thomson vergrub man geweihte Steine unter dem Türeingang, die das Haus und die Bewohner vor Unheil schützen sollten.
Der Sage nach waren die Paenga-Häuser keine ureigene Erfindung der Osterinsel-Kultur, sondern wurden, wie viele andere nützliche Errungenschaften (Rongorongo-Schrift, Tapa-Rindenbaststoff, Moai und andere), von nHotu Matua, dem mythischen Gründervater, von der Insel Hiva auf die Osterinsel gebracht. Unter Hotu Matuas Gefolgsleuten befand sich ein Mann namens Nuku Kehu, der legendäre erste Baumeister der Osterinsel. (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Paenga-Haus 12.7.2011)
Bildende Kunst
Moai, übersetzt „Skulptur“, ist eine für die Inselkultur typische Steinstatue, konkret ein Steinkopf. Pater Sebastian Englert nummerierte und katalogisierte 638 Statuen. Ursprünglich aber waren es vermutlich über 1000. Trotz umfangreicher Forschungen ist ihr eigentlicher Zweck und die genaue Zeit ihrer Errichtung unter den Experten immer noch umstritten. Man geht heute davon aus, dass sie berühmte Häuptlinge oder allseits verehrte Ahnen darstellen, die als Bindeglied zwischen diesseitiger und jenseitiger Welt fungierten.

Die mehr als 900 bekannten Moai-Schnitzereien der alten Rapa Nui sind über die ganze Insel verstreut. Die meisten von ihnen wurden aus dem Tuffstein des Vulkankegels Rano Raraku gemeißelt, von dem noch mehr als 400 Moai in verschiedenen Bauphasen erhalten sind. Der historische Zeitraum für die gesamte Entwicklung der verschiedenen Bautechniken liegt zwischen 700 und 1600. Alles deutet darauf hin, dass der Steinbruch plötzlich verlassen wurde und die halb gemeißelten Statuen im Felsen zurückblieben.
Praktisch alle fertigen Moai, die ursprünglich auf einer zeremoniellen Plattform oder einem Altar, in der Sprache der Rapa Nui ahu genannt, aufgestellt waren, wurden in der Zeit nach der Einstellung des Baus im 15. Jahrhundert. Seit 1956 wurden einige von ihnen restauriert.
Ursprünglich trugen diese riesigen Statuen auch Wappen oder Bögen aus rotem Stein mit einem Gewicht von mehr als zehn Tonnen, die Pukao genannt wurden und aus dem Krater Puna Pau gewonnen wurden. Nach der Bearbeitung mussten sie auf die richtige Höhe gebracht werden, um sie auf die Köpfe zu setzen.
Bei der Restaurierung des Nau-Nau ahu am Strand von Anakena im Jahr 1978 wurde entdeckt, dass in den Augenhöhlen früher Korallenplatten als Augen angebracht waren. Diese wurden entfernt, zerstört, vergraben oder ins Meer geworfen, wo man sie ebenfalls gefunden hat. Dies stimmt mit der Theorie überein, dass sie von den Menschen selbst abgeschlagen wurden, vielleicht bei Stammeskriegen.
Die ersten europäischen Seefahrer, die im frühen 18. Jahrhundert auf der Osterinsel ankamen, trauten ihren Augen nicht. Jahrhundert auf der Osterinsel ankamen, trauten ihren Augen nicht: Auf dem kleinen Stück Land entdeckten sie Hunderte von riesigen Statuen, die über die gesamte Oberfläche der Insel verteilt waren.
Die Bedeutung der Moai ist immer noch unklar, und es gibt mehrere Theorien zu diesen Statuen. Die gängigste besagt, dass die Statuen von den polynesischen Bewohnern der Insel zwischen dem 9. und 16. Jahrhundert als Darstellungen verstorbener Vorfahren geschnitzt wurden, damit diese ihr Mana (übernatürliche Kraft) auf ihre Nachkommen projizieren konnten.3 Sie müssen auf den Ahuans (Ahuans) gestanden haben, oder Ahuans (Ahuans).
Sie mussten auf den ahu (Zeremonialplattformen) mit dem Gesicht zum Inselinneren aufgestellt werden (mit Ausnahme der sieben auf dem Ahu Akivi und eines vierhändigen Moai, der die Wintersonnenwende auf dem Ahu Huri A Urenga markiert) und, nachdem sie mit Korallenaugen mit Pupillen aus Obsidian oder rotem Vulkangestein versehen wurden, wurden sie zu aringa ora („lebendes Gesicht“) eines Vorfahren - der vollständige Name der Statuen in der lokalen Sprache lautet aringa ora o te tupuna („lebende Gesichter der Vorfahren“).
Eine Studie von Lipo, Matt Becker und Tanya Bronson von der California State University, Long Beach, legt nahe, dass diese zeremoniellen Statuen aufgestellt wurden, um die Standorte von Trinkwasser zu markieren, einer Ressource, die auf dieser Vulkaninsel schwer zu finden ist. Sie fanden heraus, dass es dort, wo es keine Moai gibt, auch kein Süßwasser gibt, und dass es dort, wo es Moai gibt, sogar im Inneren der Insel, nahe gelegene Trinkwasserquellen gibt.
Vulkangestein ließ sich mit Basalt- und Obsidianwerkzeugen relativ leicht bearbeiten, so dass sie im Steinbruch selbst ihre Grundform erhielten. Anschließend wurden sie abgebaut und in der Nähe halb vergraben, um die Details herauszuarbeiten.
Es ist nicht genau bekannt, wie sie bewegt wurden, aber es ist fast sicher, dass dazu Schlitten oder Holzrollen verwendet wurden. Eine zweite Theorie des tschechischen Ingenieurs Pavel Pavel aus dem Jahr 1982 schlägt die bisher einfachste und praktischste Lösung für die Versetzung vor, nämlich das Gewicht des Moai aufrecht zu halten und ihn „laufen“ zu lassen (der Überlieferung nach sind die Moai „gelaufen“), eine Theorie, die mit einem Betonmodell in der tschechischen Stadt Strakonice in die Praxis umgesetzt wurde, Diese Theorie wurde 1985 auf der Insel zusammen mit Thor Heyerdahl und Sergio Rapu an einem echten Moai und unter Verwendung von Materialien von der Insel getestet. Später haben der Archäologe Carl Lipo und der Anthropologe Terry Hunt diese Theorie erneut an einem rudimentären Betonmodell getestet.
Im Sommer 2000 entdeckte ein amerikanisches Archäologenteam Daten, die auf den Einsatz komplexer Maschinen auf der Insel vor Jahrhunderten hindeuteten. Der Geologe Charles M. Love und ein Team von siebzehn Studenten gruben Abschnitte der drei Hauptstraßen aus, die zum Transport der riesigen Statuen benutzt wurden. Ein Teil dieser Straßen wurde ursprünglich aus dem Grundgestein der Insel gegraben, das hauptsächlich aus vulkanischem Gestein, dem so genannten Pahoehoe, besteht.
Interessanterweise sind die Straßen nicht flach, sondern haben einen charakteristischen „V“- oder „U“-Querschnitt. Ihre durchschnittliche Breite beträgt 3,5 Meter und erfordert ein hohes Maß an technischem Know-how. In einigen Abschnitten werden die Straßen von Felsenreihen flankiert.
Das Erstaunlichste daran ist jedoch, dass diese Felsen nicht einfach dort platziert wurden, sondern in Löcher im Felsgestein, das den Boden der Insel bildet, eingelassen sind. Besonders auffällig ist, dass diese Löcher in den Abschnitten zu finden sind, in denen die Straße bergauf verläuft. Dr. Love vermutet, dass diese Löcher dazu dienten, eine Art Mechanismus zum Bewegen der riesigen Steinköpfe unterzubringen und die Unebenheiten zu überbrücken, die andernfalls nur mit erheblichem Aufwand zu überwinden gewesen wären. Diese Löcher sowie die merkwürdige Krümmung der Straße finden sich auch in der Felswand. Diese Löcher sowie die merkwürdige V-Form der Straßen deuten darauf hin, dass das System, mit dem die Eingeborenen der Osterinsel ihre geheimnisvollen Moai errichteten, noch immer nicht ganz geklärt ist.
Die wichtigsten Ahu und Moai sind:
- Der Ahu Akivi ist ein Ahu mit einer sehr präzisen astronomischen Ausrichtung, die Achse der Plattform wurde von Norden nach Süden ausgerichtet, so dass die Gesichter der Moai genau dem Punkt zugewandt sind, an dem die Sonne während der südlichen Frühlings-Tagundnachtgleiche (21. September) untergeht, und ihre Rücken der aufgehenden Sonne während der Herbst-Tagundnachtgleiche (21. März) zugewandt sind, und er ist der einzige, dessen Moai dem Meer zugewandt sind. Er wurde 1960 restauriert.
- Der Ahu Vinapu wurde mit Bautechniken hergestellt, die denen der Inkas und denen von Cuzco ähneln.
- Der Moai Paro, der höchste aller fertiggestellten Moai, befindet sich auf der Plattform Te pito kura, ist elf Meter hoch und wiegt etwa achtzig Tonnen. Der elf Meter hohe und etwa achtzig Tonnen schwere Moai ist heute abgerissen und in drei Teile zerlegt.
- Im Steinbruch von Rano Raraku befindet sich eine unvollendete, einundzwanzig Meter hohe Statue.
- Ahu Tongariki ist mit einer Länge von 200 Metern und 15 Moai die größte der bestehenden Plattformen. Sie wurde zwischen 1992 und 1997 vom Osterinsel-Institut der Universität Chile restauriert.
- Im Jahr 1929 schenkten die Inselbewohner dem Präsidenten Carlos Ibáñez del Campo einen Moai, den dieser jedoch wieder loswurde, da ihm ein Berater der Legende nach sagte, er bringe Unglück.
Darüber hinaus sind weitere Arten von Moai-Holzfiguren bekannt:
- Moai papa (paapaa, pa’a pa’a): Eine überwiegend weibliche, gelegentlich auch hermaphroditische Figur, die einen weniger „skelettartigen“ Körperbau aufweist. Obwohl die Vulva meist deutlich ausgeprägt ist, ist das gesamte Erscheinungsbild der Gestalt eher männlich, bei einigen Figuren ist sogar ein Spitzbart vorhanden.
- Moai tangata: Eine realistischer geschnitzte männliche Figur, mit schlankem, knabenhaftem Körperbau und ebenfalls einem deutlich ausgebildeten Spitzbart.
- Moai tangata manu: Der Vogelmann, eine zoomorphe Mischung aus Mensch und Fregattvogel. Die wenigen erhaltenen Statuen sind sehr unterschiedlich, sie variieren in Größe, Haltung, Gestalt des Schnabels und im Körperbau. Eine Figur im American Museum of Natural History in New York ist mit Rongorongo-Schriftzeichen bedeckt. Der Vogelmann ist häufiges Motiv der Petroglyphen der Kultstätte Orongo auf der Osterinsel.
Von den etwa neunhundert Moai auf der Osterinsel befinden sich etwa vierhundert im Steinbruch von Rano Raraku, 288 sind mit dem Ahu verbunden, und der Rest ist in verschiedenen Teilen der Insel verstreut, wahrscheinlich auf dem Weg zu einem Ahu verlassen.
Von der Gesamtzahl wurden mehr als 800 in den Lapilli-Tuffstein von Rano Raraku gehauen, 22 in weißen Trachyt, 18 in rote Schlacke und 10 in Basalt. Die durchschnittliche Höhe der Moai beträgt etwa 4,5 Meter, aber die alten Rapa Nui waren in der Lage, zwei zehn Meter hohe Statuen zu bearbeiten und zu bewegen.
Das Standardgewicht liegt bei etwa fünf Tonnen, und nicht mehr als dreißig bis vierzig Statuen wiegen mehr als zehn Tonnen. Dies entspricht der Periode der vollen Entwicklung der Rapa-Nui-Kultur, der sogenannten Ahu-Moai-Periode, die zwischen 1500 und 1600 liegt.
Es gibt eine vielfältige Typologie von Moai, die zweifellos auf eine Entwicklung in Bezug auf Design - das im Laufe der Zeit immer stilisierter und kunstvoller wurde -, Größe, Techniken und Materialien zurückzuführen ist. Sie können nach ihrer Höhe wie folgt klassifiziert werden:
Als Moai bezeichnet man auch kleine, durchschnittlich vierzig Zentimeter hohe, geschnitzte Figuren, vorwiegend aus Toromiro-Holz. Die verbreitetste Form, Moai kavakava, zeigt einen ausgehungert wirkenden Mann mit deutlich vorstehenden Rippen, einem überdimensionierten, schädelartigen Kopf, langen Ohrläppchen, einer ausgeprägten Nase und einem Spitzbart. Der Zweck der Figuren ist unbekannt. Sie werden heute als Ahnenbildnisse mit der Funktion eines Schutzgeistes gedeutet, möglicherweise stellen sie Aku Aku dar.
Bei den meisten noch erhaltenen Holzfiguren ist eine Öse oder Bohrung im Nackenbereich nachweisbar. Kapitänleutnant Geiseler berichtet, dass Würdenträger bei Prozessionen zehn bis zwanzig solcher Figuren um den Hals getragen hätten. In der übrigen Zeit seien die Bildnisse, in Tapa-Säckchen eingehüllt, in den Hütten aufgehängt worden.
Die Holzfiguren sind heute über die Museen der ganzen Welt verstreut. In Deutschland befinden sich Moai verschiedener Art unter anderem im Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln, im Ethnologischen Museum in Berlin, im Museum für Völkerkunde Dresden und im Überseemuseum Bremen.
Rei Miro ist ein nur in der Kultur der Osterinsel bekanntes hölzernes Pektoral, vorwiegend aus Toromiro-Holz geschnitzt. Es hat eine mondsichelartige Form, die aber auch als Bootskörper gedeutet werden kann. Die beiden Enden sind häufig als menschliche oder tierische Köpfe mit feinen Gesichtszügen ausgebildet. An den oberen Enden befinden sich Löcher für eine Umhängeschnur. Einige Pektorale sind mit Schriftzeichen versehen. Rei Miro von der Osterinsel finden sich in den verschiedensten Museen der Welt. Ihre Bedeutung (Kultgegenstand, Schmuck oder Rangabzeichen) ist unbekannt.
Ao und Rapa sind paddelförmige, aus Holz geschnitzte Ritualobjekte, die als Rangabzeichen hoher Würdenträger, aber auch bei rituellen Tänzen verwendet wurden.
Rongorongo
Rongorongo (roŋoroŋo) ist ein Schriftsystem, das hauptsächlich mit Obsidianspitzen in Holztafeln geschnitzt und dann mit Haifischzähnen geschliffen wurde. Die früheste bekannte Aufzeichnung von Rongorongo ist vermutlich eine Holztafel aus dem 15. bis 16. Jahrhundert. Die Rapanui nannten es auch kohau rongo rongo. Die gängige Übersetzung des Begriffs kohau ist Holz, das zur Herstellung des Rumpfes von Kanus verwendet wird, und rongo rongo bedeutet „Nachricht“.
Im Jahr 2024 unterziog ein Forschungsteam um Silvia Ferrara von der Universität Bologna vier Rongorongo-Tafeln, die in einer Sammlung in Rom aufbewahrt werden, einer Radiocarbon-Datierung. Die Analysen ergaben in einem Fall „eine besonders sichere Datierung auf das 15. Jahrhundert. Dieses Ergebnis liefert damit einen Hinweis auf die Verwendung der Schrift in einem Zeitraum vor der Ankunft externer Einflüsse und damit auf eine völlig eigenständige Entwicklung“, auch wenn nicht auszuschließen ist, dass aljtes Holz bei der Niederschrift verwendet worden sein könnte. „Rongorongo könnte eine der wenigen unabhängigen Erfindungen der Schrift in der Geschichte der Menschheit darstellen, was die kulturellen Entwicklungen der Bewohner der Osterinsel noch komplexer erscheinen lässt.“ (Vieweg 2024)
Die Symbole oder Glyphen sind entlang von Rillen eingeritzt, die vor der Gravur auf den Artefakten angebracht wurden, und sind durchschnittlich zwischen 9 und 14 mm hoch. Sie scheinen Figuren von anthropomorphen Wesen in verschiedenen Körperhaltungen, andere Fantasiewesen, die Vögeln, Pflanzen und anderen Land- und Wassertieren ähneln, himmlische Objekte sowie geometrische Objekte, kleine Haken und anderes darzustellen. Eine der Besonderheiten des Rongorongo ist, dass die erste Zeile von links nach rechts geschrieben wurde, dann wurde die Tafel um 180 Grad gedreht, um die nächste Zeile zu schreiben undsoweiter. Es gibt etwa 400 aufgezeichnete Rongorongo-Zeichen.
Das gesamte überlieferte Schrifttum umfasst lediglich rund 14.000 Zeichen. Die Schrift besteht aus insgesamt 600, mit Ligaturern rund 1500 Symbolen, die sich jedoch auf 120 Grundbestandteile reduzieren lassen, die als Bauelemente Verwendung finden. Thomas Barthel hat diese Zeichen erfasst, katalogisiert, in Gruppen eingeteilt und eine statistische Auswertung vorgenommen. Seine Gruppierung und Kodierung mit dreistelligen Zahlen ist im Prinzip heute noch gültig, obwohl andere inzwischen Verfeinerungen und Ergänzungen dieses Systems vorgenommen haben.
Die Schrift diente – darüber herrscht weitgehend Konsens – ausschließlich den Zwecken einer religiösen und machtpolitischen Elite. Die Stammesgesellschaft Polynesiens war streng stratifiziert und hierarchisch ausgerichtet. An der Spitze standen die ariki (Häuptlinge, Stammesoberhäupter), die Inhaber aller Ressourcen. Gleichzeitig mit ihrer weltlichen Macht symbolisierten sie auch die höchsten religiösen Autoritäten. Gestützt wurden sie von einer Priester- und Adelskaste, oft enge Familienangehörige. In Polynesdien wurden Traditionen – und in einer streng hierarchischen Gesellschaftsordnung verstand man darunter vorwiegend Regeln, Riten und Herrschaftsgenealogien – in Form von Rezitationen und rituellen Gesängen weitergegeben. Solche Kenntnisse waren wichtig für die Kontinuität der Dynastien, da die Herrscher ihre Legitimation in einer ununterbrochenen Reihenfolge auf die Gründerahnen zurückführen mussten.
Wissen war Herrschaftswissen und daher ist es einleuchtend, dass die Kenntnis solcher Traditionen bestimmten Personen vorbehalten war. Meister gaben ihr Wissen mündlich an ausgesuchte Schüler weiter. Dabei erhielt die wortgetreue Wiederholung der Texte höchste religiöse Bedeutung. Die Entwicklung mnemotechnischer Hilfsmittel war daher eine wertvolle Errungenschaft.
Pater Sebastian Englert berichtete in „La Tierra de Hotu Matu’a“ von einer solchen Schreibschule: „Ein alter Mann, der in seiner Jugend am Unterricht teilnahm, erzählte einigen heute [in den 1930er Jahren] noch lebenden Personen davon: Die Disziplin war sehr streng. Die Schüler mussten zuerst die Texte lernen. Sie durften weder sprechen noch spielen, sondern mussten aufpassen, auf den Knien hockend, die Hände vor der Brust zusammengelegt … Nachdem die Schüler gelernt hatten, die Texte zu rezitieren, begannen sie die Zeichen zu kopieren, um sich an das Schreiben zu gewöhnen. Diese Kopierübungen wurden nicht auf Holz gemacht, sondern mit einem Stilus aus einem Vogelknochen auf Bananenblättern. Erst wenn sie ein gewisses Maß an Vollkommenheit erreicht hatten, schrieben die Schüler auf hölzernen Tafeln, vorzugsweise aus Toromiro. Zu diesem Einritzen benutzten sie sehr feine Obsidiansplitter oder scharfe Haifischzähne.“
Obwohl nach den Erzählungen der Rapanui die Sprecher die Schrifttafeln bei ihrem Vortrag in Händen hielten, ist es fraglich, ob sie als Gedächtnisstütze für eingeweihte Rezitatoren dienten, um Gesänge von religiöser Bedeutung fehlerfrei vortragen zu können. Die Vortragenden haben den Wortlaut wahrscheinlich nicht abgelesen, in dem Sinne, den wir mit dem Begriff „lesen“ verbinden. Sie waren langjährig geübte Profis, die, ebenso wie heutige Opernsänger, keine Gedächtnisstütze brauchten. Die geschriebenen Zeichen hatten wohl eher den Zweck, den mündlichen Vortrag zu verstärken und mit mehr Mana zu unterlegen. Zwar war der öffentliche Vortrag ritueller Gesänge in vielen polynesischen Kulturen verbreitet, dieser Entwicklungsschritt ist jedoch nirgendwo sonst vollzogen worden (Métraux 1940:392). Zweifellos waren die Tafeln wirkmächtige Kultgegenstände und in höchstem Maße mit Magie behaftet. Dafür spricht eine Anmerkung bei Alfred Métraux, der von einem alten Rapanui erfahren hatte, dass die Rongorongo-Zeichen die Fähigkeit besäßen, Krankheiten auszulösen oder gar den Tod zu bringen
Die in Binsenmatten eingerollten Tafeln wurden in den Paenga-Häusern aufbewahrt und waren mit einem Tapu behaftet. Sie durften von den gewöhnlichen Stammesangehörigen nicht berührt werden, man präsentierte sie öffentlich nur anlässlich besonderer Gelegenheiten, Feste und Riten. Bei Kriegszügen waren sie besonders begehrte Beutestücke. Das Lesen der Tafeln war den tangata rongorongo vorbehalten, Schriftgelehrten, die sich aus den Familien der Häuptlinge und Adeligen rekrutierten. Mit dem Zusammenbruch der Kultur gegen Ende des 17. Jahrhunderts schien auch das Interesse an der Schriftkunde zu erlöschen. Der letzte große Schriftgelehrte war der Ariki Ngaara des mächtigen Miru-Clans, der im Besitz von einigen hundert Tafeln gewesen sein soll. Die letzten Schriftkundigen überlebten die von Europäern eingeschleppten Infektionskrankheiten und die Entführung zahlreicher Insulaner Mitte des 19. Jahrhunderts als Kontraktarbeiter nach Peru und Chile offenbar nicht. (nach https://de.wikipedia.org/wiki/Rongorongo)
Literatur und Theater
Die Osterinselkultur verfügt als einzige im Pazifik über eine eigene Schrift, die Rongorongo-Schrift. Es ist eine mit Lautzeichen durchsetzte Bilderschrift. Geschrieben wird in Zeilen in einer Variante des Bustrophedon: Jede Zeile steht gegenüber der vorhergehenden auf dem Kopf und ist gegenläufig geschrieben. Es wird von links nach rechts gelesen und am Ende der Zeile wird die Tafel um 180 Grad gedreht. Der Beginn ist links unten. Die durchschnittlich einen Zentimeter hohen Schriftzeichen zeigen grafische Symbole, Vogelmänner, Menschen, Tiere, Körperteile, astronomische Symbole und Geräte des täglichen Gebrauchs (Boot, Haus, Speer, Steinbeil, Paddel). Die Bilderschrift setzt sich jedoch nicht aus Piktogrammen, die unmittelbar reale Objekte abbilden, zusammen. Thomas Barthel, der wohl profundeste Kenner der Osterinsel-Schrift, hält sie lediglich für eine Gedächtnisstütze, das heißt es sind Kernbegriffe abgebildet, um die herum Wörter und Sätze aus dem Gedächtnis zu ergänzen sind.
Der Archäologe Kenneth P. Emory vom Bishop Museum in Hawaii vertritt allerdings eine völlig andere Auffassung. Aus der Tatsache, dass die wenigen erhaltenen Rongorongo-Tafeln nachweislich zwischen 1722 und 1868 aufgefunden wurden, zieht er den Schluss, bei der Schrift handele es sich lediglich um eine Nachahmung europäischer Schriftzeugnisse.
Die vollständige Entzifferung der Osterinsel-Schrift galt lange als ungelöstes Problem, insbesondere, da die Schriftkultur im Südseeraum keine Parallelen hat. Erst der systematische Vergleich mit Kalenderwissen und die Einbeziehung mündlicher Überlieferungen brachte erste Ansätze zur inhaltlichen Deutung. Bereits Thomas Barthel vermutete zumindest in Teilen in einer Schrifttafel, genannt Tablet Mamari (heute im Archiv der Congregazione dei SS Cuori in Grottaferrata bei Rom), einen Mondkalender, da die Zeilen 6 bis 9 der Vorderseite auffallend viele astronomische Zeichen und Mondsymbole zeigen. Diese Ansicht wurde inzwischen bestätigt.
Weltweit sind nur 24 als authentisch geltende Schriftzeugnisse auf Holztafeln, den Rongorongo-Tafeln, aber auch auf anderen Kultgegenständen (Rei-Miro in London, Vogelmann in New York und Zeremonialstab in Santiago de Chile) bekannt. Die erhaltenen Rongorongo-Tafeln sind überwiegend aus Toromiro-Holz geschnitzt. Die Schriftzeichen wurden vermutlich mit Obsidiansplittern oder Haifischzähnen eingraviert, Kenneth P. Emory behauptet, mit eisernen Werkzeugen europäischen Ursprunges. Die Schrifttafeln sind heute über Museen und Sammlungen der ganzen Welt verstreut.
Die Deutungsversuche sind zahllos, insbesondere seit sich Laienforscher daran versuchen. Die seriösen Erklärungen für die aufgezeichneten Texte reichen von Genealogien bis zu rituellen Gesängen. Bislang ist es jedoch immer noch nicht gelungen, die Texte Zeile für Zeile zu übersetzen.
Am Hang des Rano Kao, gefährlich nah an einer 300 Meter abfallenden Klippe, befinden sich die bekannten Orongo-Petroglyphen. Das Hauptmotiv ist das des Vogelmannes (polynesisch Tangata Manu), ein Mischwesen aus Mensch und Fregattvogel. Der Kult um den Vogelmann erlangte ab etwa 1500 zunehmende Bedeutung. Die Gründe für die Abkehr von der alten Religion der Ahnenverehrung, die letztendlich auch das spätere Umstürzen der Moais zur Folge hatte, sind unbekannt. Die Archäologin Georgia Lee, Herausgeberin des Rapa-Nui-Journals, vertritt die Auffassung, dass dies mit der Machtübernahme durch eine Kriegerkaste als Folge der ökologischen Zerstörung in Zusammenhang zu bringen ist. Andere, zum Beispiel Alfred Métraux, nehmen an, dass Ahnenverehrung und Vogelmannkult zumindest eine Zeitlang parallel bestanden haben.
In jedem Frühjahr schwammen junge Männer von Orongo aus zum vorgelagerten Motu Nui, um das erste Ei der Rußseeschwalbe (Sterna fuscata) zu finden. Wer als erster ein unbeschädigtes Ei zurückbrachte, wurde zum Vogelmann erklärt, stand rituellen Opfern vor und erfreute sich besonderer Privilegien. Vogelmannfiguren sind in der gesamten Südsee (Samoa, Sepik-Region in Neuguinea) verbreitet.
Ein weiteres Motiv der Felsritzungen bei Orongo ist Makemake, ein maskenhaftes Gesicht mit großen, eulenartigen Augen, das den Schöpfergott darstellt. Es sind auch Tierdarstellungen zu finden (Vögel, Wale, Haie, Schildkröten) sowie grafische Motive.
Zur Kultstätte Orongo gehören sorgfältig errichtete steinerne Hütten, mit einem Dach aus Grassoden, die nicht ständig bewohnt, sondern nur zu kultischen Zwecken genutzt wurden.
Film
Die Osterinsel bildete für eine Reihe von Filmen den Hintergrund. In der Folge 42 Chile und die Osterinseln (Erstausstrahlung am 1. Januar 2002) der ZDF-Fernsehserie Das Traumschiff, die seit 1981 nach einer Idee von Wolfgang Rademann produziert wird, wird die Osterinsel thematisiert. Der Film Rapa Nui von Kevin Reynolds thematisiert eine der Legenden, erngtete aber heftige Kritik ob der Einseitigkeit der Darstellung (sh. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Rapa_Nui_%E2%80%93_Rebellion_im_Paradies)
Musik
Die Musik der Insel ist polynesisch geprägt, zeigt aber auch schon deutliche chilenische Einflüsse. Die traditionelle Musik besteht aus Gesängen, ähnlich den tahitianischen Stücken. Familien treten oft als Chöre auf, die sich alljährlich in einem konzertanten Wettbewerb duellieren. Die Stimmen werden dabei instrumentell untermalt von Trompeten, die aus Muschelschalen hergestellt werden, und perkussiven Tänzen, bei denen die Tänzer auf Steine springen, die als Kalebassenresonatoren wirken Zu den Instrumenten gehören des weiteren die Kauaha, der Kieferknochen eines Pferdes, die Upaupa, eine Akkordeonart, sowie Steine, die perkussiv aneinander geschlagen werden.
Seit den 1960er Jahren nimmt der südamerikanische Einfluss auf die Osterinsel deutlich zu. Der Tango zum Beispiel hat sich hier zum Tango Rapanui weiterentwickelt, charakteriert durch eine einfache Gitarrenbegleitung anstelle des frenetischen Bandoneon. (nach http://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_Easter_Island 12.7.2011)
Gastronomie und Kulinarik
Die inseltypischen Speisen sind stark an die chilenische Küche angelehnt. Es gibt viele Gerichte mit Fisch und Meeresfrüchten. Dazu zählen Meeraal, Seebarsch, Schwertfisch und Seehecht, die entweder gegrillt oder fritiert werden. Schalentiere (Seeigel, Krabben, Venusmuscheln) werden entweder natur oder als Fischsuppe verzehrt. Probieren Sie auf jeden Fall auch die typischen Gerichte wie Cazuela (Hühnersuppe mit Mais), Ajiaco (scharfes Rinderragout) und Pastel de Chocle (überbackenes Hackfleisch mit Zwiebeln und Rosinen). Salate und Sandwichs werden in der Regel mit Tomaten, Avocados und Koriander verfeinert. In den Restaurants und Hotels der Insel werden auch die berühmtesten chilenischen Weine serviert. Aber es gibt auch Bier und Pisco, ein Traubenlikör der mit etwas Zitrone und Zucker als Pisco Sour getrunken wird.
Kleidung
„Der Mangel an Kleidungszeuge war unter ihnen sehr groß. Aus Not gingen sie mehrenteils nackend, und dennoch verkauften sie ihr bisschen eigenes Zeug gegen anderes von Tahiti“. Dies schrieb James Cook 1774. Die traditionelle Kleidung – Schurze und Mäntel – wurden aus geklopfter Baumrinde hergestellt. Der Oberkörper blieb zumeist bei beiden Geschlechtern unbedeckt. Heute herrscht westlicher Kleidungsstil vor – allerdings mit zunehmenden Einflüssen aus dem polynesischen Raum.
Die Tatauierung spielte eine wichtige Rolle in der Kultur der Osterinsulaner. Je nach sozialer Stellung erhielten Männer von speziell dafür ausgebildeten „Handwerkern“ in rituellem Zusammenhang die ihnen zustehenden Tatauierungen.
Auffällig war vor allem der Ohrschmuck der Ostinsulaner. So schrieb etwa Jacob Roggeveen 1722: „Dieser Ohrschmuck ist rundlich, aber oval, sein Durchmesser beträgt etwa zwei Daumen beim größten und anderthalb Daumen beim kleinsten Umfang; sie sind ungefähr drei Daumen lang.“ Und James Cook schrieb 1774: „Das sonderbarste an ihnen war die Größe ihrer Ohren, deren Zipfel oder Lappen so lang gezogen waren, dass er fast auf den Schultern lag. Daneben hatten sie große Löcher hineingeschnitten, dass man ganz bequem vier bis fünf Finger durchstecken konnte ... Um letztere so groß zu machen, bedienen sie sich eines Blattes vom Zuckerrohr, das aufgerollt hindurch gesteckt wird und vermöge seiner eigenthümlichen Elastizität den Einschnitt im Ohre beständig aufgespannt hielt.“ (http://www.osterinsel-freunde.de/ 12.7.2011)
Etikette
Die Osterinsulaner „legten großen Wert auf gute Sitten. Die Angehörigen der höheren Schichten mußten wissen, wie sie sich in verschiedenen Situationen zu benehmen hatten. So galt es, jedes Wort zu vermeiden, das irgendeine Anspielung aufein der angeredeten Person oder seiner Familie widerfahrenes Mißgeschick enthielt. Nahm man auf einen Fall von Kannibalismus, dessen opfer die Familie des Betreffenden geworden war, Bezug, so zählte dies zu den Beleidigungen, die einen bewaffneten Konflikt auslösen konnten. Die Empfindlichkeit der polynesischen Adligen nahm gelegentlich krankhafte Formen an. Noch heute kann ein unglückliches, ungeschicktes, ohne jede böse Absicht gesprochens Wort heftige Szenen nach sich ziehen.
Stattete ein Häuptling dem Oberhaupt eines anderen Stammes seinen Besuch ab, so traf er auf seinem Wege Gruppen von Kriegern, die ihm das Geleit gaben. Zweifellos wurden bei dieser Gelegenheit von den Sängern die langen, eintönigen Genealogien vorgetragen, wie es heute noch auf Tuamotu Brauch ist. Der eine näherte sich dem anderen; beide drückten dann mit vorwärtsgeneigtem Kopf die Nasenflügel aneinander und atmeten kräftig ein, als wollten sie den Atem des Gastes oder Freundes in sich aufnehmen.
Diese Form der Begrüßung trägt den Namen hongi. Das Wort bezeichnet heute den europäischen Kuß, den die Oster-Insulaner von uns entlehnt haben. Die Mütter drückten jedoch den Kinder gegenüber ihre Zärtlichkeit dadurch aus, daß sie die Nase auf deren Körper herumführen und über ihrem braunen Fleisch einatmen.“
Wiedersehensfreude hingegen wurde versteckt geäußert. Wenn eine Person in die Nähe eines „Wiedergekehrten kam, sah sie ihn nicht an, sondern suchte schnell die Gruppe von Verwandten oder Freunden zu erreichen, die dann plötzlich in Wehklagen ausbrachen und Ströme von Tränen über ihre Wangen rollen ließen. Das Objekt dieser Trauerbekundungen schloß sich ihrem Weinen an und ließ alle Zeichen größter Verzweiflung erkennen. Dieser Anfall von Trauer dauerte aber höchstens eine halbe Stunde. Dann trockneten die Weinenden ihre Tränen, setzten eine fröhliche Miene auf und traten einer nach dem anderen heran, um ihre Nasen gegen die des Reisenden zu drücken. Alle ließen nun ihrer Freude und Neugierde freien Lauf, und der Zurückgekehrte nahm wieder seinen Platz im Schoß der Gruppe ein.“ Mitunter wurden Heimkehrer auch verprügelt oder zum Schein wieder verjagt. Damit drückten die Menschen ihre Anhänglichkeit aus, indem sie „dem Heimkehrer vorwqrfen, sie verlassen zu haben und möglicherweise dadurch“ ein Unglück verschuldet zu haben. Die Insulaner brechen überhaupt „sehr leicht in Tränen aus. Der geringste Anlaß, der die Erinnerung an einen Verstorbenen wachruft, genügt, um bei ihnen Tränen hervorzubringen.
Heute ist der tahitianische Gruß Iaorana an die Stelle der alten Grußformel Ka oho mai, te ripa riva, „Komm hierher, schöner junger Mann“ getraten, worauf Ka koe, „Du auch“, geantwortet wurde. „Eltern sagten, um ihre Kinder zu begrüßen: Aue poki, ‘O mein Kind!“ Diese Worte wurden mit zitternder, weinerlicher Stimme gesprochen.“ (Métraux 1988:83-85)
Krieg und Kannibalismus
Dmythischen Überlieferungen und den Berichten der Missionare zufolge bestand das Leben auf der Osterinsel als eine Aufeinanderfolge „von kriegen und Rivalitäten zwischen den einzelnen Stämmen – vor allem zwischen denen des Ostens und des Westens. Die Gründe für diese Konflikte waren dabei oft unbedeutend. War jedoch einmal Blut vergossen worden, so konnte sich der Kampf über mehrere Generationen hin fortsetzen …
Sobald die Feindseligkeiten begannen, färbten sich die Krieger den Körper schwarz und verbrachten die letzte Nacht damit, ihre Waffen bereit zu machen und ihre wertvollste Habe zu verstecken. Sie verzehrten gerichte, die von ihren Vätern in einem besonderen Ofen zubereitet worden“ waren. „Die ganze Nacht über durften sie keine Auge schließen. Wenn es dämmerte, begab sich die Gruppe, von Frauen und Kindern gefolgt, auf den Marsch. Unterwegs wurden Zaubersprüche oder Sprechgesänge vorgetragen, welche den Kriegern Mut machten und den Zorn der übernatürlichen Mächte auf den Gegner lenkten. Der Zug der Nichtkämpfer begleitete die Krieger bis in die Nähe der Kampfstätte und wohnte dann von der Spitze eines Hügels“ dem Kampf bei.
„Standen die feindlichen Gruppen einander gegenüber, so forderten sie sich durch wilde Schmähungen heraus und begannen dann den Kampf, indem sie“ einander mit Steinen bewarfen. „Steine bildeten in den Händen der Oster-Insulaner eine gefährliche Waffe, deren sie sich gern bedienten. Dem Steinhagel folgten dann Salven von Wurfspeeren, deren Spitzen aus Obsidian die Haut zerfetzten und klaffende Wunden verursachten. Nach diesem geschoßwechsel schritten die Krieger mit der kleinen, kurzen Flachkeule … zum Angriff. Die Hiebe fielen so lange, bis die eine Gruppe einige Krieger verloren hatte und das Feld räumte. Die Sieger machten sich schnell an die Verfolgung der Unterlegenen. Alles, was ihnen in die Hände fiel, wurde getötet oder zu Gefangenen gemacht. Dann zogen die Sieger in das Gebiet ihrer Gegner, deren Hütten sie „in Brand setzten „und deren Ernten sie plünderten. Frauen und Kinder wurden in die Gefangenschaft fortgeführt.
Hatten vorangegangene Kämpfe die Leidenschaften vertieft und das Verlangen nach Rache entstehen lassen, so wurden die Gefangenen gemartert. Man zertrümmerte ihnen den Schädel durch Schläge mit dem Dachsbeil, begrub sie bei lebendigem Leibe oder versetzte ihnen Fußtritte, bis der Bauch aufplatzte und die Eingeweide herausquollen. Um dieser Vergeltung zu entgehen, f,lohen die Besiegten über die ganze Insel. Sie suchten sich in Höhlen zu verstecken oder den Schutz von Verwandten oder Freunden bei einem anderen Stamm zu erflehen.“ In Mythen ist oft davon die Rede, dass die erschlagenen Gegner „aufgefressen“ wurden. „Befand sich unter den Gefangenen ein Häuptling von hohem Range, so wurde er nicht nur aufgefressen, sondern sein Schädel wurde verbrannt, um seinem Gedächtnis und seiner Familie besonderen Schimpf anzutun.“ (Métraux 1988:86-87)
Die wichtigste Waffe im Kampf war die Keule Ua. Diese besteht aus dem harten Holz des Toromiro-Baumes. Das Griffstück ist rund gearbeitet. Der Schlagkopf ist rund und verbreitert gestaltet. Auf der Vorder- und Rückseite des Schlagkopfes sind stilisierte Gesichter ausgearbeitet. Die Augen der Gesichter bestehen aus Knochen und Obsidian. Durch die extreme Holzknappheit auf den Osterinseln war die Ua eine kostspielige Waffe, die nur den Häuptlingen als Standeswaffe zur Verfügung stand. (http://de.wikipedia.org/wiki/Ua_%28Waffe%29 12.7.2011)
Der Anreiz zu Kriegszügen „wurde noch durch die Aussicht auf Festessen gesteigert, zu denen die Leichname der Gegner das Material lieferten … Jeder Inselbewohner weiß, daß seine Vorfahren kai-tangata, ‘Menschen-Fresser‘, gewesen sind. Manche von ihnen machen Witze darüber – andere dagegen sind über jede Anspielung auf diese Sitte beleidigt, die sie als barbarisch und schändlich ansehen. Wie Pater Roussel angibt, verschwand der Kannibalismus auf der Oster-Insel erst nach der Einführung des Christentums. Noch kurz vorher sollen die Eingeborenen einige Menschen – unter ihnen zwei peruanische Händler – verzehrt haben. Die kannibalischen Mahlzeiten fanden an abgelegenen Stellen statt.“ Anwesend waren hauptsächlich Männer, Frauen und Kinder waren nur selten dabei.
„Die Gefangenen, die für das Festmahl bestimmt worden waren, wurden in Hütten eingesperrt, die man gegenüber den Heiligtümern errichtete. Man bewachte sie bis zu dem Augenblick, da sie den Göttern geopfert wurden. Der Kannibalismus der Oster-Insulaner war nicht ausschließlich ein Ritus. Er wurzelte ebensowenig allein in dem Verlangen nach Rache, sondern entsprang auch dem direkten Appetit auf Menschenfleisch, der einen Mann dazu veranlassen konnte, nur aus Gier auf frisches Fleisch einen anderen Menschen zu töten. Vor allem Frauen und Kinder fielen diesen eingefleischten Kannibalen zum Opfer. Die Vergeltung, die solchen Überfällen folgte, war deshalb um so heftiger, weil ein Akt der Menschenfresserei, dem ein Familienmitglied zum Opfer gefallen war, für die betreffende Familie eine fürchterliche Beleidigung darstellte. Wer an dem Mahl teilgenommen hatte“, zeigte den Verwandten des Opfers die Zähne, um anzudeuten, dass hier ihr Fleisch geblieben war. Dies wiederum konnte bei dem Mann, an den die Häme gerichtet war, einen Amoklauf auslösen (Métraux 1988:87-88).
Festkultur
Zu Beginn eines jeden Jahres wird eine „Königin der Osterinsel“ gekürt. „Die Krönung Anfang Februar ist Höhepunkt und Abschluss des jährlichen Insel-Festes Tapati Rapa Nui und soll das Überleben einer fast vergessenen Kultur sichern“, wie in einem Stern-Bericht aus dem Jahr 2004 zu lesen ist. Die „Königin“, so heißt es darin, „steht im goldfarbenen Abendkleid etwas schüchtern, aber überglücklich auf der Bühne. ‘Ich danke Euch allen und werde mich für unsere Kultur einsetzen‘, haspelt die achtzehnjährige Lidia Haoa ins Mikrofon. Hinter ihr führen mit Feder geschmückte junge Männer mit prachtvoller Mähne und nur leicht bekleidet Tänze aus alter Vorzeit von Rapa Nui auf. So nennen sich die aus Polynesien stammenden Ureinwohner der sagenumwobenen Insel mitten im Südpazifik.Muschelhörner tuten dumpf, Rauch aus Trockeneis wabert durch die von Laserlicht durchzuckte Nacht. Im Hintergrund wacht stumm eine der geheimnisumwitterten Steinstatuen, für die die Insel weltberühmt ist. ‘Die Osterinsel ist wie Hawaii, aber ohne Amis‘, sagt eine junge Touristin aus Dänemark begeistert.“
Eine „Art Triathlon, Ruderwettbewerbe und Bananenschlittenfahren sind zugleich die Disziplinen, in denen die Anhänger der Kandidatinnen um den Königintitel wetteifern. Fast alle etwa 3800 Bewohner der Insel beteiligen sich an dem Wettstreit.Eine Jury aus angesehenen Mitgliedern der Inselgesellschaft bewertet die Darbietungen und vergibt Punkte. Lidia und ihre Helfer kamen auf 5800 Punkte. ‘Der Wettkampf macht nicht nur viel Spaß, sondern ist auch ein Ansporn, die eigenen Fähigkeiten und Gebräuche trotz Fernsehens und Fast Food lebendig zu erhalten‘, sagt Jurymitglied Cecilia - und schiebt einen Teller Fisch in die Mikrowelle.Drogen und westlicge Konsumkultur sind Probleme.“ (http://www.stern.de/reise/osterinsel-zwischen-muschelhoernern-und-laserlicht-521043.html)
Im Juli findet das Tokerau Gesangs-Festival Haka Pei statt - tokerau bedeutet „Wind“. Junge Männer rutschen dabei, kriegerisch bemalt und mit lendenschurzen bekleidet, auf Schlitten aus Bananenstauden mit Gras bewachsene Abhänge hinab. Die Regeln beim Haka Pei sind einfach: Jeder, der sich das zutraut, legt sich rücklings auf eine Art Bob aus zwei zusammengebundenen Kokospalmenstämmen. Dann wird er von vier Helfern mit Schwung auf einen langen Grasabhang gestoßen und rutscht den Berg hinunter - wobei „rutschen“ ein schlimmer Euphemismus für eine Fahrt ist, die durch Bodenwellen und Steinbrocken zu einer Art Rodeoritt im Liegen wird, an dem die Chiropraktiker der Insel in den nächsten Tagen ihre helle Freude haben werden. (http://www.sueddeutsche.de/reise/chile-osterinsel-rapa-nui-mit-karacho-1.78320 12.7.2011)
Ansonsten gelten heute die üblichen christlichen Feiertage: Heilige Drei Könige, Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam, Sankt Peter und Paul am 29. Juni, Mariä Himmelfahrt am 15. August, Allerheiligen am 1. November, Unbefleckte Empfängnis am 8. Dezember und Weihnachten am 25. Dezember. Dazu kommen Neujahr, der Tag der Arbeit am 1. Mai, der Nationale Versöhnungstag am zweiten Montag im September, der Unabhängigkeitstag am 18. September und der Kolumbustag am 12. Oktober (nach
http://www.goruma.de/Laender/Australien/Osterinseln/Reiseinfo/Feiertage_und_Veranstaltungen.html 12.7.2011).
Medien und Kommunikation
Auf der Insel werden folgende Medien publiziert:
Zeitschriften:
- Rapa Nui Journal (seit 1987, herausgegeben von Georgia Lee, Los Osos Ca., USA)
- Rapa Nui News (seit 1986, Hanga Roa)
- Rapa Nui Notes (seit 1986, Hanga Roa)
- Te Rapa Nui (seit 1997, Hanga Roa)
Rundfunk- und Fernsehgesellschaften:
- Radio Manukena (gegründet 1967, sendet täglich von 8,30 bis 24 Uhr auf 101,8 FM)
- Radio Vaikava (Sender der chilenischen Marine, gegründet 1990, sendet auf 98,5 FM)
- Television Nacional de la Isla de Pascua (Nationale Osterinsel-Fernsehgesellschaft, gegründet 1976, sendet täglich von 18 bis 24 Uhr, Hanga Roa)
Kommunikation
Die Telefonvorwahl der Osterinsel lautet 0(056)223. Die Postleitzahl lautet 2770000. Sie gilt für alle Straßen und Wohnadressen auf RaüaNui.
Sport
Auf der Insel gibt es etliche Sportmöglichkeiten in den Bereichen Wandern, Leichtathletik, Reiten und Ballsport.
Fußball
Fußball ist auch auf der Osterinsel ein beliebter Sport. Die lokale Wettbewerbsszene umfasst zwei wichtige Turniere:
- Competidores: Ein Turnier mit zwölf Teams
- Senior: Ein Über-35-Turnier mit sechs Mannschaften
Die Fußballspiele werden in Hanga Roa ausgetragen, wo das Stadion von zwei imposanten Moai-Statuen umrahmt wird. Bei lokalen Derbys können bis zu 400 Zuschauer die Spiele verfolgen.
Im August 2009 fand das Eröffnungsmatch der „Copa Chile 2009“ statt. Die Geschichte der „Fußballnation“ Osterinsel ist kurz. 1996 trat die Auswahl zu einem Spiel mit freundschaftlichem Hintergrund gegen die Fußballer des Archipels Juan Fernández an. Da schon mal kameradschaftlich dem vermeintlich feindlichen Gegenüber aufgelegt wurde, kam unter dem Strich ein kruder, aber sehenswerter 5:4 Erfolg der Osterinselmannschaft heraus. Vier Jahre später hatte man genug gefeiert. Da sich aufgrfund der hohen Fahrtkosten kein Gegner finden wollte kam man auf die Boys von Juan Fernández zurück. Dieses Mal präsentierte sich das Freundschafteln schon ganz anders. Nicht nur, dass es zog, was Gries und auch Gram heraufbeschwor. Eine Auswahl einheimischer Fußballer, FC Rapa Nui genannt, kickte auch noch mit fiesen Böen im Rücken. 16 Tore steckten die Boys von Juan Fernández ein, danach fand sich kein Gegner mehr.
Rapa Nui-Triathlon
Der Rapa-Nui-Triathlon umfasst drei Disziplinen: Schwimmen, Kanufahren und Laufen. Der Sport ist inspiriert von den alten Traditionen und Fähigkeiten der Rapanui, die erfahrene Seefahrer und Fischer waren. Der Sport ist auch eine Form der Ehrung ihrer Vorfahren und ihrer Verbindung zu Land und Meer.
Der Sport stellt einige der Aktivitäten und Herausforderungen nach, mit denen die Rapa-Nui-Bewohner in ihrem täglichen Leben konfrontiert waren, wie zum Beispiel die Überquerung des Ozeans, der Fischfang und der Transport von Waren. Der Sport zeugt auch von der Widerstandsfähigkeit und Ausdauer der Rapa Nui, die viele Entbehrungen und Bedrohungen überlebt haben.
Heute wird der Rapa-Nui-Triathlon noch immer von vielen Rapa-Nui-Bewohnern ausgeübt, die an lokalen und internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Der Sport wurde auch von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Rapa Nui Triathlon wird auch zur Förderung des nachhaltigen Tourismus und des Umweltbewusstseins eingesetzt. (nach https://latina-press.com/news/315800-indigene-spiele-und-sportarten-in-lateinamerika-und-der-karibik/)
Haka Pei
Haka Pei ist ein riskanter Sport, der als Wettbewerb während des Tapati Rapa Nui Festivals durchgeführt wird. Die Teilnehmer rutschen auf Bananenstämmen einen 200 Meter hohen Hügel mit 45° Neigung hinab. Dabei können sie Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h erreichen. Sieger ist derjenige, der die größte Distanz zurücklegt.
Persönlichkeiten
Die wichtigsten indigenen Persönlichkeiten der Insel sind:
- Hotu Matu’a (5. Jahrhundert), Gründer der Inselgemeinschaft
- Nga‘ara (gestorben 1859), einer der letzten Ariki
- Riro Kāinga (gestorb en 1898 oder 1899), letzter Inhaber des Königstitels und Herrscher vor der chilenischen Konsolidierung
- Ana Eva Hei (um 1849 bis um 1949), Gemahlin von Atamu Tekena und eine der letzten Frauen, die traditionelle Gesichtstätowierungen trugen
- Atamu Tekena (um 1850 bis 1892), von einem Missionar eingesetzter König, der die Insel an Chile abtrat
- Angata (um 1853 bis 1914), einheimische Katechetin und Prophetin, die 1914 eine Rebellion anführte
- Alexander Ariʻipaea Salmon (1855 bis 1914), englisch bis jüdisch bis tahitischer De bis facto bis Herrscher der Osterinsel, 1878 bis 1888.
- Juan Tepano (1867 bis 1947), indigener Führer und kultureller Informant
- Juan Edmunds Rapahango (1923 bis 2012), ehemaliger Bürgermeister
- Valentino Riroroko Tuki (1932 bis 2017), letzter Anwärter auf den Thron der Rapa Nui
- Carmen Cardinali (geboren 1944), eine chilenische Rapa bis Nui bis Professorin, Gouverneurin der Osterinsel, 2010 bis 2014.
- Melania Hotu (geboren 1959), Gouverneurin (2006 bis 2010, 2015 bis 2018)
- Pedro Edmunds Paoa (geboren 1961), Bürgermeister und ehemaliger Gouverneur
- Lynn Rapu Tuki (geboren 1969), Schulleiterin, fördert die Künste und Traditionen des Volkes der Rapa Nui.
- Marta Hotus Tuki (geboren 1969), Gouverneurin (2014 bis 2015)
- Jacobo Hey Paoa, der erste männliche Rapa bis Nui bis Bewohner, der einen Abschluss in Jura machte und Anwalt wurde
- Luz Zasso Paoa, ein Rapa bis Nui bis Politiker, Bürgermeister der Osterinsel (2008 bis 2012).
- Laura Alarcón Rapu, Gouverneurin von 2018 bis 2022
- Tiare Aguilera Hey (geboren 1982), Mitglied des chilenischen Verfassungskonvents
- Mahani Teave (geboren 1983), chilenisch bis amerikanische klassische Pianistin
- José Fati Tepano, erster männlicher Rapa Nui, der nach Abschluss seiner Ausbildung in Chile zum Richter ernannt wurde
Die wichtigsten ausländischen Persönlichkeiten, die auf der Osterinsel gewirkt haben, sind:
- Felipe González de Ahedo (1714 bis 1802), spanischer Seefahrer und Kartograph; annektierte die Osterinsel im Jahr 1770.
- Eugène Eyraud (1820 bis 1868), Missionar
- Hippolyte Roussel (1824 bis 1898), französischer Priester und Missionar
- Jean bis Baptiste Dutrou bis Bornier (1834 bis 1876), ein französischer Seefahrer, vertrieb viele der Rapa bis Nui bis Bewohner und verwandelte die Insel in eine Schafsfarm.
- Katherine Routledge (1866 bis 1935), eine englische Archäologin und Anthropologin
- Policarpo Toro (1856 bis 1921), ein chilenischer Marineoffizier, nahm die Insel im Namen Chiles in Besitz.
- Monsignore Rafael Edwards Salas (1878 bis 1938), ein chilenischer Priester, Professor und Bischof, der als Militärvikar von Chile und speziell auf der Insel tätig war.
- Sebastian Englert (1888 bis 1969), Missionar und Ethnologe
- Thomas Barthel (1923 bis 1997), ein deutscher Ethnologe und Epigraphiker
- Thor Heyerdahl (1914 bis 2002), ein norwegischer Abenteurer und Ethnograph
- William Mulloy (1917 bis 1978), ein amerikanischer Anthropologe und Archäologe
Fremdenverkehr
Tourismus in nennenswertem Umfang gibt es erst seit 1967, als die erste Passagiermaschine auf der Insel landete. Auch heute noch ist die Osterinsel per Flugzeug ausschließlich mit der Fluggesellschaft LAN Chile von Santiago de Chile oder von Tahiti aus zu erreichen. Allerdings ist die Zahl der Touristen im Vergleich zu anderen Urlaubsinseln immer noch sehr gering.
Die Osterinsel verfügt nur über einen Hafen für kleine Boote. Eine regelmäßige Schiffsverbindung gibt es nicht. Kreuzfahrtschiffe liegen vor Hanga Roa auf Reede. Die Passagiere werden ausgebootet, was bei der durchweg rauen See häufig nicht angenehm ist.
Die Unterbringung von Touristen reicht von Privatquartieren bis hin zu Hotels, deren Komfort etwa der Dreisterne-Kategorie (nach mitteleuropäischem Standard) entspricht. Die Mehrzahl der Touristen bleibt jedoch im Rahmen von Rundreisen nur zwei oder drei Tage auf der Insel. Zum Verständnis für das hohe Preisniveau sollte der Besucher wissen, dass alles – einige landwirtschaftliche Produkte ausgenommen – zu hohen Preisen vom Festland importiert werden muss.
Da die Bevölkerung heute überwiegend vom Tourismus lebt, gibt es kundige einheimische Reiseführer für alle gängigen Sprachen, auch für Deutsch. Die Sehenswürdigkeiten sind mit dem Geländewagen, zu Pferd und für geübte Wanderer auch zu Fuß erreichbar.
Gästezahlen: insgesamt
1967 444
1972 3 806
1973 5 634
1974 2 756
1980 3 600
1981 2 078
1982 1 697
1983 1 794
1984 2 705
1985 2 624
1986 3 564
1987 4 163
1988 2 712
1991 1 980
1992 3 600
1993 4 020
1994 7 188
1995 10 586
Seit 2018 gelten strenge Aufenthaltsregeln, darunter ein auf 30 Tage begrenztes Visum, um den Tourismus zu regulieren und die Umwelt zu schützen. Von März 2020 bis 4. August 2022 war die Osterinsel aufgrund coronabedingter Maßnbahmen 868 Tage lang für Touristen gesperrt. Aktuell gelten folgende Richtlinien:
Ein- und Ausreise:
- Reisedokumente: Für die Einreise ist ein gültiger Reisepass nötig, zusätzlich muss ein elektronisches Einreiseformular (FUI) ausgefüllt und ein Rückflugticket vorgelegt werden. Zudem ist eine Hotelbuchung über Sernatur oder die Einladung eines Einheimischen erforderlich. Die maximale Aufenthaltsdauer für Touristen beträgt 30 Tage.
- Impfungen: Spezielle Impfungen werden nicht verlangt.
- Zollbestimmungen: Es gelten die Zollbestimmungen der Republik Chile.
- Reisen mit Kfz: Für Mietwagen reicht der jeweilige nationale Führerschein, die Fahrmöglichkeiten sind allerdings beschränkt.
- Umgangsformen: Die Einwohner erwarten sich vor allem Respekt vor der traditionellen Kultur und den Hinterlassenschaften ihrer Vorfahren.
- Trinkgeld: Rund 10 % Trinkgeld ist üblich.
- Reisezeit: Die Osterinsel kann ganzjährig besucht werden.
Literatur
- wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Osterinsel
- wikitravel: https://wikitravel.org/en/Easter_Island
- wikivoyage: https://en.wikivoyage.org/wiki/Easter_Island
- an.: Tweejaarige Reyze rondom de wereld met drie schepen, Dordrecht 1728
- an.: Geschichte der Südländer. Entdeckungsreisen in Australien und Oceanien, zweyter Theil, o.O. [1770]
- an.: Die Mission auf der Osterinsel, in: Die katholischen Missionen 7/1881, S. 7 - 11 und 56 - 59
- an.: Le R.P. Hippolyte Roussel, Apôtre de l’Île de Pâques, in: Annales de Sacré Cœurs 5/1898, S. 269 - 274
- an.: Nouveau Regard sur l’Île de Pâques. Rapa Nui, Saintry-sur-Seine 1982
- an.: Umweltzerstörung zugunsten eines Götterkults. Laboratorium des Weltuntergangs : Die Osterinsel, in: Focus 25.4.2014 = https://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/warum-zivilisationen-untergehen-laboratorium-des-weltuntergangs-die-osterinsel_id_3739398.html
- an. : Alte DNA belegt frühen Kontakt zwischen Osterinsel und Amerika, in : Archaeologie-online 11.9.2024 = https://www.archaeologie-online.de/nachrichten/alte-dna-belegt-fruehen-kontakt-zwischen-osterinsel-und-amerika-6039/
- F.A. de Agüera y Infanzon: Journal of the Principal Occurences during the Voyage of the Frigate „Santa Rosalia“ in the Year 1770 (= Hakluyt Society 2/13), Cambridge 1908
- Björn Alden: Wild and Introduced Plants on Easter Island, in: Courier Forschungsinstitut Senckenberg, Band 125, Frankfurt am Main 1990, S. 209 - 216
- James D. Alexander: Case-marking and Passivity in Easter Island Polynesian, in: Oceanic Linguistics 20/1981, S. 131-149
- Karlo Huke Atán: Mündliche Überlieferungen der Osterinsel. Eine Botschaft der Maoris von Rapa Nui, Freiburg-Köln 1999
- ders. / Stephanie Pauly: Kultur, Philosophie, Geschichte der Osterinsel. Te Rongo o the Maori Rapa Nui - Eine Botschaft der Maoris von Rapa Nui, Köln 1999
- Fritz Auernhammer: Die Osterinsel kann wieder bereist werden!, o.O. 22.9.2022 = https://blog.suedamerika-reiseportal.de/die-osterinsel-kann-wieder-bereist-werden/
- W.S. & G.S. Ayres: Geiseler’s Easter Island Report. An 1880s Anthropological Account (= Asian and Pacific Archaeology Series no. 12), Honolulu 1995
- Paul Bahn / John Flenley: Easter Island, Earth Island, New York/London 1992
- P.E. Baker: Preliminary Account of Recent Geological Investigations on Easter Island, in: Geological Magazine 104/1967, S. 116 - 122
- ders. / F. Buckley / J.G. Holland: Petrology and Geochemistry of Easter Island, in: Controversies in Mineralogy and Petrology 44/1974, S. 85 - 100
- Henry Balfour: Some Ethnological Suggestions in Regard to Easter Island or Rapanui, in: Folklore 28/1917, S. 356 - 381
- M.C. Bandy: Geology and Petrology of Easter Island, in: Geological Society of America Bulletin 48/1937, S. 1589 - 1610
- Thomas S. Barthel: Das Geheimnis der Kohau-rongorongo, in: Urania 19/1956, S. 16 - 168
- ders.: Rätsel in Stein und Holz. Die Osterinsel, ein Zeugnis der altpolynesischen Kultur, in: Neue Deutsche Hefte 1956, S. 559 - 564
- ders.: Die Grundlagen zur Entzifferung der Osterinselschrift, Hamburg 1958
- ders.: Rongorongo-Studien. Forschungen und Fortschritte bei der weiteren Entzifferung der Osterinselschrift, in: Anthropos 58/1963, S. 372 - 436
- ders.: Pre-Contact Writing in Oceania, in: Current Trends in Linguistics 8/1970, S. 1165 - 1186
- ders.: Zur Frage der lunaren Zeichen in der Osterinselschrift, in: Asian and African Studies 8/1973
- ders.: Das Achte Land. Entdeckung und Besiedlung der Osterinsel, München 1974 - The Eighth Land. The Polynesian Discovery and Settlement of Easter Island, Honolulu 1978
- ders.: Maui auf der Osterinsel, in: Anthropos 69/1974, S. 705 - 747
- Frederick William Beechey: Narrative of a Voyage to the Pacific and Bering’s Strait, London 1831
- G. Behrendt / A. Schürmann: Der geheimnisvolle Toromiro, in: Kosmos 3/1988, S. 78 - 80
- Carl-Friedrich Behrens: Reise durch die Südländer und um die Welt 1721/22, Frankfurt am Main 1737
- ders.: Der wohlversuchte Südländer, das ist ausführliche Reisebeschreibung um die Welt, Leipzig 1738
- ders.: Histoire de l’Expédition des Trois Vaisseaux, La Haye 1739
- ders.: Der wohlversuchte Südländer. Reise um die Welt 1721/22 = Alte Reisen und Abenteuer, Band 7, hg. Hans Plischke, Leipzig 1925
- Domingo de Beire: Die Insel der Geheimnisse, in: Seraphisches Weltapostolat des hl. Franz von Assisi 3/1927, S. 193- 198
- Peter Bellwood: The Polynesians. Prehistory of an Island People, London 1978
- Hans-Georg Bergmann: Vergleichende Untersuchungen über die Sprache der Osterinsel, Hamburg (diss.) 1963
- Jean Bianco: Thomas Barthel et le déchiffrement de l’écriture Pascuane, in: Kadath 20/1960, S. 13 - 21
- ders.: Comment je déchiffre l’écriture Pascuane, in: ebd., S. 30 - 40
- Annette Bierbach / Horst Cain: Religion and Language in on Easter Island. An ethnolinguistic analysis of key words of Rapa Nui in their Austronesian context, Berlin 1996
- John Macmillan Brown: The Riddle of the Pacific, London 1924
- Marcelo Bórmida: Algunas luces sobre la penumbrosa historia de Pascua antes de 1722, in: Runa 4/1951, S. 4 - 62
- ders: Somatología de la Isla de Pascua, in: ebd., S. 178 - 222
- Axel Borsdorf: Chile. Und die Osterinseln, Stuttgart 1987
- James A. Boutilier: Metei. A Canadian Medical Expedition to Easter Island 1964 - 1965, man. Hangaroa 1984
- Gunnar Brandt: Das Rätsel von Rapa Nui, in: Spektrum der Wissenschaft 22.7.2015 = https://www.spektrum.de/magazin/das-raetsel-der-osterinsel-kollaps-oder-niedergang/1356029
- P.H. Buck: The Vikings of the Sunrise, New York 1938
- F.R.S. James Burney: A Chronological History of the Voyages and Discoveries in the South Sea or Pacific Ocean. To the Year 1723, including History of the Buccaneers of America, vol. IV, London 1816 und Amsterdam repr. 1967
- N.A. Butinov / I.V. Knosorov: Preliminary Report on the Study of the Written Language of Easter Island, in: Journal of the Polynesian Society 66/1957, S. 5 - 17
- Alfred Bühler / Terry Barrow / Charles P. Mountford: Holle Kunst der Welt - Ozeanien und Australien. Die Kunst der Südsee, Baden-Baden 1980
- Ramón Campbell: La Cultura de la Isla de Pascua, Santiago ²1987
- Daniel Camus Gundian: Salubridad y morbilidad en la Isla de Pascua, in: Runa 4/1951, S. 78 - 88
- Robert Casey: Easter Island, Indianapolis 1931
- Adelbert von Chamisso: „Tagebuch“ der Reise um die Welt mit der omannzoffischen Entdeckungs-Expedition in den Jahren 1815-18 auf der Brigg „Rurik“, Leipzig 1836
- Elena Charola: Easter Island. The Heritage and Its Conservation, New York 1994
- dies.: Death of a Moai, Easter Island Statues. Their Nature Deterioration and Conservation, Los Osos Ca. 1997
- Robert Charroux: L’énigme des Andes, Paris 1974, S. 126ff.
- ders.: Vergessene Welten, Düsseldorf 1979, S. 150ff.
- Stéphen-Charles Chauvet: L’Île de Pâques et ses Mystères. La première étude réunissant tous les documents connus sur cette île mystérieuse, Paris 1935
- ders.: La Isla de Pascua y sus Misterios, Santiago 1965
- Alberto Hotus Chavez: Wenn ihr die Erde verkauft habt, was wird dann mit der Sonne geschehen?, in: Big Mountain Aktionsgruppe (hg.): Stimmen der Erde. Ureinwohner über Umwelt und Entwicklung, München 1993, S. 89 - 99
- Helmut Christmann: Die Osterinsel. Geheimnisvolles Eiland im Südmeer, Petersen-Roil 1992
- L.J. Chubb: Geology of Galapagos, Cocos and Easter Islands, in: Bernice P. Bishop Museum Bulletin 110/1933, S. 1 - 44
- William Churchill: The Rapanui Speech and the Peopling of Southeast Polynesia (= Carnegie Institution Publication no. 174), Washington D.C. 1912
- James Cook: A Voyage towards the South Pole and Round the World, performed in His Majesty’s ships the Resolution and Adventure, in the years 1772, 1773, 1774 and 1775, vol. 1, London 1777
- George H. Cooke: Te Pito O Te Henua, Known as Rapa Nui; Commonly Called Easter Island, South Pacific Ocean, Washington D.C. 1897
- Melinda W. Cooke: Easter Island, in: dies. / Frederica M. Burge (ed.): Oceania. A Regional Study, Washington D.C. 1984, S. 371 - 375
- Cristobal Salinas Cornejo / Julio Hotu: Campaña promueve uso de banderas de pueblos originarios: Sepa qué significan, in: elciudadano 6.,9.2011 = https://www.elciudadano.com/pueblos/campana-promueve-uso-de-banderas-de-pueblos-originarios-sepa-que-significan/09/06/
- Corporacion Nacional Forestal (CONAF): Plan de Manejo Parque Nacional Rapa Nui, in: Documentos Tec. de Trabajo 20/1976, S. 1 - 73
- Claudio Cristino etc.: Atlas Arqueológico de Isla de Pascua, Santiago de Chile 1981
- Alex Crouch: Easter Island’s Flag, in : The Flag Institute 6.4.2015 = https://www.flaginstitute.org/wp/flag-facts/easter-islands-flag/
- Izaurieta Cristino Vargas: Archaeological Field Guide - Rapa Nui - National Park, o.O. 1987
- Bengt Danielsson: Die Offenbarung der Osterinsel, in: Südsee = Geo Special 6/1990, S. 42 - 50
- Erich von Däniken: Erinnerungen an die Zukunft, Wien 1968, S. 135ff.
- ders.: Zurück zu den Sternen, Düsseldorf/Wien 1969, S. 201ff.
- ders.: Meine Welt in Bildern, Düsseldorf/Wien 1973, S. 117ff.
- ders.: Besucher aus dem Kosmos, Düsseldorf/Wien 1975, S. 129ff.
- Henk De Velde: Navel der Aarde, Harderwijk 1987
- Jared Diamond: Easter’s End, in: Discover 8/1995
- ders.: Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen, Frankfurt am Main 2006, S. 103ff.
- Wieslaw Domaslowski: Les statues en pierre de l’Île de Pâques, ed. UNESCO, Genève 1981
- Ulrich Dopatka: Lexikon der Prä-Astronautik. Die außerirdischen Phänomene in Archäologie, Astronomie und Mythologie, hg. Erich von Däniken, Wien/Düsseldorf 1979, S. 256ff.
- dpa: Steigender Meeresspiegel bedroht Statuen auf der Osterinsel, in: Süddeutsche Zeitung 21.6.2018 = https://www.sueddeutsche.de/wissen/archaeologie-steigender-meeresspiegel-bedroht-statuen-auf-der-osterinsel-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180621-99-814523
- ds.: Muss die Geschichte der Osterinsel neu geschrieben werden?, in: Der Spiegel 22.6.2024 = https://www.spiegel.de/wissenschaft/osterinsel-ki-studie-widerlegt-gaengige-these-muss-die-geschichte-neu-geschrieben-werden-a-c230977f-814e-4aee-9624-c7741833cbe9
- Alan Drake: Easter Island. The Ceremonial Center of Orongo, Woodland Ca. 1993
- Veronica DuFeu: Rapanui, London 1996
- John Dunmore: Pacific Explorer. The Life of Jean François de La Pérouse 1741 - 1788, Palmerston North N.Z. 1985
- Rafael Edwards: El Apóstol de la Isla de Pascua José Eugenio Eyraud SSCC, Santiago de Chile 1918
- ders.: La Isla de Pascua. Consideraciones expuestas acerca de ella por mons. Rafael Edwards, obispo y vicario castrense que la visitó en julio 1916 y junio 1917, Santiago de Chile 1918
- S. Elbert: Internal Relationships of the Polynesian Languages and Dialects, in: Southwest Journal of Anthropology 9/1953, S. 147 - 173
- Robert S. Elliot: Easter Island’s Tapa Legacy, in: Journal of the New Brunswick Museum 1978, S. 114 - 117
- ders.: Tapa Legacy Update. Of Whales and Tapa, in: Journal of the New Brunswick Museum 1979, S. 165 - 168
- K.P. Emory: Polynesian Stone Remains, in: Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology - Harvard University 20/1943, S. 9 - 21
- ders.: East Polynesian elationships. Settlement Pattern and Time Involved as Indicated by Vocabulary Agreements, in: Journal of the Polynesian Society 72/1963, S. 78 - 100
- Sebastian Englert: Diccionario Rapanui-Español, o,O, 1938
- ders.: Tradiciones de la Isla de Pascua en idioma Rapanui y Castellano Padre Las Casas 1939
- ders.: Primer siglo cristiano de la Isla de Pascua 1864 - 1964, Vilarrica 1964
- ders.: The Island at 0the Center of the World, New York 1970
- ders.: La Tierra de Hotu Matu‘a.Historia, etnología, y lengua de la Isla de Pascua, Santiago de Chile repr. 1974
- ders.: La Tierra de Hotu Matua. Historia y Etnología de la Isla de Pascua. Gramática y Diccionario del Antiguo Idioma de la Isla, Santiago de Chile repr. 1993
- ders.: Idioma Rapanui. Gramática y diccionario del antiguo idioma de la Isla de Pascua, Santiago de Chile repr. 1978
- ders.: Leyendas de la Isla Pascua: textos bilingües, Santiago de Chile 1980
- Heide-Margaret Esen-Baur: Untersuchungen über den Vogelmann-Kult auf der Osterinsel, Wiesbaden 1983
- dies. (ed.): State and Perspective of Scientific Research in Easter Island Culture, Senckenberg 1990
- Bienvenido de Estrella: Los misterios de la Isla de Pascua, Santiago de Chile 1920
- M. Etienne / L. Faundez: Gramineas de Isla de Pascua, in: Ciencias agrícolas de la Universidad de Chile 12/1983, S. 1 - 58
- ders. / G. Michea / E. Diaz: Flora, vegetación y potencial pastoral de Isla de Pascua, in: Boletin Tec. Fac. de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales de la Universidad de Chile 47/1982, S. 1 - 29
- Walter Exner: Moai - Osterinsel-Bautasteine. Wikinger in der Südsee?, Waldeck 1994
- ders.: Te Pito o Te Henua Nabel der Erde. Osterinsel-Omphalos = Geokultur. Beiträge zur Erforschung der geschichtlichen Dynamik, Waldeck 1995
- Jean Eyraud: Notice sur le Frère Joseph-Eugène Eyraud SSCC, premier catéchisme de l’Ile de Pâques, in: Annales de la Congrégation des Sacrés Cœurs 6/1880, S. 804 - 816
- Irina Fedorowa: Mify, predanija i legendy ostrowa Paschi, Moskwa 1978
- dies.: Izledoqanija Rapanujskich Tekstow, in: Akademija Nauk SSSR / Institut Etnografij (ed.): Zabytye Sistemy Pisma, Moskwa 1982, S. 23 - 98
- Fritz Felbermayer: Sagen und Überlieferungen der Osterinsel, Nürnberg 1971
- Edwin N. Ferdon jr.: Notes on the Present-Day Easter Islanders, in: Southwestern Journal of Anthropology 13/1957, S. 223 - 238
- Silvia Ferrara etc.: The invention of writing on Rapa Nui (Easter Island). New radiocarbon dates on the Rongorongo script, in: Scientific Report 2. February 2024 = https://www.nature.com/articles/s41598-024-53063-7
- Hermann Fischer: Schatten auf der Osterinsel. Ein Plädoyer für ein vergessenes Volk, Oldenburg 1998
- Steven Roger Fischer: Homogenity in Old Rapanui, in: Oceanic Linguistics 31/1992, S. 181-190
- ders.: Rapanui's Great Old Words. E timo te akoako, in: Journal of the Polynesian Society 103/1994, S. 413-443
- ders.: Rongorongo, Oxford 1997
- ders.: Preliminary Evidence for Cosmogonic Texts in Rapanui's Rongorongo Inscriptions, in: Journal of the Polynesian Society 104/1995, S. 303-321
- ders.: Rongorongo. The Easter Island Scripts - History, Traditions, Texts, o.A.
- ders. (ed.): Easter Island Studies. Contributions to History of Rapanui in Memory of William T. Mulloy (= Oxbow Monograph no. 32), Oxford 1993
- John R. Flenley / S.M. King: ate Quarternary Pollen Records from easter Island, in: Nature 307/1984, S. 47 - 50
- G. Follmann: Das Alter der Steinriesen auf der Osterinsel, in: Umschau 12/1965, S. 374 - 377
- Francine Forment / Heide-Margaret Esen-Baur: L’Île de Pâques. Une Énigme?, Bruxelles 1990
- Georg Forster: A Voyage round the world in His Britannic Majesty’s loop, Resolution, commanded by Captain James Cook, during the years 1772, 3, 4 and 5, vol. 1, London 1777
- Johann Reinhold Forster: Observations made during a Voyage round the World ..., London 1778
- ders.: The Resolution Journal of Johann Reinhold Forster 1772 - 1775, ed. M.E. Moare, vol. 2, London 1981
- ders.: Beobachtungen der Cook’schen Weltumseglung 1772 - 75. Gedanken eines deutschen Teilnehmers, hg. Hanno Beck (= Brockhaus Antiquarium 1), Stuttgart 1981
- Jordi Fuentes: Diccionario y gramática de la lengua de la Isla de Pascua - Dictionary and Grammar of the Easter Island Language, Santiago de Chile 1960
- Peter-Matthias Gaede / Yves Gellie: Die Magie der Osterinsel. Ein Paradies für Hollywood, in: Geo 5/1993, S. 12 - 36
- Dagmar Galin: Vaaloa. Die Ankunft der weissen Geister. Erster Kontakt mit Europäern in der Überlieferung Ozeaniens, Berlin 1997, S. 146ff.
- Horst Gatermann: Der Untergang der Osterinselkultur, Hamburg 1989
- ders.: Die Osterinsel. Einsamstes Eiland der Welt. Kulturgeschichte und Denkmäler, Köln 1991
- ders.: Eine Insel im Einflußbereich zweier Kulturen. Gedanken über die Herkunft der Megalithkultur auf der Osterinsel, in: Tribus. Ethnologisches Jahrbuch des Linden-Museums, Stuttgart 1993
- ders.: Die Osterinsel. Eine Insel im Einflußbereich zweier Kulturen. Besiedlung der Insel und Entwicklung der Megalithkultur, Frankfurt am Main 1996
- ders. / Hubert Stadler: Osterinsel, München 1994
- Kapitänleutnant Wilhelm Geiseler: Die Osterinsel. Eine Stätte prähistorischer Kultur in der Südsee, Berlin 1883
- Golson: Thor Heyerdahl and the Prehistory of Easter Island, in: Oceania 36/1965
- L. Gómez: Isla de Pascua. Situación lingüística actual, in: Las islas oceánicas de Chile III/1978, S. 473 - 491
- ders.: 1990. Estudio y foratlecimiento de la lengua rapanui, in: Boletín de la Academia Chilena 69/1990, S. 249 - 253
- Lorenz Gonschor: Tapa Nui (Osterinsel). Eine aktuelle Länderkunde = Pazifik Informationsstelle Dossier Nr. 120, Honolulu / Nuku‘alofa 2018 = chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www2.pazifik-infostelle.org/uploads/dossier_120_rapa_nui.pdf
- Don P. Gonzales de Haedo / Antonio de Monte: Voyage to Easter Island 1770 - 1771, London 1908
- Felipe González y Haedo: The voyage of Captain don Felipe González in the ship of the line San Lorenzo with the frigate Santa Rosalia in company to Easter Island in 1770 - 1801, preceded by an extract from Mynheer Jacob Roggeveen’s official log of his discovery of and visit to Easter Island in 1722, ed. Bolton Glanvill Corney, Cambridge 1908
- Candace Gossen: Deforestation, Drough and Humans. New Discoveries of the Late Quaternary Paleoenvironment of Rapa Nui (Easter Island), Portland (diss.) 2011
- Martin Gray: Osterinsel, in: Weltpilgerführer o.J. = https://de.sacredsites.com/Nord-und-S%C3%BCdamerika/Chile/easter_island.html
- Roger C. Green: Linguistic Subgrouping within Polynesia. The Implication for Prehistoric Settlement, in: Journal of the Polynesian Society 75/1966, S. 6 - 38
- ders.: Rapanui Origins Prior to European Contact. The Few from Eastern Polynesia, in: Patricia Vargas Casanova (ed.): Easter Island and East Polynesian Prehistory, Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Instituto de Estudios Isla de Pascua, Santiago de Chile 1999, S. 87 - 110
- M.A. Guillaumin / A. Camus / Tardieu-Blot: Plantes Vasculaires Récoltées à l’Île de Pâques par la Mission Franco-Belge, in: Bulletin du Musée de l’Histoire Naturelle 2/8-6/1936, S. 552 - 556
- Klaus Günther: Zur Frage der Typologie und Chronologie der großen Steinbilder auf der Osterinsel, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich Schiller-Universität. Mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe, Heft 1/1953, S. 82 - 107
- A.C. Haddon: Melanesian Influence in Easter Island, in: Folklorevol. 29, no. 1, London 1918, pp.1^61f.
- Graham Hancock: Heaven's Mirror, New York 1998 (deutsch: Spiegel des Himmels. Das Vermächtnis der Götter, München 1998)
- Terence E. Hays (ed.): Encyclopedia of World Cultures, vol. II: Oceania, Boston 1991, S. 53 - 55
- Robert von Heine-Geldern: Die Osterinselschrift, in: Anthropos 33/1938, S. 815 - 909
- ders.: Heyerdahl’s Hypothesis of Polynesian Origins. A Criticism, in: The Geographical Journal 116/4-6/1950, S. 183 - 192
- ders: Some Problems of Migration in the Pacific, in: Wilhelm Kopeprs (hg.): Kultur und Sprache, Wien 1952, S. 313 - 362
- ders.: Politische Zweiteilung. Exogamie und Kriegsursachen auf der Osterinsel, in: Ethnologica Neue Folge 2/1960
- Hans Helfritz: Die Osterinsel, Zürich 1953
- Friedrich Hellmich: Osterinsel - Rapa Nui. Reisehandbuch, Kronshagen 1996
- Peter Hertel / Tim Gernitz: Die Rätsel unserer Veragnengheit, Brighton 2018
- dies.: Die Osterinsel. Ihre erfundene Vergangenheit, Freiberg 2022
- Guillaume de Hevesy: Sur une écriture océanienne paraissant d’origine néolithique, in: Bulletin de la Société prégistorique française30/7-8/1933, S. 434 - 446
- Thor Heyerdahl: American Indians in the Pacific, Stockholm 1952
- ders.: Aku-Aku. Das Geheimnis der Osterinsel, Berlin 1957
- ders.: The Archaeology of Easter Island, London 1961
- ders.: Die Kunst der Osterinsel, Gütersloh 1975
- ders.: Die Bewohner der Osterinsel - Polynesien, in: Atlantis - die Völker der Welt, Band 1: Australien und Ozeanien, Zürich 1988, S. 222 - 229
- ders.: Easter Island. The Mystery Solved, New York 1989
- ders. / F.N. Ferdon (ed): Reports of the Norwegian Archaeological Expedition to Easter Island and the East Pacific, 2 vols. (= Monographs of the School of American Research and the Museum of New Mexico no. 24, 2 parts), Albuquerque 1961/65
- Hermann Holzbauer (hg.): Missionsgeschichte der Osterinsel. Pater Sebastian Englert O.F.M.Cap. (1888 - 1969) zum 100. Geburtstag, Eichstätt 1988
- H.G.A. Hughes: Rapa Nui. A Select Bibliography, in: South Seas Studies 2/1992
- Terry L. Hunt: Kein Kollaps auf der Osterinsel?, in: Spektrum der Wissenschaft - Dossier 4/2007, S. 56 - 63
- ders. / Carl Lipo: The Statues that Walked – Unraveling the Mystery of Easter Island, Berkeley 2012
- Giselle Hyvert: Les statues de Rapa Nui. Conservation et restauration, ed. UNESCO, Genève 1972
- José Imbelloni: Las „Tabletas Parlantes“ de Pascua, monumentos de un sistema grßafico indo-oceánico, in: Runa 4/1951, S. 89 - 177
- ders.: Craneología de la Isla de Pascua, in: Runa 4/1951, S. 223 - 281
- ders.: Nuevas Indagaciones sobre Pascua, in: Runa 6/1953, S. 220 - 236
- ders. / Edwin N. Ferdon jr. (ed.): Archaeology of Easter Island, Chicago 1961
- L.B. Isaacson / D.F. Heinrichs: Paleomagnetism and Secular Variation of Easter Island Basalts, in: Journal of Geophysical Research 81-8/1976, S. 1476 - 1482
- Tepano Jaussen: Ui Katorika, Papeete 1851
- ders.: L’Île de Pâques historique, écriture et répertoire des signes des tablettes ou bois d’hibiscus intelligents, red. Alazard Ildefonse, Paris 1883
- Niklas Jonsson: Polynesian Languages - Rapanui, o.O. 1999
- Maria Juri: Die tehnologische Bedeutung der Osterinsel-Expeditionen von 1722 bis 1918. Eine ethnohistorische Annäherung an Aspekte kultureller Desintegratiuon, Wien (dipl.) 2004
- Kristopher B. Karnauskas / Jeffrey P. Donnelly / Kevin J. Anchukaitis: Future freshwater stress for island populations, in: Nature Climate Change, Band 6 / 2016, S. 720 - 725
- Sonja Kastilan: Kein Kollaps auf der Osterinsel, in: Die Welt 23.7.2024 = https://www.welt.de/wissenschaft/article252161908/Archaeologie-Mythos-Rapa-Nui-Kein-Kollaps-auf-der-Osterinsel.html
- Theodor Kery: Chile 2016, Teil 1/3 Osterinsel, Neufeld/L. [2016] = https://www.websteiner.com/osterinsel16.html
- Patrick V. Kirch: The Evolution of Polynesian Chiefdoms, Cambridge Mass. 1984
- Walter Knoche: Märchen und Mythen von der Osterinsel, man. Brüssel 1911
- ders.: Über die Kulturpflanzen der Osterinsel, in: Zeitschrift des wissenschaftlichen Vereins Kultur- und Landeskunde Argentinien 3/1919, S. 161 - 184
- ders.: Die Osterinsel. Eine Zusammenfassung der chilenischen Osterinselexpedition des Jahres 1911, Concepcion 1925
- A.M. Kondratow: Die Rätsel des Stillen Ozeans, Leipzig 1979
- Otto von Kotzebue: Entdeckungs-Reise in die Südsee und nach der Bering-Straße. Zur Erforschung einer nördlichen Durchfahrt. Unternommen in den Jahren 1815, 1816, 1817 und 1818 mit „Bemerkungen und Ansichten“ von Adelbert von Chamisso, Weimar 1821
- Kondratow Krendeljow / Aleksandr Michailowitsch Kondratow: Die Geheimnisse der Osterinsel, Leipzig 1987 und ²1990
- Viktor Krupa: „Moon“ in the Writing of Easter Island, in: Oceanic Linguistics 10/1971, S. 1 - 10
- Harold Krusell: Replica de un moai para el Museo Nacional de Historia Natural, Santiago de Chile 1977 [1988]
- B.G. Kudrjawzew: Pjemennost ostrowa Pau, in: Sbornik museja antropologij i etnografij 11/1949, S. 175 - 221
- R. Langdon / D. Tryon: The Language of Easter Island. Its Development and Eastern Polynesian Relationships, ed. The Institute for Polynesian Studies, Honolulu 1983
- P. Werner Lange: Südseehorizonte. Eine maritime Entdeckungsgeschichte Ozeaniens, Leipzig/Jena/Berlin 1983, S. 127ff.
- F. de Lapelin: L’Île de Pâques, in: Revue Maritime et Coloniale 35/1872
- Jean François de Galaup La Pérouse: Voyage de La Pérouse autour du monde 1785 - 1788, Paris [1797]
- Jean-François de Lapérouse: Zu den Klippen von Vanikoro. Weltreise im Auftrag Ludwigs XVI. 1785 - 1788, hg. Klaus Fischer, Stuttgart/Wien 1987, S. 49ff.
- Henri Lavachery: Île de Pâques, Paris 1935
- ders.: Sculpteurs modernes de l’Île de Pâques, in: Outre-Mer 9/1937, S. 352 - 355
- ders.: Les Pétroglyphes de l’Île de Pâques, Paris 1939
- ders.: Stéles et pierres-levées de l’Île de Pâques, in: Südseestudien. Gedenkschrift zur Erinnerung an Felix Speiser, Basel 1951, S. 413 - 422
- ders.: Archéologie de l’Île de Pâques, in: Journal de la Société des Océanistes 10/1954, S. 133 - 158
- P. Honoré Laval: Mangareva, l’histoire ancienne d’un peuple polynésien, Paris 1938
- Georgia Lee: Easter Island Rock Art. Ideological Symbols and Socio-Political Change, Los Angeles (diss.) 1984
- dies.: The Birdman-Cult, Los Angeles 1986
- dies.: An Uncommon Guide to Easter Island, Arroyo Grande Ca. 1990
- dies.: Rock Art of Easter Island. Symbols of Power, Prayers of the Gods, Los Osos Ca. o.J.
- Anja Christina Lehner: Jacob Roggeveen und seine Suche nach dem Südland, Wien (/dipl.) 2001
- Peter Leopold / Ricardo Herrgott: Rapa Nui - Die Osterinsel. Alltag und Mythos des entlegensten Eilands der Welt, Wien 1994
- William Liller: The Ancient Solar Observatories of Rapa Nui. The Archaeoastronomy of Easter Island, Woodland Ca. 1993
- Lioman Lipa / Matt Becker / Tanya Bronson: Chile. La teoría que explica la ubicación de los moais en la Isla de Pascua, in: BBC News Mundo 18.10.2018 = https://www.bbc.com/mundo/noticias-4584563
- U. Lisiansky: Voyage around the world. 1803 - 1806 in the ship Neva, London 1814
- William R. Long: Trouble in the South Pacific. Trying to save their culture, Easter Island’s people demand control of their lives, in: Los Angeles Times 2.8.1994
- Pierre Loti: Reflets sur la sombre route, Paris 1926
- ders: À l’Ile de Pâques, Paris 1960
- Grant MacCall: Reaction to Disaster, Canberra (diss.) 1976
- ders.: Rapanui. Tradition and Survival on Easter Island, Honolulu 1981
- ders.: Rapanui (Easter Island), Sydney 1992
- Patrick C. MacCoy: Easter Island Settlement Patterns in the Late Prehistoric and Protohistoric Periods, Washington D.C. (diss.) 1973 - ds. (= Easter Island Committee Bulletin no. 5), New York 1976
- ders.. Excavation of a Rectangular House on the East Rim of Rano Kau Volcano, Easter Island, in: Physical Anthropology in Oceania 8/1973, S. 51 - 67
- Jace Machowski: Insel der Geheimnisse, Leipzig 1968
- John Macmillan Brown: The Riddle of the Pacific, London 1924
- Daniel Mann et al.: Drought, vegetation change, and human history on Rapa Nui (Isla de Pascua, Easter Island), in: Quarternary Rsearch, Band 69 / 2008, S. 16 - 28
- Peggy Mann: Easter Island. Land of Mysteries, New York 1976
- H.E. Maude: Raiders of the Pacific, Suva 1984
- F. Mazier-Schulze: Die Osterinsel, Leipzig 1932
- Francis Mazière: Archipel du Tiki, Paris 1957
- ders.: Fantastique Île de Pâques, Paris 1965
- ders.: Insel des Schweigens. Das Schicksal der Osterinsel, Frankfurt am Main 1966
- Grant McCall: Little Ice Age. Some Speculations for Rapa Nui, in: Rapa Nui Journal, Band 7, Nr. 4 / 1993, S. 65 - 70
- Alfred Métraux: Ethnology of Easter Island (= Bernice P. Bishop Museum Bulletin no. 160), Honolulu 1940 und 1971
- ders.: Die Osterinsel, hg. Hans-Jürgen Heinrichs, Frankfurt am Main 1989
- Andreas Mieth / Hans Rudolf Bork / Barbara Tschochner: Stone mulching on Rapa Nui, in: Rapa Nui Journal May 2004, pp. 10 - 14
- dies.: Auf Tour. Die Osterinsel, Heidelberg 2012
- N.N. Miklucho Maklaj: Ostrowa Rapanui, Pitkern, Mangareva, in: Izwestija Ruzkogo Geografiseskogo Osestva 8/1872, S. 42 - 55
- Rudolf Mingau (hg.): Adelbert von Chamisso. Reise um die Welt, Frankfurt am Main 1979
- Richard E. Mooney: Les dieux de l’espace et des ténèbres, Paris 1976, S. 223f.
- J. Víctor Moreno-Mayar / Olivier Delaneau / Anna-Sapfo Malaspinas / Tom Higham et al.: Ancient Rapanui genomes reveal resilience and pre-European contact with the America, in: Nature 633/2024, S. 389 - 397 = https://www.nature.com/articles/s41586-024-07881-4
- William Mulloy: A Speculative Reconstruction of Techniques of Carving, Transporting and Erecting Easter Island Statues, in: Archaeology and Physical Anthropology of Oceania 5-1/1970, S. 1 - 23
- ders.: Preliminary Report of the Restoration of Ahu Huri a Urenga and Two Unnamed Ahu at Hanga Kio’e, Easter Island, o.O. 1973
- Mara A. Mulrooney: An island-wide assessment of the chronology of settlement and land use on Rapa Nui (Easter Island) based on radiocarbon data, in: Journal of Archaeological Science. Band 40, Nr. 12 / Dezember 2013, S. 4377 - 4399
- G. Munro: Rapa Nui, Santiago de Chile 1985
- Douglas Newton: The Art of the Pacific Islands, ed. National Gallery of Art, Washington D.C. 1978
- D.A. Olderogge: Parallelnye Teksty tablik ostrowa Pau, in: Sbornik museja antropologij i etnografij11/1949, S. 222 - 236
- Catherine Orliac: The woody vegetation of Easter Island between the early 14th and the mid-17th centuries AD, in: Christopher M. Stevenson / William S. Ayres (hg.): Easter Island archaeology. Research on early Rapanui culture, ed. Easter Island Foundation, Los Osos 2000, S. 211 - 220
- J.L. Palmer: Observations of the Inhabitants and Antiquities of Easter Island, in: Journal of the Ethnological Society of London 1868
- ders.: Easter Island, in: The Illustrated London News 1869
- ders.: A Visit to Easter Island or Rapa Nui, in: Proceedings of the Royal Geographic Society of London 1870
- ders.: A Visit to Easter Island, or Rapa Nui, in 1868, in: Journal of the Royal Geographic Society of London 14/1870
- ders.: Davis or Easter Island, in: Literary and Philosophical Society of Liverpool. Proceedings 29/1875
- Stephanie Pauly: Rapa Nui. Eine Liebe auf der Osterinsel, München 2004
- Louis Pauwels / Jacques Bergier: Aufbruch ins dritte Jahrtausend. Von der Zukunft derphantastischen Vernunft, München 1982, S. 213f.
- Pavel Pavel: Rapa Nui, Ceske Budejovice 1988
- Pawley: Polynesian Language. A Subgrouping Based on Shared Innovations in Morphology, in: Journal of the Polynesian Society 75/1966, S. 39 - 64
- ders. / R. Green: Dating the Dispersal of the Oceanic Languages, in: Oceanic Linguistics 12/1973, S. 1 - 67
- Alphonse L. Pinart: Davis or Easter Island, London 1876
- ders.: Voyage à l’Île de Pâques (= La Tour du Monde 12), Paris 1878
- Roberto Piumini: Motu-Iti, München 1997
- Clive Ponting: A Green History of the World, London 1992, S. 168ff.
- J. Douglas Porteous: The Modernization of Easter Island (= Western Geographical Series 19), Victoria 1981
- Jean Prachan: Das Geheimnis der Osterinsel, München 1991
- Ana Betty Haoa Rapahango / William Liller: Speak Rapanui. The Language of Easter Island, o.A.
- H.A. Rehder: The Marine Molluscs of Easter Island (Isla de Pascua) and Sala y Gomez, in: Smiths Controversies in Zoology 289/1980, S. I - IV und 1 - 167
- H.E. Reid: A World Away. A Canadian Adventure on Easter Island, Toronto 1965 und Sydney 1967
- Kevin Reynolds / Tim Rose Price: Kevin Costners Rapa Nui. Die Legende der Osterinsel. Das Buch zum Film. Fotos von Ben Glass, Düsseldorf/Wien 1994
- Egbert Richter: Die Schrifttafeln der Osterinsel. Ein Beitrag zu ihrer Entzifferung, Hamburg (diss.) 1999
- Christopher Right / Robert Lomas: Uriel's Machine. The Prehistoric Technology That Survived the Flood, London 1999
- S.V. Rjabchikov: Progress Report on the Decipherment of the Easter Island Writing System, in: Journal of the Polynesian Society 96/1987, S. 361 - 367
- ders.: Tayny ostrova Paschi, 5 vol., Krasnodar 1990/96
- ders.: O datirowke rapanujskich došchechek, Krasnodar 1993
- ders.: Chronologija rapanuiskoj istorij, Krasnodar 1994
- ders.: Easter Island Place-Names, in: Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge 31/1996, S. 255 - 259
- Jacob Roggeveen: Dagverhaal der Ontdekings Reis van Mr. Jacob Roggeveen met de Schepen Den Arend, Thienhoven en de Afrikaansche Galei, in de jaren 1721 en 1722, udg. S. de Wind, Middelburg 1838
- Yamirka Rojas-Agramonte et al.: Zircon xenocrysts from Easter Island (Rapa Nui) reveal hotspot activity since the 6 middle Jurassic (AGU Publications), Kiel 2024 = https://www.researchgate.net/profile/Douwe-Van-Hinsbergen/publication/376054054_Zircon_xenocrysts_from_Easter_Island_Rapa_Nui_reveal_hotspot_activity_since_the_middle_Jurassic/links/6569ee7f3fa26f66f4456918/Zircon-xenocrysts-from-Easter-Island-Rapa-Nui-reveal-hotspot-activity-since-the-middle-Jurassic.pdf
- José Luis Rosasco / Juan Pablo Lira: Osterinsel. Traum ohne Ende, Santiago de Chile 1991
- Hippolyte Roussel: Catéchisme Rapanui, Papeete 1880
- ders.: Ile de Pâques ou Rapanui, Braine-le-Comte 1926
- Katherine Scoresby Routledge: The Mystery of Easter Island. The Story of an Expedition, London 1919
- dies.: Survey of the Village nd Carved Rocks of Orongo, easter Island, by the Mana Expedition, in: Journal of the Royal Anthropological Institute 50/1920, S. 425 - 451
- François Sagnes: L'Île de Pâques, Paris 1988 (= Die Osterinsel, München 1990)
- Marshal D. Sahlins: Esoteric Efflorescence in Easter Island, in: American Anthropologist 57/1955, S. 1045 - 1052
- Manfred Scheuch: Atlas zur Zeitgeschichte. Bedrohte Völker, Wien 1995, S. 96ff.
- Frank Schubert: Osterinsel ohne Kollpas?, in: Spektrum der Wissenschaft 21.6.2024 = https://www.spektrum.de/news/vermeintliche-umweltkatastrophe-osterinsel-ohne-kollaps/2219862
- Matthias Schulz: Botschaft aus Fantasia, in: Der Spiegel 44/1999, S. 218 - 222
- Friedrich Schulze-Maizier: Die Oster-Insel, Leipzig 1932
- Jean-Michel Schwartz: Nouvelles recherches sur l’Île de Pâques, Paris 1973
- Joan T. Seaver Kurze: Ingrained Images. Wood Carvings from Easter Island, Los Angeles (thesis) 1997
- Bernard Smith: European Vision and the South Pacific, New Haven/London 1985
- David Stanley: Südsee-Handbuch, Bremen 4. Aufl. 1994, S. 253ff.
- ders.: Tahiti-Handbuch mit Osterinsel und Cook-Inseln, Bremen 2000, S.295ff.
- David W. Steadman / Patricia Vargas Casanova / Claudio Christino: Stratigraphy, Chronology, and Cultural Context of an Early Faunal Assemblage from Easter Island, in: Asian Perspectives, Band 33, Nr. 1, Honolulu 1994, S. 79 - 96
- Christopher M. Stevenson: Corporate Descent Group Structure in Easter Island Prehistory, Philadelphia (diss.) 1984
- ders. (ed.): Easter Island in Pacific Context, South Seas Symposium. Papers Presented at the Fourth International Conference on Easter Island and the Pacific, Los Osos Ca. 1998
- Miroslav Stingl: Bei den Wikingern der Südsee, Leipzig 1975, S. 21ff.
- ders.: Herrscher im Südsee-Paradies. Geheimnisvolles Polynesien, Düsseldorf/Wien 1985, S. 82ff., 151ff. und 222ff.
- H. Stolpe: Über die Tätowierung der Oster-Insulaner, Berlin 1899
- K. Stottsberg: The natural history of Juan Fernandez and Easter Island, Uppsala 1920/28
- Robert C. Suggs: Les civilizations polynésiennes, Paris 1962
- Paul Theroux: Die glücklichen Inseln Ozeaniens, München 1996, S. 590ff.
- William Judah Thomson: Te Pito te Henua or Easter Island, in: Smithsonian Institution. Annual Report of the National Museum for 1889, Washington D.C. 1891, S. 447 - 552
- ders.: Estudios sobre la Isla de Pascua, Santiago 1980
- Jens Tönnießen: Die Osterinsel, in: Naturschutz und Naturparke, Heft 2/1996, S. 12 - 18
- M.M.J. Van Balgooy: Plant Geography of the Pacific, in: Blumea suppl. 6/1971, S. 1 - 222
- Jo Anne Van Tilburg: Power and Symbol. The Stylistic Analysis of Easter Island Monolithic Sculpture, Los Angeles (diss.) 1986
- dies.: Red Scoria on Easter Island. Sculpture, Artifacts and Architecture, in: Journal of New World Archaeology 7-1/1987, S. 1 - 27
- dies.: Easter Island Archaeology, Ecology and Culture, Washington D.C. 1995
- Jennifer Vanderbes: Osterinsel. Roman, Berlin 2004
- Martin Vieweg: Rongorongo-Tafeln. Dem Ursprung der Osterinsel-SDchrift auf der Spur, in: Damals 15.2.2024 = https://www.wissenschaft.de/geschichte-archaeologie/dem-ursprung-der-osterinsel-schrift-auf-der-spur/
- Hubert Von Stadler / Horst Gatermann: Osterinsel, München 1994
- R. Weber: The Verbal Morphology of Rapa Nui. The Polynesian Language of Easter Island, and Its Functions in Narrative Discourse, Arlington (thesis) 1988
- Marshall Weisler: Hard evidence for prehistoric interaction in Polynesia, in: Current Anthropology, Band 39, Chicago 1998, S. 521 - 532
- Friedhelm Welge: Am Nabel der Welt. Ein Bildhauer sieht sein Mekka, die Osterinsel, Frankfurt am Main 1989
- Günther Wessel: Chile und Osterinsel, Bielefeld/Brackwede 1998
- Werner Wolff: Island of Death, New York 1948
- D.E. Yen: The Sweet Potato and Oceania, Honolulu 1974
- Philipp von Zabern (hg.): 1500 Jahre Kultur der Osterinsel. Schätze aus dem Land des Hotu Matua, Mainz 1989
- Wilhelm Ziehr (red.): Die Osterinsel und Juan Fernandez, in: Weltreise. Alles über alle Länder unserer Erde 274-275/1975, S. 304/05
- Georg Zizko: The Flowering Plants of Easter Island (= Palmarum Hortus Francofurtensis 3), Frankfurt am Main 1991
Zeitungen und Zeitschriften
- Rapa Nui Journal, ed. Georgia Lee, Los Osos Ca. seit 1987
- Rapa Nui News, Hanga Roa seit 1996
- Rapa Nui Notes,Hanga Roa seit 1986
- Te Rapa Nui,Hangaroa seit 1997
Reiseberichte
- David Berkliwitz = https://www.gochile.cl/en/articles/rapa-nui-five-requirements-you-cannot-forget-to-enter-easter-island.htm
- Theodor Kery 2016 = https://www.websteiner.com/osterinsel16.html
Videos
- Osterinsel per Drohne = https://www.youtube.com/watch?v=HVhZcbq_m5o&t
- Easter Island - Where Giants Walked = https://www.youtube.com/watch?v=7j08gxUcBgc
- Osterinsel - Moai-Mysterium gelöst? = https://www.youtube.com/watch?v=BzkkFM97K-s
- Rapanui in Gefahr - Welche Gefahr nagt an der Ostereinsel = https://www.youtube.com/watch?v=j3feZKMWo-8
- What is Easter Island Really Like? = https://www.youtube.com/watch?v=Cn7ro1gjvAQ
- Rapa Nui 1 = https://www.youtube.com/watch?v=CLgp-I9Nx_k
- Rapa Nui 2 = https://www.youtube.com/watch?v=gA0cZTBAmsA
- Scientists Finally Discovered the Truth About Easter Island = https://www.youtube.com/watch?v=MR4iqt6_F-0
- Ancient Secrets Discovered: From Easter Island to Mesoamerica = https://www.youtube.com/watch?v=S4jKPe7hUsg
- Rapa Nui Traditional Dance = https://www.youtube.com/watch?v=zTM-uuc-WZM
- Rapa Nui Isla de Pascua Easter Island Dance = https://www.youtube.com/watch?v=K4OfW9uZE-c
- Easter Island Music: Matato'a E tere = https://www.youtube.com/watch?v=IK8KqCmIzi4&list=PLm7NoA0dlrpgD7qlt_8TgZClBfIf7YuVE
- Easter Island Music: Tapatangi = https://www.youtube.com/watch?v=ZQiwL61bY0Y&list=PLB-qR6Jb-NV2d2qAEXTAadHfz9iKbuCNT
Atlas
- Osterinsel, Überblick = https://www.geographicguide.com/america-maps/easter-island.htm
- Osterinsel, Geologie = https://www.researchgate.net/figure/Geological-map-of-Easter-Island-Chile-draped-on-the-shaded-relief-image-Digital_fig2_259647616
- Osterinsel, Geologie = https://www.researchgate.net/figure/Geological-map-of-Easter-Island-Rapa-Nui-integrating-previous-data-of-Vezzoli-and_fig2_384865053
- Osterinsel, Topographie und Vulkanismus = https://www.researchgate.net/figure/Easter-Island-map-showing-the-geology-topography-volcanoes-boreholes-and-sites_fig1_225136812
- Osterinsel, Moais = https://www.kinderweltreise.de/kontinente/suedamerika/chile/daten-fakten/land/osterinsel/
Reiseangebote
Osterinsel-Erkundung = https://www.explora.com/de/osterinsel-karte/
Miller-Reisen (6 Tage): https://www.miller-reisen.de/reiseziele/suedamerika/chile/osterinsel-hautnah-erleben/
Wikinger-Reisen (4 Tage): https://www.wikinger-reisen.de/wanderreisen/chile/4531.php?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAhbi8BhDIARIsAJLOluc55Ww31hwbFzmhHG9b0s_bgPaP9vlGoOOreJhSAl2dE46x5JvtMgsaAnd4EALw_wcB
Dertour (4 Tage): https://rundreisen.dertour.de/rundreisen/mittel-und-suedamerika/chile/osterinsel.html
Studienreisen: https://at.studienreisen.de/laender/Osterinseln
world insight: https://www.world-insight.de/erlebnisreisen/chile-mit-verlaengerung-osterinsel/
Forum
Hier geht's zm Forum: https://www.insularium.org/forum/viewforum.php?f=7