Irland (Éire / Ireland)
Die „grüne Insel“ Irland ist ein zweigeteiltes Land. Der Norden gehört nach wie vor zum British Empire, der Süden bildet eine eigenständige freie Republik, die im Europa der Union ein recht eigenwilliges Leben führt. Irland ist keltisch geprägt, das Regiment aber führten über lange Zeit der Geschichte hinweg fremde Mächte - die katholische Kirche, das British Empire, die Europäische Union, bis sich das Land schlussendlich „wokisierte“.
| Inselsteckbrief | |
|---|---|
| offizieller Name | Ireland (englisch), Éire (irisch) |
| alternative Bezeichnungen | Íriu, Eriu, Éirinn (altirisch), Ierne, Hiernia, Iouérnia (altgriechisch), Ivernbia, Hibernia, Scotia (lateinisch), Inis na bhFíodh, Inisfail, Inis Fáil, Inis Éalga, Banba, Fódla (mythisch), Emerald Island, Sharmrock Island (poetisch), Irlands (mittellateinisch, italienisch, spanisch), Irland (deutsch), Irlande (französisch) |
| Kategorie | Meeresinsel |
| Inseltyp | echte Insel |
| Inselart | Kontinentalinsel |
| Gewässer | Atlantischer Ozean (Atlantic Ocean / an tAigéan Atlantach) und Irische See (Irish Sea / Muir Éireann) |
| Inselgruppe | Britische Inseln (British Isles / Oileáin Bhriotanacha) |
| politische Zugehörigkeit | Staaten: Republik Irland (Republic of Ireland / Poblacht na h’Éireann) und Teilstaat Nordirland (Northern Ireland / Tuaisceart Éireann) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland / Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Tuaisceart Éireann) |
| Gliederung | Republik Irland: 4 cuígí / provinces (Provinzen) 26 contae / counties (Grafschaften) 3 comhairle cathrach / city councils (Städte) 2 comhairle cathrach agus contae / city and county councils (Stadt-Grafschaften) 95 ceantair bhardasacha / municipal districts (Gemeinden) 3.440 toghroinn / wards (Wahlbezirke) Nordirland: 6 historical counties (historische Grafschaften) 11 local government areas (lokale Verwaltungsgebiete) 26 districts (Bezirke) 526 wards (Gemeinden) |
| Status | Inselstaat (island state / stát oileáin) |
| Koordinaten | 54° N, 9° W |
| Entfernung zur nächsten Insel | 50 m (An Chruit), 34,9 km (Schottland) |
| Entfernung zum Festland | 439,5 km (Argenton / Bretagne / Frankreich) |
| Fläche | 84.150 km² / 32.490 mi² (mit Nebeninseln 84.421 km² / 32.595 mi²) |
| geschütztes Gebiet | 9.230 km² / 3.564 mi² (11,0 %) |
| maximale Länge | 486 km (NNO-SSW) |
| maximale Breite | 304 km (WNW-OSO) |
| Küstenlänge | 3.170 km |
| tiefste Stelle | 0 m (Atlantischer Ozean / Irische See) |
| höchste Stelle | 1041 m (Carrantuohill) |
| relative Höhe | 1041 m |
| mittlere Höhe | 110 m |
| maximaler Tidenhub | 1,9 bis 6,2 m (Limerick 5,8 m, Cobh bzw. Corkl 4,31 m, Sligo 4,1 m, Dublin 4,08 m, Bangor 3,6 m, Belfast 3,44 m, Londonderry 2,8 m, Portrush 2,13 m, Rosslare 1,91 m) |
| Zeitzone | UTC (Coordinated Universial Time / Am Uilíoch Comhordaithe / Koordinierte Weltzeit bzw. Westeuropäische Zeit) |
| Realzeit | UTC minus 24 bis 42 Minuten |
| Einwohnerzahl | 7.171.250, mit Nebeninseln 7.175.695 (2024) |
| Dichte (Einwohner pro km²) | 85,22, mit Nebeninseln 85,00 |
| Inselzentrum | Dublin (Bhaile Átha Cliath) |
Name
Der amtlich verwendete deutsche Name für die „grüne Insel“, aber auch für die deren Großteil einnehmende Republik - ist Irland. Die offizielle Eigenbezeichnung lautet irisch Éire, gesprochen [aıru:], bzw. englisch Ireland. Viele andere Sprachen haben das mittellateinische Irlanda übernommen. Zur Unterscheidung des selbständigen Staates vom englisch verwalteten Nordirland der ist der Begriff Republik Irland, irisch Poblacht na hÉireann, englisch Republic of Ireland, üblich.
Woher der Landesname, altirisch Íriu bzw. Eriu, im Dativ Éirinn, anglisiert vereinfacht ir und im Englischen ergänzt durch land „Land“, stammt, ist nicht eindeutig geklärt. Einer gängigen Theorie zufolge soll er sich von Erinn, der „Dreifachen Göttin” oder der „Dame Eriu”, einer alten irischen Fruchtbarkeitsgöttin, herleiten. In der irischen Mythologie war Ériu eine der drei Göttinnen der Tuatha Dé Danann, die das Land personifizierten. Der Name „Ériu“ wird mit „Fülle“ oder „Fruchtbarkeit“ in Verbindung gebracht und hängt möglicherweise mit keltisch erin „grün“ zusammen. Da die keltische Wortwurzel iar „Westen“ bedeutet, könnte er aber auch ein „westliches Land“ bezeichnen. Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit einer Verbindung von gälisch i „Insel“ mit iarunn „Eisen“. Irland wäre demnach die „Eiseninsel“.
Der antike lateinische Name war Scotia oder Hibernia. Letztere Bezeichnung leitet sich her vom älteren Ivernia, einer latinisierten Form des altgriechischen Ἱερνία [Hiernía], auch Ierne und Iouérnia geschrieben. Und dahinter steckt wiederum das altirische Toponym Eriu.
Neben dieser offiziellen Bezeichnung gibt es noch eine lange Reihe mytho-poetischer Namen. Innisfail bzw. Inis Fáil etwa, worin sich irisch inis „Insel“ und fáil „Schutzwall“ vermischen, bezog sich in früheren Zeiten auf das Inselinnere. Inis na bhFíodh, zu Deutsch „Insel der Wälder“, ist eine alte gälische Umschreibung aus vorkolonialer Zeit. Banba und Fódla, neben Eriu zwei weitere wichtige altkeltische Göttinnen, sind göttliche Personifikationen der Insel aus der irischen Mythologie. Das vor allem in poetischen Texten zu findende Inis Éalga bedeutet im Gälischen „vornehme Insel“. Heute ist oft von Emerald Island, der „Grünen Insel“, die Rede - oder von Shamrock Island, der „Kleeblattinsel“.
Was Nordirland betrifft, so spiegelt die offizielle Bezeichnung, englisch Northern Ireland, irisch Tuaisceart Éireann, lediglich die geografische Lage wieder. Nimmt man die drei irischen Counties Donegal, Cavan und Monaghan dazu, so sieht die Sache etwas anders aus. Dann nämlich ergibt sich Ulster einer der vier traditionellen Landesteilen der Grünen Insel. Der Ausdruck ist die anglisierte Form von irisch Cúige Uladh, zu deutsch „Fünftel der Uladh“, ursprünglich Ulaids tír, „Platz der Uladh“. Die Uladh, deutsch auch Ulaiden genannt, sind ein altes irisches Volk, dessen Name als „Grabmal“ zu übersetzen ist. Gemeint ist damit das Grabmal der mythischen Königin Maeve, das sich auf dem Knocknarea im County Sligo an der Grenze Ulsters befindet.
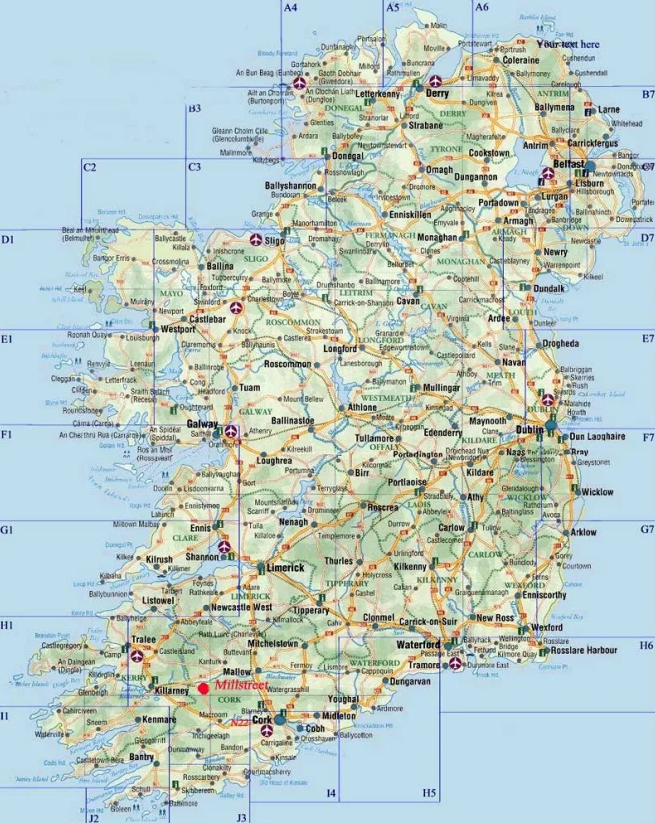
- abasinisch: Ирландия [Irlandija]
- abchasisch: Ирландия [Irlandija]
- acehnesisch: Irlandia
- adygisch: Ирланди [Irlandi]
- afrikaans: Ierland
- akan: Aereland
- albanisch: Irlandë, Irlanda
- alemannisch: Irland
- altaisch: Ирландия [Irlandija]
- altgriechisch: Ἰέρνη [Iernē], Ἰουερνία [Iouernia], Ἱβερνία [Ivernia]
- altnordisch: Írland
- amharisch: አየርላንድ [Ăyärland]
- angelsächsisch: Îrland
- arabisch: إيرلندا [Īrlandā], آيرلندا [Āyirlandā], إرلندة [Irlandâ], إرلندا [Irlandā]
- aragonesisch: Irlanda
- aramäisch: ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܐܝܪܠܢܕ
- armenisch: Իռլանդիա [Iṙlandia]
- aromunisch: Irlanda
- aserbaidschanisch: İrlandiya
- assamesisch: আয়ার্ল্যাণ্ড [Āyārlæṇḍ]
- asturisch: Irlanda
- awarisch: Ирландия [Irlandija]
- aymara: Irlandiya
- bairisch-österreichisch: Irlånd
- bambara: Irilandi
- bandscharisch: Irlanda
- baschkirisch: Ирландия [Irlandija]
- baskisch: Irlanda
- bengalisch: আয়ারল্যাণ্ড [Āyārlæṇḍ], আয়ারল্যান্ড [Āyārlænḍ], আয়ার্ল্যাণ্ড [Āyārlæṇḍ]
- bhutanisch: ཨའིརི་ལེནཌ [A’iri.lenḍ]
- biharisch: आयरलैंड [Āyarlæṃḍ]
- bikol: Irlanda
- birmanisch: အိုင်ယာလန် [Aĩyalã]
- bislama: Ailan
- bosnisch: Ирска [Irska]
- bretonisch: Iwerzhon
- bulgarisch: Ирландия [Irlandija]
- burjatisch: Ирланд [Irland]
- cebuano: Irlanda
- chakassisch: Ирландия [Irlandija]
- chavakano: Irlanda
- cherokee: ᎠᏲᎳᏂ [Irland]
- chinesisch: 愛爾蘭 / 爱尔兰 [Ài'ěrlán]
- dari: ایرلند [Airland]
- dänisch: Irland
- deutsch: Irland
- dine: Bitsiigha’ Łichíí’í Bikéyah
- emilianisch: Irlànda
- englisch: Ireland
- esperanto: Irlando
- estnisch: Iirimaa, Iiri
- estremadurisch: Irlanda
- ewe: Irlã nutome, Irlã-du
- färingisch: Írland
- fidschianisch: Irland
- finnisch: Irlanti
- flämisch: Ierland
- franko-provenzalisch: Irlande
- französisch: Irlande
- friesisch: Ierlân
- friulanisch: Irlande
- ful: Irlannda
- gagausisch: Ирландия [Irlandiya]
- galizisch: Irlanda
- ganda: Ayalandi
- gälisch: Eirinn
- georgisch: ირლანდია [Irlandia]
- gotisch:
- griechisch: Ιρλανδία [Irlandía]
- grönländisch: Irlandi
- guarani: Ilandia
- gudscheratisch: આયરલેન્ડ [Āyarlenḍ]
- guyanisch: Irlann
- haitianisch: Ilann
- hakka: Oi-ngì-làn
- hausa: Airiland
- hawaiianisch: 'Ilelani
- hebräisch: אירלנד [Îrland], אירלאנד [Îrlând]
- hindi: आयरलैंड [Āyarlæṃḍ]
- ido: Irlando
- igbo: Aialand
- ilokano: Irlandia
- indonesisch: Irlanda
- interlingua: Irlanda
- irisch: Éire
- isländisch: Írland
- italienisch: Irlanda
- jakutisch: Ирланд [Irland]
- jamaikanisch: Airilan
- japanisch: アイルランド [Airurando]
- javanisch: Irlanda
- jerseyanisch: Irlande
- jiddisch: אירלאַנד [Irland]
- kabardisch: Ирландие [Irlandie]
- kabiye: Irɩlandɩ
- kabylisch: ⵉⵔⵍⴰⵏⴷ [Lirlund]
- kalmükisch: ЭйринҺазр [Ejrinchazr]
- kambodschanisch: អៀរឡង់ [Ierḷăṅ], អៀកឡង់ [Iekḷăṅ]
- kanaresisch: ಐರ್ಲೆಂಡ್ [Airlēṇḍ]
- kantonesisch: 愛爾蘭/爱尔兰 [Oiyíhlàahn]
- kapverdisch: Irlanda
- karakalpakisch: Ирландия [Irlandija]
- karatschai-balkarisch: Ирландия [Irlandija]
- karelisch: Ирланти [Irlanti]
- kasachisch: Ирландия [Irlandija]
- kaschubisch: Irlandzkô, Jirlandzkô, Jirlandiô
- katalanisch: Irlanda
- kikuyu: Irirandi
- kirgisisch: Ирландия [Irlandija]
- komi: Ирландия [Irlandija]
- kongolesisch: Ayalan
- koreanisch: 아일랜드 [Aillaendeu]
- kornisch: Iwerdhon
- korsisch: Irlanda
- krimtatarisch: Ирландия [İrlandija]
- kroatisch: Irska
- kumükisch: Ирландия [Irlandija]
- kurdisch: ئیرلاند [Îrland]
- kurmandschisch: Ирланди / ئیرلاندی [Îrlandî]
- kvenisch: Irlanti, Irlanni
- ladinisch: Irlanda
- ladino: אירלאנדה [Irlanda]
- lakisch: Ирландия [Irlandija]
- laotisch: ອຽກລັງ [Aẏklâṅ]
- lasisch: ირლანდა [Irlanda]
- lateinisch: Irlandia, Hibernia
- lesgisch: Ирландия [Irlandija]
- lettgallisch: Eireja
- lettisch: Īrija
- letzeburgisch: Irland
- ligurisch: Éire
- limburgisch: Ierland
- lingala: Irelandɛ
- litauisch: Airija
- livisch: Irima
- lombardisch: Irlanda
- luba-katanga: Irelande
- madegassisch: Irlandy
- makedonisch: Ирска [Irska]
- malaisch: ايرلند [Ireland]
- malayalam: അയര്ലന്ഡ് [Ayarlanḍ]; ഐയര്ലാന്റ് [Aiyarlānṟ]
- maldivisch: އަޔަރްލޭންޑް [Ayarlēnḋ]
- maltesisch: Irlanda
- manx: Nerin
- maori: Airana
- marathisch: आयर्लंड [Āylæṃḍ]
- mari: Ирландий [Irlandij]
- maurizisch: Irland
- minangkabau: Irlandia
- mindong; 爱尔兰 [Ài'ěrlán]
- mingrelisch: ირლანდია [Irlandia]
- minnan: 愛爾蘭 [Ài-ní-lân / Ái-ěr-lân]
- mirandesisch: Irlanda
- moldawisch: Ирланда [Irlanda]
- mongolisch: Ирланд [Irland]
- mordwinisch: Ирландия Мастор [Irlandija Mastor]
- nahuatl: Irtlālpan
- nauruanisch: Airerand
- ndebele: Irilandi
- nepalesisch: आयरल्याण्ड [Āirləiṁḍ]
- niederländisch: Ierland
- niedersächsisch: Ierlaand
- normannisch: Irlaunde
- norwegisch: Irland
- novial: Irlande
- okzitanisch: Irlanda
- olonetzisch: Irlandii
- orissisch: ଆୟରଲ୍ଯାଣ୍ଡ [Āyôrlæṇḍ]
- oromo: Aayerlaandi
- ossetisch: Ирланди [Irlandi]
- pampangan: Ireland, Irland
- pandschabisch: ਆਇਰਲੈਂਡ [Āirlæṃḍ]
- pandschabisch, west: آئرلینڈ [Āʾirlænḋ]
- panganisan: Irlanda
- papiamentu: Irlandia
- paschtunisch: آيرلېند [Āyrlend], آئرلېند [Ā'irlend], آيرلېنډ [Āyrlenḋ], آئرلېنډ [Ā'irlenḋ]
- persisch: ایرلند [Īrland], ایرلاند [Īrlānd]
- piemontesisch: Irlanda
- pikardisch: Irlinde
- pitkernisch: Airiland
- plattdeutsch: Irland
- polnisch: Irlandia
- portugiesisch: Irlanda
- provenzalisch: Irlande, Irlando
- quetschua: Ilanda
- rätoromanisch: Irlanda
- ripuarisch: Irrlandt
- romani: Irland
- rumänisch: Irlanda
- rundi- rwandesisch:
- russisch: Ирландия [Irlandija]
- ruthenisch: Ирландія [Irlandija]
- samisch: Irlánda
- samoanisch: Aialani
- samogitisch: Airėjė
- sango: Irlânde
- sardisch: Oirlanda
- saterfriesisch: Irlound
- schlesisch: Irlandyjo
- schottisch: Ireland
- schwedisch: Irland
- schweizerdeutsch: Irland
- serbisch: Ирска [Irska]
- seschellisch: Irland
- sindi: آئرلينڊ [Ā'irlenḋ]
- singhalesisch: අයර්ලන්තය [Ayarlantaya]
- sizilianisch: Irlanda
- slovio: Irlandia
- slowakisch: Írsko
- slowenisch: Irska
- somalisch: Ayrlaanda
- spanisch: Irlanda
- sudovisch: Irija
- sundanesisch: Irland
- surinamesisch: Irlan
- swahili: Ireland
- swasi: IYalendi
- syrisch: ܐܝܪܠܢܕ [Īrland]
- tabassaranisch: Ирландия [Irlandija]
- tadschikisch: Ирландия [Irlandija], ایرلندیه [Īrlandiyâ]
- tagalog: Irlandiya, Islanda
- tahitianisch: Irelāna
- tamilisch: அயர்லாந்து [Ayarlāntu]
- tatarisch: Ирландия [İrlandiä]
- telugu: ఐర్లాండ్ [Airlāṃḍ]
- thai: ไอร์แลนด์ [Ai[r]lǣn[d]]
- tibetisch: ཨེར་ལན། (Er.lan); ཨར་ལེན་ཌ། [Ar.len.ḍa]
- tigrinisch: ኣየርላንድ [Ayärland]
- timoresisch: Irlanda
- tokelauisch: Aialani
- tok pisin: Aialan
- tonganisch: 'Aealani
- tschechisch: Irsko
- tschetschenisch: Ирланди [Irlandi]
- tschuwaschisch: Ирланди [Irlandi]
- turkmenisch: Ирландия [Irlandiýa]
- tuwinisch: Ирландия [Irlandija]
- türkisch: İrlanda
- twi: Ailande
- udmurtisch: Ирландия [Irlandiya]
- uigurisch: ئىرلاندىيه [Irlandiye]
- ukrainisch: Ірландія [Irlandija]
- ungarisch: Írország
- urdu: آئرلینڈ / آئر لینڈ [Ā'irlænḋ], آیرلینڈ [Āyarlænḋ]
- usbekisch: Ирландия [Irlandiya]
- venezianisch: Irlanda
- vietnamesisch: Ai-len
- visayan: Irlandia
- volapük: Lireyän
- voronisch: Iirimaa
- walisisch: yr Iwerddon
- wallonisch: Irlande
- weißrussisch: Ірландыя [Irlandyja], Ірляндыя [Irljandyja]
- wepsisch: Irlandii
- winaray: Irlanda
- wolof: Irlaand
- xhosa: Ayalandi
- yoruba: Írẹ́lándì
- yukatekisch: Irlanda
- zazakisch: ئیرلاندا [Îrlanda]
- zhuang: Aiwjlanz Gunghozgoz
- zulu: i-Ayilendi
Offizieller Name:
- irisch: Poblacht na h’Éireann bzw. Tuaisceart Éireann
- englisch: Republic of Ireland bzw. Northern Ireland
- Bezeichnung der Bewohner: na hÉireannaigh / Irish (Iren)
- adjektivisch: éireann / irish (irisch)
Kürzel:
- Landescode: IE / IRL
- Deutsch: IRL
- Alternativ: EIR
- Sport: IRL (seit 1921/24)
- Kfz: SE (1921 bis 1938), EIR (1938 bis 1962), IRL (seit 1962)
- FIPS-Code: EI
- ISO-Code: IE, IRL, 372
- Internet: .ie
Lage
Irland bildet den westlichen Teil der üblicherweise Westeuropa zugeordneten Britischen Inseln am Nordostrand des Atlantischen Ozeans. Sie befindet sich zwischen 51° und 56° n.B. sowie 6° und 11° w.L., auf der gleichen geografischen Breite wie England, die Benelux-Staaten, die Nordhälfte Deutschlands, das südliche Dänemark, der Großteil Polens, Kaliningrad, Litauren, weißrussland, die nördliche Ukraine, Zentral-Russland, Nord-Kasachstan, Süd-Sibirien, der äußerste Norden der Mongolei, Sachalin, die Kurilen und der Zentralgürtel Kanadas. Nordirland befindet sich auf durchschnittlich 54°44’ n.B. und 6°50’ w.L..
Geografische Lage:
- nördlichster Punkt: 55°22‘56“ n.B. (Dunaldragh / Donegal) bzw. 55°26’01“ n.B. (Inishtrahull Island)
- südlichster Punkt: 51°26‘51“ n.B. (Brow Head / Cork) bzw. 51°23’21“ n.B. (Fastnet Rock)
- östlichster Punkt: 5°25‘52“ w.L. (Burr Point / Nordirland) bzw. 5°25’37“ w.L. (Burial Island)
- westlichster Punkt: 10°28‘47“ w.L. (Dunmore Head / Kerry) bzw. 10°39’30“ w.L. (Tearaght Island / Kerry)

Geografische Lage für Nordirland:
- nördlichster Punkt: 55°17’32“ n.B. (Rathlin Island)
- südlichster Punkt: 54°01’35“ n.B. (Cranfield Point)
- östlichster Punkt: 5°25’37“ w.L. (Burial Island)
- westlichster Punkt: 8°10’00“ w.L. (Bradoge Bridge / Fermanagh)
Entfernungen:
- An Chruit 50 m
- Schottland 34,9 km
- Isle of Man 53 km
- Wales 78 km
- England 118 km
- Cornwall 243 km
- Bretagne (Argenton) 439,5 km
Zeitzone
In Irland gilt die Coordinated Universal Time, irisch Am Uilíoch Comhordaithe (Koordinierte Weltzeit), abgekürzt UTC, identisch mit der Greenwich Mean Time (Westeuropäische Zeit), kurz GMT (WEZ), eine Stunde hinter der MEZ. Die Realzeit liegt um 24 bis 42 Minuten hinter der Koordinierten Weltzeit (UTC).
Fläche
Die Republik Irland hat eine offizielle Fläche von 70.182 km², nach alternativen Angaben 70.273 km² bzw. 27.133 mi². Die Insel Irland ist insgesamt 84.150 km² bzw. 32.490 mi², inklusive Nebeninseln 84.421 km² bzw. 32.595 mi² groß. Nordirland umfasst offiziell 13.834 km² bzw. 5.345 mi² groß, nach alternativen Angaben 14.120 km². Die Insel ist in Nordnordost-Südsüdwest-Richtung 486 km lang und bis zu 304 km breit. Die Grenze der Republik Irland zu Nordirland ist 360 km. Die Küste der Insel Irland hat eine Gesamtlänge von 3.170 km, inklusive Buchten und Inseln von 5.631 km. Die tiefste Stelle liegt auf Meeresniveau mit einem maximalen Tidenhub von 1,9 bis 6,2 m - bei Limerick 5,8 m, Cobh bzw. Corkl 4,31 m, Sligo 4,1 m, Dublin 4,08 m, Bangor 3,6 m, Belfast 3,44 m, Londonderry 2,8 m, Portrush 2,13 m und Rosslare 1,91 m Höchste Erhebung ist der Carrantuohill mit 1041 m, in Nordirland der Slieve Donard mit 852 m. Die mittlere Seehöhe liegt bei etwa 110 m.
Flächenaufteilung Republik Irland 2001:
- Wiesen und Sträucher 50.170 km² (71,4 %)
- Agrarland 11.803 km² (16,8 %
- )Waldland 6 .590 km² (9,4 %)
- Gewässer 1.390 km² (2,0 %)
- Verbautes Gelände 320 km² (0,4 %)
Flächenaufteilung für Nordirland 2001:
- Grasland 8.306 qkm (58,8 %)
- Sträucher 2.032 qkm (14,4 %)
- Weideland 1.591 qkm (1,3 %)
- Waldland 880 qkm (6,2 %)
- Agrarland und Gärten 591 qkm (4,2 %)
- Gewässer 510 qkm (3,6 %)
- Verbautes Gelände 210 qkm (1,5 %)
Grenzverlauf
Die Grenze zwischen irland und Nordirland wurde im Jahr 1921 festgelegt. Bei der Teilung Irlands sind die Engländer sehr raffiniert vorgegangen. Sie haben nämlich die Grenze bewusst so gezogen, dass in Nordirland die protestantischen Nachkommen der englischen Einwanderer mit zwei Drittel in der Mehrheit sind, aber die katho-lischen Iren mit einem Drittel in der Minderheit. Deshalb haben die Engländer nicht die ursprüngliche Provinz Ulster als ganze abge-spalten. Dann wären nämlich Katholiken und Protestanten zahlenmäßig etwa gleich stark gewesen.
Wegen dieser raffinierten Grenzziehung konnten England und seine Freunde in Nordirland allen Volksabstimmungen über die Zukunft Nordirlands gelassen entgegensehen. Denn die katholischen Iren wollen zwar die Wiedervereinigung ganz Irlands - aber sie sind ja hoffnungslos in der Minderheit. Die protestantischen Nachkommen der englischen Eroberer wollen natürlich bei England bleiben. Die katholischen Iren in Nordirland wurden von der englandfreundlichen protestantischen Mehrheit systematisch unter-drückt: So sind zum Beispiel in der Stadt Londonderry die katholischen Iren in der Mehrheit. Aber die Wahlkreise wurden so raffiniert eingeteilt, daß im Stadtrat trotzdem eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Protestanten herauskam. Gegen diese skandalöse Unterdrückung haben sich die katholischen Iren gewehrt. Die katholische Bürgerrechtsbewegung forderte zum Beispiel seit 1968: für jeden Bürger eine Wahlstimme. Bislang war das Wahlrecht nämlich vom Hausbesitz abhängig. Und Häuser besaßen fast nur die Protestanten. Aber die protestantische Mehrheit blieb stur und beharrte auf ihren Privilegien. Wegen dieser andauernden sozialen Diskriminierung der katholischen Iren fand die militante IRA, die Irisch-Republikanische Armee immer mehr Sympathisanten.
Die IRA wollte mit Gewalt die Wiedervereinigung und die soziale Gleichberechtigung erzwingen, die von der protes-tantischen Mehrheit verweigert wurde. Aber wegen des IRA-Terrors schaltete die protestantische Mehrheit jetzt erst recht auf stur. Es entstand eine bürgerkriegsähnliche Situation. In dieser brenzligen Lage setzte England wieder sein Militär ein. Die Absicht der Engländer war zunächst, die streitenden Parteien auseinanderzuhalten. Aber jetzt ging’s erst richtig los.
Die englandtreuen Protestanten fühlten sich von den Engländern verraten, da die Armee auch gegen Protestanten vorging. Die katholischen Iren hassten die Engländer in der Erinnerung an die jahrhundertelange Unterdrückung Irlands und in der Erinnerung daran, daß schließlich England selber die raffinierte Grenze zwischen Nord- und Südirland erzwungen hatte.
Geologie
Die älteste Gesteinsformation Irlands ist etwa 1,7 Milliarden Jahre alt und findet sich auf Inishtrahull Island an der Küste des County Donegal. In anderen Teilen Donegals entdeckten Wissenschaftler Findlinge, die noch von der letzten Eiszeit künden. Aufgrund späterer geologischer Verwerfungen ist es jedoch unmöglich diese Gesteinslagen eindeutig zuzuordnen.
Vor etwa 600 Millionen Jahren, am Ende des Präkambriums, wurde die irische Landmasse in zwei Teile zertrennt. Die eine Hälfte lag im östlichen Teil des Urozeans Iapetus, die andere in dessen Westhälfte. Beide Teile befanden sich zum damaligen Zeitpunkt in etwa auf dem gleichen Breitengrad wie das heutige Südafrika. Aufgrund von Fossilienfunden in Bray weiß man, dass die spätere Insel zu diesem Zeitpunkt unter dem Meeresspiegel gelegen haben muss.
Während der nächsten 50 Millionen Jahre drifteten die beiden Hälften wieder aufeinander zu, bis sie sich schließlich vor etwa 440 Millionen Jahren wieder vereinigten. Auch dies wurde durch fossile Fauna, die im County Louth entdeckt wurde, bestätigt. Die Berge im Nordwesten Irlands sowie der Granit aus Donegal und Wicklow waren eine Folge dieser Wiedervereinigung.
Die irische Landmasse lag nun oberhalb des Meeresspiegels in der Nähe des Äquators. Aus dieser Zeit sind in Kiltorcan, County Kilkenny, noch versteinerte Bäume sowie auf Valentia Island fossile Süßwassermuscheln und in Schiefer die Fußabdrücke einer vierbeinigen Amphibie erhalten. Die Felsformation Old Red Sandstone stammt ebenso aus dieser Zeit.
Vor etwa 400 Millionen und 300 Millionen Jahren versank Nordwesteuropa - auch Irland - in einem warmen, kalziumreichen Ozean. Großartige Korallenriffe formten in dieser Zeit den Kalkstein, der heute noch etwa 65 % des steinernen Mantels Irlands ausmacht. Als sich das Wasser zurückzog, bildeten sich tropische Urwälder und Sümpfe. Im Karbon wandelten sich diese zu Kohle, die jedoch größtenteils der Erosion zum Opfer fiel. Während dieser Zeit bewegte sich Irland weiter nordwärts. Der so entstandene Druck formte die Hügelketten, die sich heute von Nordosten nach Südwesten erstrecken.
Vor etwa 250 Millionen Jahren befand sich Irland auf Höhe des heutigen Nordafrika und hatte ein Wüstenklima. Zu dieser Zeit erodierten große Teile der Kohle und des Sandsteins. Resultat war die heutige Karstlandschaft in Burren im County Clare.
Etwas später bildeten sich die organischen Ablagerungen, die heute als Erdgas und Erdöl wichtige Stützen der irischen Wirtschaft darstellen. Vor 150 Millionen Jahren versank die Insel erneut im Ozean, so dass sich weitläufige Kalkablagerungen bilden konnten. Spuren davon liegen in Nordirland noch unter Basaltgestein.
Vor 65 Millionen Jahren begann eine Zeit vulkanischer Aktivität. Die Mourne Mountains und andere Gebirgszüge sind Folgen dieser Epoche. Günstige klimatische Bedingungen ließen eine üppige Vegetation wachsen, die noch heute, ungenutzt im County Antrim, als Braunkohle existiert. Das warme Klima verursachte jedoch auch heftige Regenfälle, die die Erosion noch weiter beschleunigten.
Vor 25 Millionen Jahren war Irland schon nahe seiner heutigen Position. Durch Erosionsvorgänge hatte sich schon eine mächtige Erdschicht entwickelt, die den größten Teil des steinernen Mantels bedeckte. Dort wo das Wasser nicht abfließen konnte, entstanden Tonschichten. Als sich das Klima abzukühlen begann, verlangsamte sich die Bodenbildung und die Flora und Fauna begann sich so zu entwickeln, wie sie die ersten menschlichen Siedler vorfinden sollten. Vor etwa 3 Millionen Jahren hatte sich die heute existierende Landschaft geformt.
Seit etwa 1,7 Millionen Jahren ist die Erde ständig einander ablösenden Kalt- und Warmperioden ausgesetzt. Die frühesten Zeugnisse auf Irland stammen aus der Warmperiode des Ballylinian, die vor circa 500.000 Jahren einsetzte. Den stärksten Eindruck hinterließen jedoch die Eiszeiten.
Am offensichtlichsten sind die noch heute zu bewundernden Gletschertäler, wie jenes in Glendalough, Gletscherseen, Kare, Drumlins und Oser (irisch eiscir). Das eindrucksvollste Os liegt in Esker Riada. Es teilt die Insel in einen Nord- und einen Südteil und wurde einstmals als Schnellstraße genutzt.
Das weite zentral gelegene Flachland Irlands besteht aus Kalkstein, der von Schichten aus Gletschermaterial, Ton und Sand sowie von Seen und Moorlandschaften bedeckt ist. Das größte Regenmoor ist das Bog of Allen. Die küstennahen Gebirge unterscheiden sich sehr stark hinsichtlich ihrer geologischen Struktur. Im Süden bestehen die Berge aus altem roten Sandstein mit Flussbetten aus Kalkstein. In Galway, im County Mayo, in Donegal, im County Down und in Wicklow sind die Berge aus Granit aufgebaut, während die Hochebene im Nord-Osten des Landes aus Basalt aufgebaut ist. Die bemerkenswerteste Basaltformation ist Giant’s Causeway im County Antrim.
Im Norden und Westen Irlands formte Wasser, das nicht abfließen konnte, Torf und Gleylandschaften. Im Gegensatz dazu besteht das Erdreich im Süden und Osten aus braunem und grauem Podsol. Dies spiegelt auch die Verteilung der Regenfälle auf der Insel wider, da gerade im Nordwesten der meiste Regen fällt.
Eine ungewöhnliche Landschaft liegt im County Clare im Norden: The Burren. Dieses Karstgebiet besteht aus verwitterten Kalksteinfelsen, die kaum von Erdreich bedeckt sind. Es gibt dort mehrere Karsttrichter in welche Oberflächenwasser eindringt, dadurch hat sich ein ausgedehntes Höhlensystem geformt.
Landschaft
Irland ist geformt wie eine Schüssel - im Innern flach, am Rand bergig mit zum Teil steil abfaDer Fluss Shannon, der von Norden nach Süden verläuft, ist der längste der Insel. In den Ebenen liegen zahlreiche Seen, welche die Landschaft maßgeblich prägen. Lough Neagh, der zu Nordirland gehört, ist der bekannteste der irischen Seen.llenden Klippen zum Meer hin.
Das Flachland im Zentrum Irlands ist umringt von Gebirgsketten, angefangen im Südwesten im County Kerry bei den Macgillycuddy's Reeks entgegen dem Uhrzeigersinn: Comeragh Mountains, Blackstair Mountains, Wicklow Mountains, the Mournes, Glens of Antrim, Sperrin Mountains, Bluestack Mountains, Derryveagh Mountains, Ox Mountains, Nephinbeg Mountains und die Twelve Bens/Maumturks. Einige wenige Bergketten liegen im südlichen Landesinnern, darunter die Galtee Mountains, Silvermines und die Slieve Bloom Mountains. Die höchste Erhebung ist mit 1041 m der Carrauntuohill (irisch Corrán Tuathail). Der Berg ist Teil der Macgillycuddy's Reeks, einer Kette von durch Gletschern abgeschliffenen Sandsteinbergen. Die meisten Berge sind nicht hoch, nur 3 erreichen eine Höhe von über 1000 m, nur 455 Erhebungen überschreiten die 500 m-Grenze.
Größter Fluss Irlands ist der Shannon, der mit etwa 386 km Länge auch der längste Fluss Irlands und der Britischen Inseln ist. Er entspringt im County Cavan und fließt auf einer Strecke von etwa 260 km südwärts und trennt das morastige Binnenland vom Westen Irlands und bildet drei größere Seen: Lough Allen, Lough Ree und der größte: Lough Derg. Der Shannon mündet nahe Limerick in einem 113 km langen Ästuar in den Atlantik. Andere größere Flüsse sind die Liffey, der Lee, der Blackwater, der Nore, der Suir, der Barrow und der Boyne.
Lough Neagh in Ulster ist der größte See Irlands. Er bedeckt eine Fläche von 396 km² und ist 30 km lang und 15 km breit. Der Legende nach kämpfte der Riese Fionn mac Cumhaill mit einem anderen in Schottland und griff im Eifer des Gefechts einen Klumpen Lehm um diesen nach seinem Kontrahenten zu werfen. Der Klumpen landete in der Irischen See und wurde zur heutigen Isle of Man, während sich das Loch mit Wasser füllte und zum Lough Neagh wurde. Andere große Seen sind unter anderem Lough Erne und Lough Corrib.
Angefangen im Westen, im County Donegal, teilt Lough Swilly die Malin-Halbinsel. Lough Foyle auf der anderen Seite ist einer der größten Meeresarme, er liegt zwischen dem County Donegal und dem County Londonderry. Weiter findet man noch den Belfast Lough zwischen dem County Antrim und County Down. Im County Down gibt es noch den Strangford Lough, der die Arbs von Irland trennt, weiter entlang der Küste gelangt man zum Carlingford Lough zwischen Down und Louth. Der nächste größere Meeresarm ist Dublin Bay.
Die Ostküste ist zum größten Teil gleichförmig, lediglich Wexford Harbour, die Mündung des Slaney bildet eine Ausnahme. An der südlichen Küste liegt der Waterford Harbour, die Mündung des Suir, in den die beiden anderen der drei Schwestern, Nore und Barrow) fließen. Der nächstgrößere Meeresarm ist Cork Harbour, die Mündung des Lee, in der Great Island liegt.
Dunmanus Bay, Bantry Bay, die Mündung des Kenmare und Dingle Bay sind Meeresarme und Buchten der Halbinseln im County Kerry. Clew Bay liegt an der Küste des County Mayo, südlich von Achill, während sich Blacksod Bay im Norden der Insel befindet. Killala Bay ist nördlich von Mayo. Donegal Bay ist ein größerer Meeresarm zwischen den Countys Donegal und Sligo.
Malin Head im County Donegal ist der nördlichste Punkt der irischen Insel, während Mizen Head einer der südlichsten Punkte ist, daher stammt auch der Ausdruck „Malin head to Mizen head“, wenn man etwas die gesamte Insel betreffend meint. Der wirklich südlichste Punkt ist Carnsore Point im County Wexford.
Achill Island im County Mayo im Nordwesten ist die größte der Inseln Irlands. Das Eiland ist bewohnt und über eine Brücke mit der Hauptinsel verbunden. Die nächstgrößeren sind die Aran Islands vor der Küste des County Galway, bei denen es sich um Gaeltachts handelt, Regionen in denen noch irisches Gälisch vorherrschend ist. Valentia Island vor der Halbinsel von Iveragh im County Kerry ist ebenso eine der größeren Inseln. Sie ist dünn besiedelt und über eine Brücke mit der Hauptinsel verbunden. Omey Island vor der Küste von Connemara im County Galway ist eine kleinere Gezeiteninsel. Die Halbinsel Cooley an der irischen See ist eine der wenigen Halbinseln der Republik Irland im Osten.
Einige der bekanntesten Halbinseln liegen im County Kerry: die Dingle-Halbinsel, die oben erwähnte Iveragh und die Beara. Die Ards im County Down ist eine der größeren Halbinseln außerhalb von Kerry. Auf Inishowen im County Donegal liegen der nördlichste Punkt Malin Head der Hauptinsel und wichtige Städte wie Buncrana am Lough Swilly, Carndonagh und Moville am Lough Foyle.
Irlands nördlichste Insel ist Inishtrahull Island, obwohl Irland auch Anspruch auf den noch weiter nördlich gelegenen Felsen Rockall erhebt, den jedoch auch Großbritannien, Dänemark (als Teil der Färöer) und Island für sich beanspruchen.

Erhebungen
- Carrantuohill 1041 m (Macgillycuddy’s Reeks)
- Beenkeragh 1010 m (Macgillycuddy’s Reeks)
- Caher 1001 m (Macgillycuddy’s Reeks)
- Mount Brandon 952 m (Slieve Mish Mountain
- Lugnaquilla 926 m (Wicklow Mountains)
- Slieve Donard 852 m (Mourne Mountains)
- Slieve Donard 849 m (Mountains) of Mourne
- Mullaghclevaun 849 m (Wicklow Mountains)
- Mangerton Mountain 843 m (Macgillycuddy’s Reeks)
- Tonelagee 817 m (Wicklow Mountains)
- Mweelrea 814 m (Mweelrea
- Cloghernagh 800 m (Wicklow Mountains)
- Mount Leinster 795 m (Blackstairs Mountains)
- Knockmealdown 794 m (Kncokmealdown Mountains)
- Knockmoylan 768 m (Kncokmealdown Mountains)
- Slieve Commedagh 767 m (Mourne Mountains)
- Croagh Patrick 764 m (Murrisk Mountains)
- Slievemaan 759 m (Wicklow Mountains)
- Mount Errigal 749 m (Derryveagh Mountains)
- Blackstairs Mountain 735 m (Blackstairs Mountains)
- Slieve Car 721 m (Nephin Beg Mountains)
- Slievenamon 719 m (Slievenamon
- Hungry Hill 686 m (Caha Mountains)
- Sawel Mountain 683 m (Sperrin Mountains)
- Maum Trasna 682 m (Partry Mountains)
- Slievemore 671 m (Achill Island
- Knocknafallia 668 m (Kncokmealdown Mountains)
- Muckish Mountain 666 m (Derryveagh Mountains)
- Sugarloaf Hill 663 m (Kncokmealdown Mountains)
- Devil’s Mother 645 m (Partry Mountains)
- Mullaghcloga 636 m (Sperrin Mountains)
- Nephin Beg 625 m (Nephin Beg Mountains)
- Trostan 554 m (Antrim Mountains)
- Mullaghmore 541 m (Sperrin Mountains)
- Slieve Gallion 528 m (Sperrin Mountains)
- Knocklayd 517 m (Antrim Mountains)
- Agnew’s Hill 476 m (Antrim Mountains)
- Binevenagh 384 m (Binevenagh)
- Tullybrack 376 m (Fermanagh)
- Slievekirk 372 m (Sperrin Mountains)
Seen
- Lough Neagh 396 km²
- Lough Comb 200 km²
- Lough Derg 118 km²
- Lough Erne 105 km²
- Lough Ree 60 km²
- Lough Conn 57 km²
- Lough Leane 19 km²
- Lough Carra 16 km²
- Lough Gill 12 km²
Flüsse
- Shannon River 386 km
- River Barrow 192 km
- River Suir 184 km
- River Blackwater 168 km
- River Nore 140 km
- River Bann 129 km
- River Liffey 125 km
- River Erne 120 km
- River Lagan 100 km
Inseln
- Irland 84.288 km²
- Achill Island 146 km²
- Clare Island 18,7 km²
- Turk Island 12 km²
- Rathlin Island 10 km²
Flora und Fauna
Die Flora und Fauna Islands ist stark vom rauen Klima und der isolierten Lage der Insel geprägt. Die Pflanzenwelt ist eher spärlich, da das Wetter kühl und der Boden oft vulkanisch ist. Statt großer Wälder findet man vor allem Moose, Flechten, Gräser und kleine Sträucher wie die Zwergbirke oder Weidenarten. Im Sommer blühen bunte Wildblumen, darunter auch die auffällige Lupine, die zur Bodenfestigung eingeführt wurde. Die Tierwelt an Land ist begrenzt; neben dem einzigen einheimischen Säugetier, dem Polarfuchs, leben auf der Insel auch eingeführte Arten wie Rentiere und Mäuse. Dafür ist die Vogelwelt sehr artenreich: Besonders bekannt sind Papageitaucher, Möwen und andere Seevögel, die an den Küsten nisten. In den umliegenden Meeren gibt es viele Fischarten sowie Robben und Wale, die eine wichtige Rolle für Islands Natur und Wirtschaft spielen.
Flora
Irland kann nicht so viel Artenreichtum wie das europäische Festland oder die Nachbarinsel Großbritannien vorweisen. Denn die Grüne Insel wurde am Ende der letzten Eiszeit von Großbritannien getrennt, viele Pflanzen erreichten Irland nun nicht mehr. Trotzdem hat Irland landschaftlich einiges zu bieten. So konnten etwa (anders als auf dem Kontinent) Moore, Dünen und Feuchtland in Irland überdauern, da das Land aufgrund der niedrigen Bevölkerungszahl nur gering genutzt wird. In diesen Gebieten gibt es Heidekraut, Moos- und Flechtenarten.
Botanisch besonders interessant sind etwa die Burren, hier wachsen auf karbonhaltigem Kalkstein arktische sowie alpine und mediterrane Pflanzen, aber auch seltene Orchideenarten. Subtropische Pflanzen und Bäume sind bei Killarney und Glengariff in der Grafschaft Kerry, zu finden. Vor allem im Frühsommer und Sommer sind überall wild wachsende Rhododendren und Fuchsienhecken zu finden. Wälder findet man in Irland leider kaum noch, da diese im 17. Jahrhundert größtenteils gerodet worden sind. Man kann jedoch noch Eichen, Kiefer- und Fichtenarten sowie Tannen und Lärchen finden.
Mit etwa 3.815 Pflanzenarten (inklusive Gefäßpflanzen, Moose und Pilze) ist die Biodiversität im Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ gering, was auf die kleine Landfläche, begrenzte geologische Vielfalt und die Auswirkungen der letzten Eiszeit zurückzuführen ist. Nach dem Rückzug der Gletscher vor etwa 13.000 Jahren besiedelten Pflanzen die Insel über eine Landbrücke aus Wales, die bis vor zirka 7.500 Jahren bestand. Menschliche Einflüsse seit der Steinzeit, insbesondere intensive Landwirtschaft, haben die Landschaft stark verändert – Wälder machen heute nur noch einen kleinen Teil aus, während Moore, Grasländer und Küstengebiete dominieren. Irland hat keine streng endemischen Arten, aber Reliktarten aus der Eiszeit wie die Moltebeere (Rubus chamaemorus) und einzigartige Habitate wie das Burren-Gebiet in County Clare, das über 70 % der einheimischen Arten auf weniger als 0,5 % der Fläche beherbergt. Invasive Arten wie der Kanadische Wasserpest (Elodea canadensis) bedrohen die heimische Flora.
Moore, sowohl Hochmoore wie das Bog of Allen als auch Deckenmoore im Westen, sind ikonisch für Irland und bedecken etwa 200.000 Hektar. Sie entstanden vor rund 10.000 Jahren durch hohe Niederschläge und schlechte Drainage, was saure, nährstoffarme Böden schuf. Torfmoose (Sphagnum spp.) dominieren diese Habitate, ergänzt durch anpassungsfähige Gefäßpflanzen, die mit den extremen Bedingungen zurechtkommen. Typische Arten sind die Gemeine Rosmarinheide (Andromeda polifolia), die Gewöhnliche Moosbeere (Vaccinium oxycoccos), das Wollgras (Eriophorum angustifolium und Eriophorum vaginatum), das Sumpf-Blutauge (Potentilla erecta), der Rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia), der Langblättrige Sonnentau (Drosera intermedia) und der Englische Sonnentau (Drosera anglica). Weitere charakteristische Pflanzen umfassen die Torfmyrte (Myrica gale), die Sumpf-Binse (Juncus effusus), die Moor-Binse (Schoenus nigricans), die Sumpf-Orchidee (Hammarbya paludosa), das Sumpf-Labkraut (Galium palustre), der Königsfarn (Osmunda regalis), die Blasenbinse (Utricularia spp.), der Sumpf-Knöterich (Persicaria amphibia), die Schwarze Krähenbeere (Empetrum nigrum) und die Moor-Asphodel (Narthecium ossifragum). In abgetorften Mooren wachsen nasse Wälder mit Flaum-Birke (Betula pubescens), Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Grauweide (Salix cinerea). Reliktarten wie die Moltebeere (Rubus chamaemorus), eine eiszeitliche Überlebende, finden sich in höheren Lagen. Trotz ihrer ökologischen Bedeutung sind Moore durch Torfabbau und Entwässerung stark gefährdet, was europaweite Schutzmaßnahmen erforderlich macht.
Irlands Wälder, ursprünglich flächendeckend, sind durch Abholzung auf wenige Gebiete zurückgedrängt, vor allem in Hügel- und Berglagen wie im Westen, wo atlantische Regenwälder mit Eichen (Quercus robur und Quercus petraea), Birken (Betula pendula und Betula pubescens), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Stechpalme (Ilex aquifolium), Hasel (Corylus avellana), Eibe (Taxus baccata) und Espe (Populus tremula) überleben. Die feuchte Umgebung fördert eine artenreiche Bodenvegetation, darunter Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella), Wald-Windröschen (Anemone nemorosa), Haselwurz (Asarum europaeum), Gewöhnliches Haselwurz (Geum urbanum), Kriechender Günsel (Ajuga reptans), Bärlauch (Allium ursinum), Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), Hundsviole (Viola riviniana), Geißblatt (Lonicera periclymenum), Schlehe (Prunus spinosa), Vogel-Nestwurz-Orchidee (Neottia nidus-avis), Waldmeister (Galium odoratum), Bittere Schaumkraut (Cardamine amara), Gefleckte Aronstab (Arum maculatum), Glockenblumen (Hyacinthoides non-scripta) und Kleines Scharbockskraut (Ficaria verna). Diese Wälder sind durch menschliche Aktivitäten wie Landwirtschaft und Siedlungsbau stark verändert, was sie zu einem der am stärksten beeinträchtigten Habitate weltweit macht. Wiederaufforstungsprojekte versuchen, diese Verluste auszugleichen.
Grasländer, geformt durch Beweidung und Mahd, dominieren die irische Landschaft und gliedern sich in Niederungs- und Hochlandwiesen. Niederungswiesen, oft auf nährstoffreichen Böden, werden von Gräsern wie Duftendem Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Ausdauerndem Weidelgras (Lolium perenne), Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Falschem Hafergras (Arrhenatherum elatius), Kammgras (Cynosurus cristatus), Rotem Straußgras (Festuca rubra) und Wiesen-Rispengras (Poa pratensis) geprägt. Blütenpflanzen wie Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris), Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis), Wiesen-Knöterich (Persicaria bistorta), Gelbe Rattler (Rhinanthus minor), Wiesen-Bartsia (Odontites vernus), Sumpf-Labkraut (Galium palustre), Primel (Primula veris), Löwenzahn (Taraxacum officinale) und Wiesen-Butterblume (Ranunculus acris) bereichern diese Flächen. Hochlandgrasländer, auf saureren Böden, umfassen Wellen-Haargras (Deschampsia flexuosa), Schaf-Schwingel (Festuca ovina), Kreuzblättrige Heide (Erica tetralix) und Blaubeere (Vaccinium myrtillus). Diese Habitate sind essenziell für die landwirtschaftliche Nutzung, aber Überweidung und Düngung bedrohen ihre Artenvielfalt.
Grasländer, geformt durch Beweidung und Mahd, dominieren die irische Landschaft und gliedern sich in Niederungs- und Hochlandwiesen. Niederungswiesen, oft auf nährstoffreichen Böden, werden von Gräsern wie Duftendem Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Ausdauerndem Weidelgras (Lolium perenne), Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Falschem Hafergras (Arrhenatherum elatius), Kammgras (Cynosurus cristatus), Rotem Straußgras (Festuca rubra) und Wiesen-Rispengras (Poa pratensis) geprägt. Blütenpflanzen wie Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris), Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis), Wiesen-Knöterich (Persicaria bistorta), Gelbe Rattler (Rhinanthus minor), Wiesen-Bartsia (Odontites vernus), Sumpf-Labkraut (Galium palustre), Primel (Primula veris), Löwenzahn (Taraxacum officinale) und Wiesen-Butterblume (Ranunculus acris) bereichern diese Flächen. Hochlandgrasländer, auf saureren Böden, umfassen Wellen-Haargras (Deschampsia flexuosa), Schaf-Schwingel (Festuca ovina), Kreuzblättrige Heide (Erica tetralix) und Blaubeere (Vaccinium myrtillus). Diese Habitate sind essenziell für die landwirtschaftliche Nutzung, aber Überweidung und Düngung bedrohen ihre Artenvielfalt.
Irlands Küsten, geprägt von Sanddünen, Salzmarschen, Klippen und Stränden, sind durch salzhaltige Winde und Gezeiten geformt. Trotz ihrer geringen Fläche sind sie artenreich. Typische Pflanzen sind Strandhafer (Ammophila arenaria), Strand-Milchkraut (Glaux maritima), Strand-Nelke (Dianthus deltoides), Meerfenchel (Crithmum maritimum), Strand-Salzmiere (Honckenya peploides), See-Spurge (Euphorbia paralias), Pyramiden-Orchidee (Anacamptis pyramidalis), Meer-Holly (Eryngium maritimum), Salzmiere (Halimione portulacoides), Glaswurz (Salicornia europaea), Strand-Dreizack (Triglochin maritima), Strand-Knöterich (Polygonum maritimum) und Strand-Binse (Juncus maritimus). In Salzmarschen wächst die Strand-Sode (Suaeda maritima). Invasive Arten wie der Neuseeländische Spinat (Tetragonia tetragonoides) breiten sich hier aus und gefährden die heimische Flora. Küstenvegetation wie an der Howth Head zeigt die Anpassungsfähigkeit dieser Pflanzen an extreme Bedingungen.
Die Bergregionen, etwa die Comeraghs, und die Karstlandschaft des Burren bieten einzigartige Habitate mit alpinen und mediterranen Einflüssen. Das Burren ist ein globaler Biodiversitäts-Hotspot, der über 24 Orchideenarten und bis zu 45 Arten pro Quadratmeter beherbergt. Kalkliebende Arten wie die Kalk-Fetthenne (Sedum acre) und kalkflüchtige wie das Heidekraut (Calluna vulgaris) koexistieren hier. Weitere typische Pflanzen sind der Frühlings-Enzian (Gentiana verna), die Berg-Segge (Carex binervis), das Glänzende Honiggras (Holcus lanatus), die Schafgarbe (Achillea millefolium), der Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), die Eberesche (Sorbus aucuparia), der Alpen-Enzian (Gentiana acaulis), der Steinbrech (Saxifraga spp.) und das Moosglöckchen (Linnaea borealis). Diese Vielfalt macht das Burren zu einem Schutzgebiet von internationaler Bedeutung.
Künstliche Habitate wie Straßenränder oder Kiesgruben bieten Platz für Arten wie Gewöhnliches Greiskraut (Jacobaea vulgaris), Ananas-Mayweed (Matricaria discoidea) und Mauerraute (Asplenium ruta-muraria). Der Schutz der irischen Flora wird durch den National Parks and Wildlife Service vorangetrieben, da Landwirtschaft, Urbanisierung und invasive Arten die Biodiversität bedrohen. Wiederaufforstung, Moorschutz und die Bekämpfung invasiver Arten sind zentrale Maßnahmen, um die einzigartige Pflanzenwelt Irlands zu bewahren.
Fauna
Nach dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 14.000 Jahren trennte sich Irland vom europäischen Festland, was zu einer vergleichsweise armen, aber einzigartigen Fauna führte. Mit nur 26 einheimischen Land-Säugetierarten (einschließlich Fledermäusen) und einer Gesamtzahl von rund 79 Säugetierarten, darunter 33 Meeresarten, dominiert die Artenvielfalt bei Vögeln, Fischen und Wirbellosen. Viele Arten sind Zugvögel oder Meeresbewohner, während Reptilien und Amphibien auf wenige Arten beschränkt sind. Die irische Fauna umfasst sowohl einheimische Relikte aus der Eiszeit als auch eingeführte Arten, die sich etabliert haben. Bedrohungen wie Habitatverlust durch Landwirtschaft, Klimawandel und Verschmutzung fordern Schutzmaßnahmen heraus, die in Nationalparks und Naturschutzgebieten umgesetzt werden.
Unter den Säugetieren fallen die einheimischen Landarten durch ihre Anpassung an die kühle, feuchte Umwelt auf. Der Rotfuchs (Vulpes vulpes) ist weit verbreitet und ein geschickter Jäger in Wäldern und Feldern. Der Europäische Igel (Erinaceus europaeus) durchstreift Gärten und Wiesen, wo er Insekten und Würmer jagt. Der Hermelin (Mustela erminea), auch Stoat genannt, und der Europäische Fischotter (Lutra lutra) sind agile Raubtiere, die in Flüssen und Küstennähe leben; letzterer ist ein geschützter Indikator für saubere Gewässer. Der Eurasische Zwergspitzmaus (Sorex minutus) und der Europäische Dachs (Meles meles) repräsentieren die Insektenfresser und Allesfresser, wobei der Dachs in unterirdischen Bauen lebt und eine soziale Struktur aufweist. Seltener anzutreffen sind der Irische Feldhase (Lepus timidus hibernicus), eine Unterart des Alpenhasen, der in offenen Landschaften grasend überlebt, sowie der Rothirsch (Cervus elaphus) und der Baummarder (Martes martes), die in Reservaten wie dem Glenveagh-Nationalpark geschützt werden. Zehn Fledermausarten, darunter die Gemeine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros), bevölkern die Nacht; sie sind die einzigen fliegenden Säugetiere Irlands. Eingeführte Arten wie der Europäische Kaninchen (Oryctolagus cuniculus), der Graue Eichhörnchen (Sciurus carolinensis) und die Wanderratte (Rattus norvegicus) haben sich naturalisiert und verdrängen teilweise Einheimische. Historisch ausgestorbene Giganten wie der Braunbär (Ursus arctos) oder der Grauwolf (Canis lupus) erinnern an eine reichere Vergangenheit, doch Reintroduktionsprogramme für Arten wie den Seeadler (Haliaeetus albicilla) geben Hoffnung.
Die Vogelwelt Irlands zählt 444 Arten, von denen viele Zugvögel die Insel bereichern und saisonale Rhythmen prägen. Residenten wie der Zaunkönig (Troglodytes troglodytes), der Rotkehlchen (Erithacus rubecula), der Amsel (Turdus merula) und der Buchfink (Fringilla coelebs) sind in neunzig Prozent der Landflächen vertreten und bilden das Rückgrat der Gartenvögel. Der Rabe (Corvus frugilegus), der Star (Sturnus vulgaris), die Kohlmeise (Parus major) und die Blaumeise (Cyanistes caeruleus) thrivieren in landwirtschaftlichen Gebieten. Besonders schützenswert sind Bestandsstarke Populationen wie der Europäische Sturmschwalbe (Hydrobates pelagicus), deren weltgrößte Brutkolonien an den Klippen nisten, oder die Rosaseeschwalbe (Sterna dougallii) und der Alpenkrähe (Pyrrhocorax pyrrhocorax), die in Küstenregionen brüten. Der Wachtelkönig (Crex crex) ist ein Symbol für Wiesenlandschaften, doch sein Bestand schrumpft durch intensive Bewirtschaftung. Vier Unterarten sind endemisch: die Irische Kohlmeise (Periparus ater hibernicus), der Irische Wasseramsel (Cinclus cinclus hibernicus), der Irische Eichelhäher (Garrulus glandarius hibernicus) und der Rotgrouse (Lagopus lagopus hibernicus). Im Vergleich zu Großbritannien fehlen Arten wie der Waldkauz (Strix aluco) oder Spechte, abgesehen vom kürzlich etablierten Buntspecht (Dendrocopos major). Rückgang zeigen Greifvögel wie der Turmfalke (Falco tinnunculus) und Singvögel wie der Heidelerche (Alauda arvensis) durch Pestizide und Klimawandel. Die Meeresvögel dominieren an Orten wie den Saltee-Inseln oder Skellig Michael, wo Tausende von Basstölpeln und Lummen (Uria aalge) brüten. Wintergäste wie die Grönland-Blanegans (Anser albifrons flavirostris) sammeln sich in Wexford Harbour, während Reintroduktionen des Goldadlers (Aquila chrysaetos) und Rotmilans (Milvus milvus) Erfolge feiern. Insgesamt melden Berichte einen Verlust von 40 Prozent der Wasservögel in den letzten Jahrzehnten, mit dramatischen Rückgängen beim Kiebitz (Vanellus vanellus) und dem Brachvogel (Numenius arquata).
Reptilien sind auf Irland rar, mit nur 16 Arten insgesamt. Die einzige einheimische Landreptilienart ist die Vivipare Eidechse (Zootoca vivipara), die in moorigem Gelände der Wicklow Mountains und ähnlicher Habitate vorkommt und lebendgebärend ist. Die Blindschleiche (Anguis fragilis) wurde in den 1970er Jahren in The Burren eingeführt und hat sich dort etabliert, ohne jedoch als einheimisch zu gelten. Schlangen fehlen vollständig, da die Landbrücke nach der Eiszeit verschwand, bevor Schlangen aus dem Süden einwandern konnten. Fünf Meeres-Schildkrötenarten streifen regelmäßig die Westküste: die Lederschildkröte (Dermochelys coriacea), die Grüne Meeresschildkröte (Chelonia mydas), die Echte Karettschildkröte (Eretmochelys imbricata), die Suppenschildkröte (Caretta caretta) und die Kemp-Schildkröte (Lepidochelys kempii). Diese Giganten, darunter die bis zu 900 Kilogramm schwere Lederschildkröte, nutzen die kalten Strömungen als Futtergründe, stranden aber selten.
Die Amphibienfauna umfasst lediglich vier Arten, was die Isolation unterstreicht. Der Gemeine Grasfrosch (Rana temporaria) ist häufig in Teichen und Gärten anzutreffen, obwohl seine Einwanderung möglicherweise erst im 18. Jahrhundert durch den Menschen erfolgte. Die Furchenmolch (Lissotriton vulgaris) ist eindeutig einheimisch und bevölkert stehende Gewässer. Der Natterjacktoad (Epidalea calamita) ist auf wenige Moore in Kerry und West-Cork beschränkt; diese seltene Art, die nach der Eiszeit einwanderte, ist durch Drainage bedroht und wird intensiv geschützt. Der Laubfrosch fehlt, und die Artenvielfalt bleibt damit minimal, doch jede Art spielt eine Schlüsselrolle in aquatischen Ökosystemen.
Fische bereichern die irische Tierwelt mit 375 Küstenarten und 40 Süßwasserarten, die die vielfältigen Gewässer von Flüssen bis zum Atlantik nutzen. Der Atlantische Lachs (Salmo salar) ist ikonisch und wandert Tausende Kilometer, um in irischen Bächen zu laichen. Pelagische Arten wie der Gemeine Drachenfisch (Callionymus lyra), der Riesenhai (Cetorhinus maximus) – der größte Fisch der Welt und häufig vor der Westküste gesichtet – und der Ozeansonnfisch (Mola mola) zeichnen die Meeresfauna aus. Der Kabeljau (Conger conger), der Schleimaal (Myxine glutinosa), der Schleifzenfisch (Capros aper) und der Kaninchenfisch (Beryx decadactylus) bevölkern Tiefen bis hin zur Porcupine-Abyssalebene. Drei Neunaugenarten (Hyperoartia), zwei Schleimaale (Myxini), 64 Knorpelfische (Chondrichthyes) und 363 Knochenfische (Actinopterygii) diversifizieren das Spektrum. Seltene Sichtungen des Riesenkalmars (Architeuthis dux) unterstreichen die Tiefseevielfalt. In der Keltischen See dominieren der Drachenfisch und der Einsiedlerkrebs Pagurus prideaux. Aquatische Säugetiere wie der Große Tümmler (Tursiops truncatus), der Killerwal (Orcinus orca) und der Große Tümmler (Phocoena phocoena) ergänzen mit 24 Wal- und fünf Schildkrötenarten die marine Palette; der Walross (Odobenus rosmarus) ist eine absolute Rarität.
Die Wirbellosen stellen die größte Artenvielfalt dar und bilden die unsichtbare Basis der Nahrungsketten. Mit 290 Schwammarten (Porifera), 302 Nesseltiere (Cnidaria) wie Seeanemonen und Quallen, 192 Stachelhäuter (Echinodermata) einschließlich Seesterne und Seeigel sowie 1.774 Krebstiere (Crustacea) ist die marine Invertebratenfauna reichhaltig. An Land und in Süßwasser umfassen Arachniden 860 Arten (einschließlich 378 Spinnen), Myriapoden 59 Arten, Insekten 7.162 Arten – darunter Käfer, Schmetterlinge wie der Moorland-Wiesenvogel (Euphydryas aurinia) und Libellen – sowie 1.088 Weichtierarten (Mollusca), zu denen die Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera), die Kerry-Schnecke (Geomalacus maculosus) und die Pyrenäen-Schnecke (Semilimax pyrenaicus) zählen. Ringelwürmer (Annelida) mit 321 Arten, Moostierchen (Bryozoa) mit 100 Arten und Seesquirtarten (Ascidiacea) runden ab. Bemerkenswert ist die Tauchglockenspinne (Argyroneta aquatica), die unter Wasser jagt, oder der Flusskrebs (Austropotamobius pallipes). In Gezeitentümpeln offenbart sich die Vielfalt der Küsteninvertebraten, die durch kühle Temperaturen begünstigt wird und ein Paradies für Taucher darstellt.

Pflanzen-und Tierarten:
Flora
- Pflanzen inbsgesamtm 3.815
- davon Blütenpflanzen 574
Fauna
- Vögel 444
- Säugetiere 79
- Reptilien 16
- Amfibien 4
Naturschutz
Das rapide Wirtschaftswachstum Irlands in den vergangenen Jahren hat zu einer erheblichen Mehrbelastung der natürlichen und naturnahen Umwelt geführt. Gleichzeitig ist durch die starke Zunahme höherer Bildung und Urbanisierung das Bewusstsein um die Gefährdung der Umwelt, verbunden mit der Forderung nach ihrer Schonung bzw. Erhaltung, gewachsen. Dieses Ziel wird von dem für Irland bedeutenden Fremdenverkehrsgewerbe, namentlich von seinen halbstaatlichen Organisationen, vom Umweltministerium und von allen zuständigen wissenschaftlichen Disziplinen vertreten, da der Wirtschaftszweig Tourismus durch weitere Umweltverschlechterung gefährdet wäre.
Die heutige Hochleistungslandwirtschaft ist ein weiterer Bereich, der den höchsten Schaden an der Umwelt verursachen kann. Die Größe der landwirtschaftlichen Betriebe hat zugenommen und umweltschonende Bewirtschaftungsformen wurden abgeschafft. Der Einsatz von Herbiziden, Insektiziden und Kunstdünger ist erheblich angestiegen. Der Verbrauch von Stickstoff hat sich verzehnfacht, dies wiederum führt zur Eutrophierung von Flüssen und Seen. Zudem ist die Überweidung durch Schafe ein Problem.
Die erhebliche Zunahme urbaner Besiedlung, die vor allem in der Ausbreitung der Verdichtungsräume zum Ausdruck kommt, ebenso im Anwachsen vieler Mittel- und Kleinzentren, führt in Verbindung mit der Massenmotorisierung zu starker Umweltbelastung. Dies ist vor allem auch an den Küsten als beliebte Wohn- und Ferienorte sowie Industriestandorte spürbar. Ein Großteil der Gebiete, die nach verschiedenen Naturerbe-Bestimmungen (SAC = Special Area of Conservation; SPA = Special Protection Area; NHA = Natural Heritage Area) geschützt sind, liegen in der Küstenzone Irlands.
Vielerorts bestehen Landnutzungskonflikte mit der touristischen Entwicklung, Erholung, Landwirtschaft und Zweitwohnsitzentwicklung. Eine Studie aus dem Jahr 1992 zeigte auf, dass 37 % der ASI (der Vorgänger von SAC / SPA / NHA) in 4 Küstencounties zerstört wurden und 16 % unter direkter Bedrohung durch Tourismus und Erholung stehen.
In Irland hat von 1990 bis 2000 das Weide- und gemischte Farmland einen Verlust von 769 km² zugunsten des Gewinns an kulturfähigem Land (Zunahme Viehfutterproduktion undänliches) verzeichnet. Seit Jahrtausenden wird Torf in Irland als Brennstoff verwendet, der Abbau erfolgt heutzutage überwiegend industriell für Torfkraftwerke. Als Folge werden Moorlandschaften zu Ödland, die empfindlichen Feuchtbiotope geraten aus dem Gleichgewicht. Die Torfmooraufforstung in Irland hat den Feuchtgebietverlust für Europa 1990 bis 2000 maßgeblich beeinflusst; im Jahr 2000 waren 21 % der irischen Küste Feuchtgebiete. Die Küstenwälder waren um 30 % gewachsen.
Eine Studie aus dem Jahr 2008 belegt die fatale Situation der irischen Flora und Fauna: die Flussperlmuschel hat wegen der hohen Verschmutzung der Flüsse kein Bock mehr auf Sex. Hase, Otter, Kreutzkröte und Atlantischer Lachs sind auch kurz vor dem Exitus. Am schlimmsten betroffen sind Torfmoore, Dünen, Seen, Wiesen, sowie Eichen- und Eibenwälder. Von den Torfmooren der Midlands existieren vielleicht noch 1 %. Von den 59 untersuchten Habitate (charakteristischer Wohn- oder Standort, den eine Art besiedelt) sind nur 7 % gesund, mit positiven Aussichten, 46 % sind unzureichend und der Rest in schlechtem Zustand mit noch schlechteren Aussichten. Von den 69 Untersuchten Tier- und Pflanzearten waren 39 % noch in Ordnung, 33 % in schlechter oder noch schlechterer Verfassung und ebenso schlechten Aussichten. Der letzte Teil konnte wegen mangelden Daten nicht untersucht werden.
Die Nationalparks Irlands sind:
| Name | Gründung | Größe (ha) | Lokalisierung |
| Ballycroy-Nationalpark | 1998 | 11.837 | County: Mayo |
| Connemara-Nationalpark | 1980 | 2.957 | County: Galway |
| Glenveagh-Nationalpark | 1984 | 16.548 | County: Donegal |
| Killarney-Nationalpark | 1932 | 10.289 | County: Kerry, seit 1981 UNESCO Biosphärenreservat |
| Burren-Nationalpark | 1991 | 1.673 | County: Clare |
| Wicklow-Mountains-Nationalpark | 1991 | 15.913 | County: Wicklow, 1988 als Naturparks Glendalough Woods und Glenealo Valley errichtet |
| insgesamt | 59.217 |
Irland hat insgesamt 604 Natura 2000-Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von etwa 19.481 km² bzw. 7.522 mi². Diese Schutzgebiete umfassen sowohl terrestrische als auch marine Flächen und bestehen aus verschiedenen FFH-Gebieten (Fauna-Flora-Habitat) und EU-Vogelschutzgebieten. Die Schutzgebiete erstrecken sich über die Republik Irland und Nordirland zusammen und umfassen rund 13% der Landesfläche Irlands. Die Fläche der Natura 2000-Gebiete setzt sich in etwa zusammen aus 9.230 km² bzw. 3.564 mi² Landfläche und 10.258 km² bzw. 3.961 mi² Meeresfläche.
Klima
Das Klima Irlands ist gemäßigt, obwohl es aufgrund des nordatlantischen Stromes wesentlich wärmer ist als in anderen Regionen des gleichen Breitengrades. Nach der Köppen-Klassifikation gehört die Insel einheitlich zur Klasse Cfb, also zum warmgemäßigten, immerfeuchten Klima mit warmen Sommern und ganzjährigen Niederschlägen. Die vorherrschenden Winde wehen meist von Südwesten nach Nordosten. Diese Atlantikwinde bescheren dem Westen besonders wechselhaftes Wetter, wobei es im Südwesten insgesamt milder ist als im Nordwesten. Dennoch zieht das Wetter vom Atlantik her häufig schnell über die Insel. Deshalb sind lang anhaltende Regenfälle an der Küste eher selten. In Staulagen im Landesinneren sieht es dagegen anders aus. Jahresniederschläge von rund 3000 mm sprechen für sich. Der Osten wiederum präsentiert sich vergleichsweise trockener mit durchschnittlichen Jahresniederschlägen von nur 1000 mm. Dennoch gilt einheitlich für die ganze Insel: nasskalte Winter mit Niederschlägen, die auch hin und wieder als Schnee fallen. Dies ist allerdings eher im Osten und in den Gebirgen zu erwarten. Regen ist besonders charakteristisch für das westirische Klima, auf Valentia Island an der Westküste fällt jährlich zweimal so viel Regen wie in Dublin (1400 mm gegenüber 762 mm). Etwa 60 % der jährlichen Regenmenge fallen zwischen August und Januar.
Mit durchschnittlich fünf bis sieben Stunden Sonnenschein sind Mai und Juni die sonnigsten Monate. Januar und Februar sind mit einer Durchschnittstemperatur von 4 bis 7°C die beiden kältesten, Juli und August sind mit 14 bis 16°C die beiden wärmsten Monate des Jahres. Die durchschnittlichen Jahrestemperaturen fallen je nach Region leicht unterschiedlich aus. Im Süden ist es am mildesten. Während im Januar auf der Insel Valentia im Südwesten die Temperatur bei durchschnittlich fast sieben Grad liegt, sind es im Osten in Dublin nur fünf. Dagegen erreichen die Durchschnittstemperaturen im Südwesten und Osten im Juli 15°C, während es im Norden bei rund 13°C kühler bleibt.
Obwohl Extremwetterlagen, verglichen mit dem europäischen Festland, relativ selten sind, treten sie doch auf. Atlantische Tiefdruckgebiete führen im Dezember, Januar und Februar immer wieder zu Stürmen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h. Während der Sommermonate kommt es, speziell im Juli und August, zu plötzlich auftretenden Gewitterstürmen, vor allem, aber nicht ausschließlich, im Inland und im westlichen Irland.
Klimadaten für Dublin Airport (1981 bis 2010, Extreme seit 1881)
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
| Höchstrekord (°C) | 17,5 | 18,1 | 23,4 | 22,7 | 26,8 | 28,7 | 31,0 | 30,6 | 27,6 | 24,2 | 19,4 | 17,1 | 31,0 |
| Mittelmaximum (°C) | 8,1 | 8,3 | 10,2 | 12,1 | 14,8 | 17,6 | 19,5 | 19,2 | 17,0 | 13,6 | 10,3 | 8,3 | 13,3 |
| Mitteltemperatur (°C) | 5,3 | 5,3 | 6,8 | 8,3 | 10,9 | 13,6 | 15,6 | 15,3 | 13,4 | 10,5 | 7,4 | 5,6 | 9,8 |
| Mittelminimum (°C) | 2,4 | 2,3 | 3,4 | 4,6 | 6,9 | 9,6 | 11,7 | 11,5 | 9,8 | 7,3 | 4,5 | 2,8 | 6,4 |
| Tiefstrekord (°C) | −15,6 | −13,4 | −9,8 | −7,2 | −5,6 | −0,7 | 1,8 | 0,6 | −1,7 | −5,6 | −9,3 | −15,7 | −15,7 |
| Nederschlag (mm) | 62,6 | 48,8 | 52,7 | 54,1 | 59,5 | 66,7 | 56,2 | 73,3 | 59,5 | 79,0 | 72,9 | 72,7 | 758,0 |
| Niederschlagstage (≥ 1,0 mm) | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 129 |
| Schneetage | 4,6 | 4,2 | 2,8 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,9 | 16,6 |
| Potenzielle Verdunstung (mm) | 18 | 20 | 31 | 44 | 69 | 91 | 105 | 94 | 62 | 46 | 25 | 19 | 624 |
| Luftfeuchtigkeit (% um 15:00) | 80,6 | 75,7 | 71,0 | 68,3 | 68,0 | 68,3 | 69,0 | 69,3 | 71,5 | 75,1 | 80,3 | 83,1 | 73,3 |
| Sonnenstunden | 58,9 | 76,3 | 108,5 | 159,0 | 192,2 | 174,0 | 164,3 | 158,1 | 129,0 | 102,3 | 72,0 | 52,7 | 1447,3 |
| Tägliche Sonnenstunden | 1,9 | 2,7 | 3,5 | 5,3 | 6,2 | 5,8 | 5,3 | 5,1 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 1,7 | 3,9 |
| Ultraviolettindex | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Meerestemperatur (°C) | 9,6 | 8,8 | 8,4 | 9,1 | 10,4 | 12,3 | 14,1 | 14,9 | 14,8 | 14,1 | 13,1 | 11,3 | 11,7 |
Klimadaten für Belfast (63 m, 1981 bis 2010, Extreme seit 1958)
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
| Höchstrekord (°C) | 14,0 | 15,6 | 20,2 | 21,8 | 25,0 | 29,5 | 28,8 | 28,0 | 25,6 | 21,8 | 16,4 | 15,0 | 29,5 |
| Mittelmaximum (°C) | 7,1 | 7,5 | 9,5 | 11,9 | 15,0 | 17,4 | 19,0 | 18,6 | 16,4 | 12,9 | 9,5 | 7,4 | 12,7 |
| Mitteltemperatur (°C) | 4,4 | 4,6 | 6,2 | 8,1 | 10,9 | 13,6 | 15,4 | 15,0 | 13,0 | 9,9 | 6,8 | 4,8 | 9,4 |
| Mittelminimum (°C) | 1,7 | 1,6 | 2,9 | 4,3 | 6,8 | 9,7 | 11,7 | 11,4 | 9,5 | 6,9 | 4,0 | 2,1 | 6,1 |
| Tiefstrekord (°C) | −12,8 | −11,1 | −9,9 | −5,1 | −2,8 | −1,2 | 2,2 | 2,3 | −0,5 | −3,0 | −8,6 | −14,9 | −14,9 |
| Niederschlag (mm) | 80,3 | 57,7 | 67,0 | 58,0 | 57,3 | 61,5 | 71,4 | 83,8 | 75,6 | 89,6 | 79,7 | 79,3 | 861,2 |
| Niederschlagstage (≥ 1,0 mm) | 14,8 | 12,1 | 14,0 | 11,4 | 11,7 | 11,3 | 12,9 | 13,9 | 12,6 | 14,4 | 14,4 | 14,0 | 157,5 |
| Schneetage | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 89 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 91 | 90 | 89 | 91 |
| Sonnenstunden | 49,7 | 71,2 | 102,5 | 153,3 | 197,7 | 167,9 | 151,3 | 142,1 | 119,9 | 91,2 | 59,4 | 46,2 | 1352,5 |
Klimadaten für Limerick / Shannon Sairport (1981 bis 2010)
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
| Höchstrekord (°C) | 14,8 | 15,5 | 20,2 | 23,5 | 28,0 | 32,1 | 30,6 | 29,8 | 26,1 | 22,3 | 18,2 | 15,3 | 31,6 |
| Mittelmaximum (°C) | 8,8 | 9,2 | 11,1 | 13,3 | 16,0 | 18,5 | 19,8 | 19,6 | 17,7 | 14,3 | 11,1 | 9,0 | 14,0 |
| Mitteltemperatur (°C) | 6,0 | 6,2 | 7,8 | 9,5 | 12,1 | 14,6 | 16,4 | 16,2 | 14,2 | 11,2 | 8,3 | 6,3 | 10,7 |
| Mittelminimum (°C) | 3,2 | 3,2 | 4,5 | 5,7 | 8,2 | 11,0 | 13,0 | 12,7 | 10,8 | 8,2 | 5,5 | 3,6 | 7,4 |
| Tiefstrekord (°C) | −11,2 | −9,8 | −7,8 | −4,1 | −0,9 | 1,5 | 6,0 | 2,9 | 1,3 | −2,0 | −6,6 | −11,4 | −11,4 |
| Niederschlag (mm) | 102,3 | 76,2 | 78,7 | 59,2 | 64,8 | 69,8 | 65,9 | 82,0 | 75,6 | 104,9 | 94,1 | 104,0 | 977,5 |
| Niederschlagstage (≥ 0.2 mm) | 20 | 16 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 214 |
| Schneetage | 3,4 | 3,2 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 11 |
| Potenzielle Verdunstung (mm) | 16 | 19 | 34 | 48 | 72 | 94 | 103 | 94 | 70 | 47 | 27 | 19 | 642 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 88 | 87 | 85 | 81 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 88 | 88 | 89 | 84 |
| Mittlerer Taupunkt (°C) | 4
(39) |
4
(39) |
5
(41) |
5
(41) |
8
(46) |
10
(50) |
12
(54) |
12
(54) |
11
(52) |
9
(48) |
6
(43) |
5
(41) |
8
(46) |
| Sonnenstunden | 49,6 | 65,6 | 100,0 | 153,1 | 180,0 | 156,0 | 140,5 | 140,1 | 117,0 | 89,9 | 60,0 | 43,4 | 1295,2 |
| Tägliche Sonnenstunden | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 5,1 | 5,8 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 2,9 | 2,0 | 1,4 | 3,5 |
Mythologie
Die mytholischen Überlieferungen wurden im frühen Mittelalter von christlichen Mönchen niedergeschrieben, die sie teilweise christianisierten und mit historischen Elementen vermischten. Sie stellen den am besten erhaltenen Zweig der keltischen Mythologie dar und beschreiben die Ursprünge der irischen Völker, Götter, Helden und übernatürliche Wesen. Die Mythen sind in vier Hauptzyklen organisiert: den Mythologischen Zyklus, den Ulster-Zyklus, den Fenian-Zyklus und den Königszyklus (auch Historischer Zyklus genannt). Wichtige Quellen sind Manuskripte wie das Lebor na hUidre (Buch der Dunklen Kuh), das Book of Leinster und das Lebor Gabála Érenn (Buch der Eroberungen Irlands), die von Mönchen im 11. und 12. Jahrhundert kompiliert wurden. Diese Texte vermischen göttliche Elemente mit menschlichen Heldentaten und spiegeln eine Welt wider, in der das Übernatürliche eng mit der Natur und der Gesellschaft verknüpft ist.
Die Mythen des alten Irlands beginnen mit dem Buch der Eroberungen. Es wurde in seiner überlieferten Fassung von irischen Mönchen aufgeschrieben, die die keltische mit der christlichen Überlieferung zu verbinden suchten. Es beschreibt die Besiedlung Irlands und wurde bis ins 19. Jahrhundert nicht als Teil des irischen Sagenzyklus, sondern als Geschichtswerk angesehen. Von den verschiedenen Einwanderungswellen sind archäologisch drei zu belegen:
- die Erstbesiedlung durch Jäger, Fischer und Sammler, die mythologischen Fir Bolg
- die Besiedlung durch die ersten Bauern, die mythologischen Tuatha Dé Danann
- die Ankunft der Glockenbecherleute oder Proto-Kelten, die mythologischen Milesier
Der mythologischen Überlieferungen zufolge gab es jedoch mehrere Einwanderungswellen sagenhafter Völkerschaften in Irland. Zuerst traf kurz nach der Sintflut Cessair oder Banba als erste Siedlerin in Irland ein. Ihr Gatte Fintan, Sohn von Bochra oder die analoge Gestalt des Tuan, Sohn des Cairell, überliefert von diesem Zeitpunkt an in verschiedenen tierischen, göttlichen und menschlichen Inkarnationen von der Geschichte der Welt. Nach der Sintflut erreichte der Vatermörder Partholan mit seinem Volk Irland, besiegte das dämonenhafte Volk der Formoren, legte die ersten Seen und Ebenen an und machte die ersten wichtigen Erfindungen.
Nach der Auslöschung der Partholaner durch eine Seuche traf Nemed mit seinem Volk ein und setzte die Gestaltung der Insel fort. Nach einem Aufstand jedoch wurden seine Nachkommen von den zurückgekehrten Formoren besiegt und die wenigen Überlebenden flohen wieder über das Meer. Generationen später kehrten zwei Völkerschaften nach Irland zurück und beanspruchten die Insel für sich, die göttlichen Tuatha de Danaan, Nachkommen Iarbonels, die auf Inseln im Norden der Welt magische Kräfte erlangt hatten, und die Stämme der Firbolgs bzw. der Fir Domnann und Galioin, die in Iberien ein Dasein als Sklaven gefristet hatten.
Die Tuatha de Danaan kämpften in zwei Schlachten auf der Ebene von Mag Tuired. In der ersten besiegten sie die Firbolgs und machten sie sich untertan, in der zweiten befreiten sie Irland von den Formoren und ihrem König Balor. Schließlich mussten die Tuatha de Danaan Irland an das Volk der Milesier abtreten, das von Halbgöttern, den Nachfahren des Beli Mawr und Vorfahren der Gälen angeführt wurde, und sich in das Reich der Toten im Inneren der Erde zurückziehen, auf Inseln weit jenseits des Horizonts, oder in magische Reiche unterhalb des Meeres. Von diesem Zeitpunkt an wurden sie von den Menschen als Götter verehrt.
Die Tuatha Dé Danann werden als unsterbliche Wesen dargestellt, die Fruchtbarkeit, Handwerk und Krieg beherrschen. Nach ihrer Niederlage gegen die Milesier (die Vorfahren der Iren) ziehen sie sich in die Unterwelt zurück, in die Síde (Feenhügel), und werden zu den Feen der späteren Folklore. Bekannte Geschichten aus diesem Zyklus sind „Die Kinder von Lir“, in denen die Kinder des Meeresgottes Lir von ihrer Stiefmutter Aoife in Schwäne verwandelt werden und 900 Jahre leiden müssen, sowie „Der Traum des Aengus“ oder „Die Brautwerbung um Étain“, die Themen wie Liebe, Verwandlung und die Anderwelt erkunden. Dieser Zyklus betont die göttliche Herkunft Irlands und den Übergang von einer magischen zu einer menschlichen Welt.
Der Ulster-Zyklus spielt um das 1. Jahrhundert und dreht sich um die Helden des Königreichs Ulster, insbesondere um König Conchobar mac Nessa und den Helden Cú Chulainn. Er ist geprägt von kriegerischen Heldentaten, in denen Ehre, Kampfkunst und Treue im Vordergrund stehen. Das zentrale Epos ist die Táin Bó Cúailnge (Der Raub der Rinder von Cooley), in der Königin Medb von Connacht Ulster angreift, um den berühmten Stier Donn Cúailnge zu erbeuten. Cú Chulainn, der Sohn des Gottes Lugh, verteidigt Ulster allein in blutigen Einzelkämpfen, da die anderen Krieger durch einen Fluch geschwächt sind.
Andere Geschichten umfassen „Die Verbannung der Söhne von Uisnech“ (die Tragödie der Deirdre, einer schönen Frau, deren Schönheit Krieg auslöst) und „Die Zerstörung von Da Dergas Hostel“. Cú Chulainn verkörpert den archetypischen Helden: übermenschlich stark, aber von einem tragischen Schicksal gezeichnet – er stirbt jung, nachdem er die Morrígan, eine Kriegsgöttin, beleidigt. Der Zyklus mischt Magie mit realistischen Kriegergesellschaften, in denen Reichtum in Vieh gemessen wird und Kämpfe oft um Viehraub gehen. Er repräsentiert Irlands „heroisches Zeitalter“ und zeigt Parallelen zu griechischen Epen wie der Ilias.
Der Fenian-Zyklus (auch Ossianischer Zyklus genannt) konzentriert sich auf Fionn mac Cumhaill (Finn MacCool) und seine Kriegerbande, die Fianna, im 3. Jahrhundert. Im Gegensatz zum Ulster-Zyklus ist dieser romantischer und abenteuerlicher, mit Fokus auf Jagd, Weisheit und der Wildnis. Fionn, der Anführer der Fianna, gewinnt übernatürliche Weisheit, indem er versehentlich den Lachs des Wissens kostet, den sein Lehrmeister Finnegas gefangen hat.
Wichtige Erzählungen sind „Die Verfolgung von Diarmuid und Gráinne“, in der Gráinne, die mit Fionn verlobt ist, mit dem Krieger Diarmuid flieht, und „Oisín in Tír na nÓg“, wo Fionns Sohn Oisín in die Anderwelt reist und bei seiner Rückkehr altert. Die Fianna leben als Nomaden, jagen im Sommer und schützen Irland vor äußeren Bedrohungen. Dieser Zyklus hat starke Verbindungen zu Schottland und betont Themen wie Jugend, Naturverbundenheit und die Grenze zwischen Mensch und Übernatürlichem. Er überbrückt paganische und christliche Zeiten, wie in „Acallam na Senórach“ (Das Gespräch der Alten), wo überlebende Fianna-Mitglieder mit St. Patrick sprechen.
Der Königszyklus verbindet Mythos mit Geschichte und erzählt von legendären Königen Irlands. Er dient der Legitimierung von Dynastien und umfasst Geschichten von mythischen Herrschern wie Labraid Loingsech bis zu realen Figuren wie Brian Boru. Eineer dieser Mythen ist „Buile Shuibhne“ („Der Wahnsinn des Königs Sweeney“), in dem König Suibhne durch einen Fluch zu einem halbmenschlichen, vogelartigen Wanderer wird.
Zahlreiche Überlieferungen drehen sich um Königtum als heilige Verbindung zwischen Herrscher und Land, oft symbolisiert durch eine Göttin der Souveränität. Der König ist an Geasa (Verbote) gebunden, deren Bruch Unheil bringt. Dieser Zyklus ist stärker christianisiert und dient der Genealogie, zeigt aber immer noch mythische Elemente wie Prophezeiungen und magische Kämpfe.
Die irische Mythologie ist bevölkert von Göttern, Helden und Kreaturen. Die Tuatha Dé Danann umfassen Götter wie den Dagda (Gott des Lebens und Todes, Meister aller Künste), Lugh (Sonnengott und Krieger), Brigid (Göttin der Heilung, Poesie und Schmiedekunst) und die Morrígan (Kriegsgöttin und Gestaltwandlerin). Die Fomorianer, wie Balor, sind ihre Antagonisten und symbolisieren Chaos.
Helden wie Cú Chulainn (der „Hund von Ulster“, bekannt für seine Kampfwut) und Fionn mac Cumhaill (Weiser Anführer der Fianna) verkörpern Stärke und Schicksal. Frauenfiguren wie Deirdre (deren Schönheit Tragödien auslöst) oder Medb (kriegerische Königin) sind mächtig und unabhängig. Kreaturen umfassen die Banshee (Todesbotin), den Púca (Gestaltwandler) und Leprechauns (mischievolle Feen), die aus den Tuatha Dé Danann hervorgehen.
Tír na nÓg, irisch-gälisch für „Land der Jugend“ (manchmal auch als Tír na nÓige geschrieben), ist eines der zentralen Konzepte in der irischen Mythologie. Es ist die „Anderswelt“,ein Reich ewiger Jugend, Schönheit und Fülle, in dem die Zeit stillsteht und keine Krankheiten, Alterung oder Tod existieren. In der keltischen Kosmologie gehört Tír na nÓg zu den Síde-Welten – den unterirdischen oder verborgenen Reichen, die von den Tuatha Dé Danann bewohnt werden, dem gottähnlichen Volk, das nach seiner Niederlage gegen die Milesier (die Vorfahren der modernen Iren) in diese unsichtbaren Domänen zurückgezogen ist. Diese Anderwelt ist nicht nur ein Ort des Vergnügens, sondern symbolisiert auch die Grenze zwischen dem Menschlichen und dem Übernatürlichen, wo Magie, Verwandlung und Schicksal eine Rolle spielen.
Die Vorstellung von Tír na nÓg wurzelt in der vorchristlichen keltischen Tradition und wurde in mittelalterlichen Manuskripten wie dem „Acallam na Senórach“ („Das Gespräch der Alten“) aus dem Fenian-Zyklus festgehalten. Christliche Schreiber interpretierten es oft als heidnisches Paradies, das mit dem biblischen Eden oder dem christlichen Himmel kontrastiert wurde. Es ist eng verknüpft mit anderen irischen Anderwelten wie Mag Mell (Ebene der Freuden) oder Tír Tairngire (Land der Verheißung), unterscheidet sich aber durch seinen Fokus auf Jugend und Unsterblichkeit. Zugänge zu Tír na nÓg finden sich in der Folklore durch Feenhügel (Síde), Seen, Nebel oder das Meer, oft nur für Auserwählte oder durch Einladung einer Fee.
Tír na nÓg wird in den Mythen als ein Ort unermesslicher Schönheit und Überflusses beschrieben: Goldene Ebenen, kristallklare Flüsse mit heilendem Wasser, Bäume, die das ganze Jahr Früchte tragen, und Paläste aus Edelsteinen. Die Bewohner – Feen, Götter und unsterbliche Wesen – altern nicht, leiden nicht unter Hunger oder Schmerz und verbringen ihre Zeit mit Festen, Musik, Jagd und Liebesabenteuern. Die Luft ist erfüllt von magischen Melodien, und die Natur ist in perfekter Harmonie. Im Gegensatz zur sterblichen Welt Irlands, wo Kriege und Leid herrschen, herrscht hier ewiger Frieden und Freude.
Ein wiederkehrendes Motiv ist die Zeitdilatation: Was in Tír na nÓg wie Tage oder Jahre wirkt, entspricht in der realen Welt Jahrhunderten. Dies unterstreicht die Gefahr für Sterbliche, die dorthin gelangen – eine Rückkehr bedeutet oft den sofortigen Verfall durch die aufholende Zeit. Tír na nÓg ist auch ein Ort der Verwandlung: Besucher können magische Gaben erhalten, wie Weisheit oder Stärke, aber oft zu einem hohen Preis, wie dem Verlust der Heimat oder dem Wahnsinn. In der Mythologie symbolisiert es die keltische Sehnsucht nach Unsterblichkeit und die keltische Dualität von Leben und Tod, wo die Anderwelt nicht fern, sondern parallel zur sichtbaren Welt existiert.
Die berühmteste Geschichte über Tír na nÓg stammt aus dem Fenian-Zyklus und dreht sich um Oisín, den Sohn des Helden Fionn mac Cumhaill und Anführers der Fianna. In der Erzählung „Die Verfolgung von Oisín“ oder „Oisín in Tír na nÓg“ erscheint Niamh Chinn Óir (Niamh mit dem Goldenen Haar), eine Prinzessin aus Tír na nÓg und Tochter des Meeresgottes Manannán mac Lir, auf einem weißen, verzauberten Pferd in Irland. Sie ist von Oisíns Ruhm als Dichter und Krieger fasziniert und lädt ihn ein, mit ihr in ihr Land zu reiten. Verliebt folgt Oisín ihr über das Meer, wo sie durch Wellen reiten, die sich wie Berge auftürmen, und vorbei an monströsen Meereswesen.
In Tír na nÓg lebt Oisín in Luxus: Er heiratet Niamh, zeugt Kinder und genießt ewige Jugend. Nach dem, was ihm wie drei Jahre vorkommt (in Wirklichkeit 300 Jahre), sehnt er sich nach seiner Heimat und den Fianna. Niamh warnt ihn, warnt ihn, den Boden Irlands nicht zu berühren, und gibt ihm ihr Pferd. Bei der Rückkehr findet Oisín ein verändertes Irland: Die Fianna sind Legende, das Christentum hat sich durchgesetzt (symbolisiert durch St. Patrick). Beim Versuch, einem Mann zu helfen, fällt er vom Pferd, berührt den Boden und altert sofort zu einem greisen Mann. In manchen Versionen trifft er St. Patrick, dem er seine Geschichten erzählt, bevor er stirbt. Diese Sage, populär in der romantischen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts (zum Beispiel durch James Macpherson oder W.B. Yeats), betont Themen wie Nostalgie, die Vergänglichkeit des Ruhms und den Konflikt zwischen paganer und christlicher Welt.
Tír na nÓg taucht in anderen Mythen auf, zum Beispiel in Varianten, wo Bran mac Febail, ein König aus dem Mythologischen Zyklus, dorthin reist und ähnliche Zeitphänomene erlebt. Oder in „Die Reise von Máel Dúin“, wo Seefahrer verschiedene Inseln der Anderwelt besuchen, darunter solche mit Ähnlichkeiten zu Tír na nÓg. Frauenfiguren wie Niamh oder andere Feenköniginnen locken oft Helden dorthin, was auf matriarchale Elemente in der keltischen Mythologie hinweist – die Souveränität des Landes wird durch weibliche Göttinnen verkörpert.
In der Folklore verbindet sich Tír na nÓg mit realen Orten wie den Feenhügeln von Newgrange oder dem Lough Derg. Moderne Interpretationen sehen es als Metapher für das Unbewusste oder das Paradies verloren durch Zivilisation. Es gibt Parallelen zu anderen Kulturen: Dem griechischen Elysium, dem walisischen Annwn oder dem nordischen Valhalla.
Tír na nÓg verkörpert die irische Faszination für die Anderwelt als Spiegel der Seele und der Natur. Es warnt vor der Verlockung des Übernatürlichen – Schönheit birgt Gefahr – und feiert die Poesie und Musik als Brücken dorthin (Oisín ist Dichter). In der modernen irischen Kultur lebt es in Literatur (zum Beispiel Yeats' „The Wanderings of Oisin“), Musik (Folk-Songs) und Tourismus fort, wo Orte als „Eingänge“ vermarktet werden. Es symbolisiert Irlands mythisches Erbe: Ein Land, wo das Magische nie ganz erloschen ist, und erinnert an die keltische Weltanschauung, in der Tod nur eine Tür zu neuem Leben ist. Bis heute beeinflusst es den Glauben an Feen und respektiert man heilige Stätten, um nicht den Zorn der Síde zu wecken.
Weitere Themen sind die Verwandlung, Krieg und die Suche nach Weisheit. Die Mythen erkunden die Balance zwischen Mensch und Natur, Souveränität als Bund mit dem Land und den Übergang vom Paganismus zum Christentum. Sie beeinflussen moderne Literatur (speziell William Butler Yeats) und Folklore, wo Respekt vor Feenhügeln erhalten bleibt. Die irische Mythologie lehrt von der Vergänglichkeit des Ruhms und der Macht der Erzählung, die Kulturen verbindet.
Geschichte
Die Geschichte Irlands ist von wechselvollen Ereignissen, Eroberungen und dem langen Streben nach Unabhängigkeit geprägt. Schon in der Steinzeit war die Insel besiedelt, und etwa ab -500 ließen sich keltische Stämme nieder, die ihre Sprache, Kultur und Religion mitbrachten – die Grundlage der späteren irischen Identität. Im 5. Jahrhundert begann mit der Christianisierung durch den heiligen Patrick eine neue Epoche, in der Irland zu einem wichtigen Zentrum des Glaubens und der Gelehrsamkeit wurde. Im Mittelalter entstanden zahlreiche Klöster, die Bildung und Kultur bewahrten, während große Teile Europas im Chaos versanken.
Ab dem 12. Jahrhundert begann die normannische Eroberung, die Irland zunehmend unter englischen Einfluss brachte und es schließlich zur ersten Kolonie des British Empire machte. In den folgenden Jahrhunderten kam es immer wieder zu Aufständen der irischen Bevölkerung gegen die englische Herrschaft. Die Einführung des Protestantismus im 16. Jahrhundert führte zu tiefen religiösen und politischen Spannungen zwischen der katholischen Mehrheit der Iren und den protestantischen Siedlern, die von England unterstützt wurden.
Im 17. und 18. Jahrhundert verstärkte sich die englische Kontrolle, und viele Iren verloren ihr Land. Der Widerstand gegen die britische Herrschaft blieb jedoch stark und erreichte im 19. Jahrhundert einen Höhepunkt, besonders während der Großen Hungersnot (1845 bis 1852), bei der über eine Million Menschen starben und viele andere auswanderten, vor allem in die USA.
Der Kampf um Unabhängigkeit führte Anfang des 20. Jahrhunderts zum Osteraufstand von 1916 und schließlich zum Irischen Unabhängigkeitskrieg (1919 bis 1921). 1921 wurde Irland geteilt: Der Süden wurde zum Irischen Freistaat (später Republik Irland), während der Norden (Nordirland) Teil des Vereinigten Königreichs blieb.
Im 20. Jahrhundert entwickelte sich die Republik Irland zu einem eigenständigen, modernen Staat, während Nordirland lange Zeit von Konflikten zwischen Katholiken und Protestanten geprägt war – dem sogenannten Nordirlandkonflikt („The Troubles“), der erst mit dem Karfreitagsabkommen von 1998 weitgehend beendet wurde. Heute ist Irland ein demokratisches, wirtschaftlich starkes Land mit einer lebendigen Kultur und einem wachsenden internationalen Einfluss.
Paläolithikum
Während der Hochphase der letzten Eiszeit im Pleistozän (zirka -16.000) war die irische Insel nahezu von Gletschern bedeckt. 300 Meter dicke Eisschichten formten die Landschaft, zerstörten Felsen und sämtliche Zeugnisse früherer menschlicher Besiedlung. Ähnliches passierte auf der Britischen Inseln, wo man aber im (eisfreien) Süden noch Zeugnisse zwischeneiszeitlicher Besiedlung fand. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass zu dieser Zeit auch auf der irischen Insel Menschen lebten, kann man die Möglichkeit nicht ausschließen.Am Ende der letzten Eiszeit war Nordirland bei einem um 100 m niedrigeren Meeresspiegel über die Landbrücke von Kintyre mit Schottland und, da die Britischen Inseln noch an das europäische Festland angebunden waren, auch mit dem Kontinent enger verbunden. Mit der Erwärmung begannen Eiche, Ulme und Esche die Kiefernwälder und die zuvor arktische Flora und Fauna zu ersetzen. Der Riesenhirsch (Megaloceros giganteus) mit einer Geweihauslage von 3,6 m konnte dadurch auch in Irland nicht überleben. Die Vorgeschichte Irlands beginnt zirka -7500, im Mesolithikum, mit der Besiedlung durch kontinentaleuropäische Jäger, Fischer und Sammler.
Mesolithikum
Am Ende der letzten Eiszeit war das heutige Nordirland bei einem um etwa 100 m niedrigen Meeresspiegel über die Landbrücke von Kintyre mit Schottland und, da die Britischen Inseln noch an das europäische Festland angebunden waren, auch mit dem Kontinent verbunden. Mit der Erwärmung begannen Eiche, Ulme und Esche, die Kiefernwälder und die arktische Flora zu ersetzen. Der Riesenhirsch (Megaloceros giganteus) mit einer Geweihauslage von bis zu 3,60 m fand in Irland ein jähes Ende. Trotz der Landbrücke nimmt man an, dass die Erstbesiedlung der Insel mit Booten erfolgte, da sich die meisten mesolithischen Siedlungsfunde in Küstengegenden befinden.
Das früheste Zeugnis menschlicher Besiedlung nach dem Rückzug des Eises stammt aus der Zeit zwischen -8000 und -7000. Die Siedlungen mesolithischer Jäger und Sammler finden sich an diversen Stellen zum Beispiel:
- am Mount Sandel (County Derry)
- Woodpark (County Sligo)
- an der Mündung des Shannon (County Clare)
- Lough Boora (County Offaly)
- Curran (County Antrim)
- und an diversen Stellen in der Provinz Munster
Das frühe Mesolithikum weist geometrische Mikrolithen auf (um -7000 am Mount Sandel). Dieser älteste Wohnplatz Irlands wurde 1972 am Fluss Bann entdeckt. Verkohlte Haselnussschalen ermöglichten seine Datierung. Die ovalen Hütten waren vermutlich mit Rinde gedeckt. Die Bewohner fingen Lachse und Aale, sammelten Nüsse, Früchte, Beeren und jagten Wild. Das späte Mesolithikum zeigt eine mikrolithenlose Industrie aus großen Abschlägen (Larnian), die vor allem im Nordosten verbreitet ist. Kern- und Scheibenbeile dienten wohl der Holzbearbeitung, auch erste geschliffene Beile aus Felsgestein tauchen auf (Ferriter’s Grove). Während des Mesolithikums betrug die Bevölkerung der Insel vermutlich weniger als 10.000 Menschen.
Neolithikum
Mit Eintreffen der Ackerbauern in Irland (zirka -4500) kam Nutzvieh und Getreide nach Irland, was zu einem signifikanten Bevölkerungswachstum führt. Während des Neolithikums wurde zum ersten Mal Ackerbau betrieben. Die Töpferei kam auf und man verwendete vermehrt geschliffene Steinwerkzeuge, gleichzeitig beginnt die Hochmoorphase. In den Céide Fields (County Mayo) wurde unter einer Schicht Torf ein gut konserviertes weitläufiges Feldersystem aus dem Neolithikum gefunden - bisher das älteste der Welt. Das Gelände besteht aus kleinen Feldern, die durch Steinwälle abgetrennt waren und vermutlich von -3500 bis -3000 bewirtschaftet wurden. Angebaut wurden überwiegend Weizen und Gerste.
Die Töpferwaren - ähnlich denen auf der Britischen Insel - wurden in Ulster (Lyle’s Hill Pottery) und in Limerick gefunden. Typisch für diese Kultur waren Gefäße mit rundem Boden und ausgeprägtem Bauchknick (carinated bowls).
Megalithische Monumente waren religiöse und zeremonielle Stätten. In den meisten wurden menschliche Überreste gefunden, zumeist eingeäschert. Auch Grabbeigaben - Töpferwaren, Pfeilspitzen, Schmuck, Beile undsoweiter - wurden gefunden. Diesen Anlagen, von denen mehr als 1.200 entdeckt wurden, können in große Gruppen unterteilt werden:
- Court tombs, charakterisiert durch eine Hof (Creevykeel): Man findet man diese Anlagen nahezu ausschließlich in der Nordhälfte der Insel.
- Passage tombs: Die zahlenmäßig kleinste Gruppe, aber wohl beeindruckendste in Bezug auf Größe findet man hauptsächlich im Norden und Osten der Insel. Zu dieser Gruppe gehören die Anlagen von Fourknocks, Knowth, Newgrange und Loughcrew (alle im County Meath), Carrowkeel, Carrowmore (beide County Sligo).
- Portal tombs: Zu dieser Art gehören die bekannten Dolmen (Legananny, Proleek), die hauptsächlich im Südosten und Norden des Landes gefunden wurden.
- Wedge tombs: Die zahlenmäßig größte der vier Gruppen ist hauptsächlich im Westen (County Clare) und Südwesten zu finden. Ihren Namen (wedge) verdanken sie ihrer Keilform. Sie datieren teilweise in die frühe Bronzezeit.
- Cists („Kisten) sind die letzte und bereits metallzeitliche Form der Steinbauten.
Die Theorie, dass die vier Monumentgruppen in Zusammenhang mit vier Wellen von Neubesiedlung stehen, hat noch einige Anhänger, konnte aber bisher nicht belegt werden. Im Neolithikum bevölkerten mehr als 300.000 Menschen die Insel. Gegen -2500 tauchen die ersten Glockenbecher auf. Nun begann auch die Metallbearbeitung.
Kupfer- und Bronzezeit
In der Bronzezeit erfolgte die Herstellung von Bronze, einer Mischung von Zinn und Kupfer. Bronze wurde für die Erstellung von Waffen und Werkzeugen verwendet. Schwerter, Äxte, Dolche, Beile, Trinkutensilien und hornförmige Trompeten sind nur einige der Gegenstände, die bei Ausgrabungen aus dieser Zeit gefunden wurden.
Das Kupfer zur Herstellung von Bronze wurde in Irland abgebaut, während das Zinn aus Cornwall importiert wurde. Die früheste Kupfermine befindet sich auf Ross Island in County Kerry - abgebaut und verarbeitet wurde hier von -2400 bis -1800. Neben dieser Mine ist auch die am Mount Gabriel in County Cork erwähnenswert. Man geht heute davon aus, dass die Minen in Cork und Kerry in der Bronzezeit bis zu 370 Tonnen Kupfer produzierten und Irland einer der Hauptexporteure dieser Zeit war.
Neben Kupfer findet sich in Irland auch Gold, das während der Bronzezeit erstmals verarbeitet wurde. In Irland wurden mehr Goldgeräte aus der Bronzezeit entdeckt als irgendwo anders in Europa. Goldschmuck aus Irland (Lunulae) fand sich sogar in Deutschland und Skandinavien. Zu Anfang der Bronzezeit bestanden die Ornamente aus einfachen halbmondförmigen oder runden dünnen Scheiben aus Gold. Erst später wurden goldene Ohrringe und Anhänger in verschiedensten Formen gefertigt.
Während der Bronzezeit wurden auch weiterhin - wenn auch kleinere - Wedge Tombs gebaut, die Passage tombs aber weitgehend sich selbst überlassen. Gegen Ende des Zeitalters wurden neben den so genannten Steinkisten auch diverse Steinkreise errichtet, die man hauptsächlich in Ulster und Munster findet. In dieser Zeit wurde das Klima rauher und große Waldflächen verschwanden. Gegen Ende der Bronzezeit dürften nicht mehr Menschen auf der irischen Insel gelebt haben als gegen Ende des Neolithikums.
Eisenzeit
Im -4. Jahrhundert erreichten neue kontinental-keltische Einflüsse Irland. Die Übernahme einer keltischen Sprache (des späteren Irischen) wird gewöhnlich in die Eisenzeit gelegt, sie ist jedoch nicht mit einem kulturellen Bruch verbunden.
Die keltische Sprache auf der britischen und der irischen Insel kann in zwei Gruppen unterteilt werden: P-keltische Sprachen (kam auf der britischen Insel vor) und Q-keltische Sprachen (kam auf der irischen Insel vor). Ehemals ging man daher davon aus, dass sich in Irland Q-Kelten und auf der britischen Insel P-Kelten niederließen, und auch heute liest man noch oft die Aussage, dass es eine keltische Invasion in der irischen Geschichte gab. Nach dieser Ansicht führte -350 eine Bevölkerungsgruppe mit dem Namen Milesians die irische Sprache in Irland ein und unterjochte die vorkeltischen Bewohner mittels ihrer überlegenen Waffen. Diese These ist aber sehr mystisch, denn die Wahrheit ist weitaus komplexer. Neuerliche DNA-Studien ergaben, dass das Volk, das die keltische Sprache auf die irische Insel brachte, durchaus keltisch gesprochen, aber nicht zwingend der keltischen Rasse angehört hat. Ethnisch waren sie nicht von prä-indoeuropäischen Einwohnern zu unterscheiden. Die Ankunft dieses Volkes hatte nahezu keinen genetischen Einfluss auf das Erbgut, so dass man heute davon ausgeht, dass die angebliche Invasion der Kelten aus nicht mehr als ein paar Tausend Menschen bestand. Auch aus archäologischer Sicht gibt es keine Zeugnisse für eine massenhafte Einwanderung keltisch-stämmiger Siedler in der fraglichen Zeit.
Die Y-Chromosomen der heutigen irischen Bevölkerung charakterisieren sich durch die Mutation des Markierungsgens M343, welches die Haploidengruppe R1b definiert - diese ist (in verschiedenen Graden) dominant von der Iberischen Halbinsel bis nach Skandinavien vertreten. Da diese Gruppe sehr ähnlich der im Baskenland ist, vermuten einige Anthropologen, dass die Basken ein Überbleibsel der so.g prä-indoeuropäischen Bevölkerung von Westeuropa ist und dass die prä-keltische Sprache (oder Sprachen) in Irland in gewisser Beziehung zur baskischen Sprache Euskara stehen - dies ist allerdings nicht bewiesen.
T. F. O’Rahilly schlug auf Basis seiner Studien über den Einfluss der irischen Sprache und der Analyse der irischen Mythologie und Pseudohistorie das nach ihm benannte historische Modell vor. Seine Ideen, obwohl extrem einflussreich, sind nicht generell akzeptiert. Nach O’Rahilly Modell gab es folgende vier Wellen von keltischen Invasoren:
- die Cruithne oder auch Priteni (zirka -700 bis -500)
- die Builg und Érainn (zirka -500)
- die Lagin, die Domnainn und die Gálioin (zirka -300)
- die Goidels oder Gael (zirka -100)
Die heute bekannten Schriften gehen zurück bis ins Jahr 431. Der gälische König von Tara, auch bekannt als Niall Noígiallach oder Niall of the Nine Hostages, ist die früheste historische Person, deren Existenz nicht angezweifelt wird und von der man mehr als nur vage Details kennt. Sein Vater, Eochu Mugmedón, war ebenfalls König von Tara und Herrscher über das Königreich, dessen Gebiet heute der Grafschaft Meath entspricht.
Niall folgte seinem Vater und es heißt, dass er 27 Jahre lang König gewesen sei. Seine Regentschaft begründete den Aufstieg von Tara als dominante Kraft in Irland. Der Ursprung dieser Macht lag in der Eroberung von Ulster - dem Endpunkt eines jahrhundertelangen Konflikts zwischen den Gael of Tara und den Ulaid of Emain Macha. Dieser Konflikt wird auch im mythologischen Ulster-Zyklus beschrieben, in dem auch das irische Nationalepos Táin Bó Cúailnge enthalten ist.
Die Eroberung von Ulster wurde von drei von Nialls Söhnen geleitet: Conall Gulban, Eógan und Énda. Jeder der Drei erhielt als Belohnung drei Unterkönigreiche (subkingdoms) im Westen des neu eroberten Gebietes. Als direktes Ergebnis der Eroberung wurde Ulster in drei Hauptkönigreiche (overkingdoms) eingeteilt:
Ulidia im Osten entspricht in etwa den heutigen Grafschaften Antrim und Down. Ulidia wurde von den Dál nAraide, einer ansässigen Dynastie, beherrscht, die sich mit Nialls Söhnen im Krieg verbündeten. Die Ulaid (oder Dál Fiatach), die über Jahrhunderte in dieser Gegend dominierend waren, wurden besiegt und der Hauptsitz in bei Emain Macha zerstört. Die restliche Bevölkerung der Ulaid wurde ostwärts vertrieben. Die Eroberung dieses Gebiets durch die Gaelen hatte auch einen wichtigen Einfluss auf die schottische Geschichte: Einer der Ernean-Stämme im Nordosten von Ulster, Dál Riata, wurde von Nialls Söhnen unterworfen und flüchtete daraufhin über den Seeweg auf die britische Insel, wo sie Argyll besiedelten und im Laufe der Zeit zur dominanten Macht im nördlichen Britannien wurden. Das Königreich Schottland wurde im 9. Jahrhundert durch die Union der Dál Riada und des ansässigen Königreichs der Pictavia gegründet.
Airgialla (auch Königreich von Oriel genannt) lag im Zentrum von Ulster und entspricht großteils den heutigen Grafschaften Derry, Tyrone, Fermanagh, Armagh, Monaghan und Louth. Dieses Königreich war eigentlich ein Zusammenschluss von 9 Unterkönigreichen, von denen jedes von einem ansässigen Herrscherhaus geführt wurde, die allerdings nur Vasallen gegenüber den Eroberern waren. Um deren Loyalität zu sichern, wurde die Herrscher gezwungen, ein hochrangiges Mitglied ihrer Familie als „Geisel“ nach Tara zu entsenden. Daher entstammt der Name Airgialla, was soviel wie Entsender von Geiseln bedeutet und ist der Ursprung von Nialls Beiname Noigiallach, oder Niall of the Nine Hostages.
Ailech (oder Aileach) im Westen entsprach der heutigen Grafschaft Donegal. Anfangs bestand es aus den drei Unterkönigreichen Tír Eógain, Tír Chonaill und Tír Énda, doch Tír Énda wurde später von Nachfahren von Conall erobert und in Tír Chonaill eingegliedert - auch wenn Nachfahren von Énda in dieser Gegend (sowie in den Midlands) noch einige kleine Gebiete kontrollierten. Die Macht der zwei verbleibenden Königreiche wuchs mit der Zeit an und deren Namen sind der Ursprung der heutigen Grafschaften Donegal und Tyrone. Ailech wurde ungefähr acht Jahrhunderte von den Nachfahren von Conall und Eógan beherrscht - beide zusammen sind als die nördlichen Uí Néill bekannt und brachten diverse irische Hochkönige hervor. Die Gefangenschaft (etwa im Jahr 425) von Ailech markiert das Ende der gälischen Eroberung von Ulster.
Nach dem Tod von Niall übernahm sein Sohn Lóegaire mac Néill die Herrschaft über Tara. Während dessen Herrschaft wurde das römische Christentum in Irland eingeführt. Niall of the Nine Hostages gilt als Urahn aller (bis auf zwei) Linien der irischen Hochkönige, die vom 5. Jahrhundert bis zur Zeit von Brian Bórú im 11. Jahrhundert regierten.
Frühchristliche Ära
Die mittleren Jahrhunderte des ersten Jahrtausends der heutigen Zeit brachten keine große Veränderungen in Irland. Auf politischer Ebene wurden die bisherigen Stammeszugehörigkeiten bis in die 700er Jahre durch patrilineare Herrscherdynastien (Sohn folgt dem Vater) ersetzt. Irische Piraten überfielen die westliche Küste der britischen Inseln in ähnlicher Art, wie es die Wikinger in späteren Jahren auf der irischen Insel tun sollten. Einige dieser Freibeuter gründeten Königreiche in Schottland, Wales und Cornwall.
Eventuell waren einige von diesen als reiche Männer heimgekehrt und brachten erstmalig den christlichen Glauben nach Irland - es gibt Quellen, die behaupten, dass bereits lange vor der Zeit von St. Patrick Missionare in Irland aktiv waren.
Bekannt ist, dass im Jahr 432 St. Patrick auf der irischen Insel landete und in den folgenden Jahren die dort lebenden Iren zum Christentum zu bekehren suchte. Andererseits schickte der Papst bereits im Jahr 431 den Bischof Palladius als ersten Bischof nach Irland, was darauf hindeutet, dass dort bereits Christen gelebt haben müssen. Während Palladius lediglich in den Königreichen von Meath und Leinster tätig wurde, christianisierte St. Patrick wohl eher in Ulster und Connacht.
St. Patrick wird hoch angerechnet, dass er die Stammes- und Sozialmuster der Iren erhalten hat, deren Gesetze festschrieb und nur die abänderte, die mit dem Christentum nicht vereinbar waren. Weiterhin führte St. Patrick wahrscheinlich das römische Alphabet in Irland ein, das es den irischen Mönchen erlaubte, Teile der vielfältigen irisch-keltischen Erzählungen aufzuschreiben. Am überaus wichtigen Einfluss von St. Patrick in Ulster kann man nicht zweifeln, es gilt aber als relativ sicher, dass es vor seiner Zeit Christen in Irland gab - und auch Heiden noch lange nach seiner Zeit.
Die Tradition der Druiden endete mit der lokalen Verbreitung des neuen Glaubens, eventuell im Kontext mit der Hungersnot sowie den Plagen im Anschluss an den Klimawandel von 535 bis 536. Irische Gelehrten in den neu entstandenen Klosteranlagen wurden sukzessiv zu Vorreitern lateinischer Studien und christlicher Theologie. Missionare aus Irland reisten nach England und Kontinentaleuropa, und Gelehrte aus diesen Gegenden reisten mit Ende der keltischen Kirche (ab 1111) in irische Klöster.
In Irland bestand bis zum 12. Jahrhundert eine eigenständige keltische Kirche. Geistiger Mittelpunkt des Landes war zwar Armagh in Ulster, aber die zahlreichen Klöster waren autonom. Die hohe Kunst in diesen isolierten Klöstern trug dazu bei, dass Latein durch das Mittelalter erhalten blieb. Die Kunst von Handschrift, Bebilderung, Metallarbeit und Bildhauerei brachten unter anderem Kunstwerke wie das Book of Kells hervor - eines der bedeutendsten Kunstwerke aus jener Zeit, das heute noch erhalten ist.
Frühmittelalter
Der Christianisierung im 4. und 5. Jahrhundert folgten die irische Klosterkultur, die kontinentale Missionierung und erste Hinweise auf das irische Königtum. Die folgenden drei Jahrhunderte gelten als die Blütezeit des frühchristlichen Irlands, in denen irische Bildung und Kultur in Europa als führend gelten. In Irland entstand eine durchaus eigenständige keltische Kirche, geistiger Mittelpunkt des Landes waren Armagh in Ulster sowie die zahlreichen Klöster.
Das Frühmittelalter (in Irland von 800 bis 1166) wird durch die Raubzüge der Wikinger, deren Ansiedlung und das Entstehen erster Städte geprägt. Irland war in viele kleine Königreiche unterteilt, die sog. tuaithe (Einzahl: tuath). An der Spitze stand der ri tuath, ein König, der entweder von einer Herrschergeschlecht oder von sliocht (das heißt allen freien Männern des tuath) gewählt wurde. Alle Männer mit Landbesitz, Berufstätige und Handwerker bildeten eine Versammlung (oenach). Das Land eines tuath gehörte nicht dem König, sondern allen freien Familien, die darauf lebten, die dem König dafür Abgaben leisteten und ihm im Kriegsfall kämpferisch zur Seite standen. Es gab 80 bis 100 tuatha (Clans), die gleichzeitig existierten.
Über den tuaithe standen die mächtigeren Provinzkönige (ri ruireach) wie zum Beispiel der Clan der Ui Neill in Tir Eoghan (Provinz Uladh; heute: Ulster). Dennoch, war die gälisch-irische Gesellschaft nicht egalitär - die höchste Klasse, die Könige, galten als nemed (heilig). Die Könige verrichteten keine manuellen Arbeiten, da dies unter ihrer Würde (enech) war. Aufgrund des Wahlsystems in Fragen der Nachfolge entstanden häufig Kämpfe unter den möglichen Nachfolgern. Neben den Königen galten auch die heidnischen Kleriker und Poeten als „heilig“. Unterhalb dieser Klassen standen die Landbesitzer und am unteren Ende des gesellschaftlichen Leiter waren die „Unfreien“, Arbeiter, die keine politischen Rechte hatten. Irland war, bevor die Wikinger auf die Insel kamen und vieles veränderten, nahezu komplett ländlich geprägt.
Die ersten belegten Wikinger-Überfälle fanden im Jahr 795 statt, als Wikinger von Norwegen die Insel Lambay (vor Dublins Küste) plünderten. Diese frühen Überfälle waren in der Regel schnell, lokal begrenzt und beendeten das Zeitalter der frühchristlich-irischen Kultur. Es folgten über 200 Jahre andauernde Wellen wikingischer Plünderungen, die besonders die Klöster überfielen. Die meisten der frühen „Räuber“ kamen aus den Fjorden im westlichen Norwegen und man vermutet, dass diese über die Shetlandinseln und die Orkney kamen. Von dort aus ging es zur Atlantikküste Schottlands und schließlich nach Irland. Während dieser frühen Raubzüge erreichten die Wikinger auch die irisches Westküste mit Inishmurray und den Skellig Islands.
Sowohl Irland als auch England und Schottland waren in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts von den Raubzügen der Wikinger betroffen. Nach und nach begannen die Wikinger Stützpunkte an der irischen Küste zu errichten. Dort verbrachten sie zunächst nur die Wintermonate. Darauf folgten skandinavische Siedlungen. Die ersten waren die heutigen Städte Waterford, Wexford und natürlich Dublin - die Funde bei Ausgrabungen nahe Kilmainham bewiesen die Anwesenheit der Skandinavier in dieser Zeit. Schriftliche Zeugnisse dieser Epoche zeigen, dass sie von ihren Küstensiedlungen (oft über die Flüsse) ins Landesinnere vorstießen, dort Raubzüge durchführten und sich wieder in die Küstensiedlungen zurückzogen.
Thorgest (lateinisch Turgesius) war der erste Nordmanne, der versuchte ein eigenes Königreich in Irland zu errichten. Er begab sich 839 über die Flüsse Shannon und Bann nach Armagh, wo er ein Gebiet eroberte, das Teile von Ulster, Connacht und Meath umfasste. 845 wurde Thorgest von Maelsechlainn I. (König von Mide) gefangen und im Lough Owen ertränkt. 848 besiegte Maelsechlainn - nun als Hochkönig eingestuft - eine nordische Armee bei Sciath Nechtain. Indem er behauptete, sein Kampf würde auch im Namen des Christentums gegen die Heiden geführt, bat er um Unterstützung des französischen Herrschers Karl des Kahlen - allerdings ohne Erfolg.
852 landeten die Nordmannen Ivar Beinlaus und Olaf der Weiße in Dublin und bauten die seit 841 bestehende Siedlung zu einer Festung auf dem Gebiet der heutigen Stadt aus. Olaf der Weiße war der Sohn eines norwegischen Königs und krönte sich zum König von Dublin. Dies gilt allgemein als Gründung von Dublin, auch wenn griechische und römische Schriften bereits im 1. Jahrhundert von einer Siedlung an gleicher Stelle namens Eblana (oder Deblana) berichten. Ivar wurde Nachfolger von Olaf, und nach dessen Tod entstand eine Unsicherheit im Königreich Dublin, die viele Wikinger dazu veranlasste, nach England oder Frankreich umzusiedeln. Neben Dublin gründeten die Wikinger auch andere Küstenorte, und mit der Zeit vermischte sich die irische und nordische Bevölkerung immer mehr und die sog. Gall-Gaels entstanden (Gall war das irische Wort für Fremde). Der nordische Einfluss findet sich in vielen irischen Königsnamen wieder, die auf nordische Namen zurückgehen, zum Beispiel Magnus, Lochlann oder Sitric. Auch DNA-Untersuchungen in den Küstenstädten belegen noch heute diese Vermischung.
914 begann eine neue Angriffswelle der Nordmannen - diesmal von der Südküste aus, wo sie in Waterford eine neue Siedlung gründeten. Von dort aus führte man Raubzüge in ganz Südirland aus. Auch von Dublin führten die Nachfahren von Ivar Beinlaus nun wieder Raubzüge aus und eroberten einen Großteil der Insel. Ihre Vorherrschaft wurde erst durch die verbündeten Kräfte von Maelsechlainn II (König von Meath) und Brian Boru in den Jahren bis 1014 beendet. Im späten 10. Jahrhundert erreichte Brian Boru, ein Abkömmling eines Clans aus Munster, genug Einfluss, dass er den Titel ard righ (Hochkönig) erhielt. Boru und seine Alliierte besiegten eine gemeinsame Armee aus Wikingern und Einheimischen in der Schlacht bei Clontarf im Jahr 1014. Obwohl Boru dieses Schlacht nicht überlebte, war damit die Vorherrschaft der Nordmannen in Irland gebrochen. Nach und nach gingen sie in der ansässigen Bevölkerung auf. Borus Nachkommen scheiterten bei dem Versuch einen gesamtirischen Staat zu errichten und die daraus später folgenden Territorialstreitigkeiten führten indirekt zur Invasion der Nordmannen unter Strongbow im Jahr 1169.
Gegen die vorreformliche Kirche Irlands wird häufig der Vorwurf erhoben, sie habe mehr Laster denn Tugenden besessen. Doch war nicht alles an ihr schlecht. Auch mit Beginn des 1. Jahrtausends nahmen die seit dem siebten Jahrhundert weitestgehend verweltlichten Klöster Irlands geistliche Aufgaben wahr. Sie waren Wächter der traditionellen Gelehrsamkeit und erfüllten nützliche Funktionen. Die ungezügelt wachsende Wikingerstadt Dublin setzte die Reformen in Irland in Gang. Die im Jahre 1038 von König Sigtrygg gegründete Kirche wurde zur Kathedrale und benötigte einen Bischof. Die Stadt wollte aber keine Bindung an das irische Klosterwesen und entschied ihren Bischof durch den Erzbischof von Canterbury weihen zu lassen. Damit wurde Dublin Suffragan von Canterbury. Der Erzbischof von Canterbury Lanfranc (1070 bis 1089) richtete ein Schreiben an den König Turlough O'Brien, in dem er ihn ermahnte, die im Land übliche Praxis der Ehescheidung auszusetzen und die Simonie zu beenden, also keine geistlichen Ämter für Geld zu vergeben. Als Turloughs Sohn 1101 vor die Synode in Cashel trat, vermied er das Thema Scheidung. Die versammelten Synodalen bestanden nach dem Vorbild der Franken vor der Hildebrandschen Reform - auch aus der Laienschaft. Er wollte angesichts dieses Schlages der Reformer gegen das tief verwurzelte irische Rechtssystem einer Überreaktion vorbeugen.
Das spektakulärste Ereignis war die Übergabe des Rock of Cashel als Geschenk an die Kirche. Durch Verbote bemühte sich die Synode den Gleichklang der irischen Kirche mit Rom herzustellen bezüglich der Simonie, der Ehe zwischen Blutsverwandten, des Bestehens von zwei Leitungen einer Kirche und der Kirchenleitung durch Laien.
Diese Verbote waren für die alte Kultur Irlands ein Desaster. Eine weitere Synode in Rath Breasail teilte Irland, nach dem Vorbild der Erzbistümer Canterbury und York in England, in die Bistümer Armagh für den Norden und Cashel für den Süden. Erstmalig entsprach die irische Kirchenstruktur damit dem europäischen Vorbild. Mit dem Tod von Muircheartach O'Brien im Jahre 1119 wurde Armagh zum Vorreiter der Reform. 1134 übernahm der Hl. Malachy das Erzbistum. In Bangor hatte er eine der letzten Kapellen aus Holz errichtet. Gleichzeitig steht fest, dass die erste Steinkirche auf der Insel Illaunloughan bereits zwischen 640 und 790 entstand. Er strebte nach der Zustimmung Roms zu den in Rath Breasail 1111 eingeleiteten Reformen. 1139 machte er sich auf die Reise nach Rom, wo er den Papst um das Pallium, das Symbol der vom Papst verliehenen Würde, für die Erzbischöfe von Armagh und Cashel bat. Sein Besuch zweier Klöster in Frankreich war für Irland indes von entscheidenderer Bedeutung: In Arrouaise, wo er die augustinischen Ordensregeln kennenlernte, und in Clairvaux, wo ihn sofort eine tiefe Freundschaft mit dem Hl. Bernard verband. In der Überzeugung, dass Malachy der Kirche wertvollere Dienste leisten konnte, entließ der Papst Malachy ohne Pallium, aber als päpstlichen Legat. Mit Hilfe des Hl. Bernhard und französischer Steinmetze errichtete Malachy die erste Zisterzienserabtei in Mellifont im County Louth. Dieser ersten Gründung eines kontinentaleuropäischen Ordenshauses in Irland, das 1157 eingeweiht wurde, folgten weitere, die im kirchlichen Leben des Landes eine überragende Rolle spielten. Als 1152 eine Synode in Kells zusammentrat, überbrachte der päpstliche Legat Kardinal Paparo nicht nur die begehrten Pallia für Armagh und Cashel, sondern auch je eines für Dublin und Tuam. Die Synode nahm Korrekturen am organisatorischen Aufbau und den Amtsgrenzen der Bistümer vor und behandelte die Abschaffung des Konkubinates, die Abschaffung der bezahlten Taufe und ein Verbot zur Annahme von Zahlungen für Kirchenbesitz sowie die Aufforderung zur pünktlichen Zahlung des Zehnten. Kells legte der Reformbewegung seinen Stempel auf, der durch den Hl. Laurence O‘Toole, Abt von Glendalough 1153 und ab 1161 Erzbischof von Dublin in der Synode von Clonfert 1179 fortgeführt wurde. Irland war ab 1169 von anglo-normannischen Truppen besetzt und der engl. König hinderte den Erzbischof, der sich in England aufhielt, daran, nach Irland zurückzukehren. Er starb 1180 in der Normandie. Die Reform erlahmte und die Kirche wurde verfolgt, insbesondere seit der Zeit als Heinrich VIII der auch König von Irland war, 1534 die Trennung mit Rom vollzog.
Anfang des 12. Jahrhunderts bestand Irland politisch nach wie vor aus einer Vielzahl an kleinen Königreichen und Über-Königreichen (overkingdoms). Die Macht lag in den Händen regionaler Dynastien, die um die Vorherrschaft im Land kämpften. Die nördlichen Uí Néill beherrschten ungefähr das Gebiet des heutigen Ulster, die südlichen Uí Néill waren die Könige von Brega (Meath). Das Königtum von Leinster wurde von den Uí Cheinnselaigh beherrscht, das relativ neue Königreich Osraige zwischen Leinster und Munster von der Familie der Mac Giolla Phádraig, Munster großteils von den Mac Cartaig, den Nachfolgern Brian Borus und Connaght großteils von den Uí Chonchubhair.
Hochmittelalter
Nach dem Verlust des Schutzes von Hochkönig Muirchertach MacLochlainn (durch dessen Tod 1166) wurde der König von Leinster Dermot MacMurrough (oder Diarmuid MacMorrough) gewaltsam von einer verbündeten Kraft unter dem neuen Hochkönig Ruaidri mac Tairrdelbach Ua Conchobair (oder Rory O’Connor) verbannt. Diarmait floh zuerst nach Bristol, dann nach Aquitanien und erhielt schließlich von Heinrich II. die Erlaubnis mit seinen Untertanen sein Königreich zurückzuerobern. 1167 konnte Dermot die Unterstützung von Maurice Fitz Gerald gewinnen und später den Prinzen von Deheubarth (Königreich im südlichen Wales) dazu überreden, den gefangenen Halbbruder von Maurice, Robert Fitz-Stephen, zu begnadigen, damit dieser an seiner Fahrt teilnehmen konnte. Doch am wichtigsten war die Unterstützung des Richard de Clare, 2. Earl of Pembroke, besser bekannt als Strongbow.
Der erste normannische Kämpfer, der Irland betrat, war Richard Fitz Godbert de Roche im Jahr 1167, doch erst 1169 landeten die Hauptkräfte der gemeinsamen Armee aus Normannen, Walisern und Flamen in der Grafschaft Wexford. Binnen kürzester Zeit war Leinster zurückerobert sowie Dublin und Waterford unter der Kontrolle von Diarmait. Strongbow wurde zum Thronerben seines neuen Königreiches. Diese Entwicklung bestürzte jedoch Heinrich II., da dieser einen rivalisierenden normannischen Staat in Irland fürchtete. Daraufhin reiste dieser nach Leinster, um seine Autorität zu demonstrieren.
Papst Hadrian IV. (der erste englische Papst) hatte bereits in einer seiner ersten Bullen im Jahr 1155 Heinrich II. dazu ermächtigt, in Irland einzufallen, um die kirchliche Korruption und Missbrauch zu bekämpfen. Heinrich landete mit einer großen Flotte 1171 bei Waterford und war der erste englische König, der irischen Boden betrat. Sowohl Waterford als auch Dublin wurde zu königlichen Städten erklärt. Hadrians Nachfolger (Papst Alexander III.) ratifizierte 1172 den Anspruch von Heinrich II. auf irischen Boden. Heinrich II. übergab seine irischen Ländereien an seinen jüngsten Sohn John, der den Titel Dominus Hiberniae (Lord of Ireland) erhielt. Als John überraschend seinem Vater als König von England nachfolgte (anstelle seines Bruders), fiel der Titel direkt unter den Einfluss der englischen Krone.
Heinrich wurde von den meisten irischen Königen anerkannt, sahen diese in ihm eine Chance die Expansion von Leinster durch die Hiberno-Normannen aufzuhalten. Dies führte zur Ratifizierung des Vertrags von Windsor im Jahr 1175 zwischen Heinrich und Ruaidhrí. Doch mit dem Tod von Strongbow (1171) und Diarmuid (1176), der Rückkehr von Heinrich nach England und der Unfähigkeit von Ruaidhrí seine Vasallen zu zügeln, war der Vertrag binnen zwei Jahren nahezu wertlos geworden. 1177 fiel John de Courcy in Irland ein und eroberte einen Großteil des östlichen Ulster. Raymond le Gros hatte zu dieser Zeit bereits Limerick eingenommen und kontrollierte das nördliche Munster, während andere normannische Familien wie zum Beispiel Prendergast, fitz Stephen, fitz Gerald oder fitz Heinrich bereits ihre eigenen virtuellen Königreiche planten. Die Barone sicherten ihren Besitz durch auch heute noch weithin sichtbare Burgen, und begannen, weitere Teile Irlands in Besitz zu nehmen.
Die geringe Anzahl der Eroberer, auch aufgrund anglo-normannischer Interessen anderswo (Schottland, Frankreich), machten eine normannisch-irische Zusammenarbeit erforderlich. Die Anglo-Normannen beschränkten sich daher auf die Absetzung der irischen Clanchefs und versuchten in den besetzten Gebieten eine Akzeptanz durch die irländische Bevölkerung (das heißt Iren und Wikinger) zu erreichen. Die folgenden Jahrzehnte sahen die Konsolidierung anglo-normannischer Vorherrschaft, mit der die Verwaltung Irlands (insbesondere unter König Johann Ohneland (John Lackland), 1199 bis 1216) und die Gründung vieler Städte einherging. Viele der bedeutenden Kathedralen Irlands stammen aus dieser Zeit.
Die mächtigste Kraft im Land waren die großen anglo-normannischen Grafen, wie die der Geraldines, der Butlers oder der Burke´s, die große Gebiete kontrollieren, die nahezu unabhängig von den Regierungen in Dublin oder London waren. Der Lord of Ireland (daher der Name Lordschaft Irland) war König John, der bei seinen Besuchen 1185 und 1210 dabei half, die normannischen Gebiete in militärischer und administrativer Hinsicht zu sichern. Es schaffte es auch, diverse irische Könige unter seine Lehnseid zu bringen, zum Beispiel Cathal Crobderg Ua Conchobair. Dem Namen nach war die Lordschaft Irland (die bis 1541 andauerte) ein inselumfassender irischer Staat - doch in der Realität beschränkte sich der Herrschaftsbereich neben einigen normannischen Hochburgen auf ein Gebiet rund um Dublin, das als The Pale bekannt werden sollte.
Die Anglo-Normannen mussten eine Reihe von Rückschlägen hinnehmen, die ihre Ausbreitung, Siedlungspolitik und Macht einschränkten. Zuerst wurden eine Reihe von Rebellionen von gaelischen Chiefs initiiert, die Ressourcen banden, teilweise sogar Gebiete eroberten. Weiterhin versiegte der Rückhalt von Heinrich III. und seinem Nachfolger Edward I. (der sich mehr um Angelegenheiten in England, Wales und Schottland kümmerte), sodass die normannischen Kolonisten keinerlei (oder wenig) Nachschub aus England erhielten. Und letztendlich wurde die normannische Position auch durch Streitereien innerhalb der eigenen Reihen geschwächt. Durch die Aufteilung von Ländereien auf mehrere Söhne zersplitterte das Land in schwächere Einheiten (die Marshalls von Leinster zerteilten eine Grafschaft in einem Fall sogar in fünf Teile).
Spätmittelalter
Die Geschichte Irlands ab1215 markiert eine Phase des Übergangs und des Wandels, in der die normannische Eroberung, die seit der Invasion durch Strongbow und Heinrich II. im späten 12. Jahrhundert andauerte, zunehmend an Dynamik verlor. Nach der anfänglichen Konsolidierung der anglo-normannischen Herrschaft – oft als "Hiberno-Normannen" bezeichnet – begann sich Widerstand unter den gälischen Iren zu formieren. Diese Periode sah die Entstehung einer einheitlichen irischen Bewegung, die über regionale Clans hinausging und auf eine koordinierte Opposition gegen die englische Präsenz abzielte. Diese Bewegung war nicht nur politisch, sondern auch kulturell motiviert, da die Iren ihre gälische Sprache, Traditionen und soziale Strukturen verteidigten. Militärische Erfolge wie die Schlacht bei Callann im Jahr 1261, in der die Iren unter Führung von Aodh Ó Conchobhair (Hugh O'Connor) eine normannische Armee besiegten, und die Auseinandersetzung bei Carrick-on-Shannon 1270, wo irische Kräfte unter Mac Diarmada (MacDermot) siegreich waren, zeigten, dass die gälischen Lords in der Lage waren, lokale Erfolge zu erzielen und Territorien zurückzuerobern. Diese Siege schwächten die normannische Kontrolle und förderten ein Gefühl der Einheit unter den Iren, das in den folgenden Jahrhunderten anhalten sollte.
Das 14. Jahrhundert brachte eine Serie von Katastrophen für das hiberno-normannische Irland, die die englische Präsenz nachhaltig erschütterten und zu einer gälischen Wiederbelebung führten. Der erste große Vorfall war der Einfall des schottischen Adligen Edward Bruce im Jahr 1315. Bruce, Bruder des schottischen Königs Robert the Bruce, landete mit einer Armee in Ulster, unterstützt durch eine Einladung des irischen Königs von Tyrone, Domnall Ó Néill. Sein Ziel war es, Irland als zweites Front gegen England zu eröffnen und sich selbst zum High King of Ireland krönen zu lassen – eine Zeremonie, die 1316 in Dundalk stattfand. Bruce verbündete viele irische Lords gegen die Engländer und erzielte anfängliche Erfolge, indem er Städte wie Carrickfergus einnahm und weite Teile des Nordens kontrollierte. Seine Kampagne verursachte erheblichen Schaden, insbesondere in der dicht besiedelten Region um Dublin, wo Plünderungen und Zerstörungen die normannische Wirtschaft lähmten. Obwohl Bruce letztendlich in der Schlacht bei Faughart (nahe Dundalk) im Oktober 1318 getötet wurde – seine Armee wurde von einer anglo-irischen Koalition unter John de Bermingham besiegt –, hatte die Invasion langfristige Konsequenzen. In dem entstandenen Chaos konnten die irischen Lords große Teile des Landes zurückerobern, die sie bei der normannischen Eroberung verloren hatten. Die Bruce-Kampagne schwächte die englische Autorität und förderte Allianzen zwischen Schotten und Iren, die die gälische Kultur stärkten.
Die zweite Erschütterung kam 1333 mit der Ermordung von William Donn de Burgh, dem 3. Earl of Ulster. De Burgh, ein mächtiger hiberno-normannischer Lord, der weite Gebiete in Ulster und Connacht kontrollierte, wurde im Alter von nur 20 Jahren bei Le Ford (heute Belfast) von seinen eigenen Vasallen getötet – darunter Richard de Mandeville und John de Logan. Der Mord war Rache für die Inhaftrierung und den Hungertod von Sir Walter Liath de Burgh, Williams Cousin. Diese Tat führte zur Dreiteilung seines enormen Erbes unter entfernte Verwandte und löste den Burke Civil War aus, einen innerfamiliären Konflikt unter den de Burghs (später Burkes). Besonders in Connacht rebellierte das Gebiet offen gegen die englische Krone und verbündete sich mit den einheimischen Iren. Dadurch ging quasi das gesamte Territorium westlich des Shannon für die Hiberno-Normannen verloren. Die Burkes spalteten sich in gälisch orientierte Zweige auf, wie die MacWilliam Íochtar in Mayo, und es dauerte mehr als 200 Jahre, bis sie sich wieder der Dubliner Administration unterwarfen. Dieser Verlust markierte einen Wendepunkt, da er die normannische Expansion stoppte und die gälischen Clans wie die O'Connors und O'Briens stärkte.
Die dritte und vielleicht verheerendste Katastrophe war die Ankunft der Pest, bekannt als Black Death, im Jahr 1348. Die Seuche, die von Ratten und Flöhen übertragen wurde, erreichte Irland über Handelsschiffe aus England und dem Kontinent, beginnend in Häfen wie Dublin und Drogheda. Sie traf die englischen und normannischen Siedler besonders hart, da diese hauptsächlich in überbevölkerten Städten und Dörfern lebten, wo die Krankheit sich rasch ausbreitete. Schätzungen gehen von einem Bevölkerungsrückgang von bis zu 40-50 % aus, wobei die städtischen Gebiete wie Kilkenny und Dublin am stärksten betroffen waren. Eine zeitgenössische Darstellung aus dem Kloster in Kilkenny beschrieb die Pest als "den Beginn des Endes der Welt", mit Berichten über Massengräber und verlassene Siedlungen. Im Gegensatz dazu lebten die einheimischen Iren in verstreuten, ländlichen Siedlungen, was sie weniger anfällig machte. Nach der Plage waren die Iren zahlenmäßig überlegen, und die gälische Sprache sowie Bräuche dominierten erneut. Die englische Kontrolle schrumpfte auf das sogenannte Pale, ein befestigtes Gebiet um Dublin herum, das etwa die Countys Dublin, Meath, Louth und Kildare umfasste. Außerhalb des Pales verloren die Hiberno-Normannen an Einfluss, und die Pest beschleunigte die gälische Resurgence.
Außerhalb des Pales assimilierten sich die hiberno-normannischen Lords allmählich an die irische Kultur: Sie nahmen die gälische Sprache an, trugen irische Kleidung, heirateten in irische Familien ein und wurden als "Old English" bekannt – oft beschrieben als "irischer als die Iren selbst". Diese "Gälisierung" führte dazu, dass sie in politischen und militärischen Konflikten häufig mit den Iren gegen die Engländer paktierten und sogar nach der Reformation katholisch blieben. Die Machthaber im Pale fürchteten diesen Trend so sehr, dass sie 1366 im Parlament von Kilkenny die "Statutes of Kilkenny" erließen. Diese 35 Gesetze, initiiert von Lionel of Antwerp, dem Sohn Edwards III., verboten Englischstämmigen, Irisch zu sprechen, irische Sitten anzunehmen, Brehon-Gesetze zu nutzen oder mit Iren zu heiraten. Sie zielten darauf ab, die englische Identität zu bewahren und die Kolonie zu stärken. Allerdings hatte die Dubliner Regierung wenig Autorität außerhalb des Pales, sodass die Statuten weitgehend wirkungslos blieben und die Gälisierung ungehindert fortsetzte.
Im 15. Jahrhundert verstärkte sich dieser Trend der Gälisierung weiter, unterstützt durch die Ablenkung der englischen Krone durch die Rosenkriege (1455 bis 1487), die innere Kämpfe in England verursachten und Ressourcen von Irland abzogen. Die zentrale englische Autorität in Irland brach zusammen, was zu einer Fragmentierung führte. Im späten 14. und frühen 15. Jahrhundert entstanden mächtige irische Königreiche und Lordschaften, wie das von den O'Neills in Ulster, den O'Briens in Thomond oder den MacCarthys in Desmond. Zwischen diesen entbrannten Konflikte um Grenzen, Allianzen und Ressourcen, die bis in die 1500er Jahre andauerten. Die Old English Lords, wie die Fitzgeralds (Earls of Kildare) und Butlers (Earls of Ormond), dominierten das Pale, agierten aber zunehmend unabhängig und integrierten gälische Elemente. Diese Periode der gälischen Resurgence sah eine Blüte der irischen Kultur, mit Patronage für Barden, Historiker und Künstler, sowie eine Stärkung des Brehon-Rechts. Bis 1550 blieb Irland ein Patchwork aus gälischen und anglo-irischen Territorien, bis die Tudor-Monarchen unter Heinrich VIII. und Elisabeth I. eine Rekonquista einleiteten, die die Insel endgültig unter englische Kontrolle bringen sollte. Diese Ära unterstreicht die Resilienz der gälischen Gesellschaft und den langsamen Verfall der mittelalterlichen normannischen Kolonie.
Englische Kolonialzeit
Irland im Jahr 1500 war geprägt durch die unvollendete anglo-normannische Invasion, die im 12. Jahrhundert begann. Viele ansässige Iren wurden aus verschiedensten Gebieten (vor allem im Osten und Südosten) vertrieben und stattdessen englische Arbeiter und Bauern angesiedelt. Doch der Einflussbereich der Engländer schwand immer mehr, und so kam es, dass in den Lordschaften außerhalb des Pale - einem Gebiet rund um Dublin - die Macht der (englischen) Autorität in Dublin kaum wahrgenommen wurde. Die Macht außerhalb des Pale ging mit der Zeit nahezu komplett auf die wichtigste anglo-normannische Dynastie, die Fitzgeralds of Kildare, über, dessen Anführer bis 1531 als Stellvertreter der englischen Krone in Irland tätig war. Doch die Loyalität der Fitzgeralds gegenüber der Krone wurde immer schwächer (die Fitzgeralds hatten sogar Truppen aus dem Burgund nach Dublin eingeladen, um 1497 bei der Krönung des Betrügers Lambert Simnel als König von England anwesend zu sein). Der letzte ausschlaggebende Faktor entstand im Jahr 1536, als Silken Thomas Fitzgerald zur offenen Rebellion gegen die englische Krone ausrief, nachdem seine Rivalen, die Butlers of Ormonde, zum Stellvertreter der englischen Krone ernannt wurden. Nach dem Niederschlag der Rebellion mit der Hinrichtung von Silken Thomas, entschied sich Heinrich VIII., die irische Insel wieder komplett unter englische Kontrolle zu bringen, damit sie nicht zum Ausgangspunkt einer feindlichen Invasion der britischen Inseln wurde (ein Bedenken, dass für weitere 400 Jahre bestehen bleiben sollte). Heinrich VIII. suchte einen Weg um das Gebiet des Pale zu schützen sowie einen „Ersatz“ für die Fitzgeralds.
Mit der Hilfe von Thomas Cromwell, führte der König die Politik von Zuckerbrot und Peitsche ein. Man erweiterte den Schutz durch die englische Krone auf die gesamte Elite in Irland (ohne Berücksichtigung von ethnischer Zugehörigkeit), verlangte im Gegenzug aber die Einhaltung der Gesetzte der zentralen Regierung sowie die offizielle Kapitulation der irischen Lords gegenüber der Krone um so per königlicher Charta ihren Titel offiziell zu erhalten (und somit auch am Parlament teilnehmen zu können). Der Schlüsselpunkt dieser Reform war die Überführung der Lordschaft Irland durch ein Statut des irischen Parlaments im Jahr 1541 in ein Königreich. Dies geschah auf Drängen von Heinrich VIII., weil ihm der Titel ursprünglich vom Papst gewährt und Heinrich VIII. von der katholischen Kirche exkommuniziert worden war, so dass der Titel nicht länger gültig war. Weiterhin wollte man mit diesem Schritt die gälische (bzw. gälisierten) oberen Klassen stärker an die Krone binden. Praktisch stimmten alle Lords dieses neuen Privilegien zu - machten aber weiter wie bisher. Die eigentliche Macht in Irland lag auch nicht beim Parlament, sondern beim Lord Deputy of Ireland - dem königlichen Stellvertreter in Irland. Das Parlament tagte nur dann, wenn es vom Lord Deputy einberufen wurde, wenn dieser neue Gesetze oder Steuern erlassen wollte. Dem Lord Deputy beratend zur Seite stand der sog. irische Kronrat.
Heinrichs kirchliche Reformen - obwohl nicht so streng wie in England - verursachten hingegen Unruhe. Sein Stellvertreter in Irland, Lord Deputy Anthony St Leger, erkaufte sich die Opposition mittels Ländereien, die zuvor den Klöstern entwendet wurden waren.
Nach dem Tod Heinrichs VIII. im Jahr 1547 wurde es für die Stellvertreter der Krone in Irland noch schwieriger, die Gesetze der Zentralregierung durchzusetzen. Nacheinander brachen mehrere Rebellionen aus - die erste in den 1550er Jahren in Leinster, als die Clans der O’Moore und O’Connor im Zuge der Plantations umgesiedelt werden sollten. In den 1560er Jahren endete der englische Versuch in einen internen Konflikt des O’Neill Clans in einer langjährigen Auseinandersetzung zwischen dem Lord Deputy von Sussex und Shane O'Neill - dem Anführer des Clans. Andere Clans, wie zum Beispiel die O’Brynes und O’Tooles, überfielen weiterhin (wie sie es schon immer getan hatten) das Gebiet des Pale. Die wohl gewalttätigste Aktion fand in Munster in der 1560er bis 1580er Jahren statt, als die Fitzgeralds of Desmond die Desmond-Rebellionen starteten, um das englische Eindringen auf ihrem Gebiet zu unterbinden. Neben einigen äußerst brutalen Schlachten wurden gezielt Hungersnöte provoziert, in denen fast ein Drittel der Bevölkerung der Provinz starb. Endgültig wurde die Rebellion im Jahr 1583 niedergeschlagen, als der Earl of Desmond getötet wurde.
Es gab zwei Gründe für die andauernde Gewalt in Irland und die Probleme, die die englische Regierung dort hatte. Erstens, die Aggressivität der englischen Soldaten und Verwalter - ganze Garnisonen hielten sich nicht an die Gesetze, töteten örtliche irische Anführer und Lords oder beschlagnahmten und plünderten Privatbesitz. Das zweite Problem war die Unvereinbarkeit zwischen gälisch-irischer Gesellschaft und englischer Regierung. Nach irischen Brauch wurde ein Clanführer durch eine Adelslinie gewählt (was nicht selten zu internen Auseinandersetzungen führte). Unter der Siedlungspolitik von Heinrich VIII., sollte die Nachfolge nach englischem Brauch durchgeführt werden, das heißt dass der erstgeborene Sohn die Nachfolge übernahm (Primogenitur). Durch die ständige Missachtung dieses Gesetzes, waren die Engländer gezwungen in Streitigkeiten Partei zu ergreifen - was die unterlegenen Parteien wiederum gegen die Engländer aufbrachte.
1559 bestieg Elisabeth I. den englischen Thron und sie versuchte Irland mit einer Reihe von Plänen zu befrieden. Der erste Versuch beinhaltete militärische Gewalt, bei dem kriegerische Gegenden (zum Beispiel die Wicklow Mountains) durch eine einer kleine Zahl englischer Truppen unter Kommandanten (des so genannten Seneschallen) besetzt wurden. Die Seneschallen hat die Macht das Kriegsrechts auszurufen, unter dem Exekutionen ohne Gerichtsverfahren möglich waren. Für jede Person, die im Machtbereich eines Seneschalls lebte, musste der ansässige Lord bürgen - die sogenannten „masterless men“ (also Personen ohne Bürge von einem Lord) konnten jederzeit getötet werden. Die englische Krone hoffte so, dass die irischen Lords mehr Druck auf ihre Untergebenen ausüben würden - doch die beliebigen Hinrichtungen brachte die irischen Lord noch viel mehr gegen die Engländer auf.
Dieser Fehlschlag führte die Engländer zu weiteren - auf längere Sicht ausgelegte - Plänen, die irische Insel zu befrieden und zu anglisieren. Einer dieser Pläne war die sog. composition - private Armeen wurden abgeschafft und Provinzen vollständig von englischen Truppen unter dem Kommando eines Gouverneurs (genannt Lords President) besetzt und im Gegenzug wurden die mächtigsten Lords von der Steuer befreit. Die Durchsetzung dieses Plans führte jedoch zu noch mehr Gewalt - vor allem im Connacht, wo die MacWilliam Burkes einen erbitterten Kampf gegen den englischen Provinzialpräsident Sir Richard Bingham führten. Doch in einigen Gegenden hatte dieses Plan Erfolg, zum Beispiel in Thomond, wo er von der herrschenden O’Brien Dynastie unterstützt wurde.
Der zweite Plan dieser Art waren die Plantations - Gebiete in Irland, in denen gezielt englische und schottische Einwanderer angesiedelt wurden, um die englische Kultur und Loyalität zur Krone nach auf die irische Insel zu bringen. Den Versuch von Plantations gab es bereits in den 1550er Jahren in Laois und Offaly sowie in den 1570er Jahren in Antrim - jeweils mit wenig Erfolg. Doch gegen Ende der Desmond Rebellionen, Anfang der 1580er Jahre, wurden große Landflächen in Munster kolonisiert - den größten Teil dieser Landflächen erhielt Sir Walter Raleigh, der diese jedoch später an Sir Richard Boyle verkaufte. Boyle wurde zum Earl of Cork und zum wohlhabendsten Mann der frühen Stuart-Monarchen. Natürlich heizte die Landenteignung zum Zwecke der Plantations den Hass der Iren auf die Engländer noch weiter an.
Der kritische Punkt der Elisabethanischen Eroberung von Irland kam, als man versuchte die Macht auf das Gebiet von Ulster und des Clans von Hugh O'Neill (dem mächtigsten Lord in Irland zu dieser Zeit) auszuweiten. O'Neill wehrte sich mit Waffengewalt und startete den Neunjährigen Krieg (1594 bis 1603), der die ganze Insel erfasste und zum Ziel hatte, die englische Autorität komplett von der irischen Insel zu vertreiben. O’Neill gelang die Aufstellung eines aus etwa 10.000 Iren bestehenden Heeres. Diese Streitmacht war mit zahlreichen Musketen bestens ausgerüstet, welche die Iren mit spanischem Gold in Schottland gekauft hatten. Die Iren wurden von Spanien nicht nur durch finanzielle Mittel, sondern auch durch die Entsendung von Festungsingenieuren unterstützt. O’Neill setzte nicht nur auf die Iren gälischer Abstammung, sondern versuchte zusätzlich die „Alt-Engländer“ (Englische Siedler aus anglo-normannischer Zeit, die katholisch geblieben waren) für seine Sache zu gewinnen. Aufgrund der in Irland vorherrschenden Armut dienten zahlreiche Iren als Söldner im spanischen Heer, wo sie wichtige militärische Erfahrungen sammelten. Ein zur Bekämpfung von O’Neills Truppen ausgesandtes, englisches Heer wurde bei Clontibret überraschend von diesen angegriffen und vernichtend geschlagen. Drei Jahre später, am 14. August 1598, kam es bei Yellow Ford zu einer weiteren Schlacht, welche ebenfalls mit einer schweren englischen Niederlage endete.
Königin Elisabeth I. setzte 1600 Lord Mountjoy als neuen Lord Deputy in Irland ein. Dieser sorgte im Norden Irlands für die Vernichtung der Ernte und ließ die dortigen Viehherden beschlagnahmen, um den Aufständischen ihre Nahrungsgrundlagen zu entziehen. Mountjoys weiterer Vorstoß nach Ulster wurde jedoch von O’Neill und seinen Truppen vom 2. bis zum 3. Oktober 1600 am Moyry Pass gestoppt. Unterstützung erhielt O’Neill am 21. September 1601 in Form von 3500 spanischen Soldaten, die in Kinsale an Land gingen und von König Philipp III. gesandt wurden. Englische Truppen unter Mountjoy begannen wenig später mit der Belagerung der Stadt. Ende Dezember traf O’Neill mit seinem Heer bei Kinsale ein, um die Belagerung gewaltsam zu beenden. Der Versuch scheiterte, und die spanische Garnison kapitulierte. Nach einigen weiteren Kampfhandlungen handelte O’Neill 1603 einen Waffenstillstand mit den Engländern aus. Da sich Irland nun wieder gänzlich unter englischer Kontrolle befand, verließen zahlreiche Angehörige des irischen Adels - darunter O’Neill - im Jahre 1607 ihr Heimatland, wobei man von der Flight of the Earls („Grafenflucht“) sprach. Zur Vergeltung für den Aufstand wurden zahlreiche irische Grundbesitzer enteignet.
In den frühen Jahren des 17. Jahrhunderts hatte es den Anschein, als solle Irland friedlich in die englische Gesellschaft integriert werden. Der erste (und wohl wichtigste) Schritt nach dem Sieg war die Entwaffnung der irischen Lordschaften und die Schaffung einer zentralen Regierung für das ganze Land. Irische Kultur, Gesetz und Sprache wurden unterdrückt und viele irische Lords verloren ihre Ländereien und ihre Titel.
Zu einer bis in die heutige Zeit folgenschweren Entwicklung kam es unter Elisabeths Nachfolger Jakob I.. Unter dessen Regentschaft wurde seit 1609 die „Ulster Plantation“ durchgeführt. Im Zuge dieser Plantation wurden zirka 80.000 englische, schottische und walisische Siedler in Ulster angesiedelt. Ulster entwickelte sich dadurch zum Kern englischer Herrschaft in Irland. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts kam es zu einem wirtschaftlichen Aufschwung, der ein starkes Bevölkerungswachstum zur Folge hatte. Um ihre Herrschaft über Irland zu sichern, erbauten die Engländer unter Jakob I. Forts und Zitadellen in Städten wie Cork und Kinsale. Die nordirische Stadt Derry wurde 1613 direkt der englischen Hauptstadt London übertragen, befestigt und mit Engländern besiedelt. Ihr Name wurde in Londonderry geändert. Die Gerichte urteilten nach englischem Recht und den Statuten des zentralen irischen Parlaments. Doch die Engländer schafften es nicht, dass die irische Bevölkerung zum protestantischen Glauben übertrat, und nahezu alle Iren hielten an ihren bisherigen Traditionen fest. Es ist noch ungeklärt, warum die Konvertierung der Iren zum Protestantismus fehlschlug. Eine Theorie (von vielen) liegt in den brutalen Methoden, mit denen die englische Krone versuchte, das Land zu befrieden und seine Ressourcen auszubeuten. Ein weiterer Grund könnte die Gegenreformation in Irland gewesen sein - im Jahr 1600 gab es bereits in vielen (katholischen) Ländern Europas sogenannte Irish Colleges - Zentren für den irisch-katholischen Klerus.
Die vorelisabethanische irische Bevölkerung wird in der Regel in zwei Gruppen unterteilt: die Old Irish (oder Gälen, das heißt die ursprünglichen irischen Siedler) und die Old English (Abkömmlinge der mittelalterlichen hiberno-normannischen Siedler). Diese beiden Gruppen war historisch bedingte Gegner; die Old English siedelten zum Beispiel im Pale, Süd-Wexford und anderen befestigten Städten, während die Old Irish das übrige Land besiedelten. Im 17. Jahrhundert näherten sich diese beiden Bevölkerungsgruppen (vor allem auf der Elite-Ebene) einander an. Zum Beispiel sprachen die meisten Old English-Lords die irische Sprache und förderten in hohem Maß irische Dichtkunst und Musik. Auch Hochzeiten zwischen beiden Gruppen waren nun üblich. Gegen Ende der Elisabethanischen Eroberung teilten beide Gruppen auch die gleiche, römisch-katholische Religion - im Gegensatz zur protestantischen Besatzungsmacht. In den Jahren zwischen 1603 und 1641 (dem Ausbruch der Rebellion) fühlten sich die katholischen Bevölkerungsgruppen mehr und mehr durch die englische Regierung in Irland unterdrückt, was vor allem an den allerersten Penal Laws lag - sogenannte Strafgesetze, die sich gegen nicht-protestantische Bevölkerungsgruppen richteten.
Die meisten gehobenen Bevölkerungsgruppen waren prinzipiell nicht feindlich gegen die Souveränität des englischen Königs in Irland eingestellt - man wollte jedoch die gehobene Position in der irischen Gesellschaft behalten. Dies wurde aber wegen ihrer abweichenden Religion und der Gefahr, die durch die Ausbreitung der Plantations entstand, verhindert. Die protestantischen Siedler dominierten die irische Regierung und versuchten, immer mehr Land zu enteignen, indem man dessen mittelalterliche Besitztitel in Frage stellte, sowie als Sanktion bei Verstößen gegen den Pflichtbesuch protestantischer Messen. Im Gegenzug wandten sich die irischen Katholiken direkt an die Könige Jacob I und (ab 1625) Charles I, damit ihre Religion vollständig anerkannt und toleriert würde. Es gab einige Fälle, in denen die Monarchen scheinbar eine Einigung mit den Iren erzielt hatten, im Gegenzug aber höhere Steuern forderten. Trotz erhöhter Zahlungen verschoben die Monarchen die Gleichstellung aber aufgrund innenpolitischen Drucks immer weiter in die Zukunft. Auch der 1632 zum Lord Deputy in Irland ernannte Thomas Wentworth trug nicht zur Beruhigung der irischen Bevölkerung bei, als er weitere Enteignungen ankündigte. Der englische König geriet mit der Zeit in Konflikte mit dem Parlament, das stark von den puritanischen Abgeordneten beeinflusst war. Der Puritanismus war eine Glaubensbewegung, die eine Religion frei von jeglichen katholischen Elementen forderte. Als Charles I 1641 Wentworth auf Druck des Parlaments hinrichten ließ, fürchteten die katholischen Iren die Durchsetzung gegen sie gerichteter Repressalien durch die puritanischen Parlamentarier.
Die irische Rebellion von 1641 begann als Staatsstreich des katholischen irischen Adels, entwickelte sich aber schnell zu einem Glaubenskrieg zwischen den katholischen Iren und den englischen und schottischen (protestantischen) Siedlern. Die Verschwörer waren eine kleine Gruppe irischer Landbesitzer - hauptsächlich aus der stark von Engländern und Schotten besiedelten Provinz Ulster. Während Hugh MacMahon und Conor Maguire Dublin Castle besetzen wollten, sollten Phelim O’Neill und Rory O‘Moore die Stadt Derry und andere nördliche Städte erobern. Der Plan, der am 23. Oktober 1641 ausgeführt werden sollte, beruhte eher auf einem Überraschungseffekt als auf militärischer Stärke. Man hoffte auf die breite Unterstützung durch die Bevölkerung. Doch der Plan der möglichst gewaltfreien Machtübernahme scheiterte bereits, als die Obrigkeit in Dublin von einem Informanten - dem zum Protestantismus konvertierten Owen O’Connolly - von dem Plan erfuhr und Maguire und MacMahon verhaften ließ. O‘Neill konnte in der Zwischenzeit allerdings einige Forts einnehmen, indem er behauptete, im Namen des Königs zu handeln. Doch die Situation geriet außer Kontrolle, da die Obrigkeit in Dublin vermutete, es handele sich um einen generellen Aufstand der irisch-katholischen Bevölkerung, die britische und protestantische Siedler massakrieren wollte. Man schickte Kommandanten wir Sir Charles Coote und William St. Leger (beides protestantische Siedler), um die Bevölkerung wieder unter Kontrolle zu bringen, was allerdings in Übergriffen gegen irische Zivilisten mündete.
Zwischenzeitlich führte das Zusammenbrechen der staatlichen Autorität in Ulster ebenfalls zu Angriffen von irischen Einwohnern auf englische und schottische Siedler. Phelim O’Neill und die anderen aufständischen Führer versuchten diese Übergriffe zu verhindern, doch kamen sie nicht gegen die ethnisch motivierte und Jahrzehnte lang unterdrückte Landbevölkerung an. Im Laufe der nächsten Monate griff diese Gewalt auf die ganze Insel über. Viele irische Lords, die Land verloren hatten oder eine Enteignung befürchteten, traten der Rebellion bei und halfen bei den Übergriffen auf protestantische Siedler. Je länger die Rebellion dauerte, desto gewalttätiger wurden die Übergriffe. Wo anfangs nur Prügel und Räubereien herrschten, brannten später Häuser und am Ende wurde gemordet - dies vor allem in Ulster. Der schlimmste Zwischenfall ereignete sich in Portadown, wo dessen protestantische Einwohner zusammengetrieben und auf der Brücke der Stadt massakriert wurden.
Die Zahl der getöteten Protestanten in diesen frühen Monaten der Rebellion ist umstritten. Parlamentarische Pamphlets aus dieser Zeit sprechen von über 100.000 Siedlern, die ihr Leben verloren haben sollen - doch neuere Untersuchungen gehen stark davon aus, dass die tatsächliche Anzahl viel geringer ist. Man vermutet, dass während der gesamten Rebellion bis zu 12.000 Protestanten getötet wurden - die meisten davon starben durch Kälte oder durch Krankheiten, nachdem sie mitten im Winter aus ihren Häusern vertrieben wurden.
Die Verbitterung, die diese Taten auslöste, saß tief - Protestanten aus Ulster gedachten noch zweihundert Jahre später dem Jahrestag der Rebellion (23. Oktober). Bilder dieser Gräueltaten finden sich noch heute im Banner des Oranier-Ordens. Auch heute noch sehen viele die damaligen Taten als Beispiel eines Völkermords. Moderne Historiker betonen, dass die Rebellion von 1641 einen überwältigenden psychologischen Einfluss auf die protestantischen Siedler hinterlassen hat. Während sich vor der Rebellion die Beziehungen zwischen Protestanten und Katholiken eher verbesserten, war das Vertrauen zwischen beiden Bevölkerungsgruppen nach der Rebellion dahin. Im Gegenteil, viele Siedler rächten sich genauso gewalttätig an den katholischen Iren, wenn sie Gelegenheit dazu bekamen. Die Ereignisse der Rebellion trennten erstmals nachhaltig Irland in zwei glaubensabhängige Lager - eine Trennung, die noch heute in Nordirland spürbar ist.
Durch den Ausbruch des englischen Bürgerkriegs im Jahr 1642 waren keine weiteren englischen Truppen verfügbar, um die Rebellion vollständig unter Kontrolle zu bringen, und so beherrschten die Rebellen weite Teile Irlands. Die katholische Mehrheit gründete daraufhin die Konföderation Irland (1642 bis 1649) und beherrschte diese während der folgenden Kriege der drei Königreiche in Britannien und Irland. Das konföderierte Regime verbündete sich mit Karl I sowie den englischen Adligen - bis 1649 gab es allerdings keinen formellen Vertrag zwischen ihnen. Hätten die Royalisten den englischen Bürgerkrieg gewonnen, wäre ein autonomer katholisch-irischer Staat vermutlich das Ergebnis gewesen. Doch die Royalisten wurden von den Parlamentariern geschlagen und Karl I hingerichtet. Damit war der Weg frei für Oliver Cromwell, der von 1649 bis 1653 Irland zurückeroberte. Diese Rückeroberung durch Cromwell war äußerst brutal und geprägt von Gräueltaten wie dem Massaker der royalistischen Garnison bei den Belagerungen von Drogheda im Jahr 1649. Schlimmer noch war die Politik der verbrannten Erde zur Unterdrückung der irischen Guerillakämpfer, die eine landesweite Hungersnot auslöste. Zahlreiche gefangen genommene Aufständische wurden als Sklaven in die Karibik verschifft, während ein erheblicher Teil der gälischstämmigen Grundbesitzer enteignet wurde. Da die Englische Republik Probleme bei der Besoldung ihrer Truppen hatte, bot sie ihren Soldaten als Entschädigung Grundstücke in Irland an. Auf diese Weise kam es zur Niederlassung von mehreren Zehntausend parlamentarischen Veteranen in Irland, die vor allem in Ulster siedelten. Dabei handelte es sich um Angehörige der New Model Army, die mehrheitlich überzeugte Puritaner waren. Viele der enteigneten Iren sahen sich gezwungen, ihr Leben als Outlaws (Gesetzlose) zu bestreiten.
Als Bestrafung für die Rebellion von 1641 wurden nahezu alle Ländereien im Besitz von irischen Katholiken enteignet und britischen Siedlern vermacht. Die verbleibenden katholischen Landbesitzer wurden durch den Act for the Settlement of Ireland 1652 nach Connacht umgesiedelt - aus dieser Zeit stammt die Redewendung To hell or to Connacht („In die Hölle oder nach Connacht“). Zusätzlich wurden Katholiken zum Beispiel vom irischen Parlament ausgeschlossen, es war ihnen verboten in Städten zu leben und Protestanten zu heiraten - aber nicht alle diese Regeln wurden strikt durchgesetzt. Zu dieser Zeit starb bis zu einem Drittel der irischen Bevölkerung (400.000 bis 600.000 Menschen).
Mit der Stuart-Restauration in England kam Irland zu einem unruhigen Frieden. Karl II. versuchte vereinzelt katholische Iren durch Ländereien und Ausgleichszahlungen zu beschwichtigen, zum Beispiel durch den Act of Settlement 1662. 1678 kam es durch den sog. Popish Plot zu einem kurzen Aufflackern von anti-katholischen Ausschreitungen. Der popisch plot war eine, vom geistlichen Titus Oates enthüllte, vermeintliche katholische Verschwörung zur Ermordung von König Karl II. und zur Einsetzung von dessen katholischen Bruders Jakob II. Nonkonformisten unterstützten daraufhin die anglikanische Whig-Partei, der eine große Mehrheit im englischen Unterhaus gewann und 1679 die sogenannte „Exclusion Bill„ verabschiedete, um James den Anspruch auf den Thron zu verwehren. Die Gesetzesvorlage scheiterte schließlich im Oberhaus und es wurde bekannt, dass Oates die angebliche Verschwörung erfunden hatte um die Katholiken in England in Misskredit zu bringen.
Doch bereits eine Generation nach Beginn der Stuart-Restauration wurde die irische Insel zum erneuten Schlachtfeld eines Krieges, als während der glorreichen Revolution im Jahr 1689 der katholische König Jakob II. durch das englische Parlament abgesetzt und durch Wilhelm III. (Wilhelm von Oranien) ersetzt wurde. Während die irischen Katholiken James unterstützten, um die bereits bestehenden Penal Laws und Landenteignungen aufzuheben, kämpften die protestantischen Siedler für die Erhaltung der englischen Macht in Irland. Richard Talbot, von James II. als sein Stellvertreter in Irland ernannt, bildete aus katholischen Iren eine Jakobiten-Armee und besetzte alle strategisch wichtigen Punkte in Irland, mit Ausnahme von Derry, das direkt von seinen Männern belagert wurde.
James, unterstützt vom französischen König Ludwig XIV, landete am 12. Mai 1689 mit französischen Truppen in Irland nahe Kinsale - Wilhelm III. erreichte Irland mit einer multinationalen Armee im gleichen Jahr. Die beiden Könige kämpften im Krieg der zwei Könige um den englischen, schottischen und irischen Thron. Letztendlich wurde die Jakobiten-Armee besiegt, konnte das Land im Rahmen des Vertrags von Limerick aber verlassen. Obwohl der Krieg nicht so zerstörerisch war, wie der in den 40er und 50er Jahren dieses Jahrhunderts, bildete er aber eine herbe Niederlage für die irischen Landbesitzer, die niemals mehr ihrer frühere Position innerhalb der irischen Gesellschaft zurückerhalten sollten.
Die Protestanten (die nur geschätzte 20 bis 25 % der irischen Bevölkerung stellten) lehnten den relativ liberalen Vertrag von Limerick als fahrlässige Milde gegenüber den „papistischen Rebellen“ ab und trachtete danach, dessen „Versäumnisse“ auf gesetzlichem Wege zu beseitigen. In der Folge (insbesondere von 1695 bis 1709) wurden deshalb einer Reihe antikatholischer Gesetze erlassen, die heute als die Penal Laws („Strafgesetze“) bekannt sind. Abgesehen von einigen Ausnahmen richteten sich diese Gesetze gegen die katholische Kirche und die katholische Oberschicht, betrafen die einfache katholische Bevölkerung jedoch kaum.
Den Auftakt für diese Benachteiligungen bildete bereits das Jahr 1691, als ein Gesetz des englischen Parlaments Katholiken aus allen Staatsämtern, dem Parlament, den Universitäten und dem Militär - in England und auch in Irland - ausschloss. Die Penal Laws des irischen Parlaments begannen 1695, als Katholiken verboten wurde, Waffen und kriegstaugliche Pferde zu besitzen, die katholischen Schulen in Irland geschlossen wurden, und Eltern zudem untersagt wurde, ihre Kinder am Kontinent ausbilden zu lassen. 1697 wurden Katholiken weitgehend aus den Rechtsberufen ausgeschlossen. Im gleich Jahr wurden Bischöfe und Ordensklerus des Landes verwiesen und deren Einreise verboten. 1704 wurde auch die Einreise von Weltgeistlichen verboten, die sich bereits im Land befindlichen mussten sich registrieren lassen. Ab 1697 konnten Katholiken kein protestantisches Land durch Heirat, Erbe oder Vormundschaft übernehmen, ab 1704 wurde ihnen auch jeglicher Kauf und die Langzeitpacht untersagt. Außerdem durften sie ihre Güter nicht mehr einem Sohn ungeteilt vererben sondern mussten sie auf alle Söhne aufteilen, wodurch der Besitz zerstückelt werden sollte. Trat jedoch der älteste Sohn zur anglikanischen Kirche über, erbte er den gesamten Besitz ungeteilt, ja mehr noch, konvertierte er zu Lebzeiten des Vaters erhielt er den Besitz sofort und der Vater wurde zum Pächter auf Lebenszeit degradiert. Eines der wenigen Penal Laws das nach 1709 erlassen wurde, war der Entzug des passiven Wahlrechts 1728.
Zu beachten ist jedoch, dass zwischen dem Text der Penal Laws und deren Umsetzung ein gravierender Unterschied bestand. Was etwa die Kirche betrifft, so hätte die Kombination aus Ausweisung der Bischöfe (Priesterweihe!) und Einreiseverbot für Geistliche das Aussterben der katholischen Kirche innerhalb einer Generation zur Folge haben müssen. In der Realität bot sich hingegen ein völlig gegensätzliches Bild. Abgesehen von sporadischer Anwendung, insbesondere in den ersten beiden Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts, verkamen die Gesetze mehr und mehr zu einer stillen Drohung, die sicherlich nicht vollkommen ohne Wirkung blieb, die Kirche aber keineswegs daran hinderte, sich überraschend rasch zu konsolidieren. Die Gesetze gegen Landbesitzer wurden länger angewendet, was dazu geführt hat, dass die Klasse des katholischen Landbesitzers für das 18. Jahrhundert als beinahe ausgestorben (5%) galt. Jedoch weist einiges darauf hin, dass auch hier die Auswirkungen der Gesetze um einiges geringer waren, als man annehmen könnte und bisher auch annahm. Katholische Landbesitzer bewiesen offenbar ein erstaunliches Geschick darin, einen Teil der Maßnahmen durch halblegale und illegale Mittel (etwa die Abwicklung von Geschäften über protestantische Strohmänner) abzufedern. Zwar muss davor gewarnt werden, die behindernden und demütigenden Maßnahmen gegen die katholische Oberschicht zu sehr zu verharmlosen, die wirtschaftliche Realität bewegte sich jedoch fern des schwarz-weiß-malerischen Images einer Zweiteilung der irischen Gesellschaft in ausbeuterische protestantische Landbesitzer auf der einen und in unterdrückte, katholische Bauern auf der anderen Seite.
Zur tatsächlichen Aufhebung zahlreicher Penal Laws kam es gegen Ende des Jahrhunderts, im Umfeld von Amerikanischem Unabhängigkeitskrieg und Französischer Revolution, einzelne Benachteiligungen hatten jedoch bis ins 19. Jahrhundert Bestand.
Im späten 18. Jahrhundert sah ein Großteil der protestantischen Elite Irland als ihr Heimatland an. Eine parlamentarische Fraktion unter Henry Grattan strebten nach einer verbesserten Handelsbeziehung zu England und vor allem nach der Aufhebung der Strafzölle, die auf irische Produkte in England erhoben wurden. Seit dem frühen 18. Jahrhundert kämpften die Parlamentarier auch für eine legislative Unabhängigkeit des irischen Parlaments, vor allem die Zurücknahme des sog. Poyning's Law, das es dem englischen Parlament erlaubte legislative Gewalt in Irland auszuüben. Viele der Forderungen wurden 1782 erfüllt, als der Freihandel zwischen England und Irland eingeführt und Poyning's Law abgeschafft wurde.
Als Instrument für die Schaffung der Reformen gelten die Irish Volunteers des 18. Jahrhunderts (nicht zu verwechseln mit den Irish Volunteers des 20. Jahrhunderts). Die Volunteers wurden im Jahr 1778 in Belfast gegründet, um Irland gegen eine feindliche Invasion zu schützen, als ein Großteil der regulären britischen Soldaten im Zuge des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs aus Irland abgezogen wurden. Die Volunteers waren jedoch niemals der Regierung unterstellt und obwohl sie anfangs loyal gegenüber der englische Krone waren, wurden sie schnell von politischen Radikalen unterwandert. Schon 1779 hatten die Volunteers unter Lord Charlemont über 100.000 Mitglieder.
Doch die Reformen bezüglich der Katholikenemanzipation gerieten in Stocken und einige Radikale in Irland blickten auf das militärische Beispiel einer Revolution in Frankreich. Im Jahr 1791 gründete eine kleine Gruppe radikaler Presbyterianer die Society of the United Irishmen. Ursprüngliches Ziel war ein Ende der religiösen Diskriminierung und der Kampf für das Wahlrecht. Die United Irishmen war sehr bald im ganzen Land zu finden - Republikanismus war hoch aktuell zu dieser Zeit, vor allem in den presbyterianischen Gemeinden in Ulster, die ebenfalls wegen ihrer Religion diskriminiert wurden, und die enge Bande zu sog. schottisch-irischen Amerikanern (Scots-Irish American) pflegten, die gegen England während der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung kämpften. Auch viele unterdrückte Katholiken, insbesondere in den mittleren Klassen, identifizierten sich mit dieser Idee.
1793 unternahm die Regierung in London mit der Aufhebung vieler penal laws den Versuch, die radikal-republikanische Bewegung in Irland zu stoppen und 1795 unterstützte die Regierung den Bau der katholischen Universität in Maynooth. Doch all diese Maßnahmen konnten die Situation in Irland nicht beruhigen, da nun auch die ultra-loyalistischen Protestanten unzufrieden waren, dass die Unterdrückung der anderen Glaubensrichtungen gelockert wurden. Dies führte im gleichen Jahr zur Gründung des Oranier-Ordens.
Die United Irishmen, die nun eine bewaffnete Revolution planten, knüpften Verbindungen mit der militanten katholischen Gruppe Defenders, während Wolfe Tone nach Frankreich reiste, um (erfolgreich) für eine militärische Unterstützung zu werben. Im Dezember 1796 erreichte eine französische Armee, 15.000 Mann stark, die Bucht von Bantry. Die Landung schlug allerdings wegen Unentschlossenheit, schlechter Seemannskunst und permanentem Sturm fehl.
Zwischenzeitlich versuchte die Regierung, die United Irishmen mit radikaleren Mitteln wie Folter, Hinrichtungen und Verlegung in Straflager zu stoppen. Da die Gegenwehr der Regierung immer mehr zunahm, gingen die United Irishmen dazu über, die Revolte ohne französische Hilfe zu starten. Die ersten Scharmützel der Irischen Rebellion von 1798 fanden am 24. Mai 1798 statt. Als der zentrale Punkt des Plans - die Übernahme von Dublin - fehlschlug, weitete sich die Rebellion, scheinbar planlos, auf das restliche Land aus; zuerst rund um Dublin, dann in den Grafschaften Kildare, Meath, Carlow und Wicklow. Die längsten Kampfhandlungen wurden in der Grafschaft Wexford ausgetragen. Eine kleine Gruppe französischer Soldaten landete in den Killala Bay in der Grafschaft Mayo; dies führte ebenfalls zum Ausbruch der Rebellion in den Grafschaften Leitrim und Longford. Obwohl die Rebellion nach nur drei Monaten niedergeschlagen wurde, kostete sie zirka 30.000 Menschenleben.
Das Ziel der Rebellion, eine glaubensunabhängige Gesellschaft, wurde nicht erreicht - im Gegenteil: Gräueltaten gegen Andersgläubige (auf beiden Seiten) rückten das Ziel in weite Ferne. Regierungstruppen und die Miliz töteten wahllos Katholiken und auch die Rebellen töteten bei diversen Übergriffen unbeteiligte loyalistisch-protestantische Zivilisten.
Teilweise in Reaktion auf die Rebellion wurde die unabhängige irische Regierung am 1. Januar 1801 mit dem Act of Union komplett abgeschafft und Irland dem Königreich Großbritannien angeschlossen, das von nun an Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland genannt wurde. Das irische Parlament, dominiert von anglikanischen Grundbesitzern, wurde gezwungen, für seine eigene Auflösung zu stimmen. Die katholischen Bischöfe, die Gegner der Rebellion waren, unterstützten die Union mit England, um ihrem Ziel, der Katholikenemanzipation, nicht zu schaden.
Zeit der Rebellionen
Irland befand sich anfangs des 19. Jahrhunderts noch in den Nachwehen der Irischen Rebellion von 1798. Gefangene wurden nach wie vor nach Australien deportiert und einzelne Gewaltausbrüche hielten an (vor allem in der Grafschaft Wicklow). Im Jahr 1803 gab es eine weitere erfolglose Rebellion, die von Robert Emmet angeführt wurde. Durch den Act of Union wurden 1801 Irland und das Königreich Großbritannien per Gesetz zum Vereinigten Königreich von Großbritannien und Irland zusammengeschlossen. Dies war der Versuch der englischen Krone, zu verhindern, dass Irland als Basis für eine Invasion Großbritanniens agieren könnte.
Während dieser Zeit wurde Irland von englischen Obrigkeiten regiert. Diese waren der Lord Lieutenant of Ireland, der durch den König eingesetzt wurde sowie der Chief Secretary for Ireland, der vom britischen Premierminister bestimmt wurde. Im Laufe des 19. Jahrhunderts übernahm das britische Parlament vom Monarchen sowohl den exekutiven als auch den legislativen Zweig der Regierung. Aus diesem Grund wurde der Chief Secretary wichtiger als der Lord Lieutenant, der eine eher symbolische oder repräsentative Rolle einnahm. Nach der Abschaffung des irischen Parlaments, wurden die irischen Parlamentsmitglieder direkt ins britische Parlament im Palace of Westminster gewählt. Die britische Administration in Irland - euphemistisch als „Dublin Castle„ bezeichnet - blieb bis 1922 von Protestanten dominiert.
Ein Teil der Akzeptanz des Act of Union unter den irischen Katholiken war die in Aussicht gestellte Abschaffung der restlichen Penal Laws und die Schaffung der Katholikenemanzipation. Doch König Georg III. stoppte die Emanzipation, mit der Begründung, dass diese seinen Amtseid brechen würde, die anglikanische Kirche zu schützen. Erst eine Kampagne unter dem Anwalt und Politiker Daniel O'Connell und seiner 1828 gegründeten Catholic Association (Katholiken-Vereinigung) führte 1829 schließlich zur Emanzipation, die es den Katholiken erlaubte sich ins Parlament wählen zu lassen. Im Gegensatz dazu scheiterte O'Connell (zu dieser Zeit Kopf der Repeal Association - Widerruf-Bewegung) mit seinem Kampf für die Aufhebung (repeal) des Act of Union und die Wiederherstellung der eigenständigen irischen Regierung. O'Connell führte diese Kämpfe nahezu gewaltfrei und nutzte öffentliche Versammlungen um die Unterstützung zu demonstrieren.
Trotz O'Connells friedlichen Methoden gab es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einiges an Gewalt und Unmut unter der Bevölkerung. In der Provinz Ulster brach wiederholt Gewalt gegen Andersgläubige aus, wie zum Beispiel in der so genannten Schlacht von Dollys Brae am 12 Juli 1849, als bei einem Marsch des Oranier-Ordens mindestens 30 Katholiken ums Leben kamen. Auch die Ungleichheiten zwischen der stark anwachsenden armen Landbevölkerung auf der einen Seite und ihren Landlords sowie dem Staat auf der anderen führten zu sozialen Spannungen. Geheime (meist ländliche) Organisationen wie die Whiteboys oder die Ribbonmen nutzten Sabotage und Gewalt, um die Landlords zur besseren Behandlung ihrer Untergebenen zu zwingen. Der wohl nachhaltigste Ausbruch von Gewalt war der Zehnt-Krieg in den 1830er Jahren, als sich die irischen Katholiken weigerten, den obligatorischen Zehnt an den anglikanischen Klerus zu zahlen. Als Reaktion auf diese Gewalt wurde die Royal Irish Constabulary gegründet, eine Polizeieinheit für die ländlichen Gegenden.
Irland erlebte im 19. Jahrhundert diverse extreme wirtschaftliche Höhen und Tiefen; vom ökonomischen Boom während der Napoleonischen Kriege bis hin zur großen Hungersnot in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, während der zirka eine Million Menschen starben und eine weitere Million auswanderte.
Die wirtschaftlichen Probleme Irlands waren zu einem großen Teil auf die Strukturen des Landbesitzes zurückzuführen: Die Ländereien gehörten einigen wenigen Landlords, während die Bevölkerungsmehrheit als Pächter in Armut lebte und gegenüber ihren Grundbesitzern wenig Rechte hatte. Bevölkerungswachstum und Erbteilung führten zur immer weitergehenden Aufsplitterung der Pachtlandstücke. Zusätzlich wurden die Anwesen, von denen die Bauern ihren Boden pachteten, oft schlecht von nicht in Irland lebenden absentee landlords geführt und waren mit hohen Hypotheken belastet. Andere Faktoren waren das nahezu vollständige Fehlen einer Transport-Infrastruktur (in den Jahren vor der Hungersnot gab es in Irland keine Kanäle und gerade einmal zirka 10 km Eisenbahngleise rund um Dublin) und das weitgehende Fehlen von Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft.
Als 1845 und in den darauffolgenden Jahren die Kartoffelfäule die Insel heimsuchte, verloren die Armen und damit die Bevölkerungsmehrheit in Irland ihr Hauptnahrungsmittel. Die englische Regierung - zunächst unter Premierminister Robert Peel, später unter Lord John Russell - handelte daraufhin strikt nach den laissez-faire-Prinzipien, die beinhalteten, dass jede Einmischung des Staates in die Wirtschaft und damit in den Nahrungsmittelhandel untersagt war. Öffentliche Hilfsprogramme in Irland wurden ausgearbeitet, erwiesen sich jedoch als ungenügend, und so geriet die Situation außer Kontrolle, als Epidemien von Typhus, Cholera und Ruhr auftraten. Auch Hilfsgelder und -güter aus der ganzen Welt konnten nicht mehr retten, was die Untätigkeit der britischen Regierung ausgelöst hatte - die Klasse der Farmarbeiter wurde nahezu ausgelöscht.
Eine kleine republikanische Organisation mit dem Namen Young Irelanders (Junge Irländer) versuchte 1848, eine Rebellion gegen die britische Herrschaft zu starten. Das Resultat war lediglich eine kleine Auseinandersetzung (spöttisch die „Schlacht im Kohlfeld der Witwe McCormack“, the battle of widow McCormack's cabbage patch genannt) mit der Polizei, die schnell unter Kontrolle gebracht wurde.
Die Hungersnot trieb zu dieser Zeit die erste Welle Auswanderer in die USA sowie nach England, Schottland, Kanada und Australien. Durch die andauernden politischen Spannungen zwischen den USA und Großbritannien finanzierte und ermutigte die große und einflussreiche irisch-amerikanische Diaspora die irische Unabhängigkeitsbewegung. 1858 wurde die Irish Republican Brotherhood (IRB - auch als die Fenier (Fenians) bekannt) gegründet, eine geheime jesuitische Gesellschaft, die sich dem bewaffneten Kampf gegen die Briten verschieben hatte. Eine ähnlich ausgerichtet Gruppe in New York mit dem Namen Clan na Gael organisiert diverse Raubüberfälle in das von Briten dominierte Gebiet von Kanada. Obwohl die Fenier in den ländlichen Gebieten sehr präsent waren, erwies sich der Fenieraufstand 1867 als Fiasko und wurde schnell von den Polizeieinheiten im Keim erstickt. Aufgrund der scharfen Gesetzen gegen Aufruhr und Volksverhetzung war die Unterstützung für die republikanische Bewegung auf einem Tiefstand; noch bis in die 1860er Jahre endeten Versammlungen von irischen Nationalisten mit dem Singen von „God Save the Queen“ und königliche Besuche in Irland wurden von jubelnden Menschenmassen begleitet.
Nach der Hungersnot hatten hunderttausende irische Bauern und Arbeiter das Land verlassen oder waren umgekommen. Diejenigen, die übrig blieben, begannen allmählich für mehr Rechte und eine Umverteilung des Landes zu kämpfen. Diese Periode der irischen Geschichte ist in Irland auch als Land War („Krieg um Land“) bekannt und beinhaltete sowohl nationalistische als auch soziale Ziele. Grund dafür war, dass die Klasse der Landbesitzer in Irland seit den Plantations im 17. Jahrhundert nahezu vollständig aus protestantischen Siedlern mit englischen Wurzeln bestand. Die irische (römisch-katholische) Bevölkerung war weitestgehend der Ansicht, dass das Land ungerechtfertigt von ihren Ahnen enteignet wurde. Die Irish Land League wurde gegründet, um die Interessen der Farmer zu vertreten. Die erste Forderung waren die „Drei F's“: faire Pacht, freier Verkauf und Festschreibung des Pachtzinses. Als man das Potential zur Mobilisierung der Massen erkannte, wurden nationalistische Führer wie Charles Stewart Parnell in diesen Bewegungen aktiv.
Die wohl effektivste „Waffe“ der Land League war der Boykott (das Wort hat hier seinen Ursprung): Unpopuläre Landlords wurden von der ansässigen Gemeinschaft geächtet. Die Basis der Land League setzte auch Gewalt gegen die Landlords und deren Besitz ein - versuchte Vertreibungen von Pächtern endeten regelmäßig in bewaffneten Auseinandersetzungen. Der britische Premier Benjamin Disraeli stellte Irland unter eine Art Kriegsrecht, um die Gewalt einzudämmen. Parnell, Michael Davitt und andere Anführer der Land League wurden zeitweise inhaftiert, da man sie als Anstifter zur Gewalt sah.
Letztendlich wurde die „Landfrage“ durch schrittweise eingeführte Irish Land Acts gelöst, die von der britischen Regierung eingebracht wurden - angefangen 1870 mit dem Gesetz von William Gladstone, das den Farmern erstmals erweiterte Rechte zusicherte. Gladstone war es auch, der die Irish Land Commission einrichtete, die Land von den Landlords aufkaufte und es den Bauern übertrug. Dies führte auf dem Land zur Entstehung einer neuen, großen Klasse von Kleingrundbesitzern und zerteilte die Macht der alten anglo-irischen Landbesitzer. Doch trug dies nicht zur Beendigung der Unterstützung des irischen Nationalismus bei, so wie die britische Regierung gehofft hatte.
Bis in die 1870er Jahre hinein wählten die Iren liberale und konservative Politiker britischer Parteien als ihre Vertreter in das britische Parlament in Westminster. Lediglich eine kleine Minderheit wählten irische Unionisten. 1873 gründete der ehemalige konservative Anwalt und Mitglied des Oranier-Ordens und nun nationalistische Kämpfer Isaac Butt die moderate nationalistische Bewegung Home Rule League. Nach dessen Tod im Jahr 1879 wurde William Shaw neuer Anführer und wandelte zusammen mit dem jungen protestantischen Landbesitzer Charles Stewart Parnell, der die Nationalist Party anführte, die Home Rule Bewegung 1882 mittels Umformierung in die Irish Parliamentary Party (IPP) in eine einflussreiche politische Kraft. Der wachsende Zuspruch der Partei zeigte sich bereits 1880, als die Home Rule League 63 Sitze (2,8 %) gewann. Bei der Wahl im Jahr 1885 erreichte die Partei bereits 86 Sitze (6,9 %) - einen davon in der stark von Iren bewohnten englischen Stadt Liverpool. Diese Anzahl an Sitzen konnte die Partei bis in die 1910er Jahre halten.
Parnells Bewegung kämpfte für das Recht auf Selbstbestimmung und die Möglichkeit einer eigenständigen irischen Regierung innerhalb des Vereinigten Königreichs. Dies stand im Gegensatz zu Daniel O'Connell, der eine vollständige Rücknahme des Act of Union forderte. Unter dem liberalen Premierminister William Gladstone wurden zwei Home Rule-Gesetzesvorschläge (1886 und 1893) eingebracht, doch keinen der beiden konnte er durchsetzen. Die Frage der Home Rule teile die Insel: Eine nationale Minderheit von Unionisten (großteils, aber nicht ausschließlich aus Ulster) war gegen Home Rule, da sie fürchtete, dass ein von Katholiken und Nationalisten dominiertes irisches Parlament in Dublin sie diskriminieren könnte.
1892, ein Jahr nach Parnells Tod, teilte dessen Scheidungsskandal die Bewegung und das ganze Land, als bekannt wurde, dass Parnell jahrelang eine Affaire mit der Frau eines Parteimitglieds hatte. Obwohl die Partei nie aufgesplittet wurde, war sie intern doch in zwei Lager gespalten (Pro- oder Anti-Parnell) und kämpfte bis 1899, als sie unter John Redmond wieder vereint wurde, mit jeweils eigenen Kandidaten um die Sitze.
1912, auf dem Höhepunkt der IPP wurde eine dritte Home Rule Bill eingebracht, die im britischen Unterhaus bewilligt, im Oberhaus aber abgelehnt wurde (wie schon der Gesetzesvorschlag aus dem Jahr 1893). Doch im Gegensatz zur zweiten Home Rule Bill hatten das Oberhaus zwischenzeitlich nicht mehr die Macht, einen vom Unterhaus bewilligten Gesetzesvorschlag zu blockieren, sondern lediglich die Möglichkeit diesen (bis zu zwei Jahre) zu verzögern. Während dieser zwei Jahre stand Irland am Rande eines Bürgerkriegs, da sich die Fronten zwischen den Befürwortern und den Gegnern der Home Rule verschärften. Bewaffnete Gruppen wie die Ulster Volunteer Force oder die Irish Volunteers wurden gegründet und präsentierten ihre Stärke (und Bewaffnung) auch durch öffentliche Paraden.
Obwohl Nationalismus die irische Politik Anfang des 20. Jahrhunderts dominierte, führten diverse soziale und wirtschaftliche Probleme dazu, dass immer neue Krisenherde auftraten. Dublin galt auf der einen Seite als prächtig und wohlhabend, hatte auf der anderen Seite aber auch die wohl schlimmsten Slums im British Empire. In Dublin gab es auch einen der weltgrößten Rotlichtbezirke, Monto genannt nach dem zentralen Punkt, der Montgomery Street (heute Foley Street) im Nordteil der Stadt.
Die Arbeitslosigkeit in Irland war hoch und Lohn sowie Arbeitsbedingungen waren oft sehr schlecht. Um diesem Missstand zu begegnen entstanden unter sozialistischen Aktivisten wie James Larkin oder James Connolly die ersten Gewerkschaften auf Verbandsebene. In Belfast fanden 1907 unter Larkin erbitterte Streiks von 10.000 Hafenarbeitern statt. Dublin erlebte 1913 einen noch größeren Streik, als während des Dublin Lockout 20.000 Arbeiter gefeuert wurden oder streikten, weil sie Mitglieder von Larkins Gewerkschaft ITGWU (Irish Transports and General Workers Union) waren. Drei Menschen starben während der Unruhen und viele weitere wurden verletzt. Während des Lockout gründete Larkin die Irish Citizen Army (die 1916 auch am Osteraufstand teilnahm) um die streikenden Arbeiter vor der Dublin Metropolitan Police sowie vor Streikbrechern zu schützen.
Im Mai 1914 konnte die Home Rule durch das britische Oberhaus nicht mehr verhindert werden, doch der Ausbruch des ersten Weltkriegs verzögerte die Durchsetzung - zunächst auf 1915, da man von einem kurzen Krieg ausging. Viele der Mitglieder der Ulster Volunteer Force und der Irish Volunteers traten während des Krieges der britischen Armee bei und kämpften zum Beispiel in der 36. (Ulster) Division, der 10. (Irish) Division oder der 16. (Irish) Division. Sie kämpften vornehmlich an der Westfront, Gallipoli und im Nahen Osten. Man nimmt an, dass 30.000 bis 50.000 Iren während des Krieges umkamen. Beide Gruppen nahmen an, dass die britische Regierung nach dem Krieg dem Ansinnen der jeweiligen Gruppierung zustimmen würde, wenn sich deren Mitglieder im Krieg loyal zeigten.
Noch vor dem Ende des Weltkrieges unternahm Großbritannien zwei Versuche, die aufgeschobene Home Rule Bill einzuführen (einen im Mai 1916, den anderen 1917/18), doch die irischen Nationalisten und Unionisten konnten sich nicht auf einen zeitweisen oder permanenten Ausschluss von Ulster bezüglich der Bill einigen.
Vorher sorgte die Kombination aus der aufgeschobenen Home Rule Bill und der Beteiligung Englands an einem großen Krieg („Englands Schwierigkeiten sind Irlands Chancen“ - eine Aussage der Republikaner) dafür, dass radikale nationalistische Gruppierungen ihre Chance in physischer Gewalt sahen. Ein beachtlicher Teil der Irish Volunteers war mit dem Dienst der irischen Nationalisten in der britischen Armee äußerst unzufrieden und aus ihren Reihen wurde zusammen mit der Irish Republican Brotherhood 1916 ein bewaffneter Aufstand geplant.
Aufgrund interner Zerstrittenheiten unter den Anführern der Volunteers konnte jedoch nur ein kleiner Teil (zirka 1500) für die Rebellion mobilisiert werden, die an Ostern 1916 unter Patrick Pearse und James Connolly begann. Zu Beginn des Aufstands wurde vor dem Hauptpostamt (GPO) in Dublin eine unabhängige irische Republik ausgerufen. Nach knapp einer Woche erbitterten Kampfes wurde die Rebellion schließlich niedergeschlagen. Die Opfer des Aufstands sind schwer abzuschätzen. Man geht davon aus, dass zirka 500 britische Soldaten ihr Leben ließen. Auf Seiten der Iren (einschließlich Zivilisten) dürfte es doppelt so viele Opfer gegeben haben. Der materielle Schaden innerhalb der großteils zerstörten Stadt wurde auf 2.500.000 Pfund beziffert.
Während des Aufstands war die Unterstützung der Rebellen durch die Zivilbevölkerung eher gering, was sich im Anschluss an die Rebellion jedoch ändern sollte, als die britische Regierung ohne wirkliche Gerichtsurteile die Rebellenführer (unter anderem Patrick Pearse und Thomas J. Clarke) hinrichten ließ. Eamon de Valera, der auch am Aufstand beteiligt war, rettete nur Glück sowie seine amerikanische Herkunft das Leben. Diese Massenhinrichtungen führten zu einem starken Anstieg der Sympathie für die Rebellen und die nationalistischen Bestrebungen.
Die Regierung und die irischen Medien beschuldigten (fälschlicherweise) zuerst Sinn Féin, die Rebellion initiiert zu haben, dann später eine kleine monarchistische Partei, mit nur geringer Basis. Eamon de Valera und andere hochrangige Überlebende der Rebellion traten nach der Rückkehr aus dem Gefängnis allerdings in großer Anzahl Sinn Féin bei, radikalisierten das Programm und übernahmen die Anführerschaft.
Bis 1917 kämpfte Sinn Féin unter ihrem Gründer Arthur Griffith für ein unabhängiges Irland, allerdings in Form einer Doppelmonarchie unter einem gemeinsamen Monarchen mit Großbritannien. Als Vorbild galt die Doppelmonarchie von Österreich-Ungarn. Dagegen standen die Bestrebungen von de Valera, der eine komplett eigenständige irische Republik anstrebte. Diese Frage teilte die Partei intern in zwei Lager.
Bei der Parteiversammlung (Ard Fheis) 1917 schlossen beide Lager schließlich einen Kompromiss: Man entschied sich, für eine eigene Republik zu kämpfen und wollte, sollte dieses Ziel erreicht sein, einen Volksentscheid ansetzen, der zwischen Republik und Monarchie entscheiden sollte. Im Fall eine Monarchie hätte dies allerdings kein Mitglied der britischen Königsfamilie werden dürfen.
Von 1917 bis 1918 kämpften Sinn Féin und die Irish Parliamentary Party einen sehr verbitterten Wahlkampf - jede der beiden Parteien gewann und verlor einzelne Nachwahlen. Sinn Féin erlangte schließlich einen Vorteil, als die britische Regierung versuchte, die Wehrpflicht in Irland einzuführen, um so Soldatennachschub für ihren Weltkriegseinsatz zu sichern. Dies brachte die irische Bevölkerung gegen Großbritannien auf und führte schließlich zur sog. Wehrpflichtkrise (Irland) (Conscription Crisis).
Bei der Wahl 1918 gewann Sinn Féin 73 von 105 Sitzen - viele davon ohne Gegenkandidaten. Die neugewählten Parlamentarier von Sinn Féin weigerten sich aber, ihren Sitz im britischen Parlament (als Member of Parliament - MP) in Westminster einzunehmen und versammelten sich stattdessen als First Dáil - einem revolutionären irischen Parlament im Mansion House in Dublin. Sie proklamierten eine Irische Republik und versuchen ein funktionierendes Regierungssystem aufzubauen.
Von 1919 bis 1921 kämpfte die Irish Republican Army (IRA) einen Guerilla-Krieg gegen die britische Armee sowie paramilitärische Polizeieinheiten, wie die Black and Tans oder die Auxiliary Division. Beide Seiten verübten während dieses Krieges diverse Gräueltaten; die Black and Tans brannten absichtliche ganze Dörfer nieder und folterten Zivilisten; die IRA tötete Zivilisten, von denen man nur annahm, dass diese Informationen an die Briten weitergegeben hatten und brannten (aus Vergeltung) diverse historische Häuser von Anhängern der Briten ab.
Im Hintergrund versuchte die britische Regierung die Selbstregierung von Irland mittels der verschobenen Home Rule Bill von 1914 durchzusetzen. Das britische Kabinett erschuf ein neues Komitee (das Long Committee), das sich mit der Umsetzung der Bill beschäftigte. Es war allerdings sehr unionistisch ausgerichtet, da die Mitglieder des First Dáil, die Westminster boykottierten, nicht beteiligt waren. Die Beratungen mündeten schließlich in eine vierte Home Rule Bill - auch bekannt als Government of Ireland Act 1920. Der Act bevorzugte allerdings die Interessen der Unionisten aus Ulster und teilte Irland nun endgültig in zwei Gebiete: Südirland und Nordirland. Jedes Gebiet erhielt eine eigenständige Regierung, die bis auf einzelne Themengebiete (zum Beispiel Auslandsangelegenheiten, Welthandel, Währung, Verteidigung), die nach wie vor dem Parlament des Vereinigten Königreichs unterstanden, volle Machtbefugnis hatten. Das Parlament in Nordirland traf sich 1921 zur ersten Versammlung. Die erste Wahl zum südirischen Unterhaus im Jahr 1921 wurde von Sinn Féin als Wahlen zum Parlament der revolutionären Irischen Republik angesehen, die 1918 einseitig ausgerufen, aber nie anerkannt wurde. Sinn Féin gewann 124 von 128 Stimmen, doch bei der ersten Versammlung des südirischen Parlaments im Juni 1921 erschienen lediglich die vier gewählten Unionisten (die gewählten Sinn Féin Mitglieder versammelten sich stattdessen als Second Dáil), so dass von einer südirischen Regierung nicht gesprochen werden konnte.
Im Juli 1921 wurde ein Waffenstillstand zwischen britischen und irischen Delegationen ausgehandelt und das offizielle Ende des Unabhängigkeitskriegs bildete der Anglo-Irische Vertrag. Durch den Vertrag erhielte das südirische Gebiet den Status eines Dominion, ähnlich dem vom Kanada. Dies ging über das hinaus, was Ende des 19. Jahrhunderts Parnell angeboten wurde, und etwas mehr, als das, was die Irish Parliamentary Party bisher auf konstitutionellem Weg erreicht hatte. Durch diesen Vertrag wurde 1922 der irische Freistaat geschaffen, doch Nordirland hatte die Möglichkeit aus dem Vertrag auszusteigen und Teil des Vereinigten Königreiches zu bleiben, was schließlich auch passierte. Damit war die Abspaltung von Nordirland quasi vollzogen und die neue Grenze wurde durch eine neugeschaffenen Irish Boundary Commission festgelegt.
Freistaat Irland
Den unter anderem von Michael Collins und Arthur Griffith unterzeichneten anglo-irischen Vertrag, der die durch den Government of Ireland Act bereits erfolgte Teilung der Insel akzeptierte, erkannten die Minderheit im Dáil und der Präsident der Republik Éamon de Valera nicht an. Die Spaltung ging quer durch den Dáil, die Sinn Féin und die Armee (IRA). Mit einer knappen Mehrheit (64 zu 57 Stimmen) nahm der Dáil den Vertrag an und wählte Arthur Griffith zum Präsidenten. De Valera führte im darauf beginnenden irischen Bürgerkrieg die republikanischen Rebellen, den vertragsablehnenden Teil der IRA gegen die neue, reguläre irische Armee der zunächst von Griffith und Collins geführten Regierung an. Griffith starb im August 1922, und Collins wurde 10 Tage später bei einem Hinterhalt erschossen. Damit starben die zwei wichtigsten Vertragsbefürworter, was schließlich auch zu einer Wende im Bürgerkrieg führte. Die Führung der Regierung übernahm William Thomas Cosgrave, der bis 1932 die Regierung führte. Im Mai 1923 ergaben sich die republikanischen Kräfte, Stabschef Frank Aiken ordnete an, die Waffen zu vergraben, wodurch der Bürgerkrieg ein Ende fand. 1926 verließen Éamon de Valera und seine Anhänger die Sinn Féin und gründeten die neue Partei Fianna Fáil (Soldaten des Schicksals), deren Vorsitzender de Valera wurde. 1932 wurde seine Partei stärkste Kraft im irischen Parlament und de Valera wurde zum irischen Premierminister (irisch Taoiseach) gewählt. 1937 kam es unter der Regierung de Valera zur Bildung des Staates Irland durch die Annahme einer neuen irischen Verfassung (Bunreacht na hÉireann) in einem Referendum.
Im Zweiten Weltkrieg war Irland neutral. „Notstand“ - The Emergency (irisch Ré na Práinne) war der offizielle Ausdruck für eine Politik der Regierung seit dem 2. September 1939, durch den Internierungen, Presse- und Postzensur und verschiedene Kontrollen der Wirtschaftsbeziehungen und der innerstaatlichen Wirtschaft möglich waren. Deutschland und Japan hatten bis 1945 einen Botschafter im Land (Eduard Hempel). De facto gab es geheimdienstliche und militärische Kooperationen Irlands mit dem Vereinigten Königreich und den USA. Viscount Cranborne, der Staatssekretär für die Angegelegenheiten der Dominions (Secretary of State for Dominion Affairs) schrieb für das Britische Kriegskabinett eine Zusammenfassung der Irisch-Britischen Zusammenarbeit im Krieg. Geschätzt 70.000 Iren dienten bei den Westalliierten als Soldaten. Die Internierung von notgelandeten Piloten wurde verschieden gehandhabt. Der deutsche Invasionsplan „Fall Grün“ wurde im Sommer 1940 zwar überprüft aber im Zusammenhang mit dem Unternehmen Seelöwe immer weiter verschoben. Am 30. Mai 1941 bombardierte die Luftwaffe Dublin. Im praktisch unverteidigten Belfast, Nordirland, starben am Osterdienstag etwa 1.000 Bombenopfer. Viele irische Seeleute der Handelsmarine starben bis 1945 durch U-Boot-Angriffe. Gegen jüdische Flüchtlinge aus dem NS-Machtbereich versuchte sich Irland abzuschotten.
1948 trat die Republik aus dem Commonwealth aus. Irland war in dieser Zeit wirtschaftlich eher rückständig. 1973 erfolgte der Beitritt des Landes zur EG. Nach erheblichen Anpassungsschwierigkeiten kam es in den Folgejahren, nicht zuletzt aufgrund von Strukturgeldern der Europäischen Union, zu einem dauerhaften wirtschaftlichen Aufschwung. Irland erhielt den Beinamen „Keltischer Tiger“.
Nordirland
Nordirland wurde am 3. Mai 1921 durch den Government of Ireland Act 1920 als separate Einheit geschaffen, bestehend aus sechs von neun Ulster-Grafschaften: Antrim, Armagh, Down, Londonderry (unionistische Mehrheiten) sowie Fermanagh und Tyrone (leichte nationalistische Mehrheiten bei der Wahl 1918). Die restlichen drei Grafschaften (Cavan, Donegal, Monaghan) mit stärkeren nationalistischen Mehrheiten wurden ausgeschlossen. Unionisten im Nordosten unterstützten die Teilung, Nationalisten lehnten sie ab. Einige Unionisten wie Edward Carson sahen sie als Verrat an der pan-irischen Unionismus-Idee.
Der Anglo-Irische Vertrag von 1921 teilte die Insel in Nordirland und den Irish Free State. Nordirland konnte per Adresse an den König aus dem Free State austreten. Am 7. Dezember 1922 tat es dies; der König bestätigte am 13. Dezember. James Craig wurde Premierminister. Die Teilung führte zu den Troubles in Nordirland (1920 bis 1922), mit Gewalt in Belfast, wo die IRA die Teilung bekämpfte. Die Behörden schufen die Ulster Special Constabulary (ex-UVF) zur Unterstützung der Royal Irish Constabulary (RIC). Zwischen Juli 1920 und Juli 1922 starben 636 Menschen, davon 460 in Belfast (258 Katholiken, 159 Protestanten). Bloody Sunday 1921 war ein Höhepunkt. Die Gewalt ebbte 1923 nach dem Vertrag ab. Katholiken emigrierten oder fühlten sich isoliert; die neue Royal Ulster Constabulary (RUC) wurde als sektiererisch wahrgenommen.
Unter unionistischen Premierministern wie James Craig (später Lord Craigavon) etablierte sich eine Politik der Diskriminierung gegen die katholisch-nationalistische Minderheit. Lokale Wahlen wurden durch Gerrymandering manipuliert, zum Beispiel in Derry, Omagh und Fermanagh, um unionistische Kontrolle zu sichern. Das Wahlrecht begünstigte Eigentümer und Unternehmen (Plural Voting), was bis 1969 andauerte und in Großbritannien früher abgeschafft wurde. Dies führte später zur Bürgerrechtsbewegung.
Beschäftigungsdiskriminierung war weit verbreitet, besonders in Schiffbau und öffentlichem Dienst; Katholiken emigrierten stärker, was die protestantische Mehrheit festigte. 1929 wurde das Verhältniswahlrecht abgeschafft, was der Ulster Unionist Party (UUP) eine dauerhafte Mehrheit im Parliament of Northern Ireland sicherte und 50 Jahre Einparteienherrschaft ermöglichte. Nationalistische Parteien boykottierten Stormont oft; Sinn Féin war verboten und agierte über Republican Clubs.
1935 kam es zu schweren Unruhen in Belfast nach einer Orange-Order-Parade durch ein katholisches Viertel; neun Tote, über 2.000 Katholiken flohen. Die Periode war größtenteils friedlich (außer IRA-Aktivitäten, Border Campaign 1956 bis 1962), aber Katholiken fühlten sich entfremdet. Die UUP verschmolz mit der Orange Order; Katholiken waren von Ämtern ausgeschlossen. Die katholische Bevölkerungsquote sank durch Emigration, trotz höherer Geburtenraten.
Im Zweiten Weltkrieg war Belfast ein industrielles Zentrum (Schiffe, Flugzeuge), litt unter Arbeitskräftemangel und Streiks (zum Beispiel Munitionsstreik 1944). Die unzureichende Verteidigung führte zum Belfast Blitz 1941: Deutsche Luftwaffe bombardierte Docks und Harland & Wolff, tötete über 1.000, zerstörte Hälfte der Häuser. Premierminister J. M. Andrews trat zurück. Derry wurde zur Marinebasis HMS Ferret für den Atlantikkrieg; nach dem Krieg wurden U-Boote dort übergeben. Bis in die 1960er blieb die Politik stabil, aber Spannungen wuchsen durch Diskriminierung und wirtschaftliche Ungleichheit westlich des River Bann.
Die Troubles, ein ethno-politischer Konflikt, begannen Ende der 1960er und endeten konventionell mit dem Good Friday Agreement 1998, obwohl sporadische Gewalt anhielt. Premierminister Terence O’Neill versuchte Reformen, stieß auf Widerstand von Ian Paisley und Hardlinern. Die Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA) unter Austin Currie und John Hume forderte Gleichberechtigung, unterstützt von Protestanten und Studenten 1968. Zusammenstöße mit der RUC eskalierten: Burntollet Bridge Incident (Januar 1969), Battle of the Bogside (August 1969) in Derry, wo eine Apprentice Boys-Parade durch das nationalistische Bogside-Viertel führte; die RUC setzte CS-Gas ein. Unruhen breiteten sich aus, mit 1.091 Gasbehältern.
Am 14. August 1969 schickte Großbritannien die Armee; anfangs willkommen bei Nationalisten. Die Falls Curfew (Juli 1970) verschlechterte Beziehungen. Internment ohne Prozess (August 1971) führte zum Rückzug der SDLP aus Stormont und Zivilungehorsam. Bloody Sunday (30. Januar 1972) in Derry: 14 unbewaffnete Zivilisten getötet von Paras, was die IRA stärkte.
1970 spaltete sich die Provisional IRA (PIRA) von der Official IRA ab, ablehnend marxistische Tendenzen. Loyalistische Gruppen wie Ulster Defence Association (UDA) führten sektiererische Angriffe durch. 1972, das blutigste Jahr, führte Großbritannien Direct Rule ein und prorogierte Stormont. Die Northern Ireland Constitution Act 1973 löste das Parlament auf.
Das Sunningdale Agreement (Dezember 1973) schuf eine power-sharing-Regierung mit UUP, SDLP, Alliance Party und Council of Ireland; es scheiterte am Ulster Workers’ Council Strike (Mai 1974), der die Exekutive zum Kollaps brachte. Die Gewalt sank ab 1976 unter 150 Tote/Jahr, ab 1988 unter 100. Die PIRA führte Bombenanschläge in England, Europa und Nordirland durch (zum Beispiel Auto-Bomben); Loyalisten konzentrierten sich auf Katholiken („Spray Jobs“) und Strafaktionen.
1975 gab es einen kurzen PIRA-Waffenstillstand. Die Hungerstreiks 1981 (Bobby Sands gewann einen Parlamentssitz) führten zur Armalite-and-Ballot-Box-Strategie von Sinn Féin. Das Anglo-Irish Agreement 1985 verbesserte britisch-irische Kooperation, trotz unionistischen Protesten (ähnlich Ulster Covenant). Es hielt Gewalt stand, zeigte aber Unionisten die Grenzen ihrer Isolation. Margaret Thatcher bedauerte es später wegen geschädigter Zusammenarbeit gegen Republikaner.
In den 1990er Jahren erkannte die PIRA den Stillstand; Sinn Féin wuchs politisch. Unter John Major und Albert Reynolds begann der Friedensprozess mit Downing Street Declaration 1993 und Hume-Adams-Gesprächen. Der Friedensprozess intensivierte sich 1997 unter Tony Blair. David Trimble (UUP) trat Verhandlungen bei; das Belfast Agreement (Good Friday Agreement, 10. April 1998) wurde von acht Parteien unterzeichnet (ohne DUP und UK Unionist Party). Referenden am 22. Mai 1998 genehmigten es in Nordirland und der Republik, die ihre Verfassung anpasste (Nineteenth Amendment), um Ansprüche auf Nordirland aufzugeben und eine united Ireland als Aspiration anzuerkennen.
Das Agreement schuf die Northern Ireland Assembly mit power-sharing: Parteien mit ausreichender Unterstützung ernennen Minister. David Trimble wurde First Minister, Seamus Mallon (SDLP) Deputy; später Mark Durkan. UUP, SDLP, Sinn Féin und DUP hatten Minister. Die Assembly startete stop-and-go: Streitigkeiten um IRA-Entwaffnung und Spionagevorwürfe (zum Beispiel MI5-Spionage-Ring um Denis Donaldson) führten zu Suspension und Direct Rule unter Peter Hain. Königin Elizabeth II. besuchte Stormont und erkannte irische Identität an. Präsidentin Mary McAleese traf Unionisten. Dissidente Republikaner bildeten die Real IRA, verantwortlich für den Omagh Bombing (August 1998, 29 Tote); Martin McGuinness verurteilte es.
Wahlen 2003 stärkten Sinn Féin und DUP, komplizierten Restauration. Verhandlungen 2004 scheiterten an Entwaffnungsbeweisen. Die britische Wahl 2005 polarisierte weiter; Trimble verlor seinen Sitz. Am 28. Juli 2005 erklärte die IRA das Ende des bewaffneten Kampfs und den Fokus auf Politik. Operation Banner endete 2007. Das St. Andrews Agreement (Oktober 2006) brachte Fortschritt: Sinn Féin unterstützte Polizei, DUP teilte Macht. Devolution kehrte am 8. Mai 2007 zurück; Ian Paisley (DUP) und Martin McGuinness (Sinn Féin) wurden First und Deputy First Minister.
Von 2007 bis 2017 regierte die Executive: Peter Robinson folgte Paisley 2008, trat 2016 zurück; Arlene Foster wurde erste Frau als First Minister. 2017 kollabierte sie durch den Renewable Heat Incentive Scandal; Martin McGuinness trat zurück, löste Wahlen aus. Unionisten verloren die Mehrheit erstmals seit 1921 (gleichmäßige Vertretung: 39 nationalistische, 39 unionistische Sitze). DUP konnte Petition of Concern nicht mehr einseitig nutzen, zum Beispiel für Same-Sex Marriage.
Verhandlungen scheiterten; James Brokenshire verlängerte Fristen. Die britische Wahl 2017 stärkte DUP und Sinn Féin; Theresa May schloss Conservative-DUP Agreement für Minderheitsregierung, was Neutralität im Good Friday Agreement gefährdete. Streitpunkte: Irish Language Act (von Sinn Féin gefordert, DUP ablehnend). 2018 scheiterten Talks; Nordirland hatte 590 Tage ohne Exekutive (Rekord). Das Northern Ireland (Executive Formation and Exercise of Functions) Act 2018 erlaubte Beamtenentscheidungen bis März 2019.
Am 22. Oktober 2019 legalisierten Änderungen im Northern Ireland (Executive Formation etc) Act 2019 die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare sowie die Liberalisierung des Abtreibungsrechts in Nordirland. Diese Maßnahmen erhielten die königliche Zustimmung am 24. Juli 2019 und traten nur in Kraft, falls bis zum 22. Oktober keine funktionsfähige Exekutive wiederhergestellt würde. Versuche, die Assembly am 21. Oktober neu zu beleben, scheiterten, da Sinn Féin und die Alliance Party der Teilnahme verweigerten. Dadurch wurde die Legalisation umgesetzt, und Fortschritte zur Wiederherstellung von Stormont stagnierten für mehrere Monate, bis Neuwahlen wahrscheinlich wurden.
Im Februar 2020 erreichte die COVID-19-Pandemie Nordirland. Zu Beginn des ersten offiziellen Lockdowns meldete das Department of Health insgesamt 3.445 Todesfälle unter Personen, die kürzlich positiv getestet worden waren. Die Northern Ireland Statistics and Research Agency berichtete von 5.757 Fällen, in denen COVID-19 auf dem Totenschein als mögliche Ursache genannt wurde. Nordirland wies die niedrigste COVID-Todesrate pro Einwohner im Vereinigten Königreich auf. Die Statistiken waren zu Pandemiebeginn weit verfügbar; die Mehrzahl der Todesfälle betraf Personen über 60 Jahre, wobei fast die Hälfte in Pflegeheimen starb. Etwa 1 von 12 der über 5.700 Todesopfer durch die akute Infektion war unter 65 Jahre alt.
Am 23. März 2020 ging Nordirland wie der Rest des Vereinigten Königreichs in Lockdown. Eine „Bleib-zu-Hause“-Anordnung verbot „nicht-essentielle“ Reisen und Kontakte; Schulen, Unternehmen, Veranstaltungsorte, Einrichtungen und Gottesdienste wurden geschlossen. Große Ereignisse wie St. Patrick's Day wurden abgesagt. Ein längerer Lockdown wurde als schädlich für die Wirtschaft prognostiziert, mit steigender Arbeitslosigkeit. Der Gesundheitsdienst arbeitete an der Erhöhung der Krankenhauskapazitäten. Im April zeigten Modelle des Department of Health, dass der Gesundheitsdienst mit dem erwarteten Peak umgehen könne. Am 21. April erklärte der Chef-Wissenschaftsberater Nordirlands, dass die Kurve neuer Fälle abgeflacht sei und der Peak überschritten worden war.
Der Lockdown wurde schrittweise im Juni–Juli gelockert, da Infektions- und Todesraten sanken. Schulen blieben über die Sommerferien geschlossen, öffneten aber im September wieder. Die Infektionsrate (oder Positivitätsrate) stieg im September erneut an, was zu erneuten Einschränkungen führte. Am 16. Oktober ging Nordirland in einen acht-wöchigen Lockdown, wobei Schulen offen blieben und einige Einschränkungen für eine Woche gelockert wurden. Der Lockdown wurde größtenteils am 11. Dezember aufgehoben. Nach einer kurzen Lockerung über Weihnachten wurde am 26. Dezember ein weiterer Lockdown verhängt, einschließlich Schulen, da die Positivitätsrate stark anstieg. Ein umfangreiches Impfprogramm begann, und die Infektionsrate fiel Anfang 2021. Schulen öffneten im März wieder, und der Lockdown wurde ab Ende April schrittweise gelockert. Im Dezember wurde ein Nachweis der Impfung oder Nichtinfektion für den Zutritt zu Innenräumen obligatorisch.
Anfang Januar 2020 veröffentlichten die britische und irische Regierung den Text eines Abkommens zur Wiederherstellung der Machtteilung in Nordirland und zur Rückkehr zur Devolution. Die Northern Ireland Assembly und die Exekutive (die vor drei Jahren kollabiert war) nahmen am 11. Januar 2020 wieder ihre Arbeit auf, nach Unterzeichnung des Abkommens „New Decade, New Approach“ zwischen DUP und Sinn Féin sowie den britischen und irischen Regierungen und anschließend den meisten anderen Parteien.
Im April 2021 kündigte Arlene Foster ihren Rücktritt als DUP-Führerin zum 28. Mai an und beendete ihre Amtszeit als First Minister Ende Juni 2021. Am 3. Februar 2022 trat Paul Givan als First Minister zurück, was automatisch Michelle O'Neill als stellvertretende First Minister zum Rücktritt zwang und die Exekutive von Nordirland zum Kollaps führte.
Am 18. Januar 2024 führten über 100.000 Arbeiter aus dem National Health Service, Translink NI und Lehrergewerkschaften einen Streik im öffentlichen Sektor durch, um höhere Löhne zu fordern, in vielen Städten und Orten einschließlich Belfast. Am 30. Januar 2024 erklärte Jeffrey Donaldson, Führer der Democratic Unionist Party (DUP), dass die DUP eine Exekutivregierung wiederherstellen würde, unter der Bedingung, dass neues Gesetzgebung im britischen Unterhaus verabschiedet würde. Nach zwei Jahren Suspension traf sich die Northern Ireland Assembly am 3. Februar 2024 und ernannte Michelle O'Neill zur First Minister und Emma Little-Pengelly zur stellvertretenden First Minister. Dies war das erste Mal in der Geschichte Nordirlands, dass eine Republikanerin zur First Minister wurde.
Bis Oktober 2025 bleibt die Exekutive unter der Führung von Michelle O'Neill und Emma Little-Pengelly aktiv, wobei der Brexit weiterhin Auswirkungen auf Nordirland hat, insbesondere durch das Northern Ireland Protocol, das zu Spannungen führte und den DUP-Boykott von 2022 bis 2024 mitverursachte. Die Wiederherstellung der Exekutive im Februar 2024 markierte einen Meilenstein in der Machtteilung gemäß dem Good-Friday-Abkommen, mit anhaltenden Herausforderungen durch politische Veränderungen, Wahlen und wirtschaftliche Auswirkungen des Brexit, der Nordirlands besondere Handelsbeziehungen zur EU und zum Vereinigten Königreich betrifft.
Moderne Zeit
Der Freistaat Irland kam aus dem Zweiten Weltkrieg (in Irland als „The Emergency“ bezeichnet) relativ unversehrt heraus, dank ihrer strikten Neutralitätspolitik. Diese Neutralität wurde durch die Erinnerungen an den Unabhängigkeitskrieg und den Bürgerkrieg beeinflusst, sowie durch die mangelnde militärische Vorbereitung. Obwohl Irland Druck von Großbritannien und den USA ausgesetzt war, blieb es neutral, was zu Spannungen führte, aber auch Vorteile brachte: Das Land erhielt einen Kredit aus dem Marshall-Plan in Höhe von 36 Millionen US-Dollar zu günstigen Konditionen, der für Wohnungsbauprogramme, Slumräumung und die erfolgreiche Bekämpfung der Tuberkulose genutzt wurde. Wirtschaftlich litt Irland unter Importknappheit, was Rationierungen bis in die 1950er Jahre verlängerte, und die Industrieproduktion sank um 25 Prozent.
Politisch markierte der Republic of Ireland Act 1948 einen Meilenstein: Am 18. April 1949 wurde der Staat offiziell zur Republik erklärt und trat aus dem Britischen Commonwealth aus. Die diplomatischen Funktionen des britischen Monarchen wurden auf den Präsidenten übertragen, der nun unumstritten Staatsoberhaupt war. Die IRA kritisierte dies, da die Teilung der Insel und die britische Präsenz in Nordirland die Republik von 1916 nicht vollständig wiederherstellten. Irland trat 1955 den Vereinten Nationen bei, nach einer Verzögerung durch ein sowjetisches Veto.
In den 1950er Jahren stagnierte die Wirtschaft mit nur 1 Prozent jährlichem Wachstum, was zu massiver Emigration führte – etwa 50.000 Menschen verließen das Land jährlich, und die Bevölkerung sank auf ein Tief von 2,81 Millionen. Die protektionistischen Politiken der 1930er Jahre zeigten ihre Grenzen. Fianna Fáil dominierte die Politik, aber Koalitionen unter Fine Gael (mit Labour und Clann na Poblachta) regierten 1948 bis 1951 und 1954 bis 1957, ohne radikale Veränderungen. Sozialpolitisch scheiterte der Versuch von Gesundheitsminister Noël Browne, das Mother and Child Scheme einzuführen, an Opposition der Katholischen Kirche und privater Ärzte.
Bezüglich Nordirland beanspruchte die irische Verfassung von 1937 die gesamte Insel, doch der Staat lehnte bewaffnete Gruppen wie die IRA ab. Die IRA-Border-Campaign der 1950er Jahre zielte auf nordirische Sicherheitskräfte ab, worauf die Regierung IRA-Führer internierte und die Kampagne bis 1962 beendete.
Unter Taoiseach Seán Lemass (Fianna Fáil, 1959–1966), Nachfolger von Éamon de Valera, wandelte sich die Wirtschaftspolitik grundlegend. Zusammen mit Finanzsekretär T.K. Whitaker wurden Wachstumspläne umgesetzt: Investitionen in Industrieinfrastruktur, Abbau von Schutzzöllen und Steueranreize für ausländische Direktinvestitionen (FDI). Dies führte zu 4 Prozent jährlichem Wachstum von 1959 bis 1973, einer Reduzierung der Emigration und einer Steigerung des Lebensstandards um 50 Prozent auf europäisches Niveau. Soziale Reformen umfassten die Einführung der kostenlosen Sekundarbildung 1967 durch Minister Donough O'Malley. Lemass förderte auch Beziehungen zu Nordirland, mit ersten Treffen zwischen Regierungschefs seit der Teilung.
1973 trat Irland der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG, Vorläufer der EU) bei, zusammen mit dem Vereinigten Königreich und Dänemark, was Freihandel und FDI erweiterte. Politisch wechselten Fianna Fáil und Fine Gael-Labour-Koalitionen ab. Die Energiekrise der 1970er Jahre durch OPEC-Ölembargos verursachte Inflation und Haushaltsdefizite; die Fine Gael-Labour-Regierung (1973 bis 1977) kürzte Ausgaben.
Sozial veränderte die kostenlose Bildung die Gesellschaft: Höhere Qualifikationen, Urbanisierung und Massenmedien lockerten den Einfluss der Katholischen Kirche und traditioneller Parteien. Die Emigration nahm ab, die Bevölkerung stabilisierte sich.
Die Troubles in Nordirland ab 1968 wirkten sich stark aus. Unruhen in Derry und Belfast 1969 führten zu Andeutungen einer Intervention durch Taoiseach Jack Lynch, der Feldlazarette einrichtete und heimlich Waffen an Nationalisten lieferte. Minister Charles Haughey und Neil Blaney wurden deswegen angeklagt. Die Provisional IRA (PIRA) entstand und tötete 1972 über 100 britische Soldaten. Irland verwehrte britischen Truppen Grenzübertritte, setzte Gardaí und Armee gegen Paramilitärs ein und verbot republikanische Vertreter in Medien. Loyalistische Anschläge wie die Bomben von Dublin und Monaghan 1974 töteten 33. Irland diente der PIRA als Rückzugsraum, mit Sympathien in Teilen der Bevölkerung.
Die Krise Ende der 1970er verschärfte sich in den 1980er Jahren. Unter Charles Haughey (Fianna Fáil, 1979 bis 1981, 1982, 1987 bis 1992) stiegen Ausgaben auf 65 Prozent des BIP, die Staatsverschuldung von 7 Milliarden Pfund (81 Prozent des BIP) 1980 auf über 23 Milliarden (142 Prozent) 1986. Hohe Steuern (35 bis 60 Prozent auf Löhne) und Arbeitslosigkeit trieben bis zu 40.000 Emigranten jährlich an. Regierungen waren instabil, mit drei Wahlen in 18 Monaten.
Ab 1989 reformierten Fianna Fáil-Progressive Democrats-Koalitionen (1989 bis 1992) und Nachfolger: Steuersenkungen, Sozialreformen, Wettbewerbssteigerung und Verbot von Krediten für laufende Ausgaben. Die „Tallaght-Strategie“ sah Oppositionsunterstützung, ergänzt durch Sozialpartnerschaftsabkommen mit Gewerkschaften. Dies stabilisierte die Wirtschaft, obwohl Arbeitslosigkeit bis in die 1990er Jahre hoch blieb. Sozial gab es kontroverse Referenden: Das Achte Amendment 1983 verbot Abtreibungen. Kondome wurden 1985 rezeptfrei, Kontrazeptiva vollständig 1993. Ein Scheidungsverbot-Abbau scheiterte 1986. Das Anglo-Irish Agreement 1985 erkannte Irlands Rolle in Nordirland-Verhandlungen an.
Die 1990er markierten den „Celtic Tiger“-Boom: Niedrige Körperschaftsteuern (12 Prozent), gebildete Arbeitskräfte, EU-Zugang und Sozialpartnerschaften trieben Wachstum. Arbeitslosigkeit und Emigration kehrten um, Netto-Immigration trieb die Bevölkerung über 4 Millionen. Bis 2000 war Irland EU-weit zweitreichstes Land nach BIP pro Kopf (kaufkraftbereinigt), Netto-EU-Beitragszahler mit 10 Prozent Ausländern. Haushaltsüberschüsse finanzierten Infrastruktur; Verschuldung sank auf 32 Prozent des BIP 2002. Privatisierungen umfassten Eircom.
Politisch Koalitionen: Fianna Fáil-Labour (1992 bis 1994), Fine Gael-Labour-Democratic Left (1994 bis 1997). Bertie Ahern (Fianna Fáil) wurde 1997 Taoiseach. International trug Irland zum IRA-Waffenstillstand 1994 und Good Friday Agreement 1998 bei, das Machtteilung in Nordirland schuf. Ein Referendum änderte die Verfassung, gab territoriale Ansprüche auf und bot irische Staatsbürgerschaft an. Dissidente Gruppen wie Real IRA blieben, wurden aber bekämpft.
Sozial: Das Zwölfte Amendment 1992 erlaubte Abtreibungen zur Lebensrettung, Informationszugang und Reisen ins Ausland. Das Fünfzehnte Amendment 1995 legalisierte Scheidung. Homosexuelle Handlungen wurden 1993 entkriminalisiert. Kirchenskandale (zum Beispiel Bishop Eamon Casey, Father Brendan Smyth, Ryan Commission) minderten Einfluss: Kirchenbesuch sank von 85 Prozent 1990 auf 43 Prozent 2008. Korruptionsuntersuchungen betrafen Politiker wie Ray Burke.
Der Boom endete 2007 mit Immobilienkrach und globaler Kreditkrise. Banken, in Immobilien investiert, kollabierten; unter Brian Cowen (Fianna Fáil, 2008–2011) garantierte die Regierung Bankenschulden (über 50 Milliarden Euro). Einnahmen brachen ein, Defizit 2010 bei 93,4 Milliarden (Schuld 148,6 Milliarden, 94,2 Prozent BIP). 2010 nahm Irland ein 85-Milliarden-IMF-EU-Kreditpaket an, mit hohem Zins und Souveränitätsverlust.
Die Wahl 2011 zerstörte Fianna Fáil (17 Prozent, 20 Sitze); Enda Kenny (Fine Gael) führte Fine Gael-Labour-Koalition. Emigration stieg. Wachstum kehrte post-2012 zurück, außer während COVID-19; Irland rangiert global 4. nach BIP pro Kopf. Die Wahl 2016 schwächte Fine Gael; Kenny trat zurück, Leo Varadkar (Fine Gael, offen schwul, indischer Herkunft) wurde 2017 Taoiseach.
Sozial: Das 34. Amendment 2015 legalisierte gleichgeschlechtliche Ehe per Referendum (weltweit erstes per Volksabstimmung, über 60 Prozent Zustimmung). Das 36. Amendment 2018 hob das Abtreibungsverbot auf; ab 2019 erlaubte ein Gesetz Abtreibungen bis 12 Wochen.
Die Wahl 2020 brach das Zweiparteiensystem: Sinn Féin gewann die meisten Erststimmen (37 Sitze), Fianna Fáil 38, Fine Gael 35 (je 20 bis 25 Prozent). Micheál Martin (Fianna Fáil) bildete eine historische Koalition mit Fine Gael und Grünen im Juni 2020, mit Rotation des Taoiseach-Postens: Martin zuerst, Varadkar ab Dezember 2022. Im April 2024 trat Simon Harris (Fine Gael) als Taoiseach an, der jüngste in der Geschichte.
Während der Corona-Zeit ab März 2020 erlebte Irland erhebliche gesellschaftliche Spannungen und Konflikte, die sich aus den Maßnahmen der Regierung ergaben. Insbesondere die Lockdowns, Ausgangssperren und Schließungen von Geschäften und Gastronomiebetrieben stießen bei vielen Iren auf Widerstand. Ein großer Teil der irischen Bevölkerung empfand die Restriktionen als zu streng oder schlecht kommuniziert, was zu Kritik an der Regierung und einzelnen Maßnahmen führte.
Auch Impfkampagnen und die Einführung von Gesundheitszertifikaten führten zu gröberen Auseinandersetzungen. Zahlreiche Gruppen lehnten die eingeführten Impfpflichten ab oder kritisierten den „Vaccine Pass“. Die Proteste mündeten mehrfach in Konflikte mit der Polizei („Gardaí“). Die Sicherheitskräfte wurden angewiesen, Versammlungen aufzulösen, ohne die öffentliche Ordnung unverhältnismäßig zu gefährden.
Die Maßnahmenpolitik belastete zudem Wirtschaft und Gesellschaft stark. Gastronomie, Tourismus und Einzelhandel verzeichneten erhebliche Umsatzeinbußen, während viele Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen waren. Soziale Isolation und Unsicherheit führten zu psychischen Belastungen und verstärkten die Spannungen innerhalb der Gesellschaft. Diffamierungen von Maßnahmengegnern seitens der Machtelite und wichtigere Medien trugen zur Polarisierung bei und förderten die Radikalisierung auf der Gegnerseite. Rechtsfragen spielten ebenfalls eine Rolle. Debatten über die Verhältnismäßigkeit der Einschränkungen führten zu Fragen über persönliche Freiheitsrechte und die Grenzen staatlichen Handelns.
Ein wachsendes Problem bildet unterdessen die Migrationspolitik. Irland hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem Auswanderungsland zu einem attraktiven Ziel für Einwanderung entwickelt. Der wirtschaftliche Aufschwung seit den 1990er Jahren („Celtic Tiger“) und die EU-Mitgliedschaft zogen Arbeitskräfte, Studierende und Flüchtlinge an, wodurch heute etwa 20 % der Bevölkerung aus dem Ausland stammen. Die Migrationspolitik ist stark von EU-Vorgaben und der Common Travel Area (CTA) mit dem Vereinigten Königreich geprägt, steht jedoch vor Herausforderungen wie Wohnraummangel, steigenden Asylzahlen und gesellschaftlichen Spannungen. Im Folgenden ein zusammenhängender Überblick über die aktuelle Politik.
Bis in die 1990er Jahre war Irland ein Emigrationsland, geprägt durch Ereignisse wie die Große Hungersnot (1845 bis 1852). Seit dem Wirtschaftsboom kehrte sich der Trend um: Nach der EU-Erweiterung 2004 strömten vor allem Osteuropäer ins Land. Laut Central Statistics Office (CSO) wuchs die Bevölkerung bis April 2025 auf 5,46 Millionen, angetrieben durch eine Netto-Zuwanderung von 59.700 Personen. Die Einwanderung sank jedoch um 16 % auf 125.300, während 65.600 Menschen auswanderten, vor allem nach Australien und in die USA. Unter den Einwanderern dominieren EU-Bürger, gefolgt von Nicht-EU-Staatsangehörigen aus Indien, Brasilien und Nigeria. Asylanträge stiegen stark an: Im August 2024 wurden 1.690 Erst-Anträge gestellt, und für 2025 wird ein Anstieg von 39,4 % erwartet. Zudem erhielten bis Januar 2025 110.575 Ukrainer temporären Schutz.
Irland ist laut wirtschaftspolitischer Vorgaben auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen, insbesondere in IT, Gesundheitswesen und Bauwesen. Für Nicht-EU-Bürger sind Employment Permits erforderlich, deren Regelungen 2025 angepasst wurden. Neue Permits, wie das Seasonal Employment Permit für Saisonarbeiter oder erweiterte Rechte für Ehepartner von Permit-Inhabern, erleichtern die Rekrutierung. Mindestgehälter wurden überprüft (zum Beispiel 30.000 € für Critical Skills Permits), und der Employment Permits Act wurde reformiert, um globale Talente anzuziehen. Visumpflichten wurden für einige Länder verschärft, etwa für Trinidad und Tobago (Mai 2025) sowie Eswatini, Lesotho und Nauru (März 2025). Diese Maßnahmen sollen das Wirtschaftswachstum stützen, während die Politik flexibel auf Arbeitsmarktanforderungen reagiert.
Irland genießt EU-weit einen Ruf für seine Willkommenskultur, doch Unterkunftsnot und steigende Asylzahlen setzen die Politik unter Druck. Im Rahmen des EU-Migrations- und Asylpakts (2024 beigetreten, Umsetzung bis Juni 2026) wurde das International Protection Act 2015 durch den International Protection Bill 2025 ersetzt, um Verfahren zu beschleudingen. Zunehmende Kriminalitätszahlen im migrantischen Bereich führten unterdessen zu einer zunehmend angespannten Debatte über Migration, die sich ab 2022 von vereinzelten Protesten zu landesweiten Spannungen und gewaltsamen Ausschreitungen entwickelt hat. Der wachsende Zustrom von Migranten hat in Verbindung mit einer akuten Wohnkrise und Ressourcenknappheit zu erheblichen Konflikten geführt. Der Widerstand wird durch Gruppen wie jener um den medial ins rechtsextreme Eck gestellten Conor McGregor geführt. Ein zentraler Teil seiner Plattform ist die Ablehnung des EU-Migrationspakts, den er durch eine Volksabstimmung demokratisch entschieden sehen möchte.
Die Wurzeln der Konflikte liegen in Irlands raschem Wandel von einem Auswanderungs- zu einem Einwanderungsland. Seit dem wirtschaftlichen Aufschwung der 1990er Jahre („Celtic Tiger“) und der EU-Erweiterung 2004 wuchs die ausländische Bevölkerung auf etwa 20 % der 5,46 Millionen Einwohner (Stand April 2025). Die Netto-Zuwanderung belief sich im gleichen Zeitraum auf 59.700 Personen, wobei Asylanträge seit 2020 um 300 % stiegen – getrieben durch den Ukraine-Krieg (über 110.000 Ukrainer unter temporärem Schutz) und wirtschaftliche Migration aus Ländern wie Nigeria, Syrien und Indien. Die Regierung gibt jährlich 2,5 Milliarden Euro für Asylunterkünfte aus, doch die Wohnkrise (über 13.000 Obdachlose) schürt Ressentiments. Umfragen zeigen, dass 75 % der Iren das Land als „zu voll“ empfinden. Soziale Medien, angeführt von Figuren wie Conor McGregor oder internationalen Akteuren wie Tommy Robinson, verstärken die Spannungen durch Desinformation über „kriminelle Migranten“ oder Verschwörungstheorien wie den „Great Replacement“. Hassverbrechen stiegen 2024/25 um 40 %, besonders gegen Nicht-EU-Migranten, und in Nordirland sogar um 50 %.
Die Konflikte begannen 2022 mit lokalen Protesten und eskalierten 2025 zu landesweiten Unruhen. In East Wall (Dublin) blockierten Anwohner 2022 Straßen gegen ein neues Asylzentrum, was zu Auseinandersetzungen mit der Polizei (Gardaí) führte. In Rosslawn (Co. Donegal) wurden Zelte von Flüchtlingen angezündet. Am 23. November 2023 ereignete sich in Dublin ein Messerangriff vor der Gaelscoil Choláiste Mhuire, bei dem mehrere Kinder und eine Betreuerin verletzt wurden. Der Täter wurde als Riad Bouchaker identifiziert, einem fünfzigjährigen Mann algerischer Herkunft, der seit 20 Jahren in Irland lebte und 2014 die irische Staatsbürgerschaft erlangte. Als Reaktion daauf kam es zu teils spontanen Protesten, die zu massiven Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht führten.
Migration wurde zum zentralen Thema der Parlamentswahl. In Coolock (Dublin) protestierten Hunderte gegen ein geplantes Asylzentrum. In Ballaghaderreen, County Roscommon, kam es im November 2024 zu Protesten der Anwohner nach einem Vorfall, bei dem Kinder offensichtlich migrantischer Herkunft (genauere Angaben lehnte die Polizei ab) über einen Jugendlichen herfielen. Die Demonstrationen wurden von der Gruppe „Ballaghaderreen Concerned Citizens“ organisiert und zogen Hunderte von Menschen an. Die Teilnehmer forderten mehr Polizeipräsenz und Maßnahmen gegen steigende Kriminalität und Vandalismus in der Region.
Am 26. April 2025 marschierten Tausende Demonstranten, organisiert von Gruppen wie der Irish Freedom Party, vom Garden of Remembrance zur Custom House. Parolen wie „Irish Lives Matter“ und „Get them out“ dominierten. Conor McGregor rief in Posts auf X zu „Krieg“ gegen die Migrationspolitik auf. Gegenproteste von United Against Racism (mehr als 1.000 Teilnehmer) führten zu Rangeleien, getrennt durch massive Polizeipräsenz.
Im Juni 2025 kam es in Nordirland, insbesondere in der Stadt Ballymena, zu schweren Ausschreitungen, die mehrere Nächte andauerten. Auslöser war der sexuelle Übergriff auf ein minderjähriges Mädchen von zwei vierzehnjährigen Jugendlichen aus Rumänien, die vor Gericht behaupteten, das Mädchen hätte sich ihnen freiwillig hingegeben.
In Limerick, Galway (August, 150 bis 500 Teilnehmer) und Waterford kam es zu Protesten und heftigen inneren Konflikten in Asylzentren. Neue Gruppen wie die „Pink Ladies“ (antimigrantisches Frauennetzwerk) entstanden in Nordirland. In Athlone blockierten Anwohner Pläne für ein Zentrum mit 1.000 männlichen Asylbewerbern.
Die Konflikte spalten Irland tief. Während 20 % der Bevölkerung migrantischer Herkunft sind, berichten NGOs wie Movement of Asylum Seekers in Ireland von zunehmenden (verbalen) Angriffen auf Migranten. Der International Protection Bill 2025 ersetzt unterdessen ältere Gesetze, um die Asylpolitik zu straffen. Gleichzeitig gewannen Unabhängige aus dem rechten politischen Lager und Parteien wie die Irish Freedom Party an Einfluss, während Sinn Féin eine liberale Haltung beibehielt.
Verwaltung
Die Genealogie der irischen Hochkönige beginnt im Jahr -1930, die der Milesier -1699. Um -500 entstanden die keltischen Königreiche Tuisceart, Airghialla, Ulaid, Mide, Lagain, Mumhain und Ol nEchmacht. Um -200 war Irland in insgesamt rund 200 Kleinkönigreiche unterteilt. Im 1. Jahrhundert begann der Einfluss der Römer, im 4. Jahrhundert wurden fünf größere Königreiche - Connacht, Leinster, Meath, Munster und Ulster - geschaffen. Um 450 übernahmen die Iren das Christentum. Von 800 bis 1014 herrschten die Wikinger über große Teile der Insel. Von 1022 bis 1121 tobte ein schier endloser Bürgerkrieg. 1155 übergab Papst Hadrianus IV den Großteil Irlands an König Henry II von England. Im Oktober 1171 begann die englische Eroberung der Grünen Insel. 1172 erklärte der Papst den englischen König zum Lehensherrn über Irland. Am 1. Februar 1171 übernahmen die Engländer die Herrschaft über Ulster, 1235 auch über Connaught. 1366 wurde im Statute im Kilkenny der Versuch unternommen, die gälische Identität von der der Normannen und Engländer abzusondern.
Die sogenannte Neuzeit war geprägt durch zahlreiche Aufstandsversuche. 1515 herrschte Anarchie in Irland, 1534 kam es in Kildare zu einer Rebellion. Im Juni 1541 wurde das Kingdom of Ireland in Personalunion mit England geschaffen. 1562 tobten die elisabethanischen Kriege. 1595 bis 1603 führte Hugh O’Neill von Enniskillen aus einen Aufstand. 1606 konfiszierten die Engländer sechs Grafschaften Ulsters, das heutige Nordirland. 1608 begann mit der Plantation of Derry die planmäßige Kolonisierung des Landes. Dagegen revoltierten unter anderem 1641 die Katholiken von Ulster. 1642 bis 1647 bestand die Confederation of Kilkenny. 1656 wurden mehr als 60.000 irische Katholiken als Sklaven in die Karibik geschickt. Im April 1689 begann ein neuer Aufstand in Derry. 1690 schlug Wilhelm der Oranier mit seinen Truppen James II in der Schlacht am Boyne.
Ein neuer Unabhängigkeitskrieg dauerte von 27. August 1797 bis 15. September 1798. Am 1. Januar 1801 entstand formal das Vereinigte Königreich von und Irland. 1803 kam es zu einem neuen Aufstand unter Robert Emmett. 1823 wurde die Daniel O'Connell's Catholic Association gegründet. 1829 tobte der Tithe War. 1831 verabschiedete das britische Parlament den Catholic Emancipation Act. Einen großen Einschnitt in die Entwicklung der Insel bedeuteten die Hungerjahre von 1845 bis 1849. Mitten drin im Jahr 1848 versuchten die Young Islanders einen Aufstand. Im März 1867 kam es zum Fenian Rising. 1879 wurde die Irish National League gegründet. In den Jahren darauf bis 1882 prägte der Land War das Land. 1909 wurde der Land Purchase Act erlassen.
Der letzte Akt im Unabhängigkeitskrieg der Iren begann 1914 mit mehreren Aufständen. Der wichtigste davon war derEaste Rising im April 1916 in Dublin. Von 24. bis 29. April herrschte damals eine erste provisorische Regierung. Im Dezember 1918 erhielten alle Iren über 21 und Irinnen über 30 Jahren das Wahlrecht. Am 21. Januar 1919 erklärten sich die Iren für unabhängig. Damit begann der Anglo-Irische Krieg. Am 6. Dezember 1921 erhielt Irland den Status eines Dominions. Im April 1922 begann der Bürgerkrieg. Am 16. Juni 1922 wurde der Irish Free State (Saorstát Éireann) errichtet. Dieser wurde am 6. Dezember gleichen Jahres britisches Dominion. Im Mai 1923 endete der Bürgerkrieg. 1928 erhielten alle Iren und Irinnen über 21 Jahren das Wahlrecht. Am 29. Dezember 1937 wurde eine neue Verfassung in Kraft gesetzt, und am 11. Juli 1938 überließen die Briten die Rechte über die von ihnen bis dahin beherrschten Häfen Queenstown (Cobh), Berehaven und Lough Swilly den Iren.
Am 11. Dezember 1948 wurde die Republic of Ireland (Poblacht na hÉireann) gegründet, die zugleich aus dem Commonwealth austrat. Großbritannien anerkannte den neuen Staat erst am 18. April 1949. 1955 trat Irland den Vereinten Nationen bei, und 1972 wurde es Mitglied der Europäischen Gemeinschaft, der heutigten Europäischen Union, in der es sich vertraglich Sonderrechte sicherte.
Herrschaftsgeschichte
- um -1930 bis um -500 mythisches Hochkönigreich Irland
- um -500 bis um -200 Königreiche Königreiche Tuisceart, Airghialla, Ulaid, Mide, Lagain, Mumhain und Ol nEchmacht
- um -200 bis um 400 bis zu 200 keltische Kleinkönigreiche
- um 400 bis 853 Hochkönigreich Irland (Ard Rí Éireann) mit den Fünfteln (cóiceda) Connaught (Connacht), Leinster (Laighin), Meath (Mide), Munster (Mumu) und Ulster (Ulaid)
- 853 bis 21. September 1170 Hochkönigreich Irland (Ard Rí Éireann) und Königreich Dublin (Dyflin)
- 21. September 1171 bis 6. Oktober 1175 Hochkönigreich Irland (Ard Rí Éireann) und Königreich England (Regnum Angliae bzw. Kingdom of England)
- 6. Oktober 1175 bis 19. Juni 1541 Herrschaft Irland (Lordship of Ireland) des Königreichs England (Regnum Angliae bzw. Kingdom of England)
- 19. Juni 1541 bis 14. November 1642 Königreich Irland (Kingdom of Ireland) in Personalunion mit dem Königreich England (Kingdom of England)
- 14. November 1642 bis 17. Januar 1649 Irische Katholische Knföderation (Comhdháil Chaìtliceach na hÉireann) in Union mit dem Königreich England (Kingdom of England)
- 17. Januar 1649 bis 25. April 1660 Staatenbund England und Irland (Commonwealth of England and Ireland)
- 25. April 1660 - 1. Mai 1707 Königreich Irland (Kingdom of Ireland) in Personalunion mit dem Königreich England (Kingdom of England)
- 1. MaI 1707 bis 31. Dezember 1800 Königreich Irland (Kingdom of Ireland / Ríoghacht Éireann) im Königreich Großbritannien (Kingdom of Great Britain)
- 1. Januar 1801 bis 6. Dezember 1922 Königreich Irland (Kingdom of Ireland / Ríoghacht Éireann) im Vereinigten Königreich Großbritannien und Irland (United Kingdom of Great Britain and Ireland)
- 6. Dezember 1922 bis 12. April 1927 Freistaat Irland (Saorstát Éireann) und Nordirland (Northern Ireland) als Teilstaat des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland (United Kingdom of Great Britain and Ireland)
- 12. April 1927 bis 29. Dezember 1937 Freistaat Irland (Saorstát Éireann) und Nordirland (Northern Ireland) als Teilstaat des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
- seit 29. Dezember 1937 Republik Irland (Poblacht na hÉireann) und Nordirland (Northern Ireland) als Teilstaat des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
Verfassung
Die Verfassung der Republik Irland, bekannt als Bunreacht na hÉireann, wurde 1937 unter der Leitung von Éamon de Valera verabschiedet und trat nach einem Volksreferendum in Kraft. Sie ersetzte die Verfassung des Irischen Freistaats von 1922 und markierte Irlands endgültigen Bruch mit dem britischen Commonwealth, wobei die volle Republikstatus 1949 erreicht wurde. Diese Verfassung ist ein zentrales Dokument der irischen Identität und legt die Grundlagen für eine parlamentarische Republik mit Gewaltenteilung fest. Sie beginnt mit einer Präambel, die sich auf die Heilige Dreifaltigkeit bezieht, und umfasst 50 Artikel, die Themen wie nationale Souveränität, Grundrechte, die Rolle des Präsidenten, des Parlaments (Oireachtas) und der Justiz behandeln. Besonders hervorzuheben sind die Artikel 2 und 3, die ursprünglich einen Anspruch auf die gesamte Insel erhoben, aber nach dem Good Friday Agreement 1998 geändert wurden, um eine friedliche Wiedervereinigung unter Zustimmung der Mehrheit in Nordirland zu betonen. Die Verfassung schützt Grundrechte wie Gleichheit, Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit, wobei der Katholizismus bis 1973 eine besondere Stellung einnahm. Änderungen der Verfassung erfordern eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und ein Referendum, was zu 32 Änderungen geführt hat, darunter die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe 2015 und die Aufhebung des Abtreibungsverbots 2018. Die Verfassung bleibt ein lebendiges Dokument, das durch höchstrichterliche Urteile, wie etwa zur Anerkennung ungeschriebener Rechte, weiterentwickelt wird und Irlands Rolle in der EU widerspiegelt.
Nordirland hingegen hat keine eigene kodifizierte Verfassung, da es Teil des Vereinigten Königreichs ist, dessen Verfassung aus einer Mischung von Statuten, Common Law und Konventionen besteht. Die verfassungsrechtliche Grundlage Nordirlands wurzelt im Government of Ireland Act von 1920, der die Teilung der Insel schuf, wobei Nordirland aus sechs Grafschaften Ulsters bestand und ein eigenes Parlament in Stormont erhielt. Dieses System war jedoch von Diskriminierung gegen die katholische Minderheit geprägt, was zu den Troubles (1969–1998) führte. Nach der Suspendierung von Stormont 1972 und mehreren gescheiterten Reformversuchen wurde 1998 das Good Friday Agreement unterzeichnet, das die Grundlage für die heutige Devolution bildet. Dieses Abkommen, durch das Northern Ireland Act 1998 umgesetzt, etabliert eine Machtteilung zwischen unionistischen und nationalistischen Gemeinschaften, mit einer Northern Ireland Assembly und einer Regierung, die von einem First Minister und einem deputy First Minister geleitet wird. Nordirland bleibt Teil des UK, solange keine Mehrheit für eine Vereinigung mit Irland stimmt, wie im Agreement festgelegt. Menschenrechte werden durch die Europäische Menschenrechtenkonvention geschützt, und Institutionen wie der Nord-Süd-Ministerrat fördern die Zusammenarbeit mit der Republik Irland. Der Brexit hat die Situation kompliziert, insbesondere durch das Northern Ireland Protocol und den Windsor Framework von 2023, die Sonderregelungen für den Handel schaffen. Trotz Stabilität seit 1998 bleibt die politische Lage fragil, da Spannungen zwischen den Gemeinschaften und die Frage nach einer möglichen Wiedervereinigung bestehen.
Das Good Friday Agreement verknüpft beide Systeme, indem es den territorialen Anspruch Irlands auf Nordirland aufhob und eine gemeinsame Vision für Frieden und Kooperation schuf. Während die Republik Irland durch ihre Verfassung Souveränität und nationale Identität betont, navigiert Nordirland die Herausforderungen eines geteilten Systems innerhalb des UK, geprägt von der Notwendigkeit, beide Gemeinschaften einzubinden. Beide Regionen stehen vor modernen Herausforderungen: Irland in Bezug auf soziale Rechte und EU-Integration, Nordirland in Bezug auf Brexit und die fragile Balance des Power-Sharing.
Legislative und Exekutive
Die Republik Irland ist eine parlamentarische Demokratie mit einer repräsentativen Regierungsform. Das politische System basiert auf der Verfassung von 1937 (Bunreacht na hÉireann), die die Gewaltenteilung zwischen Legislative (Parlament), Exekutive (Regierung) und Judikative regelt. Die Regierung ist dem Parlament rechenschaftspflichtig und benötigt dessen Vertrauen, um zu regieren. Dies führt zu einer engen Verflechtung: Das Parlament wählt den Regierungschef und kontrolliert die Exekutive durch Misstrauensvoten oder Gesetzesinitiativen.
Oireachtas ist das bicamerale Parlament und besteht aus:
- Dáil Éireann (Unterhaus): 160 Abgeordnete (TDs), gewählt alle maximal fünf Jahre per Verhältniswahl (Single Transferable Vote). Es ist die dominante Kammer und entscheidet über Haushalt, Gesetze und Regierungswechsel.
- Seanad Éireann (Oberhaus): 60 Senatoren, gewählt oder ernannt (zum Beispiel von Universitäten oder dem Taoiseach). Es kann Gesetze verzögern, aber nicht blockieren.
- Präsident von Irland (Uachtarán): Zeremonielle Rolle als Staatsoberhaupt, gewählt alle sieben Jahre direkt vom Volk; unterzeichnet Gesetze, hat aber begrenzte Vetorechte.
Der Oireachtas tagt im Leinster House in Dublin und hat ausschließliche Kompetenzen in Bereichen wie Steuern, Armee und EU-Integration. Gesetze müssen von beiden Kammern verabschiedet werden und durch den Präsidenten genehmigt. Die EU-Recht hat Vorrang, und Verfassungsänderungen erfordern Volksabstimmungen.
Die Exekutive wird vom Taoiseach (Premierminister) geleitet, der vom Dáil gewählt wird. Das Kabinett (Regierung) umfasst 15 Minister und ist kollektiv verantwortlich. Die Regierung bildet sich typischerweise als Koalition (zum Beispiel aktuell seit Januar 2025 eine Mitte-rechts-Koalition aus Fianna Fáil, Fine Gael und Unabhängigen unter Micheál Martin als Taoiseach). Sie setzt Gesetze um, leitet die Verwaltung und vertritt Irland international.
Die Regierung benötigt die Mehrheit im Dáil; verliert sie das Vertrauen, muss der Taoiseach zurücktreten oder Neuwahlen beantragen. Das Dáil kann die Regierung durch Ausschüsse kontrollieren, und der Taoiseach kann Gesetze einbringen. Dieses System fördert Stabilität, da Koalitionen üblich sind (so etwa nach den Wahlen 2020 und 2024). Im Demokratieindex 2024 rangiert Irland auf Platz 8 als „vollständige Demokratie“.
Nordirland ist ein Teildtsst des Vereinigten Königreichs mit einer konsensbasierten Machtteilung (power-sharing), verankert im Karfreitagsabkommen von 1998. Dieses System zielt auf Kooperation zwischen unionistischen (pro-britischen, meist protestantischen) und nationalistischen (pro-irischen, meist katholischen) Gruppen ab, um Konflikte zu vermeiden. Das britische Parlament in Westminster behält Souveränität und kann die Devolution suspendieren. Die Beziehung zwischen Parlament und Regierung ist eng, aber anfällig für Blockaden, wie in den Suspensionen 2002 bis 2007 und 2017 bis 2020.
Die Northern Ireland Assembly ist ein unicamerales Parlament mit 90 Abgeordneten (MLAs), gewählt alle fünf Jahre per Verhältniswahl (Single Transferable Vote) in 18 Wahlkreisen. Es tagt im Parliament Building in Stormont (Belfast). Abgeordnete klassifizieren sich als Unionisten, Nationalisten oder „Andere“. Nach der Wahl 2022: Sinn Féin (27 Sitze, Nationalisten), DUP (24, Unionisten), Alliance (17, Andere).
Funktionen: Gesetzgebung in eigenständigen Bereichen (zum Besipiel Gesundheit, Bildung, Justiz seit 2010). Reservierte Kompetenzen (speziell Handel) können übertragen werden; ausgenommene - wie zum Beispiel die Verteidigung - bleiben bei Westminster. Die Assembly wählt die Exekutive und kann sich mit Zweidrittelmehrheit auflösen.
Die Exekutive umfasst das Office of the First Minister and deputy First Minister sowie 9 Ministerien. Der First Minister (von der stärksten Partei) und deputy First Minister (von der stärksten der anderen Community) haben gleiche Befugnisse und werden gemeinsam gewählt. Aktuell (seit 2024): Michelle O’Neill (Sinn Féin) als First Minister, Emma Little-Pengelly (DUP) als deputy. Ministerposten werden proportional verteilt. Die Exekutive ist hochdefizitär (Subventionen aus London über 9 Mrd. £/Jahr) und umsetzt Assembly-Gesetze. Sie ist eine Zwangskoalition: Alle Parteien mit ≥9 Sitzen müssen einbezogen werden.
Die Assembly wählt die Exekutive; ohne Konsens innerhalb 6 Wochen löst sie sich auf, und das britische Northern Ireland Office übernimmt. Dieses power-sharing verhindert Alleinherrschaft, birgt aber Instabilität - so f+ührten etwa die Brexit-Kontrollen 2022 bis 2024 zu einer Blockade durch DUP. Der Windsor-Rahmenplan (2023) löste dies teilweise, ermöglichte die Wiederaufnahme 2024. Das System fördert Inklusion, hängt aber von Verhandlungen ab.
Inseloberhaupt
Bis zur Teilung 1921 gehörte Irland zum Vereinigten Königreich, und das Staatsoberhaupt war der britische Monarch. Der letzte König, der ganz Irland regierte, war König George V. Nach dem Anglo-Irischen Vertrag von 1921 entstand der Irische Freistaat, der nominell bis 1937 unter der britischen Krone stand, wobei König George VI. der letzte Monarch war, der diese Rolle innehatte. Allerdings wurde die Rolle des Königs durch die Verfassung von 1937 stark eingeschränkt, und mit der Ausrufung der Republik Irland im Jahr 1949 endete die Monarchie endgültig. Seitdem ist das Staatsoberhaupt der Republik Irland der Präsident (Uachtarán na hÉireann). Nordirland blieb nach der Teilung 1921 Teil des Vereinigten Königreichs, und das Staatsoberhaupt war und ist der britische Monarch.
Hochkönigreich Irland
Ardri (Hochkönige)
Fir Bolg (legendär)
- -1935 - -1934 Sláine mac Dela (Slainge)
- -1933 - -1932 Rudhraighe
- -1931 - -1928 Gann - zusammen mit -
- -1931 - -1928 Geannan
- -1927 - -1923 Sengann
- -1922 - -1919 Fiacha Cennfinnian
- -1918 - -1912 Rinnan
- -1911 - -1909 Foidhbhgen
- -1907 - -1898 Eochaidh
Tuatha de Danaan (legendär)
- -1897 - -1891 Breas („der Schöne”)
- -1890 - -1871 Nuadha („mit der Silberhand”)
- -1870 - -1831 Lugh („mit dem langen Arm”)
- -1830 - -1751 Eochaidh („Allvater”)
- -1750 - -1741 Dealbhaeth
- -1740 - -1731 Fiacha
- -1730 - -1701 MacCuill, MacCeacht & MacGreine
Milesians (legendär)
- -1699 Heber - zusammen mit -
- -1699 - -1684 Heremon
- -1683 - -1681 Muimhne, Luaighe & Laighne
- -1681 Ir, Orba, Fearon & Ferga
- -1681 Nuadha I Neacht
- -1680 - -1671 Irial Faidh
- -1670 - -1651 Eithrial
- -1650 - -1621 Conmael (Connaol)
- -1620 - -1544 Tighernmas
- -1536 - -1533 Eochaidh Eadghadhach (Eochu I)
- -1532 - -1493 Cearmna Finn & Sobhairce
- -1492 - -1473 Eochaidh Faebhar Ghlas (Eochu II)
- -1472 - -1449 Fiacha Labhrainne (Fiacha I)
- -1448 - -1428 Eochaidh Mumho (Eochu III)
- -1427 - -1410 Aengus Olmucadha (Angus I)
- -1409 - -1383 Eanna Airgtheach (Enna I)
- -1382 - -1358 Roitheachtaigh
- -1357 - -1353 Sedna I
- -1353 - -1333 Fiacha Finsothach (Fiacha II)
- -1332 - -1328 Muineamhon (Munmoin)
- -1327 - -1318 Faildeargdoid (Fualdergoid)
- -1317 - -1278 Eochaidh Ollamh Fodhla (Eochu IV)
- -1277 - -1258 Finnachta
- -1257 - -1241 Slanoll
- -1240 - -1231 Gedhe Ollghothach
- -1230 - -1209 Fiacha Finnailches (Fiacha III)
- -1208 - -1197 Bearnghal
- -1196 - -1181 Oilioll I
- -1180 - -1131 Síorna (Sirna)
- -1130 - -1024 Roitheachtaigh (Rotheachta)
- -1023 Eiliomh Oillfinshneachta (Elim Ollfhionach)
- -1022 - -1014 Giallchaidh (Gialchadh)
- -1013 - -1002 Art Imleach (Art I)
- -1001 - -962 Nuadhat Finnfail (Nuada II)
- -961 - -953 Breas Rioghacta (Breas)
- -952 Eochaidh Apthach (Eochu V)
- -951 - -930 Finn
- -929 - -910 Seidnas Innarraigh (Sedna II)
- -909 - -904 Simon Breac
- -903 - -894 Duach Finn (Duach I)
- -893 Muireadhach Bolgrach (Muredach Bolgach)
- -892 - -881 Enda Dearg
- -880 - -872 Lughaidh Iardonn (Lugha I)
- -871 - -856 Sirlamh
- -855 - -844 Eochaidh Uaircheas (Eochu VI)
- -843 - -839 Eochaidh Fiadhmuine (Eochu VII) - zusammen mit -
- -843 - -839 Conaing Begeaglach
- -838 - -832 Lughaidh Laimhdhearg (Lugha II)
- -831 - -812 Conaing Begeaglach [wieder eingesetzt]
- -811- -806 Art II
- -805 - -796 Fiacha Tolgrach (Fiacha IV)
- -795 - -785 Oilioll Finn (Oilioll II)
- -784 - -778 Eochaidh (Eochu VIII)
- -777 - -748 Airgeatmhar
- -747 - -738 Duach Ladhgrach (Duach II)
- -737 - -731 Lughaidh Laighdhe (Lugha III)
- -730 - -724 Aedh Ruadh (Aedh I)
- -723 - -717 Diothorba
- -716 - -710 Cimbaeth
- -709 - -703 Aedh Ruadh (Aedh I) [2]
- -702 - -696 Diothorba [2]
- -695 - -689 Cimbaeth [2]
- -688 - -682 Aedh Ruadh (Aedh I) [3]
- -681 - -675 Diothorba [3]
- -674 - -660 Cimbaeth [3] - zusammen mit -
- -667 - -654 Macha [w]
- -653 - -634 Reachtaidh Righdhearg
- -633 - -594 Úgaine Mor („Hugony der Große”)
- -594 Badhbhchadh
- -593 - -592 Loeguire Lorc (Loeguire I)
- -591 - -542 Cobhthach Cael Breagh
- -541 - -523 Labhraidh („der Seefahrer”)
- -522 - -506 Melghe Molbhthach
- -505 - -499 Modhcorb
- -498 - -481 Aengus Ollamh (Angus II)
- -480 - -474 Irereo
- -473 - -463 Fearcorb
- -462 - -443 Connla Caemh
- -442 - -418 Oilioll Cas-Fiachla („Oliol mit dem Hakenzahn”, Oilioll III)
- -417 - -414 Adamair
- -413 - -396 Eochaidh Ailtleathan (Eochu IX)
- -395 - -385 Feargus Fortamhail (Fergus I)
- -319 - -312 Niadhsedhaman
- -312 - -293 Enna Aighneach (Enna II)
- -292 - -289 Crimthann Cosgrach
- -288 - -219 Ruadhri Mor („Rory der Große”)
- -218 - -210 Ionadmoar (Innatmar)
- -209 - -199 Breasal Boidhiobhadh
- -198 - -184 Lughaidh Luaighne (Lugha IV)
- -183 - -168 Congal Claroineach (Congal)
- -168 - -159 Duach Dalladh Deadha
- -158 - -143 Fachtna Fathach
- -143 - -131 Eochaidh („of the Constant Sighs”, Eochu X)
- -130 - -116 Eochaidh Gravedigger (Eochu XI)
- -115 - -111 Ederscel - zusammen mit -
- -112 Clann Eimhir Finn
- -110 Nuadha Neacht (Nuada III)
- -109 - -40 Conaire („der Große”)
- -34 - -9 Lughaidh („von den roten Kreisen”, Lugha V)
- -8 Conchobhar („Conchobar der Rötlich-Braune”)
- -7 - 9 Crimhthann Niadhnair (Crimthainn)
- 10 - 14 Cairbre („Katzenkopf”)
- 15 - 36 Faraday Finnfeachtnach
- 37 - 39 Fiatach Finn
- 40 - 56 Fiacha Finnfolaidh (Fiacha V)
- 57 - 76 Elim
- 77 - 106 Tuathal („der Legitime”)
- 106 - 110 Mál MacRochraidhe
- 110 - 119 Feidhlimidh („der Gesetzgeber”)
- 119 - 122 Cathair („der Große”)
- 122 - 157 Conn („von den hundert Schlachten”)
- um 125 Eoghan Mor („Eugene der Große”, in Opposition)
- 157 - 165 Connor II
- 165 - 195 Art Eanfhear
- 195 - 225 Lugha VI
- 225 - 226 Fergus I („Schwarzzahn”)
- 226 - 266 Cormac Ulhada
- 266 - 267 Eocha I Gunait
- 267 - 284 Cairbre II Aiffeachair
- 284 - 285 Faharsy & Fachardy
- 285 - 315 Fiacha VI
- 315 - 320 Cairoll
- 320 - 340 Moiready Tireach
- 340 - 341 Caolbhach
- 341 - 360 Eocha II („Herr der Sklaven”)
- 360 - 378 Criomthann (Crimthan)
UiNiall (O’Neill)
- 378 - 405 Niall I Nóigiallach („Neil von den neun Geiseln”)
- 405 - 428 Dathy
- 428 - 458 Loeguire († 463)
- 458 - 482 Ailill Molt
- 482 - 507 Lugha VII
- 507 - 534 Murtough
- 534 - 544 Tuathal II
- 544 - 565 Dermot I
- 565 - 566 Fergus II & Donnell I
- 566 - 569 Ainmire
- 569 - 572 Baedan I („mit dem gelben Haar”) & Eocha III
- 572 - 586 Baedan II
- 572 - 586 Aedh I
- 598 - 604 Colman („der Gefeirte”) & Aedh II SlaineAedh III
- 604 - 612 Uaireodhnach
- 612 - 615 Máel Cobo
- 615 - 628 Suibne („der Kleine”)
- 628 - 642 Donnell II
- 642 - 654 Conal & Kelly († 658)
- 654 - 665 Blathmac & Dermot II
- 665 - 671 Shaughnessy
- 671 - 675 Cenn Faelad
- 675 - 695 Finniety Fleadha („der Heilige”)
- 695 - 704 Loingseach
- 704 - 710 Congal I Cionmaghair
- 710 - 722 Fergal
- 722 - 724 Fogerty
- 724 - 728 Kenneth
- 724 - 734 Flaugherty (in Opposition, † 765)
- 734 - 743 Aedh IV („der Stattliche”)
- 743 - 763 Donnell III
- 763 - 770 Niall II („aus den Regengüssen”, † 778)
- 770 - 797 Donchad I
- 797 - 819 Aedh V („der Ehrwürdige”)
- 819 - 833 Conchobar II
- 833 - 838 Niall III Caille († 836)
Wikinger
- 838 - 846 Thorgest („der Tyrann”)
O’Neill
- 846 - 862 Malachy I (Máel Sechnaill mac Máele Ruanaid)
- 862 - 879 Aedh VI Findliath
- 879 - 916 Flann Sionna
- 916 - 919 Niall IV („Schwarzknie”)
- 919 - 944 Donchad II
- 944 - 956 Congal II Cnoba
- 956 - 980 Donnell IV
- 980 - 1002 Malachy II († 1022)
O’Brian
- 1002 - 1014 Brian Boru
O’Neill
- 1014 - 1022 Malachy II [wieder eingesetzt]
- 1024 - 1064 Donchad
- 1042 - 1072 Dermot („der Stürmische”, in Opposition)
- 1072 - 1086 Turlough I
- 1086 - 1119 Murcherty I
- 1090 - 1121 Donnell (in Opposition)
- 1119 - 1156 Turlough II (in Opposition)
- 1156 - 1166 Murcherty II
- 1166 - 1186 Rory O'Connor († 1198)
Lords (Herren)
- 20 Aug 1170 - 20 Apr 1176 Richard FitzGilbert Pembroke, Earl of Pembroke („Strongbow”, 1130 - 1176)
- 20 Apr 1176 - 25 Apr 1185 Könige von England
- 25 Apr 1185 - 27 Mai 1199 John Plantagenet („Lackland”, 1167 - 1216)
- 27 Mai 1199 - 16 Mar 1254 Könige von England
- 16 Mar 1254 - 1265 Edward („Longshanks”, ab 1272 Edward I, King of England, 1239 - 1307)
- 1265 - Jun 1541 Könige von England
Kings / Queens (Könige / Königinnnen)
- Jun 1541 - 29 Dez 1937 Könige und Königinnen von England
Dyflin (Dublin)
Rí (Könige)
Yngling Dynasty
- 856 - 871 Olaf I
- 871 - 873 Ivar I („der Knochenlose”)
- 873 - 875 Eystein
- 875 - 877 Halfdan
- 877 - 881 Bard
- 881 - 888 Sigfried
- 888 - 896 Sihtric I
- 896 - 902 Ivar II
- 917 - 920 Sihtric II Caoch
- 920 - 934 Guthfrith I
- 934 - 941 Olaf II
- 941 - 945 Blacar
- 945 - 948 Olaf III Brogues († 981)
- 948 - 953 Guthfrith II
- 953 - 980 Olaf III Brogues [2]
- 980 - 989 Glunjaran
- 989 - 994 Sihtric III († 1035)
- 994 - 995 Ivar III († 1000)
- 995 - 1014 Sihtric III [2]
Earls (Grafen)
- 1014 - 1035 Sihtric III
- 1035 - 1038 Margad († 1052)
- 1038 - 1046 Ivar IV
- 1046 - 1052 Margad [2]
- 1072 - 1075 Gudred
- 1119 - 1124 Thorfinn
- 1136 - 1146 Ragnald
- 1146 - 1148 Ottar
- 1148 - 1160 Brodar
- 1160 - 1170 Astell
Duke (Herzog)
- 1386 - 1397 Robert DeVere († 1397)
Herrschaft und Königreich Irland
Justiciars (Justiziare)
- Apr 1172 - Apr 1173 Hugh de Lacy († 1186)
- Apr - Aug 1173 William Fitzadhelm
- Aug 1173 - Jun 1176 Richard FitzGilbert Pembroke, Earl of Pembroke („Strongbow”)
- Jun 1176 - Mai 1177 Raymond Fitz William [amtierend]
- Mai 1177 - 1 Apr 1181 Hugh de Lacy [2]
- 1 Apr - Dez 1181 John de Lacy & Richard de Pec
- Jan 1182 - 1 Sep 1184 Hugh de Lacy (3)
- 1 Sep 1184 - Apr 1185 Philip de Braose
- 25 Apr - Dez 1185 John („Lackland”, ab 1199 King John of England, 1167 - 1216)
- Dez 1185 - 1192 John de Courci
- 1192 - 1194 Peter Pipard & William le Petit
- 1194 - 1196 Peter Pipard [2]
- 1196 - Jul 1199 Hamo de Valognes
- Jul 1199 - Sep 1208 Meiler Fitz Henry
- Sep - Dez 1208 Hugh de Lacy, Earl of Ulster
- Dez 1208 - 20 Jun 1210 John de Grey, Bishop of Norwich
- 20 Jun - 26 Aug 1210 King John („Lackland”)
- 26 Aug 1210 - 23 Jun 1213 John de Grey, Bishop of Norwich [2]
- 23 Jun 1213 - 6 Jun 1215 Henry de Loundres, Archbishop of Dublin
- 6 Jun 1215 - 3 Jul 1221 Geoffrey de Marisco
- 2 Jul 1221 - 2 Mai 1224 Henry de Loundres, Archbishop of Dublin [2]
- 2 Mai 1224 - 25 Jun 1226 William Marshall, Earl of Pembroke
- 25 Jun 1226 - 13 Feb 1228 Geoffrey de Marisco [2]
- 13 Feb 1228 - 16 Jun 1232 Richard de Burgh
- 16 Jun 1232 - 29 Jul 1232 Hubert de Burgh, Earl of Kent
- 3 Sep 1232 - 18 Nov 1245 Maurice Fitzgerald, Baron of Offaly
- 18 Nov 1245 - 8 Aug 1246 Geoffrey St. Leger [amtierend]
- 8 Aug 1246 - 16 Mar 1254 John FitzGeoffrey
- 16 Mar 1254 - Jun 1256 Richard de la Rochelle
- Jun 1256 - Mar 1259 Alain de la Zouche
- Mar 1259 - Okt 1260 Stephen de Longespée
- Okt 1260 - Jul 1261 William de Dene († 1261)
- 28 Okt 1261 - Mar 1265 Richard de la Rochelle [2]
- Mar - 6 Mai 1265 Faulk de Sandford, Archbishop of Dublin
- 6 Mai - 10 Jun 1265 Roger Waspayl [amtierend]
- 10 Jun 1265 - 1266 Hugh de Taghmon, Bishop of Meath
- 1266 - 1268 David de Barry
- 1268 - 1270 Robert de Ufford
- 1270 - Jul 1272 James de Augley († 1272)
- Jul 1272 - 8 Aug 1272 John de Muscegros [amtierend]
- 8 Aug 1272 - Aug 1273 Maurice Fitzgerald
- Aug 1273 - 17 Jun 1276 Geoffrey de Joinville
- 17 Jun 1276 - Apr 1280 Robert de Ufford [2]
- Apr 1280 - 7 Jul 1288 Stephen de Fulburne, Archbishop of Tuam
- 7 Jul 1288 - 12 Sep 1290 John de Sandford, Archbishop of Dublin
- 12 Sep 1290 - 18 Okt 1294 William de Vescy
- 18 Okt 1294 - 19 Apr 1295 William de Odyngseles († 1295)
- 19 Apr - 18 Okt 1295 Maurice FitzThomas [amtierend]
- 18 Okt 1295 - 15 Jun 1308 John Wogan
- 15 Jun - 16 Jun 1308 Richard de Burgh, Earl of Ulster („der rote Earl of Ulster”)
- 16 Jun 1308 - 16 Mai 1309 Piers de Gaveston [amtierend]
- 16 Mai 1309 - 7 Aug 1312 John Wogan [2]
Lords Deputies (Lord Deputierte)
- 7 Aug 1312 - 30 Apr 1313 Edmund Butler [amtierend]
- 30 Apr 1313 - 4 Jan 1314 Theobald de Verdun
- 4 Jan - 18 Jun 1314 Edmund Butler [2, amtierend]
Lords Justices (Lord-Richter)
- 18 Jun 1314 - 7 Apr 1317 Edmund Butler [amtierend]
- 7 Apr 1314 - 6 Mai 1318 Roger Mortimer
- 6 Mai - 11 Aug 1318 William FitzJohn, Bishop of Cashel
- 11 Aug 1318 - 15 Mar 1319 Alexaner de Bicknor, Archbishop of Dublin
- 15 Mar 1319 - 30 Sep 1320 Roger Mortimer [2]
- 30 Sep 1320 - 21 Mai 1321 Thomas Fitz John Fitzgerald, Earl of Kildare
- 1 Feb 1321 - 23 Apr 1320 Ralph de Gorges [formal, kam nie nach Irland]
- 21 Mai 1321 - 18 Nov 1323 John de Bermingham, Earl of Louth
- 18 Nov 1323 - 13 Apr 1327 John Darcy, le Neveu
- 13 Apr 1327 - 6 Apr 1328 Thomas Fitz John Fitzgerald, Earl of Kildare [2]
- 6 Apr 1328 - 19 Feb 1329 Roger Outlaw, Prior of Kilmainham [amtierend]
- 21 Aug 1328 - 19 Feb 1329 John Darcy, le Neveu [2, übernahm das Amt nicht]
- 19 Feb 1329 - 3 Mar 1331 John Darcy, le Cosyn
Lords Lieutenants (Leutnante des Lords)
- 3 Mar 1331 - Nov 1331 William de Burgh, Earl of Ulster („der braune Earl of Ulster”)
- Nov 1331 - 30 Sep 1332 Anthony de Lucy
- 30 Sep 1332 - 28 Jul 1337 John Darcy le Cosyn
- 28 Jul 1337 - Jul 1338 John Charleton, Baron of Powys
- Jul 1328 - 3 Mar 1340 Thomas de Charleton, Bishop of Hereford [amtierend als Lord Deputierter]
- 3 Mar 1340 - 10 Feb 1344 John Darcy, le cCosyn [2]
- 10 Feb 1344 - 6 Apr 1346 Ralph de Ufford († 1346)
- 7 Apr - 10 Mai 1346 John Morice (Lord Deputierter)
- 10 Mai 1346 - Dez 1349 Walter Bermingham
- Dez 1349 - 8 Jul 1355 Thomas de Rokeby († 1357)
- 8 Jul 1355 - 26 Jan 1356 Maurice Fitzthomas
- 26 Jan - 26 Jul 1356 Maurice Fitzgerald, Earl of Kildare
- 26 Jul 1356 - 23 Apr 1357 Thomas de Rokeby [2]
- 24 Apr - 5 Sep 1357 John de Bolton [amtierend]
- 5 Sep 1357 - 18 Apr 1359 Almeric de Saint Armand
- 18 Apr 1359 - 16 Mar 1361 James Butler, Earl of Ormonde
- 1 Ju1 1361 - 22 Apr 1364 Lionel, Earl of Ulster (ab 13 Nov 1362 Duke of Clarence, 1338 - 1368)
- 22 Apr 1364 - 25 Jan 1365 Gerlad Fitzgerlad, Earl of Desmond (Lord Deputierter)
- 25 Jan 1365 - 7 Nov 1366 Lionel, Duke of Clarence [2]
- 7 Nov 1366 - 20 Feb 1367 Thomas de la Dale [amtierend]
- 20 Feb 1367 - 3 Mar 1369 Gerlad Fitzgerlad, Earl of Desmond (Lord Deputierter) [2]
- 3 Mar 1369 - 28 Apr 1372 William Windsor
- 28 Apr 1372 - 20 Sep 1373 Robert de Asheton
- 20 Sep 1373 - 16 Feb 1376 William Windsor [2]
- 16 Feb - 24 Jul 1376 Maurice Fitzgerald, Earl of Kildare (Lord Deputierter) [2]
- 24 Jul 1376 - 22 Sep 1377 James Butler, Earl of Ormonde
- 22 Sep 1377 - 22 Okt 1379 John de Bromych
- 22 Okt 1379 - 24 Jan 1381 Edmund Mortimer, Earl of Ulster and Earl of March († 1381)
- 24 Jan 1381 - 1 Jul 1383 Roger Mortimer, Earl of Ulster and Earl of March († 1398)
- 1 Jul 1383 - 1384 Philip de Courtenay
- 1384 - 6 Mar 1385 James Butler, Earl of Ormonde [2]
- 6 Mar - 1 Dez 1385 Philip de Courtenay [2]
- 1 Dez 1385 - 1387 Robert de Vere, Earl of Oxford (ab Okt 1386 Marquess of Dublin and Duke of Ireland)
- 1387 - 25 Okt 1389 Alexander de Balscot, Bishop of Meath [amtierend]
- 25 Okt 1389 - 11 Sep 1391 Sir John I Stanley (um 1350 - 1414)
- 11 Sep 1391 - 24 Jul 1392 Thomas Woodstock, Duke of Gloucester
- 24 Jul 1392 - 2 Okt 1394 James Butler, Earl of Ormonde [3]
- 2 Okt 1394 - 28 Apr 1395 King Richard II (1367 - 1400)
- 28 Apr 1395 - 25 Apr 1396 Roger Mortimer, Earl of Ulster and Earl of March [2]
- 25 Apr 1396 - 23 Jan 1397 William le Scrope (um1351 - 1399)
- 23 Jan - 24 Apr 1397 Edmund Mortimer (1391 - 1425)
- 24 Apr 1397 - Jul 1398 Roger Mortimer, Earl of Ulster and Earl of March [3]
- Jul - 7 Okt 1398 Reginald de Grey, Baron Grey de Ruthyn
- 7 Okt 1398 - 9 Mai 1399 Thomas Holland, Duke of Surrey
- 9 Mai - 31 Jul 1399 King Richard II [2]
- 31 Jul - 10 Dez 1399 Alexander de Balscot, Bishop of Meath [2] & Edmund Holland, Earl of Kent [amtierend]
- 10 Dez 1399 - 13 Nov 1401 Sir John I Stanley [2]
- 13 Nov 1401 - Nov 1403´ Thomas Plantagenet Lancaster, Duke of Clarence (1388 - 1421)
- Nov 1403 - 3 Mar 1404 Stephen le Scrope [amtierend]
- 3 Mar - Sep 1404 James Butler
- 1 Okt 1404 - 25 Sep 1413 Thomas Plantagenet Lancaster, Duke of Clarence [2]
- 25 Sep 1413 - 18 Jan 1414 Sir John Stanley [3]
- 18 Jan - Sep 1414 Thomas Cranley
- Sep 1414 - Jul 1419 John Talbot, Baron Furnivall
- Jul 1419 - 10 Feb 1420 Richard Talbot, Archbishop of Dublin [amtierend]
- 10 Feb 1420 - 1422 James Butler, Earl of Ormonde [2]
- 1422 - 4 Okt 1422 William Fitzthomas
- 4 Okt 1422 - 9 Mai 1423 Richard Talbot, Archbishop of Dublin [2, amtierend]
- 9 Mai 1423 - 19 Jan 1425 Edmund Mortimer, Earl of Ulster and Earl of March [2]
- 25 Jan - 13 Apr 1425 John Talbot, Baron Furnivall [2]
- 13 Apr 1425 - 30 Apr 1428 John de Grey
- 30 Apr 1428 - Mai 1430 John Sutton, Baron Dudley
- Mai 1430 - 12 Apr 1431 Richard Talbot, Archbishop of Dublin [3, amtierend]
- 12 Apr 1431 - Mai 1437 Thomas Stanley
- Mai 1437 - 12 Feb 1438 Richard Talbot, Archbishop of Dublin [4, amtierend]
- 12 Feb 1438 - 27 Feb 1442 Leo Lionel Wells
- 27 Feb 1442 - 1444 James Butler, Earl of Ormonde [3]
- 1444 - 12 Mar 1445 Richard Talbot, Archbishop of Dublin [5, amtierend]
- 12 Mar 1445 - 1447 John Talbot, Baron Furnivall, Earl of Shrewsbury [3]
- 1447 - 5 Jul 1449 Richard Talbot, Archbishop of Dublin [6, amtierend]
- 5 Jul 1449 - Sep 1450 Richard, Duke of York (1411 - 1460)
- Sep 1450 - Okt 1454 James Butler, Earl of Wiltshire (und ab 1452 Earl or Ormonde)
- Okt 1454 - 8 Dez 1457 Thomas Fitzgerald, Earl of Kildare
- 8 Dez 1457 - 1458 Richard, Duke of York [2]
- 1458 - Dez 1459 Thomas Fitzgerald, Earl of Kildare [2]
- Dez 1459 - Jul 1460 Richard, Duke of York [3]
- Jul 1460 - 6 Mar 1462 George Plantagenet, Duke of Clarence (1449 - 1478)
- 1462 Robert FitzEustace [amtierend]
- 1462 - 1463 George Plantagenet, Duke of Clarence [2]
- 1463 - 1464 Thomas, Earl of Desmond [amtierend]
- 1464 - 1465 Thomas Fitzgerald, Earl of Kildare [3]
- 1465 - 1467 Thomas, Earl of Desmond [2, amtierend]
- 1467 - 23 Mar 1470 George Plantagenet, Duke of Clarence [3]
- 23 Mar - 1 Sep 1470 John Tiptoft, Earl of Worcester
- 1 Sep - 18 Okt 1470 Edmund Dudley
- 18 Okt 1470 - 1474 Thomas Fitzgerald, Earl of Kildare [4]
- 1474 - 1477 William Sherwood, Bishop of Meath [amtierend]
- 1477 - Mar 1478 Thomas Fitzgerald, Earl of Kildare [5]
- Mar - 6 Jul 1478 Gerald Fitzgerald, Earl of Kildare [amtierend]
- 6 Jul 1478 - 1479 Henry, Lord Grey [amtierend]
- 1479 - 5 Mai 1479 Robert Preston, Viscount Gormanston [amtierend]
- 5 Mai 1479 - 19 Jul 1483 Gerald Fitzgerald, Earl of Kildare [amtierend für Richard Duke of York]
- 19 Jul 1483 - 9 Apr 1484 Edward, Prince of Wales
- 21 Aug 1484 - 11 Mar 1486 John de la Pole, Earl of Lincoln
- 11 Mar 1486 - 11 Jun 1492 Jasper Tudor, Duke of Bedford (1430 - 1495)
- 11 Jun 1492 - 6 Sep 1493 Walter FitzSimons, Archbishop of Dublin [amtierend]
- 6 Sep - 11 Okt 1493 Robert Preston, Viscount Gormanston [2, amtierend]
- 14 Okt 1493 - 11 Sep 1494 William Preston, Viscount Gormanston
- 11 Sep - 13 Okt 1494 Henry, Prince of Wales (ab 22 Apr 1509 King Henry VIII, 1491 - 1547)
- 13 Okt 1494 - Dez 1495 Edward Poynings (1459 - 1521) [amtierend]
- 1 Jan 1496 - 1503 Henry Dean, Bishop of Bangor
- 1503 - 8 Jun 1509 Henry, Prince of Wales [2]
- 8 Jun 1509 - 26 Nov 1513 Gerald Fitzgerald, Earl of Kildare († 1513)
- 26 Nov 1513 - 13 Apr 1515 Gerald Fitzgerald, Earl of Kildare (Sohn des vorigen)
- 13 Apr - Sep 1515 William Preston, Viscount Gormanston [2]
- Sep 1515 - Sep 1519 Gerald Fitzgerald, Earl of Kildare [2]
- Sep 1519 - 24 Mai 1520 Maurice Fitzgerald
- 24 Mai 1520 - Dez 1521 Thomas Howard, Earl of Surrey
- Dez 1521 - 5 Aug 1524 Piers Butler, Earl or Ormonde
- 5 Aug 1524 - Nov 1526 Gerald Fitzgerald, Earl of Kildare [3]
- Nov 1526 - 1527 Thomas Fitzgerald of Leixlip [amtierend]
- 1527 - 4 Aug 1528 Richard Nugent, Baron Delvin [amtierend]
- 4 Aug 1528 - 22 Jun 1529 Piers Butler, Earl or Ormonde [2]
- 22 Jun 1529 - 22 Jun 1530 Henry Fitzroy, Duke of Ricmond and Somerset
- 22 Jun 1530 - 5 Jul 1532 William Skeffington († 1535) [amtierend]
- 5 Jul 1532 - Feb 1534 Gerald Fitzgerald, Earl of Kildare [4, amtierend]
- Feb - Jun 1534 Thomas Fitzgerald [amtierend]
- 23 Jul 1534 - 31 Dez 1535 William Skeffington [2]
- 1 Jul 1536 - Apr 1540 Leonard Grey, Lord Grey
- 2 Mai - Jul 1540 William Brereton
- 7 Jul 1540 - 20 Mai 1548 Anthony St. Leger (1469 - 1559)
- 20 Mai 1548 - 29 Mar 1549 Edward Bellingham
- 29 Mar 1549 - 2 Feb 1550 Francis Bryan
- 2 Feb 1550 - Aug 1550 William Brabazon
- 10 Sep 1550 - 29 Apr 1551 Anthony St. Leger [2]
- 29 Apr 1551 - 6 Dez 1552 James Croft („der Ältere”, † 1590)
- 6 Dez 1552 - 19 Nov 1553 Lord-Richter Thomas Cusack & Gerald Aylmer
- 19 Nov 1553 - 26 Mai 1556 Anthony St. Leger [3]
- 26 Mai 1556 - 18 Jan 1558 Thomas Radcliffe, Earl of Sussex (1523 - 1583)
- 18 Jan 1558 - 30 Aug 1559 Henry Sidney (1529 - 1586)
- 30 Aug 1559 - 13 Okt 1565 Thomas Radcliffe, Earl of Sussex (bis 6 Mai 1560, Lord Deputy) [2]
- 13 Okt 1565 - 1 Apr 1571 Henry Sidney [2]
- 1 Apr 1571 - 18 Sep 1575 William Fitzwilliams (1526 - 1599)
- 18 Sep 1575 - 14 Sep 1578 Henry Sidney [3]
- 14 Sep 1578 - 11 Okt 1579 William Drury (1527 - 1579)
- 11 Okt 1579 - 7 Sep 1580 William Pelham († 1587)
- 7 Sep 1580 - 31 Aug 1582 Arthur Grey, Baron Grey de Wilton (1536 - 1593)
- 31 Aug 1582 - 21 Jun 1584 Lord-Richter Adam Loftus, Archbishop of Dublin (1567 - 1643) & Henry Wallop (1540 - 1599)
- 21 Jun 1584 - 30 Jun 1588 John Perrott (1527 - 1592)
- 30 Jun 1588 - 11 Aug 1594 William Fitzwilliam [2]
- 11 Aug 1594 - 22 Mai 1597 William Russell
- 22 Mai - 30 Okt 1597 Thomas de Burgh, Baron de Burgh
- 30 Okt - 27 Nov 1597 Thomas Norreys
- 27 Nov 1597 - 15 Apr 1599 Lord-Richter Adam Loftus, Archbishop of Dublin [2] & Richrad Gardner
- 15 Apr - 25 Sep 1599 Robert Devereux, Earl of Essex (1567 - 1602)
- 25 Sep 1599 - 27 Feb 1600 Lord-Richter Adam Loftus, Archbishop of Dublin [3] & George Cary († 1617)
- 27 Feb 1600 - 1 Jun 1603 Charles Blount, Baron Mountjoy (bis 25 Apr 1603 Lord Deputierter, 1563 - 1606)
- 1 Jun 1603 - 3 Feb 1605 George Cary
- 3 Feb 1605 - 4 Mar 1614 Sir Arthur Chichester (1563 - 1625)
- 4 Mar 1614 - 30 Aug 1616 Lord-Richter Thomas Jones, Archbishop of Dublin, Richard Wingfield & John Denham (ab 11 Feb 1616)
- 30 Aug 1616 - 4 Mai 1622 Sir Oliver St. John, Baron Saint John (1559 - 1630)
- 4 Mai - 8 Sep 1622 Lord-Richter Adam Loftus, Archbishop of Dublin [4] & Richard Wingfield, Viscount Powerscourt [2]
- 8 Sep 1622 - 26 Okt 1629 Henry Cary, Viscount of Falkland († 1633)
- 26 Okt 1629 - 25 Jul 1633 Lord-Richter Adam, Viscount Loftus of Ely [4] & Richard Boyle, Earl of Cork (1566 - 1643)
- 25 Jul 1633 - 12 Mai 1641 Thomas Wentworth Stratfford, Viscount Wentworth (ab 13 Jan 1640 Earl of Stafford, 1593 - 1641)
- 14 Jun 1641 - 12 Mai 1643 Robert Sidney, Earl of Leicester (1595 - 1677, ging nicht nach Irland)
- 12 Mai - 13 Nov 1643 Sir John Borlase & Henry Tichborne
- 13 Nov 1643 - Feb 1647 James Butler, Marquess of Ormonde (1610 - 1688)
- 9 Apr 1646 - 15 Apr 1647 Philip Sidney de L’Isle (vom Parlament ernannt, 1619 - 1698)
- 19 Jun 1647 - Feb 1649 Kommissare der Parlaments Arthur Annesley (1614 - 1686), John Moore († 1650), Michael Jones († 1649), Sir Robert King & Sir Robert Meredith
- 30 Sep 1648 - 14 Aug 1649 James Butler, Marquess of Ormonde [appointed by the King, 2]
- 22 Jun 1649 - Jun 1652 Oliver Cromwell (1599 - 1658)
- 2 Jul 1650 - 20 Nov 1651 Henry Ireton (Lord Deputy, 1611 - 1651)
- 4 Okt 1650 - Jul 1654 Bürgerliche Kommissare des Parlaments Charles Fleetwood (1618 - 1692), Edmund Ludlow (1617 - 1692), Miles Corbett, John Jones (1597 - 1660) & John Weaver
- Jul 1654 - Aug 1655 Charles Fleetwood
- Aug 1655 - 17 Nov 1657 Kommissare der Parlaments Henry Cromwell (1628 - 1674), Matthew Tomlinson, Miles Corbett [2], Robert Goodwin & William Steele (ab Aug 1656)
- 17 Nov 1657 - 7 Mai 1659 Henry Cromwell (Lord-Deputierter)
- 7 Mai 1659 - Jun 1660 Kommissare der Parlaments Edmund Ludlow [2], John Jones [2], Matthew Tomlinson [2], Miles Corbett [3] & William Bury
- Jun - 31 Dez 1660 George Monck (1608 - 1670)
- 31 Dez 1660 - 27 Jul 1662 Sir Maurice Eustace & Roger Boyle, Earl of Orrery (1621 - 1679)
- 27 Jul 1662 - 18 Sep 1669 James Butler, Duke of Ormonde [3]
- 18 Sep 1669 - 21 Mai 1670 John Robartes, Baron Robartes
- 21 Mai 1670 - 5 Aug 1672 John Berkeley, Baron Berkeley of Tratton († 1678)
- 5 Aug 1672 - 24 Aug 1677 Arthur Capell, Earl of Essex
- 24 Aug 1677 - 20 Feb 1685 James Butler, Duke of Ormonde [4]
- 20 Feb 1685 - 9 Jan 1686 Lord-Richter Michael Boyle, Archbishop of Dublin (1609 - 1702) & Arthur Forbes, Earl of Granard (1623 - 1696)
- 9 Jan 1686 - 12 Feb 1687 Henry Hyde, Earl of Clarendon
- 12 Feb 1687 - 12 Mar 1689 Richard Talbot, Earl of Tyrconnell (1630 - 1691)
- 12 Mar 1689 - 4 Jul 1690 King James II (in opposition, 1633 - 1701)
- 14 Jun - 5 Sep 1690 King William III (1650 - 1702)
- 6 Sep 1690 - 3 Jul 1693 Lord-Richter Henry Sidney Romney (1641 - 1704), Thomas Coningsby (bis 1692, 1656 - 1729) & Sir Charles Porter (ab Nov 1690, † 1696
- 3 Jul 1693 - 28 Jul 1693 Sir Cyril Wyche (um1632 - 1707)
- 28 Jul 1693 - 6 Feb 1697 Lord-Richter Sir Cyril Wyche (bis 1695), Henry, Baron Capell (bis 18 Mai 1696, 1637 - 1696), William Dunscombe (bis 18 Mai 1696), Morrogh, Viscount Blessington (18 Mai 1696 - 2 Jun 1696), William Wolseley (18 Mai 1696 - 2 Jun 1696), Charles Porter (2 Jun 1696 - Dez 1696) [2], Charles Cook, Earl of Mountrath (ab 2 Jun 1696) & Henry Hamilton, Earl of Drogheda (ab 10 Jul 1696)
- 6 Feb 1697 - 28 Dez 1700 Lord-Richter Henry de Massue, Earl of Galway (1648 - 1720), Edward Villiers, Earl of Jersey (29 Jul 1697 - 1699, 1656 - 1711), Narcissius Harsh (18 Mai - Aug 1699), Charles Paulet, Duke of Bolton (ab 18 Mai 1699, 1661 - 1722) & Charles Berkeley, Earl of Berkeley (ab 23 Aug 1699, 1649 - 1710)
- 28 Dez 1700 - 18 Sep 1701 Sir Cyril Wyche & Henry Sidney, Earl of Romney [amtierend]
- 18 Sep 1701 - 4 Jun 1703 Laurence Hyde, Earl of Rochester (1641 - 1711)
- 4 Jun 1703 - 24 Jun 1707 James Butler, Duke of Ormonde (1665 - 1745)
- 24 Jun 1707 - 21 Apr 1709 Thomas Herbert, Earl of Pembroke (1656 - 1733)
- 21 Apr 1709 - 3 Jul 1711 Thomas Wharton, Baron Wharton (1648 - 1715)
- 3 Jul 1711 - 27 Okt 1713 James Butler, Duke of Ormonde [2]
- 27 Okt 1713 - 4 Okt 1714 Charles Talbot, Duke of Shrewsbury (1660 - 1718)
- 4 Okt 1714 - 13 Feb 1717 Charles Spencer, Earl of Sunderland (1674 - 1722)
- 13 Feb - 7 Aug 1717 Charles Townshend, Viscount Townshend (1674 - 1738)
- 7 Aug 1717 - 28 Aug 1721 Charles Paulet, Duke of Bolton [2]
- 28 Aug 1721 - 22 Okt 1724 Charles Fitzroy, Duke of Grafton (1683 - 1757)
- 22 Okt 1724 - Apr 1730 John Carteret, Baron Carteret (1690 - 1763)
- Apr 1730 - 11 Sep 1731 Hugh Boulter (1672 - 1742), Thomas Wyndham (1681 - 1745) & Ralph Gore (1675 - 1733) [amtierend]
- 11 Sep 1731 - 7 Sep 1737 Lionel Cranfield Sackville, Duke of Dorset (1688 - 1765)
- 7 Sep 1737 - 31 Aug 1745 William Cavendish, Duke of Devonshire (1698 - 1755)
- 31 Aug 1745 - 13 Sep 1747 Philip Dormer Stanhope, Earl of Chesterfield (1694 - 1773)
- 13 Sep 1747 - Apr 1750 William Stanhope, Earl of Harrington (1690 - 1756)
- Apr 1750 - 19 Sep 1751 Henry Boyle (1682 - 1764) [amtierend]
- 19 Sep 1751 - 5 Mai 1755 Lionel Cranfield Sackville, Duke of Dorset [2]
- 5 Mai 1755 - 25 Sep 1757 William Cavendish, Duke of Devonshire (1720 - 1764)
- 25 Sep 1757 - 6 Okt 1761 John Russell, Duke of Bedford (1710 - 1771)
- 6 Okt 1761 - 22 Sep 1763 George Montagu-Dunk, Earl of Halifax (1716 - 1771)
- 22 Sep 1763 - 5 Jun 1765 Hugh Smithson Percy, Earl of Northumberland (1715 - 1786)
- 5 Jun - 18 Okt 1765 Thomas Thynne, Viscount Weymouth (1734 - 1796)
- 18 Okt 1765 - 6 Okt 1766 Francis Seymour, Earl of Hertford (1718 - 1794)
- 6 Okt 1766 - 14 Okt 1767 George William Hervey, Earl of Bristol (1721 - 1775)
- 14 Okt 1767 - 30 Nov 1772 George Townshend, Viscount Townshend (1724 - 1807)
- 30 Nov 1772 - 25 Jan 1777 Simon Harcourt, Earl Harcourt (1714 - 1777)
- 25 Jan 1777 - 23 Dez 1780 John Hobart, Earl of Buckingshamshire (1723 - 1793)
- 23 Dez 1780 - 14 Apr 1782 Frederick Howard, Earl of Carlisle (1748 - 1825)
- 14 Apr - 15 Sep 1782 William Henry Cavendish-Bentinck, Duke of Portland (1738 - 1809)
- 15 Sep 1782 - 3 Jun 1783 George Nugent-Temple-Grenville, Earl Temple (1753 - 1813)
- 3 Jun 1783 - 24 Feb 1784 Robert Henley, Earl of Northington (1747 - 1786)
- 24 Feb 1784 - 24 Okt 1787 Charles Manners, Duke of Rutland (1754 - 1787)
- 16 Dez 1787 - 5 Jan 1790 George Nugent-Temple-Grenville, Marquess of Buckingham [2]
- 5 Jan 1790 - 4 Jan 1795 John Fane, Earl of Westmorland (1759 - 1841)
- 4 Jan - 31 Mar 1795 William Wentworth Fitzwilliam, Earl Fitzwilliam (1748 - 1833)
- 31 Mar 1795 - 20 Jun 1798 John Jeffreys Pratt, Earl Camden (1759 - 1840)
- 20 Jun 1798 - 25 Mai 1801 Charles Cornwallis, Marquess Cornwallis (1738 - 1805)
- 25 Mai 1801 - 28 Mar 1806 Philip Yorke, Earl of Hardwicke (1757 - 1834)
- 28 Mar 1806 - 19 Apr 1807 John Russell, Duke of Bedford (1766 - 1839)
- 19 Apr 1807 - 26 Aug 1813 Charles Lennox, Duke of Richmond (1764 - 1819)
- 26 Aug 1813 - 9 Okt 1817 Charles, Earl of Whitworth (1752 - 1825)
- 9 Okt 1817 - 29 Dez 1821 Charles Chetwynd Talbot, Earl Talbot (1777 - 1849)
- 29 Dez 1821 - 1 Mar 1828 Richard Colley Wellesley, Marquess Wellesley (1760 - 1842)
- 1 Mar 1828 - 6 Mar 1829 Henry William Paget, Marquess of Anglesey (1768 - 1854)
- 6 Mar 1829 - 23 Dez 1830 Hugh Percy, Duke of Northumberland (1785 - 1847)
- 23 Dez 1830 - 26 Sep 1833 Henry William Paget, Marquess of Anglesey [2]
- 26 Sep 1833 - 6 Jan 1835 Richard Colley Wellesley, Marquess Wellesley [2]
- 6 Jan - Apr 1835 Thomas Hamilton, Earl of Haddington (1780 - 1858)
- 11 Mai 1835 - 3 Apr 1839 Constantine Henry Phipps, Earl of Mulgrave (ab 25 Jan 1838 Marquess of Normanby, 1797 - 1863)
- 3 Apr 1839 - 15 Sep 1841 Hugh Fortescue, (ab 1841 Earl Fortescue, 1783 - 1861)
- 15 Sep 1841 - 26 Jul 1844 Thomas Philip Robinson, Earl de Grey (1781 - 1859)
- 26 Jul 1844 - 11 Jul 1846 William à Court, Baron Heytesbury (1779 - 1860)
- 11 Jul 1846 - 16 Mai 1847 John William Ponsonby, Earl of Bessborough (1781 - 1847)
- 26 Mai 1847 - 10 Mar 1852 George Villiers, Earl of Clarendon (1800 - 1883)
- 10 Mar - Dez 1852 Archibald Montgomerie, Earl of Eglinton (1812 - 1861)
- 6 Jan 1853 - 13 Mar 1855 Edward Granville Eliot, Earl of Saint Germans (1798 - 1877)
- 13 Mar 1855 - 12 Mar 1858 George Howard, Earl of Carlisle (1802 - 1864)
- 12 Mar 1858 - 13 Jul 1859 Archibald Montgomerie, Earl of Eglinton [2]
- 13 Jul 1859 - 8 Nov 1864 George Howard, Earl of Carlisle [2]
- 8 Nov 1864 - 20 Jun 1866 John Wodehouse, Baron Wodehouse (ab 1866 Earl of Kimberley, 1826 - 1902)
- 20 Jun 1866 - 23 Dez 1868 James Hamilton, Marquess (ab 1868 Duke of Abercorn 1811 -1885)
- 23 Dez 1868 - 18 Apr 1874 John Poyntz Spencer, Earl Spencer (1835 - 1910)
- 18 Apr 1874 - 11 Dez 1876 James Hamilton, Duke of Abercorn [2]
- 11 Dez 1876 - 5 Mai 1880 John Churchill, Duke of Marlborough (1822 - 1883)
- 5 Mai 1880 - 6 Mai 1882 Francis Thomas de Grey, Earl Cowper (1834 - 1905)
- 6 Mai 1882 - 30 Jun 1885 John Poyntz Spencer, Earl Spencer [2]
- 30 Jun 1885 - 20 Feb 1886 Henry Herbert, Earl of Carnarvon (1831 - 1890)
- 20 Feb - 5 Aug 1886 John Campbell Hamilton-Gordon, Earl of Aberdeen (1847 -1934)
- 5 Aug 1886 - 5 Okt 1889 Charles Vane-Tempest-Stewart, Marquess of Londonderry (1852 - 1915)
- 5 Okt 1889 - 18 Aug 1892 Lawrence Dundas, Earl of Zetland (1844 - 1929)
- 18 Aug - 8 Jul 1895 Robert Crewe-Milnes, Baron Houghton (1858 - 1945)
- 8 Jul 1895 - 16 Aug 1902 George Henry Cadogan, Earl Cadogan (1840 - 1915)
- 16 Aug 1902 - 14 Dez 1905 William Humble Ward, Earl of Dudley (1867 - 1932)
- 14 Dez 1905 - 19 Feb 1915 John Campbell Hamilton-Gordon, Earl of Aberdeen [2]
- 19 Feb 1915 - 11 Jul 1916 Ivor Churchill Guest, Viscount Wimborne (1873 - 1939)
President of the Provisional Government of the Irish Republic (Präsident der provisorischen Regierung der Republik Irland)
- 24 Apr - 29 Apr 1916 Patrick Henry Pearse (in Rebellion, 1879 - 1916) IRB
Lord-lieutenants (Oberleutnante)
- 11 Jul - 11 Aug 1916 Lord-Richter [amtierend]: Bernard Edward Barnaby Fitzpatrick, Baron Castletown (1849 - 1937), Sir David Harrel (1841 - 1939), Richard Robert Cherry (1859 - 1923), James Owen Wylie (1845 - 1935) und Jonathan Pim (1858 - 1949)
- 11 Aug 1916 - 2 Mai 1918 Ivor Churchill Guest, Viscount Wimborne [2]
- 2 Mai 1918 - 2 Mai 1921 John Denton Pinkstone French, Viscount French (1852 - 1925)
- 2 Mai 1921 - 6 Dez 1922 Edmund Bernard Fitzalan-Howard, Viscount Fitzalan of Derwent (1855 - 1947)
Chief Secretaries for Ireland (Oberste Sekretäre Irlands)
- 20 Jan 1566 - 1568 Sir Edward Waterhouse (1535 - 1791)
- 15 Jul 1569 - 31 Mar 1571 Edmund TreMaine († 1582)
- 1571 - 1574? Philip Williams
- 18 Sep 1575 - vor 1580 Edmund Molyneaux
- 7 Sep 1580 - 30 Aug 1582 Edmund Spencer
- 21 Jun 1584 - 21 Jun 1594 Philip Williams
- 11 Aug 1594 - 21 Mai 1597 Sir Richard Cooke
- 22 Mai - 13 Okt 1597 Philip Williams [2]
- 15 Apr 1599 - 4 Sep 1599 Sir Henry Wotton (1568 - 1639)
- 27 Feb - Mar 1600 Sir Francis Mitchell
- Mar - 13 Nov 1600 George Cranmer († 1600)
- 14 Nov 1600 - 31 Mai 1603 Fynes Moryson (1566 - 1630)
- 1 Jun 1603 - 2 Feb 1605 Sir John Bingley
- 3 Feb 1605 - 10 Feb 1616 Sir Henry Piers
- 30 Aug 1616 - 3 Mai 1622 Sir Henry Holcroft
- 8 Sep 1622 - 25 Okt 1629 Sir John Veele
- 21 Jan 1644 - Apr 1646 Sir George Lane
- Jun 1660 - Dez 1660 Matthew Lock
- 27 Jul 1662 - 17 Sep 1669 Sir Thomas Page
- 18 Sep 1669 - 20 Mai 1670 Sir Henry Ford
- 21 Mai 1670 - 4 Aug 1672 Sir Ellis Leighton
- 5 Aug 1672 - 10 Dez 1673 Sir Henry Ford
- 11 Dez 1673 - 23 Aug 1676 Sir William Harbord (1635 - 1792)
- 24 Dez 1676 - 1 Mai 1682 Sir Cyril Wyche (1632 - 1707)
- 2 Mai 1682 - 19 Mar 1685 Sir William Ellis
- 9 Jan 1686 - 11 Feb 1687 Sir Paul Rycaut (1629 - 1700)
- 12 Feb 1687 - 20 Jan 1688 Thomas Sheridan
- 2 Feb 1688 - 24 Jan 1689 Patrick Tyrrell
- Sep 1690 - Mar 1692 John Davis
- 4 Sep 1692 - 2 Jul 1693 Sir Cyril Wyche [2]
- 27 Mai 1696 - 16 Mai 1696 Sir Richard Aldworth
- 30 Jul 1696 - Mai 1697 William Palmer
- Mai 1697 - Nov 1699 Matthew Prior (1664 - 1721)
- Nov 1699 - Apr 1701 Humphrey Mai
- 28 Dez 1701 - 18 Feb 1703 Francis Gwyn (1648 - 1734)
- 19 Feb 1703 - 30 Apr 1707 Edward Southwell (1671 - 1730)
- 30 Apr 1707 - 3 Dez 1708 George Dodington
- 4 Dez 1708 - 25 Okt 1710 Joseph Addison (1672 - 1719)
- 26 Okt 1710 - 22 Sep 1713 Edward Southwell [2]
- 22 Sep 1713 - 3 Okt 1714 Sir John Stanley († 1744)
- 4 Okt 1714 - 23 Aug 1715 Joseph Addison [2]
- Sep 1715 - 27 Apr 1717 Martin Bladen (1680 - 1746) & Charles Delafaye († 1762)
- 27 Apr 1717 - 8 Apr 1720 Edward Webster Whg
- 8 Apr 1720 - Aug 1721 Horatio Walpole (1678 - 1757) Whg
- Aug 1721 - 5 Mai 1724 Edward Hopkins Whg
- 6 Mai 1724 - 22 Jun 1730 Thomas Clutterbuck Whg
- 23 Jun 1730 - 8 Apr 1737 Walter Cary Whg
- 9 Apr 1737 - 11 Mai 1739 Sir Edward Walpole (1706 - 1784) Whg
- 12 Mai - 13 Okt 1739 Thomas Townshend (1701 - 1780) Whg
- 14 Okt 1739 - 7 Jun 1741 Henry Bilson Legge (1708 - 1764) Whg
- 8 Jun 1741 - 7 Jan 1745 William Ponsonby, Viscount Duncannon (1704 - 1793) Whg
- 8 Jan 1745 - 22 Jun 1746 Richard Liddell († 1746) Whg
- 5 Jul - 14 Nov 1746 Sewallis Shirley Whg
- 15 Nov 1746 - 14 Dez 1750 Edward Weston (1703 - 1770) Whg
- 15 Dez 1750 - 1 Apr 1755 Lord George Sackville (1716 - 1785) Whg
- 2 Apr 1755 - 2 Jan 1757 Henry Seymour Conway (1721 - 1795) Whg
- 3 Jan 1757 - 2 Apr 1761 Richard Rigby (1722 - 1788) Whg
- 3 Apr 1761 - 2 Jul 1764 William Gerard Tor / Whg
- 3 Jul 1764 - 4 Jun 1765 Charles Moore, Earl of Drogheda (1730 - 1821) Whg
- 5 Jun - 6 Aug 1765 Sir Charles Bunbury Whg
- 7 Aug 1765 - 5 Okt 1766 Francis Seymour Conway, Viscount Beauchamp (1743 - 1822) Whg
- 6 Okt 1766 - 6 Jul 1767 Augustus John Hervey (1724 - 1779) Whg
- 9 Jul - 18 Aug 1767 Theophilus Jones Whg
- 19 Aug 1767 - 31 Dez 1768 Lord Frederick Campbell (1729 - 1816) Whg
- 1 Jan 1769 - 29 Nov 1772 Sir George Macartney (1737 - 1806) Tor
- 30 Nov 1772 - 6 Dez 1776 Sir John de Blaquiere (1732 - 1812) Tor
- 13 Dez 1776 - 28 Nov 1780 Sir Richard Heron (1726 - 1805) Tor
- 29 Nov 1780 - 7 Apr 1782 William Eden (1744 - 1814) Tor
- 8 Apr - 14 Aug 1782 Richard Fitzpatrick (1747 - 1813) Whg
- 15 Aug 1782 - 2 Mai 1783 William Wyndham Grenville (1759 - 1834) Whg
- 3 Mai - 26 Aug 1783 William Wyndham (1750 - 1810) Tor
- 27 Aug 1783 - 11 Feb 1784 Thomas Pelham Tor
- 12 Feb 1784 - 24 Okt 1787 Thomas Orde (1740 - 1807) Tor
- 7 Nov 1787 - 5 Apr 1789 Alleyne FitzHerbert (1753 - 1839) Tor
- 6 Apr 1789 - 15 Dez 1793 Robert Hobart Tor
- 16 Dez 1793 - 12 Dez 1794 Sylvester Douglas (1743 - 1823) Tor
- 13 Dez 1794 - 12 Mar 1795 George Damer, Viscount Milton (1746 - 1808) Tor
- 13 Mar 1795 - 2 Nov 1798 Thomas Pelham [2] Tor
- 3 Nov 1798 - 26 Apr 1801 Robert Stewart, Viscount Castlereagh (1769 - 1822) Tor
- 26 Apr - 25 Mai 1801 John, Viscount Fitzgibbon [amtierend] (1749 - 1802)
- 25 Mai 1801 - 13 Feb 1802 Charles Abbot (1757 - 1829) Tor
- 13 Feb 1802 - 6 Feb 1804 William Wickham (1761 - 1840) Tor
- 6 Feb 1804 - 23 Mar 1805 Sir Evan Nepean (1751 - 1822) Tor
- 23 Mar - 21 Sep 1805 Sir Nicholas Vansittart (1766 - 1851) Tor
- 21 Sep 1805 - 28 Mar 1806 Charles Lang Tor
- 28 Mar 1806 - 19 Apr 1807 William Elliot Whg
- 19 Apr 1807 - 13 Apr 1809 Sir Arthur Wellesley (1769 - 1852) Tor
- 13 Apr - 18 Okt 1809 Robert Saunders-Dundas (1771 - 1851) Tor
- 18 Okt 1809 - 4 Aug 1812 William Wellesley-Pole (1763 - 1845) Tor
- 4 Aug 1812 - 4 Aug 1818 Robert Peel (1788 - 1850) Tor
- 3 Aug 1818 - 29 Dez 1821 Charles Grant (1778 - 1866) Tor
- 29 Dez 1821 - 29 Apr 1827 Henry Goulbourn (1784 - 1856) Tor
- 29 Apr 1827 - 21 Jun 1828 William Lamb, Viscount Melbourne (1779 - 1848) Tor
- 21 Jun 1828 - 17 Jul 1830 Francis Egerton Leveson-Gower, Earl Gower (1800 - 1857) Tor
- 17 Jul - 29 Nov 1830 Sir Henry Hardinge (1785 - 1856) Tor
- 29 Nov 1830 - 29 Mar 1833 Edward George Geoffrey Smith, Earl Stanley (1799 - 1869) Whg
- 29 Mar - 17 Mai 1833 Sir John Cam Hobhouse (1786 - 1869) Tor
- 17 Mai 1833 - 16 Dez 1834 Edward John Littleton (1791 - 1863) Tor
- 16 Dez 1834 - 29 Apr 1835 Sir Henry Hardinge [2] Tor
- 29 Apr 1835 - 6 Sep 1841 George William Freceick Howard, Viscount Morpeth (1802 - 1864) Whg
- 6 Sep 1841 - 1 Feb 1845 Edward Graville Elliot, Warl of Saint Germans (1798 - 1877) Con
- 1 Feb 1845 - 14 Feb 1846 Sir Thomas Francis Freemantle, Baron Cottosloe (1798 - 1890) Con
- 14 Feb - 6 Jul 1846 Henry Pelham Pelham-Clinton, Earl of Lincoln (1811 - 1864) Con
- 6 Jul 1846 - 22 Jul 1847 Henry Labouchere (1798 - 1869) Con
- 22 Jul 1847 - 1 Mar 1852 Sir William Meredyth Sommerville (1802 - 1873) Lib
- 1 Mar 1852 - 6 Jan 1853 Richard Southwell Bourke, Earl Naas (1822 - 1872) Con
- 6 Jan 1853 - 1 Mar 1855 Sir John Young (1807 - 1876) Con
- 1 Mar 1855 - 27 Mai 1857 Edward Horsman (1807 - 1876) Lib
- 27 Mai 1857 - 4 Mar 1858 Henry Arthur Albert Lib
- 4 Mar 1858 - 24 Jun 1859 Richard Southwell Bourke, Earl Naas [2] Con
- 24 Jun 1859 - 29 Jul 1861 Edward Cardwell (1813 - 1866) Lib
- 29 Jul 1861 - 7 Dez 1865 Chichester Samuel Parkinson-Fortescue (1823 - 1898) Lib
- 7 Dez 1865 - 26 Jun 1866 Sir Robert Peel (1822 - 1895) Lib
- 6 Jul 1866 - 29 Sep 1868 Richard Southwell Bourke, Earl Naas [3]
- 29 Sep - 16 Dez 1868 James Wilson-Patten (1807 - 1888) Con
- 16 Dez 1868 - 12 Jan 1871 Chicheser Samuel Parkinson-Fortescue [2] Lib
- 12 Jan 1871 - 27 Feb 1874 Spencer Cavendish, Marquis of Hartington (1833 - 1908) Lib
- 27 Feb 1874 - 15 Feb 1878 Sir Michael Edward Hicks-Beach (1837 - 1916) Con
- 15 Feb 1878 - 30 Apr 1880 James Lowther (1840 - 1904) Con
- 30 Apr 1880 - 6 Mai 1882 William Edward Forster (1818 - 1886) Lib
- 6 - 9 Mai 1882 Frederick Charles Cavendish, Earl Cavendish (1836 - 1882) Lib
- 9 Mai 1882 - 23 Okt 1884 Sir George Otto Trevelyan (1838 - 1928) Lib
- 23 Okt 1884 - 25 Jun 1885 Henry Campbell-Bannerman (1836 - 1908) Lib
- 25 Jun 1885 - 23 Jan 1886 Sir William Hart Dyke (1837 - 1931) Con
- 23 Jan - 6 Feb 1886 William Henry Smith (1825 - 1891) Con
- 6 Feb - 5 Aug 1886 John Morley (1838 - 1922) Lib
- 5 Aug 1886 - 7 Mar 1887 Sir Michael Hicks-Beach (1837 - 1916) Con
- 7 Mar 1887 - 9 Nov 1891 Sir Arthur James Balfour (1848 - 1930) Con
- 9 Nov 1891 - 22 Aug 1892 Willliam Lawies Jackson (1840 - 1917) Con
- 22 Aug 1892 - 4 Jul 1895 John Morley [2] Lib
- 4 Jul 1895 - 7 Nov 1900 Gerald Willian Balfour (1853 - 1945) Con
- 7 Nov 1900 - 12 Mar 1905 George Wyndham (1863 - 1913) Con
- 12 Mar - 10 Dez 1905 Walter Hume Long (1854 - 1924) Con
- 10 Dez 1905 - 23 Jan 1907 James Bryce (1838 - 1922) Lib
- 23 Jan 1907 - 31 Jul 1916 Augustine Birrell (1850 - 1933) Lib
- 31 Jul 1916 - 5 Mai 1918 Henry Edward Duke (1855 - 1939) Lib
- 5 Mai 1918 - 10 Jan 1919 Edward Shortt (1862 - 1935) Lib
Republic of Ireland (Republik Irland)
Chairmen of Dáil Éireann (Vorsitzende des Repräsentantenhauses)
- 21 Jan 1919 Cathal Brugha (Charles William Saint John Burgess, 1874 - 1922) SF
- 22 Jan 1919 George Noble, Count Plunkett (1851 - 1948)
Presidents of Dáil Éireann (Präsidenten des Repräsentantenhauses)
- 22 Jan - 1 Apr 1919 Cathal Brugha SF
- 1 Apr 1919 - 9 Jan 1922 Eamon de Valera (1882 - 1975) SF
- 10 Jan - 12 Aug 1922 Arthur Griffith (1872 - 1922) SF
- 12 Aug - 6 Dez 1922 William Thomas Cosgrave [amtierend bis 9 Sep 1922] (1880 - 1965) FG
- 25 Okt 1922 - 24 Mai 1923 Eamon de Valera (in Opposition) FF
Governors-general (Generalgouverneure als Repräsentanten der britischen Krone)
- 6 Dez 1922 - 31 Jan 1928 Timothy Michael Healy (1855 - 1931)
- 1 Feb 1928 - 1 Nov 1932 James McNeill (1869 - 1938)
- 27 Nov 1932 - 12 Dez 1936 Domhnall Ua Buachalla (Donald Buckley, 1865 - 1963)
- 12 Dez 1936 - 29 Dez 1937 Francis „Frank” Patrick Fahy (Proinsias Pádraig Ó Fathaigh, 1880 - 1953) FF & Eamon de Valera FF [amtierend]
Presidents (Präsidenten)
- 29 Dez 1937 - 25 Jun 1938 Präsidentialkommission [amtierend] mit Timothy Sullivan (1874 - 1949), Francis „Frank“ Patrick Fahy FF und Conor Alexander Maguire (1889 - 1971)
- 25 Jun 1938 - 24 Jun 1945 Douglas Hyde (1860 - 1949) FF
- 25 Jun 1945 - 24 Jun 1959 Sean Thomas O'Kelly (1882 - 1966) FF
- 25 Jun 1959 - 24 Jun 1973 Eamon de Valera FF
- 25 Jun 1973 - 17 Nov 1974 Erskine Hamilton Childers (1905 - 1974) FF
- 17 Nov - 18 Dez 1974 Präsidentialkommission [amtierend] miut Sean Treacy (* 1923) LP, James Clement Dooge (* 1922) FG und Thomas Francis O'Higgins (1916 - 2003)
- 19 Dez 1974 - 22 Okt 1976 Cearbhall O Dalaigh (1911 - 1978) FF
- 22 Okt - 2 Dez 1976 Präsidentialkommission [amtierend] mit Sean Treacy [2] LP, James Clement Dooge [2] FG und Thomas Francis O'Higgins [2]
- 3 Dez 1976 - 2 Dez 1990 Patrick John Hillery (1923 - 2008) FF
- 3 Dez 1990 - 12 Sep 1997 Mary Terese Winifred Bourke Robinson [w] (* 1944) LP
- 12 Sep - 10 Nov 1997 Präsidentialkommission [amtierend] mit Liam Hamilton (1928 - 2000), Seamus Pattison (1936 - 2018) LP, Liam Thomas Cosgrave (bis 17 Sept 1997, * 1956) FG und Brian Mullooly (ab 17 Seot 1997, * 1935) FF
- 11 Nov 1997 - 11 Nov 2011 Mary Patricia Leneghan McAleese [w] (* 1951) FF
- seit 11 Nov 2011 Michael Daniel Higgins (* 1941) LP
- Principal Secretaries of State for Ireland (Leitende Sekretäre des Staates Irland)
- Mai 1560 - 11 Mai 1581 Sir John Challoner (um 1525 – 1581)
- 11 Mai 1581 - 19 Okt 1608 Geoffrey Fenton (ab 5 Jan 1589 Sir, um 1539 – 1608)
- 1608 - 8 Sep 1615 Sir Richard Cooke (1561 - 1616)
- 25 Sep 1615 - 12 Jul 1634 Sir Dudley Norton († 1634)
- 31 Okt 1616 - 12 Jul 1634 Sir Francis Annesley of Mountnorris (ab 8 Feb 1629 Sir, 1584 - 1660)
- 12 Jul 1634 - 1 Jun 1648 Sir Philip Mainwaring (1589 - 1661)
- 1 Jun 1648 - Mai 1660 Francis Annesley, Baron Mountnorris of Mountnorris [2]
- Mai 1660 - 6 Jul 1661 Sir Philip Mainwaring [2]
- 6 Jul 1661 - 7 Dez 1672 Sir Paul Davis (Davys) (um 1600 – 1672)
- 7 Dez 1672 - 11 Dez 1683 George Lane, Viscount Lanesborough (ab 31 Jul 1676 Sir, 1620 - 1683)
- 11 Dez 1683 - Nov 1689 Sir John Davys (Davis) (1646 - 1689)
- 25 Jul 1690 - 13 Jul 1702 Sir Robert Southwell (1635 - 1702) Tor
- 13 Jul 1702 - 4 Dez 1730 Edward Southwell, Sr. Tor
- 4 Dez 1730 - 16 Mar 1755 Edward Southwell, Jr. (1705 - 1755) Whg
- 13 Nov 1755 - 3 Sep 1763 Thomas Carter, Sr. (1664? – 1763) Whg
- 3 Sep 1763 - 11 Sep 1777 Philip Tisdall (1703 - 1777) Whg
- 11 Sep 1777 - 4 Sep 1794 John Hely-Hutchinson (1724 - 1794) Whg
- 22 Jun 1795 - 24 Jul 1797 Edmund Henry Pery, Baron Glentworth (Hüter des Privatsiegels, 1758 - 1844) Tor
- 24 Jun 1796 - 12 Jun 1801 Thomas Pelham (1756 - 1826) Whg
- 24 Jul 1797 - 12 Jun 1801 Robert Stewart, Viscount Castlereagh (Hüter des Privatsiegels, 1769 - 1822) Tor
- 12 Jun 1801 - 11 Feb 1802 Charles Abbot (1757 - 1829) Tor
Chief Secretaries for Ireland (beigeordnet dem Lord Lieutenants)
- 20 Jan 1566 - 9 Okt 1567 Edward Waterhouse (1535 - 1591)
- 28 Okt 1568 - 15 Jul 1569 Edward Waterhouse [2]
- 15 Jul 1569 - 31 Mar 1571 Edmund Tremayne (um 1525 – 1582)
- 13 Jan 1572 - 17 Sep 1575 Philip Williams
- 18 Sep 1575 - 1578? Edmund Molyneux (15.. - 1605)
- 7 Sep 1580 - 30 Aug 1582 Edmund Spenser (1552? - 1599)
- 21 Jun 1584 - 10 Aug 1594 Philip Williams [2]
- 11 Aug 1594 - 21 Mai 1597 Richard Cooke (1561 - 1616)
- 22 Mai - 13 Okt 1597 Philip Williams [3]
- 15 Apr 1599 - 4 Sep 1599 Henry Wotton (1568 - 1639)
- 27 Feb 1600 - Mar 1600 Francis Mitchell (um 1556 – um 1628)
- Mar - 13 Nov 1600 George Cranmer (1563 - 1600)
- 14 Nov 1600 - 31 Mai 1603 Fynes Moryson (Morison) (1566 - 1630)
- 1 Jun 1603 - 2 Feb 1605 John Bingley (um 1572 - 1638)
- 3 Feb 1605 - 10 Feb 1616 Henry Piers (1568 - 1623)
- 30 Aug 1616 - 3 Mai 1622 Henry Holcroft (ab 1 Mai 1622 Sir, 1586 – 1650)
- 8 Sep 1622 - 25 Okt 1629 Sir John Veele (Veale) (15.. - 1648)
- 25 Jul 1633 - 11 Sep 1639 Sir George Radcliffe (1593 - 1657)
- 14 Nov 1642 - 15 Sep 1643 Richard Butler, Viscount Mountgarret (President of Supreme Council of Catholic Confederation in Rebellion, 1578 - 1651)
- 21 Jan 1644 - Apr 1646 George Lane (Royalist, für Earl of Ormonde bis 28 Jul 1647, um 1620 - 1683)
- 3 Okt 1648 - 11 Dez 1650 George Lane [2] (Royalist, für Earl of Ormonde)
- Jan 1651 - 22 Aug 1654 Commissioners for Civil Affairs of Parliament mit Edmund Ludlow (um 1617 - 1692), John Jones (um 1597 - 1660), Miles Corbet (1595 - 1662) und John Weaver (160. - 1685)
- 1652 - 1659 Thomas Herbert (Secretary to the commissioners bis Aug 1654, danach Ratsbeamter, 1606 - 1686)
- Jun - Dez 1660 Matthew Locke (Lock, † 1683)
- 27 Jul 1662 - 17 Sep 1669 Sir Thomas Page († 1681)
- 18 Sep 1669 - 20 Mai 1670 Henry Ford (1617 - 1684)
- 21 Mai 1670 - 4 Aug 1672 Sir Ellis (Elisha) Leighton (1615? - 1684)
- 5 Aug 1672 - 10 Dez 1673 Sir Henry Ford [2]
- 11 Dez 1673 - 23 Aug 1676 William Harbord (1635 - 1692)
- 24 Aug 1676 - 1 Mai 1682 Sir Cyril Wyche
- 24 Aug 1676 - 1 Mai 1682 William Ellis (acting for Wyche) (1647 - 1732)
- 2 Mai 1682 - 19 Mar 1685 William Ellis
- 9 Jan 1686 - 11 Feb 1687 Sir Paul Rycaut (1628 - 1700)
- 12 Feb 1687 - 20 Jan 1688 Thomas Sheridan (1646 - 1712)
- 2 Feb 1688 - 24 Jan 1689 Patrick Tyrrell, Bishop of Clogher (1627 - 1692)
- Sep 1690 - Mar 1692 John Davis (Davys)
- 4 Sep 1692 - 2 Jul 1693 Sir Cyril Wyche [2]
- 27 Mai 1695 - 16 Mai 1696 Sir Richard Aldworth (163. - af.1696)
- 30 Jul 1696 - Mai 1697 William Palmer (1657 - 1726)
- 13 Jun 1697 - 24 Nov 1699 Matthew Prior (1664 - 1721)
- Nov 1699 - Apr 1700 Humphrey Mai (1674 - 1722)
- 28 Dez 1700 - 18 Feb 1703 Francis Gwyn (1648 - 1734) Tor
- 19 Feb 1703 - 29 Apr 1707 Edward Southwell (1671 - 1730) Tor
- 30 Apr 1707 - 3 Dez 1708 George Dodington (um 1662 - 1720) Whg
- 4 Dez 1708 - 25 Okt 1710 Joseph Addison (1672 - 1719) Whg
- 26 Okt 1710 - 21 Sep 1713 Edward Southwell [2] Tor
- 22 Sep 1713 - 3 Okt 1714 Sir John Stanley (1663 - 1744) Tor
- 4 Okt 1714 - 23 Aug 1715 Joseph Addison [2] Whg
- Sep 1715 - 27 Apr 1717 Martin Bladen (1680 - 1746) Whg & Charles Delafaye (1677 - 1762) Whg
- 27 Apr 1717 - 7 Jun 1720 Edward Webster (b.bf.1691 - 1755)Whg
- 8 Jun 1720 - Aug 1721 Horatio Walpole (1678 - 1757) Whg
- Aug 1721 - 5 Mai 1724 Edward Hopkins (1674/75-1736) Whg
- 6 Mai 1724 - 22 Jun 1730 Thomas Clutterbuck (1697 - 1742) Whg
- 23 Jun 1730 - 8 Apr 1737 Walter Cary (Carey) (1685 - 1757) Whg
- 9 Apr 1737 - 11 Mai 1739 Sir Edward Walpole (1706 - 1784) Whg
- 12 Mai 1739 - 13 Okt 1739 Thomas Townshend (1701 - 1780) Whg
- 14 Okt 1739 - 7 Jun 1741 Henry Bilson Legge (1708 - 1764) Whg
- 8 Jun 1741 - 7 Jan 1745 William Ponsonby, Viscount Duncannon (1704 - 1793) Whg
- 8 Jan 1745 - 22 Jun 1746 Richard Liddell (1694? - 1746) Whg
- 5 Jul - 14 Nov 1746 Sewallis Shirley (1709 - 1765) Whg
- 15 Nov 1746 - 14 Dez 1750 Edward Weston (1703 - 1770) Whg
- 15 Dez 1750 - 1 Apr 1755 Lord George Sackville (1716 - 1785) Whg
- 2 Apr 1755 - 2 Jan 1757 Henry Seymour Conway (1721 - 1795) Whg
- 3 Jan 1757 - 2 Apr 1761 Richard Rigby (1722 - 1788) Whg
- 3 Apr 1761 - 2 Jul 1764 William Gerard Hamilton (1729 - 1796) Whg
- 3 Jul 1764 - 4 Jun 1765 Charles Moore, Earl of Drogheda (1730 - 1821) Whg
- 5 Jun - 6 Aug 1765 Sir Charles Bunbury (1740 - 1821) Whg
- 7 Aug 1765 - 5 Okt 1766 Francis Seymour Conway, Viscount Beauchamp (1718 - 1794) Whg
- 6 Okt 1766 - 6 Jul 1767 Augustus John Hervey (1724 - 1779) Whg
- 9 Jul 1767 - 18 Aug 1767 Theophilus Jones (1729? - 1811) Whg
- 19 Aug 1767 - 31 Dez 1768 Lord Frederick Campbell (1729 - 1816) Tor
- 1 Jan 1769 - 30 Nov 1772 Sir George Macartney (1737 - 1806) Tor
- 30 Nov 1772 - 6 Dez 1776 Sir John de Blaquiere (1732 - 1812) Tor
- 13 Dez 1776 - 28 Nov 1780 Sir Richard Heron, Earl of Buckingham (ab 25 Jul 1778 Richard Heron, Baron Heron, 1726 - 1805) Tor
- 29 Nov 1780 - 7 Apr 1782 William Eden (1744 - 1814) Tor
- 8 Apr - 14 Aug 1782 Richard FitzPatrick (1747 - 1813) Whg
- 15 Aug 1782 - 2 Mai 1783 William Wyndham Grenville (1759 - 1834) Whg
- 3 Mai - 26 Aug 1783 William Windham (1750 - 1810) Whg
- 27 Aug 1783 - 11 Feb 1784 Thomas Pelham Whg
- 12 Feb 1784 - 24 Okt 1787 Thomas Orde (1740 - 1807) Tor
- 6 Nov 1787 - 5 Apr 1789 Alleyne FitzHerbert (1753 - 1839) Tor
- 6 Apr 1789 - 15 Dez 1793 Robert Hobart (1760 - 1816) Tor
- 16 Dez 1793 - 12 Dez 1794 Sylvester Douglas (1743 - 1823) Tor
- 13 Dez 1794 - 12 Mar 1795 George Damer, Viscount Milton (1746 - 1808) Whg
- 13 Mar 1795 - 2 Nov 1798 Thomas Pelham [2] Whg
- 3 Nov 1798 - 26 Apr 1801 Robert Stewart, Viscount Castlereagh Tor
- 26 Apr - 25 Mai 1801 John, Viscount Fitzgibbon (acting) (1749 - 1802) Tor
- 25 Mai 1801 - 13 Feb 1802 Charles Abbot Tor
- 13 Feb 1802 - 6 Feb 1804 William Wickham (1761 - 1840) Tor
- 6 Feb 1804 - 23 Mar 1805 Sir Evan Nepean (1751 - 1822) Tor
- 23 Mar - 21 Sep 1805 Nicholas Vansittart (1766 - 1851) Tor
- 21 Sep 1805 - 28 Mar 1806 Charles Long (1761 - 1838) Tor
- 28 Mar 1806 - 19 Apr 1807 William Elliot (1766 - 1818) Whg
- 19 Apr 1807 - 13 Apr 1809 Sir Arthur Wellesley (1769 - 1852) Tor
- 13 Apr - 18 Okt 1809 Robert Saunders-Dundas (1771 - 1851) Tor
- 18 Okt 1809 - 4 Aug 1812 William Wellesley-Pole (1763 - 1845) Tor
- 4 Aug 1812 - 4 Aug 1818 Robert Peel (1788 - 1850) Tor
- 3 Aug 1818 - 29 Dez 1821 Charles Grant (1778 - 1866) Tor
- 29 Dez 1821 - 29 Apr 1827 Henry Goulbourn (1784 - 1856) Tor
- 29 Apr 1827 - 21 Jun 1828 William Lamb, Viscount Melbourne (1779 - 1848) Whg
- 21 Jun 1828 - 17 Jul 1830 Francis Egerton Leveson-Gower, Earl Gower (1800 - 1857) Tor
- 17 Jul - 15 Nov 1830 Sir Henry Hardinge (1785 - 1856) Tor
- 29 Nov 1830 - 29 Mar 1833 Edward George Geoffrey Smith Stanley, Earl Stanley (1799 - 1869) Whg
- 29 Mar - 17 Mai 1833 Sir John Cam Hobhouse (1786 - 1869) Whg
- 17 Mai 1833 - 14 Nov 1834 Edward John Littleton (1791 - 1863) Whg
- 16 Dez 1834 - 8 Apr 1835 Sir Henry Hardinge [2] Con
- 29 Apr 1835 - 30 Aug 1841 George William Freceick Howard, Viscount Morpeth (1802 - 1864) Whg
- 6 Sep 1841 - 1 Feb 1845 Edward Granville Eliot, Earl of Saint Germans Con
- 1 Feb 1845 - 14 Feb 1846 Sir Thomas Francis Freemantle (1798 - 1890) Con
- 14 Feb - 6 Jul 1846 Henry Pelham Pelham-Clinton, Earl of Lincoln (1811 - 1864) Peelite
- 6 Jul 1846 - 22 Jul 1847 Henry Labouchere Lib
- 22 Jul 1847 - 21 Feb 1852 Sir William Meredyth Sommerville (1802 - 1873) Lib
- 1 Mar - 17 Dez 1852 Richard Southwell Bourke, Earl Naas (1822 - 1872) Con
- 6 Jan 1853 - 30 Jan 1855 Sir John Young (1807 - 1876) Peelite
- 1 Mar 1855 - 27 Mai 1857 Edward Horsman (1807 - 1876) Lib
- 27 Mai 1857 - 21 Feb 1858 Henry Arthur Herbert (1815 - 1866) Lib
- 4 Mar 1858 - 24 Jun 1859 Richard Southwell Bourke, Earl Naas [2] Con
- 24 Jun 1859 - 29 Jul 1861 Edward Cardwell (1813 - 1866) Lib
- 29 Jul 1861 - 7 Dez 1865 Sir Robert Peel (1822 - 1895) Lib
- 7 Dez 1865 - 26 Jun 1866 Chichester Samuel Parkinson-Fortescue (1823 - 1898) Lib
- 10 Jul 1866 - 29 Sep 1868 Richard Southwell Bourke, Earl Naas [3] Con
- 29 Sep - 1 Dez 1868 James Wilson-Patten (1807 - 1888) Con
- 16 Dez 1868 - 12 Jan 1871 Chicheser Samuel Parkinson-Fortescue [2] Lib
- 12 Jan 1871 - 17 Feb 1874 Spencer Cavendish, Marquis of Hartington (1833 - 1908) Lib
- 27 Feb 1874 - 15 Feb 1878 Sir Michael Edward Hicks-Beach (1837 - 1916) Con
- 15 Feb 1878 - 21 Apr 1880 James Lowther (1840 - 1904) Con
- 30 Apr 1880 - 6 Mai 1882 William Edward Forster (1818 - 1886) Lib
- 6 - 9 Mai 1882 Frederick Charles Cavendish, Earl Cavendish (1836 - 1882) Lib
- 9 Mai 1882 - 23 Okt 1884 George Otto Trevelyan (1838 - 1928) Lib
- 23 Okt 1884 - 9 Jun 1885 Henry Campbell-Bannerman (1836 - 1908) Lib
- 25 Jun 1885 - 23 Jan 1886 Sir William Hart Dyke (1837 - 1931) Con
- 23 Jan 1886 - 6 Feb 1886 William Henry Smith (1825 - 1891) Con
- 6 Feb - 20 Jul 1886 John Morley (1838 - 1922) Lib
- 5 Aug 1886 - 7 Mar 1887 Sir Michael Hicks-Beach (1837 - 1916) Con
- 7 Mar 1887 - 9 Nov 1891 Arthur James Balfour (1848 - 1930) Con
- 9 Nov 1891 - 11 Aug 1892 Willliam Lawies Jackson (1840 - 1917) Con
- 22 Aug 1892 - 4 Jul 1895 John Morley [2] Lib
- 4 Jul 1895 - 9 Nov 1900 Gerald William Balfour (1853 - 1945) Con
- 9 Nov 1900 - 12 Mar 1905 George Wyndham (1863 - 1913) Con
- 12 Mar - 4 Dez 1905 Walter Hume Long (1854 - 1924) Con
- 14 Dez 1905 - 29 Jan 1907 James Bryce (1838 - 1922) Lib
- 29 Jan 1907 - 3 Mai 1916 Augustine Birrell (1850 - 1933) Lib
- 3 Aug 1916 - 11 Mai 1918 Henry Edward Duke (1855 - 1939) Con
- 11 Mai 1918 - 13 Jan 1919 Edward Shortt (1862 - 1935) Lib
- 13 Jan 1919 - 12 Apr 1920 James Ian Mcpherson (1880 - 1937) Lib
- 12 Apr 1920 - 19 Okt 1922 Sir James Hamar Greenwood (1870 - 1948) Lib
Chief Secretaries (Chefsekretäre)
- 10 Jan 1919 - 2 Apr 1920 James Ian Mcpherson (1880 - 1937) Lib
- 2 Apr 1920 - 19 Okt 1922 Sir James Hamar Greenwood (1870 - 1948) Lib
Chairmen of the Provisional Government (Vorsitzende der provisorischen Regierung)
- 16 Jan - 22 Aug 1922 Michael Collins (1890 - 1922) SF
- 17 Jul - 6 Dez 1922 William Thomas Cosgrave [amtierend bis 25 Aug 1922, für Collins bis 22 Aug 1922] FG
Presidents of the Executive Council (Präsidenten des Exekutivrats)
- 6 Dez 1922 - 9 Mar 1932 William Thomas Cosgrave FG
- 9 Mar 1932 - 29 Dez 1937 Eamon de Valera FF
Taoiseach (Premierminister)
- 29 Dez 1937 - 18 Feb 1948 Eamon de Valera FF
- 18 Feb 1948 - 13 Jun 1951 John Aloysius Costello (1891 - 1976) FG
- 13 Jun 1951 - 2 Jun 1954 Eamon de Valera [2] FF
- 2 Jun 1954 - 20 Mar 1957 John Aloysius Costello [2] FG
- 20 Mar 1957 - 23 Jun 1959 Eamon de Valera [3] FF
- 23 Jun 1959 - 10 Nov 1966 Sean Francis Lemass (1899 - 1971) FF
- 10 Nov 1966 - 14 Mar 1973 John Mary „Jack“ Lynch (1917 - 1999) FF
- 14 Mar 1973 - 5 Jul 1977 William „Liam“ Thomas Cosgrave (1920 - 2017) FG
- 5 Jul 1977 - 11 Dez 1979 John Mary „Jack“ Lynch [2] FF
- 11 Dez 1979 - 30 Jun 1981 Charles James Haughey (1925 - 2006) FF
- 30 Jun 1981 - 9 Mar 1982 Garret FitzGerald (1926 - 2011) FG
- 9 Mar - 14 Dez 1982 Charles James Haughey [2] FF
- 14 Dez 1982 - 10 Mar 1987 Garret FitzGerald [2] FG
- 10 Mar 1987 - 11 Feb 1992 Charles James Haughey [3] FF
- 11 Feb 1992 - 15 Dez 1994 Albert Martin Reynolds (1932 - 2014) FF
- 15 Dez 1994 - 26 Jun 1997 John Gerard Bruton (1947 - 2024) FG
- 26 Jun 1997 - 7 Mai 2008 Bartholomew „Bertie” Patrick Ahern (* 1951) FF
- 7 Mai 2008 - 9 Mar 2011 Brian Bernard Cowen (* 1960) FF
- 9 Mar 2011 - 14 Jun 2017 Enda Patrick Kenny (* 1951) FG
- 14 Jun 2017 - 27 Jun 2020 Leo Eric Varadkar (* 1979) FG
- 27 Jun 2020 - 27 Dez 2022 Micheál Martin (* 1960) FF
- 27 Dez 2022 - 9 Apr 2024 Leo Eric Varadkar [2] FG
- 9 Apr 2024 - 23 Jan 2025 Simon Harris (* 1986) FG
- seit 23 Jan 2025 Micheál Martin [2] FG
Northern Ireland (Nordirland):
Governors (Gouverneure)
- 12 Dez 1922 - 7 Sep 1945 James Albert Edward Hamilton, Duke of Abercorn (1869 - 1953)
- 7 Sep 1945 - 1 Dez 1952 William Spencer Leveson Gower, Earl Granville (1880 - 1953)
- 3 Dez 1952 - 1 Dez 1964 John de Vere Loder, Baron Wakehurst (1895 - 1970)
- 3 Dez 1964 - 2 Dez 1968 John Maxwell Erskine, Baron Erskine of Rerrick (1893 - 1980)
- 3 Dez 1968 - 18 Jul 1973 Ralph Francis Alnwick Grey, Baron Grey of Naunton (1910 - 1999)
Secretaries of State for Northern Ireland (Staatssekretäre für Nordirland)
- 1 Apr 1972 - 2 Dez 1973 William Shepard Ian Whitelaw (1918 - 1999) Con
- 2 Dez 1973 - 5 Mar 1974 Francis Leslie Pym (1922 - 2008) Con
- 5 Mar 1974 - 10 Sep 1976 Merlyn Merlyn-Rees (1920 - 2006) Lab
- 10 Sep 1976 - 5 Mai 1979 Roy Mason (1924 - 2015) Lab
- 5 Mai 1979 - 14 Sep 1981 Humphrey Edward Atkins (1922 - 1996) Con
- 14 Sep 1981 - 10 Sep 1984 James Michael Leathes Prior (1927 - 2016) Con
- 10 Sep 1984 - 2 Sep 1985 Douglas Richard Hurd (* 1930) Con
- 2 Sep 1985 - 24 Jul 1989 Thomas „Tom” Jeremy King (* 1933) Con
- 24 Jul 1989 - 2 Apr 1992 Peter Leonard Brooke (* 1934) Con
- 9 Apr 1992 - 3 Mai 1997 Sir Patrick Barnabas Burk Maihew (1929 - 2016) Con
- 3 Mai 1997 - 11 Okt 1999 Marjorie „Mo” Mowlam [w] (1951 - 2005) Lab
- 11 Okt 1999 - 24 Jan 2001 Peter Benjamin Mandelson (* 1953) Lab
- 24 Jan 2001 - 24 Okt 2002 John Reid (* 1947) Lab
- 24 Okt 2002 - 6 Mai 2005 Paul Peter Murphy (* 1948) Lab
- 6 Mai 2005 - 28 Jun 2007 Peter Gerald Hain (auch Secretary of State for Wales, * 1950) Lab
- 28 Jun 2007 - 12 Mai 2010 Shaun Anthony Woodward (* 1958) Lab
- 12 Mai 2010 - 4 Sep 2012 Owen William Paterson (* 1956) Con
- 4 Sep 2012 - 14 Jul 2016 Theresa Anne Villiers [w] (* 1968) Con
- 14 Jul 2016 - 11 Jan 2018 James Peter Bropkenshire (1968 - 2021) Con
- 11 Jan 2018 - 25 Jul 2019 Karen Anne Bradley [w] (* 1970) Con
- 25 Jul 2019 - 13 Feb 2020 Julian Richard Smith (* 1971) Con
- 13 Feb 2020 - 7 Jul 2022 Brandon Kenneth Lewis (* 1971) Con
- 7 Jul - 13 Sep 2022 Shailesh Lakhman Cvara (* 1960) Con
- 13 Sep 2022 - 5 Jul 2024 Christopüher „Chris“ Heaton-Harris (* 1967) Con
- seit 5 Jul 2024 Hilary James Wedgwood Benn (* 1953) Lab
Prime Ministers (Premierminister)
- 7 Jun 1921 - 24 Nov 1940 Sir James Craig (ab 1927 James Craig, Viscount Craigavon, 1871 - 1940) UUP
- 27 Nov 1940 - 1 Mai 1943 John Miller Andrews [amtierend bis 27 Nov 1940] (1871 - 1956) UUP
- 1 Mai 1943 - 26 Mar 1963 Sir Basil Stanlake Brooke (ab 1952 Basil Stanlake Brooke, Viscount Brookeborough of Colebrooke, 1888 - 1973) UUP
- 26 Mar 1963 - 1 Mai 1969 Terence Marne O’Neill (1914 - 1990) UUP
- 1 Mai 1969 - 23 Mar 1971 James Dawson Chichester-Clark (1923 - 2002) UUP
- 23 Mar 1971 - 30 Mar 1972 Arthur Brian Faulkner (1921 - 1977) UUP
- Chief executive (Oberster Exekutiv-Beamter)
- 1 Jan - 28 Mai 1974 Arthur Brian Faulkner UUP
First ministers (Erste Minister)
- 1 Jul 1998 - 1 Jul 2001 Willliam David Trimble [suspendiert 11 Feb - 30 Mai 2000] (1944 - 2022) UUP
- 1 Jul - 18 Okt 2001 Sir Reginald Norman Morgan „Reg“ Empey [amtierend, suspendiert 10-11 Aug 2001 und 22-23 Sep 2001] (* 1947) UUP
- 6 Nov 2001 - 15 Okt 2002 William David Trimble [2] UUP
- 8 Mai 2007 - 5 Jun 2008 Ian Richard Kyle Paisley (1926 - 2014) DUP
- 5 Jun 2008 - 13 Jan 2016 Peter David Robinson (* 1948) DUP
- 11 Jan - 12 Feb 2010 Arlene Isabel Foster [w, amtierend für Robinson] (* 1970) DUP
- 10 Sep - 20 Okt 2015 Arlene Isabel Foster [2, w. amtierend für Robinson] DUP
- 11 Jan 2016 - 9 Jan 2017 Arlene Isabel Foster [3, w] DUP
- 11 Jan 2020 - 17 Jun 2021 Arlene Isabel Foster [4, w] DUP
- 17 Jun 2021 - 3 Feb 2022 Paulk Jonathan Givan (* 1981) DUP
- seit 3 Feb 2024 Michelle D oris O’Neill [w] (* 1077) SF
Politische Gruppierungen
Es gibt eine Reihe von aktiven politischen Parteien in der Republik Irland und Koalitionsregierungen sind üblich. Ungewöhnlich ist, dass die irische Politik nicht wie sonst in ein rechts-links-Schema passt, da die beiden größten Parteien Fianna Fáil und Fine Gael sich selbst in erster Linie nicht als Mitte-Links- bzw. Mitte-Rechts-Parteien bezeichnen. Beide Parteien bildeten sich nach einer Spaltung der politischen Landschaft zur Zeit des Anglo-Irischen Vertrags und des folgenden Irischen Bürgerkriegs und stammen ursprünglich von der Partei Sinn Féin ab. Fine Gael von der Fraktion der Unterstützer des Vertrags und Fianna Fáil von der der Fraktion der Vertragsgegner.
Historisch gesehen, wird Fine Gael, als Partei für Geschäftsleute und Farmer, meist als Mitte-Rechts-Partei charakterisiert, auch wenn diese Bezeichnung sehr oberflächlich ist. Zum Beispiel war in den 1960er Jahren die Partei ein Sinnbild der Sozialdemokratie und jegliche Regierungszeiten von Fine Gael gingen mit einer Labour Party-Koalition einher. Auf der anderen Seite wird Fianna Fáil oft als Mitte-Links-Partei bezeichnet, doch auch Fianna Fáil betreibt eine eher rechtsgerichtete Wirtschaftspolitik und ging bereits einige Male eine Koalition mit den eher rechts angesiedelten Progressive Democrats ein.
Als traditionelle Mitte-Links-Partei kann die Labour Party angesehen werden, Irlands drittstärkste Partei. Die Labour Party war in der Vergangenheit bereits Koalitionspartner von sowohl Fianna Fáil als auch Fine Gael. Kleinere Linksparteien sind die moderne Sinn Féin-Partei, die Grünen, die Socialist Party und die Communist Party of Ireland. Der rechte Flügel wurde durch die Progressive Democrats vertreten. Die Progressive Democrats haben sich am 8. November 2008 aufgelöst.
Neben den Parteimitgliedern sitzen im irischen Unterhaus (Dáil Éireann) auch unabhängige Parlamentarier, die eine große Rolle in der irischen Politik spielen können, da sie oft das Zünglein an der Waage für Minderheiten-Regierungen bzw. knappe Koalitionen sind. Aktuell im Unterhaus vertretene Parteien sind:
- Fianna Fáil: Gegründet 1926 von Eamon de Valera kam die Partei 1932 erstmals an die Macht und ist seitdem die stärkste Partei des Unterhauses.
- Fine Gael: Gegründet 1933 durch den Zusammenschluss von Cumann na nGaedhael, der Centre Party und den Blueshirts. Seit ihrer Gründung ist die Partei die zweitstärkste Kraft und stellte bereits (meist mit der Labour Party) diverse Koalitionsregierungen.
- Labour Party: Gegründet 1912 durch James Connolly als politischer Flügel der Gewerkschaftsbewegung. Bis 1927 galt die Labour Party als Haupt-Opposition im Dáil. Seitdem stellte sie diverse Koalitionsregierungen mit Fianna Fáil und Fine Gael.
- Green Party: Gegründet 1981 wuchsen die Grünen (auch Comhaontas Glas genannt) langsam von einer Randbewegung zu einer mittelgroßen Partei heran. Seit Juni 2007 zusammen mit Fianna Fáil und Progressive Democrats in einer Regierungskoalition.
- Sinn Féin: Der Name Sinn Féin wurde seit 1905 für diverse politische Bewegungen in Irland gebraucht und jede behauptete von sich, von der original Sinn Féin-Partei (gegründet von Arthur Griffith) abzustammen. Die größte der heutigen Sinn Féin-Parteien ist eng mit der provisorischen IRA verbunden und die einzige Partei, die sowohl in der Republik Irland als auch in Nordirland Sitze im Unterhaus besitzt.
Aktive Parteien ohne Sitz im Unterhaus sind:
- Socialist Party: Gegründet 1996 von trotzkistischen Mitgliedern der Labour Party. Sie hat bisher lediglich geringen Erfolg; hauptsächlich in Arbeitervierteln von Dublin und Cork.
- Communist Party of Ireland: Erstmals gegründet 1933, entstammt die aktuelle Partei aus den 1970er Jahren, als sich die Kommunistische Partei von Nordirland mit der Irish Workers Party zusammenschloss.
- Christian Solidarity Party
- Republican Sinn Féin
- Republican Socialist Party
- Socialist Workers Party: Eine antikapitalistische Partei, die zum Aufstand der Arbeiterklasse aufruft.
- Workers Party
Ehemalige politische Parteien sind:
- Blueshirts (eigentlich Army Comrades Association)
- Centre Party
- Clann na Poblachta
- Clann na Talmhan
- Cumann na nGaedhael
- Cumann Poblachta na hÉireann
- Democratic Left
- Democratic Socialist Party
- Home Rule League
- Irish Parliamentary Party
- National Labour Party
- Nationalist Party
- National Progressive Democrats
- Progressive Democrats
- Saor Éire
- Socialist Labour Party
- Socialist Party of Ireland
Die Parteienlandschaft Nordirlands ist traditionell konfessionell geprägt. Die etablierten britischen Parteien wie die Konservative Partei,Aktive Parteiendie Labour Party sowie die Liberal Democrats spielen dort keine Rolle und stellen auch (mit Ausnahme der Konservativen) keine Kandidaten für Wahlen auf.
Aktive Parteien
Unionistisch und loyalistisch
- Democratic Unionist Party (DUP)
- Progressive Unionist Party (PUP)
- Traditional Unionist Voice (TUV)
- Ulster Unionist Party (UUP)
- United Kingdom Independence Party (UKIP)
- United Unionist Coalition (UUC)
Nationalistisch und republikanisch
- Éirígí
- Fianna Fáil (FF)
- Irish Republican Socialist Party (IRSP)
- Republican Sinn Féin (RSF)
- Sinn Féin (SF)
- Social Democratic and Labour Party (SDLP)
Sonstige
- Alliance Party of Northern Ireland
- Communist Party of Ireland
- Socialist Party
- Socialist Workers Party
- Conservatives in Northern Ireland
- Green Party in Northern Ireland
- Labour – Federation of Labour Groups
- Labour Party of Northern Ireland
- Official Monster Raving Loony Party
- Respect – The Unity Coalition
- Socialist Environmental Alliance
- Ulster Christian Democratic Party
- Ulster Third Way
- Veritas
- Vote for Yourself Party
- Workers' Party of Ireland
- Liberal democrats
- British Labour Party
- Fianna Fáil
Nicht mehr aktive Parteien
Unionistisch und loyalistisch
- British Ulster Dominion Party
- Commonwealth Labour Party
- Independent Unionist Association
- Labour Unionist Party
- Northern Ireland Unionist Party (formell noch existierend)
- Protestant Unionist Party (aufgegangen in der DUP)
- Ulster Constitution Party
- Ulster Democratic Party
- Ulster Loyalist Democratic Party
- Ulster Popular Unionist Party
- Ulster Progressive Unionist Association
- Ulster Protestant League
- Ulster Resistance
- Ulster Unionist Labour Association
- Unionist Party of Northern Ireland
- United Kingdom Unionist Party (formell noch existierend)
- United Ulster Unionist Council
- United Ulster Unionist Party
- Vanguard Progressive Unionist Party
- Volunteer Political Party
Nationalistisch und republikanisch
- All Ireland Anti-Partition League
- Federation of Labour
- Fianna Uladh
- Irish Anti-Partition League
- Independent Socialist Party
- Irish Independence Party
- National Democratic Party
- National Democrats
- National League of the North
- National Unity
- Nationalist Party
- Northern Council for Unity
- Official Sinn Féin (heute Workers' Party of Ireland)
- People's Democracy
- Red Republican Party
- Republican Congress
- Republican Labour Party
- Saor Éire
- Socialist Republican Party
- Unity
Sonstige
- Belfast Labour Party
- Commonwealth Labour Party
- Communist Party of Ireland (marxistisch-leninistisch)
- Communist Party of Northern Ireland
- Irish Labour Party (in der Republik noch existierend)
- Labour Party of Northern Ireland
- Northern Ireland Labour Party
- Northern Ireland Women's Coalition
- Newtownabbey Ratepayers Association
- Natural Law Party
- Social Democratic Party
- Ulster Independence Movement
- Ulster Liberal Party
- Ulster Movement for Self-Determination
Wahlen
In der Republik Irland finden auf nationaler Ebene folgende Wahlen statt:
- Wahlen zum irischen Unterhaus, dem Dáil Éireann
- Präsidentschaftswahlen
- Europawahl
- Regionalwahlen (sogenannte local elections)
Der Dáil ist das Unterhaus des irischen Parlaments Oireachtas. Das Unterhaus besteht aus 166 Mitgliedern, die für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt werden. Wahlberechtigt sind alle irischen Bürger, oder Bürger des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, die ihren festen Wohnsitz in der Republik haben. Die Wahl findet nach dem Prinzip der übertragbaren Einzelstimmgebung (engl. Single Transferable Vote) statt und die einzelnen Wahlbezirke haben jeweils mehrere Sitze zu vergeben.
Nachwahlen (by(e)-election) finden in Irland statt, um frei gewordene Sitze im irischen Unterhaus neu zu vergeben. Ein Parlamentarier kann durch Tod, Rücktritt oder Ausschluss aus dem Dáil ausscheiden, so dass eine Nachwahl notwendig wird. Daher können Parteien innerhalb des Dáil während einer Amtszeit durchaus Sitze verlieren oder hinzugewinnen. Nachwahlen können einzeln oder gesammelt abgehalten werden.
Justizwesen und Kriminalität
Das Gerichtssystem in der Republik Irland besteht aus dem Supreme Court (Oberster Gerichtshof), aus dem High Court (oberstes Zivil- und Strafgericht) sowie einer Reihe von untergeordneten Gerichten. Die Republik Irland besitzt ein System des bürgerlichen Rechts und Gerichtsverfahren aufgrund von ernsten Vergehen werden in der Regel vor einem Geschworenengericht verhandelt. Der High Court als auch der Supreme Court haben die Möglichkeit Gesetze und andere Staatsaufgaben auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen. Bis auf besondere Fälle müssen alle Gerichtsverfahren öffentlich verhandelt werden.
Der Supreme Court und der High Court wurden durch die Verfassung von Irland eingeführt. Der Supreme Court gilt dabei als die höchste Instanz der irischen Gerichtsbarkeit, in der aber in der Regel lediglich überprüft wird, ob alle Gesetze eingehalten wurden. Die Entscheidungen und Urteile des Supreme Court sind endgültig. Der High Court hat ebenfalls die Möglichkeit die Verfassungstexte zu interpretieren. Weiterhin werden im High Court die schwerwiegendsten Strafgerichts- und Zivilgerichtsfälle verhandelt und es gilt als Berufungsgericht für die untergeordneten Gerichte.
Der Supreme Court und der High Court sind die einzigen Gerichte, die per Verfassung festgelegt sind. Die weiteren Gerichte wurden durch Gesetze eingeführt. Unterhalb dieser beiden Gerichte befinden sich noch der Circuit Court und der District Court. Der Circuit Court befasst sich mit Vergehen, die vor einer Jury verhandelt werden müssen und unterhalb der Vorgaben (zum Beispiel Schadenshöhe) des High Court liegen. Der District Court befasst sich mit allen übrigen Fällen.
Die Verfassung nennt lediglich zwei Fälle, in denen ernsthafte Straftaten ohne Jury verhandelt werden können: Verfahren vor einem Militärgericht und spezielle Gerichte die vom Parlament (Oireachtas) eingesetzt werden können, falls dieses es im Sinne der öffentlichen Ordnung für notwendig hält. Ein solches Gericht ist der Special Criminal Court, der Fälle in Bezug auf organisiertes Verbrechen oder terroristische Vereinigungen verhandelt.
Richter werden vom irischen Präsidenten aufgrund der Vorschläge (die allerdings bindend sind) des Kabinetts eingesetzt. Das Verfahren der Entlassung eines Richters von einem der beiden oberen Gerichte ist in der Verfassung festgelegt, doch wurde dieses Verfahren per Gesetz auch auf die untergeordneten Gerichte ausgedehnt. Ein Richter kann daher nur in Fällen von Amtsmissbrauch oder Unvermögen aus seinem Amt entlassen werden und wenn dies von beiden Häusern des Parlaments gemeinsam in einer Resolution beschlossen wurde. Mit einer solchen Resolution wird der Richter daraufhin vom Präsidenten entlassen. Das Gehalt eines Richters kann solange er sich im Amt befindet nicht gekürzt werden.
In Nordirland, wo die Police Service of Northern Ireland (PSNI) die Statistiken führt, zeichnet sich ein markanter Abwärtstrend ab. Für das Finanzjahr 2024/25 wurden 95.968 Straftaten registriert, was einem Rückgang von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht – der zweitniedrigste Stand seit 1998/99. Dieser Trend setzte sich fort: Im Zeitraum Juli 2024 bis Juni 2025 sanken die Delikte um weitere 6,8 Prozent auf 94.222 Fälle. Besonders auffällig ist der Rückgang bei Gewaltverbrechen und Eigentumsdelikten, was auf effektive Polizeiarbeit und soziale Programme zurückzuführen ist. Antisoziales Verhalten stieg leicht um 1 Prozent auf 44.454 Vorfälle, bleibt aber auf einem historischen Tief. Die Homicide-Rate liegt bei etwa 0,9 pro 100.000, ähnlich wie in der Republik, und die Region weist die niedrigste Kriminalitätsrate im Vergleich zu allen britischen Polizeibehörden auf. In Städten wie Belfast ist die Rate höher (96 pro 1.000), doch ländliche Gebiete profitieren von der allgemeinen Stabilisierung seit dem Ende der Troubles. Organisierte Kriminalität, wie Drogenhandel über die Grenze zur Republik, bleibt ein Problem, wird aber durch grenzüberschreitende Kooperation bekämpft.
In der Republik Irland, deren Daten vom Central Statistics Office (CSO) und An Garda Síochána stammen, präsentiert sich das Bild nuancierter. Die Gesamtzahl der Straftaten stieg 2023 auf 218.128, ein leichter Anstieg gegenüber 2022, doch 2024 fielen viele Kategorien: Schäden an Eigentum um 2 Prozent, gefährliche Handlungen um 2 Prozent und Verbrechen gegen Regierung und Justiz um 7 Prozent. Im Vierteljahr 1 2024 (Januar bis März) stiegen jedoch Raub, Waffendelikte, Diebstähle und Betrug, was auf wirtschaftliche Faktoren wie Inflation und Urbanisierung zurückgeführt wird. Gewaltverbrechen wie Morddrohungen und Assaults sanken um 2 Prozent, sexuelle Delikte um 12 Prozent und Homicides um 8 Prozent. Für 2025 deuten vorläufige Zahlen auf einen Rückgang in den meisten Gruppen hin, mit Ausnahmen bei sexuellen Delikten (+17 Prozent) und öffentlichen Ordnungsstörungen (+6 Prozent). Die Mordrate bleibt stabil bei 0,9 pro 100.000, und trotz Medienberichten über steigende Unsicherheit in Dublin – etwa durch Zuwanderung und Angriffe auf Migranten – widerlegen Faktenchecks wie von Euronews einen dramatischen Anstieg. Die Republik profitiert von hoher Polizeipräsenz und EU-Fördermitteln, doch organisierte Banden aus Osteuropa und Drogenrouten über Häfen fordern anhaltende Maßnahmen.
Frauen und LGBTQ
Bis 1999 konnten Ehepaare in Irland sich entweder getrennt oder gemeinsam zur Einkommenssteuer veranschlagen lassen. Dies sollte Mütter ermutigen, sich statt zu arbeiten der Erziehung ihrer Kinder zu widmen.
Seit 2000 hat die Regierung von Bertie Ahern das Steuerrecht nun schrittweise reformiert. Nun können nur noch Paare über 65 Jahren die Steuer gemeinsam veranschlagen. Die Kindererziehung und auch die Pflege älterer Leute werden mit Steuervorteilen anerkannt. Frauen profitieren am meisten von den neuen Regelungen: Wessen Jahreseinkommen den Betrag von 5080 Euro nicht überschreitet und für mindestens eine abhängige Person sorgt, hat Anspruch auf den „Home Carer’s Tax Credit” von 900 Euro im Jahr.
Der Wandel von der gemeinsamen zur individuellen Besteuerung hat dazu geführt, dass „erheblich mehr verheiratete Frauen am Erwerbsleben teilnehmen”, so das Dubliner Wirtschaftsforschungsinstitut ESRI. Dies hatte wiederum zu Folge, dass der Bedarf an Kinderbetreuung enorm gestiegen ist. Die Regierung reagierte darauf mit der Möglichkeit für Frauen, bis zu 1500 Euro im Jahr steuerfrei zu verdienen bei der Betreuung dreier Kinder im eigenen Haushalt.
In der Republik Irland begann der Kampf für Reformen in den 1970er Jahren mit der Campaign for Homosexual Law Reform, angeführt von Senator David Norris. Trotz eines Rückschlags beim Obersten Gerichtshof 1980 brachte Norris den Fall vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), der 1988 zugunsten der Entkriminalisierung entschied. Dies ebnete den Weg für das Criminal Law (Sexual Offences) Act 1993, das Homosexualität am 24. Juni 1993 dekriminalisierte – ein Meilenstein, der als „großer Tag in der irischen LGBTQ-Geschichte“ gefeiert wird. Ab 2000 schützt das Employment Equality Act Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung am Arbeitsplatz, und weitere Gesetze erweiterten den Schutz auf Wohnen, Bildung und Dienstleistungen. 2011 führte das Civil Partnership Act eingetragene Partnerschaften ein, die viele Rechte von Ehepaaren gewährten, inklusive Adoption für Paare ab 2015. Der Durchbruch kam 2015 mit einem Referendum: 62 Prozent der Wähler stimmten für die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe, was Irland zum ersten Land weltweit machte, das dies per Volksabstimmung tat. Das Gender Recognition Act 2015 erlaubt Transpersonen ab 18 Jahren, ihr Geschlecht selbst zu deklarieren, ohne medizinische Intervention. Heute rangiert Irland in internationalen Rankings unter den liberalsten Ländern; es gibt keine bekannten Fälle von Entlassungen aus dem Militär wegen LGBTQ-Identität seit 1993, und Organisationen wie BelongTo bieten Unterstützung für Jugendliche. Dennoch fordern Aktivisten weitere Fortschritte, etwa bei nicht-binären Identitäten.
In Nordirland, das nach der Teilung 1921 britisch blieb, spiegelten die Rechte lange die englische Entwicklung wider, doch der „Troubles“-Konflikt und sektiererische Spaltungen (unionistisch vs. nationalistisch) verzögerten Reformen. Homosexualität wurde erst 1982 dekriminalisiert, nach dem EGMR-Urteil im Fall Jeff Dudgeon – dem ersten LGBTQ-Sieg vor dem Gericht, das die nordirischen Gesetze als Verstoß gegen Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention brandmarkte. Die Northern Ireland Gay Rights Association (NIGRA) trieb den Wandel voran. Ab 2005 ermöglichte der Civil Partnership Act eingetragene Partnerschaften, und 2013 erhielten gleichgeschlechtliche Paare volle Adoptionsrechte. Diskriminierungsschutz umfasst seit 2000 Arbeitsplatz und Dienstleistungen, doch Debatten um „Sextarianismus“ – die Überschneidung von Ethnonationalismus und Homophobie – zeigen anhaltende Herausforderungen, insbesondere unter konservativen Protestanten und Katholiken. Die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe erfolgte erst 2020, als das britische Parlament in Abwesenheit einer funktionsfähigen Regionalregierung (Stormont) eingriff: Am 13. Januar 2020 trat das Gesetz in Kraft, und seit September 2020 sind kirchliche Trauungen erlaubt. Belfast Pride, seit 1991 gewachsen von 50 auf über 6.500 Teilnehmer, symbolisiert Einheit jenseits der Spaltungen. Aktuell erfordert die Geschlechtsangleichung eine medizinische Diagnose, und es gibt keine Zensur von LGBTQ-Themen in Schulen oder Medien. Trotz Fortschritten kämpfen Gruppen wie die LGBTQIA+ Heritage Project gegen Reste von Homophobie, verstärkt durch den Mord an Aktivistin Lyra McKee 2019.
Wie in anderen EU-Ländern gibt es auch in Irland das Konzept der sogenannten „Hassrede“, das jeglichen verbalen Widerstand gegen Maßnahmen, die als „woke“ empfunden werden, unter Rechtsextremismus-Verdacht oder gar Strafandrohung stellt.. Der Europarat kritisiert 2024 mangelnde Maßnahmen gegen transphobe Äußerungen. Proteste, zum Beispiel gegen Sprecherin Posie Parker 2024, eskalierten zu Gegenmanifestationen mit Hunderten Unterstützern. Ein Lehrer wurde 2025 erneut inhaftiert, weil er Trans-Schülern falsche Pronomen verweigerte. Bücher werden bezüglich LGBTQ-Inhalten zensiert und Jugendliche berichten von Angst in Schulen, hier noch frei ihre Meinung äußern zu dürfen.
In Nordirland sind Konflikte akuter. Im März 2025 kritisierte Sinn-Féin-MLA Carál Ní Chuilín das Christian Institute in der Assembly, das Kirchen erlauben wollte, LGBTQ-Mitarbeiter wegen „nicht-konformer Sexualität“ zu entlassen. Im September 2025 entfernte Bildungsminister Paul Givan (DUP) Leitlinien für trans- und genderdiverse Schüler sowie eine Studie aus dem Jahr 2015 zu LGBTQ-Erfahrungen von den Schulen, was 15 Organisationen (inklusive Gewerkschaften und Rainbow Project) zu Protesten bewegte. Sie warfen „vorzeitige Zensur“ vor, da ein UK-Supreme-Court-Urteil (über Toiletten für trans Jugendliche) noch unklar für Nordirland sei.
Umfragen zeigen unterdessen, dass über 70 % der Bevölkerung LGBTQ+-Rechte unterstützen, doch bei Themen wie Transrechten (zum Beispiel Jugendliche, Sport oder Frauenräume) gibt es Spaltungen, besonders unter Älteren, Kirchgängern und in ländlichen Gebieten. Kritiker, die oft „TERFs“ (trans-exclusionary radical feminists) oder gender-kritisch argumentieren, sehen sich zunehmend mit Vorwürfen der Hassrede konfrontiert. Der Europarat kritisierte 2024, dass Irland mehr gegen LGBTI-phobe Äußerungen tun muss. Gleichzeitig warnen Konservative vor einer „Cancel Culture“, die freie Meinungsäußerung unterdrücke – ein Vorwurf, der in X-Posts (ehemals Twitter) und konservativen Medien wie dem Christian Institute kursiert.
Mehrere Vorfälle in den letzten Jahren und Monaten illustrieren, wie Kritiker durch öffentlichen Druck sanktioniert werden. Der irische Autor John Boyne, bekannt für „Der Junge im gestreiften Pyjama“, wurde von der Longlist des renommierten Polari Prizes (ein LGBTQ+-Literaturpreis für UK- und irische Schriftsteller) gestrichen. Boyne hatte in einem Artikel im Irish Independent (27. Juli 2025) sich als „fellow TERF“ bezeichnet und J.K. Rowlings gender-kritische Ansichten verteidigt, was er als Schutz von Frauenrechten darstellte. Über 800 Autoren und Verlagsprofis unterzeichneten einen offenen Brief, der Boynes Nominierung als „unangemessen und verletzend“ brandmarkte und auf steigende Anti-Trans-Stimmungen hinwies. Die Organisatoren pausierten den gesamten Wettbewerb – ein klarer Fall von Cancel Culture, der Boynes Karriere (trotz Bestseller-Status) überschattet.
Ein angeblich nachhaltigkeitsorientiertes Festival in Mullingar wurde kurzfristig abgesagt, nachdem Aktivisten die Organisatoren als far-right Conspiracy-Theoretiker enttarnt hatten. Beteiligt war Jana Lunden, eine prominente Anti-Trans-Aktivistin, die Bibliotheken stürmte und LGBTQ+-Inhalte als „Grooming“ diffamierte. Der Whistleblower-Alarm führte zur Kündigung durch die Venue, was die Veranstalter als „Zensur“ kritisierten. Tickets (150 €) wurden erstattet, doch der Vorfall polarisierte: Linke Aktivisten feierten es als Schutz vulnerabler Gruppen, Rechte als Angriff auf Freiheit.
Die britische Anti-Trans-Aktivistin Kellie-Jay Keen-Minshull (Posie Parker) plante Events in Dublin, wurde aber mit massiven Gegenprotesten konfrontiert – Hunderte Trans-Unterstützer:innen übertrafen ihre Anhänger bei weitem. Obwohl keine Absage erfolgte, wurde sie medial als „transphob und misogyn“ gebrandmarkt, was ihre Plattform in Irland einschränkte. Ähnliche Proteste gab es gegen US-Speaker:innen, die gender-kritische Views äußern.
In Nordirland, wo LGBTQ+-Rechte erst 2020 (Ehe für alle) legalisiert wurden und die DUP (Democratic Unionist Party) lange blockierte, sind Cancel-Fälle seltener, aber vorhanden. Der Fokus liegt auf politischen Debatten: Im September 2025 entfernte Bildungsminister Paul Givan (DUP) Leitlinien zu trans Jugendlichen in Schulen, was 15 LGBTQ+-Organisationen zu Protesten bewegte und als „Zensur“ galt – umgekehrt also. Der Mord an der lesbischen Aktivistin Lyra McKee 2019 verstärkte den Druck auf anti-LGBTQ+-Stimmen. X-Posts deuten auf „Cancel Culture“ hin, zum Beispiel ein Unionist, der 2022 beklagte, dass Kritik an der LGBTQ+-Community zu Haft führen könne. Dennoch rangiert Nordirland in der ILGA-Europe Rainbow Map 2025 niedriger als die Republik, mit anhaltender Homophobie in protestantischen Kreisen.
Sicherheitskräfte
Garda Síochána na hÉireann, kurz auch Garda oder Gardai, bezeichnet die Nationalpolizei in der Republik Irland. Die Behörde untersteht einem von der irischen Regierung eingesetzten Polizeipräsidenten (Commissioner), das Hauptquartier befindet sich im Phoenix Park in Dublin. Die gebräuchlichste Kurzform im Sinne des Kollektivums „Die Polizei“ ist Garda, wie auch der einzelne Polizist heißt. Der Plural Polizisten = Gardaí kommt ebenfalls häufig als Sammelbezeichnung vor.
Die Garda existiert seit 1922, ihre zirka 9.000 uniformierten Mitglieder sind in der Regel unbewaffnet, auch um sich von der Vorgängereinheit, der Royal Irish Constabulary (RIC) zu unterscheiden. Daneben gibt es rund 1700 mit Handfeuerwaffen ausgestattete nicht uniformierte Garda Detectives, die u. a. für den Personenschutz verantwortlich sind und die schwer bewaffnete Emergency Response Unit. Irland gliedert sich in sechs Polizeiregionen, darunter die Dublin Metropolitan Region, die jeweils von einem Regional Assistant Commissioner geleitet werden.
Kommunale Polizeikräfte gibt es seit der Zusammenlegung der Dubliner Polizei mit der Garda im Jahr 1925 nicht mehr. Die Airport Police auf dem Flughafen von Dublin, die Harbor Police und die Railway Police, die auf dem Gelände von Bahnhöfen Dienst tut, sind keine klassischen Polizeikräfte, sondern eher als Sicherheitsdienste zu bezeichnen. Verhaftungen werden auch hier nur von der Garda vorgenommen.
Die Irish Defence Forces (IDF, irisch Óglaigh na hÉireann) stellen die Armee der Republik Irland dar. Sie bestehen aus den Teilstreitkräften Heer (Irish Army, irisch Arm na hÉireann), Marine (Naval Service) und Luftwaffe (Irish Air Corps).
In der Irischen Armee dienen knapp 11.000 (Stand 2006) Männer und Frauen, davon rund 8500 im Heer. Die Marine verfügt über acht Patrouillenschiffe. Die Aufgaben der Luftwaffe bestehen hauptsächlich in der Unterstützung des Heeres und dem Transport von Menschen und Material. Sie verfügt derzeit über keine düsengetriebenen Kampfflugzeuge. Zusätzlich zur Berufsarmee gibt es noch die Reserve Defence Force, die aus der Army Reserve (Cúltaca an Airm) und der Naval Service Reserve (NSR, Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh) besteht.
Internationale Beziehungen
Seit 1973 ist Irland Mitglied der EU (damals noch EG). Bei militärischer Neutralität ist Irland politisch wie wirtschaftlich fest im Kreis der westlichen Demokratien verwurzelt. Eine weitgehend integrationsfreundliche EU-Politik, das Eintreten für Abrüstung, die Belange der Dritten Welt und eine starke Rolle der Vereinten Nationen (Mitglied seit 1955) bestimmen die allgemeine außenpolitische Linie. Irland beteiligt sich mit eigenen Truppen an mehreren VN-Missionen.
Die Nordirlandfrage sowie die Zusammenarbeit mit der neu geschaffenen nordirischen Regierung gehören nach wie vor zu den wichtigsten Themen der irischen Außenpolitik. Irland und Großbritannien bemühten sich mit Unterstützung Washingtons lange darum, die Nordirlandfrage gemeinsam zu lösen. So wurde unter anderem entsprechend den Regelungen des „Karfreitags-Abkommens“ das in der irischen Verfassung vorgesehene Wiedervereinigungsgebot aufgehoben. Der Entwaffnungsprozess wurde im September 2005 mit der vollen Demilitarisierung und der Aufgabe jeglicher paramilitärischen Aktivitäten durch die IRA vollendet.
Am 8. Mai 2007 wurde der Friedensprozess in Nordirland mit der Bildung der neuen nordirischen Regierung offiziell zum lang ersehnten Erfolg geführt. Mit der Arbeitsaufnahme der neuen Regierung und der Wiederherstellung der politischen Institutionen in Nordirland, ist die „Devolution“ weitgehend vollzogen, also die Direktverwaltung von London aus beendet. Seit dem 9. Mai ist die nordirische Regierung grundsätzlich eigenverantwortlich für die Bereiche Landwirtschaft, Bildung, Kultur, Gesundheit, Wirtschaft, Regionalentwicklung und Umwelt tätig; inzwischen sind Justiz und Polizei weitestgehend hinzugekommen. Durch den Einsatz der aus London zugewiesenen Finanzmittel hat die neue Regierung erhebliche Spielräume erhalten.
Bislang ist die Regierungstätigkeit ohne größere Reibungen gut angelaufen. Nordirland hat bereits in den letzten Jahren nicht zuletzt dank der wachsenden Nord-Süd-Zusammenarbeit zwischen Nordirland und (der Republik) Irland einen beachtlichen wirtschaftlichen Aufschwung erfahren. Der Aussöhnungsprozess bewährt sich im Alltag, die Aussichten für die Zukunft sind positiv. Die Frage nach Entschädigungszahlungen für Opfer des Nordirlandkonfliktes wird derzeit diskutiert.
Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union wirkte sich für Irland nicht nur wirtschaftlich vorteilhaft aus. Auch die Fortschritte im Nordirland-Friedensprozess dürften durch die EU-Mitgliedschaft sowohl Irlands als auch Großbritanniens begünstigt worden sein. Die grundsätzlich überwiegendpositive Einstellung der irischen Bürger zu Europa und zur Zusammenarbeit in der Union ist auch von dieser Erfahrung geprägt.
Aktuell wird die irische Europapolitik allerdings geprägt vom Scheitern des am 12. Juni 2008 durchgeführten Referendums über den Vertrag von Lissabon. Obwohl sich die große Mehrheit der im Parlament vertretenen Parteien für den Vertrag ausgesprochen hatte, haben 53,4 % der abstimmenden Bürger dagegen gestimmt. Seither wird die Frage, wie Irland den Vertrag noch ratifizieren kann intern wie mit den EU-Partnern intensiv erörtert. Beim Europäischen Rat im Dezember 2008 verständigten sich die Staats- und Regierungschefs auf ein Zieldatum zum Inkrafttreten des Vertrags vor Ende 2009 sowie auf den Erhalt des Prinzips „ein Kommissar pro Land“ und darauf, den im Referendum deutlich gewordenen Bedenken mit einer Reihe von Garantien, besonders zur Neutralität, zur Steuerpolitik und zu einer Reihe von sozialen und ethischen Fragen zu begegnen. Die irische Regierung hat zugesichert, den Vertrag nach Einarbeitung der Änderungen der Bevölkerung erneut zur Abstimmung vorzulegen.
Von den sonstigen EU-Politiken erhofft sich die Regierung vor allem, dass sie das Bild einer aktiven, problemlösenden Union vermitteln. Mit der Einigung zum „Health Check“ der für das Land wichtigen Gemeinsamen Agrarpolitik hat sich Irland zufrieden gezeigt. Als bedeutende Aufgabe wird auch die Klima- und Energiepolitik gesehen. Wie in den anderen EU-Staaten steht zur Zeit die Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise ganz oben auf der politischen Agenda. Von der EU erwartet man die Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen ohne zu große Einmischung in die nationalen Maßnahmen zur Belebung der Konjunktur bzw. zur Stabilisierung der Finanzen. Die irische Regierung hat angekündigt, voraussichtlich erst im Jahr 2013 wieder das Defizitkriterium des Stabilitätspakts zu erfüllen. Einer EU-weiten Steuerharmonisierung steht Irland weiterhin ablehnend gegenüber. Irland ist kein Schengen-Mitglied. Jede Vertiefung der Zusammenarbeit bei Justiz und Politik wird traditionell sorgfältig geprüft.
Irland hat die bisherigen Erweiterungen der Europäischen Union uneingeschränkt befürwortet. Nur erhebliche Zuwanderung, besonders aus den neuen EU-Mitgliedstaaten, konnte in den vergangenen Jahren die Nachfrage der Wirtschaft nach Arbeitskräften befriedigen. Die Regierung hat die Aufnahme von Verhandlungen zwischen der EU und der Türkei auf der Basis der Kopenhagen-Kriterien begrüßt und steht zu den Zusagen gegenüber den Ländern des Westlichen Balkans. Sie fordert heute, auch angesichts der geänderten Wirtschaftslage, jedoch einen „pragmatischen Ansatz“, der auf die Aufnahmefähigkeit der EU und die Zustimmung der Bevölkerung abhebt.
Die Beziehungen zu den USA sind traditionell von besonderer Bedeutung; politisch wie wirtschaftlich besteht ein enges Verhältnis. Der Austausch im Bereich medizinischer Forschung und Bildung nimmt einen wichtigen Platz ein. Der frühere irische Premierminister John Bruton ist der Vertreter der EU-Kommission in den Vereinigten Staaten. Amerikanische Investitionen haben zum irischen Wirtschaftsaufschwung seit Mitte der 1980er Jahre (IT-Boom) erheblich beigetragen (55 Millairden US-Dollar Direktinvestitionen). Über 40 Millionen US-Amerikaner nehmen eine irische Abstammung für sich in Anspruch. Die Wahl von Barack Obama zum Präsidenten der Vereinigten Staaten wurde in Irland sehr positiv aufgenommen.
Internationale Mitgliedschaften:
- Asian Development Bank (ADB) - nicht regionales Mitglied
- Australia Group
- Bank for International Settlements (BIS)
- British-Irish Council (BIC)
- Council of Europe (CE)
- Economic and Monetary Union (EMU)
- Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC)
- European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
- European Investment Bank (EIB)
- European Space Agency (ESA)
- European Union (EU)
- Food and Agriculture Organization (FAO)
- International Atomic Energy Agency (IAEA)
- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
- International Chamber of Commerce (ICC)
- International Civil Aviation Organization (ICAO)
- International Criminal Court (ICCt)
- International Criminal Police Organization (Interpol)
- International Development Association (IDA)
- International Energy Agency (IEA)
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCS)
- International Finance Corporation (IFC)
- International Fund for Agricultural Development (IFAD)
- International Hydrographic Organization (IHO)
- International Labour Organization (ILO)
- International Maritime Organization (IMO)
- International Monetary Fund (IMF)
- International Olympic Committee (IOC)
- International Organization for Migration (IOM)
- International Organization for Standardization (ISO)
- International Red Cross and Red Crescent Movement (ICRM)
- International Telecommunication Union (ITU)
- International Telecommunications Satellite Organization (ITSO)
- International Trade Union Confederation (ITUC)
- Inter-Parliamentary Union (IPU)
- Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
- Nuclear Energy Agency (NEA)
- Nuclear Suppliers Group (NSG)
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
- Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
- Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
- Organization of American States (OAS) - Beobachter
- Paris Club
- Partnership for Peace (PFP)
- Permanent Court of Arbitration (PCA)
- United Nations (UN) seit 14. Dezember 1955
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
- United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)
- United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO)
- United Nations Mission in Liberia (UNMIL)
- United Nations Operation in Cote d'Ivoire (UNOCI)
- United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC)
- United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)
- Universal Postal Union (UPU)
- Western European Union (WEU) - Beobachter
- World Customs Organization (WCO)
- World Federation of Trade Unions (WFTU)
- World Health Organization (WHO)
- World Intellectual Property Organization (WIPO)
- World Meteorological Organization (WMO)
- World Trade Organization (WTO)
- Zangger Committee (ZC)
Flagge und Wappen
Die Flagge der Republik Irland steht als vertikale Trikolore in der Tradition der Flagge Frankreichs. Sie ist senkrecht grün-weiß-orange getreift. Immer wieder sieht man auch irische Flaggen mit einem eher gelblichen Streifen. Manchmal entsteht dies aus Missinterpretation des Streifens als Gold, doch ist diese Variante auch die offizielle Flagge der Grafschaft Offaly.
Offiziell werden den Farben keine Bedeutungen zugeschrieben, aber es gibt viele inoffizielle Erklärungen. So soll Grün für die Insel und die katholische Bevölkerung, Orange für die protestantische Bevölkerung und Weiß für den Frieden zwischen diesen beiden Konfessionen stehen. Andere sehen im Grün die alte Keltische Tradition und Orange stehe für die Unterstützer von Wilhelm von Oranien. Weiß stünde für den Waffenstillstand zwischen den beiden Parteien.
Historisch richtig ist, dass Grün schon lange eine Tradition hatte als Farbe der irischen Freiheitskämpfer und Orange die Farbe der Protestanten von Ulster ist, die sich von Wilhelm von Oranien ableitet. Sie soll an die Schlacht an der Boyne 1690 erinnern, in welcher der protestantische Wilhelm den katholischen Jakob II. besiegte.
1782 erhielt das irische Parlament von den Briten das Recht zur Vertretung des Landes. Symbol Irlands wurde das St.-Patricks-Kreuz, ein rotes Andreaskreuz auf weißem Grund. Nach dem Act of Union 1800, mit dem Irland in das Vereinigte Königreich integriert wurde, wurde das St.-Patricks-Kreuz Teil des britischen Union Jack. Es war ein Nationalsymbol, das die Iren auch offiziell während der britischen Herrschaft benutzen durften.
Schon seit dem 15. Jahrhundert ist die Harfe ein irisches Nationalsymbol. Die grüne Flagge mit ihr leitete sich vom Wappen der Provinz Leinster ab. Die Society of United Irishmen verwendete sie ab dem Ende des 18. Jahrhunderts. Sie wurde von den Iren auch in den Aufständen von 1798 und 1803 benutzt. Heute findet sie sich als Gösch der irischen Marine wieder.
Ab dem 17. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert wurde auf irischen Handelsschiffen die Green Ensign verwendet, eine grüne Flagge mit der goldenen Harfe und in der Gösch im Laufe der Jahre entweder das St.-Patricks-Kreuz, das Georgskreuz und zuletzt den Union Jack.
Nach dem Vorbild der Trikolore Frankreichs verwendeten irische Freiheitskämpfer erstmals im 19. Jahrhundert die irische Trikolore. Die älteste bekannte Darstellung der Farbkombination ist ein Emblem vom September 1830. Zu dieser Zeit wurden Kokarden in den drei Farben auf einem Treffen getragen, um die französische Revolution von 1830 zu feiern, mit der die französische Trikolore wieder als Nationalflagge Frankreichs eingeführt wurde.
Die älteste bekannte irische Trikolore stammt aus dem Jahr 1848, als sie von der Young-Ireland-Bewegung eingeführt wurde. Einer ihrer Führer, Thomas Francis Meagher, stellte sie bei einem Treffen in Waterford am 7. März 1848 erstmals der Öffentlichkeit vor. Am 15. April wurde sie nochmals in Dublin präsentiert. Reihenfolge der Farben und Form der Flagge wurden nicht festgelegt. Teilweise finden sich auch Trikoloren mit dem orangen Streifen am Mast. In den darauffolgenden Jahren bis 1916 war die Trikolore kaum im Gebrauch. Es dominierte wieder die goldene Harfe auf grünem Grund, die um 1880 offiziell durch die Briten toleriert wurde. Bei den Olympischen Zwischenspielen in Athen 1906 protestierte der für die britische Mannschaft startende Weitsprungsieger Peter O'Connor dagegen, dass für ihn der Union Jack gesetzt werden sollte. Zur Siegerehrung wurde daher stattdessen die grüne Harfenflagge benutzt.
1913 wurden bei einer Demonstration in Dublin zwei streikende Arbeiter von der Polizei getötet. Daraufhin wurde von Gewerkschaften eine paramilitärische Organisation gegründet, die Irish Citizen Army (ICA). Die bewaffneten und uniformierten Einheiten sollten die Arbeiter beschützen. 1914 nahmen sie, aufgrund ihrer Uniformen, eine blaue Flagge mit dem Sternbild des Großen Wagens an, der auch als Pflug bezeichnet wird. Entsprechend wurde die Flagge der Starry Plough (engl.: „Besternter Pflug“) genannt. Die Originalflagge wurde von britischen Truppen während des Osteraufstandes 1916 erobert und wurde erst 1966 nach Irland zurückgegeben. Heute befindet sie sich im Nationalmuseum in Dublin. 1934 führte die Irish Transport and General Workers' Union eine vereinfachte hellblaue Version ein, die eine weite Verbreitung bei allen Gewerkschaften, sozialistischen Gruppen und bei der irischen Labour Party fand. Sie benutzte sie bis in die 1970er, als sie die Hintergrundfarbe in Rot änderten. In den späten 1980ern wurde die Pflugflagge durch eine weiße Flagge mit einer roten Rose ersetzt. Auch republikanische, paramilitärische Gruppen benutzten die blaue Pflugflagge.
Während des Osteraufstands wehte die Flagge vom Hauptpostamt (General Post Office) in Dublin, doch auch hier wurde in erster Linie die grüne Harfenflagge mit den Worten „Irish Republic“ in goldener Schrift benutzt. Nach der Niederschlagung des Aufstandes benutzten vor allem die republikanischen Separatisten von Sinn Féin die Trikolore, im Gegensatz zur Irish Parliamentary Party, die die grüne Flagge und die Home Rule propagierte. Die Trikolore wurde immer mehr als irische Nationalflagge empfunden, aber auch als Flagge von Sinn Féin. Mit deren landesweitem Sieg bei den Wahlen von 1918 wurde die grüne Flagge endgültig an die zweite Stelle hinter die Trikolore gedrängt. Allerdings behielt sie während der Zeit des Irischen Freistaats (1922 bis 1937) nur einen inoffiziellen Status. Die Verfassung von 1922 erwähnt keine nationalen Symbole. Erst mit der Ausrufung der Republik 1937 erhielt die heutige Trikolore ihren Status als Nationalflagge.
Im Trinity College in Dublin wird die Brian-Boru-Harfe aufbewahrt. Sie ist das Vorbild für alle modernen Darstellungen, sowohl im Wappen Irlands, als auch auf der Präsidentenstandarte und der Gösch der irischen Marine. Auch in der Flagge Dublins findet sich dieses Symbol wieder.
Die Flagge der vier Provinzen zeigt die vier Wappenbanner der irischen Provinzen. Die Flagge an sich hat keinen offiziellen Status, wird aber gerne als Alternative zur Nationalflagge verwendet, so bei verschiedenen sportlichen Gelegenheiten.
Die Elfenbeinküste verwendet dieselbe Trikolore als ihre Nationalflagge, allerdings mit dem orangen Streifen an der Mastseite und in anderen Proportionen. Es gibt einen Cocktail mit Namen Irische Flagge. Er besteht aus 2 cc Pfefferminzlikör, 2 cc Irish cream und 2 cc Grand Marnier. Die Bestandteile werden der Reihe nach langsam entlang eines langen Löffels in das Glas gefüllt, so dass sie sich nicht vermischen.
Das Wappen der Republik Irland, auch bekannt unter Brian Boru Harp, Trinity College Harp oder auch einfach nur Brian Boru besteht aus einer Harfe auf blauem Grund. Die Harfe ist schon seit dem 13. Jahrhundert ein Wahrzeichen Irlands und erschien erstmals auf einer Münze während der Regierungszeit Heinrichs VIII. Die Brian-Boru-Harfe geht zurück bis in das späte 14. Jahrhundert und kann im Langraum der Bibliothek des Trinity College in Dublin besichtigt werden. Benannt wurde die Harfe nach dem Hochkönig Brian Boru, der jedoch mehr als 400 Jahre vor der Herstellung der Harfe verstarb, sodass sie ihm niemals gehörte.
Das Abbild der Harfe wird auf irischen Münzen, Reisepässen und Regierungsdokumenten verwendet, und es ist auch das offizielle Siegel des Präsidenten, der Minister und anderen Offiziellen. Die Harfe auf Münzen von 1928 basierte größtenteils auf der Galway-Harfe, während eine modifizierte Version 1939 eingeführt wurde, auf der auch die derzeitigen irischen Münzen basieren.
Nationale Symbole:
- Farbe: grün
- Pflanze: shamrock bzw. klefoil (Weißklee, trifolium repens)
- Tier (lebend): irish wolfhound bzw. cú faoil (Irischer Wolfshund, canis lupus familiaris)
- Tier (ausgestorben): irish elk bzw. giant deer (Irischer Elch, megaloceros giganteus)
- Motto: Éire go deo (Ireland forever) bzw. Fé Mhóid Bheith Saor (Sworn to be free)
- Held: Brian Boru (König, gestorben 1014)
Hymne
Amhrán na bhFiann (The Soldier’s Song) ist die Nationalhymne der Republik Irland. Sie wurde 1907 von Peadar Kearney, einem Onkel des bekannten Liedertexters Brendan Behan, auf Englisch geschrieben und 1926 ins Irische übersetzt. Die Melodie wurde von Peadar Kearney und Patrick Heeney komponiert. Als Nationalhymne gilt nur der Refrain, nicht die Strophen des Liedes. Gewöhnlich wird die irischsprachige Version gesungen. Vorläufer von Amhrán na bhFiann war das Lied God Save Ireland, das 1867 von Timothy Daniel Sullivan im Gedenken an drei in England hingerichtete irische Freiheitskämpfer verfasst worden war. Es galt seit dem Osteraufstand des Jahres 1916 als inoffizielle Nationalhymne der Irischen Republik.
Originaltext (irisch)
Seo dhibh a cháirde duan Oglaigh,
Cathréimeach briomhar ceolmhar,
Ár dtinte cnámh go buacach táid,
'S an spéir go min réaltogach
Is fonnmhar faobhrach sinn chun gleo
'S go tiúnmhar glé roimh thíocht don ló
Fé chiúnas chaomh na hoiche ar seol:
Seo libh canaídh Amhrán na bhFiann.
Refrain:
Sinne Fianna Fáil
Atá fé gheall ag Éirinn,
Bhuíon dár slua
Thar toinn do ráinig chugainn,
Fé mhóid bheith saor.
Seantír ár sinsir feasta
Ní fhagfar fén tíorán ná fén tráil
Anocht a théam sa bhearna bhaoil,
Le gean ar Ghaeil chun báis nó saoil
Le gunna scréach fé lámhach na bpiléar
Seo libh canaídh Amhrán na bhFiann.
Cois bánta réidhe, ar árdaibh sléibhe,
Ba bhuachach ár sinsir romhainn,
Ag lámhach go tréan fén sár-bhrat séin
Tá thuas sa ghaoith go seolta
Ba dhúchas riamh dár gcine cháidh
Gan iompáil siar ó imirt áir,
'S ag siúl mar iad i gcoinne námhad
Seo libh, canaídh Amhrán na bhFiann.
Refrain
A bhuíon nách fann d’fhuil Ghaeil is Gall,
Sin breacadh lae na saoirse,
Ta scéimhle 's scanradh i gcroíthe namhad,
Roimh ranna laochra ár dtire.
Ár dtinte is tréith gan spréach anois,
Sin luisne ghlé san spéir anoir,
'S an bíobha i raon na bpiléar agaibh:
Seo libh, canaídh Amhrán na bhFiann.
Refrain
Englische Version
We’ll sing a song, a soldier’s song,
With cheering rousing chorus,
As round our blazing fires we throng,
The starry heavens o’er us;
Impatient for the coming fight,
And as we wait the morning’s light,
Here in the silence of the night,
We’ll chant a soldier’s song.
Chorus:
Soldiers are we
whose lives are pledged to Ireland;
Some have come
from a land beyond the wave.
Sworn to be free,
No more our ancient sire land
Shall shelter the despot or the slave.
Tonight we man the gap of danger
In Erin’s cause, come woe or weal
’Mid cannons’ roar and rifles peal,
We’ll chant a soldier’s song.
In valley green, on towering crag,
Our fathers fought before us,
And conquered ’neath the same old flag
That’s proudly floating o’er us.
We’re children of a fighting race,
That never yet has known disgrace,
And as we march, the foe to face,
We’ll chant a soldier’s song.
Chorus
Sons of the Gael! Men of the Pale!
The long watched day is breaking;
The serried ranks of Inisfail
Shall set the Tyrant quaking.
Our camp fires now are burning low;
See in the east a silv’ry glow,
Out yonder waits the Saxon foe,
So chant a soldier’s song.
Chorus
Deutsche Übersetzung
Wir singen ein Lied, ein Soldatenlied
In jubelndem, stürmischem Chor
Während wir uns um die lodernden Feuer scharen,
Den sternenklaren Himmel über uns;
Ungeduldig harrend des kommenden Kampfs,
Und während wir das Morgenlicht erwarten,
Werden wir hier in der Stille der Nacht
Ein Soldatenlied singen.
Refrain:
Wir sind Soldaten
Deren Leben Irland geweiht ist;
Einige sind aus einem Land
Jenseits der See gekommen.
Der Freiheit verschworen,
Soll unser altes Vaterland nie wieder
Despoten oder Sklaven beherbergen.
Heute Nacht besetzen wir die Schlucht der Gefahr
Für Erin, komme was da wolle,
Inmitten Kanonendonner und Flintenschüssen
Werden wir ein Soldatenlied singen.
Im Talesgrün, auf hochragendem Gipfel,
Kämpften vor uns unsere Väter,
Und siegten unter derselben alten Flagge,
die stolz über uns weht.
Wir sind Kinder einer kämpfenden Rasse,
Die bisher noch nie Schande gekannt hat,
Und während wir vorrücken, Auge in Auge mit dem Feind,
Werden wir ein Soldatenlied singen.
Refrain
Söhne der Gälen! Männer des Pale!
Der langerwartete Tag bricht heran;
Die dichten Reihen von Inisfail
Sollen den Tyrannen das Fürchten lehren.
Unsere Lagerfeuer brennen nun herunter;
Seht den Silberstreif im Osten,
Da draußen wartet der angelsächsische Feind,
So singt denn ein Soldatenlied.
Refrain
Das Lied God Save Ireland („Gott schütze Irland“) erfüllte zur Zeit der Irischen Republik von 1919 bis 1922 und des Irischen Freistaats zwischen 1922 und 1926 die Funktion einer Nationalhymne, auch obgleich das Lied keinen offiziellen Status hatte. Im Jahr 1926 wurde The Soldier's Song offiziell zur Nationalhymne des Freistaats erhoben und blieb es auch, nachdem der Freistaat im Jahr 1937 durch Éire abgelöst wurde.
Das Lied wurde im Jahre 1867 von T. D. Sullivan unter dem Eindruck des Verfahrens gegen die sogenannten Manchester Martyrs verfasst, die wegen der Tötung eines Polizisten im Zuge eines Ausbruchs aus dem Gefängnis verurteilt und hingerichtet wurden. Das Lied wurde unter den Feniern schnell populär.
Die Weise hingegen wurde vom Lied Tramp! Tramp! Tramp! übernommen, welches aus dem Sezessionskrieg stammt. Es wurde von George F. Root geschrieben, dem Autor auch des Battle Cry of Freedom - und zwar unter dem Eindruck seines Aufenthalts im von den Konföderierten Staaten von Amerika eingerichteten Lager Andersonville.
| High upon the gallows tree swung the noble-hearted three.
By the vengeful tyrant stricken in their bloom; But they met him face to face, with the courage of their race, And they went with souls undaunted to their doom. |
Hoch auf dem Galgen schaukelten die nobelmütigen Drei,
Vom rachsüchtigen Tyrannen in ihrer Blüte weggerafft; Doch sie trafen ihn von Angesicht zu Angesicht mit dem Mut ihres Volkes, Und sie schieden mit von ihrem Schicksal unerschrockenen Seelen. |
| Refrain:
„God save Ireland!“ said the heroes; „God save Ireland“ said they all. Whether on the scaffold high Or the battlefield we die, Oh, what matter when for Erin dear we fall! |
Refrain:
„Gott schütze Irland“, sagten die Helden, „Gott schütze Irland!“, sagten sie alle. „Ob wir nun hoch auf dem Galgen oder ob wir auf dem Schlachtfeld sterben, Was macht das schon, wenn wir für das liebe Irland fallen!“ |
| Girt around with cruel foes, still their courage proudly rose,
For they thought of hearts that loved them far and near; Of the millions true and brave o'er the ocean's swelling wave, And the friends in holy Ireland ever dear. |
Noch von grausamen Feinden umgeben stieg stolz ihr Mut,
Denn sie dachten an die Herzen nah und fern, die sie liebten, Der treuen und tapferen Millionen jenseits der wogenden Welle des Ozeans Und der so lieben Freunde im heiligen Irland. |
| Climbed they up the rugged stair, rang their voices out in prayer,
Then with England's fatal cord around them cast, Close beside the gallows tree kissed like brothers lovingly, True to home and faith and freedom to the last. |
So stiegen sie die holprige Treppen hinan, die Stimmen in lautem Gebet begriffen,
Dann ward ihnen Englands verhängnisvolles Seil übergeworfen, Und dicht neben dem Galgen küssten sie sich liebevoll wie Brüder, Treu der Heimat, dem Glauben und der Freiheit bis zuletzt. |
| Never till the latest day shall the memory pass away,
Of the gallant lives thus given for our land; But on the cause must go, amidst joy and weal and woe, Till we make our Isle a nation free and grand. |
Bis zum Jüngsten Tag soll ihr Gedenken nicht vergehen
Der so für unser Land hingegebenen ritterlichen Leben; Doch muss unsere Sache weitergeführt werden, in Freude, Wohl und Wehe, Bis wir unsere Insel zu einer freien und großen Nation gemacht haben. |
Ireland’s Call ist ein Lied, das 1995 von der Irish Rugby Football Union in Auftrag gegeben wurde, um vor Beginn von Länderspielen der irischen Rugby-Union-Nationalmannschaft gesungen zu werden. Komponist ist Phil Coulter. Später übernahmen es auch die Nationalmannschaften im Feldhockey, Cricket und Rugby League.
Diese Nationalmannschaften repräsentieren sowohl die Republik Irland als auch das zum Vereinigten Königreich gehörende Nordirland. Nur Mannschaften, welche die Republik Irland allein repräsentieren, singen ausschließlich die irische Nationalhymne Amhrán na bhFiann. In den übrigen Fällen werden bei Heimspielen in der Republik Irland nacheinander Amhrán na bhFiann und Ireland's Call gespielt, bei Auswärtsspielen nur Ireland's Call. Üblicherweise wird nur die erste Strophe gesungen, gefolgt vom Refrain. Der Refrain wird dann in einer höheren Tonlage wiederholt. Am Schluss wird die letzte Zeile des Refrains ebenfalls wiederholt.
Hauptstadt
Der alte Königssitz Tara im Zentrum der Grünen Insel ist mit vielen Mythen und Legenden verbunden und die wahre Geschichte des schon seit der Steinzeit besiedelten Ortes ist schwer zu fassen. Der „Mound of the Hostages“ beispielsweise stammt aus der neolithischen Periode vor rund 5000 Jahren. Manche Historiker sind der Ansicht, dass Tara ab der Invasion der goidelischen Kelten bis zur anglo-normannischen Invasion durch Richard de Clare, 2. Earl of Pembroke, im Jahr 1169 ein politisches und spirituelles Zentrum war. Eine Rolle spielte Tara als Sitz der südlichen Ui Néill, irische Könige, und behielt diesen Status, wenn auch nicht in der Bedeutung, bis ins 12. Jahrhundert.
Nach einem dindsenchas (Ortsnamengedicht) des Fintan war Tara zuerst ein Haselwald namens Fordrium. Liath, Sohn von Laigne Lethan-glas rodete den Wald zur Zeit Ollcans und baute hier Korn an. Danach wurde der Hügel Druim Leith genannt. Unter Cain dem Sorgenfreien, Sohn von Fiachu Cendfindan erhielt es den Namen Druim Cain. Unter den Tuatha de Danann hieß es Cathair Crofhind. Tea, Tochter des Lugaid und Frau des Erimon baute hier ein Haus, das mit einem Wall befestigt war. Sie wurde jenseits des Walles auf dem Hügel begraben und gab ihm den Namen Temair. Unter den Milesiern wurde es Königssitz.
Im 9. Jahrhundert begannen einige irische Könige, vornehmlich jene aus der Dynastie der Uí Néill, den Titel „König aller Iren“ zu beanspruchen. Nach der Eroberung des heiligen Hill of Tara entstand zur Legitimation ein fünftes, nur formal unabhängiges Königreich: Meath (Mide „Mitte“, das als Zentrum Irlands den Sitz des Hochkönigs innehaben sollte. Das einstmals zu Leinster gehörende Gebiet hatten die Uí Néills von Ulster (nun nördliche Uí Néills genannt) annektiert und zur Legitimation der Hochkönigswürde zum eigenständigen Königreich erklärt.
Faktisch jedoch kann nicht von einer tatsächlichen Instanz mit ausreichend Einfluss in allen Teilen Irlands gesprochen werden. Selbst der Einfluss Brian Borús, der als erster (einziger) unumstrittener irischer Hochkönig bezeichnet wird, reichte nur kurze Zeit in alle Regionen. Lange Zeit seiner Herrschaft als Hochkönig verbrachte er damit, mit seiner Armee kreuz und quer über die Insel zu ziehen, um seine Machtansprüche zu festigen. Unumstritten war Brian Ború nie.
Ab 1172 wurde Dublin, irisch Baile Átha Cliath, das Verwaltungszentrum der Anglonormannen. Die Stadt hatte zu der Zeit weitverzweigte, internationale Handelsbeziehungen zu Skandinavien, Island, Großbritannien und in zunehmendem Maße zu Frankreich. Im Jahre 1204 befahl König Johann von England die Errichtung einer Festung in Dublin (Dublin Castle), um seine Machtposition im Land zu stärken. In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich diese Burg zum britischen Verwaltungszentrum in Irland. Der britische Vizekönig wohnte bis 1782 in diesem Schloss.
1916 kam es in Dublin zu einem Aufstand gegen die Briten (Osteraufstand). Es folgte der Irische Unabhängigkeitskrieg und darauf der Irische Bürgerkrieg, der in Dublin große Schäden anrichtete. Viele der wichtigsten Gebäude wurden zerstört. 1922 wurde Irland unabhängig und Dublin zur Hauptstadt des Freistaates Irland, aus dem 1949 die Republik Irland hervorging.
Belfast, irisch Béal Feirste, wurde 1603 gegründet. Angesichts der fortdauernden Aufstände im katholisch gebliebenen Irland wurde die Ansiedlung loyaler schottischer Presbyterianer speziell im Bereich Belfasts durch die britische Krone gefördert. Sie errichtete hier ihren wichtigsten Stützpunkt. Seit 1922 ist Belfast die Hauptstadt Nordirlands.
Verwaltungsgliederung
Irland besteht aus vier (historischen) Provinzen, die sich in 32 (historische) Grafschaften (counties) aufspalten. Von den neun Grafschaften Ulsters gehören sechs zu Nordirland und damit zum Vereinigten Königreich. In der Republik Irland haben die Provinzen keine Bedeutung mehr für die Verwaltung des Staates, sie spielen aber im Sport eine Rolle, da dieser in Irland oft auf regionaler Basis organisiert ist. Die Rugby-Mannschaft von Ulster umfasst zum Beispiel den irischen und den nordirischen Teil Ulsters.
Die Grafschaft Dublin ist verwaltungsmäßig in vier (Teil-)Grafschaften aufgespalten. Auch sind mehrere größere Städte (zum Beispiel Cork, Limerick, Galway) verwaltungsmäßig aus der sie umgebenen Grafschaft herausgelöst. Bis 1972 war Nordirland ebenfalls in (sechs) Grafschaften gegliedert. Seitdem gibt es 26 Landkreise (districts und boroughs) mit durchschnittlich 60.000 Einwohnern.
Die Kreisverwaltung in Irland wird durch den Local Government Act aus dem Jahr 2001 geregelt, der eine zweischichtige Struktur einführte. Die oberste Schicht besteht aus 29 County councils (Grafschaftsräte). 24 der 26 (traditionellen) Grafschaften in Irland haben einen, Dublin hat drei (Fingal, South Dublin und Dun Laoghaire-Rathdown) und Tipperary zwei (Nord- und Süd-Tipperary) solcher Räte. Dazu kommen die city councils (Stadträte) von Dublin, Cork, Galway, Limerick und Waterford, die den county councils gleichgestellt sind.
Die zweite Schicht besteht aus den town councils (Ortsräte). Die Stadträte von Kilkenny sowie Sligo, Drogheda, Clonmel und Wexford dürfen den Titel borough council (Bezirksrat) anstelle von town council tragen, haben ansonsten aber keine weitergehenden Befugnisse.
Die verschiedenen Kreisverwaltungen haben ihre Verantwortlichkeiten zum Beispiel in den Bereichen Planung, Straßen, Abwasser und Büchereiwesen. Jeder Rat hat einen offiziellen Vorsitzenden (chief executive of the council), der gleichzeitig ein Staatsbeamter ist, der durch die Civil Service and Local Appointments Commission eingesetzt wird. Der irische Minister für Umwelt, Kulturerbe und Kreisverwaltung (Irish Minister for the Environment, Heritage and Local Government) ist für die örtlichen Verwaltungen und anhängenden Aufgaben verantwortlich.
Nach der Abschaffung der Grundbesitzsteuern in den späten 1970er Jahren wurde es für die Räte immer schwieriger, Finanzmittel zu erhalten, sodass Gebühren auf Wasser und Abfälle erhoben wurden, die in manchen Gebieten aber im großen Stil nicht bezahlt wurden. Daher sind die Räte stark von der finanziellen Unterstützung durch die Regierung abhängig, was zu einem stark zentralisierten System der lokalen Regierungen führte.
Die counties Irlands sind nach dem Zensus von 2001:
| County | HASC | ISO | FIPS | Pr | Einwohner | km² | sqm | gälischer Name | Hauptstadt |
| Carlow | IE.CW
|
CW
|
EI01
|
L
|
46 014 | 896 | 346 | Ceatharlach | Carlow |
| Cavan | IE.CN
|
CN
|
EI02
|
U
|
56 546 | 1 891 | 730 | An Cabhán | Cavan |
| Clare | IE.CE
|
CE
|
EI03
|
M
|
103 277 | 3 188 | 1 231 | An Clár | Ennis |
| Cork | IE.CK
|
C
|
EI04
|
M
|
447 829 | 7 460 | 2 880 | Corcaigh | Cork |
| Donegal | IE.DL
|
DL
|
EI06
|
U
|
137 575 | 4 831 | 1 865 | Dún na nGall | Lifford |
| Dublin | IE.DN
|
D
|
EI07
|
L
|
1 122 821 | 922 | 356 | Baile Átha Cliath | Dublin |
| Galway | IE.GY
|
G
|
EI10
|
C
|
209 077 | 5 940 | 2 293 | An Ghaillimh | Galway |
| Kerry | IE.KY
|
KY
|
EI11
|
M
|
132 527 | 4 701 | 1 815 | Ciarraighe | Tralee |
| Kildare | IE.KE
|
KE
|
EI12
|
L
|
163 944 | 1 694 | 654 | Cill Dara | Naas |
| Kilkenny | IE.KK
|
KK
|
EI13
|
L
|
80 339 | 2 062 | 796 | Cill Chainnigh | Kilkenny |
| Laoighis | IE.LS
|
LS
|
EI15
|
L
|
58 774 | 1 720 | 664 | Laoighis | Port Laoighis |
| Leitrim | IE.LM
|
LM
|
EI14
|
C
|
25 799 | 1 525 | 589 | Liathdroim | Carrick on Shannon |
| Limerick | IE.LK
|
LK
|
EI16
|
M
|
175 304 | 2 686 | 1 037 | Luimneach | Limerick |
| Longford | IE.LD
|
LD
|
EI18
|
L
|
31 068 | 1 044 | 403 | Longphort | Longford |
| Louth | IE.LH
|
LH
|
EI19
|
L
|
101 821 | 823 | 318 | Lughbadh | Dundalk |
| Mayo | IE.MO
|
MO
|
EI20
|
C
|
117 446 | 5 398 | 2 084 | Muigheo | Castlebar |
| Meath | IE.MH
|
MH
|
EI21
|
L
|
134 005 | 2 336 | 902 | An Mhídhe | Trim |
| Monaghan | IE.MN
|
MN
|
EI22
|
U
|
52 593 | 1 291 | 498 | Muineachán | Monaghan |
| Offaly | IE.OY
|
OY
|
EI23
|
L
|
63 663 | 1 998 | 771 | Uíbh Fáilghe | Tullamore |
| Roscommon | IE.RN
|
RN
|
EI24
|
C
|
53 774 | 2 463 | 951 | Roscomáin | Roscommon |
| Sligo | IE.SO
|
SO
|
EI25
|
C
|
58 200 | 1 796 | 693 | Sligeach | Sligo |
| Tipperary | IE.TY
|
TA
|
EI26
|
M
|
140 131 | 4 255 | 1 643 | Tiobraid Aran | Clonmel |
| Waterford | IE.WD
|
WD
|
EI27
|
M
|
101 546 | 1 838 | 710 | Port Láirghe | Waterford |
| Westmeath | IE.WH
|
WH
|
EI29
|
L
|
71 858 | 1 763 | 681 | An Iar-Mhídhe | Mullingar |
| Wexford | IE.WX
|
WX
|
EI30
|
L
|
116 596 | 2 351 | 908 | Loch Garman | Wexford |
| Wicklow | IE.WW
|
WW
|
EI31
|
L
|
114 676 | 2 025 | 782 | Cill Mhanntáin | Wicklow |
| Irland | 3 917 203 | 68 897 | 26 600 | ||||||
Verwaltungseinheiten:
4 cuígí bzw. provinces (Provinzen)
26 contae bzw. counties (Grafschaften), 3 comhairle cathrach / city councils (Städte) und 2 comhairle cathrach agus contae / city and county councils (Stadt-Grafschaften)
95 ceantair bhardasacha / municipal districts (Gemeinden)
3.440 toghroinn / wards (Wahlbezirke)
In Nordirland gibt es 26 Bezirke (Districts). Es handelt sich - wie in Wales und Schottland um so genannte Unitary Authorities, das heißt sie sind für alle lokalen Verwaltungsaufgaben zuständig. Es gibt keine Verwaltungsstufe über oder unter ihnen („einstufige Verwaltung“). Manche der Districts führen aufgrund ihrer Geschichte oder Bedeutung die Bezeichnung City. Dies ist in der folgenden Übersicht besonders gekennzeichnet.
Die heutige Verwaltungsstruktur wurde 1973 eingeführt. Sie löste die seit 1898 bestehende Gliederung ab, bei der es insgesamt 6 Countys und 2 County Boroughs gab. Die Countys waren in verschiedene Urban districts („städtische Bezirke“) und Rural districts („ländliche Bezirke“) unterteilt. Es handelte sich somit bis 1973 um eine „zweistufige Verwaltung“. Die traditionellen sechs Counties Nordirlands waren nach dem Zensus von 1971:
| County | Einwohner | Fläche (qkm) | Hauptstadt |
| Antrim | 717 798 | 2 907 | Belfast |
| Armagh | 133 969 | 1 266 | Armagh |
| Down | 311 876 | 2 465 | Downpatrick |
| Fermanagh | 50 255 | 1 701 | Enniskillen |
| Londonderry | 183 094 | 2 083 | Londonderry |
| Tyrone | 139 073 | 3 155 | Omagh |
| 1 536 065 | 13 577 |
Die gegenwärtigen 26 Distrikte Nordirlands sind nach dem Zensus von 1991:
| District | HASC | ISO | FIPS | Fläche (km²) | Einwohner | Hauptstadt | Counties | |||
| Antrim | GB.AN
|
ANT
|
UK52
|
563 | 46 600 | Antrim | Antrim | |||
| Ards | GB.AD
|
ARD
|
UK53
|
369 | 63 600 | Newtownards | Down | |||
| Armagh | GB.AM
|
ARM
|
UK54
|
672 | 50 700 | Armagh | Armagh | |||
| Ballymena | GB.BL
|
BLA
|
UK55
|
637 | 56 100 | Ballymena | Antrim | |||
| Ballymoney | GB.BY
|
BLY
|
UK56
|
419 | 23 800 | Ballymoney | Antrim | |||
| Banbridge | GB.BB
|
BNB
|
UK57
|
445 | 32 000 | Banbridge | Down | |||
| Belfast | GB.BF
|
BFS
|
UK58
|
115 | 303 800 | Belfast | Antrim | |||
| Carrickfergus | GB.CF
|
CKF
|
UK59
|
87 | 29 300 | Carrickfergus | Antrim | |||
| Castlereagh | GB.CS
|
CSR
|
UK60
|
85 | 57 900 | Belfast | Antrim, Down | |||
| Coleraine | GB.CL
|
CLR
|
UK61
|
485 | 47 700 | Coleraine | Antrim | |||
| Cookstown | GB.CK
|
CKT
|
UK62
|
623 | 27 700 | Cookstown | Tyrone | |||
| Craigavon | GB.CR
|
CGV
|
UK63
|
382 | 76 600 | Craigavon | Antrim, Armagh, Down | |||
| Down | GB.DW
|
DOW
|
UK64
|
647 | 56 400 | Downpatrick | Down | |||
| Dungannon | GB.DN
|
DGN
|
UK65
|
780 | 43 900 | Dungannon | Armagh, Tyrone | |||
| Fermanagh | GB.FE
|
FER
|
UK66
|
1 876 | 50 300 | Enniskillen | Fermanagh | |||
| Larne | GB.LR
|
LRN
|
UK67
|
338 | 28 700 | Larne | Antrim | |||
| Limavady | GB.LM
|
LMV
|
UK68
|
587 | 29 600 | Limavady | Londonderry | |||
| Lisburn | GB.LB
|
LSB
|
UK69
|
444 | 92 900 | Lisburn | Antrim, Down | |||
| Londonderry | GB.LD
|
DRY
|
UK70
|
387 | 97 500 | Londonderry | Londonderry | |||
| Magherafelt | GB.MF
|
MFT
|
UK71
|
572 | 33 300 | Magherafelt | Londonderry | |||
| Moyle | GB.MY
|
MYL
|
UK72
|
495 | 15 200 | Ballycastle | Antrim | |||
| Newry & Mourne | GB.NM
|
NYM
|
UK73
|
895 | 87 100 | Newry | Armagh, Down | |||
| Newtownabbey | GB.NW
|
NTA
|
UK74
|
150 | 72 300 | Newtownabbey | Antrim | |||
| North Down | GB.ND
|
NDN
|
UK75
|
73 | 70 700 | Bangor | Down | |||
| Omagh | GB.OM
|
OMH
|
UK76
|
1 129 | 45 800 | Omagh | Tyrone | |||
| Strabane | GB.SB
|
STB
|
UK77
|
870 | 35 700 | Strabane | Tyrone | |||
| Nordirland | 1 575 200 | 14 125 | ||||||||
Im Jahr 2015 wurden 11 local govnerment areas ein gerichtet:
| Name | Fläche (km²) | Z 2021 |
| Antrim and Newtownabbey | 570,7 | 145.661 |
| Ards and North Down | 457,3 | 163.659 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 1.347 | 218.656 |
| Belfast | 137,1 | 345.418 |
| Causeway Coast and Glens | 1.980 | 141.746 |
| Derry City and Strabane | 1.237 | 150.756 |
| Fermanagh and Omagh | 2.847 | 116.812 |
| Lisburn and Castlereagh | 502,9 | 149.106 |
| Mid and East Antrim | 1.046 | 138.994 |
| Mid Ulster | 1,821 | 150.293 |
| Newry, Mourne and Down | 1.619 | 182.074 |
| Nordirland | 13.562 | 1.903.175 |
Verwaltungseinheiten:
6 historical counties (historische Grafschaften)
11 local government areas (lokale Verwaltungsgebiete)
26 districts (Bezirke)
526 wards (Gemeinden)
Bevölkerung
Die Einwohnerzahl Irlands ging Mitte des 19. Jahrhunderts drastisch zurück. Missernten, Hungersnöte und Repressalien durch die englische Herrschaft ließen die Einwohnerzahl von rund 6,5 Millionen im Jahre 1841 auf 3,0 Millionen im Jahre 1921 schrumpfen; viele Iren wanderten aus, vor allem nach Großbritannien und in die USA. Die Unabhängigkeit von Großbritannien und Nordirland ab Beginn der 1920er Jahre führte zwar zu allmählichen Verbesserungen der Lebensumstände, die Einwohnerzahl schrumpfte weiterhin, wenn auch nicht mehr ganz so stark.
Der Tiefpunkt war mit rund 2,82 Millionen Einwohnern in den 1960er Jahren erreicht. Seither hat sich die Bevölkerungszahl wieder positiv entwickelt und mit derzeit rund 4,3 Millionen Einwohnern inzwischen wieder einen Stand erreicht, den sie zuletzt in den 1860er Jahren hatte. Die Zunahme erfolgt zwar in erster Linie durch Zuwanderung, jedoch auch durch Geburtenüberschuss.
Im Folgenden die Bevölkerungsentwicklung Irlands samt Dichte, basierend auf der offiziellen Fläche von 70.272,78 km², vor 1851 auf 84.412 km².
Bevölkerungsentwicklung:
Jahr Einwohner Dichte (E/km²)
1700 3 750 000 44,42
1750 3 950 000 46,79
1791 4 200 000 49,76
1801 5 220 000 61,84
1811 5 650 000 66,93
1821 6 802 000 80,58
1831 7 767 000 92,01
1841 6 528 800 77,34
1851 5 111 600 60,56
1861 4 402 100 62,64
1871 4 035 200 57,42
1881 3 870 000 55,07
1891 3 468 700 49,36
1901 3 221 823 45,85
1911 3 139 688 44,68
1922 3 020 000 42,98
1926 2 971 992 42,29
1931 2 930 000 41,69
1936 2 968 420 41,97
1939 2 930 000 41,69
1942 2 960 000 42,12
1946 2 955 107 42,05
1949 2 980 000 42,40
1950 2 970 000 42,26
1951 2 960 593 42,13
1952 2 950 000 41,98
1953 2 940 000 41,84
1954 2 930 000 41,69
1955 2 920 000 41,55
1956 2 898 300 41,24
1957 2 880 000 40,98
1958 2 855 000 40,63
1959 2 850 000 40,56
1960 2 821 700 40,15
1961 2 818 341 40,11
1962 2 825 000 40,20
1963 2 840 000 40,41
1964 2 855 000 40,63
1965 2 882 000 41,01
1966 2 884 000 41,04
1967 2 900 000 41,27
1968 2 910 000 41,41
1969 2 954 000 42,04
1970 2 971 300 42,28
1971 2 978 248 42,38
1973 3 070 000 43,69
1976 3 230 000 45,96
1979 3 368 200 47,93
1980 3 400 000 48,38
1981 3 443 405 49,00
1982 3 490 000 49,66
1983 3 522 800 50,13
1984 3 525 000 50,16
1985 3 535 000 50,30
1986 3 540 600 50,38
1987 3 534 900 50,29
1988 3 515 100 50,02
1989 3 507 000 49,91
1990 3 521 000 50,10
1991 3 525 719 50,17
1992 3 560 000 50,66
1993 3 571 000 50,82
1994 3 534 000 50,29
1995 3 586 000 51,02
1996 3 626 087 51,60
1997 3 661 000 52,10
1998 3 705 000 52,72
1999 3 752 000 53,39
2000 3 797 300 54,04
2001 3 828 000 54,47
2002 3 917 203 55,74
2003 3 994 000 56,84
2004 4 011 000 57,13
2005 4 027 303 57,37
2006 4 239 848 60,33
2007 4 301 500 61,21
2008 4 364 523 62,11
2009 4 407 000 62,71
2010 4 493 457 63,94
2011 4 561 269 64,91
2012 4 587 000 65,27
2013 4 593 100 65,36
2014 4 686 347 66,69
2015 4 700 107 66,88
2016 4 726 078 67,25
2017 4 761 657 67,76
2018 4 803 748 68,36
2019 4 847 139 68,98
2020 4 937 786 70,27
2021 4 986 526 70,96
2022 5 089 478 72,42
2023 5 149 139 73,27
2024 5 247 840 74,68
Die Bevölkerung wuchs von 1981 bis 2001 um durchschnittlich 0,558 % pro Jahr. Die Fertilitätsrate lag 2009 bei 1,85 Kindern pro gebärfähiger Frau, das Durchschnittsalter bei 35 Jahren. Die mittlere Lebenserwartung liegt bei etwa 78 Jahren.
Lebenserwartung in Jahren 2009:
- insgesamt 78,24
- Männer 75,60
- Frauen 81.06
Die Zahl der Haushalte beträgt insgesamt rund 1,3 Millionen.
Haushalte 2002:
- Gesamtzahl 1.287 958
- Personen in Haushalten 3.791.316
- Personen pro Haushalt 2,944
In Nordirland leben zur Zeit rund 1,75 Millionen Menschen. Es ist dies nur unwesentlich mehr die Bevölkerungszahl von 1800. Im Folgenden die Entwicklung der Bevölkerungszahl samt Dichte, bezogen auf die Fläche von 14.120 qkm.
Bevölkerungsentwicklung:
Jahr Einwohner Dichte (E/qkm)
1800 1 600 000 113,31
1851 1 442 000 102,12
1861 1 390 000 98,44
1871 1 350 000 95,61
1881 1 310 000 92,78
1891 1 260 000 89,24
1901 1 236 952 87,60
1911 1 250 531 88,56
1921 1 256 600 88,99
1931 1 279 700 90,63
1939 1 279 745 90,63
1946 1 335 000 94,55
1949 1 360 000 96,32
1950 1 365 000 96,67
1951 1 370 921 97,09
1952 1 380 000 97,73
1953 1 388 000 98,30
1954 1 395 000 98,80
1955 1 400 000 99,15
1956 1 405 000 99,50
1957 1 410 000 99,86
1958 1 415 000 100,21
1959 1 420 000 100,57
1960 1 430 000 101,27
1961 1 435 400 101,66
1962 1 445 000 102,34
1963 1 460 000 103,39
1964 1 470 000 104,10
1965 1 480 000 104,81
1966 1 490 000 105,52
1967 1 500 000 106,23
1968 1 510 000 106,94
1969 1 520 000 107,65
1970 1 530 000 108,36
1971 1 536 065 108,79
1972 1 536 500 108,83
1973 1 537 000 108,86
1974 1 537 500 108,89
1975 1 538 000 108,92
1976 1 538 100 108,93
1977 1 539 000 108,99
1978 1 540 000 109,07
1979 1 541 000 109,14
1980 1 542 000 109,22
1981 1 543 000 109,28
1982 1 544 500 109,38
1983 1 550 600 109,82
1984 1 557 300 110,29
1985 1 565 400 110,65
1986 1 573 500 111,74
1987 1 582 000 112,03
1988 1 585 400 112,28
1989 1 590 400 112,63
1990 1 595 600 113,00
1991 1 601 400 113,41
1992 1 623 300 114,96
1993 1 635 600 115,84
1994 1 643 700 116,41
1995 1 649 100 116,79
1996 1 661 800 117,69
1997 1 671 300 118,36
1998 1 677 800 118,82
1999 1 679 000 118,91
2000 1 682 900 119,19
2001 1 685 267 119,35
2002 1 696 600 120,16
2003 1 702 600 120,58
2004 1 710 322 121,13
2005 1 718 000 121,67
2006 1 727 185 122,32
2007 1 737 517 123,05
2008 1 763 331 124,88
2009 1 784 787 126,40
2010 1 799 392 127,44
2011 1 810 863 128,20
2012 1 823 634 129,15
2013 1 829 700 129,58
2014 1 840 500 130,35
2015 1 851 600 131,13
2016 1 861 200 131,81
2017 1 870 800 132,49
2018 1 881 641 133,26
2019 1 885 400 133,53
2020 1 890 000 133,85
2021 1 903 175 134,79
2022 1 910 543 135,31
2023 1 920 400 136,01
2024 1 927 855 136,53
Die Bevölkerung wuchs von 1981 bis 2001 um durchschnittlich 0,461 % pro Jahr. Die Fruchtbarkeitsrate lag 2008 bei etwa 1,4 Kindern pro gebärfähiger Frau, das Durchschnittsalter bei 42 Jahren. Die mittlere Lebenserwartung liegt bei etwa 78 Jahren. Die Zahl der Haushalte beträgt insgesamt rund 600.000.
Regionale Verteilung
Die Einwohnerzahlen der counties entwickelten sich wie folgt:
| County | S 1821? | Z 1891 | Z 1901 | Z 1926 | Z 1936 | S 1941 | Z 1946 | Z 1951 | Z 1956 | Z 1961 | Z 1966 | Z 1971 | Z 1981 |
| Carlow | 50.000 | 40.900 | 37.723 | 34.500 | 34.452 | 34.200 | 34.081 | 34.500 | 33.888 | 33.300 | 34.000 | 34.237 | 39.820 |
| Cavan | 95.000 | 111.900 | 97.368 | 82.400 | 76.670 | 73.800 | 70.355 | 76.700 | 61.740 | 56.600 | 54.000 | 52.618 | 53.855 |
| Clare | 100.000 | 124.500 | 112.129 | 95.000 | 89.879 | 88.400 | 85.064 | 89.900 | 77.176 | 73.700 | 74.000 | 75.008 | 87.567 |
| Cork | 416.000 | 438.400 | 404.813 | 365.800 | 355.957 | 352.200 | 343.668 | 356.000 | 336.663 | 330.400 | 340.000 | 352.892 | 402.465 |
| Donegal | 248.300 | 185.600 | 173.625 | 152.500 | 142.310 | 142.700 | 136.317 | 142.300 | 122.059 | 113.800 | 109.000 | 108.344 | 125.112 |
| Dublin | 288.000 | 419.200 | 447.266 | 505.700 | 586.925 | 619.000 | 636.193 | 562.000 | 705.781 | 718.300 | 795.000 | 852.219 | 1.003.164 |
| Galway | 142.000 | 214.700 | 192.146 | 169.300 | 168.198 | 168.800 | 165.201 | 168.200 | 155.553 | 149.900 | 148.000 | 149.223 | 172.018 |
| Kerry | 107.000 | 179.100 | 165.331 | 150.900 | 139.834 | 139.600 | 133.893 | 139.800 | 122.072 | 116.500 | 113.000 | 112.772 | 122.770 |
| Kildare | 56.500 | 70.200 | 63.469 | 58.000 | 57.892 | 63.500 | 64.849 | 66.400 | 65.915 | 64.400 | 66.000 | 71.977 | 104.122 |
| Kilkenny | 100.000 | 87.300 | 78.821 | 71.000 | 68.614 | 68.300 | 66.712 | 68.600 | 64.089 | 61.700 | 60.000 | 61.473 | 70.806 |
| Laoighis | 82.000 | 64.900 | 57.226 | 51.500 | 50.109 | 49.697 | 46.000 | 47.087 | 45.100 | 45.000 | 45.259 | 51.171 | |
| Leitrim | 35.000 | 78.600 | 69.201 | 55.900 | 50.908 | 48.500 | 44.591 | 50.900 | 37.056 | 33.500 | 31.000 | 28.360 | 27.609 |
| Limerick | 170.000 | 158.900 | 146.018 | 136.900 | 141.153 | 143.400 | 142.559 | 141.200 | 137.881 | 133.300 | 137.000 | 140.459 | 161.661 |
| Longford | 50.000 | 52.600 | 46.581 | 39.800 | 37.847 | 37.800 | 36.218 | 37.800 | 32.969 | 30.600 | 29.000 | 28.250 | 31.140 |
| Louth | 57.800 | 71.000 | 65.741 | 62.700 | 64.339 | 65.700 | 66.194 | 68.800 | 69.194 | 67.400 | 70.000 | 74.951 | 88.514 |
| Mayo | 140.000 | 219.000 | 202.627 | 172.700 | 161.349 | 154.600 | 148.120 | 161.300 | 133.052 | 123.300 | 116.000 | 109.525 | 114.766 |
| Meath | 112.400 | 77.000 | 67.463 | 62.900 | 61.405 | 65.100 | 66.232 | 66.300 | 66.762 | 65.100 | 67.000 | 71.729 | 95.419 |
| Monaghan | 118.000 | 86.200 | 74.505 | 65.100 | 61.289 | 59.300 | 57.215 | 61.300 | 52.064 | 47.100 | 46.000 | 46.242 | 51.192 |
| Offaly | 74.500 | 65.600 | 60.129 | 52.500 | 51.308 | 51.600 | 53.686 | 52.500 | 51.970 | 51.500 | 52.000 | 51.829 | 58.312 |
| Roscommon | 76.500 | 114.400 | 101.639 | 83.500 | 77.566 | 76.200 | 72.510 | 77.600 | 63.710 | 59.200 | 56.000 | 53.519 | 54.543 |
| Sligo | 60.000 | 98.000 | 84.022 | 71.400 | 67.447 | 64.700 | 62.375 | 67.400 | 56.850 | 53.600 | 51.000 | 50.275 | 55.474 |
| Tipperary | 69.000 | 65.100 | 159.754 | 56.800 | 137.835 | 56.700 | 136.014 | 54.700 | 129.415 | 52.900 | 123.000 | 124.565 | 135.261 |
| Waterford | 140.000 | 111.800 | 87.030 | 95.800 | 77.614 | 93.800 | 76.108 | 92.200 | 74.031 | 83.300 | 73.000 | 77.315 | 88.591 |
| Westmeath | 60.000 | 62.100 | 61.527 | 57.600 | 54.706 | 59.100 | 54.949 | 62.600 | 54.122 | 58.500 | 53.000 | 53.570 | 61.523 |
| Wexford | 347.000 | 178.200 | 103.860 | 140.900 | 94.245 | 137.400 | 91.855 | 137.800 | 87.259 | 123.800 | 83.000 | 85.351 | 99.081 |
| Wicklow | 128.000 | 98.300 | 60.679 | 58.500 | 58.569 | 77.600 | 60.451 | 77.600 | 59.906 | 71.400 | 60.000 | 66.295 | 87.449 |
| Irland | 6.802.000 | 3.478.700 | 3.221.823 | 2.971.992 | 2.968.420 | 2.950.000 | 2.955.107 | 2.960.593 | 2.898.264 | 2.818.341 | 2.885.000 | 2.978.248 | 3.443.405 |
| Name | Status | Z 1981 | Z 1986 | Z 1991 | Z 1996 | Z 2002 | Z 2006 | Z 2011 | Z 2016 |
| Connacht | Provinz | 424.410 | 431.409 | 423.031 | 433.231 | 464.296 | 504.121 | 542.547 | 550.688 |
| Galway | Grafschaft | ... | 131.448 | 129.511 | 131.613 | 143.245 | 159.256 | 175.124 | 179.390 |
| Galway City | Stadt | ... | 47.104 | 50.853 | 57.241 | 65.832 | 72.414 | 75.529 | 78.668 |
| Leitrim | Grafschaft | 27.609 | 27.035 | 25.301 | 25.057 | 25.799 | 28.950 | 31.798 | 32.044 |
| Mayo | Grafschaft | 114.766 | 115.184 | 110.713 | 111.524 | 117.446 | 123.839 | 130.638 | 130.507 |
| Roscommon | Grafschaft | 54.543 | 54.592 | 51.897 | 51.975 | 53.774 | 58.768 | 64.065 | 64.544 |
| Sligo | Grafschaft | 55.474 | 56.046 | 54.756 | 55.821 | 58.200 | 60.894 | 65.393 | 65.535 |
| Leinster | Provinz | 1.790.521 | 1.852.649 | 1.860.949 | 1.924.702 | 2.105.579 | 2.295.123 | 2.504.814 | 2.634.403 |
| Carlow | Grafschaft | 39.820 | 40.988 | 40.942 | 41.616 | 46.014 | 50.349 | 54.612 | 56.932 |
| Dublin City | Stadt | 525.882 | 502.749 | 478.389 | 481.854 | 495.781 | 506.211 | 527.612 | 554.554 |
| Dún Laoghaire-Rathdown | Grafschaft | ... | 180.675 | 185.410 | 189.999 | 191.792 | 194.038 | 206.261 | 218.018 |
| Fingal | Grafschaft | ... | 138.479 | 152.766 | 167.683 | 196.413 | 239.992 | 273.991 | 296.020 |
| Kildare | Grafschaft | 104.122 | 116.247 | 122.656 | 134.992 | 163.944 | 186.335 | 210.312 | 222.504 |
| Kilkenny | Grafschaft | 70.806 | 73.186 | 73.635 | 75.336 | 80.339 | 87.558 | 95.419 | 99.232 |
| Laois (Laoighis) | Grafschaft | 51.171 | 53.284 | 52.314 | 52.945 | 58.774 | 67.059 | 80.559 | 84.697 |
| Longford | Grafschaft | 31.140 | 31.496 | 30.296 | 30.166 | 31.068 | 34.391 | 39.000 | 40.873 |
| Louth | Grafschaft | 88.514 | 91.810 | 90.724 | 92.166 | 101.821 | 111.267 | 122.897 | 128.884 |
| Meath | Grafschaft | 95.419 | 103.881 | 105.370 | 109.732 | 134.005 | 162.831 | 184.135 | 195.044 |
| Offaly | Grafschaft | 58.312 | 59.835 | 58.494 | 59.117 | 63.663 | 70.868 | 76.687 | 77.961 |
| South Dublin | Grafschaft | ... | 199.546 | 208.739 | 218.728 | 238.835 | 246.935 | 265.205 | 278.767 |
| Westmeath | Grafschaft | 61.523 | 63.379 | 61.880 | 63.314 | 71.858 | 79.346 | 86.164 | 88.770 |
| Wexford | Grafschaft | 99.081 | 102.552 | 102.069 | 104.371 | 116.596 | 131.749 | 145.320 | 149.722 |
| Wicklow | Grafschaft | 87.449 | 94.542 | 97.265 | 102.683 | 114.676 | 126.194 | 136.640 | 142.425 |
| Munster | Provinz | 998.315 | 1.020.577 | 1.009.533 | 1.033.903 | 1.100.614 | 1.173.340 | 1.246.088 | 1.280.020 |
| Clare | Grafschaft | 87.567 | 91.344 | 90.918 | 94.006 | 103.277 | 110.950 | 117.196 | 118.817 |
| Cork | Grafschaft | 266.121 | 279.464 | 283.116 | 293.323 | 324.767 | 361.877 | 399.802 | 417.211 |
| Cork City | Stadt | 136.344 | 133.271 | 127.253 | 127.187 | 123.062 | 119.418 | 119.230 | 125.657 |
| Kerry | Grafschaft | 122.770 | 124.159 | 121.894 | 126.130 | 132.527 | 139.835 | 145.502 | 147.707 |
| Limerick | Stadt und Grafschaft | 161.661 | 164.569 | 161.956 | 165.042 | 175.304 | 184.055 | 191.809 | 194.899 |
| Tipperary | Grafschaft | 135.261 | 136.619 | 132.772 | 133.535 | 140.131 | 149.244 | 158.754 | 159.553 |
| Waterford | Stadt und Grafschaft | 88.591 | 91.151 | 91.624 | 94.680 | 101.546 | 107.961 | 113.795 | 116.176 |
| Ulster | Provinz | 230.159 | 236.008 | 232.206 | 234.251 | 246.714 | 267.264 | 294.803 | 296.754 |
| Cavan | Grafschaft | 53.855 | 53.965 | 52.796 | 52.944 | 56.546 | 64.003 | 73.183 | 76.176 |
| Donegal | Grafschaft | 125.112 | 129.664 | 128.117 | 129.994 | 137.575 | 147.264 | 161.137 | 159.192 |
| Monaghan | Grafschaft | 51.192 | 52.379 | 51.293 | 51.313 | 52.593 | 55.997 | 60.483 | 61.386 |
| Ireland (Éire) | Republik | 3.443.405 | 3.540.643 | 3.525.719 | 3.626.087 | 3.917.203 | 4.239.848 | 4.588.252 | 4.761.865 |
| Name | Status | Z 1981 | Z 1986 | Z 1991 | Z 1996 | Z 2002 | Z 2006 | Z 2011 | Z 2016 | Z 2022 |
| Connacht | Provinz | 424.410 | 431.409 | 423.031 | 433.231 | 464.296 | 504.121 | 542.547 | 550.688 | 591.363 |
| Galway | Grafschaft | ... | 131.448 | 129.511 | 131.613 | 143.245 | 159.256 | 175.124 | 179.390 | 193.323 |
| Galway City | Stadt | ... | 47.104 | 50.853 | 57.241 | 65.832 | 72.414 | 75.529 | 78.668 | 84.414 |
| Leitrim | Grafschaft | 27.609 | 27.035 | 25.301 | 25.057 | 25.799 | 28.950 | 31.798 | 32.044 | 35.199 |
| Mayo | Grafschaft | 114.766 | 115.184 | 110.713 | 111.524 | 117.446 | 123.839 | 130.638 | 130.507 | 137.970 |
| Roscommon | Grafschaft | 54.543 | 54.592 | 51.897 | 51.975 | 53.774 | 58.768 | 64.065 | 64.544 | 70.259 |
| Sligo | Grafschaft | 55.474 | 56.046 | 54.756 | 55.821 | 58.200 | 60.894 | 65.393 | 65.535 | 70.198 |
| Leinster | Provinz | 1.790.521 | 1.852.649 | 1.860.949 | 1.924.702 | 2.105.579 | 2.295.123 | 2.504.814 | 2.634.403 | 2.870.354 |
| Carlow | Grafschaft | 39.820 | 40.988 | 40.942 | 41.616 | 46.014 | 50.349 | 54.612 | 56.932 | 61.968 |
| Dublin City | Stadt | 525.882 | 502.749 | 478.389 | 481.854 | 495.781 | 506.211 | 527.612 | 554.554 | 592.713 |
| Dún Laoghaire-Rathdown | Grafschaft | ... | 180.675 | 185.410 | 189.999 | 191.792 | 194.038 | 206.261 | 218.018 | 233.860 |
| Fingal | Grafschaft | ... | 138.479 | 152.766 | 167.683 | 196.413 | 239.992 | 273.991 | 296.020 | 330.506 |
| Kildare | Grafschaft | 104.122 | 116.247 | 122.656 | 134.992 | 163.944 | 186.335 | 210.312 | 222.504 | 247.774 |
| Kilkenny | Grafschaft | 70.806 | 73.186 | 73.635 | 75.336 | 80.339 | 87.558 | 95.419 | 99.232 | 104.160 |
| Laois (Laoighis) | Grafschaft | 51.171 | 53.284 | 52.314 | 52.945 | 58.774 | 67.059 | 80.559 | 84.697 | 91.877 |
| Longford | Grafschaft | 31.140 | 31.496 | 30.296 | 30.166 | 31.068 | 34.391 | 39.000 | 40.873 | 46.751 |
| Louth | Grafschaft | 88.514 | 91.810 | 90.724 | 92.166 | 101.821 | 111.267 | 122.897 | 128.884 | 139.703 |
| Meath | Grafschaft | 95.419 | 103.881 | 105.370 | 109.732 | 134.005 | 162.831 | 184.135 | 195.044 | 220.826 |
| Offaly | Grafschaft | 58.312 | 59.835 | 58.494 | 59.117 | 63.663 | 70.868 | 76.687 | 77.961 | 83.150 |
| South Dublin | Grafschaft | ... | 199.546 | 208.739 | 218.728 | 238.835 | 246.935 | 265.205 | 278.767 | 301.075 |
| Westmeath | Grafschaft | 61.523 | 63.379 | 61.880 | 63.314 | 71.858 | 79.346 | 86.164 | 88.770 | 96.221 |
| Wexford | Grafschaft | 99.081 | 102.552 | 102.069 | 104.371 | 116.596 | 131.749 | 145.320 | 149.722 | 163.919 |
| Wicklow | Grafschaft | 87.449 | 94.542 | 97.265 | 102.683 | 114.676 | 126.194 | 136.640 | 142.425 | 155.851 |
| Munster | Provinz | 998.315 | 1.020.577 | 1.009.533 | 1.033.903 | 1.100.614 | 1.173.340 | 1.246.088 | 1.280.020 | 1.373.346 |
| Clare | Grafschaft | 87.567 | 91.344 | 90.918 | 94.006 | 103.277 | 110.950 | 117.196 | 118.817 | 127.938 |
| Cork | Grafschaft | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 319.494 | 333.213 | 360.152 |
| Cork City | Stadt | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 199.538 | 209.655 | 224.004 |
| Kerry | Grafschaft | 122.770 | 124.159 | 121.894 | 126.130 | 132.527 | 139.835 | 145.502 | 147.707 | 156.458 |
| Limerick | Stadt und Grafschaft | 161.661 | 164.569 | 161.956 | 165.042 | 175.304 | 184.055 | 191.809 | 194.899 | 209.536 |
| Tipperary | Grafschaft | 135.261 | 136.619 | 132.772 | 133.535 | 140.131 | 149.244 | 158.754 | 159.553 | 167.895 |
| Waterford | Stadt und Grafschaft | 88.591 | 91.151 | 91.624 | 94.680 | 101.546 | 107.961 | 113.795 | 116.176 | 127.363 |
| Ulster | Provinz | 230.159 | 236.008 | 232.206 | 234.251 | 246.714 | 267.264 | 294.803 | 296.754 | 314.076 |
| Cavan | Grafschaft | 53.855 | 53.965 | 52.796 | 52.944 | 56.546 | 64.003 | 73.183 | 76.176 | 81.704 |
| Donegal | Grafschaft | 125.112 | 129.664 | 128.117 | 129.994 | 137.575 | 147.264 | 161.137 | 159.192 | 167.084 |
| Monaghan | Grafschaft | 51.192 | 52.379 | 51.293 | 51.313 | 52.593 | 55.997 | 60.483 | 61.386 | 65.288 |
| Irland | Republik | 3.443.405 | 3.540.643 | 3.525.719 | 3.626.087 | 3.917.203 | 4.239.848 | 4.588.252 | 4.761.865 | 5.149.139 |
Die Einwohnerzahlen der Counties Nordirlands entwickelten sich wie folgt:
| County | 1901 | 1911 | 1937 | 1951 | 1961 | 1971 |
| Antrim | 545 270 | 580 811 | 635 352 | 674 820 | 692 500 | 717 798 |
| Armagh | 125 392 | 120 291 | 108 815 | 114 254 | 117 900 | 133 969 |
| Down | 205 889 | 204 303 | 210 687 | 241 181 | 270 200 | 311 876 |
| Fermanagh | 65 430 | 61 836 | 54 569 | 53 044 | 52 400 | 50 255 |
| Londonderry | 144 404 | 140 625 | 142 736 | 155 540 | 167 900 | 183 094 |
| Tyrone | 150 567 | 142 665 | 127 586 | 132 082 | 134 500 | 139 073 |
| Nordirland | 1 236 952 | 1 250 531 | 1 279 745 | 1 370 921 | 1 435 400 | 1 536 065 |
Die 2015 eingerichteten lokalen Verwaltungseinheiten zeigen folgendes Bild:
| Name | Status | Z 1981 | Z 1991 | Z 2001 | Z 2011 | Z 2021 |
| Antrim and Newtownabbey | Bezirk | 116.015 | 118.551 | 128.361 | 138.567 | 145.661 |
| Ards and North Down | Bezirk | ... | ... | 149.221 | 156.672 | 163.659 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | Bezirk | ... | ... | 175.427 | 199.693 | 218.656 |
| Belfast | Bezirk | ... | ... | 328.617 | 333.871 | 345.418 |
| Causeway Coast and Glens | Bezirk | 110.122 | 118.992 | 131.564 | 140.877 | 141.746 |
| Derry City and Strabane | Bezirk | 118.412 | 131.512 | 143.314 | 147.720 | 150.756 |
| Fermanagh and Omagh | Bezirk | 92.167 | 99.842 | 105.479 | 113.161 | 116.812 |
| Lisburn and Castlereagh | Bezirk | ... | ... | 124.302 | 134.841 | 149.106 |
| Mid and East Antrim | Bezirk | 111.813 | 118.810 | 127.101 | 135.338 | 138.994 |
| Mid Ulster | Bezirk | ... | ... | 119.000 | 138.590 | 150.293 |
| Newry, Mourne and Down | Bezirk | ... | ... | 152.881 | 171.533 | 182.074 |
| Nordirland | Landesteil | 1.481.959 | 1.577.836 | 1.685.267 | 1.810.863 | 1.903.175 |
Volksgruppen
Über 90 % der Staatsbürger der Republik Irland sind Nachfahren der Kelten. Aber auch die vorkeltischen Bewohner Irlands und von dort im 9. und 10. Jahrhundert eingefallenen Wikinger haben Spuren hinterlassen. Besonders im Nordosten der Insel gibt es eine protestantische Minderheit, die ihre Wurzeln zum größten Teil auf Einwanderer von der Insel Großbritannien zurückführt.
Irland war Jahrhunderte lang bis in die späten 1980er Jahre ein Auswanderungsland. Deswegen sind große Teile der Bevölkerung der USA, Kanadas, Australiens und Neuseelands irischer Abstammung, und New York City gilt als die größte irische Stadt der Welt. Viele Nachkommen pflegen auch weiterhin die irischen Traditionen (zum Beispiel Halloween und St. Patrick’s Day) und betonen ihre Abstammung.
Die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe in der Republik Irland sind die ethnischen Iren (na hÉireannaigh). Sie machen etwa 82 bis 85 Prozent der Bevölkerung aus und sind Nachfahren der keltischen Bevölkerung, die seit vielen Jahrhunderten auf der Insel lebt. Die irische Kultur ist tief in keltischen Traditionen verwurzelt – Musik, Tanz, Literatur und Volksglaube spielen bis heute eine zentrale Rolle. Die meisten ethnischen Iren sind römisch-katholisch, was das gesellschaftliche und kulturelle Leben über viele Jahrhunderte stark geprägt hat. Die irische Sprache (Gaeilge) ist neben Englisch die offizielle Amtssprache des Landes, wird jedoch nur in bestimmten Regionen – den sogenannten Gaeltacht-Gebieten – noch regelmäßig gesprochen. Englisch ist im Alltag die dominante Sprache.
Eine besondere und eigenständige Volksgruppe innerhalb Irlands sind die Irish Travellers (auf Irisch an lucht siúil). Sie sind keine Roma, sondern eine indigene Minderheit mit eigenen kulturellen Traditionen, Werten und einer eigenen Sprache, dem Shelta oder Cant. Historisch lebten sie als Wanderhandwerker, Händler und Schausteller, wobei sie zwischen Städten und ländlichen Gebieten umherzogen. Heute sind viele Travellers sesshaft geworden, dennoch bleibt ihre nomadische Identität ein wichtiger Bestandteil ihres Selbstverständnisses. Die Gruppe ist offiziell als ethnische Minderheit anerkannt. In Irland leben etwa 30.000 bis 40.000 Travellers, doch sie sind häufig von sozialer Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit und Diskriminierung betroffen.
Seit den 1990er Jahren hat sich die ethnische Zusammensetzung der irischen Gesellschaft durch Zuwanderung stark verändert. Während Irland früher eher ein Auswanderungsland war, wurde es mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der „Celtic Tiger“-Jahre zu einem Einwanderungsland. Zu den größten Migrantengruppen zählen heute Polen, die seit dem EU-Beitritt Polens 2004 in großer Zahl nach Irland kamen. Daneben gibt es größere Gruppen aus Litauen, Lettland, Rumänien und Bulgarien. Auch Menschen aus Nigeria und anderen afrikanischen Ländern sowie aus China, Indien und den Philippinen haben in Irland neue Gemeinschaften gebildet. Diese Gruppen tragen zunehmend zur kulturellen und religiösen Vielfalt des Landes bei und prägen insbesondere das Stadtbild von Dublin, Cork und Galway.
In Nordirland, das politisch Teil des Vereinigten Königreichs ist, ist die Bevölkerungsstruktur komplexer und historisch stark von politischen und religiösen Konflikten geprägt. Hier lassen sich zwei große traditionelle Gemeinschaften unterscheiden:
- Die katholisch-nationalistische Gemeinschaft, die sich als irisch versteht und oft eine Vereinigung mit der Republik Irland befürwortet.
- Die protestantisch-unionistische Gemeinschaft, die sich als britisch identifiziert und den Verbleib Nordirlands im Vereinigten Königreich unterstützt.
Diese Unterscheidung geht auf die Plantation of Ulster im 17. Jahrhundert zurück, als englische und schottische Siedler in den Norden Irlands gebracht wurden, um das Gebiet politisch und religiös zu festigen. Die Nachfahren dieser Siedler bilden heute den Kern der protestantischen, britisch orientierten Bevölkerung Nordirlands, während die katholische Bevölkerung stärker mit der ursprünglichen irischen Bevölkerung verwandt ist. Der jahrzehntelange Konflikt zwischenden beiden Gruppen, bekannt als „The Troubles“ (späte 1960er bis späte 1990er Jahre), hatte tiefe soziale und kulturelle Spuren hinterlassen. Erst durch das Karfreitagsabkommen (Good Friday Agreement) von 1998 kam es zu einem stabileren Frieden und einer politischen Machtteilung zwischen den beiden Gemeinschaften.
Neben diesen beiden traditionellen Gruppen wächst auch in Nordirland die Zahl der Einwanderer, insbesondere aus Osteuropa, Asien und Afrika. Diese neuen Minderheiten spielen eine zunehmende Rolle im kulturellen und wirtschaftlichen Leben des Landes, auch wenn sie zahlenmäßig noch eine kleine Minderheit darstellen.
Sprachen
Die Amtssprachen der Republik irland sind Englisch und Irisch bzw. Gälisch. Die irische Sprache (irisch Gaeilge oder Gaolainn, nach der bis 1948 geltenden Orthographie meist Gaedhilge) ist eine der drei goidelischen oder gälischen Sprachen. Zu diesen zählen auch das Schottisch-Gälische und das Manx (eine früher auf der Insel Man gesprochene Sprache). Die goidelischen Sprachen zählen zum inselkeltischen Zweig der keltischen Sprachen. Laut des 8. Verfassungsartikels ist sie „die Hauptamtssprache“ (an phríomhtheanga oifigiúil) der Republik Irland, „da [sie] die nationale Sprache ist“. Auch die Europäische Union führt Irisch seit dem 1. Januar 2007 als eine ihrer 23 Amtssprachen.
In schriftlicher Form ist das Irische in ganz Irland anzutreffen. Offizielle Ausschilderungen, so beispielsweise Orts- und Straßenschilder, sind in der gesamten Republik, zum eil auch in Nordirland, nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Irisch beschrieben. In Teilen der Gaeltacht (beispielsweise in Gebieten West-Connemaras) sind Orientierungshilfen dieser Art nur auf Irisch ausgezeichnet. Das gleiche gilt für Gedenktafeln und offizielle Dokumente. Gesetzestexte müssen in einer irischsprachigen Fassung veröffentlicht werden, deren Wortlaut in Zweifelsfällen verbindlich ist. Einige staatliche und öffentliche Institutionen haben ausschließlich irischsprachige Bezeichnungen oder solche, die neben der englischen Form häufig verwendet werden:
- Landesname: Éire (neben Ireland, häufig poetisch oder liebevoll gemeint)
- Parlament: An tOireachtas („die Versammlung“), offiziell nur irisch gebraucht
- Oberhaus: Seanad Éireann („Senat Irlands“), offiziell nur irisch gebraucht
- Unterhaus: Dáil Éireann („Zusammenkunft Irlands“), offiziell nur irisch gebraucht
- Premierminister: An Taoiseach („Der Erste“, „Der Anführer“), im inneririschen Gebrauch nur irisch
- Vize des Premierministers: An Tánaiste („Der Zweite“), im inneririschen Gebrauch nur irisch
- Parlamentsmitglied: Teachta Dála („Mitglied der Zusammenkunft“), fast nur irisch gebraucht (Titel T.D. dem Namen nachgestellt)
- alle Ministerien: Roinn + jeweiliger Zuständigkeitsbereich im Genitiv („Abteilung der/des…“), meist englisch gebraucht
- Post: An Post („Die Post“), offiziell nur irisch gebraucht
- Busgesellschaften: Bus Éireann („Bus Irlands“), Bus Átha Cliath („Bus Dublins“), nur irisch gebraucht
- Eisenbahngesellschaft: Iarnród Éireann („Eisenbahn Irlands“), nur irisch gebraucht
- Radio- und Fernsehstation: Radio Telefís Éireann (RTÉ, „Radio Fernsehen Irlands“), nur irisch gebraucht
- Telekom: früher Telecom Éireann („Telekom Irlands“), offiziell nur irisch gebraucht, mittlerweile privatisiert, nun „Eircom“ genannt
- Entwicklungsförderungsgesellschaft für die Gaeltacht: Údarás na Gaeltachta („Behörde der Gaeltacht“), nur irisch gebraucht
Die meisten für private Zwecke veröffentlichten Hinweise und Erklärungen, beispielsweise Speisekarten in Restaurants, sind dagegen üblicherweise nur auf Englisch ausgezeichnet. Manche private Firmen zeichnen einen Teil ihrer öffentlichen Texte jedoch ebenfalls zweisprachig aus. So sind die einzelnen Abteilungen in Buchläden und Supermärkten häufig auch auf Irisch bezeichnet, Produkte irischer Herkunft jedoch sehr selten. Letztlich tragen zahlreiche Kneipen, Restaurants und Läden irische Namen.
In irischer Sprache produzieren mehrere Radiosender (Raidió na Gaeltachta (staatlich), Raidió na Life (privat, Dublin)), ein Fernsehsender (TG4, anfangs TnaG, Teilifís na Gaeilge) sowie einige Periodika, unter anderem die Wochenzeitung Foinse („Quelle“) und einige meist kulturell oder literarisch orientierte Zeitschriften. Im Vergleich zur Sprecherzahl gibt es eine recht rege irischsprachige Literatur. Es gibt verschiedene Literaturfestivals und Literaturpreise. In den meisten Buchläden sind irischsprachige Bücher zu finden.
An allen staatlichen Schulen des Landes ist Irisch Pflichtfach, während der restliche Unterricht normalerweise auf Englisch stattfindet. Es gibt jedoch eine Anzahl von Schulen, Gaelscoileanna genannt, an denen Irisch die Unterrichtssprache für alle Fächer ist. Ansonsten müssen Schüler seit Jahrzehnten zwar Irisch lernen, ihre Kenntnisse aber selten ernsthaft nachweisen. Lediglich für den Zugang zu bestimmten Berufen im Staatsdienst und zu den Colleges der National University muss ein A-Level-Abschluss im Fach Irisch vorgelegt werden.
Sprachen in Irland (nach ethnologue):
- Englisch [eng] 3.750.000 in Irland (2005 Crystal). Dialekte: South Hiberno English, North Hiberno English. Einordnung: Indo-European, Germanic, West, English
- Irisch-Gälisch [gle] 260.000 in Irland (1983 census). Gesamtsprecherzahl: 391.470. Nordwest- und Südwestküste; Galway, Teil von Mayo, Kerry, Donegal, Meath, Cork, Waterford, Scotland (Albain), Isle of Mann. Also in Brazil, Canada, United Kingdom, United States. Alternativbezeichnungen: Erse, Gaeilge, Irish. Dialekte: Munster-Leinster (Southern Irish), Connacht (Western Irish), Donegal (Ulster, Northern Irish). Einordnung: Indo-European, Celtic, Insular, Goidelic
- Scots [sco] 100.000 in Irland (1999 B. Kay). 60.000 in Lallans, 30.000 in Doric, 10,000 in Ulster. Donegal County. Einordnung: Indo-European, Germanic, West, English
- Shelta [sth] 6.000 in Irland. Gesamtsprecherzahl: 86.000. Auch in Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Alternativbezeichnungen: Cant, Gammon, Irish Traveler Cant, Sheldru, The Cant. Dialekte: Basierend auf Irisch [gle] mit verschiedenen Einflüssen. Einordnung: Mischsprache, Irish-undocumented
Irische Sprache
Die irische Sprache, deren Eigenbezeichnung Gaeilge (ausgesprochen etwa „Gälge“) lautet – oder genauer Gaeilge na hÉireann („Irisches Gälisch“) –, ist eine der ältesten lebenden Sprachen Europas und eine der offiziellen Sprachen der Republik Irland. Sie wird auch als Irisch-Gälisch oder einfach Irisch bezeichnet, um sie von anderen gälischen Sprachen wie Schottisch-Gälisch (Gàidhlig) oder Manx-Gälisch (Gaelg) zu unterscheiden. Als eine der beiden Amtssprachen Irlands (neben Englisch) genießt sie verfassungsrechtlichen Schutz und ist seit 2007 eine offizielle Arbeitssprache der Europäischen Union. In Nordirland hat sie den Status einer anerkannten Minderheitensprache. Trotz ihrer historischen Bedeutung ist Irisch heute eine bedrohte Sprache, die vor allem in den sogenannten Gaeltacht-Regionen im Westen Irlands (wie Teilen von Donegal, Galway, Kerry und Cork) noch als Alltagssprache verwendet wird, während sie landesweit durch Bildung und Medien gefördert wird.
Irisch gehört zur indoeuropäischen Sprachfamilie, die die Mehrheit der europäischen und vielen asiatischen Sprachen umfasst. Innerhalb dieser Familie zählt es zur keltischen Untergruppe, die wiederum in zwei Hauptäste unterteilt wird: die kontinentalkeltischen Sprachen (wie das ausgestorbene Gallisch oder Lepontisch, die auf dem europäischen Festland gesprochen wurden) und die insularkeltischen Sprachen (die auf den Britischen Inseln heimisch sind). Irisch fällt in die letztere Kategorie und speziell in die goidelische (oder Q-keltische) Untergruppe der insularkeltischen Sprachen. Diese Unterscheidung basiert auf phonetischen Entwicklungen: In den goidelischen Sprachen wandelte sich der proto-keltische Laut */kʷ/ (wie in kʷenno- für „Kopf“) zu /k/ (zum Beispiel irisch ceann), im Gegensatz zu den brythonischen (P-keltischen) Sprachen wie Walisisch, wo er zu /p/ wurde (walisisch pen). Die goidelische Untergruppe umfasst:
- Irisch (Gaeilge)
- Schottisch-Gälisch (Gàidhlig), das sich im Mittelalter aus dem Irischen entwickelte
- Manx-Gälisch (Gaelg), die Sprache der Isle of Man, die im 20. Jahrhundert ausstarb, aber revitalisiert wird
Diese Sprachen teilen gemeinsame Vorfahren im Altirischen (zirka 4.–9. Jahrhundert n. Chr.), das aus dem Primitiv-Irischen (vor dem 4. Jahrhundert) hervorging, das wiederum auf das Proto-Keltische zurückgeht. Die keltischen Sprachen insgesamt sind indoeuropäisch und stehen in entfernte Verwandtschaft zu Sprachen wie Latein, Griechisch, Sanskrit oder Deutsch, mit gemeinsamen Wurzeln in einer rekonstruierten Proto-Indoeuropäischen Sprache vor etwa 6000 Jahren.
Die Wurzeln des Irischen reichen bis in die Eisenzeit zurück, als keltische Stämme um 500 v. Chr. nach Irland einwanderten und ihre Sprache mitbrachten. Das Altirische, die früheste dokumentierte Form, ist in Ogham-Inschriften (einem alten Alphabet aus Strichen) und später in lateinischen Manuskripten wie dem Book of Kells (8. Jahrhundert) überliefert. Im Mittelalter blühte eine reiche Literatur auf, darunter epische Mythen wie die Táin Bó Cúailnge („Der Rinderraub von Cooley“), die in Mittelirisch (9.–12. Jahrhundert) verfasst wurden. Ab dem 12. Jahrhundert beeinflussten normannische und englische Invasionen die Sprache, doch sie blieb bis ins 17. Jahrhundert dominant.
Der dramatische Rückgang setzte im 19. Jahrhundert ein: Die englische Kolonisierung, die Unterdrückung der irischen Kultur, die Große Hungersnot (1845–1852), die Millionen Tote und Emigranten forderte, sowie die Einführung englischsprachiger Schulen führten dazu, dass Irisch von einer Mehrheitssprache zu einer Minderheitensprache wurde. Im 20. Jahrhundert bemühte sich die irische Unabhängigkeitsbewegung um Revitalisierung; der Irische Freistaat (1922) machte Irisch zur Nationalsprache. Heute sprechen schätzungsweise 1,8 Millionen Menschen in Irland Irisch auf unterschiedlichem Niveau, doch nur etwa 70.000–100.000 nutzen es täglich als Erstsprache, hauptsächlich in den Gaeltacht-Gebieten. Weltweit gibt es weitere Sprecher in der Diaspora, insbesondere in den USA, Kanada und Australien.
Irisch verwendet das lateinische Alphabet mit 18 Buchstaben (ohne j, k, q, v, w, x, y, z, die nur in Lehnwörtern vorkommen). Eine Besonderheit ist der síneadh fada (langer Vokalstrich), der Vokale verlängert und die Bedeutung verändert, zum Beispiel sean (alt) vs. séan (Omen). Die Rechtschreibung wurde in den 1940er/1950er-Jahren reformiert, um sie phonetischer zu machen (zum Beispiel Gaeilge statt Gaeḋilge).
Phonetisch ist Irisch reich an Konsonantenmutationen: Lenition (Weichung, zum Beispiel c [k] zu ch [x]) und Eclipsis (Verschattung, zum Beispiel c zu gc [g]) verändern Anlaute je nach grammatikalischem Kontext, wie in an cat (die Katze) vs. mo chat (meine Katze). Es gibt palatalisierte („schlanke“) und velarisierte („breite“) Konsonanten, die die Aussprache beeinflussen. Die Wortstellung folgt dem VSO-Muster (Verb-Subjekt-Objekt), zum Beispiel Tá an fear ag ithe („Ist der Mann am Essen“ = „Der Mann isst“). Substantive haben zwei Genera (maskulin und feminin), vier Kasus (Nominativ, Genitiv, Vokativ, Dativ) und werden in Deklinationsklassen eingeteilt. Es gibt einen bestimmten Artikel (an für Singular, na für Plural), aber keinen unbestimmten.
Verben sind synthetisch und werden nach Person, Numerus, Tempus (zum Beispiel Präsens, Futur, Imperfekt) und Modus konjugiert, oft mit Partikeln wie tá (sein, für progressive Formen). Der Wortschatz basiert auf keltischen Wurzeln, ergänzt durch Lehnwörter aus Latein, Altnordisch und Englisch. Moderne Begriffe werden oft neugeprägt, zum Beispiel ríomhaire (Computer, von ríomh „rechnen“) oder teilifís (Fernsehen).
Es existieren drei Hauptdialekte:
- Ulster-Irisch (Nordirland und Donegal): Beeinflusst von Schottisch-Gälisch, mit stärkerer Nasalierung.
- Connacht-Irisch (Galway, Mayo): Oft als „Standard“ betrachtet, mit klarer Aussprache.
- Munster-Irisch (Kerry, Cork): Archaischer, mit einzigartigen Verbalformen.
Die Standardform (An Caighdeán Oifigiúil, seit 1958) vereinheitlicht die Dialekte für offizielle Zwecke.
Irisch ist untrennbar mit der irischen Identität verbunden und spiegelt sich in Literatur, Musik und Folklore wider. Berühmte Autoren wie Samuel Beckett oder Seamus Heaney integrierten Elemente, und moderne Werke erscheinen auf Irisch. Medien wie der Sender TG4 (Fernsehen), Raidió na Gaeltachta (Radio) und Online-Plattformen fördern die Sprache. In Schulen ist Irisch Pflichtfach, und Gaelscoileanna (Immersionsschulen) wachsen. Organisationen wie Conradh na Gaeilge (gegründet 1893) setzen sich für Revitalisierung ein, unterstützt durch EU-Fördermittel.
Trotz Fortschritten bleibt die Sprache vulnerabel: Der Klimawandel und Urbanisierung bedrohen die Gaeltacht-Gebiete, und Englisch dominiert den Alltag. Dennoch symbolisiert Irisch Widerstandsfähigkeit und kulturelles Erbe. Ein erweiterter Beispielsatz: Táim ag foghlaim Gaeilge le bliain anuas, agus tá sé dúshlánach ach fiúntach. („Ich lerne Irisch seit einem Jahr, und es ist herausfordernd, aber lohnenswert.“)
Religion
Die Bevölkerung Irlands bekennt sich zu 86,8 % zum römisch-katholischen Glauben, 3,0 % gehören der anglikanischen Church of Ireland an. Daneben gibt es noch 1,3 % Angehörige anderer christlicher Kirchen, sowie 0,8 % Muslime (alle Zahlen von 2006). Die römisch-katholische Kirche besteht aus vier Erzbistümern mit Sitzen in Armagh, Dublin, Tuam und Cashel. Der Primas von ganz Irland ist der Erzbischof von Armagh. Sitz des obersten Primas der Church of Ireland ist Armagh. Die Presbyterianische Kirche ist vor allem unter den Nachfahren der schottischen Ansiedler stark verwurzelt. Deshalb ist sie am stärksten in Nordirland verbreitet. Daneben gibt es noch kleinere methodistische und evangelisch-lutherische Kirchen. Mit 1.591 Mitgliedern (2005) sind die Quäker zwar eine vergleichsweise kleine Gemeinschaft, aber es ist nach GB die zweitgrößte in Europa. Irland ist im angelsächsischen und deutschen Sprachraum auch bekannt für die Irischen Segenswünsche.
Ein markanter Trend ist das starke Wachstum der Gruppe ohne religiöse Zugehörigkeit. Im Jahr 2022 gaben etwa 14 % der Menschen in der Republik Irland an, keiner Religion anzugehören. Dieser Anstieg der Säkularisierung ist besonders bei jüngeren Generationen und in städtischen Gebieten wie Dublin spürbar.
Neben dem Christentum gibt es kleinere, aber wachsende Gemeinschaften anderer Religionen, die durch Einwanderung an Vielfalt gewinnen. Der Islam macht etwa 1,6 % der Bevölkerung aus (zirka 81.000 Menschen), während Hinduismus und Buddhismus jeweils unter 1 % liegen. Weitere Glaubensrichtungen wie Judentum und Sikhismus sind in geringer Zahl vertreten. Zudem gibt es eine kleine, aber wachsende Gruppe, die sich für vorchristliche keltische Spiritualität oder neuheidnische Praktiken interessiert, auch wenn diese statistisch kaum ins Gewicht fallen.
Römisch-Katholische Kirche
Die römisch-katholische Kirche in Irland führt ihre Tradition auf den hl. Patrick zurück. Im keltischen Christentum bestand im 1. Jahrtausend eine große Mönchstradition. Zahllose Klöster mit verschiedenen Ordensregeln, jedes hatte für gewöhnlich eine eigene, besiedelten das Land. Hierbei gab es einen großen Hang zur Mission, der sich durch das Opfer des heimatlichen Wegzuges erklären lässt (siehe: Wandermönch). Heilige wie Columban zogen auf das europäische Festland und gründeten neue Mönchszellen, welche zur Christianisierung Europas einen großen Beitrag leisteten. Geprägt durch einen strengen Bußcharakter, entwickelte sich hier die bis heute gebräuchliche Ohrenbeichte.
Die zahlreichen Äbte der Klöster waren zugleich Quasibischöfe, welche sich einen Weihbischof für die Pontifikalfunktionen hielten, da sie selbst zumeist keine Bischofsweihe besaßen. Erst mit der Synode von Rath Breasail im Jahr 1111 bildeten sich Diözesen im heutigen Sinne, die zumeist von ihrer Fläche eher gering waren. Zugleich verlor die irische Kirche ihre Bedeutung für die Weltkirche und erhielt diese erst durch einen neuen Missionsaufschwung im 19. Jahrhundert wieder. Zahlreiche Ordensgründungen, wovon viele in die Mission gingen und unzählige Berufungen zum Priester- und Ordensleben gaben der Katholischen Kirche von Irland wieder weltkirchliche Bedeutung.
Mit der Ausbreitung Englands auf der Insel, geriet die einheimische Bevölkerung immer weiter ins Hintertreffen. Bereits die Statuten von Kilkenny (1367) verboten den aus England stammenden Kolonisten die Übernahme irischer Gebräuche und auch die Heirat zwischen Iren und Engländern. Die Aufnahme von Iren in Kallegiatskapitel oder Klöstern wurde untersagt. Doch hatte dieser Beschluss keine Auswirkung auf die normalen Landgeistlichen. König Heinrich III. hatte bereits im Jahre 1217 an seinen Justiziar für Irland geschrieben, dass die Berufung von Iren auf einen Bischofsstuhl nicht zuzulassen sei, da die irischen Bischöfe immer wieder Probleme bereiten. Ein Protest der irischen Geistlichkeit führte dazu, dass Papst Honorius III. das Königsdekret 1220 und 1224 für unzulässig erklärte. In den folgenden Jahren ergriff man nun in den Gebieten der irischen Fürsten ähnliche Maßnahmen und verbot den Kapiteln und Klöstern die Aufnahme von Engländern. Auch die Beziehung zwischen englischen und irischen Klerikern war alles andere als harmonisch. Lediglich ihre Loyalität zum Papst einte sie noch. Mit der Zeit zeigte sich jedoch auch dem Papst, dass eine Aussöhnung der beiden Parteien nicht möglich war. So erließ Papst Leo X. eine nationale Trennung des Stifts von St. Patrick in Dublin und sprach es den Iren zu. Engländer sollten, so der päpstliche Erlass, keine Aufnahme mehr finden.
Gab es in Irland im 13. Jahrhundert noch ein aktives Bischofswahlrecht, so bedürfte der Erwählte im frühen 14. Jahrhundert bereits der Zustimmung des Königs von England. Schon wenige Jahre später ernannte der König gänzlich frei. Die „Wahl“ war lediglich noch eine Meinungsäußerung des Kapitels. Entsprechend sahen oftmals auch die Bischofsernennungen aus. Die Kandidaten hatten ein größeres Interesse an einer politischen Karriere, denn an der Leitung ihres Bistums. Oftmals hielten die Bischöfe zugleich auch hohe politische Ämter. Innerhalb ihrer Diözese war ihr Einfluss eher gering, da der Großteil der Patronate in den Händen des Adels lag, der die entsprechenden Geistlichen einsetzte. So besaß der Earl of Kildare über vierzig Patrozinien in fünf Diözesen. Wie die Bischöfe, so hielten auch viele Pfarrer keine Residenz, sondern ließen sich durch schlecht bezahlte Vikare vertreten.
Unter König Heinrich VIII. gelangte ganz Irland an England. Wie in England, so kam es nun auch in Irland zum Kampf um den Supremat und in den Folgen zur Säkularisierung zahlreicher Klöster und kirchlicher Einrichtungen. Doch anders als in England, traf der König hier auf einen wehementen Widerstand. Die königlichen Reformationsversuche brachten genau das Gegenteil hervor und Bevölkerung, Klerus und Bischöfe standen fester denn je auf der Seite des Papstes.
Zur Zeit Heinrichs VIII. gab es in Irland 231 Häuser der Augustinerchorherren, 36 der Prämonstratenser, 22 der Johanniter, 14 der Trinitarier, 9 der Benediktiner, 42 der Zisterzienser, 43 der Dominikaner, 65 der Franziskaner, 26 der Augustiner, 25 der Karmeliten und 43 verschiedenartige Nonnenklöster.König Edward VI., Heinrichs Nachfolger, versuchte nun die katholischen Gottesdienste zu unterdrücken. Hierbei wurden 1548 eigenst Prediger entsandt, welche der Bevölkerung den Glauben an die Realpräsenz der Eucharistie austreiben sollte. Gleichzeitig setzten die neuen Bischöfe, welche vom König ernannt wurden, dass Book of Common Prayer durch.
Mit der Krönung von Königin Mary wurde die Katholische Kirche noch einmal in ihre alten Rechte eingesetzt und erhielt ihre Besitztümer, wie zum Beispiel die Kathedrale von Dublin, zurück. Da sich die meisten Bischöfe als „Papstanhänger“ bewiesen hatten, tauschte man nur noch die Kanoniker der zurückerstatteten Kollegiatsstifte aus. Gleichzeitig wurde das Book of Common Prayer verboten und es geschah eine Erneuerung der katholischen Religionsausübung. Zu einer Verfolgung der Protestanten kam es nicht. Da die Reform durch die Regierung erzwungen worden war, hatte sie so gut wie keine Anhänger gefunden.
Königin Elizabeth I., die ihrer Schwester 1558 auf den Thron gefolgt war, verfolgte wieder eine antikatholische Haltung. Schon bald wurden leitende Persönlichkeiten in Irland stark überwacht. Das Book of Common Prayer kam erneut in Gebrauch, durfte jedoch nur in Privathäusern verwandt werden. Erst 1560 beschloss das Parlament die allgemeine und alleinige Verwendung des Book of Common Prayer und überwies der Krone erneut die Herrschaft über die Kirche und damit auch die Ernennung der Bischöfe. Auf Zuwiederhandlung standen Geldstrafen, Haft und Tod.
Erneut stieß London an seine Grenzen. Bischöfe, Klerus und Volk leisteten Widerstand. Lediglich zwei Bischöfe beugten sich der Königin. Bischofsstühle konnte sie nicht besetzen, da sich in Irland niemand dazu bereit fand. Bei Vakanz wurden die Bischöfe nun sofort vom Papst ernannt, ohne es der Königin überhaupt mitzuteilen.
Bereits 1560 sandte Papst Pius V. eine Delegation nach Irland, die nicht nur die dortige Kirche visitieren sollte, sondern auch die Namen würdiger Priester nach Rom senden sollte, welche im Falle einer Vakanz umgehend zu Bischöfen erhoben werden konnten. Da die theologische Ausbildung in Irland aber kaum noch möglich war, verließen viele Priesteramtskandidaten Irland und studierten in Rom (Italien), Löwen (Belgien) oder Frankreich.
Von 1937 bis 1973 genoss die Kirche eine hervorgehobene Stellung in der Verfassung der irischen Republik. Nach dem Vatikanum II hat es verschiedene Veränderungen in der Kirche gegeben. So ist normale Zivilkleidung für Priester und Ordensschwestern heute die Regel und auch viele Klöster wurden zugunsten von Niederlassungen, welche in einem Wohnhaus untergebracht sind, aufgegeben. Doch durchlebt die Katholische Kirche in Irland, wie alle anderen europäischen Länder auch, zur Zeit eine Krise. Sinkende Zahlen der Gottesdienstbesucher und entsprechend sinkende Zahlen bei Priestern und Ordensleuten zeigen das Bild einer beginnenden Kirchenkrise. So verstarben 2007 160 Priester, doch gab es nur 9 Priesterweihen.
Die volkstümlich geprägte Kirche gliedert sich in vier Kirchenprovinzen, mit zusammen 26 Bistümern. In ihnen leben 4.063.000 Katholiken, 76,7 % der Bevölkerung. 3.160 Diözesan- und 1.833 Ordenspriester versorgen hierim Jahre 2002 1.367 Pfarreien, in welchen auch 8.678 Ordensschwestern leben.
Bistümer nach Kirchenprovinz
- Armagh: Ardagh und Clonmacnois, Clogher, Derry, Down und Connor, Dromore, Kilmore, Meath, Raphoe
- Cashel-Emly: Cloyne, Cork und Ross, Kerry, Killaloe, Limerick, Waterford und Lismore
- Dublin: Ferns, Kildare und Leighlin, Ossory
- Tuam: Achonry, Clonfert, Elphin, Galway und Kilmacduagh, Killala
Das zentrale Organ der irischen Bischöfe ist die Irische Bischofskonferenz.
Archbishops of Cashel and Bishops of Emly (Erzbischöfe von Cashel und Emly)
- 1718 - 1757 Christopher Butler
- 1757 - 1774 James Butler I
- 1774 - 1791 James Butler II
- 1792 - 1820 Thomas Bray
- 15 Dez 1820 - 31 Mar 1821 Patrick Everard
- 1823 - 1833 Robert Laffan
- 1833 - 1857 Michael Slattery
- 1857 - 1875 Patrick Leahy
- 1875 - 1902 Thomas William Croke
- 23 Jul 1902 - 1913 Thomas Fennelly
- 2 Dez 1913 - 1 Sep 1946 John Mary Harty
- 11 Sep 1946 - 18 Feb 1959 Jeremiah Kinane
- 21 Dec 1959 - 12 Sep 1988 Thomas Morris
- 12 Sep 1988 - 22 Nov 2014 Dermot Clifford
Archbishop of Cashel and Emly (Erzbischof von Cashel und Emly)
- seit 22 Nov 2014 Kieran O‘Reilly
Arcchbishops of Dublin (Erzbischöfe von Dublin)
- um 1030 - 1074 Dunan (Donatus I.)
- 1074 - 1084 Gilla Pátraic (Patricius, Patrick)
- 1085 - 1095 Donngus Ua hAingliu (Donatus II.)
- 1096 - 1121 Samuel Ua hAingliu
- 1121 - 1161 Gréne (Gregorius, Gregor, ab 1152 erster Erzbischof)
- 1162 - 1180 Lorcán Ua Tuathail (Laurentius, Laurence O’Toole)
- 1182 - 1212 John Comyn
- 1213 - 1228 Henry of London (ab der Vereinigung mit dem Bistum Glendalough 1216 Erzbischof von Dublin und Glendalough)
- 1230 - 1255 Luke
- 1256 - 1271 Fulk of Sandford
- 1279 - 1284 John of Darlington OP
- 1286 - 1294 John of Sandford
- 1295 - 1299 Thomas de Chadworth (nicht geweiht)
- 1297 - 1298 William Hotham OP
- 1299 - 1306 Richard of Ferrings
- 1307 - 1310 Richard de Havering (nicht geweiht)
- 1311 - 1313 John Lech (Leeck)
- 1317 - 1349 Alexander Bicknor (auch Lordkanzler von Irland)
- 1350 - 1362 John de St Paul (auch Lordkanzler von Irland)
- 1363 - 1375 Thomas Minot
- 1376 - 1390 Robert Wikeford (auch Lordkanzler von Irland)
- 1391 - 1395 Robert Waldby OSA (danach Bischof von Chichester)
- 1396 - 1397 Richard Northalis OCarm
- 1397 - 1417 Thomas Cranley (auch Lordkanzler von Irland)
- 1418 - 1449 Richard Talbot (auch Lordkanzler von Irland)
- 1450 - 1471 Michael Tregury
- 1472 - 1484 John Walton
- 1484 - 1511 Walter Fitzsimons (auch Lordkanzler von Irland)
- 1512 - 1521 William Rokeby (auch Lordkanzler von Irland)
- 1523 - 1528 Hugh Inge OP (auch Lordkanzler von Irland)
- 1530 - 1534 John Alen (Allen, auch Lordkanzler von Irland)
- 1536 - 1554 George Browne (später anglikanisch)
- 1655 - 1567 Hugh Curwen (später anglikanisch, auch Lordkanzler von Irland)
- um 1570 - 1584 Dermitius O’Urley
- 5 Mai 1600 - 10 Jan 1610 Mateo de Oviedo, O.F.M.
- 1611 - 1623 Eugene Matthews
- 1623 - 1651 Thomas Fleming O.F.M.
- 1657 - 1665 James Dempsey (Apostolischer Vikar)
- 1669 - 1680 Peter Talbot
- 1683 - 1692 Patrick Russell
- 9 Mar 1693 - 1712 Peter Creagh
- 1712 - 1724 Edmund Byrne
- 1724 - 1729 Edward Murphy
- 1729 - 1733 Luke Fagan
- 1734 - 1757 John Linegar
- 1757 - 1763 Richard Lincoln
- 1763 - 1769 Patrick Fitzsimon
- 1770 - 1786 John Carpenter
- 1786 - 11 Mar 1823 John Thomas Troy, O.P.
- 1823 - 1852 Daniel Murray
- 3 Mai 1852 - 24 Okt 1878 Paul Cullen
- 4 Apr 1879 - 11 Feb 1885 Edward MacCabe
- 3 Jul 1885 - 9 Apr 1921 William Joseph Walsh
- 28 Aug 1921 - 9 Feb 1940 Edward Joseph Byrne
- 6 Nov 1940 - 29 Dez 1971 John Charles McQuaid, C.S.Sp.
- 29 Dez 1971 - 1 Sep 1984 Dermot J. Ryan
- 15 Nov 1984 - 8 Apr 1987 Kevin McNamara
- 21 Jan 1988 - 26 Apr 2004 Desmond Connell
- 26 Apr 2004 - 29 Dez 2020 Diarmuid Martin
- seit 29 Dez 2020 Dermoit Pius Farrell
Bishops of Tuam (Bischöfe von Tuam)
- 520 Jarlath
- 1032 Murrough O’Nioc
- 1085 Hugh O’Hessian
- 1117 Cathusach Ua Conaill
- 1137 Ó Clérig
- 1150 Muiredach Ua Dubhthaig
Archbishops of Tuam (Erzbischöfe von Tuam)
- 1152 - 1161 Áed Ua h-Oissín (Edanus)
- 1167 - 1201 Cadla Ua Dubthaig (Catholicus)
- 1202 - 1235 Felix Ua Ruanada († 1238)
- 1236 - 1249 Máel Muire Ó Lachtáin (Marianus)
- 1250 - 1256 Flann Mac Flainn (Florentius)
- 1256 James O’Laghtnan
- 1257 - 1258 Walter de Saleron
- 1258 - 1279 Tommaltach Ó Conchobair (Thomas) (vorher Bischof von Elphin)
- um 1283 Nicol Mac Flain (nicht geweiht)
- 1286 - 1288 Stephen de Fulbourn (vorher Bischof von Waterford)
- 1288 - 1312 William de Bermingham
- 1312 - 1348 Máel Sechlain Mac Áeda (vorher Bischof von Elphin)
- 1348 - 1365 Tomás MacCearbhaill (MacCarwill) (danach Erzbischof von Cashel)
- 1364 - 1371 Eóin Ó Gráda
- 1372 - 1383 Gregorius Ó Mocháin I. (vorher Bischof von Elphin)
- 1384 - 1386 Gregorius Ó Mocháin II. (abgesetzt durch Papst Urban VI., † 1392)
- 1386 - 1393 William Ó Cormacáin (danach Bischof von Clonfert)
- 1393 - 1407 Muircheartach mac Pilib Ó Ceallaigh (vorher Bischof von Clonfert)
- 1408 - 1410 John Babingle (danach Bischof von Achonry)
- um 1411 Cornelius
- 1430 - 1437 John Bermingham (Winfield)
- 1438 - 1441 Tomás mac Muircheartaigh Ó Ceallaigh (danach Bischof von Confert)
- 1441 - 1450 John de Burgo
- 1450 - 1485 Donatus Ó Muireadhaigh (O'Murray)
- 1485 Walter Blake (danach Bischof von Clonmacnoise)
- 1485 - 1501 William Seoighe (Joyce)
- um 1503 Philip Pinson
- 1506 - 1513 Muiris Ó Fithcheallaigh (Maurice O’Fihely oder Maurice de Portu)
- 1514 - 1536 Thomas O’Mullally (irisch Tomás Ó Maolalaidh) (vorher Bischof von Clonmacnoise)
- um 1538 Arthur O’Friel
- 1555 - 1572 Christopher Bodkin
- 1580 - 1583 Nicholas Skerrett
- 1586 - 1590 Maol Muire Ó hÚiginn
- 1591 - 1595 Seamus Ó hÈilidhe
- 1609 - 1629 Flaithri Ó Maolconaire
- 1630 - 1645 Malachy O’Queely
- 1647 - 1667 John de Burgh
- 1669 - 1713 James Lynch
- 1713 - 1723 Francis Burke
- 1723 - 1740 Bernard O’Gara
- 1740 - 1748 Michael O’Gara
- 1749 - 1785 Michael Skerrett
- 1785 - 1787 Philip Phillips
- 1787 - 1798 Boetius Egan
- 1798 - 1809 Edward Dillon
- 4 Okt 1814 - 18 Apr 1834 Oliver O'Kelly
- 1834 - 4 Nov 1881 John MacHale
- 1881 - 1902 John MacEvily
- 13 Feb 1903 - 19 Mar 1918 John Healy
- 10 Jul 1918 - 1939 Thomas P. Gilmartin
- 16 Jan 1940 - 31 Jan 1969 Joseph Walsh
- 31 Jan 1969 - 11 Jul 1987 Joseph Cunnane
- 22 Aug 1987 - 28 Jun 1994 Joseph Cassidy
- 17 Jan 1995 - 10 Nov 2021 Michael Neary
- seit 10 Nov 2021 Francis Duffy
Prebyterianische Kirche
Die Presbyterianische Kirche in Irland (englisch: Presbyterian Church in Ireland, PCI) ist die größte presbyterianische Denomination auf der Insel Irland. Sie umfasst Gemeinden in der Republik Irland und in Nordirland und ist die zweitgrößte protestantische Kirche in Nordirland (nach der katholischen Kirche) sowie die zweitgrößte protestantische Denomination in der Republik Irland (nach der Church of Ireland). Die Kirche hat ihre Wurzeln in der schottischen Migration und der Reformation und ist bekannt für ihre konservative Haltung in sozialen Fragen.
Presbyterianismus kam im frühen 17. Jahrhundert nach Irland, hauptsächlich durch schottische Siedler während der Plantation of Ulster (1610), die von König James I. initiiert wurde, um protestantische Bevölkerung in die nordirische Provinz Ulster zu bringen. Die ersten presbyterianischen Gemeinden entstanden 1642 durch schottische Kaplan, die während des Irischen Aufstands von 1641 in Ulster stationiert waren.
Im 18. Jahrhundert gab es Spaltungen, zum Beispiel durch die Secession Church und die Synod of Ulster, die sich über die Westminster Confession of Faith stritten. Die Vereinigung dieser Gruppen 1840 führte zur Gründung der General Assembly of the Presbyterian Church in Ireland. 1854 fusionierte die Synod of Munster hinzu. Die Teilung Irlands 1921 (in Republik Irland und Nordirland) hatte wenig Einfluss auf die Kirche, da die Mehrheit der Mitglieder in Nordirland blieb.
Heute ist die PCI in 19 Presbyterien (regionalen Verwaltungseinheiten) organisiert, mit über 540 Gemeinden und etwa 230.000 Mitgliedern (Stand 2025). Die Mehrheit der Gemeinden liegt in Nordirland (vor allem im Norden und Osten), während in der Republik Irland Konzentrationen in den Grenzcounties wie Donegal, Monaghan und Cavan sowie in Dublin bestehen. Kürzlich entstand eine neue Gemeinde in Co. Kildare.
Die PCI folgt dem presbyterianischen Prinzip der Ältestenregierung (presbyteros = Ältester), bei der Laienälteste (Elders) neben Geistlichen eine zentrale Rolle spielen. Die höchste Instanz ist die jährliche General Assembly in Belfast, die alle Gemeinden repräsentiert. Die Kirche betont Bibelglaube, Predigt und zwei Sakramente: Taufe und Abendmahl. Frauen können seit 1920 als Älteste und seit 1973 als Pfarrerinnen ordiniert werden.
Die Kirche ist konservativ, sie lehnt Abtreibung ab (außer bei Lebensgefahr der Mutter) und hat „totale Opposition“ gegen die Liberalisierung der Abtreibungsgesetze in Nordirland. In Bezug auf LGBTQ+-Rechte schloss die PCI 2018 gleichgeschlechtliche Paare und ihre Kinder von voller Kirchenbeteiligung aus, was zu Kontroversen und Rücktritten führte. Es gibt aktuelle Debatten um Disziplin, Governance und Compliance als registrierte Wohltätigkeitsorganisation in beiden Teilen Irlands.
Die PCI engagiert sich sozial, zum Beispiel in Mission, Bildung und interkirchlichen Räten wie dem Irish Council of Churches. Sie steht vor Herausforderungen wie Säkularisierung und sinkender Mitgliederzahlen, ähnlich wie andere traditionelle Kirchen in Irland. Die offizielle Website (presbyterianireland.org) bietet Ressourcen zu Veranstaltungen und Publikationen wie dem Presbyterian Herald.
Neben der PCI gibt es kleinere Denominationen, zum Beispiel die Reformed Presbyterian Church of Ireland (RPCI), die psalm-singend und a cappella-Gottesdienste pflegt und ebenfalls in Nordirland und der Republik aktiv ist. Die Non-Subscribing Presbyterian Church ist liberaler und lehnt die Westminster Confession ab.
Anglikanische Kirche
Die Anglikanische Kirche in Irland und Nordirland, bekannt als Church of Ireland (Eaglais na hÉireann), ist eine eigenständige Kirche innerhalb der weltweiten Anglikanischen Gemeinschaft und spielt eine bedeutende historische und kulturelle Rolle auf der Insel Irland. Ihre Geschichte reicht bis zur Reformation im 16. Jahrhundert zurück, als König Heinrich VIII. die Kirche in Irland 1536 von Rom trennte und sich selbst zum Oberhaupt erklärte. Damit wurde die Church of Ireland zur Staatskirche, obwohl die Mehrheit der irischen Bevölkerung katholisch blieb, was über Jahrhunderte hinweg zu Spannungen führte.
Im Jahr 1871 verlor die Kirche durch den Irish Church Act von 1869 ihren Status als Staatskirche, ein Prozess, der als Disestablishment bekannt ist. Seitdem agiert sie als unabhängige Kirche ohne staatliche Privilegien. Heute ist die Church of Ireland eine Minderheitskirche, hat jedoch besonders in Nordirland eine stärkere Präsenz als in der Republik Irland. In der Republik zählt sie etwa 126.000 Mitglieder (zirka 2,5 % der Bevölkerung), während sie in Nordirland mit rund 250.000 Mitgliedern (rund 13 % der Bevölkerung) eine größere Rolle spielt.
Die Kirche ist in 12 Bistümer unterteilt, die sowohl die Republik Irland als auch Nordirland abdecken und in zwei Provinzen organisiert sind: Armagh und Dublin, jeweils geleitet von einem Erzbischof. Die Kathedrale von St. Patrick in Dublin und die Kathedrale von Armagh sind zentrale spirituelle und historische Stätten. Die Church of Ireland ist bekannt für ihre ökumenische Haltung und arbeitet eng mit anderen christlichen Denominationen zusammen, während sie ihre anglikanische Identität mit einer Mischung aus katholischen und reformierten Elementen bewahrt.
Theologisch und liturgisch ist sie vielfältig, wobei einige Gemeinden einen eher evangelikalen Ansatz verfolgen, andere hingegen hochliturgisch ausgerichtet sind. Die Kirche engagiert sich in sozialen Fragen, Bildung und Gemeindearbeit und bleibt ein wichtiger Teil des religiösen und kulturellen Lebens, insbesondere in Nordirland, wo sie oft als Brücke zwischen verschiedenen Gemeinschaften dient.
Archbishops of Dublin (Anglikanische Erzbischöfe von Dublin)
- 1567 - 1605 Adam Loftus
- 1605 - 1619 Thomas Jones
- 1619 - 1650 Lancelot Bulkeley
- 1661 - 1663 James Margetson, danach Erzbischof von Armagh
- 1663 - 1679 Michael Boyle, danach Erzbischof von Armagh
- 1679 - 1681 John Parker
- 1682 - 1693 Francis Marsh
- 1694 - 1703 Narcissus Marsh, danach Erzbischof von Armagh
- 1703 - 1729 William King
- 1730 - 1742 John Hoadly, danach Erzbischof von Armagh
- 1743 - 1765 Charles Cobbe
- 1765 William Carmichael
- 1766 - 1771 Arthur Smyth
- 1772 - 1778 John Cradock
- 1779 - 1801 Robert Fowler
- 1801 - 1809 Charles Agar
- 1809 - 1819 Euseby Cleaver
- 1820 - 1822 John Beresford, danach Erzbischof von Armagh
- 1822 - 1831 William Magee
- 1831 - 1863 Richard Whately, ab 1846 Erzbischof von Dublin, Kildare und Glendalough
- 1864 - 1884 Richard Chenevix Trench
- 1885 - 1897 William Conyngham Plunket
- 1897 - 1915 Joseph Peacocke
- 1915 - 1919 John Bernard
- 1919 - 1920 Charles D’Arcy
- 1920 - 1939 John Gregg, danach Erzbischof von Armagh
- 1939 - 1956 Arthur Barton
- 1956 - 1969 George Simms, danach Erzbischof von Armagh
- 1969 - 1977 Alan Buchanan
- 1977 - 1985 Henry McAdoo, nach Abtrennung von Kildare seit 1977 Erzbischof von Dublin und Glendalough
- 1985 - 1996 Donald Caird
- 1996 - 2002 Walton Empey
- 2002 - 2011 John Neill
- seit 2011 Michael Jackson
Judentum
Die ersten Hinweise auf jüdische Präsenz in Irland stammen aus dem 11. Jahrhundert. Die Annals of Innisfallen berichten 1079 von fünf Juden aus Rouen, die in Limerick ankamen. Im Mittelalter siedelten sephardische Juden, vor allem aus Spanien und Portugal, in Irland, doch die Vertreibung der Juden aus England 1290 traf auch die irische Gemeinde. Erst im späten 15. Jahrhundert kehrten Flüchtlinge der Spanischen Inquisition zurück, und 1555 wurde William Annyas, ein portugiesischstämmiger Jude, Bürgermeister von Youghal – ein Meilenstein als erster Jude in einem öffentlichen Amt.
Im 19. Jahrhundert wuchs die Gemeinde durch deutsche Händler, die in der Leinenindustrie tätig waren, und ab den 1880er Jahren durch osteuropäische Immigranten, die vor Pogromen in Litauen und Polen flohen. Um 1891 erreichte die jüdische Bevölkerung mit etwa 5.500 Mitgliedern ihren Höchststand, konzentriert in Städten wie Dublin, Belfast, Cork und Limerick. Die irische Verfassung von 1937 erkannte das Judentum als Minderheitenreligion an und bot Schutz vor Diskriminierung. Während des Zweiten Weltkriegs blieb Irland neutral, und die Gemeinde unterstützte die Rettung jüdischer Kinder, etwa durch den Kindertransport nach Nordirland. Nur ein irischer Jude fiel dem Holocaust zum Opfer. Bekannte Persönlichkeiten wie Rabbiner Isaac Herzog, Oberrabbiner Irlands (1921 bis 1936) und Vater des späteren israelischen Präsidenten Chaim Herzog, verdeutlichen die Verbindungen zwischen Irland und Israel.
Heute ist die jüdische Gemeinde klein, aber lebendig. In der Republik Irland leben etwa 2.700 Juden, hauptsächlich in Dublin, wo eine orthodoxe Synagoge in Terenure und eine Reform-Synagoge bestehen. Eine neue Reform-Gemeinde entstand in Cork, nachdem die dortige Synagoge 2016 schloss. Die Gemeinde wird durch Zuwanderer aus Israel, Südafrika und Osteuropa belebt. Institutionen wie das Irish Jewish Museum und die jüdische Schule in Dublin (die auch nicht-jüdische Schüler aufnimmt) sind kulturelle Zentren. In Nordirland leben schätzungsweise 80–400 Juden, fast ausschließlich in Belfast, wo die Belfast Hebrew Congregation (gegründet 1870) die einzige Synagoge betreibt. Frühere Synagogen in Derry und Lurgan sind geschlossen. Die Troubles (1968–1998) beschleunigten die Abwanderung aus Nordirland, doch Initiativen wie die Belfast Jewish Record und interreligiöse Projekte wie der Council for Christians and Jews fördern die Gemeinschaft.
Die jüdische Gemeinde ist überwiegend ashkenazisch, mit wachsendem Reform-Anteil. Herausforderungen wie der demografische Rückgang durch Alterung und Emigration (viele Jugendliche ziehen nach London oder Manchester) bestehen fort, ebenso wie begrenzte koschere Angebote – der letzte koschere Metzger in Dublin schloss 2001. Dennoch gibt es positive Entwicklungen: Die Ernennung von Shira Li Bartov zur Oberrabbinerin Irlands 2024 signalisiert Erneuerung. Antisemitismus war historisch gering, doch aktuelle politische Debatten, etwa um Israel, werfen gelegentlich Schatten. Kulturelle Beiträge sind vielfältig, von Leopold Bloom in James Joyces Ulysses bis zu Politikern wie Alan Shatter, ehemaliger Justizminister. Die Gemeinde bleibt durch Museen, historische Projekte und neue Einwanderer vital und bewahrt ihr Erbe in einer sich wandelnden Welt.
Islam
Die muslimische Gemeinschaft in Irland und Nordirland wächst seit den 1990er Jahren deutlich, angetrieben durch Immigration aus Ländern wie Pakistan, Nigeria, Syrien und Algerien. In der Republik Irland leben laut Volkszählung 2022 etwa 81.930 Muslime (zirka 1,6 % der Bevölkerung), in Nordirland rund 10.870 (rund 0,6 %). Diese Entwicklung bereichert die Gesellschaft, da Muslime oft in Berufen wie Medizin, Pflege oder Gastronomie tätig sind und sich vielfach gut integrieren. Dennoch nehmen Spannungen zu. Diese Konflikte äußern sich in Fällen islamistischer Gewalt und polarisierenden Debatten.
Die Geschichte des Islam in Irland begann 1959 mit der Gründung der ersten islamischen Gesellschaft in Dublin durch Studenten. 1976 wurde die erste Moschee eröffnet, und seit den 1990er Jahren wuchs die muslimische Bevölkerung durch EU-Beitritt und Flüchtlingszuwanderung. Heute gibt es über 40 Moscheen und Zentren, darunter das Islamic Cultural Centre in Dublin. Die muslimische Gemeinschaft ist superdivers, mit Mitgliedern aus über 40 Herkunftsländern, und nicht durch koloniale Vergangenheit geprägt wie in anderen europäischen Ländern. In Nordirland ist die Gemeinschaft kleiner, konzentriert in Belfast und Derry, und war lange von den „Troubles“ (1969–1998) überschattet, einem ethno-nationalistischen Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten, der die Sensibilität für gesellschaftliche Spaltungen prägt.
Die Spannungen um den Islam in Irland und Nordirland haben in den letzten Jahren zugenommen. Fälle islamistischer Gewalt verstärken die in der einsässigen Bevölkerung vorhandenen Ängste. In der Republik Irland führten die Dublin-Riots 2023, ausgelöst durch eine Messerstecherei islamischer Einwanderer, zu Ausschreitungen. Brandanschläge auf Moscheen wie in Clonskeagh (2024). In Nordirland eskalierten 2024 Unruhen in Ballymena und Belfast, nachdem ein Vergewaltigungsversuch durch rumänische Zuwanderer die antimigrantische Stimmung aufschaukelte. Häuser wurden angezündet, und loyalistische Gruppen organisierten sich. Die Polizei musste Unterstützung aus Schottland anfordern.
Immer wieder gab es auch Fälle islamistischer Gewalt. Beispiele sind die Stichattacke auf einen Garda in Dublin (2023, Täter rief „Allahu Akbar“), die Enthauptung eines schwulen Mannes in Sligo (2024) durch einen radikalisierten Pakistaner oder ein Angriff auf einen Priester in Galway. Solche Vorfälle nähren Ängste. Die Clonskeagh-Moschee, die größte Irlands, ist seit Monaten geschlossen, da ihr Verbindungen zur Muslimbruderschaft und Radikalisierung vorgeworfen werden.
Die Konflikte haben mehrere Ursachen. Hohe Einwanderungszahlen (Irland: über 20.000 Asylanträge 2024) treffen auf eine Wohnungs- und Ressourcenkrise. Muslime arbeiten oft in unterbesetzten Sektoren, doch Ressentiments wachsen, da Einheimische Migranten für wirtschaftliche Engpässe verantwortlich machen. Parteien wie Fine Gael werden für „schwache“ Migrationspolitik kritisiert, was Proteste gegen Asylzentren (zum Beispiel Coolock 2024) anheizt.
In Nordirland meiden Muslime in Ballymena vielfach die Straßen, während in Dublin die migrantische North Inner City zu einem Brennpunkt der Kriminalität wurde. In Irland wurden Moschee-Eröffnungen (zum Beispiel Fairyhouse 2025) abgesagt und Proteste gegen muslimische Veranstaltungen nehmen zu. Dagegen wenden sich Initiativen wie „Zero Tolerance“ gegen Hass. Gleichzeitig wächstg der Islamismus. Zwischen 2017 und 2021 wurden durch die Garda Síochána rund 30 Personen im Zusammenhang mit islamistischem Extremismus festgenommen, vor allem im Bereich der Finanzierung extremistischer Gruppen. Konkrete Anschlagspläne oder ausgeführte terroristische Akte sind in Irland bislang sehr selten. Es gibt Berichte über kleine Netzwerke oder Personen mit Kontakten zu international agierenden extremistischen Gruppierungen, die aber überwacht werden. Insgesamt gilt, dass islamistische Gruppen in Irland nicht stark organisiert sind und kein vergleichbares Risiko darstellen wie in manchen anderen europäischen Staaten.
Siedlungen
Die mit Abstand größte Agglomeration in der Republik Irland ist Dublin mit einer Einwohnerzahl von 1.270.603 (Stand 2011). Damit konzentriert sich über ein Viertel der Bevölkerung des Landes (4,58 Mill.; 2011) in der Hauptstadtregion. In der folgenden Tabelle sind die Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 28. April 2002, vom 23. April 2006 und die vorläufigen Zahlen vom 10. April 2011 sowie das County, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Stadt oder Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte. Die Einwohnerzahlen der größten Ortschaften Irlands entwickelten sich wie folgt:
| Stadt | Z 1991 | Z 1996 | Z 2002 | Z 2006 | Z 2011 | Z 2016 | Z 2022 |
| Ardee | 3.604 | 3.791 | 3.948 | 4.694 | 4.927 | 4.928 | 5.478 |
| Arklow (Antinbhear Mor) | 7.987 | 8.557 | 9.993 | 11.759 | 13.009 | 13.163 | 13.399 |
| Ashbourne | 4.411 | 4.999 | 6.362 | 8.528 | 11.355 | 12.679 | 15.680 |
| Athlone (Áth Luain) | 15.358 | 15.544 | 15.936 | 17.544 | 20.153 | 21.349 | 22.869 |
| Athy | 5.204 | 5.306 | 6.049 | 8.218 | 9.926 | 9.677 | 11.035 |
| Balbriggan | 7.724 | 8.473 | 10.294 | 15.559 | 19.960 | 21.722 | 24.322 |
| Ballina | 8.167 | 8.762 | 9.647 | 10.409 | 11.086 | 10.171 | 10.556 |
| Ballinasloe | 5.892 | 5.723 | 6.219 | 6.303 | 6.659 | 6.662 | 6.597 |
| Ballybofey - Stranorlar | 2.972 | 3.047 | 3.603 | 4.176 | 4.852 | 4.852 | 5.406 |
| Bandon | 4.741 | 4.751 | 5.161 | 5.822 | 6.640 | 6.957 | 8.196 |
| Birr | 4.056 | 4.193 | 4.436 | 5.081 | 5.822 | 4.370 | 4.726 |
| Blessington (Ballycomeen) | 1.408 | 1.860 | 2.509 | 4.018 | 5.010 | 5.520 | 5.611 |
| Bray (Brí Chualann) | 26.953 | 27.923 | 30.951 | 31.901 | 31.872 | 32.600 | 33.512 |
| Buncrana | 4.388 | 4.805 | 5.271 | 5.911 | 6.839 | 6.785 | 6.971 |
| Carlow (Ceatharlach) | 14.027 | 14.979 | 18.487 | 20.724 | 23.030 | 24.272 | 27.351 |
| Carrickmacross | 3.341 | 3.617 | 3.832 | 4.387 | 4.925 | 5.032 | 5.745 |
| Carrick-on-Suir | 5.143 | 5.217 | 5.586 | 5.906 | 5.931 | 5.771 | 5.752 |
| Carrigaline | 6.482 | 7.827 | 11.191 | 12.835 | 14.775 | 15.770 | 18.239 |
| Carrigtwohill | 1.212 | 1.232 | 1.411 | 2.782 | 4.551 | 5.080 | 5.568 |
| Cashel | 2.814 | 2.687 | 2.770 | 2.936 | 4.051 | 4.422 | 4.805 |
| Castlebar | 7.648 | 8.532 | 11.371 | 11.891 | 12.318 | 12.068 | 13.054 |
| Cavan | 5.254 | 5.623 | 6.098 | 7.883 | 10.205 | 10.914 | 11.741 |
| Celbridge | 9.629 | 12.289 | 16.016 | 17.262 | 19.537 | 20.288 | 20.601 |
| Clane | 1.822 | 3.126 | 4.417 | 4.968 | 6.702 | 7.280 | 8.152 |
| Clonakilty | 2.812 | 2.950 | 3.698 | 4.154 | 4.721 | 4.592 | 5.112 |
| Clonmel (Cluain Meala) | 15.562 | 16.182 | 16.910 | 17.008 | 17.908 | 17.140 | 18.369 |
| Cobh | 8.219 | 8.459 | 9.811 | 11.303 | 12.347 | 12.800 | 14.148 |
| Cork (Corcaigh) | 174.400 | 179.954 | 186.239 | 190.384 | 198.582 | 208.669 | 222.526 |
| Donabate | 1.104 | 1.868 | 3.854 | 5.499 | 6.778 | 7.443 | 9.669 |
| Drogheda (Droichead Átha) | 24.656 | 25.282 | 31.020 | 35.090 | 38.578 | 40.956 | 44.135 |
| Dublin (Baile Átha Cliath) | 929.090 | 952.692 | 1.004.614 | 1.045.769 | 1.110.627 | 1.173.179 | 1.263.219 |
| Duleek | 1.718 | 1.731 | 2.173 | 3.236 | 3.988 | 4.219 | 4.899 |
| Dunboyne | 2.392 | 3.080 | 5.363 | 5.713 | 6.959 | 7.272 | 7.155 |
| Dundalk (Dún Dealgan) | 30.061 | 30.195 | 32.505 | 35.085 | 37.816 | 39.004 | 43.112 |
| Dungarvan | 6.920 | 7.175 | 7.452 | 8.362 | 9.427 | 9.227 | 10.081 |
| Dunshaughlin | 1.275 | 2.139 | 3.063 | 3.384 | 3.903 | 4.035 | 6.644 |
| Edenderry | 3.742 | 3.825 | 4.559 | 5.888 | 6.977 | 7.359 | 7.888 |
| Ennis (Inis) | 16.058 | 17.726 | 22.051 | 24.253 | 25.360 | 25.276 | 27.923 |
| Enniscorthy | 7.655 | 7.640 | 8.964 | 9.538 | 10.838 | 11.381 | 12.310 |
| Fermoy | 4.462 | 4.469 | 4.804 | 5.873 | 6.489 | 6.585 | 6.720 |
| Galway (An Ghaillimh) | 50.853 | 57.363 | 66.163 | 72.729 | 76.778 | 79.934 | 85.910 |
| Gorey | 3.840 | 3.939 | 5.282 | 7.193 | 9.114 | 9.822 | 11.517 |
| Greystones (incl. Delgany) | 10.778 | 11.296 | 11.913 | 14.569 | 17.468 | 18.140 | 22.009 |
| Kells (Ceannanus Mór) | 3.539 | 3.542 | 4.421 | 5.248 | 5.888 | 6.135 | 6.608 |
| Kilcock | 1.551 | 1.825 | 2.740 | 4.100 | 5.533 | 6.093 | 8.674 |
| Kildare | 4.196 | 4.278 | 5.694 | 7.538 | 8.142 | 8.634 | 10.302 |
| Kilkenny (Cill Choinnigh) | 17.669 | 18.696 | 20.735 | 22.179 | 24.423 | 26.512 | 27.184 |
| Killarney | 9.950 | 12.011 | 13.137 | 14.603 | 14.219 | 14.504 | 14.412 |
| Kinsale | 2.751 | 3.064 | 3.554 | 4.099 | 4.893 | 5.281 | 5.991 |
| Kinsealy - Drinan | 2.084 | 2.182 | 2.110 | 3.651 | 5.814 | 6.643 | 7.526 |
| Laytown (incl. Bettystown, Mornington, Donacarney) | 3.360 | 3.678 | 5.597 | 8.978 | 10.889 | 11.872 | 15.642 |
| Leixlip | 13.194 | 13.451 | 15.016 | 14.676 | 15.452 | 15.504 | 16.733 |
| Letterkenny | 10.726 | 11.996 | 15.231 | 17.586 | 19.588 | 19.274 | 22.549 |
| Limerick (Luimneach) | 75.436 | 79.137 | 86.998 | 90.757 | 91.454 | 94.192 | 102.287 |
| Listowel | 3.597 | 3.656 | 3.999 | 4.338 | 4.832 | 4.820 | 4.794 |
| Longford | 6.824 | 6.984 | 7.557 | 8.836 | 9.601 | 10.008 | 10.952 |
| Loughrea | 3.271 | 3.335 | 4.004 | 4.532 | 5.062 | 5.556 | 6.322 |
| Lusk | 2.071 | 2.287 | 2.456 | 5.236 | 7.022 | 7.786 | 8.806 |
| Malahide | 12.088 | 13.539 | 13.826 | 14.937 | 15.846 | 16.550 | 18.608 |
| Mallow | 7.521 | 7.768 | 8.937 | 10.241 | 11.605 | 12.459 | 13.456 |
| Maynooth | 6.027 | 8.528 | 10.151 | 10.715 | 12.510 | 14.585 | 17.259 |
| Midleton | 5.951 | 6.209 | 7.957 | 10.048 | 12.001 | 12.496 | 13.906 |
| Monaghan | 5.946 | 5.842 | 5.936 | 6.710 | 7.452 | 7.678 | 7.894 |
| Monasterevin | 2.224 | 2.302 | 2.583 | 3.017 | 3.710 | 4.246 | 5.307 |
| Mountmellick | 3.003 | 2.912 | 3.361 | 4.069 | 4.735 | 4.777 | 4.905 |
| Mullingar | 11.867 | 12.492 | 15.621 | 18.416 | 20.103 | 20.928 | 22.667 |
| Naas | 11.141 | 14.074 | 18.288 | 20.044 | 20.713 | 21.393 | 26.180 |
| Navan (An Uaimh) | 11.706 | 12.810 | 19.417 | 24.851 | 28.559 | 30.173 | 33.886 |
| Nenagh | 5.825 | 5.913 | 6.454 | 7.751 | 8.439 | 8.968 | 9.895 |
| Newbridge (Droichead Nua) | 12.069 | 13.363 | 16.739 | 18.520 | 21.561 | 22.742 | 24.366 |
| Newcastle West | 3.612 | 3.618 | 4.017 | 5.098 | 6.327 | 6.619 | 7.209 |
| New Ross | 6.079 | 6.147 | 6.537 | 7.709 | 8.151 | 8.040 | 8.610 |
| Oranmore | 1.192 | 1.410 | 1.692 | 3.513 | 4.799 | 4.990 | 5.819 |
| Passage West (incl. Monkstown) | 3.606 | 3.922 | 4.595 | 5.203 | 5.790 | 5.843 | 6.051 |
| Portarlington | 3.211 | 3.320 | 4.001 | 6.004 | 7.788 | 8.368 | 9.288 |
| Portlaoise (Maryborough) | 8.360 | 9.474 | 12.127 | 14.613 | 20.145 | 22.050 | 23.494 |
| Portmarnock | 9.173 | 9.145 | 8.376 | 8.979 | 9.285 | 9.466 | 10.750 |
| Rathcoole | 2.926 | 2.784 | 2.499 | 2.927 | 3.421 | 4.351 | 5.792 |
| Ratoath | 593 | 1.061 | 3.794 | 7.249 | 9.043 | 9.533 | 10.077 |
| Roscommon | 3.427 | 3.915 | 4.489 | 5.017 | 5.693 | 5.876 | 6.555 |
| Roscrea | 4.231 | 4.170 | 4.578 | 4.910 | 5.403 | 5.446 | 5.542 |
| Rush | 4.839 | 5.429 | 6.769 | 8.286 | 9.231 | 9.943 | 10.875 |
| Sallins | 783 | 854 | 2.922 | 3.806 | 5.283 | 5.849 | 6.269 |
| Shannon | 7.920 | 7.939 | 8.561 | 9.222 | 9.673 | 9.729 | 10.256 |
| Skerries | 7.032 | 7.339 | 9.149 | 9.535 | 9.671 | 10.043 | 10.743 |
| Sligo (Sligeach) | 17.964 | 18.509 | 19.735 | 19.402 | 19.452 | 19.199 | 20.608 |
| Swords | 17.705 | 22.314 | 27.175 | 33.998 | 36.924 | 39.248 | 40.776 |
| Thurles | 6.955 | 6.939 | 7.425 | 7.682 | 7.933 | 7.940 | 8.185 |
| Tipperary | 4.963 | 4.854 | 4.964 | 5.065 | 5.310 | 4.979 | 5.387 |
| Tralee (Tráighlí) | 17.862 | 19.950 | 21.987 | 22.744 | 23.693 | 23.691 | 26.079 |
| Tramore | 6.064 | 6.536 | 8.305 | 9.634 | 10.328 | 10.381 | 11.277 |
| Trim | 4.185 | 4.405 | 5.894 | 6.870 | 8.268 | 9.194 | 9.563 |
| Tuam | 5.540 | 5.627 | 5.947 | 6.885 | 8.242 | 8.767 | 9.647 |
| Tullamore (An Tulach Mhór) | 9.430 | 10.039 | 11.098 | 12.927 | 14.361 | 14.607 | 15.598 |
| Tullow | 2.424 | 2.364 | 2.417 | 3.048 | 3.972 | 4.673 | 5.138 |
| Waterford (Port Láirge) | 41.853 | 44.155 | 46.736 | 49.213 | 51.519 | 53.504 | 60.079 |
| Westport | 3.688 | 4.520 | 5.634 | 5.475 | 6.063 | 6.198 | 6.872 |
| Wexford (Loch Garman) | 15.393 | 15.862 | 17.235 | 18.163 | 20.072 | 20.188 | 21.524 |
| Wicklow | 6.215 | 7.290 | 9.355 | 10.070 | 10.356 | 10.584 | 12.957 |
| Youghal | 5.828 | 5.943 | 6.597 | 6.785 | 7.794 | 7.963 | 8.564 |
Sligo, an der Nordwestküste Irlands gelegen, ist eine lebendige Stadt, die für ihre literarische Tradition und atemberaubende Landschaften bekannt ist. Der Dichter William Butler Yeats, der hier viel Zeit verbrachte, prägt die Identität der Stadt: Sein Grab in Drumcliffe und das nahegelegene Benbulben-Gebirge sind ikonische Orte. Die Stadt beherbergt das Sligo Abbey, ein gut erhaltenes Kloster aus dem 13. Jahrhundert, und das Yeats Memorial Building, das an den Dichter erinnert. Sligo ist auch ein Hotspot für Surfer, dank der nahegelegenen Strände wie Strandhill und Rosses Point. Kulturell brummt die Stadt mit Veranstaltungen wie dem Sligo Arts Festival und einer lebendigen Musikszene in traditionellen Pubs.
Castlebar, die Hauptstadt des County Mayo, ist eine geschichtsträchtige Marktstadt, die Tradition und Moderne verbindet. Das National Museum of Ireland – Country Life, eines der vier Nationalmuseen, bietet faszinierende Einblicke in das ländliche Leben Irlands. Die georgianische Architektur, insbesondere entlang des grünen Mall, verleiht der Stadt Charme. Castlebar ist ein idealer Ausgangspunkt für Outdoor-Aktivitäten: Der nahegelegene Croagh Patrick, ein heiliger Berg, lockt Pilger und Wanderer, während die Great Western Greenway Radfahrer begeistert. Historisch ist die Stadt für ihre Rolle im Aufstand von 1798 bekannt, als französische Truppen hier landeten.
Athlone liegt zentral in Irland am Ufer des River Shannon und ist eine Stadt mit reicher Geschichte und strategischer Bedeutung. Das imposante Athlone Castle aus dem 13. Jahrhundert ist ein Highlight und erzählt von der turbulenten Vergangenheit der Region, einschließlich der Belagerung von 1691. Die Stadt ist ein Paradies für Wassersportler, da der Shannon Möglichkeiten für Bootsfahrten, Angeln und Kajakfahren bietet. Athlone hat sich in den letzten Jahren zu einem kulinarischen und kulturellen Zentrum entwickelt, mit gemütlichen Cafés, Restaurants und Live-Musik in traditionellen Pubs. Die nahegelegene Klosterruine Clonmacnoise, ein bedeutendes frühchristliches Zentrum, ist ein beliebtes Ausflugsziel.
Limerick, die drittgrößte Stadt Irlands, liegt am mächtigen River Shannon und ist ein kulturelles und historisches Zentrum. King John’s Castle, eine normannische Festung aus dem 13. Jahrhundert, ist ein Wahrzeichen, ebenso wie die St. Mary’s Cathedral, die älteste Kathedrale Irlands. Das Hunt Museum zeigt eine beeindruckende Sammlung von Kunst und Antiquitäten. Limerick ist bekannt für seine Rugby-Tradition, lebhafte Pub-Szene und Veranstaltungen wie das Limerick Literary Festival. Die Stadt hat sich zu einem kulinarischen Hotspot entwickelt, mit Märkten wie dem Milk Market, der lokale Produkte anbietet. Dank der University of Limerick und einer jungen Bevölkerung wirkt die Stadt dynamisch und innovativ.
Tralee, die Hauptstadt des County Kerry, ist vor allem für das jährliche Rose of Tralee Festival bekannt, ein internationales Fest, das irische Kultur und weibliche Talente feiert. Die Stadt ist ein kulturelles Zentrum mit dem Siamsa Tíre, dem National Folk Theatre, das traditionelle irische Musik, Tanz und Geschichten präsentiert. Das Kerry County Museum beleuchtet die Geschichte der Region, einschließlich der gälischen Vergangenheit. Tralee liegt ideal für Ausflüge zur Dingle-Halbinsel oder zum Tralee Bay Wetlands Centre, das Naturfreunde anzieht. Die Stadt bietet eine Mischung aus Geschäften, Restaurants und traditionellen Pubs, die für ihre Live-Musik bekannt sind, und strahlt eine herzliche, einladende Atmosphäre aus.
Killarney, im Herzen des County Kerry, ist eine der schönsten Städte Irlands, umgeben von der atemberaubenden Landschaft des Killarney National Park. Dieser Park umfasst die malerischen Lakes of Killarney, das historische Muckross House und den beeindruckenden Torc Waterfall. Killarney ist ein Mekka für Outdoor-Enthusiasten, mit Wanderwegen, Radtouren und Bootsfahrten, sowie ein Ausgangspunkt für den berühmten Ring of Kerry. Die Stadt selbst ist charmant, mit bunten Fassaden, traditionellen Pubs und gemütlichen Cafés. Kulturelle Veranstaltungen wie das Killarney Summerfest ziehen Besucher an, während die Nähe zu den Kerry Mountains die Stadt zu einem Paradies für Naturliebhaber macht.
Cork, die zweitgrößte Stadt Irlands, ist ein pulsierendes Zentrum für Essen, Kultur und Geschichte. Der English Market, ein überdachter Lebensmittelmarkt, ist berühmt für seine frischen, lokalen Produkte und zieht Feinschmecker aus aller Welt an. Sehenswürdigkeiten wie die St. Fin Barre’s Cathedral, eine neugotische Meisterleistung, und das Cork City Gaol, ein historisches Gefängnis, zeugen von der reichen Vergangenheit der Stadt. Der River Lee teilt Cork in zwei Hälften und verleiht der Stadt eine malerische Kulisse. Cork ist bekannt für seine lebendige Kunstszene, mit Festivals wie dem Cork Jazz Festival und einer Vielzahl von Theatern und Galerien.
Waterford, die älteste Stadt Irlands, wurde im 9. Jahrhundert von den Wikingern gegründet und ist reich an Geschichte. Der Viking Triangle, ein historisches Viertel, umfasst das Waterford Museum of Treasures und den Reginald’s Tower, den ältesten erhaltenen Stadtturm Irlands. Waterford ist weltweit bekannt für seine Kristallmanufaktur, und Besucher können die Handwerkskunst in der House of Waterford Crystal bewundern. Die Stadt liegt an der malerischen Copper Coast, die zum UNESCO Global Geopark gehört, und bietet spektakuläre Ausblicke. Veranstaltungen wie das Spraoi Festival, ein Straßenkunst- und Musikfestival, bringen Leben in die Stadt.
Kilkenny, oft als Irlands mittelalterliche Hauptstadt bezeichnet, ist eine Stadt voller Charme und Geschichte. Das imposante Kilkenny Castle, ein normannisches Schloss aus dem 12. Jahrhundert, dominiert die Skyline, während die St. Canice’s Cathedral mit ihrem Rundturm ein weiteres Highlight ist. Die engen, gepflasterten Straßen, bekannt als „Slips“, sind gesäumt von farbenfrohen Geschäften, Cafés und Pubs. Kilkenny ist ein kulturelles Zentrum, mit dem Kilkenny Arts Festival und dem Cat Laughs Comedy Festival, die internationale Besucher anziehen. Die Stadt ist auch für ihr Kunsthandwerk bekannt, mit zahlreichen Galerien und Werkstätten.
Carlow, eine kleine Stadt am River Barrow, ist ein verstecktes Juwel im Südosten Irlands. Das Carlow Castle, obwohl größtenteils in Ruinen, und die neugotische Carlow Cathedral sind Zeugnisse der reichen Geschichte. Die Stadt ist ein Paradies für Naturliebhaber, mit dem Barrow Way, einem malerischen Wander- und Radweg entlang des Flusses, und den nahegelegenen Blackstairs Mountains. Das VISUAL Centre for Contemporary Art, ein modernes Kulturzentrum, zeigt innovative Ausstellungen und Aufführungen. Carlows entspannte Atmosphäre, kombiniert mit regelmäßigen Märkten und Festivals, macht die Stadt zu einem charmanten Reiseziel.
Portlaoise, die Hauptstadt des County Laois, ist eine lebendige Stadt im Herzen der irischen Midlands. Die Ruine des Rock of Dunamase, eine spektakuläre Festung auf einem Hügel, ist ein faszinierendes Zeugnis der mittelalterlichen Geschichte. Portlaoise ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, was es zu einem praktischen Ausgangspunkt für Reisen durch Irland macht. Das Dunamaise Arts Centre bietet ein vielfältiges Programm aus Theater, Musik und Kunst, während die nahegelegenen Slieve Bloom Mountains Wanderer und Naturliebhaber anziehen.
Mullingar, im County Westmeath gelegen, ist eine lebhafte Marktstadt mit einer entspannten Atmosphäre. Sie ist bekannt für ihre literarischen Verbindungen, insbesondere zu James Joyce, der die Stadt in seinen Werken erwähnt. Das Belvedere House and Gardens, ein georgianisches Herrenhaus mit wunderschönen Parkanlagen, ist ein Highlight. Die nahegelegenen Seen Lough Ennell und Lough Owel sind ideal für Angeln, Bootsfahrten und Spaziergänge. Mullingar ist auch für seine Musikszene bekannt, mit traditionellen Pubs, die regelmäßig Live-Musik bieten.
Navan, die größte Stadt im County Meath, liegt im Herzen des historischen Boyne Valley. Die Nähe zu bedeutenden archäologischen Stätten wie dem Hill of Tara, dem Sitz der alten Hochkönige Irlands, und Newgrange macht Navan zu einem idealen Ausgangspunkt für Geschichtsinteressierte. Der River Boyne fließt durch die Stadt und bietet malerische Spazierwege. Navan ist auch ein modernes Handelszentrum mit belebten Einkaufsstraßen und Restaurants.
Drogheda, eine Hafenstadt im County Louth, liegt am River Boyne und ist reich an Geschichte. Die mittelalterliche St. Laurence’s Gate und das Millmount Fort sind beeindruckende Überreste der Vergangenheit, während die Stadt eine Schlüsselrolle in der Schlacht am Boyne von 1690 spielte. Das Droichead Arts Centre ist ein kulturelles Zentrum mit Theater, Kunst und Musik. Drogheda liegt in der Nähe des UNESCO-Welterbes Newgrange, was es zu einem beliebten Ziel für Tagesausflüge macht.
Dundalk, im County Louth nahe der Grenze zu Nordirland, ist eine geschäftige Stadt mit einer Mischung aus Industrie, Sport und Kultur. Das County Museum Dundalk, untergebracht in einer restaurierten Destillerie, beleuchtet die Geschichte der Region, von der Wikingerzeit bis zur Industrialisierung. Die Stadt ist ein Zentrum für Gaelic Football und hat eine lebendige Musikszene mit traditionellen Pubs. Die nahegelegene Cooley-Halbinsel bietet spektakuläre Wanderwege und Ausblicke.
Naas, die Hauptstadt des County Kildare, ist eine blühende Stadt mit einer starken Verbindung zur Pferderennkultur. Die nahegelegenen Rennbahnen von Punchestown und der Curragh machen Naas zu einem Mekka für Pferdesportfans. Historische Stätten wie die Ruinen von Jigginstown Castle und die St. David’s Church zeugen von der langen Geschichte der Stadt. Naas bietet moderne Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und eine lebendige Pub-Szene. Dank der Nähe zu Dublin ist die Stadt ein beliebter Wohnort für Pendler.
Swords, nördlich von Dublin, ist eine historische Stadt mit modernem Ambiente. Das Swords Castle, eine gut erhaltene normannische Festung, und der Rundturm sind Zeugnisse der mittelalterlichen Vergangenheit. Die Stadt ist ein wichtiges Handelszentrum, mit dem Pavilions Shopping Centre als Anziehungspunkt. Das Fingal Arts Centre bietet kulturelle Veranstaltungen, während die Nähe zur Küste, insbesondere nach Malahide, Outdoor-Aktivitäten ermöglicht. Nahe der Staadt befindet sich der Flughafen von Dublin.
Bray, eine malerische Küstenstadt im County Wicklow, ist bekannt für ihre elegante viktorianische Promenade und den Sandstrand. Der Aufstieg auf den Bray Head bietet atemberaubende Ausblicke auf die Irische See und die Wicklow Mountains. Die Stadt ist ein kulturelles Zentrum mit Veranstaltungen wie dem Bray Air Display, einem spektakulären Flugshow-Festival, und einer lebendigen Musik- und Pub-Szene. Bray ist auch ein Tor zu den Wicklow Mountains, ideal für Wanderer und Naturliebhaber. Die Nähe zu Dublin macht Bray zu einem beliebten Ziel für Tagesausflüge oder einen entspannten Aufenthalt am Meer.
Dublin, die Hauptstadt Irlands, ist eine dynamische Metropole, die Geschichte, Kultur und Moderne vereint. Der River Liffey teilt die Stadt in Nord und Süd, verbunden durch Brücken wie die Ha’penny Bridge, eine elegante Fußgängerbrücke aus dem 19. Jahrhundert, und die moderne Samuel Beckett Bridge prägen das Stadtbild und laden zu Spaziergängen entlang der Uferpromenaden ein.
Dublin wurde im 9. Jahrhundert von den Wikingern gegründet, und Spuren dieser Vergangenheit sind noch heute sichtbar. Das Dublin Castle, ein normannisches Wahrzeichen aus dem 13. Jahrhundert, war einst Sitz der britischen Verwaltung und ist heute ein kulturelles Zentrum mit beeindruckenden Staatsgemächern und einem Museum. Das Trinity College, Irlands älteste Universität, gegründet 1592, ist ein weiteres Highlight. Hier wird das Book of Kells ausgestellt, ein kunstvoll illuminiertes Manuskript aus dem 9. Jahrhundert, das als eines der schönsten mittelalterlichen Kunstwerke gilt. Die Long Room in der Bibliothek des Trinity College, mit ihren hohen Holzregalen und über 200.000 Büchern, ist ein Paradies für Buchliebhaber.
Die Christ Church Cathedral und die St. Patrick’s Cathedral, beide aus dem Mittelalter, sind architektonische Juwelen. St. Patrick’s, die größte Kathedrale Irlands, ist eng mit Jonathan Swift, dem Autor von Gullivers Reisen, verbunden, der hier als Dekan wirkte. Das Viertel rund um die Kathedralen, bekannt als das Liberties-Gebiet, ist eines der ältesten in Dublin und bietet einen Einblick in das traditionelle Leben der Stadt.
Die Einwohnerzahlen der größten Städte Nordirlands entwickelten sich wie folgt:
| Ortschaft | Z 1981 | Z 1991 | Z 2001 | Z 2011 | Z 2021 |
| Aghagallon | ... | ... | 824 | 1.056 | 1.175 |
| Ahoghill | 1.082 | 1.686 | 3.027 | 3.403 | 3.529 |
| Annaghmore | ... | ... | ... | 870 | 1.052 |
| Annahilt | 357 | 1.110 | 1.131 | 1.045 | 1.034 |
| Annalong | 1.823 | 1.832 | 1.761 | 1.796 | 2.037 |
| Antrim | 22.342 | 20.878 | 19.986 | 23.353 | 25.464 |
| Ardglass | 1.282 | 1.651 | 1.659 | 1.643 | 1.761 |
| Armagh | 12.700 | 14.265 | 14.517 | 14.749 | 16.438 |
| Aughnacloy | ... | ... | 801 | 1.041 | 1.162 |
| Ballinamallard | 686 | 1.068 | 1.326 | 1.432 | 1.361 |
| Ballycarry | ... | ... | 981 | 1.371 | 1.479 |
| Ballycastle | 3.284 | 4.005 | 5.073 | 5.238 | 5.628 |
| Ballyclare | 6.159 | 7.108 | 8.772 | 9.919 | 10.848 |
| Ballygowan | 1.123 | 2.289 | 2.670 | 2.957 | 3.083 |
| Ballyhalbert | ... | ... | ... | 1.026 | 1.266 |
| Ballykelly | 1.166 | 2.140 | 1.827 | 2.103 | 2.004 |
| Ballymena | 28.166 | 28.112 | 28.704 | 29.467 | 31.308 |
| Ballymoney | 5.679 | 7.818 | 9.009 | 10.393 | 10.903 |
| Ballynahinch | 3.721 | 4.591 | 5.334 | 5.715 | 6.335 |
| Ballynure | ... | ... | 677 | 977 | 1.034 |
| Ballywalter | 1.019 | 1.073 | 1.419 | 2.027 | 2.008 |
| Banbridge | 9.650 | 11.448 | 14.748 | 16.653 | 17.248 |
| Bangor | 46.585 | 52.437 | 58.368 | 61.401 | 64.122 |
| Belfast (mit Vororten) | ... | ... | 423.496 | 433.086 | 450.386 |
| Bellaghy | 905 | 1.041 | 1.071 | 1.115 | 1.235 |
| Bessbrook | ... | ... | ... | 2.739 | 3.004 |
| Bleary | ... | ... | ... | 1.011 | 1.107 |
| Broughshane | 1.503 | 1.873 | 2.349 | 2.851 | 3.067 |
| Bushmills | 1.381 | 1.348 | 1.314 | 1.292 | 1.234 |
| Camlough | ... | ... | 910 | 1.081 | 1.038 |
| Carnlough | 1.462 | 1.493 | 1.440 | 1.512 | 1.457 |
| Carrickfergus | 17.633 | 22.786 | 27.192 | 27.903 | 27.886 |
| Carrowdore | ... | ... | 816 | 960 | 1.052 |
| Carryduff | 2.666 | 4.270 | 6.564 | 6.947 | 7.017 |
| Castledawson | 1.460 | 1.691 | 2.085 | 2.292 | 2.345 |
| Castlederg | 1.730 | 2.579 | 2.739 | 2.985 | 2.963 |
| Castlerock | 999 | 1.023 | 1.326 | 1.287 | 1.152 |
| Castlewellan | 2.105 | 2.133 | 2.367 | 2.792 | 2.822 |
| Claudy | 913 | 970 | 1.323 | 1.336 | 1.322 |
| Clogh Mills | 951 | 933 | 1.224 | 1.309 | 1.230 |
| Cloughey | ... | ... | ... | 1.075 | 1.340 |
| Coalisland | 3.324 | 3.802 | 4.872 | 5.700 | 6.323 |
| Cogry / Kilbride | ... | ... | 1.167 | 1.246 | 1.330 |
| Coleraine | 15.967 | 20.721 | 24.042 | 24.630 | 24.560 |
| Comber | 7.600 | 8.333 | 8.952 | 9.078 | 9.512 |
| Cookstown | 7.649 | 9.842 | 10.566 | 11.620 | 12.549 |
| Craigavon (incl. Portadown, Lurgan) | 53.049 | 53.434 | 57.651 | 64.193 | 72.721 |
| Crossgar | 1.225 | 1.246 | 1.542 | 1.892 | 2.010 |
| Crossmaglen | 1.333 | 1.586 | 1.449 | 1.608 | 1.683 |
| Crumlin | 1.708 | 1.762 | 4.248 | 5.099 | 5.340 |
| Cullybackey | 2.098 | 2.167 | 2.388 | 2.569 | 2.614 |
| Culmore | 217 | 1.116 | 2.937 | 3.466 | 3.655 |
| Cushendall | 1.077 | 1.285 | 1.242 | 1.276 | 1.180 |
| Derry (Londonderry) | 62.697 | 72.334 | 83.652 | 83.125 | 84.884 |
| Doagh | 689 | 961 | 1.119 | 1.390 | 1.404 |
| Dollingstown | 604 | 877 | 1.830 | 2.126 | 2.250 |
| Donaghadee | 3.874 | 4.455 | 6.474 | 6.869 | 7.320 |
| Donaghcloney | ... | ... | 972 | 1.701 | 1.977 |
| Donaghmore | ... | ... | 947 | 1.122 | 1.182 |
| Downpatrick | 8.245 | 10.113 | 10.320 | 10.874 | 11.541 |
| Draperstown | 1.300 | 1.409 | 1.626 | 1.772 | 1.848 |
| Dromara | ... | ... | 597 | 1.006 | 1.118 |
| Dromore | 3.089 | 3.434 | 4.959 | 6.011 | 6.492 |
| Dromore | ... | ... | 1.095 | 1.202 | 1.106 |
| Drumaness | 700 | 1.026 | 1.269 | 1.344 | 1.309 |
| Drumnacanvy | ... | ... | 915 | 999 | 1.126 |
| Dundrum | 1.037 | 1.004 | 1.062 | 1.551 | 1.538 |
| Dungannon | 8.295 | 9.190 | 10.983 | 14.332 | 16.361 |
| Dungiven | 2.249 | 2.812 | 2.988 | 3.286 | 3.346 |
| Dunloy | 1.089 | 1.119 | 1.044 | 1.215 | 1.150 |
| Eglinton | 1.252 | 1.658 | 3.150 | 3.650 | 3.550 |
| Enniskillen | 10.429 | 11.436 | 13.560 | 13.790 | 14.120 |
| Fintona | 1.353 | 1.324 | 1.344 | 1.160 | 1.212 |
| Fivemiletown | 976 | 1.107 | 1.104 | 1.243 | 1.341 |
| Garvagh | 1.214 | 1.091 | 1.278 | 1.274 | 1.252 |
| Gilford | 1.512 | 1.551 | 1.548 | 1.927 | 1.957 |
| Glenavy | 396 | 497 | 1.071 | 1.791 | 2.384 |
| Greenisland | 5.103 | 4.967 | 5.067 | 5.484 | 6.383 |
| Greysteel | 958 | 1.029 | 1.224 | 1.454 | 1.418 |
| Groomsport | 1.038 | 1.436 | 1.401 | 1.233 | 1.220 |
| Hamiltonsbawn | ... | ... | ... | 895 | 1.030 |
| Helen's Bay | 1.249 | 1.268 | 1.356 | 1.390 | 1.547 |
| Hillsborough and Culcavy | 1.190 | 2.407 | 3.396 | 3.953 | 4.160 |
| Hilltown | ... | ... | 899 | 1.698 | 1.755 |
| Holywood | 9.462 | 9.252 | 12.027 | 11.332 | 10.735 |
| Irvinestown | 1.827 | 1.906 | 1.797 | 2.264 | 2.320 |
| Keady | 2.561 | 2.467 | 2.937 | 3.036 | 3.327 |
| Kells / Connor | ... | ... | 1.737 | 2.053 | 2.113 |
| Kesh | ... | ... | 972 | 1.036 | 1.101 |
| Kilkeel | 6.036 | 6.024 | 6.297 | 6.521 | 6.632 |
| Killyleagh | 2.094 | 2.221 | 2.490 | 2.928 | 2.785 |
| Killyman | ... | ... | ... | 682 | 1.057 |
| Kilrea | 1.320 | 1.271 | 1.509 | 1.679 | 1.676 |
| Kinallen | ... | ... | 557 | 961 | 1.126 |
| Kircubbin | 1.081 | 1.098 | 1.218 | 1.153 | 1.065 |
| Laurelvale / Mullavilly | ... | ... | 959 | 1.284 | 1.387 |
| Limavady | 8.015 | 10.350 | 12.075 | 12.047 | 11.697 |
| Lisbellaw | 511 | 632 | 1.041 | 1.102 | 1.085 |
| Lisburn | ... | ... | 43.755 | 45.410 | 51.447 |
| Lisnaskea | 1.568 | 2.367 | 2.730 | 2.960 | 3.006 |
| Maghaberry | ... | 1.009 | 1.692 | 2.468 | 2.943 |
| Maghera | 1.953 | 2.876 | 3.648 | 4.217 | 4.222 |
| Magherafelt | 5.044 | 6.682 | 8.289 | 8.819 | 9.647 |
| Magheralin | 911 | 1.075 | 1.134 | 1.337 | 2.036 |
| Maguiresbridge | ... | ... | 774 | 1.038 | 1.029 |
| Markethill | 1.264 | 1.337 | 1.290 | 1.652 | 1.906 |
| Mayobridge | ... | ... | 842 | 1.068 | 1.162 |
| Millisle | 1.373 | 1.531 | 1.791 | 2.318 | 2.553 |
| Milltown | ... | ... | 1.356 | 1.499 | 1.633 |
| Moira | 1.453 | 2.772 | 3.669 | 4.584 | 4.879 |
| Moneymore | 1.266 | 1.231 | 1.371 | 1.897 | 2.141 |
| Moy | 852 | 875 | 1.209 | 1.603 | 1.941 |
| Newbuildings | 1.815 | 2.025 | 2.496 | 2.599 | 2.829 |
| Newcastle | 6.246 | 7.214 | 7.431 | 7.743 | 8.293 |
| Newry | 22.182 | 24.765 | 27.300 | 26.893 | 28.026 |
| Newtownards | 20.531 | 23.869 | 27.795 | 28.039 | 29.591 |
| Newtownstewart | 1.425 | 1.520 | 1.467 | 1.547 | 1.414 |
| Omagh | 14.627 | 17.280 | 19.836 | 19.682 | 20.353 |
| Portaferry | 2.148 | 2.324 | 2.478 | 2.514 | 2.372 |
| Portavogie | 1.420 | 1.482 | 1.593 | 2.122 | 2.269 |
| Portglenone | 969 | 1.193 | 1.191 | 1.174 | 1.367 |
| Portrush | 5.114 | 5.598 | 6.345 | 6.442 | 6.050 |
| Portstewart | 5.312 | 6.459 | 7.803 | 8.029 | 7.698 |
| Randalstown | 3.591 | 3.925 | 4.944 | 5.099 | 5.156 |
| Rasharkin | ... | ... | 864 | 1.114 | 1.072 |
| Rathfriland | 2.243 | 2.126 | 2.061 | 2.472 | 2.489 |
| Richhill | 1.728 | 2.709 | 2.808 | 2.821 | 2.738 |
| Rostrevor | 1.852 | 2.269 | 2.433 | 2.788 | 2.617 |
| Saintfield | 1.419 | 2.168 | 2.955 | 3.406 | 3.578 |
| Sion Mills | 1.771 | 1.676 | 2.073 | 1.903 | 1.970 |
| Strabane | 10.340 | 11.670 | 13.380 | 13.147 | 13.456 |
| Strathfoyle | 2.050 | 1.703 | 1.578 | 2.412 | 2.605 |
| Tandragee | 2.224 | 2.871 | 3.018 | 3.486 | 3.543 |
| Templepatrick | 991 | 1.383 | 1.551 | 1.437 | 1.541 |
| Waringstown | 1.167 | 1.831 | 2.523 | 3.647 | 3.787 |
| Warrenpoint (incl. Burren) | 4.798 | 5.408 | 6.981 | 8.721 | 8.821 |
| Whitehead | 3.546 | 3.761 | 3.711 | 3.786 | 3.537 |
Belfast, die Hauptstadt Nordirlands und größte Stadt der Region, liegt am westlichen Ufer der Belfast-Lough. Als wirtschaftliches, kulturelles und politisches Zentrum der Provinz hat sie eine reiche Geschichte, geprägt von der Industriellen Revolution, als sie zu einem der führenden Schiffbauzentren der Welt aufstieg – hier entstand die Titanic. Heute ist Belfast ein pulsierender Mix aus moderner Architektur und viktorianischen Bauten, mit Attraktionen wie dem Titanic Belfast Museum, der Grand Opera House und den lebhaften Märkten wie St. George's Market. Die Stadt war Schauplatz der Troubles, dem nordirischen Konflikt, was Spuren in Form von Peace Walls hinterlassen hat, doch mittlerweile blüht sie als kreatives Zentrum mit Street Art, Universitäten wie der Queen's University und einer blühenden Tech- und Filmindustrie auf.
Derry, auch Londonderry genannt, ist die zweitgrößte Stadt Nordirlands. Sie liegt am Fluss Foyle im Nordwesten der Provinz. Als älteste Stadt der Insel Irland, gegründet im 6. Jahrhundert von St. Columba, ist sie berühmt für ihre intakte Stadtmauer aus dem 17. Jahrhundert, die zu den am besten erhaltenen in Europa zählt und eine Umfang von über 1,5 Kilometern hat. Derry war ein Hotspot der Bürgerrechtebewegung in den 1960er Jahren und der Troubles, symbolisiert durch die Bloody Sunday-Gedenkstätte. Heute ist sie ein lebendiges Universitätsstädte mit der Ulster University, die ein Zentrum für Künste und Kultur darstellt, inklusive des Guildhall-Theaters und jährlicher Festivals wie den Foyle Film Days. Die Stadt bildeet das Einstiegstor zu den wilden Landschaften des Nordwestens, wie den Sperrins oder der Küstenstraße nach Donegal.
Lisburn, eine Stadt mit Stadtstatus im County Antrim, erstreckt sich südlich von Belfast entlang des River Lagan, mit dem sie eine enge urbane Verbindung bildet. Historisch als Leinenhandelszentrum im 17. Jahrhundert etabliert, profitiert sie heute von ihrer Nähe zur Metropole als Pendlerstadt, mit einer starken Wirtschaft in Handel, Bildung und Fertigung. Sehenswürdigkeiten umfassen die imposante Lisburn Cathedral aus dem 17. Jahrhundert und den Irish Linen Centre & Museum, das die textilen Traditionen ehrt. Die Stadt ist grün und familienfreundlich, mit Parks wie Wallace Park und einer Vielzahl von Boutiquen und Cafés entlang der Hauptstraße. Als Teil des Belfast Metropolitan Areas ist Lisburn ein ruhigerer Kontrast zur Hauptstadt, doch sie teilt deren kulturelle Vielfalt, mit protestantischer Prägung und wachsendem internationalem Einfluss durch Zuzug aus Osteuropa.
Newtownabbey, im Borough of Antrim and Newtownabbey gelegen, ist eine moderne Vorstadt nördlich von Belfast am Ufer des Belfast Lough. Entstanden in den 1950er Jahren als Planstadt zur Entlastung der Hauptstadt, hat sie sich zu einem dynamischen Wohn- und Industriegebiet entwickelt, mit Fokus auf Ingenieurwesen und Logistik dank des nahen Hafenviertels. Die Universität Ulster in Jordanstown, ein Campus für Ingenieur- und Gesundheitswissenschaften, prägt das Bild einer bildungsstarken Community. Attraktionen wie der Muckamore Abbey Park oder die Uferpromenade laden zu Spaziergängen ein, während Einkaufszentren wie Valley Leisure Park Freizeitmöglichkeiten bieten.
Bangor, eine Küstenstadt im Ards and North Down Borough, liegt am östlichen Rand von Belfast Lough und ist bekannt als „Juwel der Nordküste“. Als viktorianischer Badeort aus dem 19. Jahrhundert angelegt, zieht sie mit ihrer Promenade, Yachthäfen und Sandstränden Touristen an, die Wassersport oder Spaziergänge genießen. Die Stadt hat Stadtstatus seit 2022 und dient als wohlhabender Vorort für Pendler, mit einer Wirtschaft basierend auf Tourismus, Einzelhandel und kleinen Tech-Firmen. Historische Sehenswürdigkeiten sind die Bangor Abbey, eine der ältesten Kirchen Irlands aus dem 6. Jahrhundert, und das Ward Park mit seinen Gärten.
Craigavon, im Armagh City, Banbridge and Craigavon District gelegen, ist eine der wenigen Planstädte Großbritanniens, entstanden in den 1960er Jahren als Masterplan zur Förderung des Wachstums im Herzen Nordirlands. Die Stadt erstreckt sich über die ehemaligen Orte Lurgan und Portadown am Ufer des Lough Neagh, dem größten See der britischen Insel, und verbindet Wohngebiete mit Industrieparks und Grünflächen. Wirtschaftlich stark in Fertigung, Landwirtschaft und Logistik, profitiert sie von ihrer zentralen Lage. Kulturell bietet Craigavon das Tayto Castle, ein Erlebnismuseum für Chips, und den Craigavon Lakes für Wassersport.
Newry, eine Grenzstadt mit Stadtstatus im Newry, Mourne and Down District, liegt am River Clanrye nahe der Grenze zur Republik Irland. Als strategischer Handelsort seit dem Mittelalter, wo Mönche eine Abtei gründeten, ist sie heute ein vitaler Knotenpunkt für Handel und Transport, mit Einkaufszentren wie The Quays. Die Stadt verbindet protestantische und katholische Traditionen, was in der Architektur sichtbar wird, etwa in der neugotischen St.-Patricks-Kathedrale. Umgeben von den Ring of Gullion-Hügeln bietet Newry Wanderwege und Angelparadiese, während das jährliche Oriel Festival keltische Musik zelebriert. Trotz ihrer Grenzlage hat Newry eine stabile Wirtschaft durch Cross-Border-Handel und dient als Tor zu den Mourne Mountains.
Carrickfergus, eine historische Hafenstadt im Mid and East Antrim Borough, befindet sich am Nordufer des Belfast Lough. Bekannt für ihr normannisches Carrickfergus Castle aus dem 12. Jahrhundert, das als bestes erhaltenes in Irland gilt und Schauplatz mittelalterlicher Turniere war, zieht die Stadt Geschichtsinteressierte an. Als alter Fährhafen nach Schottland war sie ein Tor für schottische Siedler, was ihre Architektur und Kultur prägt. Heute ist Carrickfergus ein ruhiger Wohnort mit Fokus auf Tourismus, Fischerei und kleinen Industrien, umgeben von Stränden wie Greenisland.
Coleraine, im Causeway Coast and Glens Borough gelegen, hat etwa 25.000 Einwohner (2021) und liegt am River Bann im Nordosten Nordirlands. Als Universitätsstadt mit dem Campus der Ulster University ist sie ein Zentrum für Agrarwissenschaften und Tourismus, dank ihrer Lage nahe der UNESCO-Weltkulturerbestätte Giant’s Causeway. Die Stadt hat eine lange Geschichte als Hafen für Hanfhandel im 17. Jahrhundert, was in der Coleraine Town Hall widerhallt. Grüne Parks wie der Mountsandal Forest Park laden zum Wandern ein, und der jährliche Coleraine Folk Music Festival feiert irische Musik.
Armagh, die religiöse Hauptstadt Nordirlands mit Stadtstatus im Armagh City, Banbridge and Craigavon District, ist bekannt als „Kirchenstadt“. Hier residierten einst die Könige von Ulster, und heute beherbergen zwei Kathedralen – die katholische St. Patrick’s und die anglikanische – Reliquien des Heiligen Patrick, der Irland christianisierte. Die Stadt ist Sitz des Prälaten von Armagh, dem Kopf der Kirche von Irland, und umfasst Observatorien wie das Armagh Observatory, eines der ältesten der Welt. Wirtschaftlich basiert sie auf Bildung, Landwirtschaft und Tourismus, mit Apfelplantagen in der Region. Armagh’s gepflasterte Straßen, Parks wie der The Mall und Festivals wie das Apple Harvest Festival vermitteln eine Atmosphäre tiefer spiritueller und kultureller Wurzeln in einer grünen Hügellandschaft.
Verkehr
Die Insel Irland umfasst die Republik Irland und Nordirland, die unterschiedliche Verkehrsregeln haben: In der Republik gilt Rechtsverkehr, in Nordirland Linksverkehr. Das Straßennetz in der Republik umfasst rund 95.000 km, darunter Autobahnen wie die M50 um Dublin. Nordirland hat ein kleineres, aber gut ausgebautes Netz, besonders rund Belfast. Städtische Zentren leiden unter hohem Verkehrsaufkommen, ländliche Gegenden sind oft über schmale, kurvige Straßen erreichbar.
Der öffentliche Verkehr wird in der Republik durch Bus Éireann, städtische Busse, die Bahn (Iarnród Éireann) und die Straßenbahn Luas in Dublin abgedeckt. Nordirland nutzt Translink-Busse und NI Railways. Beide Regionen sind durch offene Grenzübergänge verbunden. Fähren verbinden die Insel mit Großbritannien und Europa.
Der Luftverkehr erfolgt über Dublin, Cork, Shannon und Knock in der Republik sowie Belfast International und Belfast City in Nordirland. Rad- und Fußverkehr ist in Städten wie Dublin besser ausgebaut als in ländlichen Gebieten.
Straßenverkehr
Sowohl das Straßensystem in Irland als auch das in Nordirland ist sehr umfassend. Historisch bedingt haben Nordirlands Straßen eine bessere Qualität, auch wenn die Erneuerung der Trassen in der Republik Irland die Unterschiede kleiner werden lässt. Trotzdem erinnern etliche 'Landstraßen' auf der ganzen Insel eher an Feldwege und versprechen eine unvergessliche Fahrt - zum Beispiel die Strecke von Charleville nach Macroom in der Grafschaft Cork; hier kommen alle Vorurteile zusammen: Schlechter Fahrbahnbelag, Schlaglöcher, uneinsehbare Kreuzungen und Kurven.
Durch die Unterstützung der Europäischen Union wurden und werden die meisten irischen Nationalstraßen erneuert. Noch vor 1990 gab es in ganz Irland lediglich eine einzige Autobahn - mittlerweile gibt es Autobahn-ähnliche Teilstücke auf vielen Hauptstrecken zu den größten irischen Städten.
Während in Nordirland alle Entfernungen auf Straßenschildern in Meilen angegeben sind, werden in der Republik seit 2005 alle Entfernungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Kilometer-Angaben umgestellt. Auf manchen Straßen sind zur Verwirrung aller derzeit (Mai 2006) noch in lockerem Wechsel Schilder aufgestellt, die Entfernungen entweder in Meilen oder Kilometern angeben. Manchmal stehen auch Kilometer-Schilder, bei denen man sich auf die Entfernungsangaben nicht hundertprozentig verlassen darf - man hat den Eindruck, dass die Meilen-Angaben zweimal in Kilometer umgerechnet oder einfach „in die falsche Richtung“ umgerechnet wurde.
Die Autobahnen in Irland konzentrieren sich vor allem auf die Gegend rund um Dublin. Auch die größten Bauvorhaben wie die East-Link- und die West-Link-Brücken oder der Dubliner Hafentunnel beschränken sich meistens auf die Hauptstadt. Ausnahmen sind hier der Jack Lynch Tunnel unter dem Fluss Lee in Cork oder die geplante vierte Brücke über den Fluss Shannon bei Limerick. Allerdings erhielten nahezu alle größeren Städte in Irland Ortsumgehungen, die den Innenstadtverkehr deutlich reduzierten.
Die Hauptverkehrsstraßen in Irland sind die wenigen Autobahnen (motorways). Sie werden mit dem Buchstaben M gekennzeichnet, gefolgt von einer maximal zweistelligen Ziffer, zum Beispiel M1 oder M50. Neben den Autobahnen rund um Dublin gibt es noch einige Autobahn-ähnliche Teilstücke, die sich nahtlos in die Nationalstraßen integrieren, daher wird diesen Autobahnen meist noch die Nummer der Nationalstraße angehängt.
Folgende Autobahn (-Teilstücke) gibt es (Stand: 2005) in Irland. Orte in Klammern sind nicht direkt an die Straße angebunden, sie geben lediglich die Richtung an. Angaben über die wichtigsten Orte beziehen sich nur auf die wirklichen Autobahn-Teilstücke, nicht auf die Nationalstraßen.
| Bezeichnung | Richtung |
| M1/N1 | Dublin-(Belfast) |
| M4/N4 | Dublin-(Sligo) |
| M6/N6 | Galway-Kinnegad |
| M7/N7 | Dublin-Limerick |
| M8/N8 | Cork-Portlaoise |
| M9/N9 | (Dublin)-Waterford |
| M11/N11 | Dublin-Wexford |
| M50/N50 | Ringstraße um Dublin |
Der M50 motorway (Autobahn M50) ist eine zirka 40 km lange, C-förmige Ringstraße, die Dublins Westseite umspannt. Die Straße startet im Nord-Osten mit einer Verbindung zum M1 motorway, der in nördlicher Richtung nach Belfast (Nordirland) führt. Zwischen den beiden Beton-Brücken (385m lang) beim 'West-Link' befand sich bis Mitte 2008 eine Maut-Station. Inzwischen wurde diese durch ein vollautomatisches elektronisches Free-Flow Mautsystem (e-flow) ersetzt, wodurch eine wesentliche Stauquelle beseitigt werden konnte. Für einen PKW sind hier mindestens 3,00 Euro (Stand: 11/2008) zu entrichten.
Das südliche Ende befindet sich bei der Verbindung zur N11/M11 in Richtung Wexford. Die Entdeckung einer mittelalterlichen Ruine nahe Carrickmines Castle verzögerte nach einem Gerichtsbeschluss die Fertigstellung.
Jede Nationalstraße, die von Dublin aus verläuft, hat eine Auffahrt zur M50, die in der Regel die Form eines Kreisverkehrs (über oder unter der Fahrbahn) hat. Weiterhin werden noch wichtige Vororte (zum Beispiel Ballymun, Tallaght, Dundrum oder Sandyford) mit eigenen Auffahrten durch die M50 verbunden. Die komplette Strecke der M50 hat ein sehr hohes Verkehrsaufkommen, so dass es gerade bei den Auf- und Abfahrten häufig zu Staus kommt. Daher haben die wichtigsten Auffahrten elektronisch gesteuerte Ampelanlagen, die gerade im Berufsverkehr kilometerlange Autoschlangen erzeugen; berühmt-berüchtigt ist hier der 'Red Cow Roundabout' zu Nationalstraße N7 - scherzhaft auch 'Mad Cow Roundabout' genannt.
Der M50 motorway ist eine großteils vierspurige Autobahn. Es gibt Pläne, vor allem die Kreisverkehre auszubauen. Die Erweiterung umfasst auch den Ausbau der Trasse von der M1 nach Sandyford auf sechs Spuren. Die Erweiterung soll in drei Phasen durchgeführt werden: Zuerst die Strecke zwischen den Auffahrten zur Nationalstraße N4 und zur N7. Danach sollen zuerst die nördlichen und zuletzt die südlichen Abschnitte der Autobahn erweitert werden. Die Straße beginnt als Nationalstraße N32 an der Malahide Road in Dublin. Sie wird zur M50 an der dritten Auffahrt, die ebenso die dritte Auffahrt der Autobahn M1 ist.
Auf Autobahnen gilt Tempolimit 120, außerhalb von Ortschaften Tempo 100. In geschlossenen Ortschaften wie bei uns 50, bei entsprechender Beschilderung auch 60. Inzwischen wird sehr viel an den Strassen gearbeitet. Daher besteht oft die Gefahr, dass zwischendurch extrem viel Split auf der Strasse liegt, Kurven sind davon nicht ausgenommen. Ausserdem sind die irischen Strassen der Landschaft angepasst - es gibt hier und da böse Schlaglöcher und sehr viele Unebenheiten, die sich auch gerne in den Kurven zeigen und die mit dem blossen Auge nicht erkennbar sind. Unüberlegtes oder zu schnelles Fahren und Testen der Schräglage kann zu einem schnellen und teuren Ende der Tour führen.
Motorways entsprechen in etwa einer vierstreifigen deutschen Autobahn mit Mittelstreifen und breiten Seitenstreifen (hard shoulder). Sie sind hauptsächlich auf den Großraum Dublin konzentriert. Auch die Ringstraße, die Dublin westlich umschließt, ist als Motorway (M50) klassifiziert. Alle Motorways sind Teil einer, oder bilden eine National road. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Motorways beträgt 120 km/h. Einige Abschnitte von Motorways, beispielsweise der M4, sind gebührenpflichtig, die Maut beträgt zwischen 1,80 und 3 Euro für PKW und bis zu 1,40 Euro für Motorräder (Stand: 08/2008). Die Beschilderung für Richtungs- und Entfernungsinformationen auf Motorways ist in blau gehalten. Irland hat in Westeuropa im Verhältnis zur Bevölkerung die geringste Dichte an Autobahnen.
National Roads entsprechen in ihrer Funktion den deutschen Bundesstraßen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist 100 km/h. Es wird unterschieden in National primary roads - N1 bis N11, die von Dublin aus fächerförmig ins Land führen und N12 bis N33, welche größeren Städte miteinander verbinden - sowie National secondary roads (mit Nummern höher als 50). Viele der National primary roads sind inzwischen gut, einige zum Teil vierstreifig ausgebaut, oder verfügen zumindest über einen breiten Seitenstreifen. Einige der besser ausgebauten Strecken entsprechen der Spezifikation der Motorways, werden aber (noch) nicht als solcher klassifiziert, um auch langsamerem Verkehr wie zum Beispiel Landmaschinen, die Benutzung zu ermöglichen. National secondary roads entsprechen in ihrem Standard oft nur Regional roads oder sind wenig besser. Die Beschilderung für Richtungs- und Entfernungsinformationen auf National Roads ist in grün gehalten.
Regional roads sind nachrangige ländliche Fahrbahnen zum Teil ohne Markierungslinien. Da sie besonders durch ländliche Gegenden führen, werden sie oft von Schafen, Kühen, Pferden oder Wildtieren überquert oder begangen, entsprechend rücksichtsvolle Fahrweise ist daher geboten. Zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Regional roads ist 80 km/h, wobei diese Geschwindigkeit selten gefahrlos realisiert werden kann. Die Beschilderung für Richtungsangaben auf Landstraßen ist Schwarz auf Weiß gehalten und häufig mangelhaft. Ortsangaben finden sich in einigen Gebieten Irlands, vor allem in Gaeltachten, zudem nur in irischer Sprache.
Local roads sind kleine Verbindungsstraßen oder -wege zwischen kleinen Ortschaften. Die Iren interpretieren diesen Begriff übrigens sehr frei. Auch ein nicht betonierter Feldweg mit Grasstreifen in der Mitte ist in vielen Karten als Nebenstraße eingezeichnet. Möchte man als Tourist diese Straßen nutzen, sollte man keine Wege nach europäischer Norm erwarten. Landstraßen sind oft von Mauern oder hohen Hecken begrenzt und sehr schmal, zumeist einspurig. Dies schützt allerdings nicht vor Gegenverkehr. Dessen ungeachtet findet sich auch auf Landstraßen die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.
Gelegentlich findet man, vor allem in ländlichen Gegenden, noch die alte Straßenbeschilderung mit den Typen „T“ (für „trunk road“ = Fernstraße, entspricht weitgehend der jetzigen National Road) und „L“ (für „link road“ = Anbindung, entspricht der jetzigen Regional Road).
Seit Ende der 90er Jahre baut die irische Regierung das Straßennetz durch Investitionsprogramme im Umfang mehrerer Milliarden Euro aus. Seitdem finden kontinuierlich Ausbesserungsarbeiten an einem Großteil des Straßennetzes statt. Zum Einsatz kommen dabei jedoch nicht Asphalt oder Beton, sondern zumeist Rollsplitt, der durch die Nutzung der Straße allmählich in einen weicheren Teer-Untergrund eingepresst wird. Irische Straßen erscheinen dadurch rau und uneben.
Anfang 2005 stellte die Republik Irland vom angloamerikanischen Maßsystem auf das metrische System um, seitdem werden Geschwindigkeiten in km/h sowie Entfernungen in Kilometern und nicht mehr in mph beziehungsweise in Meilen gemessen. Jedoch ist die Strecke auf vielen Verkehrsschildern noch in Meilen angegeben, wobei diese keine Angabe der Maßeinheit haben. Auf den neuen Schildern steht das Kürzel km. Alte Autotachos zeigen auch mph statt km/h an.
Die Straßen sind mitunter kreativ bemalt, mit Slow, Very Slow, Dead Slow oder mit Schildern wie Dangerous Bend(s) ahead. Es ist zwar öfter zu sehen aber es gibt Stellen, da sollte man es sich ganz besonders zu Herzen nehmen, es könnte die letzte Kurve mit intaktem Motorrad sein.
Was die Verkehrsschilder angeht, sind in Irland mittlerweile nicht nur die Entfernungen sondern auch die Geschwindigkeitsbegrenzungen in KM angeben, nicht mehr in Meilen. Ausserdem sollte man die zulässige Höchstgeschwindigkeit erstens nicht übertreten (wie wir uns haben sagen lassen, kann es teuer werden, wenn man sich erwischen lässt) und zweitens nicht als die empfohlene Mindestgeschwindigkeit betrachten, da die Angaben selten an die Strassenverhältnisse angepasst sind. Soll heißen: nicht überall wo 100 steht, kann man auch locker 100 fahren.
Der Busverkehr in der Republik Irland wird maßgeblich von Bus Éireann dominiert, einem staatlichen Unternehmen, das ein dichtes Netz von Regional- und Überlandverbindungen betreibt. Städte wie Dublin, Cork und Galway sind gut angebunden, und es gibt regelmäßige Verbindungen zu kleineren Orten. In Dublin betreibt Dublin Bus das städtische Netz mit einem dichten Liniennetz, während die Luas (Straßenbahn) und der DART (S-Bahn) den öffentlichen Nahverkehr ergänzen. Private Anbieter wie GoBus oder Citylink bieten schnelle Verbindungen zwischen Großstädten an, oft günstiger und schneller als Bus Éireann. Fahrkarten können online, an Automaten oder direkt im Bus gekauft werden, wobei in Dublin die Leap Card für bargeldloses Bezahlen genutzt wird. Der Busverkehr ist zuverlässig, aber auf dem Land können Verbindungen seltener sein, und Fahrpläne sollten im Voraus geprüft werden.
In Nordirland wird der Busverkehr hauptsächlich von Translink betrieben, das sowohl städtische (Metro in Belfast) als auch regionale Verbindungen (Ulsterbus) anbietet. Belfast und Derry/Londonderry sind die Hauptknotenpunkte, und das Netz deckt auch ländliche Gebiete ab, allerdings mit weniger häufigen Verbindungen. Translink betreibt zudem die Bahnverbindungen, wie die Strecke Belfast-Derry. Tickets können online, an Bahnhöfen oder im Bus gekauft werden, und es gibt Smartcards wie die Smartlink Card für regelmäßige Fahrten. Private Busunternehmen spielen in Nordirland eine kleinere Rolle, aber es gibt grenzüberschreitende Verbindungen, zum Beispiel zwischen Dublin und Belfast, die von Anbietern wie Bus Éireann oder privaten Betreibern wie Aircoach bedient werden.
Bahnverkehr
Der Schienenverkehr in Irland wird auf 2.259 km Breitspur von 1600 mm abgewickelt, davon 1.919 km in den 26 südlichen Countys der Republik Irland und 340 km in den nördlichen 6 Countys von Nordirland. Die Geschichte der Eisenbahn begann in Irland 1834, nur neun Jahre nach der weltweit ersten Eisenbahn überhaupt. Die größte Ausdehnung erreichte das Streckennetz im Jahr 1920 mit 5.600 km.
Im Norden ist die Northern Ireland Railways zuständig, im Süden die Iarnród Éireann. Beide Gesellschaften sind Tochtergesellschaften von staatlichen Transportunternehmen, zu denen auch Bus- und andere Straßentransportunternehmen gehören, Translink im Norden und Córas Iompair Éireann (CIÉ) in der Republik. Die Eisenbahn in Nordirland war nicht von der Bahnprivatisierung auf Großbritannien betroffen.
In der Republik (damals Freistaat Irland - Saorstát Éireann) wurden 1925 die verschiedenen Bahngesellschaften zur Great Southern Railways zusammengeschlossen. Diese wurde 1945 mit der Dublin United Transport Company zur jetzigen Córas Iompair Éireann (CIÉ) zusammengeschlossen.
Ausgenommen war die Great Northern Railway (Ireland), die zahlreiche Strecken betrieb, die die neue innerirische Grenze überquerten. Die Grenzkontrollen schadeten dieser Gesellschaft, die nach einem langen Niedergang im Jahre 1953 verstaatlicht wurde; die Gesellschaft war im gemeinsamen Besitz der Republik und Nordirlands. Im Mai 1958 wurde die Gesellschaft aufgelöst und zwischen der CIÉ einerseits und der Ulster Transport Authority aufgeteilt, wobei alle Arten von Fahrzeugen streng paritätisch verteilt wurden. Der Norden legte dann die meisten grenzüberschreitenden Strecken still, was schließlich CIÉ zwang, ihre jetzt im Niemandsland der Grenze endenden Streckenteile ebenfalls stillzulegen.
Von den 1919 km in der Republik sind 497 km zweigleisig, im Norden 140 km von 340 km. In der Republik Irland sind 52 km für die Vorortbahnen der Hauptstadt Dublin (DART = Dublin Area Rapid Transit) elektrifiziert, in Nordirland wird nur mit Dieselfahrzeugen gefahren. Von dem einst dicht geknüpften Netz sind nur sternförmig von der Hauptstadt Dublin aus sich verzweigende Hauptlinien übrig geblieben, und die Verbindung mit Belfast und dem dortigen kleinen Netz.
Im Jahre 2005 wurden im Norden 7,4 Millionen Passagiere befördert, ein Zuwachs von 7 % gegenüber dem Vorjahr, wobei 236 Millionen Personenkilometer geleistet wurden, ein Zuwachs von 5 % gegenüber dem Vorjahr. Im Süden waren es 37,7 Mio Passagiere mit 1.781 Personenkilometern, ein Zuwachs von jeweils 9 bzw. 13 % gegenüber dem Vorjahr.
Dublin und Belfast sind durch eine Schnellzuglinie verbunden, die unter dem Markennamen Enterprise gemeinsam von den Eisenbahngesellschaften der Republik und des Nordens betrieben wird. Grenzkontrollen finden in der informellen Common Travel Area von Irland und Großbritannien nicht statt. Montags bis samstags fahren acht Zugpaare, sonntags fünf. Die planmäßige Reisezeit beträgt ungefähr zwei Stunden.
Im Güterverkehr wurden 2004 von Iarnród Éireann noch 2,3 Millionen Tonnen mit 399 Tonnenkilometern befördert. 2005 waren es nur noch 1,5 Millionen Tonnen oder 303 Tonnenkilometer.
Nachdem 1951 die Straßenbahn in Dublin eingestellt wurde, fährt seit 2004 wieder eine neue Straßenbahn namens Luas in Dublin. Luas mit seinen zwei Linien gehört allerdings nicht zum CIÉ, sondern wird von Veolia Transport betrieben. Sie fährt auf Normalspur von 1435 mm und wird mit 750 Volt Gleichstrom versorgt.
In Dublin ist eine Untergrundbahn in Bau, die unter dem Markennamen Metro fahren wird. Zwei Linien, Metro North und Metro West sollen in Public Private Partnership entstehen. Wie die Straßenbahn wird die Metro auf Normalspur verkehren und dasselbe Stromsystem verwenden, so dass Fahrzeuge aller vier Nahverkehrslinien auf den anderen Linien verkehren könnten.
Neben dem öffentlichen Schienennetz betreibt Bord na Móna (Torfagentur) ein Schmalspurnetz (3 Fuß = 914 mm) von 1.365 km (848 Meilen), mit dem der abgebaute Torf transportiert wird. 850 km davon sind dauerhaft verlegte Gleise, der Rest wird je nach Bedarf gelegt und wieder abgebaut. Jährlich werden zirka 5 Millionen Tonnen gemahlener Torf transportiert.
Die irische Regierung verfolgt mit dem Programm Transport 21 den Ausbau des Verkehrswesens, einschließlich der Wiederbelebung stillgelegter Bahnstrecken. So wurde die 36 km lange Strecke von Ennis nach Athenry 2009 wieder eröffnet, wodurch Limerick und Galway erstmals seit 30 Jahren wieder direkt verbunden sind. Weitere Wiederaufbauprojekte und Modernisierungen im Norden und Süden sollen folgen.
Schiffsverkahr
Der Schiffsverkehr in Irland und Nordirland bildet eine zentrale Säule der Verkehrsinfrastruktur auf der Insel, die politisch in die Republik Irland und das zum Vereinigten Königreich gehörende Nordirland unterteilt ist. Trotz dieser Grenze läuft der Schiffsverkehr nahtlos und eng verknüpft, da beide Regionen von denselben Fährlinien, Häfen und Routen profitieren. Die Irische See dient als natürliche Verbindung zu Großbritannien und dem europäischen Festland, und der Verkehr umfasst Passagierfähren, Autofähren, Kreuzfahrten sowie Gütertransporte. Jährlich transportieren Fähren Millionen von Passagieren und Fahrzeugen, was die Insel für Touristen und Pendler attraktiv macht – insbesondere seit dem Brexit, der den Straßenverkehr über Landgrenzen komplizierter gestaltet hat.
Die dominanten Reedereien sind Stena Line und Irish Ferries, die regelmäßige Dienste anbieten. Von England aus starten Routen wie Holyhead (Wales) nach Dublin (zirka 3,5 Stunden), Fishguard nach Rosslare (zirka 3,5 Stunden) oder Liverpool nach Belfast (zirka 8 Stunden, oft als Nachtfähre). Diese Verbindungen sind ideal für Reisende aus dem Süden und Westen Großbritanniens und ermöglichen den Transport von Autos, Wohnmobilen und Fahrrädern. Von Schottland aus, speziell von Cairnryan, gibt es schnelle Überfahrten nach Larne oder Belfast (zirka 2–2,25 Stunden), die als kürzeste Routen nach Nordirland gelten und perfekt für Ausflüge entlang der dramatischen Causeway Coast geeignet sind. Für Anreisen vom europäischen Kontinent bieten sich Verbindungen von Frankreich aus an, wie Cherbourg oder Roscoff nach Rosslare (zirka 18 bis 20 Stunden), betrieben von Irish Ferries oder Stena Line. Insgesamt gibt es über 14 Fährlinien mit bis zu fünf Zielhäfen in Irland, die ganzjährig, mehrmals täglich, verkehren.
Zwischen Nordirland und der Republik Irland selbst ist der Schiffsverkehr weniger dominant, da Landstraßen und Züge effizienter sind. Dennoch verbinden Fähren kleinere Routen, wie von Dublin nach Belfast, und unterstützen den grenzüberschreitenden Pendlerverkehr. Für Güter ist der Schiffsverkehr entscheidend: Häfen wie Dublin und Rosslare in der Republik sowie Belfast und Larne in Nordirland handhaben Importe von Waren aus Europa und Großbritannien, darunter Lebensmittel, Maschinen und Energieprodukte. Der Hafen von Belfast ist der größte in Nordirland und verarbeitet jährlich über 20 Millionen Tonnen Fracht, während Dublin als Tor zur Republik dient.
Neben dem regulären Fährverkehr blüht der Kreuzfahrtsektor, der Irland und Nordirland als Highlights der britischen Inseln positioniert. Reedereien wie AIDA, TUI Cruises, Costa und MSC Cruises bieten Rundreisen um Großbritannien an, die Häfen wie Dublin, Cork (Cobh), Killybegs in der Republik und Belfast in Nordirland anlaufen. Diese Touren dauern typischerweise 7 bis 14 Tage und starten oft aus Hamburg, Bremerhaven oder Southampton. Im Sommer (Juni bis August) sind die Routen besonders beliebt, da die Temperaturen mild (15–20 °C) sind und Ausflüge zu ikonischen Stätten wie den Klippen von Slieve League oder dem Glenveagh-Nationalpark möglich sind. Kreuzfahrten betonen die kulturelle Vielfalt: In Dublin erkunden Gäste die Guinness-Brauerei und bunte Viertel, in Cobh die Titanic-Geschichte, in Belfast die Titanic-Werft und in Killybegs die Fischerei-Tradition. Die Schiffe bieten Annehmlichkeiten wie Restaurants, Casinos und Shows, was den Schiffsverkehr zu einem entspannten Einstieg in die grüne Insel macht.
Der Schiffsverkehr ist wetterabhängig – Stürme in der Irischen See können zu Verspätungen führen, doch moderne Schiffe wie die Stena Britannica sind stabil und komfortabel ausgestattet. Für deutsche Reisende ist die Anreise per Fähre von Hoek van Holland nach Harwich (England) eine gängige Option, gefolgt von einer Weiterfahrt. Gepäckregeln variieren je Reederei, aber Fahrzeuge sind willkommen; beachten Sie den Linksverkehr in Irland und Nordirland. Währung: Euro in der Republik, Pfund Sterling in Nordirland. Seit April 2025 ist für Nordirland ein digitales Visum (ETA) erforderlich, während die Republik EU-Regeln folgt – ein Personalausweis reicht für Irland, aber ein Pass wird für Nordirland empfohlen.
Luftverkehr
Irland hat internationale Flughäfen in Dublin, im County Donegal in Carrickfinn, im County Kerry in Farranfore, im County Clare in Shannon sowie in Galway, Cork und Knock, die von Austrian, der Lufthansa, Swiss, Ryanair, TUIfly und der einheimischen Fluggesellschaft Aer Lingus angeflogen werden. Ebenso existiert eine Inlandsfluglinie, die Aer Arann. Dazu sind noch zahlreiche lokale Flughäfen vorhanden.
| Stadt | County | ICAO | IATA | Name |
| Zivile Flughäfen | ||||
| Inverin, Connemara | County Galway | EICA | NNR | Connemara Regional Airport Inverin |
| Cork | County Cork | EICK | ORK | Flughafen Cork |
| Carrickfin | County Donegal | EIDL | CFN | Flughafen Donegal |
| Dublin | County Dublin | EIDW | DUB | Flughafen Dublin |
| Carnmore | County Galway | EICM | GWY | Flughafen Galway |
| Farranfore | County Kerry | EIKY | KIR | Flughafen Kerry |
| Knock | County Mayo | EIKN | NOC | Flughafen Knock |
| Leixlip | County Kildare | EIWT | Flughafen Weston | |
| Shannon (Irland) | County Clare | EINN | SNN | Flughafen Shannon |
| Strandhill, nahe Sligo | County Sligo | EISG | SXL | Flughafen Sligo |
| Waterford | County Waterford | EIWF | WAT | Flughafen Waterford |
| Militärische Flughäfen | ||||
| Bundoran | County Donegal | EIFR | Finner Camp (Heliport) | |
| Dublin | County Dublin | EIME | Flughafen Baldonnel | |
Der Dublin Airport wurde 1940 eröffnet, ursprünglich als Militärflugplatz Collinstown. Der erste kommerzielle Flug startete am 19. Januar 1940. Während des Zweiten Weltkriegs diente der Flughafen hauptsächlich militärischen Zwecken, doch nach 1945 begann der zivile Ausbau. In den 1950er Jahren wuchs der Flughafen durch den zunehmenden Transatlantikverkehr, unterstützt durch die strategische Lage Irlands. Die Eröffnung des ersten Terminals (heute Terminal 1) erfolgte 1972, während Terminal 2 im Jahr 2010 hinzukam, um die wachsende Passagierzahl zu bewältigen. Heute ist Dublin Airport der größte Flughafen Irlands und ein wichtiger Transatlantik-Hub, der 2019 rund 32 Millionen Passagiere verzeichnete. Trotz pandemiebedingter Rückgänge erholt sich der Flughafen seit 2023 stark, mit Plänen für weitere Erweiterungen trotz Kapazitätsbeschränkungen.
Der Flughafen liegt etwa 10 km nördlich von Dublin in Collinstown und wird von der Dublin Airport Authority (daa) betrieben. Er verfügt über zwei Start- und Landebahnen (10/28 und 16/34), wobei die Hauptbahn 10/28 für die meisten Flüge genutzt wird. Dublin hat zwei Terminals:
- Terminal 1: Hauptsächlich für Low-Cost-Airlines wie Ryanair, mit zahlreichen Check-in-Schaltern, Sicherheitskontrollen, Geschäften und Restaurants.
- Terminal 2: Modern, eröffnet 2010, für Aer Lingus und Langstreckenflüge, mit hochwertigen Einrichtungen wie Lounges und großzügigen Wartebereichen. Zu den Einrichtungen gehören umfangreiche Duty-Free-Shops (The Loop), Restaurants, kostenloses WLAN, Autovermietungen und nahegelegene Hotels wie das Maldron Hotel. Parkmöglichkeiten umfassen Kurz- und Langzeitparkplätze mit Shuttlebussen.
Dublin Airport bedient über 190 Destinationen weltweit, darunter europäische Städte (London, Paris, Amsterdam), Nordamerika (New York, Chicago, Toronto) und den Nahen Osten (Dubai, Doha). Über 40 Fluggesellschaften operieren hier, darunter Aer Lingus, Ryanair, American Airlines und Emirates. Der Flughafen bietet eine U.S. Preclearance, die Passagieren ermöglicht, US-Einreiseformalitäten vor dem Abflug zu erledigen. Dublin Bus und Aircoach verbinden den Flughafen in 20 bis 30 Minuten mit der Stadt. Eine Metrolinie (MetroLink) ist geplant, aber erst nach 2030 fertiggestellt.
Dublin Airport ist bekannt für seine U.S. Preclearance, die Zeit bei der Einreise in die USA spart. Der Flughafen investiert in Nachhaltigkeit, etwa durch CO₂-Reduktion und energieeffiziente Gebäude. Aufgrund der Kapazitätsgrenze von 32 Millionen Passagieren pro Jahr gibt es Diskussionen über Erweiterungen oder Einschränkungen. Der Flughafen ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Irland und ein Drehkreuz für Transatlantikflüge.
| Airlines | Ziele |
| Aegean Airlines | saisonal: Athen |
| Aer Lingus | Alicante, Amsterdam, Barcelona, Berlin–Tegel, Bilbao, Birmingham, Bordeaux, Boston, Brussels, Budapest, Chicago–O'Hare, Düsseldorf, Faro, Frankfurt, Fuerteventura, Geneva, Gran Canaria, Hamburg, Hartford, Lanzarote, Lissabon, London–Gatwick, London–Heathrow, Los Angeles, Lyon, Madrid, Málaga, Manchester, Miami, Mailand–Linate, Mailand–Malpensa, München, New York–JFK, Newark, Orlando, Paris–Charles de Gaulle, Philadelphia, Prag, Rom–Fiumicino, San Francisco, Seattle/Tacoma, Tenerife–Süd, Toronto–Pearson, Venedig, Verona, Wien, Washington–Dulles, Zürich, saisonal: Athen, Bologna, Burgas, Catania, Korfu, Dubrovnik, İzmir, Marseille, Montpellier, Murcia, Nantes, Neapel, Nice, Palma de Mallorca, Perpignan, Pisa, Pula, Santiago de Compostela, Split, Stuttgart, Toulouse, saisonal (Charter): Reykjavík–Keflavík, Rovaniemi, Salzburg |
| Aer Lingus Regional | Aberdeen, Birmingham, Bristol, Donegal, Edinburgh, Glasgow, Isle of Man, Kerry, Leeds/Bradford, Manchester, Newcastle upon Tyne, Newquay, saisonal: Jersey, Rennes |
| Air Arabia Maroc | Agadir |
| Air Canada | Toronto–Pearson, saisonal: Montréal–Trudeau |
| Air Canada Rouge | saisonal: Vancouver |
| Air Europa | saisonal (Charter): Palma de Mallorca |
| Air France | Paris–Charles de Gaulle |
| Air Moldova | Chișinău |
| Air Transat | saisonal: Toronto–Pearson |
| AlbaStar | saisonal (Charter): Palma de Mallorca, Reus, Verona |
| American Airlines | Philadelphia, saisonal; Charlotte, Chicago–O'Hare, New York–JFK |
| Arkia | saisonal: Tel Aviv–Ben Gurion |
| ASL Airlines France | saisonal: Halifax, Paris–Charles de Gaulle |
| ASL Airlines Ireland | saisonal (Charter): Burgas, Dubrovnik, Neapel, Palma de Mallorca, Reus, Salzburg, Verona |
| Blue Air | Bacău, Bukarest, Cluj-Napoca |
| British Airways | London–City, London–Heathrow, saisonal: Manchester |
| Cathay Pacific | Hong Kong |
| CityJet | London–City, saisonal (Charter): Alghero, Menorca |
| Cobalt Air | Larnaka |
| Croatia Airlines | saisonal: Zagreb (ab 3. Mai 2018) |
| Danish Air Transport | saisonal: Odense (Charter) |
| Delta Air Lines | New York–JFK, saisonal: Atlanta, Boston |
| Eurowings | Köln/Bonn, Düsseldorf |
| Emirates | Dubai–International |
| Ethiopian Airlines1 | Addis Ababa, Los Angeles |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| Finnair | Helsinki |
| Flybe | Cardiff, Doncaster/Sheffield, Exeter, London–Southend, Southampton |
| FlyOne | Chișinău |
| Iberia Express | Madrid |
| Icelandair | Reykjavík–Keflavík |
| KLM | Amsterdam |
| Loganair | Inverness |
| Lufthansa | Frankfurt, München |
| Luxair | Luxemburg, saisonal (Charter): Faro |
| Norwegian Air Shuttle | Kopenhagen, Helsinki, Newburgh, Oslo–Gardermoen, Providence, Stockholm–Arlanda |
| Qatar Airways | Doha |
| Ryanair | Alicante, Amsterdam, Barcelona, Basel/Mulhouse, Beauvais, Bergamo, Berlin–Schönefeld, Birmingham, Bologna, Bratislava, Bristol, Brüssel, Bukarest, Budapest, Bydgoszcz, Carcassonne, Charleroi, Köln/Bonn, Kopenhagen, East Midlands, Edinburgh, Eindhoven, Faro, Fuerteventura, Gdańsk, Glasgow, Gran Canaria, Hahn, Hamburg, Katowice, Kaunas, Kraków, Lanzarote, Leeds/Bradford, Lissabon, Liverpool, Łódź, London–Gatwick, London–Luton, London–Stansted, Madrid, Málaga, Malta, Manchester, Memmingen, München, Murcia, Neapel, Nantes, Newcastle upon Tyne, Nice, Paphos, Pisa, Porto, Poznań, Prag, Riga, Rom–Ciampino, Rzeszów, Seville, Sofia, Stuttgart, Szczecin, Tenerife–Süd, Tours, Treviso, Valencia, Vilnius, Warsaw–Modlin, Wrocław, saisonal: Almería, Athen, Bari, Bremen, Biarritz, Chania, Comiso, Girona, Grenoble, Ibiza, La Rochelle, Lublin, Palermo, Palma de Mallorca, Reus, Rodez, Salzburg, Santander, Tallinn, Turin, Vigo, Zadar |
| S7 Airlines | saisonal (Charter): Moskau–Domodedowo |
| Scandinavian Airlines | Kopenhagen, Oslo–Gardermoen, Stockholm–Arlanda |
| SunExpress | saisonal (Charter): İzmir |
| Swiss International Air Lines | Genf, Zürich |
| Transavia France | Paris–Orly |
| Travel Service | saisonal (Charter): Lanzarote |
| TUI Airways | saisonal (Charter): Burgas, Cancún, Chambéry, Korfu, Faro, Gran Canaria, Heraklion, Ibiza, Innsbruck, Kos, Lanzarote, Palma de Mallorca, Rhodos, Rovaniemi, Tenerife–Süd, Turin, Zakynthos |
| Turkish Airlines | Istanbul–Atatürk |
| United Airlines | Newark, saisonal: Chicago–O’Hare, Washington–Dulles |
| Vueling | Barcelona |
| WestJet | saisonal: St. John’s, Toronto–Pearson |
| WOW air | Reykjavík–Keflavík |
Dublin Airport
- irischer Name: Aerfort Bhaile Átha Cliath
- Code: DUB / EIDW
- Lage: 53°25‘17“ N, 6°16‘12“ W
- Seehöhe: 74 m (242 ft)
- Entfernung: 10 km nördlich des Stadtzentrums von Dublin
- Inbetriebnahme: 19. Januar 1940
- Betreiber: Dublin Airport Authority
- Terminals: 2
- Rollbahnen: 3
- Länge der Rollbahnen: 2637 m (Beton), 2072 m und 1339 m (beide Asfalt)
- Fluggesellschaften: 51
- Flugzeug-Standplätze: ca. 150
- jährliche Passagierkapazität: ca. 30 mio.
- jährliche Frachtkapazität: ca. 150.000 t
- Flughafen-Statistik: Jahr Flugbewegungen Passagiere Fracht in t
1998 162 086 11 641 100
1999 170 421 12 802 031
2000 180 245 13 843 528
2001 185 702 14 333 555
2002 181 874 15 084 667
2003 177 781 15 856 084
2004 182 175 17 138 373
2005 186 838 18 450 439 64 100
2006 196 641 21 196 382 107 200
2007 211 804 23 287 438 111 000
2008 211 890 23 466 711 107 300
2009 176 811 20 503 677 97 300
2010 160 320 18 431 064 105 300
2011 162 016 18 740 593 101 900
2012 163 670 19 099 649 111 100
2013 170 357 20 166 783 113 482
2014 180 334 21 711 967 127 448
2015 197 870 25 049 319 137 267
2016 215 078 27 907 384 134 207
2017 223 197 29 582 308 144 913
2018 233 185 31 495 604 143 708
2019 238 998 32 911 227 133 229
2020 80 500 7 267 200 123 200
2021 82 500 8 266 300 144 300
2022 199 500 27 793 300 142 400
2023 229 800 ee 262 900 152 800
Der Belfast International Airport, früher Aldergrove Airport, wurde 1917 als Militärflugplatz für das Royal Flying Corps gegründet. Während des Zweiten Weltkriegs spielte er eine wichtige Rolle für die Royal Air Force. Nach dem Krieg begann der zivile Betrieb, und 1963 wurde der Flughafen für kommerzielle Flüge geöffnet. In den 1980er-Jahren wuchs er durch den Aufstieg von Low-Cost-Airlines wie easyJet und Ryanair. 1998 wurde der Flughafen privatisiert und ist heute im Besitz von Vinci Airports. Mit etwa 6 Millionen Passagieren jährlich (vor der Pandemie) ist er der zweitgrößte Flughafen Nordirlands. Seit 2023 erholt sich der Verkehr, bleibt aber unter dem Vor-Pandemie-Niveau.
Der Flughafen liegt 21 km nordwestlich von Belfast in Aldergrove und verfügt über eine Hauptstart- und Landebahn (07/25). Er hat ein einziges, funktionales Terminal mit Check-in-Schaltern, Sicherheitskontrollen, einigen Duty-Free-Shops, Cafés und Restaurants. Die Auswahl an Einrichtungen ist kleiner als in Dublin, aber ausreichend für die Passagierzahl. Es gibt kostenloses WLAN, eine Lounge, Autovermietungen (unter anderem Hertz und Avis) und das Maldron Hotel in der Nähe. Parkmöglichkeiten umfassen Kurz- und Langzeitparkplätze mit Shuttlebussen.
Belfast International konzentriert sich auf europäische Ziele, insbesondere Ferienorte in Spanien, Portugal und Italien, sowie Flüge innerhalb des Vereinigten Königreichs. Hauptsächlich operieren Low-Cost-Airlines wie easyJet, Ryanair und Jet2. Langstreckenflüge gibt es nicht. Der Airport Express 300 fährt in 30 bis 40 Minuten ins Stadtzentrum.
Der Flughafen ist auf preisbewusste Reisende ausgerichtet und bietet eine kompakte, übersichtliche Infrastruktur. Seine Lage weiter außerhalb macht ihn weniger praktisch für Geschäftsreisende, aber ideal für Urlaubsflüge. Die begrenzte Größe führt zu einem kleineren Angebot an Dienstleistungen im Vergleich zu Dublin.
| Airlines | Ziele |
| Aer Lingus | London–Heathrow, saisonal: Faro, Málaga,Verona |
| British Airways | London–Heathrow |
| Flybe | Aberdeen, Birmingham, Cardiff, East Midlands, Edinburgh, Exeter, Glasgow, Inverness, Leeds/Bradford, Liverpool, London–City, Manchester, Southampton, saisonal: Newquay, Salzburg |
| Flybe bzw. Eastern Airways | Isle of Man, Newcastle |
| Icelandair bzw. Air Iceland Connect | Reykjavík-Keflavík |
| KLM bzw. KLM Cityhopper | Amsterdam |
George Best Belfast City Airport
- Code: BHD / EGAC
- Lage: 54°37‘05“ N, 5°52‘21“ W
- Seehöhe: 5 m (16 ft)
- Entfernung: 3,2 km von Belfast
- Inbetriebnahme: 1937
- Betreiber: Ferrovial
- Terminal: 1
- Rollbahn: 1
- Länge der Rollbahn: 1829 m (Asfalt)
- Fluggesellschaften: 6
- Flugzeug-Standplätze: ca. 90
- jährliche Passagierkapazität:
- jährliche Frachtkapazität:
- Flughafen-Statistik: Jahr Flugbewegungen Passagiere Fracht in t
2000 41.256 3.147.670 30.599
2001 45.706 3.618.671 32.130
2002 38.453 3.576.785 29.474
2003 39.894 3.976.703 29.620
2004 43.373 4.407.413 32.148
2005 47.695 4.824.271 37.878
2006 48.412 5.038.692 38.417
2007 51.085 5.272.664 38.429
2008 55.000 5.262.354 36.115
2009 44.796 4.546.475 29.804
2010 40.324 4.016.170 29.716
2011 57.460 4.103.620 31.062
2012 58.011 4.313.685 29.095
2013 54.003 4.023.336 29.288
2014 50.973 4.033.954 30.073
2015 52.246 4.391.307 30.389
2016 55.155 5.147.546 7.597
2017 58.152 5.836.552 12.308
2018 60.541 6.269.025 27.672
2019 47.230 6.278.563 25.095
2020 19.416 1.747.086 27.946
2021 24.008 2.328.276 28.225
2022 38.489 4.818.214 23.526
2023 57.761 5.957.055 22.280
Der Flughafen Shannon (englisch Shannon International Airport, irisch Aerfort na Sionna) liegt im Westen Irlands am Fluss Shannon, nahe der Stadt Shannon und 24 km von Limerick entfernt. Er entstand in den 1930er Jahren, als Irland den transatlantischen Luftverkehr ausbauen wollte. 1937 erfolgte der erste Flug von Neufundland, 1939 ein Testflug zum neuen Flugplatz Rineanna. Trotz des Zweiten Weltkriegs wurde der Flughafen weiterentwickelt und spielte nach 1945 eine zentrale Rolle im Transatlantikverkehr. Am 16. September 1945 startete der erste Linienflug von Gander (Neufundland). Wegen der begrenzten Reichweite damaliger Flugzeuge diente Shannon bis in die 1960er Jahre als wichtiger Zwischenstopp. Mit Einführung von Langstreckenjets verlor er jedoch an Bedeutung als Drehkreuz.
Heute bietet Shannon neben regionalen Verbindungen zahlreiche Flüge nach Nordamerika, unter anderem nach New York, Boston und Philadelphia. British Airways nutzt ihn als Tank- und Einreisestopp auf der Strecke London City – New York. Bis 2006 war der Flughafen ein wichtiger Transitpunkt für US-Truppentransporte in den Nahen Osten und diente während des Space-Shuttle-Programms der NASA als Notlandeplatz. Eine Bahnverbindung gibt es nicht; Busse, Taxis und Mietwagen stellen den Anschluss an Städte wie Limerick, Ennis und Galway sicher.
| Airlines | Ziele |
| Aer Lingus | London–Heathrow, New York–JFK, saisonal: Boston, Faro, Lanzarote, Málaga |
| Aer Lingus Regional | Birmingham, Edinburgh |
| Air Canada | saisonal: Toronto–Pearson |
| Air Europa | saisonal (Charter): Lanzarote, Palma de Mallorca |
| American Airlines | saisonal: Philadelphia |
| Austrian Airlines | saisonal (Charter): Wien |
| Cello Aviation | saisonal (Charter): Reus |
| Delta Air Lines | saisonal: New York–JFK |
| Helvetic Airways | saisonal: Zürich |
| Lufthansa | saisonal: Frankfurt |
| Norwegian Air Shuttle | Newburgh, saisonal: Providence |
| Ryanair | Fuerteventura, Kaunas, Kraków, Lanzarote, London–Gatwick, London–Stansted, Málaga, Manchester, Tenerife–Süd, Warschau–Modlin, Wrocław, saisonal: Alicante, Bristol, Faro, Liverpool, Palma de Mallorca, Reus |
| United Airlines | saisonal: Newark |
Shannon International Airport
- irischer Name: Aerfort na Sionna
- Code: SNN / EINN
- Lage: 52°42‘07“ N, 8°55‘29“ W
- Seehöhe: 14 m (46 ft)
- Entfernung: 3 km südwestlich von Shannon, 24 km westlich von Limerick
- Inbetriebnahme:
- Betreiber: Shannon Airport Authority
- Terminal: 1
- Rollbahnen: 4 (3 sind geschlossen)
- Länge der Rollbahnen: 3199 m (Asfalt), geschlossen 1970: 1720 m, 1713 m und 1465 m
- Fluggesellschaften: 13
- Flugzeug-Standplätze: ca. 80
- jährliche Passagierkapazität:
- jährliche Frachtkapazität:
- Flughafen-Statistik: Jahr Flugbewegungen Passagiere Fracht in t
2005 45.093 3.302.424 29.300
2006 46.715 3.639.046 31.100
2007 48.114 3.620.623 27.000
2008 42.359 3.169.529 23.200
2009 34.966 2.794.563 18.900
2010 27.382 1.755.885 20.000
2011 27.846 1.625.453 16.600
2012 24.264 1.394.781 16.100
2013 12.648 1.400.032 13.921
2014 15.605 1.639.315 10.886
2015 16.692 1.714.872 12.270
2016 13.604 1.748.935 12.591
2017 13.229 1.751.500 18.998
2018 13.699 1.677.661 13.592
2019 12.658 1.616.422 12.658
Wirtschaft
Irland, einst als „Armenhaus Europas“ bekannt, erlebte in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren ein beispielloses Wirtschaftswachstum und entwickelte sich zu einem der wohlhabendsten Länder der EU. 2005 lag das inflationsbereinigte Pro-Kopf-Einkommen nach Luxemburg an zweiter Stelle in der EU und rund 31 % über dem deutschen Niveau. Aufgrund dieser dynamischen Entwicklung erhielt Irland den Spitznamen „Keltischer Tiger“. Der gesetzliche Mindestlohn liegt bei Vollzeitbeschäftigten über 1.180 Euro monatlich, während die Körperschaftsteuer nach einer Absenkung zur Anwerbung ausländischer Unternehmen bei 12,5 % liegt – weiterhin einer der niedrigsten Werte in der EU.
Die Finanzkrise ab 2007 traf Irland besonders hart, da der Wohlstand stark auf einer Immobilienblase und spekulativen Finanzgeschäften beruhte. Gleichzeitig ist die irische Wirtschaft stark von ausländischen Direktinvestitionen abhängig, insbesondere aus den USA. Die hohe Verschuldung des Finanzsektors machte sich deutlich bemerkbar: Die Summe ausstehender Kredite, Derivate und Hypothekendarlehen überstieg nahezu das Vierfache des Bruttoinlandsprodukts. Viele Haushalte gerieten durch fallende Immobilienpreise in finanzielle Schwierigkeiten, und zahlreiche Industrieunternehmen verlagerten ihre Produktion ins Ausland, insbesondere nach Osteuropa, um von niedrigeren Lohnkosten zu profitieren. Die Arbeitslosenquote stieg von über 8 % Ende 2008 auf über 12 % Ende 2009, während das BIP 2008 um 1,7 % sank. Zudem trat die erste Deflation seit 1960 auf, was die wirtschaftliche Lage zusätzlich verschärfte.
Ein wesentlicher Faktor für Irlands wirtschaftlichen Aufschwung war die Ansiedlung internationaler Unternehmen. Konzerne wie IBM, Intel, Hewlett-Packard, Symantec, Dell und Microsoft nutzten die steuerlichen Vorteile des Landes und beschäftigten bereits 2003 mehr als 1 % der Bevölkerung. Besonders der Informations- und Kommunikationstechnologiesektor trug erheblich bei: 2003 erzielten die Exporte in diesem Bereich über 21 Mrd. Euro, das entspricht 26 % der Gesamtexporte. Auch heute bleibt Irland ein attraktiver Standort für ausländische Direktinvestitionen, insbesondere in den Bereichen Pharma- und Medizintechnik, Software, Kommunikationsindustrie, Servicezentren sowie Forschung und Entwicklung. Die USA sind mit rund 70 % der Arbeitsplätze, die durch ausländische Direktinvestitionen geschaffen werden, der bedeutendste Investor.
Darüber hinaus haben viele europäische Finanzunternehmen Niederlassungen in Irland eingerichtet. Unter den 35 größten Banken des Landes befanden sich 2007 allein 15 deutsche Institute. So verlegte beispielsweise die Depfa-Bank, eine Tochter der Hypo Real Estate, ihre Hauptniederlassung nach Irland.
Landwirtschaft
Die Landwirtschaft auf der Insel Irland hat eine lange und reiche Geschichte, die bis in die Jungsteinzeit zurückreicht, als die ersten Bewohner Tierhaltung und Getreideanbau einführten. Mit einer Fläche, die etwa der von South Carolina entspricht, umfasst die Insel die Republik Irland und Nordirland, wobei über 80 Prozent des Landes für Weiden und Heuproduktion genutzt werden, während weniger als 10 Prozent für Ackerbau dienen. Das gemäßigte maritime Klima, beeinflusst vom Golfstrom, ermöglicht ganzjähriges Graswachstum, was die Grundlage für eine extensive Viehwirtschaft bildet. In der Republik Irland, die den Großteil der Insel ausmacht, ist die Landwirtschaft ein Eckpfeiler der Wirtschaft, mit einem Fokus auf Milch- und Rindfleischproduktion, während Nordirland ähnliche Strukturen aufweist, aber historisch eine geringere Beschäftigungsquote in diesem Sektor hatte.
Historisch gesehen begann die intensive Bewirtschaftung zwischen -4000 und -2500 mit der Domestizierung von Rindern und Schafen sowie dem Anbau von Gerste und Weizen. Im Mittelalter dominierten Hafer und Gerste, ergänzt durch Weizen, Flachs und Hülsenfrüchte. Die Große Hungersnot von 1845–1848, verursacht durch Kartoffelfäule, führte zu massiven Verlusten und Emigration, wodurch die Kartoffelanbaufläche dramatisch schrumpfte und die Landwirtschaft sich stärker auf Viehzucht verlagerte. Nach der Teilung 1922 verfolgten die beiden Teile unterschiedliche Politiken: Die Irische Freistaat (heutige Republik) führte protektionistische Maßnahmen ein, die zu Handelskonflikten mit dem Vereinigten Königreich führten, während Nordirland enger an britische Strukturen gebunden blieb. Im 20. Jahrhundert verschob sich der Fokus von Ackerbau zu Weidewirtschaft, was die Dominanz der Viehzucht verstärkte.
Die Hauptsäulen der irischen Landwirtschaft sind die Milch- und Fleischproduktion. Mit über 1,55 Millionen Milchkühen produziert Irland jährlich mehr als 5,4 Milliarden Liter Milch, hauptsächlich in grasbasierten Systemen, die kosteneffizient und nachhaltig sind. Über 90 Prozent der Milchprodukte werden exportiert, vor allem in die EU und das Vereinigte Königreich. Die Rindfleischproduktion umfasst 6,6 Millionen Rinder, darunter 0,9 Millionen Mutterkühe, was Irland zur drittgrößten Rinderherde in Europa macht. Etwa 90 Prozent des Rindfleischs werden exportiert, mit einem Wert von rund 2,1 Milliarden Euro. Schafzucht ist ebenfalls bedeutend, mit 4 Millionen Schafen, die Lammfleisch im Wert von 420 Millionen Euro erzeugen. Der Ackerbau konzentriert sich auf Getreide wie Weizen, Gerste und Hafer auf etwa 300.000 Hektar, mit hohen Erträgen wie 175 Bushel Weizen pro Acre. Kartoffeln bleiben ein Grundnahrungsmittel, doch Irland importiert mehr, als es exportiert. Andere Sektoren umfassen Schweine-, Geflügel- und Pilzproduktion, wobei der Zuckerrübenanbau eingestellt wurde.
Wirtschaftlich trägt die Landwirtschaft erheblich zur irischen Wirtschaft bei. In der Republik Irland waren 2020 etwa 164.400 Personen (7,1 Prozent der Belegschaft) in der Landwirtschaft beschäftigt, und die Agri-Food-Exporte erreichten 2021 ein Rekordhoch von 13,5 Milliarden Euro. Die Insel exportiert 80–90 Prozent ihrer Rind- und Milchprodukte, während sie 80 Prozent ihres Tierfutters, Lebensmittels und Getränkebedarfs importiert, hauptsächlich aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich und den Niederlanden. Die USA sind der vierthäufigste Lieferant, mit Exporten von 808,3 Millionen Dollar im Jahr 2022, einschließlich Futtermitteln und Zutaten. Nordirland integriert sich in die britische Wirtschaft, doch die Landwirtschaft bleibt inselweit für wirtschaftliche Entwicklung entscheidend, mit einem Beitrag von 7,5 Prozent zum BIP in einigen Bericht
Landwirtschaftliche Nutzfläche Republik Irland 2005 in ha:
insgesamt 4 435 700
davon Dauergrünland 3 016 600
Ackerland 1 142 400
Forstfläche 121 200
sonstiges 152 400
Viehbestand: 2005 2007
Gefl+gel 12 300 000 12 180 000
Rinder 6 849 600 5 934 700
Schafe 6 218 100 3 530 500
Schweine 1 660 300 1 574 600
Pferde 78 900 .
Ziegen 11 200 .
Weinbau
Weinbau ist nicht unbedingt etwas, was man mit der „grünen Insel“ in Verbindung bringt. Tatsächlich aber spielt „irischer Wein“ eine zunehmend interessante Rolle in der europäischen Weinlandschaft. Aufgrund des feucht-milden Klimas und der geringen Zahl an Sonnenstunden war der Anbau von Weinreben dort lange Zeit kaum möglich. Dennoch lässt sich feststellen, dass Irland schon in früheren Jahrhunderten Berührungspunkte mit dem Wein hatte: Bereits im Mittelalter pflegten Mönche in Klostergärten kleine Weinstöcke, meist für sakrale Zwecke. Ein eigentlicher Weinbau, wie man ihn aus südlicheren Ländern kennt, entstand jedoch nie, da das Klima zu kühl und zu regnerisch war. Erst im 20. und vor allem im 21. Jahrhundert begannen einige experimentierfreudige Landwirte und Hobbywinzer, erneut Reben auf irischem Boden zu pflanzen, um herauszufinden, ob der Weinbau unter den sich wandelnden klimatischen Bedingungen möglich sein könnte.
Das irische Klima ist maritim geprägt: Die Winter sind mild, die Sommer eher kühl, und es fällt über das ganze Jahr hinweg viel Niederschlag. Diese Bedingungen erschweren den Reifeprozess der Trauben, da zu wenig Wärme und Sonnenschein vorhanden sind, um die Zuckerbildung und Aromenentwicklung optimal zu fördern. Zudem begünstigt die hohe Luftfeuchtigkeit Pilzkrankheiten wie Mehltau oder Botrytis, die den Reben stark zusetzen können. Dennoch gibt es Regionen auf der Insel, die sich durch günstige Mikroklimata etwas besser eignen, insbesondere im Süden und Südosten, etwa in den Grafschaften Cork, Waterford und Wicklow. Dort profitieren die Reben von leicht höheren Durchschnittstemperaturen, etwas mehr Sonnenschein und gut drainierten Böden, die Staunässe verhindern.
Die meisten irischen Winzer setzen auf widerstandsfähige Hybridreben oder sogenannte PIWI-Sorten (pilzwiderstandsfähige Rebsorten), die weniger anfällig für Krankheiten sind und auch mit kühleren Temperaturen gut zurechtkommen. Dazu gehören Sorten wie Solaris, Rondo oder Regent, die in Nord- und Mitteleuropa schon länger erprobt sind. Diese Reben ermöglichen es, trotz des schwierigen Klimas, Trauben von ausreichender Qualität zu ernten. In einigen Fällen wird der Anbau auch in Gewächshäusern oder unter Folientunneln betrieben, um die Pflanzen vor Regen und Wind zu schützen und die Reifezeit zu verlängern.
Da die Bedingungen für kräftige Rotweine kaum gegeben sind, konzentrieren sich viele irische Winzer auf die Herstellung leichter Weißweine, frischer Rosés oder Schaumweine. Besonders Letztere finden Anklang, da das natürliche Säureprofil der irischen Trauben gut zu spritzigen, frischen Schaumweinen passt. Einige Betriebe experimentieren zudem mit Fruchtweinen, zum Beispiel aus Erdbeeren, Heidelbeeren oder Schwarzen Johannisbeeren, die unter dem Etikett „Irish wine“ vermarktet werden, auch wenn sie streng genommen keine Traubenweine sind.
Zu den bekanntesten irischen Weingütern gehören heute kleine Betriebe wie Lusca Vineyards nahe Dublin oder Wicklow Way Wines, die sich auf innovative Fruchtweine spezialisiert haben. In County Cork gibt es ebenfalls vereinzelte Weinbauversuche, häufig als Teil größerer landwirtschaftlicher Betriebe oder touristischer Projekte. Diese Produzenten arbeiten oft mit großem Idealismus, da die Mengen sehr gering und die Produktionskosten hoch sind. Viele verkaufen ihre Weine direkt vor Ort, bei Veranstaltungen oder über lokale Märkte.
Die Nachfrage nach lokalem Wein wächst in Irland langsam, was nicht zuletzt am zunehmenden Interesse an nachhaltigen, handwerklichen Produkten liegt. Touristen und Einheimische gleichermaßen schätzen es, regionale Spezialitäten zu probieren, und Weinproben oder Führungen durch kleine Weingüter werden immer beliebter. Dennoch bleibt die wirtschaftliche Bedeutung des irischen Weinbaus gering, da der heimische Markt fast ausschließlich von Importweinen aus Ländern wie Frankreich, Spanien, Italien oder Chile beherrscht wird.
Mit dem fortschreitenden Klimawandel könnten sich die Voraussetzungen für den Weinbau in Irland jedoch langfristig verbessern. Steigende Durchschnittstemperaturen und längere Vegetationsperioden bieten künftig bessere Bedingungen für die Reifung von Trauben. Schon heute zeigen Versuche, dass sich an bestimmten Standorten beachtliche Ergebnisse erzielen lassen. Gleichzeitig bleibt der Weinbau auf der Insel eine Herausforderung, die viel Experimentierfreude, technische Innovation und Durchhaltevermögen erfordert.
Fischerei
Die Fischerei ist in Irland und Nordirland sowohl ein beliebtes Freizeitvergnügen als auch ein bedeutender Wirtschaftszweig. Die Insel, umgeben von über 5.600 km Küstenlinie und beeinflusst durch den Golfstrom, bietet ein reichhaltiges Ökosystem mit vielfältigen Fischarten in Flüssen, Seen und dem Meer. Die politische Teilung – Republik Irland als EU-Mitglied und Nordirland als Teil des Vereinigten Königreichs – führt zu unterschiedlichen Regelungen für Freizeit- und kommerzielle Fischerei, die jedoch in grenzüberschreitenden Gewässern wie Foyle und Carlingford Lough durch die Loughs Agency gemeinsam verwaltet werden.
Irland gilt als eines der besten Angelziele Europas, dank seiner unberührten Gewässer und vielfältigen Fischbestände. Für die meisten Arten wie Forelle, Hecht, Barsch oder Weißfische ist das Angeln in der Republik Irland und Nordirland kostenlos, jedoch sind für Lachs und Meerforelle Lizenzen erforderlich. In der Republik Irland, reguliert durch Inland Fisheries Ireland (IFI), kostet eine Tageslizenz für Lachs und Meerforelle etwa 36 €, eine 21-Tages-Lizenz 50 € und eine Jahreslizenz 100 €. Zusätzlich können für bestimmte Flüsse Tageskarten (zirka 10 bis 20 €) nötig sein. In Nordirland, unter der Aufsicht des Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs (DAERA), kostet eine zweiwöchige Lizenz für Lachs und Meerforelle etwa 25 £, während andere Arten wie Forelle, Hecht oder Barsch ohne Lizenz geangelt werden dürfen.
Es gibt strikte Regeln zum Schutz der Fischbestände: In der Republik Irland ist pro Person und Tag nur ein Hecht bis 50 cm erlaubt, in Nordirland einer bis 4 kg. Aalfischerei ist verboten, Würmer als Köder sind vielerorts untersagt, und widerhakenlose Haken sind Pflicht. Catch & Release wird stark empfohlen, um die Nachhaltigkeit zu fördern. Beliebte Angelregionen sind die Westküste (Mayo, Clare, Donegal) für Meeresangeln, Flüsse in Galway und Mayo für Lachs sowie Küstenorte wie Rathmullan oder Westport. Die beste Zeit für Dorsch ist Mai bis Juni, für Küstenangeln Dezember bis Januar, und im Sommer ist Haifischerei an der Süd- und Westküste populär. Hausboot- oder Chartertouren bieten sich für Familien oder geführte Trips an, und EU-Bürger benötigen lediglich einen Personalausweis, sollten aber Brexit-bedingte Änderungen für Grenzgewässer prüfen.
Die Gewässer bieten eine beeindruckende Vielfalt: Im Süßwasser finden sich Lachs, Brown Trout, Hecht und Barsch, während im Meer über 80 Arten vorkommen, darunter Dorsch (bis 28 kg), Wolfsbarsch, Lippfisch, Rochen (zum Beispiel Nagelrochen bis 9 kg) und Haie. Der Golfstrom ermöglicht auch das Vorkommen von Warmwasserarten wie Rotbrachse, was Irland zu einem einzigartigen Angelziel macht.
Die kommerzielle Fischerei ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, insbesondere in der Republik Irland, wo sie etwa 2,83 % der EU-Fangtonnage ausmacht. Killybegs im Nordwesten ist der größte Fischereihafen, spezialisiert auf Dorsch, Schellfisch und Makrelen, die hauptsächlich exportiert werden, etwa ins Vereinigte Königreich. Doch die Branche steht vor Herausforderungen: EU-Fangquoten und Billigimporte aus Nicht-EU-Ländern drücken die Preise um bis zu 40 %, und Brexit hat die Bürokratie für Lizenzen in Grenzgewässern wie Carlingford Lough erhöht, was Kosten und Konkurrenz steigert. Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema, mit zunehmend zertifizierten Fischereien (Zum Beispiel MSC), doch Überfischung durch externe Flotten bleibt ein Problem.
Bergbau
Der Bergbau in Irland reicht bis in die Bronzezeit um -2500 zurück, als die Insel zu einem der wichtigsten Kupferproduzenten Westeuropas wurde. Funde in Kerry, Cork und Waterford deuten auf eine intensive Ausbeutung von Kupferminen hin – Schätzungen gehen von bis zu 370 Tonnen Kupfer aus, das für Waffen, Werkzeuge und Schmuck verarbeitet wurde. Gold, das aus Flussseifen in Wicklow und Waterford gewonnen wurde, zierte bereits in der Jungsteinzeit Ornamente wie Lunulae und Sonnenscheiben, oft importiert aus Cornwall, aber zunehmend lokal verarbeitet. Die Wikinger ab dem 9. Jahrhundert trieben den Abbau von Eisen, Silber und Kupfer voran, was die Grundlage für eine frühe Metallverarbeitung legte.
Im Mittelalter und der Frühen Neuzeit blühte der Bergbau sporadisch auf, beeinflusst durch europäische Einflüsse. Die Gründung der Mining Company of Ireland 1824 markierte den Beginn einer organisierteren Phase: Bis in die 1860er Jahre wuchs die Branche, getrieben durch den Export von Kupfer, Blei und Silber, bis der Amerikanische Bürgerkrieg die Preise einbrechen ließ und viele Minen schließen mussten. In Nordirland, insbesondere in Tyrone, förderten dänische Siedler ab dem 11. Jahrhundert Kohle, und im 19. Jahrhundert entstanden Salz- und Kohleminen, die die Industrialisierung antrieben.
Der 20. Jahrhundert brachte einen Neuanfang: Das Minerals Development Act von 1940 und Steuererleichterungen in den 1950er Jahren revitalisierten den Sektor. Seit den 1960er Jahren ist Irland ein globaler Spitzenproduzent von Zink (38 % der westeuropäischen Produktion) und Blei (25 %), mit Minen wie Tara in Meath, Lisheen in Tipperary und Galmoy in Kilkenny. In Nordirland gibt es Goldminen bei Omagh, und Gypsabbau in Cavan und Monaghan versorgt die Zementindustrie. Heute rangiert Irland weltweit auf Platz 11 bei Zink und 16 bei Blei, mit einem Fokus auf umweltverträgliche Methoden – ein Kontrast zu den verlassenen Schäften der Vergangenheit, die nun als Industriedenkmal geschützt werden. Der Bergbau bleibt ein Exporttreiber, der Irlands Übergang von der Subsistenzwirtschaft zur High-Tech-Nation unterstreicht.
Die Suche nach Erdgasvorkommen vor der irischen Küste begann 1970. Das erste größere entdeckte Feld war das „Kinsale Gas Field“ (1971), später entdeckte man mit dem „Ballycotton Gas Field“ (1989) und dem „Corrib Gas Field“ (1996) kleinere Erdgasvorkommen. Die Erschließung des Corrib Fields ist noch nicht abgeschlossen, da immer noch nicht sicher ist, ob die Raffinierung an Land oder noch auf See stattfinden soll. Das Gas wird an Land gepumpt und dort sowohl in Haushalten, als auch in der Industrie verwendet. Das Helvick Oil Field mit einer geschätzten Kapazität von fünf Millionen Barrel Öl wurde erst kürzlich entdeckt. Irland ist auch Europas größter Produzent von Zink, mit drei Zink- und Bleiminen in Navan, Galmoy und Lisheen. Andere mineralische Bodenschätze sind Gold, Silber, Gips, Talk, Calcit, Dolomit, Dachschiefer, Kalkstein, Mauersteine, Sand und Kies.
Handwerk
Handwerk in Irland ist tief in der keltischen Kultur verwurzelt und diente jahrhundertelang dem Überleben und der Identitätsbildung. Bereits in der Bronzezeit (um -2500 bis -700) entstanden Meisterwerke aus Metall und Textilien, die mit keltischen Knoten und Spiralen verziert waren – Symbole, die bis heute in der irischen Kunst nachwirken. Die Normannen brachten im 12. Jahrhundert romanische Einflüsse, doch Irland bewahrte seine einzigartigen Techniken: Von der Weberei bis zum Schmiedehandschmied.
Textilhandwerk dominiert die Tradition: Irisches Leinen, besonders in Nordirland, hat Wurzeln im 17. Jahrhundert und wurde durch Hugenottenflüchtlinge professionalisiert. Die raue See inspirierte Aran-Pullover mit ihren kodierten Mustern – Kabel für Fischer, Diamanten für Wohlstand –, die ab 1890 auf den Aran-Inseln als Einkommensquelle gefördert wurden. Donegal-Tweed, mit seinen farbigen Flecken aus lokaler Wolle, entstand im 19. Jahrhundert und symbolisiert die Verbindung zur Landschaft. Irische Spitze (Carrickmacross oder Limerick) blühte im 19. Jahrhundert als Frauenhandwerk auf, oft in Heimindustrie, und wurde weltberühmt durch Queen Victorias Auftrag.
Metall- und Holzverarbeitung reicht bis in die Steinzeit: Gold- und Silberschmiedekunst produzierte Torques und Claddagh-Ringe, die Liebe, Loyalität und Freundschaft symbolisieren – erstmals im 17. Jahrhundert in Galway gefertigt. In Nordirland, beeinflusst von schottischen Traditionen, blühten Bootsbau und Korbweberei (meist aus Weide) seit 4000 Jahren, essenziell für Fischer und Bauern. Töpferei, wie in Belleek (Fermanagh), kombiniert Porzellan mit keltischen Motiven seit dem 19. Jahrhundert, während Steinmetzarbeiten und Schmiedekunst (zum Beispiel Shillelagh-Stöcke aus Schwarzdorn) die ländliche Handwerkskunst prägen.
Diese Handwerke waren nicht nur wirtschaftlich, sondern kulturell vital: Sie überlebten die Große Hungersnot (1845 bis 1849), indem sie Familien ernährten, und erlebten im 20. Jahrhundert eine Renaissance durch den Celtic Revival. Heute fördert die Design & Crafts Council Irland über 40 traditionelle Techniken, von Crios-Gürteln bis zu Flechtkunst, und schafft so Brücken zur Moderne – ein Erbe, das Touristen und Einheimische gleichermaßen fasziniert.
Industrie
Die Industrialisierung Irlands begann spät und ungleichmäßig, getrieben durch britische Einflüsse. Im 18. Jahrhundert exportierte Irland Rohstoffe wie Rindfleisch und Butter nach England, doch die eigentliche Revolution startete im Norden: Belfast wurde zum Zentrum für Schiffbau (Harland & Wolff baute die Titanic 1912), Leinen und Seilherstellung, die durch billige Flachsimporte boomten. Bis 1914 war Nordirland industriell hochentwickelt, mit einem Netzwerk zu Liverpool und Glasgow, das die imperiale Wirtschaft speiste.
Der Süden hingegen blieb agrarisch: Nur wenige Fabriken wie die Guinness-Brauerei (1786) oder Jacobs-Biskuits in Dublin prägten das Bild. Die Große Hungersnot zerstörte vieles, und die Teilung 1921 vertiefte den Graben: Nordirland profitierte von UK-Integration, mit Schiffbau und Textilien als Säulen, während der Freistaat bis in die 1950er Jahre deindustrialisierte – Wachstum lag bei nur 1,5 % jährlich (1924–1947).
Nach dem Zweiten Weltkrieg wandelte sich alles: Der Industrial Development Authority (IDA) lockte ab den 1960er Jahren US-Firmen mit niedrigen Steuern (12,5 %). Intel und Pharma-Giganten siedelten an, und der Beitritt zur EG 1973 öffnete Märkte. Heute macht Industrie 46 % des BIP aus, dominiert von High-Tech (Pharma, IT, Aerospaces) und Getränken (Guinness exportiert weltweit). In Nordirland rangen Schiffbau und Textilien mit dem Niedergang (besonders durch die Troubles 1969–1998), doch Sektoren wie Aerospace (Spirit AeroSystems) und Lebensmittelverarbeitung blühen. Die Insel produziert nun 22 % der globalen Flugzeugflotte und ist selbstversorgt in der Landwirtschaft.
Wasserwirtschaft
In der Republik Irland ist Uisce Éireann das nationale Wassernutzungsunternehmen, das täglich 1,7 Milliarden Liter Trinkwasser versorgt und 1,2 Milliarden Liter Abwasser behandelt. Die Wasser Services Strategic Plan (WSSP) 2025–2050, die derzeit entwickelt wird, zielt auf eine resiliente Versorgung ab, unter Berücksichtigung von Klimarisiken wie Dürren und Überschwemmungen. Im Jahr 2023 investierte Uisce Éireann über 1,2 Milliarden Euro in Infrastruktur-Upgrades, darunter die Modernisierung der Ringsend-Abwasserbehandlungsanlage, die nun für 2,1 Millionen Einwohner konform mit der EU-Städteabwasserrichtlinie ist. Bis 2025 sollen weitere 42 Abwasser- und 9 Wasserbehandlungsanlagen erneuert werden, um EU-Richtlinien wie die Trinkwasserrichtlinie (2020/2184/EU) und die Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EC) zu erfüllen. Trotz Fortschritten bleibt die Recyclingrate für Abwasser niedrig, und der Regulator CRU betont in seinem Jahresbericht 2025 die Notwendigkeit eines neuen Strategieplans 2025 bis 2027, um Kostensteigerungen und Umweltauswirkungen zu bewältigen.
In Nordirland betreibt NI Water die Versorgung als staatliches Unternehmen, das von Subventionen abhängt, da keine direkten Haushaltsgebühren erhoben werden – ein Modell, das zunehmend als unnachhaltig gilt. Der NI Fiscal Council fordert 2025 höhere Investitionen, um einen 18-jährigen Investitionsrückstau aufzuholen, der zu Kapazitätsengpässen im Abwassernetz führt. Die Northern Ireland Water Classification Statistics 2024 zeigen Stagnation im ökologischen Status der Gewässer: Nur 30 % der Flüsse und Seen erreichen guten Status, beeinträchtigt durch Verschmutzung und unzureichende Behandlung. Eine achtwöchige Konsultation zu Auswirkungen auf die Wasserumwelt läuft bis Juni 2025, um den vierten Zyklus des Flussbeckenmanagements zu informieren. Insgesamt erfordert die gemeinsame Inselstrategie – unter Einbeziehung der Water Framework Directive – massive Investitionen in digitale Überwachung und Leckage-Reduktion, um bis 2030 eine nachhaltige Versorgung für die wachsende Bevölkerung zu sichern. Haushalte in Nordirland verbrauchen durchschnittlich 130 Liter pro Person täglich, was durch Bewusstseinskampagnen wie den Household Water Usage Report 2024/25 gesenkt werden soll.
Energiewirtschaft
Die Energiewirtschaft auf der Insel Irland ist geprägt von einem schnellen Übergang zu erneuerbaren Quellen, getrieben durch EU-Vorgaben und nationale Klimapläne. In der Republik Irland soll der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung 2025 50 % und bis 2030 80 % erreichen, mit Fokus auf Wind (onshore und offshore) und Solar. Im Jahr 2024 deckten Windkraftanlagen 35 % des Strombedarfs, ein Rekord von 13.725 GWh, doch Netzengpässe führten zu Verlusten – 2025 wird mit 6 GW installierter Windkapazität gerechnet. Der Climate Action Plan 2024 priorisiert Netzausbau, Nachfragemanagement und eine Politik für Großverbraucher, während die Übergang zu net-zero Gas durch Wasserstoff- und Biomethan-Integration vorangetrieben wird. Die Energie-Sicherheitsstrategie bis 2030 betont Diversifikation, Speicherung und Interkonnektoren, um Abhängigkeit von UK-Importen zu reduzieren; ein strategischer Gase-Reserve wird 2025 implementiert. Kohleausstieg erfolgt 2025, mit 2 GW neuen Gaskraftwerken bis 2030 als Übergang. Bord Gáis Energy investiert 1 Milliarde Euro bis 2029 in erneuerbare Projekte, darunter 979 MW Solar- und Windkapazität bis 2028.
In Nordirland zielt die Energy Strategy ‘Path to Net Zero’ auf 80 % erneuerbare Strom bis 2030 ab, mit 43,5 % im Jahr 2024. Der Action Plan 2025 umfasst 19 Maßnahmen, darunter den Renewable Electricity Support Scheme (RESS) und Netzverstärkung für 630 Millionen Pfund. Der Integrated Single Electricity Market (I-SEM) verbindet beide Teile der Insel, mit Prognosen bis 2060, die steigende Preise durch Übergangskosten vorhersagen. Herausforderungen umfassen Fachkräftemangel und sozialisierte Anschlusskosten, doch Offshore-Wind könnte bis 2050 38 Milliarden Euro einbringen. Die gemeinsame Energiewende schafft Jobs und reduziert Emissionen, erfordert aber koordinierte Politik, um Energieunabhängigkeit zu erreichen.
Energieproduktion: 2004/05
- Produktion 24.130 mio. kWh
- Verbrauch 23.230 mio. kWh
- Verbrauch pro Person pro Jahr 5791,6 kWh
Abfallwirtschaft
Die Abfallwirtschaft bewegt sich hin zu einer Kreislaufwirtschaft, doch Irland droht, EU-Ziele zu verfehlen. In der Republik Irland generierte 2023 der Bausektor 9 Millionen Tonnen Abfall, der größte Strom, während kommunaler Abfall bei 3,1 Millionen Tonnen stagnierte – mit einer Recyclingrate von 42 % (Ziel 55 % bis 2025). Verpackungsrecycling liegt bei 59 % (Ziel 65 %), Plastik bei 30 % (Ziel 50 %); jährlich müssen 400.000 Tonnen mehr recycelt werden. Der National Waste Management Plan for a Circular Economy 2024–2030, implementiert von 31 Kommunen, zielt auf 0 % Abfallwachstum ab, mit Fokus auf Prävention, Reuse und EPR (Extended Producer Responsibility). Die Waste Action Plan 2020–2025 und Circular Economy Strategy fördern Investitionen in Infrastruktur; Lebensmittelabfall soll bis 2030 um 50 % sinken. 39 % des Abfalls werden exportiert, was die Abhängigkeit von Auslandskapazitäten zeigt. Incentivierte Tarife für kommerziellen Abfall seit 2023 sollen Segregation fördern und Kosten senken.
In Nordirland fordert die Konsultation ‘Rethinking Our Resources’ (2024) höhere Recyclingquoten: 70 % bis 2030, mit Interimszielen von 55 % (2025) und 60 % (2030) für kommunalen Abfall. Der Circular Economy Package (2020) erweitert den Scope auf Unternehmen; ein Verbot biodegradierbaren Abfalls auf Deponien bis 2025 wird empfohlen. Der Plan betont Qualitätsverbesserung der Sammlung, Reduktion von Lebensmittelabfall und EPR für Textilien und Elektronik, um Emissionen zu senken und Ressourcen zu schonen. Die Insel-weite Strategie, unterstützt durch den EPA Circular Economy Programme, zielt auf Innovation und Infrastruktur ab, um von linearer zu regenerativer Wirtschaft zu wechseln – mit Potenzial für Jobs und Ressourcenschonung, doch dringendem Handlungsbedarf für 2025-Ziele.
Handel
Die irische Wirtschaft ist stark exportabhängig. 2007 betrug der Export von Waren etwa 88,8 Mrd. Euro, der Warenimport 62,8 Mrd. Euro. Das ergibt für 2007 einen Überschuss im Warenhandel von rund 26 Mrd. Euro. Bei den Dienstleistungen ist die Bilanz zwar weiterhin negativ, wobei sich aber die Bilanz 2007 mit -4 Mrd. Euro gegenüber -8,3 Mrd. Euro im Jahre 2006 deutlich verbessert hat.
Die USA sind der größte Exportmarkt für Irland, wobei die Exporte im Jahr 2007 im Vergleich zu 2006 um 2 % auf 15.779 Mio. Euro zurückgegangen sind. Im gleichen Zeitraum sind die Exporte nach Großbritannien um sieben Prozent auf 14.799 Mio. Euro gestiegen. Deutschland steht bei den Exportländern hinter Belgien (12.692 Mio. Euro) mit 6.687 Mio. Euro an vierter Stelle (2007). Bemerkenswert ist der Zuwachs von 45 % bei Exporten nach China, auch wenn der Anteil an den Gesamtexporten damit nur 1 % erreicht. Bei den Importen steht China hinter Großbritannien, den USA und Deutschland bereits an vierter Stelle.
Der nationale Handel auf der Insel Irland, der die Republik Irland und Nordirland umfasst, hat sich seit dem Brexit zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Dank des Northern Ireland Protocol bleibt der Grenzhandel weitgehend frei von Zöllen und Kontrollen, was ihn zu einer „Oase der Ruhe“ in einer ansonsten disruptiven globalen Handelslandschaft macht. Im Jahr 2023 erreichte der grenzüberschreitende Handel Güter und Dienstleistungen einen Wert von rund 14,3 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 30 % gegenüber 2022 entspricht. Für die ersten drei Monate 2025 wurden allein Güter im Wert von 2,6 Milliarden Euro gehandelt, wobei der Fokus auf Sektoren wie Lebensmittel und Getränke liegt: Exporte aus der Republik nach Nordirland stiegen um 10 %, in der Gegenrichtung sogar um 23 %. Seit dem Belfast-Good-Friday-Agreement von 1998 hat sich der Umsatz von 2 Milliarden Euro auf über 15 Milliarden Euro im Vorjahr vervielfacht, getrieben durch enge Lieferketten in der Agrarwirtschaft – Nordirland exportierte 2023 beispielsweise Rohmilch im Wert von 125 Millionen Pfund und Fleischprodukte im Wert von 245 Millionen Pfund in die Republik. Für Nordirland stellt der Handel mit der Republik 41 % der Güterexporte und 36 % der Importe dar, was die wirtschaftliche Verflechtung unterstreicht und die Insel zu einem integrierten Markt macht.
Der Retail-Sektor profitiert besonders von dieser Dynamik und wächst robust, trotz anhaltender Inflationsdrucke. In der Republik Irland erzielte der Einzelhandel 2025 ein Umsatzwachstum von 3,9 % im August im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Fokus auf Lebensmittel und Convenience-Produkte, wo die Inflation bei 5,4 % lag. Der Sektor umfasst rund 48.500 Unternehmen und beschäftigt über 373.000 Personen, wobei Frauen 57 % der Belegschaft stellen. Große Ketten wie Tesco, Aldi und Lidl investieren massiv: Aldi plant bis 2030 30 neue Filialen, Lidl 35 und Tesco 10 in den nächsten 12 Monaten, was den Umsatz im Grocery-Bereich ankurbelt. In Nordirland stieg der Retail-Output im zweiten Quartal 2025 um 4,7 % und um 12,1 % jährlich, was einen Serienrekord markiert und 7,5 % über dem Vorkrisenniveau von 2019 liegt. Der gesamte Dienstleistungssektor, inklusive Wholesale und Retail, wuchs um 2,4 %, mit Prognosen für ein BIP-Wachstum von 1,4 % im Jahr 2025. Dieser Boom fördert nicht nur den grenzüberschreitenden Güterfluss, sondern auch den Konsumverkehr, da Verbraucher aus beiden Teilen der Insel zunehmend in großen Einkaufszentren einkaufen, die als Knotenpunkte des Handels dienen.
Große Einkaufszentren spielen eine Schlüsselrolle im Retail-Handel und ziehen jährlich Millionen Besucher an, die durch den reibungslosen Grenzverkehr mobilisiert werden. In der Republik Irland dominiert das Dundrum Town Centre in Dublin als größtes Zentrum mit über 165 Geschäften, 47 Restaurants, einem Kino und einer Verkaufsfläche von 111.484 m² – es feiert 2025 sein 20-jähriges Jubiläum und beherbergt Irlands einziges House of Fraser sowie Flagship-Stores von Harvey Nichols und Michael Kors. Jährlich besuchen 16 Millionen Menschen das Zentrum, das per Luas-Straßenbahn oder Bus leicht erreichbar ist und durch seine Integration von Shopping, Entertainment und Gastronomie den lokalen Handel ankurbelt. Ähnlich imposant ist das Blanchardstown Centre, das größte Komplex in West-Dublin mit über 180 Läden, darunter Primark und Arnotts, plus einem Retail-Park für Sportausrüstung und Mode. Das Liffey Valley Shopping Centre in Clondalkin bietet 160 Einheiten, darunter kürzlich eröffnete Filialen wie Jack & Jones und H.Samuel, und profitiert von freiem Parken sowie Nähe zur M50-Autobahn. Weitere Highlights sind das Crescent Shopping Centre in Limerick (zweites größtes in Munster mit 65 Outlets) und das Mahon Point in Cork, das durch seine Lage am Hafen den südlichen Handel verstärkt.
In Nordirland ist das Victoria Square in Belfast das größte und modernste Zentrum, mit über 100 Geschäften, einem Odeon-Kino und einer einzigartigen Kuppel für Panoramablicke auf die Stadt – es zieht Shopper aus der gesamten Region an, inklusive Grenzpendler. Das The Boulevard in Banbridge, ein Outlet-Center mit Marken wie Next und Superdry, liegt strategisch an der M1 und profitiert vom Cross-Border-Tourismus. Das Foyleside Shopping Centre in Derry-Londonderry integriert lokale Handwerker und internationale Ketten, während das Lisburn Centre und das Sprucefield Centre (mit Sainsbury’s und Marks & Spencer) den Pendlerverkehr nach Belfast bedienen. Diese Zentren fördern den nationalen Handel, indem sie grenzüberschreitende Lieferketten nutzen – etwa für Lebensmittel aus irischen Farmen – und durch Events wie Weihnachtsmärkte den Umsatz steigern.
Daten für 2015:
Export Import
USA 27,11 % Großbritannien 22,06 %
Großbritannien 11,83 % USA 20,59 %
Belgien 10,90 % Frankreich 13,27 %
Deuztschland 8,24 % Deutschlkand 8,70 %
Schweiz 5,07 % China 5,60 %
Niederlande 4,84 % Niederlande 3,07 %
Frankreich 4,35 % Italien 2,03 %
China 3,57 % Belgien 1,76 %
talien 2,14 % Spanien 1,66 %
Spanien 2,12 % Japan 1,53 %
Japan 2,10 % Norwegen 1,43 %
Mexiko 1,16 % Südkorea 1,24 %
Polen 1,08 % Indien 1,03 %
Kanada 0,89 % Polen 0,79 %
Australien 0,73 % Kanada 0,77 %
Schweden 0,61 % Schweiz 0,76 %
Saudi-Arabien 0,58 % Türkei 0,73 %
Singapur 0,56 % Schweden 0,65 %
Hongkong 0,56 % Malaysia 0,60 %
Dänemark 0,53 % Tschechien 0,56 %
Südkorea 0,52 % Dänemark 0,55 %
Türkei 0,43 % Thailand 0,49 %
Russland 0,41 % Russland, Singapur je 0,39 %
Finanzwesen
Die Republik Irland ist Teil der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, somit ist der Euro das offizielle Zahlungsmittel. In Nordirland ist das englische Pfund Sterling die anerkannte Währung; in der Republik wird das Pfund nicht anerkannt, genauso in Nordirland der Euro nicht. Umtauschmöglichkeiten sind allerdings viele vorhanden.
Durch weit überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum und damit verbundene hohe Steuereinnahmen konnte die Staatsverschuldung von 95,2 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahre 1990 kontinuierlich auf 25,1 % des BIP 2007 gesenkt werden. Nach einem Haushaltsdefizit von 0,2 % des BIP 2002 konnte nach Überschüssen bereits in den Vorjahren im Staatshaushalt für 2006 noch ein Überschuss von 2,3 % und für 2007 noch von 0,5 % erreicht werden. Im Laufe des Jahres 2008 mussten die bereits zurückhaltenden Schätzungen der Steuereinnahmen mehrfach nach unten korrigiert werden. Die Regierung geht für 2008 von einem Haushaltsdefizit von 6,25 % aus. Für 2009 rechnet sie mit einem Defizit in Höhe von 9,5 %. Um notwendige Investitionen in die Infrastruktur gewährleisten zu können, soll das Investitionsniveau bei 5 % gehalten werden. Die Schuldenquote wird in den nächsten Jahren somit - trotz erheblicher Bemühungen der Regierung um Einkommenssteigerungen und Ausgabenkürzungen - wieder deutlich ansteigen. Sie lag zum Jahresende 2008 bei 41 %. Für 2009 wird eine Quote von 53 % erwartet.
Die internationale Banken- und Finanzkrise hat auch Irland schwer getroffen. Die Regierung hat im September / Oktober 2008 mit einer umfassenden Garantieerklärung für Einlagen und Verbindlichkeiten irischer Geldinstitute (die auch auf irische Niederlassungen von ausländischen Häusern ausgedehnt werden kann) reagiert. Anglo-Irish Bank wurde im Januar 2009 verstaatlicht; es wurden Maßnahmen zur Rekapitalisierung weiterer Banken eingeleitet.
In den 2010er Jahren hat sich der internationale Finanzsektor (IFS) in Irland zu einem „Weltklasse-Hub“ entwickelt, der 2023 Exporte im Wert von 22 Milliarden Euro erzielte und rund 50.000 direkte Beschäftigte beschäftigt – ein Ziel, das durch die „Ireland for Finance“-Strategie bis 2025 erreicht wurde. Die Strategie, die vier Säulen (Regulierung, Talent, Infrastruktur und Kommunikation) umfasst, wurde 2019 gestartet und bis 2026 verlängert, um Irland als führenden Standort für Banking, Fondsmanagement, Versicherungen und Fintech zu festigen. Mit 4,5 Billionen Euro unter Verwaltung ist Irland der drittgrößte Fondsdomizil weltweit, wobei 70 % der europäischen ETFs hier ansässig sind. Die Zentralbank von Irland (CBI) priorisiert in ihrem Regulatory & Supervisory Outlook 2025 Themen wie Verbraucherschutz, Risikomanagement, operative Resilienz und Cyber-Sicherheit, insbesondere im wachsenden Fintech-Bereich. Neue Regulierungen wie DORA (Digital Operational Resilience Act), das ab Januar 2025 gilt, und der AI Act, der ab Februar 2025 verbotene KI-Systeme regelt, stärken die IT-Sicherheit in Banken und Versicherungen. Der Budget 2025 prognostiziert ein Haushaltsüberschuss von 9,7 Milliarden Euro bei Einnahmen von 141 Milliarden Euro und Ausgaben von 131,3 Milliarden Euro, was Investitionen in den Sektor ermöglicht, darunter eine Review des R&D-Steuergutschreins und Erweiterungen für den Audiovisuellen Sektor. EY schätzt ein Wachstum des Sektors um 26 % bis 2028, mit 34 % mehr Beschäftigung, getrieben durch FDI von US-Firmen in Pharma, Tech und Finanzen – über 950 US-Tochtergesellschaften operieren hier.
In Nordirland, das fiskalisch mit dem Vereinigten Königreich verbunden ist und das Pfund Sterling nutzt, wächst der Finanzsektor langsamer, aber resilient, mit Fokus auf Dienstleistungen und Tech. Der Sektor beschäftigt über 45.000 Personen in Financial & Professional Services, darunter 24.000 in Kernbereichen wie Banking und Insurance, und trägt zu einem BIP-Anteil von rund 10 % bei. Im ersten Quartal 2025 stieg der Output im Business Services and Finance-Sektor um 6,5 %, im zweiten um 3,2 %, was zu einem jährlichen Wachstum von 0,9 % führte und den Sektor 13,5 % über dem Pre-Pandemie-Niveau von 2019 positioniert. Die Northern Ireland Statistics and Research Agency (NISRA) berichtet von einer starken Erholung, unterstützt durch Subventionen aus London, die 2023/24 bei 9,16 Milliarden Pfund lagen. Banking umfasst 10.000 Stellen bei 355 Standorten, darunter indigene Banken wie Ulster Bank und Danske Bank sowie internationale wie Citi und Santander. Insurance beschäftigt 5.600 Personen bei 120 Standorten, mit Wachstum in Telematics und Fraud Analytics. Der Finanzsektor profitiert von der robusten UK-Regulierung, einschließlich AML/CFT und SEAR (Senior Executive Accountability Regime), das ab Juli 2025 erweitert wird. Die Interim Fiscal Framework 2025 sichert eine Bedarfsfinanzierung von 124 % im Vergleich zum UK-Durchschnitt, mit Anpassungen für neue Barnett-Konsequenzen. Trotz Herausforderungen wie einem Produktivitätsdefizit von 18 % gegenüber dem UK-Durchschnitt bleibt der Sektor ein Pfeiler, mit Exporten von 1,5 Milliarden Pfund in die EU, hauptsächlich in die Republik Irland.
Die Integration des Finanzwesens zwischen Republik Irland und Nordirland ist durch den Brexit und das Northern Ireland Protocol (NP) geprägt, das Nordirland im EU-Binnenmarkt für Güter hält, aber Dienstleistungen wie Finanzen kompliziert. Der grenzüberschreitende Handel, einschließlich Finanzdienstleistungen, erreichte 2023 14,3 Milliarden Euro, mit 41 % der NI-Exporte in die Republik. Dies schafft Synergien: Nordirland exportiert 1 Milliarde Pfund in Finanzdienstleistungen in die EU, überwiegend über die Grenze, und nutzt All-Ireland-Banking-Legislation, um Kunden in der Republik zu bedienen. Invest NI und IDA Ireland fördern gemeinsame FDI, zum Beispiel in Fintech, wo Belfast als Top-3-Global-Fintech-Location (nach London und Singapur) und Dublin als EU-Hub kooperieren. US-Firmen wie Allstate (2.400 Mitarbeiter in NI) und Citi (2.900 in Belfast) nutzen die Dual-Market-Zugänglichkeit, während Fintech-Start-ups wie AID:Tech digitale Identität und Zahlungen über die Insel hinweg entwickeln. Der Windsor Framework 2023 mildert Handelsbarrieren, doch geopolitische Risiken – wie steigende Unterstützung für eine United Ireland (41 % in Umfragen aus dem Jahr 2025) – und ein potenzieller Unification-Kostenrahmen von 8–20 Milliarden Euro jährlich belasten die Stabilität. Dennoch schafft die Integration Wachstum: Nordirlands Fintech-Ökosystem, mit 1:5 Beschäftigten in Fintech, ergänzt Dublins 400 internationale Firmen, darunter die Hälfte der Top-50-Banken weltweit.
Im Fintech-Bereich boomt die Insel: In der Republik Irland zogen 2019–2024 fast 1 Milliarde Euro Investitionen an, mit Fokus auf Payments, Regtech, Blockchain und Insurtech – 22 VASPs sind registriert, und der Innovation Hub der CBI führte 389 Engagements durch. Nordirland führt weltweit in Fintech-FDI (fDi Markets 2025), mit Stärken in Cybersecurity (Aflac, Allstate), Trading-Tech (Citi, TP ICAP) und GRC-Lösungen; 2.000 Software-Ingenieure entwickeln für globale Märkte. Gemeinsame Trends umfassen AI, Blockchain für Cross-Border-Payments und nachhaltige Finance, unterstützt durch EU-Regulierungen wie MiCAR (Übergang bis 2025). Herausforderungen wie Cyber-Risiken und Talentmangel (tight labor market bis 2025) erfordern Koordination, doch die Strategien – Ireland for Finance und NI's Economic Vision – zielen auf 80.000 Jobs bis 2030 ab.
Soziales und Gesundheit
In Irland gibt es kein klassisches Krankenversicherungssystem, es herrscht eine staatliche Heilfürsorge. Das Department of Social and Family Affairs kümmert sich um die Sozialversicherungen in Irland. Arbeiter zahlen einen Beitrag der Pay Related Social Insurance (PRSI) genannt wird; dieser wird vom Arbeitgeber abgezogen und an das Ministerium weiter geleitet. Die Sozialversicherung umfasst Arbeitslosengeld, Rente, Invalidität und einen Großteil der medizinischen Versorgung. Für eine komplette Versorgung bedarf es einer privaten Zusatzversicherung.
Das soziale Sicherungssystem in Irland wird vom Department of Social Protection verwaltet und umfasst Leistungen wie Arbeitslosengeld, Renten, Kindergeld und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen oder Alleinerziehende. Es basiert auf einer Mischung aus beitragsabhängigen Zahlungen (PRSI) und bedarfsgeprüften Hilfen. Im Haushalt 2025 wurde ein €2,6 Milliarden schweres Sozialpaket beschlossen, das Erhöhungen der wöchentlichen Leistungen um €12 (zum Beispiel Jobseeker’s Allowance: €232, State Pension: €277) sowie Einmalzahlungen wie €300 Fuel Allowance und doppeltes Kindergeld (€140/Monat pro Kind) umfasst. Für 2026 ist eine weitere Erhöhung um €10 pro Woche geplant, mit dem Ziel, Leistungen an 27,5 % des Durchschnittseinkommens zu indexieren. Trotz dieser Maßnahmen bleibt die Armutsquote mit 13 % (2024) eine Herausforderung, und Organisationen wie die Society of St. Vincent de Paul fordern Erhöhungen um €25 pro Woche, um Armut effektiver zu bekämpfen.
In Nordirland orientiert sich das Sozialsystem am britischen Modell, insbesondere am Universal Credit, einer monatlichen Zahlung (rund £300 bis £600 je nach Haushalt), die mehrere ältere Leistungen ersetzt. Weitere Leistungen umfassen Child Benefit (£25/Woche pro Kind) und Personal Independence Payment (bis £172/Woche für Menschen mit Behinderungen). Nordirland hat jedoch eigene Regelungen, um die Auswirkungen der britischen Welfare-Reformen abzumildern, etwa durch Supplementary Payments für Unterkunftskosten. Mit einem Sozialbudget von etwa £7,3 Milliarden bleibt die Finanzierung angespannt, da Reformen seit 2010 Einsparungen von £3 Milliarden bis 2026 vorsehen. Besonders hoch ist der Anteil an Disability-Leistungen, der in Nordirland doppelt so hoch wie im restlichen Großbritannien ist. Eine zentrale Herausforderung ist die Förderung der Rückkehr ins Berufsleben, während gleichzeitig Mietrückstände den sozialen Wohnungsbau gefährden.
Gesundheitsversorgung
Das Gesundheitssystem in Irland wird vom Health Service Executive (HSE) verwaltet und ist steuerfinanziert, wobei etwa 40 % der Bevölkerung durch den General Medical Services (GMS)-Schein kostenlosen Zugang zu öffentlichen Leistungen haben. Für andere kosten GP-Besuche €50–65, während Krankenhausbehandlungen in öffentlichen Einrichtungen kostenlos sind, jedoch oft lange Wartezeiten aufweisen. Rund 47 % der Iren haben private Krankenversicherungen für schnellere Termine. Das Sláintecare-Programm zielt darauf ab, bis 2030 ein universelles Gesundheitssystem einzuführen, das Wartezeiten reduziert und die Primärversorgung stärkt. Das Budget 2025 sieht €1,33 Milliarden für Investitionen vor, etwa für eine neue Kinderklinik, doch Überlastungen bleiben ein Problem: Im Januar 2025 warteten 13.972 Patienten ohne Bett, und die Intensivkapazität ist gering. Die Pandemie förderte Telemedizin, aber die Nutzung elektronischer Patientenakten (EHR) ist weiterhin unzureichend.
Nordirland hingegen betreibt ein vollständig öffentliches Health and Social Care (HSC)-System, das Gesundheits- und Sozialdienste integriert und kostenlos am Point of Delivery ist. Private Versicherungen spielen mit 18 % eine geringere Rolle. Das System leidet unter einem chronischen Defizit (£160 Millionen 2018, anhaltend) und Personalmangel, was Wartezeiten von bis zu 52 Wochen, besonders in der mentalen Gesundheit, verursacht. Investitionen in die Primärversorgung steigen (£412 Millionen für Allgemeinmedizin 2024/25, +6 %), und es gibt Fortschritte in der frühen Intervention bei psychischen Erkrankungen. Dennoch sind Gesundheitsungleichheiten ein Problem: Benachteiligte Gebiete weisen höhere Sterberaten auf. Die Integration von Gesundheits- und Sozialdiensten ermöglicht eine bessere Pflege für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen, doch die Finanzierung bleibt eine Herausforderung.
Krankheiten
In früheren Jahrhunderten waren Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Typhus und Cholera weit verbreitet, insbesondere während der Großen Hungersnot im 19. Jahrhundert, als schlechte hygienische Bedingungen und Mangelernährung das Immunsystem vieler Menschen schwächten. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und dem Ausbau des Gesundheitssystems im 20. Jahrhundert konnten diese Krankheiten jedoch stark eingedämmt werden.
Heute gehören chronische nichtübertragbare Krankheiten zu den größten Gesundheitsproblemen auf der Insel. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Diabetes zählen zu den häufigsten Todesursachen. Ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, Alkohol- und Tabakkonsum tragen wesentlich zu diesen Krankheiten bei. In städtischen Gebieten, insbesondere in Dublin und Belfast, wird zunehmend auf Prävention, Aufklärung und Gesundheitsförderung gesetzt.
Auch psychische Erkrankungen haben in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen. Depressionen, Angststörungen und Stressbelastungen nehmen zu, was teilweise auf gesellschaftliche Veränderungen, Leistungsdruck und wirtschaftliche Unsicherheiten zurückgeführt wird. Sowohl in Irland als auch in Nordirland bemühen sich staatliche Stellen, das Bewusstsein für mentale Gesundheit zu stärken und den Zugang zu psychologischer Unterstützung zu verbessern.
Infektionskrankheiten spielen zwar heute eine geringere Rolle, doch die COVID-19-Pandemie zeigte, wie verwundbar auch moderne Gesundheitssysteme sind. Die Regierungen beider Landesteile arbeiteten eng zusammen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern und die Bevölkerung zu schützen.
Bildung
Das Bildungssystem der Republik Irland ist den Systemen anderer Länder ähnlich und dreistufig ausgerichtet. Es werden die drei Bereiche Primär, Sekundär und höhere Bildung unterschieden. Seit den 1960er Jahren ist das Bildungswesen bedingt durch das anhaltende Wirtschaftswachstum großen Änderungen unterworfen.
Das Department of Education and Science (Ministerium für Bildung und Wissenschaft) bestimmt die Richtlinien, die Finanzierung und die generelle Ausrichtung des Bildungswesens. Neben der National Qualifications Authority of Ireland (Nationale Bildungsbehörde), der Higher Education Authority (Behörde für höhere Bildung) und auf lokaler Ebene den Vocational Education Committees (Berufsbildungsausschüssen) als Regierungseinrichtungen tragen viele andere Körperschaften sowohl öffentlichen als auch privaten Rechtes die Umsetzung der ministeriellen Vorgaben. Die derzeitige Bildungsministerin ist Mary Hanafin.
Nach dem Bildungsgesetz Education (Welfare) Act sind alle Kinder im Alter von sechs bis fünfzehn Jahren schulpflichtig. Die irische Verfassung erlaubt eine Ausbildung zuhause, was wegen fehlender Vorgaben bezüglich der Qualität des Hausunterrichts als problematisch angesehen wird. Die im Unterricht verwendete Sprache ist in allen Bereichen Englisch, mit Ausnahme der gaelscoileanna (irisch-sprachige Schulen, singular gaelscoil) in denen auf Irisch unterrichtet wird. An den Universitäten werden Studiengänge meist in Englisch angeboten.
1973 wurde das Bestehen eines Irisch-Sprachtests als Bedingung für den Abschlusses der Sekundärschule abgeschafft. In öffentlich finanzierten Bildungseinrichtungen ist das Lehren der irischen Sprache allerdings weiterhin Pflicht. Es gibt Ausnahmeregelungen für Studenten / Schüler, die eine längere Zeit im Ausland verbracht haben oder Lernschwierigkeiten haben.
Ferien an Grundschulen (primary school)
- Das Schuljahr reicht vom 1. September bis zum 30. Juni. Aus Flexibilitätsgründen kann die Schule aber auch schon in den letzten zwei oder drei Augustwochen geöffnet werden.
- Das Schuljahr hat 183 Tage (abzüglich sechs Studien- bzw. Verwaltungstagen 177).
- Erste größere Pause ist die letzte Oktoberwoche (allgemein Halloween-Ferien genannt).
- Die Weihnachtsferien reichen vom letzten Schultag vor dem 23. Dezember bis zum ersten Wochentag nach dem 6. Januar (17 bis 21 Tage).
- Die zweite Unterbrechung im Halbjahr ist minimal zwei Tage und maximal fünf Tage in der dritten Februarwoche, die Faschingsferien (Shrove break).
- Die Osterferien bestehen aus der Woche vor und nach Ostern (10 Schultage).
- Weiterhin gibt es noch flexible Ferientage, die in der Regel um die gesetzlichen Feiertage im Mai und Juli (?) liegen.
Ferien an weiterführenden Schulen (secondary school)
- Das Schuljahr an weiterführenden Schulen ist einen Monat kürzer und reicht vom 1. September bis zum 31. Mai. Aus Flexibilitätsgründen kann die Schule aber auch schon in den letzten zwei oder drei Augustwochen geöffnet werden.
- Das Schuljahr hat 167 Tage.
- Erste größere Pause ist die Woche nach dem letzten Wochenende im Oktober
- Die Weihnachtsferien sind identisch.
- Die zweite Unterbrechung im Halbjahr ist die dritte Februarwoche.
- Die Abschlussprüfungen (Junior Certificate, vergleichbar Mittlere Reife und Leaving Certificate, vergleichbar Abitur), beginnen am ersten Mittwoch im Juni.
Nordirland gehört zwar zum Vereinigten Königreich, das Schulsystem weist aber einige Besonderheiten auf. Die Schulpflicht erstreckt sich hier auf Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren. Öffentliche Schulen sind kostenlos, zusätzlich gibt es private Bildungseinrichtungen. Das System gliedert sich in Primar- und Sekundarschulen, wobei der Einfluss der Religion deutlich spürbar ist: Viele Schulen sind entweder katholisch oder protestantisch geprägt, während es zunehmend auch integrative Schulen gibt, in denen Kinder beider Konfessionen gemeinsam unterrichtet werden.
Die Primarstufe beginnt im Alter von vier Jahren und dauert bis etwa elf. Sie umfasst zunächst die Foundation Stage, in der grundlegende Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Mathematik vermittelt werden, und anschließend Key Stage 1 und 2, in denen Fächer wie Englisch, Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte, Geografie, Kunst, Musik, Sport und Religion unterrichtet werden.
An die Primarstufe schließt die Sekundarstufe an, die von elf bis sechzehn Jahren Pflicht ist, optional jedoch bis 18 Jahre verlängert werden kann. Sie beginnt mit Key Stage 3, in der die Schüler ein breites Fächerangebot kennenlernen, einschließlich der Einführung in Fremdsprachen. Darauf folgt Key Stage 4, in der die Jugendlichen auf die GCSE-Prüfungen vorbereitet werden, zentrale Abschlussprüfungen, die die weitere schulische Laufbahn maßgeblich beeinflussen. Nach Abschluss der Pflichtschule können Schüler in der Post-16 Education entweder A-Levels für den Zugang zu Universitäten absolvieren oder beruflich orientierte Kurse besuchen.
In Nordirland existieren verschiedene Schulformen: Controlled Schools, staatlich finanziert und meist protestantisch; Maintained Schools, ebenfalls staatlich finanziert, überwiegend katholisch; Integrated Schools, die Kinder beider Konfessionen gemeinsam unterrichten; Voluntary Grammar Schools, die selektiv nach Leistung über den 11-plus-Test Schüler aufnehmen und stark akademisch ausgerichtet sind; sowie private, gebührenpflichtige Schulen.
Die Prüfungen spielen eine zentrale Rolle im Bildungssystem. Mit 16 Jahren legen die Schüler die GCSEs ab, während die A-Levels mit 18 Jahren als allgemeine Hochschulreife dienen. Alternativ können berufsbezogene Qualifikationen erworben werden. Trotz Bemühungen um Integration bleibt das System durch die historische Trennung der Konfessionen geprägt, und der 11-plus-Test ist weiterhin umstritten. In den letzten Jahren gab es jedoch zunehmende Reformen, um Schulen inklusiver und integrativer zu gestalten.
Höhere Bildung
In Irland gibt es vergleichsweise wenige höhere Bildungseinrichtungen, die alle unter der Aufsicht des Department of Education and Science stehen (Selbstverwaltungsorganisation der Hochschulen). Grundsätzlich unterscheiden die Iren vier unterschiedliche Arten: Universitäten, Technische Hochschulen (Institutes of Technology), Hochschulen für die Lehrerausbildung (Colleges of Education) und weitere regionale Colleges oder Institutes for Higher Education.
Die Institutes of Technology sind außeruniversitäre Hochschulen mit praxisorientierter Lehre und anwendungsbetonter Forschung. Sie bieten eine zweijährige berufsqualifizierende Ausbildung, die zum Erwerb des National Certificate führt. Nach einem dreijährigem Studium können die Studierenden das National Diploma erwerben. Diese Abschlüsse entsprechen keinem Akademischen Grad. Vereinzelt werden von den Institutes auch validierte Hochschulstudiengänge angeboten, die mit dem Bachelor's Degree abschließen.
Unter den relativ wenigen irischen Hochschulen hat sich eine Hierarchie nach britischem Vorbild etabliert. An der Spitze steht das Trinity College. Die vier Universitäten, die unter der University of Ireland zusammengefasst sind genießen allesamt einen sehr guten Ruf. Die neuen Universitäten und die Institutes of Technology konfrontieren sich, so wie die Polytechnics in Großbritanien, zurzeit noch mit mehr oder weniger berechtigten Vorurteilen.
Hochschul-Rankings sind allgemein akzeptiert und dienen vielen Studienanfängern als wichtige Entscheidungshilfe bei der Hochschulwahl. Am renommiertesten ist das Ranking von The Times. Es setzt sich aus mehreren Kriterien zusammen: von der Qualität der Lehre über die finanzielle Ausstattung der Bibliotheken bis hin zu den Noten der Absolventen. Hier findet man das Trinity College Dublin auf dem vorderen Platz, gefolgt vom University College Cork. Auch international taucht das Trinity College Dublin auf, im Academic Ranking of World Universities 2005 platziert es sich unter den Top 100 Universitäten in Europa.
Das Studium in Irland ist sehr viel verschulter und kürzer als Deutschland. Die Studierenden beginnen deutlich früher mit dem Studium. Ein Drittel der Studienanfänger ist jünger als 18, nur fünf Prozent sind älter als 20 Jahre. Dank eines straff organisierten Studienverlaufs erhalten die meisten Studierenden schon nach drei bis vier Jahren ihren ersten akademischen Abschluss.
Das akademische Jahr beginnt in Irland Anfang Oktober und die Vorlesungen, Workshops und Seminare gehen bis Juni. Am Ende des Studienjahres im Mai und Juni finden mündliche und schriftliche Prüfungen statt. Nur wer alle Prüfungen besteht, wird zum folgenden Jahr zugelassen. Zusätzlich gibt es in einigen Fächern laufende Prüfungen während des Jahres. Trotz äußerst strenger Leistungskontrollen gibt es in Irland deutlich weniger Studienabbrecher als in Deutschland. Unterschiedlich ist auch die Berechnung des Studiums: first, second und final year. Das Jahr von Oktober bis Juni war bisher in Trimester aufgeteilt. Inzwischen aber zählt man an den meisten Hochschulen nach Semestern. Das geschah unter anderem wegen der Einführung des Credit-Point-Systems ECTS, bei dem es für ein Jahr 60 Credits, für ein Semester 30 Credits gibt.
Hochschulen und Universitäten
Universities (nach dem Universities Act, 1997)
- Dublin City University
- National University of Ireland
- University College Cork
- University College Dublin
- National University of Ireland, Galway
- National University of Ireland, Maynooth
- University of Limerick
- University of Dublin
- Trinity College, Dublin
Colleges of Education
- St Angela's College of Education, Sligo
- St Catherine's College of Education for Home Economics
- Church of Ireland College of Education
- Froebel College of Education
- The Marino Institute of Education
- Mary Immaculate College, Limerick
- Mater Dei Institute of Education
- St Patrick's College of Education
- Hibernia College
Unabhängige höhere Bildungseinrichtungen
- Abbey School of Theatre
- All Hallows College
- American College Dublin
- Burren College of Art
- College of Computer Training
- Cork College of Commerce
- Development Studies Centre
- Dublin Business School
- Dublin Institute of Design
- Edgewater College
- Gaiety School of Acting
- Griffith College Cork
- Griffith College Dublin
- Griffith College Limerick
- Hibernia College
- Honorable Society of King's Inns
- HSI College
- Irish Bible Institute
- Irish School of Ecumenics
- Killybegs Tourism School
- St Michael's House
- Mallow College of Further Education
- Mid West Business Institute
- Milltown Institute of Theology and Philosophy
- National College of Art and Design
- National College of Ireland
- St. John's Central College, Cork
- St Nicholas Montessori
- St Patrick's College, Maynooth
- St. Patrick's, Carlow College
- Sallynoggin College, Pearse Street, Sallynoggin
- Portobello College Dublin
- Royal Irish Academy of Music
- Royal College of Physicians of Ireland
- Royal College of Surgeons in Ireland
- Shannon College of Hotel Management
- Tipperary Institute
- Turning Point
- Irish International University - Dublin
Institutes of Technology (nach dem Institutes of Technology Act 2006)
- Athlone Institute of Technology
- Institute of Technology, Blanchardstown
- Institute of Technology, Carlow
- Cork Institute of Technology
- Cork School of Music
- Crawford College of Art and Design
- National Maritime College of Ireland
- Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology
- Dundalk Institute of Technology
- Galway-Mayo Institute of Technology
- Letterkenny Institute of Technology
- Tourism College Killybegs
- Limerick Institute of Technology
- Institute of Technology, Sligo
- Institute of Technology, Tallaght
- Institute of Technology, Tralee
- Waterford Institute of Technology
Nationale Institutionen
- Dublin Institute for Advanced Studies
- Dublin Institute of Technology
- Garda Síochána College
- Institute of Public Administration
- Irish Management Institute
- Military College, Curragh Camp
National Ambulance Service College
- Albert Agricultural College (1838 bis 1979)
- Apothecaries' Hall, Dublin (1791bis1971)
- Catholic University of Ireland (1854 bis 1908)
- Irish Academy for the Performing Arts (2002 bis 2004)
- Media Lab Europe (2000 bis 2005)
- Our Lady of Mercy College, Carysfort (1877 bis 1988)
- Queen's University of Ireland (1850 bis 1882)
- Royal University of Ireland (1880 bis 1909)
- St. Patrick's Cathedral University (1320 bis spätes 16. Jahrhundert)
- Thomond College of Education, Limerick (1973 bis 1991)
- Bandon University, Bandon, Co. Cork (16. Jahrhundert bis Reformation unter Henry VIII)
Die wichtigste Universität der Republik Irland ist das Trinity College Dublin (TCD), die älteste Universität Irlands, gegründet 1592. Das TCD genießt besonders in den Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Medizin und Wirtschaft ein hohes Ansehen. Ebenfalls in Dublin liegt das University College Dublin (UCD), die größte Universität des Landes, gegründet 1854. UCD ist bekannt für seine exzellenten Programme in Business, Ingenieurwesen, Rechts- und Naturwissenschaften.
Im Süden Irlands befindet sich das University College Cork (UCC), gegründet 1845, das sich durch starke Forschung in Biowissenschaften, Lebensmittelwissenschaften, Meeresforschung und Umweltwissenschaften auszeichnet. Im Westen des Landes liegt die National University of Ireland Galway (NUIG), ebenfalls 1845 gegründet, die besonders in den Bereichen Meeresforschung, Biowissenschaften, Sozialwissenschaften und kreatives Schreiben renommierte Programme anbietet.
Die University of Limerick (UL), gegründet 1972, ist bekannt für ihre praxisorientierte Ausbildung und enge Zusammenarbeit mit der Industrie, vor allem in den Bereichen Ingenieurwesen, Informatik, Wirtschaft und Sportwissenschaften. Die Dublin City University (DCU), gegründet 1980, legt einen starken Fokus auf Technologie, Forschung und Entrepreneurship und hat sich in Informatik, Ingenieurwesen, Business und Kommunikationswissenschaften einen Namen gemacht.
In Nordirland gibt es vier große Hochschulen, die internationale Anerkennung genießen. Die Queen’s University Belfast (QUB) ist die älteste und bekannteste Universität des Landes. Sie wurde 1845 gegründet und zählt zu den führenden Forschungsuniversitäten im Vereinigten Königreich. Ihr breites Studienangebot reicht von Medizin und Ingenieurwesen bis hin zu Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften. Die Universität legt besonderen Wert auf Forschung, Innovation und internationale Zusammenarbeit.
Die zweite große Universität ist die Ulster University, die mehrere Standorte besitzt – unter anderem in Belfast, Coleraine, Jordanstown und Magee (Derry/Londonderry). Sie bietet praxisorientierte Studiengänge in Bereichen wie Wirtschaft, Informatik, Design, Sozialwissenschaften und Gesundheitswesen an. In den letzten Jahren hat die Ulster University stark in moderne Campus-Infrastruktur investiert und fördert den Austausch mit Industrie und Unternehmen, um die Beschäftigungsfähigkeit ihrer Absolventinnen und Absolventen zu verbessern.
Neben diesen Universitäten gibt es spezialisierte Einrichtungen wie das Stranmillis University College und das St Mary’s University College, beide in Belfast. Sie sind mit der Queen’s University verbunden und konzentrieren sich vor allem auf Lehramtsausbildung, Pädagogik und Bildungswissenschaften.
Darüber hinaus existiert ein Netzwerk von Further and Higher Education Colleges, die berufliche und technische Ausbildung auf hohem Niveau anbieten. Diese Colleges – wie das Belfast Metropolitan College oder das North West Regional College – ermöglichen Studierenden den Zugang zu praxisnahen Qualifikationen und bereiten sie sowohl auf den Arbeitsmarkt als auch auf ein späteres Universitätsstudium vor.
Bibliotheken und Archive
Die Insel Irland beherbergt eine reiche Tradition von Bibliotheken und Archiven, die als Hüter der kulturellen, historischen und literarischen Schätze dienen. Diese Institutionen umfassen sowohl öffentliche Bibliotheksnetze als auch spezialisierte Archive, die Dokumente, Manuskripte, Zeitungen und genealogische Quellen aus Hunderten von Jahren bewahren. In der Republik Irland, die den Süden der Insel umfasst, dominieren zentrale nationale Einrichtungen in Dublin, ergänzt durch regionale Bibliotheken in den 26 Countys. Nordirland, als Teil des Vereinigten Königreichs, verfügt über eigene, unabhängige Strukturen, die eng mit der lokalen Geschichte verknüpft sind, insbesondere mit Themen wie der Union mit Großbritannien, der Unabhängigkeitsbewegung und dem Konflikt der Troubles. Gemeinsam bieten sie Forschern, Genealogen und Interessierten Zugang zu digitalisierten Sammlungen, Ausstellungen und Beratungsdiensten, oft mit Fokus auf irische Identität, Literatur und Alltagsgeschichte. Viele dieser Einrichtungen sind durch EU-Förderungen und Kooperationen vernetzt, was grenzüberschreitende Recherchen erleichtert.
In der Republik Irland bildet die Nationale Bibliothek Irlands (National Library of Ireland) in Dublin das Herzstück des bibliothekarischen Netzes. Gegründet 1877, beherbergt sie über 12 Millionen Objekte, darunter Bücher, Manuskripte, Karten, Fotografien und Zeitungen, die die dokumentierte Erinnerung an Irland seit dem Mittelalter festhalten. Besonders wertvoll sind ihre Sammlungen zu irischer Literatur, mit Archiven von Autoren wie W.B. Yeats, James Joyce und Seamus Heaney, sowie das National Photographic Archive in Temple Bar. Die Bibliothek profitiert vom Legal Deposit-Gesetz, wonach alle in Irland veröffentlichten Werke hier landen müssen, und bietet umfangreiche digitale Ressourcen wie den Census von 1901 und 1911 oder die Irish Newspaper Archive. Ergänzt wird sie durch das Nationale Archiv Irlands (National Archives of Ireland), ebenfalls in Dublin ansässig, das staatliche Aufzeichnungen von 1700 bis heute verwaltet – von Gerichtsprotokollen und Volkszählungen bis hin zu Aufständen wie dem von 1916. Es dient als zentrale Anlaufstelle für Familienforschung, mit digitalen Tools wie den Tithe Applotment Books oder Soldatenerbschaften.
Neben diesen nationalen Institutionen strahlen Universitätsbibliotheken wie die Bibliothek des Trinity College Dublin aus, deren Long Room eine der ikonischsten Lesesäle der Welt ist. Sie beherbergt Schätze wie das Book of Kells, ein illuminiertes Evangelienbuch aus dem 9. Jahrhundert, sowie die Brian Boru-Harfe, ein Symbol irischer Kultur. Als Copyright-Bibliothek erhält sie Kopien aller UK- und irischen Publikationen und zieht jährlich Millionen Besucher an. Die Bibliothek der University College Dublin (UCD) und die Royal Irish Academy Library ergänzen dies mit Fokus auf Manuskripte und wissenschaftliche Werke, letztere mit einer der größten Sammlungen irischer Handschriften seit 1785. Öffentliche Bibliotheken, koordiniert durch Libraries Ireland, reichen von der Dublin City Library & Archive mit ihren städtischen Protokollen seit 1171 bis zu regionalen Zentren wie der Cork County Library oder der Galway County Library, die lokale Zeitungen und Familiengeschichten archivieren. Spezialisierte Einrichtungen wie das Irish Architectural Archive oder das Guinness Archive in Dublin runden das Angebot ab, oft mit digitalen Portalen für weltweite Nutzer.
In Nordirland konzentriert sich das bibliothekarische und archivarische Leben auf Belfast, wo das Public Record Office of Northern Ireland (PRONI) als offizielles Archiv dient. Errichtet 1923 im Titanic Quarter, bewahrt es Millionen Dokumente seit 1600, einschließlich Regierungsakten, Gerichtsakten, Ulster-Covenant-Unterlagen und Fotos aus der Zeit der Teilung Irlands. Es ist ein Mekka für Historiker des 20. Jahrhunderts, mit Schwerpunkten auf Emigration, protestantischen Kirchenregistern und den Troubles, und bietet digitale Zugänge zu Volkszählungen und Testamenten. Die Bibliothek der Queen's University Belfast (QUB) ergänzt dies mit umfangreichen Archiven zu den nördlichen Countys, insbesondere protestantischen religiösen Quellen und lokalen Zeitungen, sowie als Repository für irische Komponisten. Die Belfast Central Library, seit 1888 ein Wahrzeichen, beherbergt die größte Zeitungssammlung Nordirlands – von der Belfast Newsletter seit 1759 bis zu provinziellen Titeln – sowie Spezialsammlungen zu Musik (Northern Ireland Music Archive) und Autoren wie Amanda McKittrick Ros.
Weitere Highlights in Nordirland umfassen die Linen Hall Library in Belfast, die älteste Bibliothek der Stadt (gegründet 1788), mit Fokus auf irischer Geschichte, Literatur und dem Northern Ireland Political Collection, das über 250.000 Dokumente zu Politik und Konflikt seit 1968 umfasst. Universitätsbibliotheken wie die der Ulster University in Derry~Londonderry bieten Zugang zu regionalen Archiven, etwa zum Museum of Free Derry mit Materialien zu Bürgerrechtsbewegungen und Bloody Sunday. Öffentliche Bibliotheken, verwaltet durch Libraries NI, verteilen sich über die sechs Countys und integrieren lokale Studienabteilungen, z. B. in der Newry City Library mit Karten und Crossle-Papieren oder der Armagh Robinson Library mit genealogischen Funden. Kooperationen mit dem National Museums and Galleries of Northern Ireland (MAGNI) erweitern den Zugriff auf folkloristische und transportbezogene Archive.
Kultur
Die Kultur Irlands ist eng mit der Geschichte, Sprache und Identität des Landes verbunden. Neben Englisch ist Irisch (Gaeilge) eine offizielle Landessprache, die vor allem in bestimmten Regionen, den sogenannten Gaeltacht-Gebieten, aktiv gesprochen wird. Musik und Tanz spielen eine zentrale Rolle im kulturellen Leben: Traditionelle irische Musik mit Instrumenten wie Geige, Flöte, Harfe und Bodhrán ist weltweit bekannt, ebenso der rhythmische irische Tanz, der durch Shows wie Riverdance berühmt wurde.
Irland hat eine reiche literarische Tradition und brachte viele berühmte Schriftsteller hervor, darunter James Joyce, Oscar Wilde, William Butler Yeats und Samuel Beckett. Die Kunst und das Handwerk des Landes sind häufig von Natur, Geschichte und alten keltischen Mythen inspiriert. Ein besonders wichtiger Feiertag ist der St. Patrick’s Day am 17. März, der nicht nur in Irland, sondern auf der ganzen Welt mit Paraden, Musik und der Farbe Grün gefeiert wird.
Im Alltag sind die Iren bekannt für ihre Offenheit, ihren Humor und ihre Gastfreundschaft. Der Begriff Craic steht für gute Stimmung und gemeinsames Vergnügen, oft im Pub, der als sozialer Treffpunkt für Musik, Gespräche und Geselligkeit dient. Insgesamt spiegelt die irische Kultur eine starke Verbindung zwischen Tradition, Gemeinschaft und Lebensfreude wider.
Museen
In der Republik Irland gibt es mehr als hundert Museen:
| Name | Ort | County | Typ |
| Abbeyleix Heritage House | Abbeyleix | Laois | Lokale Belange |
| Allihies Copper Mine Museum | Allihies | Cork | Bergbau |
| Altidore Castle | Kilpedder | Wicklow | Historisches Gebäude |
| Aran Heritage Centre | Kilronan | Galway | Lokale Belange |
| Áras an Uachtaráin | Dublin | Dublin | Historisches Gebäude |
| Ardara Heritage Centre | Ardara | Donegal | Industrie |
| Ardgillan Castle | Balbriggan | Dublin | Historisches Gebäude |
| Arigna Mining Experience | Arigna | Roscommon | Bergbau |
| Arklow Maritime Museum | Arklow | Wicklow | Meeresbiologie |
| Ashtown Castle | Dublin | Dublin | Historisches Gebäude |
| Athenry Castle | Athenry | Galway | Historisches Gebäude |
| Athenry Heritate Center | Athenry | Galway | Verschiedenes |
| Aughnanure Castle | Oughterard | Galway | Historisches Gebäude |
| Avondale House | Rathdrum | Wicklow | Historisches Gebäude |
| Ballina Arts Centre | Ballina | Mayo | Kunst |
| Ballintubber Abbey | Ballintubber | Mayo | Kirche |
| Ballymore Historic Features | Camolin | Wexford | Landwirtschaft |
| Bantry Museum | Bantry | Cork | Lokale Belange |
| Bantry House | Bantry | Cork | Historisches Gebäude |
| Barryscourt Castle | Carrigtwohill | Cork | Historisches Gebäude |
| Battle Of Aughrim Interpretative Centre | Aughrim | Galway | Militär |
| Belcarra Eviction Cottage | Belcarra | Mayo | Lokale Belange |
| Belltable Arts Centre | Limerick | Limerick | Kunst |
| Belvedere House and Gardens | Mullingar | Westmeath | Historisches Gebäude |
| Berkeley Costume and Toy Museum | New Ross | Wexford | Toy |
| Bishop Daniel Delany Museum | Tullow | Carlow | Biografisches |
| Blennerville Windmill | Blennerville | Kerry | Mühle |
| Boyle Abbey | Boyle | Roscommon | Kirche |
| Bray Heritage Centre | Kilpedder | Wicklow | Lokale Belange |
| Brian Boru Heritage Centre | Killaloe | Clare | Geschichte |
| Bunratty Castle & Folk Park | Bunratty | Clare | Open air |
| Burren Centre | Kilfenora | Clare | Natural Geschichte |
| Cahir Castle | Cahir | South Tipperary | Historisches Gebäude |
| Cape Clear Museum | Cape Clear Island | Cork | Lokale Belange |
| Cappoquin House & Gardens | Cappoquin | Waterford | Historisches Gebäude |
| Carlow County Museum | Carlow | Carlow | Lokale Belange |
| Carrick Craft Basketry Museum | Mountnugent | Cavan | Kunst |
| Carrowmore Megalithic Cemetery | Clifden | Sligo | Archäologie |
| Castlecoote House | Castlecoote | Roscommon | Historisches Gebäude |
| Castlerea Railway Museum | Castlerea | Roscommon | Eisenbahn |
| Castletown House | Celbridge | Kildare | Historisches Gebäude |
| Cavan and Leitrim Railway | Dromod | Leitrim | Eisenbahn |
| Cavan County Museum | Ballyjamesduff | Cavan | Lokale Belange |
| Cavanacor House | Lifford | Donegal | Historisches Gebäude |
| Céide Fields | Ballycastle | Mayo | Archäologie |
| Ceim Hill Museum | Union Hall | Cork | Lokale Belange |
| Celtic Furrow Visitor Centre | Ballintubber | Mayo | Geschichte |
| Chester Beatty Library | Dublin | Dublin | Verschiedenes |
| Clare Archaeology Centre | Corofin | Clare | Archäologie |
| Clare Heritage Centre Museum | Corofin | Clare | Lokale Belange |
| Clare Museum | Ennis | Clare | Lokale Belange |
| Claypipe Centre | Knockcroghery | Roscommon | Industrie |
| Clew Bay Heritage Centre | Westport | Mayo | Lokale Belange |
| Cliffs of Moher Visitor Centre | Killaloe | Clare | Natural Geschichte |
| Clogher Heritage Complex | Claremorris | Mayo | Historisches Gebäude |
| Clonalis House | Castlerea | Roscommon | Historisches Gebäude |
| Cobh Heritage Centre | Cobh | Cork | Geschichte |
| Colmcille Heritage Centre | Gartan | Donegal | Kirche |
| Connemara Heritage and History Centre | Clifden | Galway | Open air |
| Cork Butter Museum | Cork | Cork | Nahrungsmittel |
| Cork City Gaol | Cork | Cork | Gefängnis |
| Cork Public Museum | Cork | Cork | Verschiedenes |
| Cork Vision Centre | Cork | Cork | Verschiedenes |
| County Carlow Military Museum | Carlow | Carlow | Militär |
| County Museum Dundalk | Dundalk | Louth | Lokale Belange |
| Craggaunowen – the Living Past Experience | Sixmilebridge | Clare | Open air |
| Crawford Municipal Art Gallery | Cork | Cork | Kunst |
| Croagh Patrick Visitor Center | Murrisk | Mayo | Verschiedenes |
| Cruachan Aí Heritage Centre | Tulsk | Roscommon | Archäologie |
| Dartfield Horse Museum and Heritage Centre | Dartfield | Galway | Verschiedenes |
| De Valera Museum and Bruree Heritage Centre | Bruree | Limerick | Biografisches |
| Derryglad Folk Museum | Curraghboy | Roscommon | Geschichte |
| Drimnagh Castle | Drimnagh | Dublin | Historisches Gebäude |
| Doagh Famine Village | Doagh Island | Donegal | Open air |
| Donaghmore Famine Workhouse Museum | Donaghmore | Laois | Geschichte |
| Donegal Castle | Donegal | Donegal | Historisches Gebäude |
| Donegal Ancestry Centre | Ramelton | Donegal | Lokale Belange |
| Donegal County Museum | Letterkenny | Donegal | Lokale Belange |
| Donegal Railway Centre | Donegal | Donegal | Eisenbahn |
| Douglas Hyde Centre | Frenchpark | Roscommon | Biografisches |
| Douglas Hyde Gallery | Dublin | Dublin | Kunst |
| Dublin Castle | Dublin | Dublin | Historisches Gebäude |
| Dublin City Gallery The Hugh Lane | Dublin | Dublin | Kunst |
| Dublin Writers Museum | Dublin | Dublin | Literatur |
| Dunbrody | New Ross | Wexford | Meeresbiologie |
| Duncannon Fort | Duncannon | Wexford | Militär |
| Dunfanaghy Workhouse Heritage Centre | Dunfanaghy | Donegal | Verschiedenes |
| Dungarvan Castle | Dungarvan | Waterford | Militär |
| Dunguaire Castle | Kinvara | Galway | Historisches Gebäude |
| Dunlewey Centre | Dunlewey | Donegal | Historisches Gebäude |
| Dunsandle Castle | Athenry | Galway | Historisches Gebäude |
| Elphin Windmill | Elphin | Roscommon | Mühle |
| Emo Court | Emo | Laois | Historisches Gebäude |
| Fairbrook House | Kilmeaden | Waterford | Kunst |
| Famine Warhouse 1848 | Ballingarry | South Tipperary | Geschichte |
| Farmleigh | Castleknock | Dublin | Historisches Gebäude |
| Fethard Folk Farm and Transport Museum | Fethard | South Tipperary | Verschiedenes |
| Fort Dunree | Buncrana | Donegal | Militär |
| Foxford Woollen Mills Visitor Centre | Foxford | Mayo | Industrie |
| Fr McDyer's Folk Village Museum | Glencolmcille | Donegal | Open air |
| Fr Murphy Centre | Boolavogue | Wexford | Landwirtschaft |
| Fr Patrick Peyton CSC Memorial Centre | Attymass | Mayo | Kirche |
| Fox's Lane Museum | Youghal | Cork | Geschichte |
| Frye Model Railwyay | Malahide | Dublin | Eisenbahn |
| GAA Museum | Dublin | Dublin | Sport |
| Galway City Museum | Galway | Galway | Lokale Belange |
| Gallery of Photography | Dublin | Dublin | Kunst |
| Glasnevin Museum | Glasnevin | Dublin | Geschichte |
| Glebe House and Gallery | Letterkenny | Donegal | Kunst |
| Glengowla Mines | Oughterard | Galway | Bergbau |
| Glenveagh Castle | Churchill | Donegal | Historisches Gebäude |
| Glenview Folk Museum | Ballinamore | Leitrim | Geschichte |
| Famine Museum and Granuaile Visitor Centre | Louisburgh | Mayo | Geschichte |
| Greenan Farm Museums & Maze | Greenan | Wicklow | Landwirtschaft |
| Guinness Storehouse | Dublin | Dublin | Nahrungsmittel |
| Gurtnagrough Folk Museum | Ballydehob | Cork | Geschichte |
| Hennigan's Heritage Centre | Knock | Mayo | Lokale Belange |
| Hillview Museum | Bagenalstown | Carlow | Geschichte |
| Hook Lighthouse | Fethard-on-Sea | Wexford | Meeresbiologie |
| Hunt Museum | Limerick | Limerick | Kunst |
| Ionad Deirbhle | Aughleam | Mayo | Lokale Belange |
| Imaginosity, Dublin Children’s Museum | Sandyford | Dublin | Kinder |
| Inishowen Maritime Museum | Greencastle | Donegal | Meeresbiologie |
| International Museum of Wine | Kinsale | Cork | Geschichte |
| Ireland's Historic Science Centre | Birr | Offaly | Wissenschaft |
| Irish Agricultural Museum | Murrintown | Wexford | Landwirtschaft |
| Irish Fly Fishing and Game Shooting Museum | Attanagh | Laois | Sport |
| Irish Jewish Museum | Dublin | Dublin | Judentum |
| Irish Museum of Modern Art | Dublin | Dublin | Kunst |
| Irish National Heritage Park | Wexford | Wexford | Open air |
| Irish National Stud | Celbridge | Kildare | Sport |
| Jackie Clarke Library and Archives | Ballina | Mayo | Bibliothek |
| James Joyce Centre | Dublin | Dublin | Literatur |
| James Joyce Tower and Museum | Sandyford | Dublin | Literatur |
| James Mitchell Museum | Galway | Galway | Naturgeschichte |
| Jeanie Johnston | Dublin | Dublin | Meeresbiologie |
| Kennedy Homestead | New Ross | Wexford | Historisches Gebäude |
| Kerry Bog Village Museum | Glenbeigh | Kerry | Historisches Gebäudes |
| Kerry County Museum | Tralee | Kerry | Lokale Belange |
| Kilmainham Gaol | Kilmainham | Dublin | Gefängnis |
| Kilmore Quay Maritime Museum | Kilmore Quay | Wexford | Meeresbiologie |
| Kiltartan Gregory Museum and Millennium Park | Gort | Galway | Biografisches |
| Kiltimagh Museum | Aughleam | Mayo | Lokale Belange |
| King House | Boyle | Roscommon | Historisches Gebäude |
| King John's Castle | Limerick | Limerick | Historisches Gebäude |
| Knappogue Castle | Quin | Clare | Historisches Gebäude |
| Knock Shrine | Knock | Mayo | Kirche |
| Lackagh Museum And Heritage Park | Turloughmore | Galway | Historisches Gebäude |
| Lewis Glucksman Gallery | Cork | Cork | Kunst |
| Lifetime Lab | Cork | Cork | Technologie |
| Lifford Courthouse | Lifford | Donegal | Gefängnis |
| Limerick City Gallery | Limerick | Limerick | Kunst |
| Limerick City Museum | Limerick | Limerick | Lokale Belange |
| Lismore Castle | Lismore | Waterford | Kunst |
| Lismore Heritage Centre | Lismore | Waterford | Lokale Belange |
| Lissadell House | Sligo | Historisches Gebäude | |
| Lockes Distillery Museum | Kilbeggan | Westmeah | Industrie |
| Lough Gur Visitors Centre | Bruff | Limerick | Archäologie |
| Malahide Castle | Malahide | Dublin | Historisches Gebäude |
| Marsh's Library | Dublin | Dublin | Library |
| Mayo North Family Heritage Centre | Castlehill | Mayo | Verschiedenes |
| Michael Collins Centre | Clonakilty | Cork | Biografisches |
| Michael Davitt Museum | Straide | Mayo | Biografisches |
| Mill Museum | Tuam | Galway | Mühle |
| The Model (Sligo) | Sligo | Sligo | Kunst |
| Monaghan County Museum | Monaghan | Monaghan | Lokale Belange |
| Mountmellick Museum | Mountmellick | Laois | Lokale Belange |
| Tara's Palace Museum of Childhood | Enniskerry | Wicklow | Spielzeug |
| Muckross House | Killarney | Kerry | Open air |
| Museum of Country Life | Castlebar | Mayo | Geschichte |
| Museum of the Master Saddler | Ballyjamesduff | Cavan | Industrie |
| National 1798 Rebellion Centre | Enniscorthy | Wexford | Geschichte |
| National Gallery of Ireland | Dublin | Dublin | Kunst |
| Natural History Museum | Dublin | Dublin | Natural Geschichte |
| National Leprechaun Museum | Dublin | Dublin | Kultur |
| National Library of Ireland | Dublin | Dublin | Bibliothek |
| National Maritime Museum of Ireland | Dún Laoghaire | Dublin | Meeresbiologie |
| National Museum of Ireland - Archaeology | Dublin | Dublin | Archäologie |
| National Museum of Ireland - Decorative Arts & History | Dublin | Dublin | Verschiedenes |
| National Photographic Archive | Dublin | Dublin | Library |
| National Print Museum of Ireland | Dublin | Dublin | Kunst |
| National Transport Museum of Ireland | Howth | Dublin | Transportation |
| National Wax Museum | Dublin | Dublin | Wachs |
| Newtownbarry House | Bunclody | Wexford | Historisches Gebäude |
| Newmills Corn and Flax Mills | Milltown | Donegal | Landwirtschaft |
| Nora Barnacle House | Galway | Galway | Historisches Gebäude |
| Number Twenty Nine - Georgian House Museum | Dublin | Dublin | Historisches Gebäude |
| Ormonde Castle | Carrick-on-Suir | South Tipperary | Historisches Gebäude |
| Parke's Castle | Leitrim | Historisches Gebäude | |
| Patrick Kavanagh Centre | Inniskeen | Monaghan | Literatur |
| Patrick Pearse's Cottage | Rosmuc | Galway | Biografisches |
| Partry House | Partry | Mayo | Historisches Gebäude |
| Pearse Museum | Rathfarnham | Dublin | Natural Geschichte |
| Phoenix Park Visitor Centre | Dublin | Dublin | Lokale Belange |
| Poet's Cottage | Camross | Laois | Historisches Gebäude |
| Portumna Castle | Portumna | Galway | Historisches Gebäude |
| Project Arts Centre | Dublin | Dublin | Kunst |
| Quiet Man Cottage Museum | Cong | Mayo | Medien |
| Radio Museum Experience | Cork | Cork | Technologie |
| Rathfarnham Castle | Rathfarnham | Dublin | Historisches Gebäude |
| Redwood Castle | Lorrha | North Tipperary | Historisches Gebäude |
| Rock of Cashel | Carrick-on-Suir | South Tipperary | Historisches Gebäude |
| Roscommon County Museum | Roscommon | Roscommon | Lokale Belange |
| Ross Castle | Killarney | Kerry | Historisches Gebäude |
| Royal Hibernian Academy | Dublin | Dublin | Kunst |
| Russborough House | Blessington | Wicklow | Historisches Gebäude |
| Science Gallery | Dublin | Dublin | Wissenschaft |
| Sheep and Wool Centre | Leenane | Galway | Industrie |
| Skibbereen Heritage Centre | Skibbereen | Cork | Lokale Belange |
| Sligo Abbey | Sligo | Sligo | Kirche |
| Sligo County Museum | Sligo | Sligo | Lokale Belange |
| Sligo Folk Park | Riverstown | Sligo | Open air |
| South Tipperary County Museum | Clonmel | South Tipperary | Verschiedenes |
| St. Connell's Museum | Glenties | Donegal | Lokale Belange |
| St. Kilian's Heritage Centre | Mullagh | Cavan | Kirche |
| St. Mullins Heritage Centre | St Mullin's | Carlow | Lokale Belange |
| Stradbally Steam Museum | Stradbally | Laois | Transport |
| Strokestown Park | Strokestown | Roscommon | Historisches Gebäude |
| Swiss Cottage | Cahir | South Tipperary | Historisches Gebäude |
| Thomas Dillon's Claddagh Gold Museum | Galway | Galway | Verschiedenes |
| Thoor Ballylee | Gort | Galway | Literatur |
| Tullow Museum | Tullow | Carlow | Lokale Belange |
| Waterford County Museum | Dungarvan | Waterford | Lokale Belange |
| Waterford Museum of Treasures | Waterford | Waterford | Lokale Belange |
| Waterways Ireland Visitor Centre | Dublin | Dublin | Meeresbiologie |
| West Cork Regional Museum | Clonakilty | Cork | Lokale Belange |
| Westport House | Westport | Mayo | Historisches Gebäude |
| Wexford County Museum | Enniscorthy | Wexford | Lokale Belange |
| Wicklow's Historic Gaol | Wicklow | Wicklow | Gefängnis |
| Ye Olde Hurdy Gurdy Museum of Vintage Radio | Howth | Dublin | Technologie |
| Yeats Memorial Building | Sligo | Sligo | Biografisches |
Die wichtigsten Museen in Nordirland sind:
| Name | Ort | Themen | ||
| Armagh County Museum | Armagh | Regionalmuseum mit Geschichte, Archäologie, Kunst | ||
| Crumlin Road Gaol | Belfast | ehemaliges Gefängnis mit Museumsteil | ||
| Fermanagh County Museum | Enniskillen | Sammlung regionaler Geschichte und Kulturgut | ||
| HMS Caroline | Belfast (Titanic-Stadtteil) | schwimmendes Museumsschiff (Erster Weltkrieg) | ||
| Inniskillings Museum (Enniskillen Castle) | Enniskillen | Militärgeschichte der Regimenter von Fermanagh | ||
| Linen Hall Library | Belfast | Bibliothek mit Ausstellungen, historische Bestände | ||
| Museum of Free Derry | Derry / Londonderry | zum Thema „Free Derry“ und politischer Geschichte | ||
| Northern Ireland War Memorial | Belfast | Erinnerung an die Kriege und ihre Auswirkungen in NI | ||
| The Saint Patrick Centre | Downpatrick | Ausstellung über das Leben des heiligen Patrick | ||
| Somme Museum | zwischen Bangor und Newtownards | unabhängiges Museum in der Region Belfast / Ards | ||
| The Siege Museum | Derry / Londonderry | Ausstellung über die Belagerung von Derry (Siege of Londonderry) | ||
| Titanic Belfast | Belfast | Bau & Untergang der Titanic | ||
| Ulster Museum | Belfast | Nationalmuseum | ||
| Ulster Folk Museum | Cultra, östlich von Belfast | Nationalmuseum | ||
| Ulster Transport Museum | Cultra | Nationalmuseum | ||
| Ulster American Folk Park | Omagh | Nationalmuseum | ||
Architektur
Aus der Ur- und Frühgeschichte Irlands sind viele Steinmonumente, vor allem aus der Jungsteinzeit erhalten. Dabei unterscheidet man:
- Menhire (Menhir bedeutet „langer Stein“) oder Stehende Steine, einzeln stehende Steine, die wahrscheinlich als Grenz- oder Totengedenksteine dienten.
- Megalithgräber, wörtlich „Großsteingräber“. Megalithgräber stellen die bedeutendsten Relikte der Jungsteinzeit in Nordeuropa (etwa -4000 bis -2500) dar. Sie geben eindrucksvoll Zeugnis von dem hochentwickelten Totenkult jener Zeit. Die frühesten Gräber sind Kammergräber (um -3000 bis -2500) die hauptsächlich im nördlichen Teil der Insel verbreitet sind. Aufrecht stehende Steine bilden eine - teilweise in Nischen unterteilte - Kammer, davor befindet sich ein runder Vorhof, in dem die Begräbnisriten abgehalten wurden. Über dem Grab wurde aus Erde oder Steinen ein Hügel aufgeschüttet. Ein späterer Typus sind die besonders eindrucksvollen Ganggräber (passage graves), wie zum Beispiel bei Newgrange. Ein langer, schmaler, von Menhiren begrenzter Gang führt zu einer zentralen Grabkammer, von der einzelne Nischen abgehen. Auch die Ganggräber wurden mit einem Erdhügel bedeckt und rundum von Steinen umgeben, die teilweise reich mit Ornamenten (Kreisen, Spiralen, Rhomben und Zickzacklinien) verziert sind. Die Gräber wurden über einen längeren Zeitraum für die Toten einer Familie oder Dorfgemeinschaft benutzt, in manchen fand man Knochen von über 200 Menschen. Kleinere Megalithgräber sind die Dolmen („Steintische“). Sie bestehen aus mehreren Orthostaten, senkrecht stehenden Steinen, auf denen ein großer Deckstein liegt. Dieser Deckel ist bis zu 100 Tonnen schwer und wurde mit Hilfe von Erdrampen auf die Monolithen aufgelegt. Die irischen Legenden geben eine etwas poetischere Version. Der Sagenheld Diarmuid war mit Graínne, der angehenden Frau des Recken Finn MacCool, geflohen und suchte mit ihr auf der Flucht vor dem eifersüchtigen Finn ein Jahr lang jede Nacht ein anderes Lager. Allnächtlich baute er eine dieser steinernen Schutzhütten, die deshalb im Volksmund auch Beds of Diarmuid and Graínne heißen.
- Die dritte Gruppe bilden Steinsetzungen, aus mehreren Steinen gebildete Anlagen wie Steinkreise oder -reihen, die in der Bronzezeit, etwa -2500 bis -300 entstanden (zum Beispiel Drombeg). Diese Formationen von Monolithen unterschiedlicher Größe, Form und Anzahl dienten kultischen Zwecken oder als Versammlungsstätten der Sippe. Teilweise waren es auch astronomische Markierungen, wahrscheinlich zur Beobachtung der Sterne. Zu jener Zeit entwickelte sich in Irland eine hohe Kunst der Metallverarbeitung, insbesondere von Bronze- und Goldarbeiten. Neben Waffen und Gebrauchsgegenständen wurden vor allem Goldschmiedearbeiten von hohem Niveau hergestellt. Aus der Eisenzeit (zirka -300 bis 450) sind eindrucksvolle Wohn- und Verteidigungsanlagen erhalten. Eingewanderte Kelten bauten die beeindruckenden Hügel- oder Steinforts. Aus Erde oder Lehm wurden Wälle errichtet, so genannte Raths, innerhalb derer sich die einfachen, in Trockensteinbauweise - also ohne Mörtel - errichteten Behausungen befanden (zum Beispiel Staigue Fort). Innerhalb der breiten Mauern, auf die von innen Treppen führen, befinden sich meist mehrere Kammern und Gänge. Einen anderen Befestigungstyp bilden die Crannógs, künstliche, mit Palisaden befestigte Inseln in Ufernähe eines Sees.
Das besondere Verdienst des heiligen Patrick bestand darin, daß er auf friedlichem Wege Irland vom Heidentum zum Christentum bekehrt hat. Die hochentwickelten, bis in die Steinzeit zurückreichenden künstlerischen Traditionen wurden nicht zerstört, sondern dem Christentum dienstbar gemacht. Für die nun an religiöse Inhalte gebundene Kunst eröffneten sich durch die rasche Etablierung des Christentums neue Wege.
Rund 270 Ogham-Steine wurden in Irland gefunden. Die Ogham-Schrift, benannt nach Ogmios, dem keltischen Gott der Schrift, ist die älteste irische Schrift. Sie entstand etwa um 300 n. Chr. nach dem Vorbild des lateinischen Alphabets. Somit ist Gaelisch nach Griechisch und Latein die dritte schriftlich überlieferte europäische Sprache, die allerdings fast ausschließlich für Inschriften auf Grab- und Gedenksteinen verwendet wurde. Die Schrift war bis zum 7./8. Jahrhundert in Gebrauch.
Mit der Einführung des Christentums entwickelten sich die Klöster nicht nur zu Zentren der Bildung, der Gelehrsamkeit und des Kunstschaffens, sondern waren gleichzeitig auch Handwerksstandort, Markt- und Münzstätte sowie Pilgerziel. Diese verschiedenen Funktionen lassen die Bezeichnung Klosterstädte zu. (Die heute noch erhaltenen Klosteranlagen wie Monasterboice, Glendalough oder Clonmacnoise datieren allerdings aus einer späteren Zeit.) Die Kirchenarchitektur Irlands begann mit kleinen, unscheinbaren Holzbauten und erreichte ihren Höhepunkt in der irischen Romanik des 12. Jahrhunderts. Da die ersten Klöster fast alle aus Holz gebaut worden waren, ist von ihnen heute nichts mehr übrig geblieben.
Unter Einfluss der Wikinger entstanden die frühen irischen Steinkirchen, wohl um das 9./10. Jahrhundert. Es handelt sich um einräumige Oratorien, die in Trockenbauweise zusammengefügt sind. Die ersten Klöster bestanden aus einer Kirche, um die sich mehrere kleine Bienenkorbzellen (clochán) scharten, die Wohnstätten der Mönche. Eine Steinmauer umgab den Klosterbezirk und schirmte ihn von der Außenwelt ab. Ogham-Steine und mit Kreuzen versehene Grabplatten markierten die Gräber der Verstorbenen.
Mit der Ankunft der Normannen im 12. Jahrhundert und der Einführung einer neuen klösterlichen Ordnung begann der Zerfall der alten irischen Klöster. In ganz Europa erlebte das Christentum im 12. Jahrhundert eine grundlegende Erneuerung (Kreuzzüge, Gründung neuer Orden undsoweiter). Die Mönche machten die Klöster wieder zum Mittelpunkt des kirchlichen Lebens. Außerdem brachten sie den gotischen Baustil mit, der in der Kirchenarchitektur bestimmend wurde. Fortan blieb die irische Architektur in engem Kontakt mit dem restlichen Europa und verlor an künstlerischer Eigenständigkeit.
Gegen Ende des 12. Jahrhunderts überzogen die verschiedensten Mönchsorden die Insel mit einem dichten Netz an mächtigen Klöstern im gotischen Stil. Auch Kathedralen - zum Beispiel die beiden Kathedralen in Dublin - sowie Dorfkirchen wurden in gotischer Bauweise gebaut. 1257 gab es bereits 38 irische Zisterzienserklöster. Sie alle - wie zum Beispiel auch Mellifont Abbey - sind streng nach den Regeln des Ordens angelegt.
Im 14. Jahrhundert war durch die englisch-irischen Auseinandersetzungen und durch die Pest das Bauen stark eingeschränkt. Im relativ friedlichen 15. Jahrhundert erlebte die Bautätigkeit wieder einen starken Aufschwung. Viele Klöster wurden im spätgotischen Stil des Flamboyant entweder wiederaufgebaut oder neu gestaltet. In der Zeit zwischen 1400 und 1535 erfolgte eine neue Blüte der Kirchenbaukunst. Die überwiegende Anzahl aller erhaltenen irischen Kirchen stammt aus dieser Zeit.
Im Jahre 1540 löste der englische König Henry VIII. die Klostergemeinden auf und eignete sich deren Besitztümer und Ländereien an. Die Auflösung der Klöster und die Reformation bedeutete nicht nur ein Ende des irischen Kirchenbaus, sondern für die katholische Mehrheit der Gläubigen in Irland war dies der Beginn einer dunklen Zeit der Unterdrückung. Im 17. und 18. Jahrhundert entstanden nur wenige, meist protestantische Kirchen nach kontinentalem Vorbild. Im 19. Jahrhundert konnten sich die Christen wieder frei zu ihrem Glauben bekennen. Nach der Gleichstellung der Katholiken 1829 entstanden zahlreiche Kathedrale überall im Lande. Sie wurden vor allem im neogotischen Stil gebaut, wie zum Beispiel in Cork.
Erst in jüngster Zeit begann sich wieder eine eigenständige irische Kirchenarchitektur zu entwickeln. Die berühmten irischen Hochkreuze sind einzigartig in der Entwicklung der Sakralkunst. Noch zirka 100 Exemplare existieren auf der Insel. Außerhalb Irlands gibt es nur noch in Schottland und in England Hochkreuze, wobei die englischen allerdings keinen Kreuzring besitzen. Die irischen Hochkreuze waren immer streng nach Osten ausgerichtet, und ihre Höhe variiert meist zwischen 3,5 und 4 m. Sie sind keine Grabkreuze, sondern Orte der Predigt, der Versammlung und des Gebets. Als Bibelkreuze hatten sie auch didaktische Funktion.
Im 8. Jahrhundert entstand die erste bekannte Form der Hochkreuze, im 9. Jahrhundert erschienen die ersten Darstellungen alttestamentarischer Szenen, die die keltischen Bandornamente allmählich auf die Schmalseiten und den Kreuzring verdrängten. Anstelle der bisherigen rein repräsentativen Funktion der Kreuze trat nun die didaktische immer mehr in den Vordergrund. Durch die zahlreichen Bildfelder und Figuren sollten die Schriftunkundigen mit der biblischen Geschichte und der Lehre Jesu vertraut werden.
Mit der irischen Romanik findet die Entwicklung der Hochkreuze ein Ende. Zwar wurden auch später noch Hochkreuze errichtet, doch stehen sie alle in der Tradition der mittelalterlichen Kreuze. Im 19. Jahrhundert erlebten die Hochkreuze einen neuen Aufschwung als Grabkreuze.
Neben den Hochkreuzen gelten die Rundtürme als Wahrzeichen der christlichen irischen Architektur, denn außerhalb Irlands sind nur noch zwei Türme in Schottland bekannt. Etwa 70 Rundtürme sind erhalten, ein Dutzend davon in - zumindest außen - sehr gutem Erhaltungszustand. In der Form erinnern sie an riesige Bleistifte: sie sind schmal und hoch und verjüngen sich nach oben hin. Die Rundtürme fungierten - wie der Campanile in Italien und das Minarett in der islamischen Welt - als Glockentürme (Cloigtheachs), die den sich nähernden Pilgern das Ziel ihrer Wanderung zeigten und von denen aus die Mönche zum Gebet gerufen wurden. Darüber hinaus dienten Rundtürme dem Schutz der Mönche und ihrer Kirchenschätze in Gefahrenzeiten. Der Eingang lag fast überall mindestens drei Meter über dem Boden. Idealen Schutz boten sie jedoch nicht. Zwar waren sie wegen der erhöhten Eingänge schwer zugänglich, aber gegen Feuer waren sie mit ihren hölzernen Böden und Treppen im Innern nicht geschützt. Die ersten Rundtürme entstanden um 900, als im Zuge der Wikingereinfälle die ersten Steinbauten in Irland entstanden. Da die Türme auch noch bis ins 12. Jahrhundert, also nach den Invasionen der Wikinger, errichtet wurden, hatten sie vermutlich neben ihrer defensiven auch eine repräsentative Funktion, um die Macht und das Ansehen der Klöster zu zeigen.
In Zusammenarbeit mit den Mönchen entstanden auch die Meisterwerke der Gold- und Bronzeschmiede. Das Metallhandwerk konnte beim Einzug des Christentums bereits auf eine lange keltische Tradition bis in die Bronzezeit mit ihren meisterhaften Goldblecharbeiten und hochentwickelten Gebrauchsgegenständen zurückblicken. Die sich rasch ausbreitenden Klöster gaben dem Metallhandwerk neue Aufträge: benötigt wurden Meßgeschirr, Reliquienschreine, liturgische Geräte, Gefäße und Vortragekreuze.
Die wichtigste Kunst im 7. und 8. Jahrhundert war neben dem Metallhandwerk die Buchmalerei. Beide Künste sind hinsichtlich ihrer ornamentalen Gestaltung recht ähnlich. Man bediente sich dabei eines recht begrenzten Motivinventars, das in unzähligen Variationen immer wieder neu gestaltet wurde. Zwischen dem späten 7. und dem frühen 9. Jahrhundert entstanden in den Klöstern wahre Meisterwerke an illustrierten Schriftstücken von unvergleichlicher künstlerischer Qualität. Die zwei berühmtesten Exemplare werden heute in der Bücherei des Trinity College in Dublin aufbewahrt. Es sind das Book of Durrow aus dem 7. Jahrhundert und das Book of Kells aus dem 9. Jahrhundert.
Der Burgenbau war - wie auch die Gotik und die Romanik - eine von außen nach Irland importierte Entwicklung. Zur Kontrolle des unterworfenen Landes bauten sich die normannischen Eroberer ab etwa 1200 mächtige Festungen. Ab dem 13. Jahrhundert wurde im Burgenbau anstelle von Holz nur noch Stein verwendet. Die normannischen Burgen sind damit die ersten großen profanen Steinbauten Irlands; bis dahin wurde Stein als Baumaterial nur für Kirchen verwendet. Im 15. Jahrhundert kam die vor allem in Schottland bekannte Form des Tower House nach Irland, wo sie rasch von dem niederen irischen Adel und von reichen Kaufleuten übernommen wurde. Diese Gebäude stellten eine Mischung aus Haus und befestigter Burg dar und dienten beiden Zwecken gleichermaßen.
Mit der Vorherrschaft der Engländer gelangte der Klassizismus nach Irland. Das Selbstverständnis und den enormen Wohlstand der britischen protestantischen Großgrundbesitzer dokumentiert die stattliche Anzahl an Herrenhäusern, die ab etwa 1720 entstanden. Die Mansion Houses sind meist von parkähnlichen Gärten umgeben. Auch diese Mode kam aus England. Heute ist Irland für seine wunderschönen Gärten berühmt.
Kunstvolle Anlagen mit Rosenarrangements, exotischen Pflanzen, Steingärten und Wasserspielen wurden harmonisch in die sie umgebende Landschaft integriert. In den großzügig angelegten Gärten findet man eine große Vielfalt an seltenen Bäumen, Büschen, Sträuchern und Blumen, denn in dem milden und feuchten Klima wächst (fast) alles.
Bildende Kunst und Malerei
Die Kunstgeschichte Irlands beginnt mit prähistorischen Zeugnissen wie den Megalithgräbern von Newgrange (um -3200), deren kunstvolle Steinritzungen geometrische Muster und Symbole zeigen. Im frühen Mittelalter blühte die keltische Kunst auf, insbesondere durch illuminierte Manuskripte wie das Book of Kells (um 800), ein Meisterwerk der insularen Buchmalerei. Diese Werke verbinden komplexe Ornamente, leuchtende Farben und christliche Symbolik und prägen bis heute das Bild der irischen Kunst.
Während des Mittelalters blieb die irische Kunst stark von religiösen Motiven geprägt. Klöster waren Zentren der künstlerischen Produktion, und Metallarbeiten wie der Ardagh-Kelch zeugen von hoher Handwerkskunst. Mit der Ankunft der Normannen und später der englischen Herrschaft geriet die einheimische Kunst ins Hintertreffen, doch Porträt- und Landschaftsmalerei gewannen im 17. und 18. Jahrhundert an Bedeutung. Künstler wie James Barry und Hugh Douglas Hamilton schufen Werke, die europäische Einflüsse mit lokalen Themen verbanden.
Im 19. Jahrhundert spiegelte die Malerei das wachsende Nationalbewusstsein wider. Die Romantik brachte eine Faszination für die irische Landschaft und Folklore hervor. Künstler wie Daniel Maclise malten historische und mythologische Szenen, die das irische Erbe betonten. Gleichzeitig entwickelte sich die Landschaftsmalerei, inspiriert von der wilden Schönheit der irischen Küsten und Berge, etwa in den Werken von Paul Henry, dessen impressionistische Darstellungen der Connemara-Landschaft ikonisch wurden.
Im 20. Jahrhundert erlebte die irische Kunst eine Modernisierung, beeinflusst von internationalen Strömungen wie Impressionismus, Expressionismus und Abstraktion. Künstler wie Jack B. Yeats, Bruder des Dichters William Butler Yeats, kombinierten expressive Maltechniken mit Themen der irischen Kultur und Geschichte. Seine Werke fangen die Stimmung des unabhängigen Irlands ein, das 1922 seine Unabhängigkeit erlangte. In Nordirland, das Teil des Vereinigten Königreichs blieb, prägten politische Spannungen, insbesondere während der Troubles (1960er bis 1990er Jahre), die Kunstszene. Künstler wie Basil Blackshaw und später Rita Duffy setzten sich mit Konflikten, Identität und Gemeinschaft auseinander.
Heute ist die bildende Kunst in Irland und Nordirland vielfältig und international anerkannt. In der Republik Irland fördern Institutionen wie die Irish Museum of Modern Art (IMMA) und die Hugh Lane Gallery zeitgenössische Künstler. In Nordirland spielen Einrichtungen wie das Ulster Museum in Belfast eine zentrale Rolle. Künstler wie Dorothy Cross und Brian Maguire thematisieren soziale und ökologische Fragen, während Streetart, etwa in Belfast, politische und kulturelle Botschaften vermittelt. Die Murals in Nordirland, die oft politische Statements darstellen, sind ein einzigartiges Phänomen und ziehen internationale Aufmerksamkeit auf sich.
Während die Republik Irland eine stärkere Betonung auf nationale Identität und keltische Wurzeln legt, ist die Kunst in Nordirland oft von der politischen Teilung und der Auseinandersetzung mit Loyalismus und Nationalismus geprägt. Dennoch teilen beide Regionen eine Liebe zur Natur und eine starke narrative Tradition in der Malerei. Zeitgenössische Künstler beider Regionen arbeiten zunehmend global und integrieren Themen wie Migration, Gender und Klimawandel.
Literatur
In Irland ist Literatur seit dem Frühmittelalter in verschiedenen Sprachen überliefert. Der Großteil liegt in irischer und englischer Sprache vor, kleinere Corpora sind auf Latein und Französisch entstanden. Dabei ist eine deutliche zeitliche Trennung hinsichtlich der Bedeutung der einzelnen literarischen Traditionen festzustellen. Während im Mittelalter die Literatur in alt-, mittel- und frühneuirischer Sprache den Großteil des Korpus bildete, der von lateinischen Texten eher ergänzt wurde, entwickelte sich ab der Zeit der normannischen Eroberung nach und nach ein kleines französisches Korpus und vor allem ein bedeutendes englischsprachiges Korpus.
Aus der Zeit vor der Christianisierung Irlands ist keine Literatur in schriftlicher Form überliefert. Wie im Falle vieler früher Kulturen wird jedoch von einer äußerst reichhaltigen mündlichen literarischen Tradition ausgegangen, die ihre Spuren in den literarischen Denkmälern der späteren Zeit jedoch mehr oder minder deutlich hinterlassen hat. Mit dem Einzug des Christentums und vor allem der Gründung von Klöstern wurde diese Literatur nach und nach in Teilen aufgezeichnet und - nach heute weithin anerkannter Lehrmeinung - stark christianisiert. Bereichert wurde diese einheimische Literatur um Werke aus dem Lateinischen und teilweise Griechischen, die zum Teil übersetzt und auch weiterentwickelt wurden. Es ist davon auszugehen, dass der mittelalterliche irische Schatz von Sagen und Erzählungen mit dem vorchristlichen Korpus nur noch entfernte Ähnlichkeiten hatte.
Mit der Eroberung der Insel durch die Normannen ab 1169 wurde nicht nur die irische Sprache in eine Konkurrenzsituation mit dem Anglo-Normannischen, später dem Englischen gebracht, die neuen Bewohner hinterlassen im Laufe der Zeit auch schriftliche Spuren in ihrer eigenen Sprache. Bis jedoch von einem nennenswerten literarischen Korpus die Rede sein kann, vergehen aufgrund der politischen und sozialen Entwicklung Irlands im Hoch- und Spätmittelalter Jahrhunderte. Erst ab dem 18. Jahrhundert kann sich das entwickeln, was heute als Anglo-Irische Literatur bezeichnet wird. Diese späte Entwicklung sollte jedoch im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zu einer ungeahnten Blüte führen, als die irische Literatur für Erzählkunst und Innovation Weltruhm erlangte. Das 20. Jahrhundert sah dann eine Vielzahl irischer Schriftsteller englischer Sprache, die ihre eigene literarische Tradition wie die „Weltliteratur„ um einiges bereicherten.
Parallel zum Aufstieg der anglo-irischen Literatur fand der Abstieg der irischsprachigen Literatur statt. Nach einem erneuten Höhepunkt im 13. und 14. Jahrhundert (Klassisches Irisch) und allmählichem Niedergang bis etwa 1600 zerbrach mit der Vertreibung der irischen Adelsschicht ab 1607 die politische und kulturelle Grundlage dieser Literaturtradition. Die Literarturproduktion sank Mitte des 19. Jahrhunderts fest gegen null. Erst gegen Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts fand als Teil der Wiederbelebung der irischen Sprache auch ein literarischer Neuanfang statt, der mit Einschränkungen bis heute anhält.
Seit etwa den 1970er Jahren nehmen die anglo-irische und die irischsprachige Literatur in der irischen Kultur Positionen ein, die theoretisch häufig als gleich wichtig eingestuft werden. Praktisch dominiert die anglo-irische Literatur jedoch zahlenmäßig und in Bezug auf Wahrnehmung - sowohl in Irland als auch vor allem im Ausland - in hohem Maße. Festzustellen ist jedoch ein relativ hoher Grad der gegenseitigen Beeinflussung der beiden Traditionen. Während viele anglo-irische Autoren offen Anspruch auf ihren Teil der langen irischen Tradition (einschließlich beispielsweise der mittelalterlichen, irischsprachigen Literatur) erheben, orientieren sich viele moderne irischsprachige Autoren in internationalem Rahmen und dabei auch und vor allem an der einheimischen Literatur englischer Sprache (so Máirtín Ó Cadhain etwa an James Joyce).
Die anglo-irische Literatur, irisch Litríocht Angla-Éireannach oder Litríocht Bhéarla na hÉireann, wird im Allgemeinen die in Irland und Nordirland entstandene Literatur bezeichnet, die in englischer Sprache verfasst wurde. Häufig wird dieser Begriff auf Werke ausgeweitet, die von „irischstämmigen“ Autoren verfasst wurden, die nicht in Irland leben, sondern in anderen Ländern, sei es in der ersten, zweiten oder einer höheren Generation. Anglo-irische Schriftsteller wurden mehrfach mit Nobelpreisen gewürdigt. Die wichtigsten sind:
- Jonathan Swift (1667 bis 1745), Prosa
- Maria Edgeworth (1767 bis 1849), Prosa
- Sydney Owenson, Lady Morgan (1776? bis 1859), Prosa
- Sheridan Le Fanu (1814 bis 1873), Prosa
- Bram Stoker (1847 bis 1912), Prosa
- Oscar Wilde (1854 bis 1900), Prosa, Drama, Lyrik
- George Bernard Shaw (1856 bis 1950), vorwiegend Dramen
- William Butler Yeats (1865 bis 1939), Lyrik, Drama, Prosa (Nobelpreis 1923)
- John Millington Synge (1871 bis 1909) vorw. Drama
- Sean O'Casey (1880 bis 1964), vorw. Drama
- James Joyce (1884 bis 1941), Prosa, ein Drama, wenig Lyrik, journalistische Texte
- Austin Clarke (1896 bis 1974), vorwiegend Lyrik
- Patrick Kavanagh (1904 bis 1967), Lyrik
- Samuel Beckett (1906 bis 1989), Drama, Prosa (Nobelpreis 1969)
- Flann O'Brien (1911 bis 1966), Prosa
- Robert Greacen (1920 bis 2008), Lyrik
- Brendan Behan (1923 bis 1964), Drama
- Brian Friel (* 1929), Drama
- Edna O'Brien (* 1930), Prosa
- Seamus Heaney (* 1939), vorwiegend Lyrik (* Nobelpreis 1995)
- Derek Mahon (* 1942), Lyrik
- John Banville (* 1945), Prosa, Drama
- Neil Jordan (* 1950), Prosa, auch Filmregisseur
- Patrick McCabe (* 1955), Prosa
- Roddy Doyle (* 1958), Prosa, zwei Dramen
- Dermot Bolger (* 1959), Prosa, Drama, Lyrik
- Deirdre Madden (* 1960), Prosa
- Joseph O’Connor (* 1963), Prosa, Drama; Journalist
Theater
Die Ursprünge des Theaters in Irland lassen sich bis in die vorchristliche Zeit zurückverfolgen. Die keltischen Barden, bekannt als Filí, waren Dichter und Geschichtenerzähler, die epische Sagen und Mythen mündlich überlieferten. Diese Erzählungen, oft begleitet von Musik und performativen Elementen, waren die ersten Formen theatralischer Darbietungen. Mit der Christianisierung Irlands im 5. Jahrhundert wurden religiöse Rituale und liturgische Dramen, wie Mysterienspiele, populär, die in Kirchen und Klöstern aufgeführt wurden.
Im Mittelalter entwickelten sich sogenannte Mummer’s Plays, volkstümliche Aufführungen, die besonders in ländlichen Gegenden während der Wintermonate stattfanden. Diese Stücke, die oft Themen wie Tod und Wiedergeburt behandelten, waren stark ritualisiert und hatten Einflüsse aus keltischen und christlichen Traditionen.
Mit der englischen Kolonisierung Irlands ab dem 16. Jahrhundert begann das Theater, sich stärker an englischen Vorbildern zu orientieren. In Dublin wurde 1637 das Werburgh Street Theatre gegründet, das erste feste Theater der Stadt. Es war jedoch vor allem der wohlhabenden anglo-irischen Oberschicht vorbehalten. Im 18. Jahrhundert wuchs die Theaterkultur mit der Eröffnung des Smock Alley Theatre (1662) und später des Crow Street Theatre (1758). Diese Bühnen brachten sowohl englische Klassiker als auch erste einheimische Werke auf die Bühne, oft mit satirischem oder politischem Unterton.
Der Wendepunkt für das irische Theater kam Ende des 19. Jahrhunderts mit der Irish Literary Revival, einer kulturellen Bewegung, die die irische Identität und Sprache wiederbeleben wollte. Eine zentrale Rolle spielte dabei die Gründung des Abbey Theatre in Dublin 1904 durch William Butler Yeats, Lady Augusta Gregory und Edward Martyn. Das Abbey Theatre, oft als Nationaltheater Irlands bezeichnet, setzte sich zum Ziel, irische Geschichten und Autoren zu fördern. Werke wie The Playboy of the Western World (1907) von John Millington Synge sorgten für Kontroversen, da sie die irische Gesellschaft kritisch beleuchteten, aber sie festigten auch die Reputation des Theaters als Plattform für mutige und innovative Dramatik.
In dieser Zeit entstanden auch andere bedeutende Dramatiker wie George Bernard Shaw, der zwar in London wirkte, aber durch seine irische Herkunft und Themen wie soziale Gerechtigkeit das irische Theater beeinflusste. Sean O’Casey brachte mit Werken wie Juno and the Paycock (1924) die Realitäten des städtischen Lebens und der politischen Unruhen in den Fokus.
In Nordirland entwickelte sich das Theater parallel, aber oft mit anderen Schwerpunkten, da die Region stärker von der britischen Kultur beeinflusst war. Das Grand Opera House in Belfast, 1895 eröffnet, wurde zur zentralen Bühne für Opern, Musicals und Dramen. Während des 20. Jahrhunderts, besonders während der Zeit der Troubles (1960er–1990er), wurde das Theater in Nordirland zu einem Medium, um die politischen Spannungen und den Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten zu thematisieren. Dramatiker wie Stewart Parker (Pentecost, 1987) nutzten das Theater, um Identitätsfragen und die Suche nach Versöhnung zu erforschen.
Im 20. und 21. Jahrhundert erlebte das irische Theater eine Blütezeit. Dramatiker wie Samuel Beckett, dessen existentialistische Werke wie Waiting for Godot (1953) die Theaterwelt revolutionierten, und Brian Friel, dessen Dancing at Lughnasa (1990) internationale Anerkennung fand, prägten das globale Bild des irischen Theaters. Das moderne Theater zeichnet sich durch seine Vielfalt aus, von experimentellen Werken kleinerer Ensembles wie dem Druid Theatre in Galway bis hin zu kommerziellen Erfolgen in Dublin und Belfast. Auch das zeitgenössische Theater in Nordirland hat sich weiterentwickelt, mit Compagnien wie Tinderbox und Kabosh, die oft ortsspezifische und sozial engagierte Stücke produzieren. Themen wie Migration, Gender und die Nachwirkungen der Troubles stehen im Vordergrund.
Die wichtigsten Theater Irlands sind das Abbey Theatre und das Focus Theatre in Dublin sowie das Siamsa tire in Tralee. Das Abbey Theatre ist das irische Nationaltheater in Dublin, Irland. Es wurde 1898 gegründet, um Werke irischer Autoren und irischer Thematik zu zeigen und zu einer kulturellen Identität Irlands beizutragen. Es erhält seit 1925 Subventionen der irischen Regierung und ist somit das erste staatlich subventionierte Theater der englischsprachigen Welt. Nach einem Brand 1951 nutzte das Ensemble das Queen's Theatre, bis 1966 das Abbey Theatre wieder aufgebaut werden konnte und heute Platz für 628 Zuschauer bietet.
Der Dichter William Butler Yeats und die Schriftstellerin Isabella Augusta Gregory waren Gründer und Direktoren des Theaters, in dem am 27. Dezember 1904 das erste Stück aufgeführt wurde. In den Anfangsjahren war das Theater eng mit den Schriftstellern der irischen Renaissance (auch Celtic Revival) verbunden und diente als Bühne für viele irische Dramatiker und Schauspieler des 20. Jahrhunderts. Zusätzlich haben die vielen Gastspiele im Ausland, insbesondere in Nordamerika dazu beigetragen, dass das Theater ein wichtiger Träger des irischen Tourismus ist.
Im Abbey Theatre wurden Stücke irischer Schriftsteller uraufgeführt, darunter Werke von Yeats und Gregory sowie von John Millington Synge, George William Russell und Sean O'Casey. Es ist bekannt für seine Produktionen von Werken aus dem frühen 20. Jahrhundert. Aber in den letzten Jahren werden auch junge Künstler und Schauspielschüler gefördert, im Abbey Theatre befindet sich eine eigene Experimentierbühne, das Peacock Theatre, wo Stücke der Abbey School of Acting aufgeführt werden.
Das Focus Theatre ist ein kleines Theater in Dublin, Irland, das in den 1970er-Jahren von Deirdre O’Connell ins Leben gerufen wurde. Die irischen Schauspieler Gabriel Byrne und Colm Meaney lernten dort 1979 ihr Schauspielhandwerk nach Konstantin Sergejewitsch Stanislawski und feierten ihre ersten Erfolge auf der Bühne des „Focus“.
Siamsa Tíre ist Irlands nationales Folkloretheater in Tralee im County Kerry. Es wurde 1974 von Pater Pat Ahern gegründet und ist das Vorzeigeprojekt irischer Musik, Tanz und anderer Folklore.
Film
Bereits kurz nach der Erfindung des Kinematographen erreichte das neue Medium die Grüne Insel. Um 1896 fanden in Dublin und Belfast die ersten Filmvorführungen statt, die das Publikum mit den bewegten Bildern begeisterten. Bald darauf begannen auch irische Filmemacher, selbst zu drehen. Einer der ersten war James H. White, der für die amerikanische Firma Edison kurze Dokumentarfilme über das Alltagsleben in Irland produzierte. Diese frühen „actualities“ zeigten Bauern, Straßenmärkte oder Landschaften und waren vor allem für das irische Publikum im Ausland interessant.
In den 1910er und 1920er Jahren entstanden die ersten Spielfilme mit irischen Themen, oft unter Beteiligung ausländischer Produktionsfirmen. Viele dieser Filme behandelten die irische Geschichte oder den Freiheitskampf gegen die britische Herrschaft. Allerdings war die Produktion schwierig, da es an finanzieller Unterstützung und technischer Infrastruktur mangelte. Nach der Unabhängigkeit 1922 versuchte die junge Republik Irland, eine eigene Filmindustrie aufzubauen, doch diese blieb klein und unregelmäßig.
In den 1930er Jahren entstanden in Dublin die ersten professionellen Studios, etwa die Ardmore Studios. Zugleich nutzte die irische Regierung das Medium Film, um ein konservatives und katholisches Selbstbild zu fördern. Dokumentarische Wochenschauen, die von der staatlichen „Irish Film Unit“ produziert wurden, zeigten das Land als fromm, landwirtschaftlich und traditionsbewusst. Die Zensur war streng – Filme, die als moralisch bedenklich galten, wurden verboten oder stark geschnitten.
Erst in den 1950er Jahren gewann Irland als Drehort für internationale Produktionen an Bedeutung. Filme wie The Quiet Man (1952) von John Ford machten das Bild des idyllischen, romantischen Irlands weltweit bekannt. In dieser Zeit kamen viele Hollywood-Produktionen ins Land, die von der landschaftlichen Schönheit und den niedrigen Produktionskosten profitierten. Dennoch blieb eine eigenständige irische Filmproduktion weiterhin begrenzt.
In den 1980er Jahren begann eine neue Ära des irischen Films. Mit der Gründung des „Irish Film Board“ (heute Screen Ireland) im Jahr 1980 entstand erstmals eine nationale Förderstruktur. Gleichzeitig veränderten gesellschaftliche Umbrüche und wirtschaftliche Modernisierung die Themen der Filme. Regisseure wie Neil Jordan (The Crying Game, Mona Lisa) oder Jim Sheridan (My Left Foot, In the Name of the Father) machten den irischen Film international bekannt. Diese Werke verbanden persönliche Geschichten mit politischen Themen wie der Nordirlandfrage, sozialer Ungleichheit oder nationaler Identität.
Auch Nordirland entwickelte sich ab den 1980er Jahren zunehmend zu einem eigenen Filmstandort. Während des Konflikts, der als The Troubles bekannt wurde, waren viele Filme politisch geprägt – etwa Hunger (2008) oder Bloody Sunday (2002). Nach dem Friedensabkommen von 1998 investierte die nordirische Regierung gezielt in die Filmindustrie. Die Gründung von Northern Ireland Screen und der Bau moderner Studios in Belfast zogen internationale Produktionen an.
Seit Beginn des 21. Jahrhunderts erlebt die gesamte Insel Irland einen regelrechten Filmboom. Große internationale Produktionen wie Braveheart (1995), Saving Private Ryan (1998), Star Wars: The Last Jedi (2017) und besonders die Serie Game of Thrones (2011 bis 2019) nutzten Irland und Nordirland als Drehorte. Gleichzeitig hat sich eine starke heimische Filmszene etabliert. Filme wie Once (2007), The Wind That Shakes the Barley (2006), Brooklyn (2015) oder The Banshees of Inisherin (2022) zeigen, dass irische Regisseure heute international erfolgreich sind, ohne ihre kulturellen Wurzeln zu verlieren.
In der Republik Irland hat die Filmförderung durch das „Irish Film Board“ (heute „Screen Ireland“) wesentlich zur Entwicklung einer lebendigen Filmkultur beigetragen. Viele irische Regisseure wie Neil Jordan, Lenny Abrahamson oder John Carney haben international Erfolge gefeiert. Filme wie Once (2007), Brooklyn (2015) oder Room (2015) zeigen nicht nur das Talent irischer Filmschaffender, sondern auch das Interesse an Themen wie Identität, Emigration und sozialem Wandel. Dublin, Galway und Cork sind heute wichtige Zentren der Filmproduktion.
Nordirland hat vor allem in den letzten Jahren durch große internationale Produktionen auf sich aufmerksam gemacht. Ein entscheidender Faktor war die Unterstützung durch die „Northern Ireland Screen“ sowie der Aufbau moderner Studios in Belfast, darunter die berühmten Titanic Studios. Besonders bekannt wurde Nordirland als Drehort der HBO-Serie Game of Thrones, die viele ihrer spektakulären Szenen an Orten wie dem Dark Hedges, Ballintoy oder Cushendun Caves drehte. Diese Erfolge haben nicht nur der Filmwirtschaft, sondern auch dem Tourismus einen enormen Aufschwung gebracht.
Kinos auf der Insel Irland
- Dublin: Stella Cinema, Light House Cinema, Irish Film Institute, Savoy Cinema, Cineworld Cinema
- Cork: Gate Cinema, Omniplex Cork, Triskel Christchurch Cinema
- Galway: Eye Cinema, Pálás Cinema
- Limerick: Odeon Limerick, Omniplex Dooradoyle
- Waterford: Omniplex Waterford, Garter Lane Arts Centre
- Sligo: Omniplex Cinema Sligo, The Model Cinema.
- Belfast: The Avenue Cinema, Omniplex Cinema Belfast (mit drein Standorten)
- Nordirland: Omniplex Cinema Newry, Omniplex Cinema Lisburn, Omniplex Cinema Antrim, Movie House Coleraine
Musik und Tanz
Die irische traditionelle Musik, oft als "Irish Trad" oder "Irish Folk" bezeichnet, ist ein reiches kulturelles Erbe, das tief in der Geschichte Irlands verwurzelt ist. Sie umfasst eine Vielzahl von Melodien, Rhythmen und Gesängen, die eng mit Tanz, Gemeinschaft und nationaler Identität verbunden sind. Im Gegensatz zu meiner vorherigen Übersicht werde ich hier eine noch detailliertere Darstellung geben, basierend auf historischen Quellen, regionalen Variationen, Einflüssen und modernen Entwicklungen. Ich werde die Geschichte chronologisch gliedern, die Genres mit Beispielen, Merkmalen und Ursprüngen beschreiben, sowie Instrumente, Stile und kulturelle Bedeutung einbeziehen. Diese Musik ist primär oral überliefert, was ihre Dynamik und Vielfalt erklärt.
Die Wurzeln der irischen traditionellen Musik reichen bis in die Eisenzeit um -500 zurück, als keltische Völker aus Mitteleuropa nach Irland einwanderten und ihre musikalischen Traditionen mitbrachten, die von östlichen Einflüssen geprägt waren. In der gälischen Epoche (bis etwa 1600) waren mindestens zehn Instrumente im Gebrauch, darunter die Crwth (eine Art Lyra), die Cláirseach (keltische Harfe mit bis zu 30 Saiten), die Tiompán (eine Saitentrommel), Feadán (Flöte), Buinne (Oboe-ähnlich), Guthbuinne (Basshorn), Beannbhuabhal und Corn (Hornpipes), Cuislenna (frühe Sackpfeifen wie die Great Irish Warpipes), Stoc und Storgán (Trompeten) sowie Cnámha (Knochen als Percussion). Poetische Erwähnungen der Fiddle (Geige) datieren auf das 7. Jahrhundert, was sie um etwa 900 Jahre älter macht als die moderne Violine.
Die Musik war eine orale Tradition, überliefert durch Barden und Wandermusiker, die in Höfen auftraten. Sie spiegelte mythologische und epische Themen wider, wie in den alten Sagen beschrieben. Die normannische Invasion im 12. Jahrhundert und die englische Kolonisierung ab dem 16. Jahrhundert unterdrückten die gälische Kultur durch Gesetze wie die Statutes of Kilkenny (1366), die irische Musik und Sprache verboten. Dennoch überlebte sie in ländlichen Gebieten, oft in privaten Zusammenkünften. Im 17. Jahrhundert beschrieben Reisende wie Richard Head lebhafte Tänze und Musik, die von Travelling Musicians (Wandermusikern) gelehrt wurden.
Die Harfe war aristokratisch und von italienischem Barock beeinflusst, wie beim Komponisten Turlough Ó Carolan (1670 bis 1738), der Blinde Harfner, der Planxties (Loblieder) schuf. Bis zum 18. Jahrhundert blieben Sammlungen rar; Edward Bunting notierte 1792 beim Belfast Harp Festival Harfenmelodien, was den Beginn systematischer Archivierung markierte.
Im 18. Jahrhundert begannen systematische Sammlungen, etwa durch George Petrie und James Goodman, die Tausende von Melodien archivierten. Balladen-Drucker in Dublin produzierten im 19. Jahrhundert Liederblätter, die Volkslieder verbreiteten. Wichtige Sammler wie Francis O'Neill (1848–1936), ein irisch-amerikanischer Polizist in Chicago, veröffentlichten Werke wie "O'Neill's Music of Ireland" mit über 1.850 Tunes.
Die Große Hungersnot um 1850 führte zu massiver Emigration, wodurch irische Musik in die USA, Australien und Europa exportiert wurde. Dort verschmolz sie mit lokalen Stilen, z. B. beeinflusste sie die US-Old-Time-Musik. Umgekehrt standardisierten US-Aufnahmen in den 1920er Jahren regionale irische Stile. Koloniale Unterdrückung, wie die Penal Laws, trieb die Musik in den Untergrund, wo sie in Hauspartys und Céilí-Tänzen überlebte.
Nach der Unabhängigkeit 1922 förderte der kulturelle Nationalismus ein erstes Revival. Die Gaelic League (gegründet 1893) ermutigte die Wiederentdeckung irischer Künste und etablierte 1903 das Feis Ceoil-Festival. In den USA half Francis O'Neill bei der Promotion. Der Public Dance Halls Act von 1935, beeinflusst von der Kirche, beschränkte öffentliche Veranstaltungen und trieb die Musik zurück ins Private.
Nach dem Zweiten Weltkrieg (bis Ende der 1950er Jahre) wurde die Musik als altmodisch abgetan, doch das zweite Revival begann in den 1960er Jahren durch Comhaltas Ceoltóirí Éireann (1951) und das Fleadh Cheoil-Festival. Die Clancy Brothers und Tommy Makem eroberten 1959 die USA und machten irische Folk wieder populär. Gruppen wie die Dubliners führten Gitarrenbegleitung ein, ersetzend sentimentale Stile (zum Beispiel Delia Murphy). Seán Ó Riada (1931 bis 1971) schuf orchestrale Arrangements mit Ceoltóirí Chualann und popularisierte den Bodhrán.
Ab den 1960er Jahren fand Irish Folk in Europa immer mehr Anhänger. Ein Zentrum dieses „Revivals“ war Doolin im irischen County Clare. Andere waren und sind Dublin, Galway und Dingle. Die Auswanderung zahlreicher Iren im Gefolge der Großen Kartoffelpest führte zur Entstehung bedeutender irischer Gemeinden unter anderem in den USA. International bekannte irische Bands wie die Chieftains oder die Dubliners finden dort ein großes Publikum. Doch auch anglo-irische Bands wie die Pogues haben mit originellen Interpretationen irischer Musik weltweit Erfolge erzielt. Gerade die Einflüsse aus den USA haben der irischen Folklore den Zugang zur weltweiten Popularität geöffnet. Verwiesen sei hier auf die erfolgreichen, bei Anhängern traditioneller irischer Folklore umstrittenen Irish-Dance-Tanzshows Riverdance und Lord of the Dance. Im Bereich Pop und Rock haben Anleihen bei der irischen Folkmusik und der Einsatz entsprechender Instrumente (Uilleann Pipes, Low Whistle) bereits Tradition. Zu den Interpreten mit solchen Einflüssen gehören Kate Bush, Enya, The Hooters und Van Morrison.
In den 1970er Jahren entstanden Fusions: Planxty und The Bothy Band mischten Trad mit Rock (Celtic Rock). Thin Lizzy (gegründet 1969) und Horslips (1970) integrierten irische Themen in Hard Rock. Die 1980er brachten globale Erfolge durch The Chieftains, Clannad und Enya (New Age-Fusion). Die Pogues (1980er) schufen Folk-Punk, Afro-Celt Sound System (1990er) mischte mit afrikanischen Rhythmen. Organisationen wie die Folk Music Society of Ireland (1971) und das Irish Traditional Music Archive (1987) unterstützten die Erhaltung. Im 21. Jahrhundert halten Festivals und digitale Plattformen die Musik lebendig, mit Bands wie Beoga, Danú und Kíla, die Fusions weiterentwickeln.
Irische Trad gliedert sich in Tanzmusik, Airs und Gesänge. Tanzmusik ist isometrisch, mit Phrasen in AABB-Form (zwei Teile, je wiederholt), oft in Sets (Medleys) gespielt. Modi: Ionian, Aeolian, Dorian, Mixolydian, pentatonisch/hexatonisch. Ornamente: Rolls, Cuts, Crans, Slides. Hier eine detaillierte Tabelle der Hauptgenres:
| Genre | Taktart | Merkmale | Ursprünge | Regionale Variationen | Beispiele |
| Reels | 4/4 oder 2/2 | Schnell (110–120 BPM), energiegeladen, gleichmäßiger Rhythmus, für Stepdance. | 18. Jahrhundert, schottisch-irisch. | Donegal: schnell, bogenbetont. | "The Foxhunter" (5-teilig), "The Wind That Shakes the Barley". |
| Jigs | 6/8 (Double/Single), 9/8 (Slip/Hop) | Bouncy, fröhlich; Double: Dreier-Gruppen; Slip: fließend. | 16. Jahrhundert, englisch, in Irland adaptiert. | Nationwide, Kerry: langsamer. | "The Kesh Jig", "The Strayaway Child" (6-teilig), "The Haymakers Jig". |
| Hornpipes | 4/4, geswingt | Swing-Feel (dotted eighths), langsamer (80–100 BPM), maritim; oft identische Enden. | 17. Jahrhundert, englisch-seefahrerisch. | Sessions allgemein. | "The Harvest Home", "The Rights of Man". |
| Polkas | 2/4 | Marschartig, repetitiv, schnell; in Sets. | 19. Jahrhundert, böhmisch, in Munster adaptiert. | Südwesten (Kerry, Cork). | "The Ballydesmond Polka", "John Ryan's Polka". |
| Slides | 12/8 | Gleitend, swingend; jig-ähnlich. | Irische Adaptation. | Sliabh Luachra (Munster). | "The Star Above the Garter", "The Brosna Slide". |
| Mazurkas | 3/4, Akzent auf 2. Schlag | Swing-Feel, C-Phrasen statt A-Wiederholung. | Polnisch, 19. Jahrhundert | Donegal prominent. | "Sonny's Mazurka". |
| Highlands | 4/4, ähnlich Reels | Strathspey-ähnlich mit Scots Snap. | Schottisch. | Donegal. | "The Cat That Kittled in Jamie's Wig". |
| Waltzes | 3/4, Akzent auf Downbeat | Späterer Zusatz, schwerer Akzent. | Europäisch. | Allgemein. | "The Marino Waltz". |
Die wichtigsten Instrumente der traditionellen irischen Volksmusik sind:
Fiddle (Geige)
- oeschreibung: Eine Violine, die mit regionalen Techniken (zum Beispiel Donegal: schnell, bogenbetont; Clare: langsamer, ornamentreich) gespielt wird. Zentral für Tanzmusik wie Reels und Jigs.
- Herkunft: Früh erwähnt im 7. Jahrhundert, etabliert im 18. Jahrhundert.
- Verwendung: Melodieführung in Sessions; berühmte Spieler wie Michael Coleman.
Uilleann Pipes (irische Sackpfeife)
- Beschreibung: Ellenbogenbetriebene Sackpfeife mit Chanter (Melodiepfeife), Drones (Borduntöne) und Reglern (Akkordtasten). Komplex, mit weichem, melodischem Klang.
- Herkunft: 18. Jahrhundert, entwickelt aus früheren Warpipes.
- Verwendung: Solo- oder Session-Spiel, oft für Airs; Meister wie Paddy Keenan.
Tin Whistle (Blechflöte)
- Beschreibung: Einfache, sechslochige Metallflöte, erschwinglich und tragbar. Produziert klare, hohe Töne.
- Herkunft: 19. Jahrhundert, industriell gefertigt.
- Verwendung: Melodien in Reels, Jigs; Low Whistle für tiefere Töne.
Fliúit (Flöte)
- Beschreibung: Querflöte aus Holz oder Metall, ähnlich der klassischen Flöte, aber mit einfacherem Design. Atemig und warm im Klang.
- Herkunft: 19. Jahrhundert, aus europäischen Traditionen übernommen.
- Verwendung: Melodieführung, oft mit Tin Whistle kombiniert; Spieler wie Matt Molloy.
Cláirseach (Harfe)
- Beschreibung: Keltische Harfe mit 30 bis 34 Saiten, melodisch und resonanzreich. Nationales Symbol Irlands.
- Herkunft: Mittelalter, aristokratisch; Turlough Ó Carolan als berühmter Harfner.
- Verwendung: Weniger in Tanzmusik, mehr für Airs oder Solo; modern reviviert.
Bodhrán (Rahmentrommel)
- Beschreibung: Einseitige Trommel (30–65 cm Durchmesser), mit Schlägel (Tipper) gespielt. Vielseitige Rhythmen.
- Herkunft: Frühgeschichte unsicher, populär seit 1960er durch Seán Ó Riada.
- Verwendung: Rhythmische Begleitung in Sessions; Spieler wie Christy Moore.
Bosca Ceoil (Akkordeon)
- Beschreibung: Blasebalginstrument, meist diatonisch (Knopf- oder Piano-Akkordeon). Liefert Melodie und Akkorde.
- Herkunft: 19. Jahrhundert, aus Europa importiert.
- Verwendung: Tanzmusik, besonders Polkas; Sharon Shannon als bekannte Spielerin.
Consairtín (Concertina)
- Beschreibung: Kleines, sechseckiges Blasinstrument, ähnlich dem Akkordeon, aber kompakter. Hoher, klarer Klang.
- Herkunft: 19. Jahrhundert, englisch-deutsch.
- Verwendung: Melodien, besonders in Clare; Spieler wie Noel Hill.
Banjo (Tenor-Banjo)
- Beschreibung: Viersaitiges Banjo in GDAE-Stimmung, perkussiv und klar.
- Herkunft: 1920er Jahre, aus US-Jazz übernommen.
- Verwendung: Melodie- und Rhythmusbegleitung; Barney McKenna (Dubliners).
Búsúicí (Bouzouki)
- Beschreibung: Achtsaitiges, langhalsiges Zupfinstrument, oft in GDAD-Stimmung. Akkord- und Melodieunterstützung.
- Herkunft: 1960er Jahre, aus griechischer Musik adaptiert (Johnny Moynihan).
- Verwendung: Begleitung, populär durch Planxty.
Giotár (Gitarre)
- Beschreibung: Akustische Gitarre, oft in DADGAD-Stimmung für offene Akkorde.
- Herkunft: 1960er Jahre, US-Folk-Einfluss.
- Verwendung: Rhythmische und harmonische Begleitung; Spieler wie Paul Brady.
Maindilín (Mandoline)
- Beschreibung: Viersaitiges Zupfinstrument, ähnlich dem Banjo, mit hellem Klang.
- Herkunft: 19. Jahrhundert, italienischer Einfluss.
- Verwendung: Melodien, oft in Sessions.
Bones und Spoons
- Beschreibung: Paarweise gespielte Knochen oder Löffel als Percussion. Einfach, rhythmisch.
- Herkunft: Alte keltische Tradition, auch US-Einfluss.
- Verwendung: Improvisierte Rhythmusunterstützung in Sessions.
Die Ursprünge der klassischen Musik in Irland lassen sich auf die mittelalterlichen Klöster zurückführen, wo liturgische Gesänge und frühe polyphone Musik gepflegt wurden. Irische Mönche wie Columban der Jüngere trugen im 6. und 7. Jahrhundert zur Verbreitung gregorianischer Gesänge in Europa bei. Die keltische Harfe, ein Symbol Irlands, spielte in dieser Zeit eine zentrale Rolle, besonders in aristokratischen Kreisen. Harfner wie Turlough O’Carolan (1670 bis 1738), oft als „letzter der Barden“ bezeichnet, verbanden irische Melodien mit barocken Strukturen, beeinflusst von italienischen Komponisten wie Vivaldi. Seine „Planxties“ (Loblieder) und Concerti sind frühe Beispiele einer hybriden irischen Klassik.
Im 18. Jahrhundert begann die klassische Musik in Dublin, dem kulturellen Zentrum der Insel, aufzublühen. Die Stadt war ein wichtiger Standort für europäische Musik, da sie unter englischer Herrschaft stand. Georg Friedrich Händels „Messiah“ wurde 1742 in Dublin uraufgeführt, ein Meilenstein, der die Stadt als Musikzentrum etablierte. Konzertgesellschaften wie die Dublin Musical Society förderten Aufführungen europäischer Werke, und Theater wie das Smock Alley Theatre boten Opern von Komponisten wie Thomas Arne. Dennoch war die klassische Musik elitär und stand im Schatten der lebendigeren Volksmusiktradition.
Im 19. Jahrhundert, während der Romantik, entwickelte sich eine irische klassische Musik, die zunehmend nationale Themen aufgriff. Die Große Hungersnot (1845 bis 1852) und die wachsende Unabhängigkeitsbewegung förderten einen kulturellen Nationalismus, der sich in der Musik widerspiegelte. Komponisten wie John Field (1782 bis 1837), geboren in Dublin, gelten als Pioniere. Field erfand das Nocturne, eine lyrische Klavierform, die später Frédéric Chopin beeinflusste. Seine Werke, wie die Nocturnes und Klavierkonzerte, brachten irische Melodien in die europäische Romantik.
Andere bedeutende Figuren waren Charles Villiers Stanford (1852 bis 1924) und Michele Esposito (1855 bis 1929). Stanford, ein Dubliner, komponierte Sinfonien, Opern und Kammermusik, oft inspiriert von irischen Volksmelodien, wie in seiner „Irish Symphony“ (1887). Esposito, ein Italiener, der in Dublin wirkte, gründete die Royal Irish Academy of Music (1848) und förderte die musikalische Ausbildung. Die Gaelic League (gegründet 1893) unterstützte die Integration traditioneller Musik in klassische Kompositionen, etwa durch Sammlungen von Edward Bunting.
Das 20. Jahrhundert brachte eine stärkere Eigenständigkeit der irischen klassischen Musik, obwohl sie oft im Schatten Englands stand. Arnold Bax (1883 bis 1953), ein Engländer mit Liebe zu Irland, komponierte Werke wie „In the Faery Hills“, inspiriert von der irischen Mythologie. Frederick May (1911 bis 1985) und Brian Boydell (1917 bis 2000) experimentierten mit moderneren, atonale Stilen, während Seán Ó Riada (1931 bis 1971), bekannt für seine Arbeit in der Volksmusik, auch klassische Werke wie die Filmmusik zu „Mise Éire“ (1959) schuf, die traditionelle Melodien orchestrierte.
Nach der Unabhängigkeit 1922 förderten Institutionen wie Radio Éireann (heute RTÉ) die klassische Musik durch das RTÉ National Symphony Orchestra (gegründet 1948). Die Contemporary Music Centre Ireland (1985) unterstützte neue Komponisten. Komponisten wie Gerald Barry (geboren 1952) mit seiner avantgardistischen Oper „The Intelligence Park“ (1990) und Seóirse Bodley (geboren 1933) mit Werken wie „A Small White Cloud Drifts over Ireland“ brachten moderne Klänge in die irische Musik.
Heute ist die irische klassische Musik vielfältig und international anerkannt. Komponisten wie Donnacha Dennehy (geboren 1970) verbinden Minimalismus mit irischen Elementen, etwa in „Grá agus Bás“ (2007), das Sean-nós-Gesang integriert. Jennifer Walshe (geboren 1974) experimentiert mit Multimedia und Improvisation, während Bill Whelan, bekannt für die Musik zu „Riverdance“ (1994), traditionelle Klänge in orchestralen Kontexten nutzt. Festivals wie das West Cork Chamber Music Festival und Institutionen wie die Irish Chamber Orchestra fördern neue Werke und Talente.
Die Wurzeln der irischen Popmusik liegen in der Nachkriegszeit, als Irland wirtschaftlich und kulturell herausgefordert war. In den 1940er und 1950er Jahren begannen Künstlerinnen wie Delia Murphy traditionelle irische Lieder mit einem zugänglicheren, pop-orientierten Stil zu interpretieren. Murphy, bekannt als die "Queen of Irish Ballad", nahm Songs wie „The Spinning Wheel“ für HMV auf und machte irische Musik international bekannt. Ebenfalls aus dieser Zeit stammt Ruby Murray aus Belfast, die 1955 mit „Softly, Softly“ fünf Top-10-Hits in den UK-Charts hatte und als Irlands erste internationale Popstarin gilt. Bridie Gallagher, die „Girl from Donegal“, erreichte in den späten 1950er Jahren mit sentimentalen Emigrantenballaden wie „A Mother’s Love’s a Blessing“ große Beliebtheit, besonders in der irischen Diaspora.
In den 1960er Jahren erlebte Irland den Aufstieg der Showbands, eine einzigartige Erscheinung in der irischen Musikszene. Diese sechs- bis siebenköpfigen Ensembles spielten in Tanzhallen Coverversionen von Rock ’n’ Roll, Country, Jazz und Pop-Hits, oft mit einem irischen Twist. Bands wie die Royal Showband oder die Miami Showband zogen Tausende an und waren besonders in ländlichen Gebieten populär. Sie führten auch eigene Songs ein, wie Brendan Boyers „Hucklebuck“, und legten den Grundstein für die Professionalisierung der irischen Musikszene. Die Showbands waren nicht nur musikalisch, sondern auch visuell ansprechend, mit einheitlichen Kostümen und energiegeladenen Performances. Trotz ihres Erfolgs schwand ihr Einfluss Ende der 1960er Jahre mit dem Aufkommen von Rock und Beatmusik.
Die 1970er Jahre markierten den Übergang zu einer moderneren Pop- und Rockmusik. Thin Lizzy, angeführt von Phil Lynott, kombinierte Hard Rock mit irischen Themen in Hits wie „Whiskey in the Jar“ (1972), einer Neuinterpretation eines traditionellen Folksongs. Ihre Mischung aus kraftvollem Rock und lyrischer Poesie machte sie zu Pionieren des Celtic Rock. Gleichzeitig experimentierten Bands wie Horslips mit einer Fusion aus traditioneller Musik und psychedelischem Rock, was Alben wie „The Táin“ (1973) prägte.
Die 1980er Jahre brachten den Durchbruch von U2, einer der einflussreichsten Bands der Musikgeschichte. Mit Alben wie „The Joshua Tree“ (1987) und Hits wie „With or Without You“ und „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ kombinierten sie Post-Punk, Pop-Rock und spirituelle Texte, die weltweit resonierten. Ihr Stadionrock-Sound und Bono’s charismatische Bühnenpräsenz machten sie zu globalen Superstars. Parallel dazu entwickelte Clannad einen atmosphärischen, New-Age-inspirierten Pop-Sound, der traditionelle gälische Elemente integrierte. Ihr Song „Theme from Harry’s Game“ (1982) wurde ein internationaler Hit und führte zur Solokarriere von Enya, deren Album „Watermark“ (1988) mit „Orinoco Flow“ die Charts stürmte. Enya’s einzigartiger Ethereal-Pop machte sie zu einer der erfolgreichsten irischen Künstlerinnen.
Die 1990er Jahre waren eine goldene Ära für irische Popmusik. The Cranberries, angeführt von Dolores O’Riordan, brachten mit „Linger“ (1993) und „Zombie“ (1994) einen melancholischen Alternative-Pop-Rock-Sound, der soziale und politische Themen wie den Nordirland-Konflikt ansprach. Boyzone, eine der ersten Boybands, dominierte mit Covers wie „Words“ (1996) die Charts und ebnete den Weg für spätere Acts wie Westlife. The Corrs kombinierten Pop mit traditionellen irischen Instrumenten (Fiddle, Tin Whistle) in Hits wie „Breathless“ (2000), was ihnen einen einzigartigen Platz in der Popmusik sicherte. Sinéad O’Connor sorgte mit ihrer kraftvollen Stimme und „Nothing Compares 2 U“ (1990) für einen weltweiten Hit, wobei sie oft kontroverse Themen ansprach.
Im neuen Jahrtausend setzte sich die Vielfalt fort. Westlife, eine weitere Boyband, verkaufte weltweit über 55 Millionen Platten mit Balladen wie „My Love“ (2000). Snow Patrol, obwohl aus Nordirland, erlangten mit „Chasing Cars“ (2006) globalen Erfolg im Indie-Pop-Rock. The Script brachten mit Alben wie „Science & Faith“ (2010) und Songs wie „Breakeven“ einen emotionalen, pop-rockigen Sound. Der Durchbruch von Hozier mit „Take Me to Church“ (2013) markierte einen Wendepunkt, da sein soulvoller, folk-infizierter Pop soziale Themen wie Religion und Sexualität ansprach und weltweit in den Charts landete.
Heute prägen Künstler wie Dermot Kennedy („Outnumbered“, 2019) mit seinem Mix aus Folk, Pop und R&B sowie Niall Horan (ehemals One Direction) mit Solo-Hits wie „Slow Hands“ (2017) die Szene. Neue Talente wie Fontaines D.C. bringen Post-Punk mit irischen literarischen Einflüssen, während CMAT und Lyra mit ihrem eklektischen Pop Aufmerksamkeit erregen.
Kleidung
Mode spielt in Irland keine besondere Rolle, Kleidung soll dem irischen Verständnis nach in erster Linie praktisch und bequem sein. Sprich Kleidung muss dem Regen trotzen. Etwas modischer und schicker ist lediglich die Abendgarderobe.
Ältere Herren mögen es meist klassisch und bequem: Cord-Hose, ein Sakko und eine Schirmmütze aus Irish Tweed sind die bevorzugte Wahl. Jüngere Iren greifen dagegen tagsüber meist auf Trainingshose, Kapuzenpulli und Turnschuhe zurück. Beide Generationen befolgen jedoch die Regel: Wer abends ausgeht, macht sich chic. Das Verständnis von Chic variiert dabei aber natürlich. Während die Älteren zum Restaurantbesuch eine Krawatte umbinden, wechseln die Jüngeren vor der Disco Jogginghose gegen Jeans.
Bei den jüngeren Damen ist die nächtliche Verwandlung noch auffälliger. Die bei auch bei ihnen übliche Jogginghose wird abends gegen einen kurzen Rock eingetauscht, die Turnschuhe gegen High Heels, das weite T-Shirt gegen ein knappes Top.
Die irischen Strickwaren (Aranpullover beziehungsweise Aransweater) sind nicht nur auf der „Grünen Insel“, sondern mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt und gern getragen. Die Tradition der irischen Aran-Strickwaren hat ihren Ursprung auf den Aran Islands, eine Inselgruppe vor der irischen Westküste. Die einheimischen Männer nutzten Gänsefedern als Stricknadeln. Später nahmen die Frauen kreativen Einfluss und entwickelten Strickmuster. Die Bezeichnungen der Muster orientierten sich an Dingen, mit denen die Einheimischen nahezu täglich in Berührung kamen, so entstanden Namen wie beispielsweise Honigwabe, Seemannstau und Brombeermuster.
Kulinarik und Gastronomie
Die irische Küche ist traditionell eine einfache und deftige Hausmannskost. Wichtige Produkte des Landes sind Lamm- und Rindfleisch, Geflügel, Eier, Butter und andere Milchprodukte, Forellen und Lachs sowie Krebse und Muscheln. Getreideanbau ist aufgrund der Feuchtigkeit nur in geringerem Umfang möglich. Dem Gemüseanbau (vor allem Kartoffeln und Kohl) kommt jedoch eine große Bedeutung zu.
Die irische Küche war seit Beginn der Besiedlung vor allem darauf ausgerichtet, die Bewohner ausreichend zu ernähren. Das Nahrungsangebot war nicht sehr reichhaltig. In der Geschichte Irlands kam es mehrfach zu großen Hungersnöten und die Versorgung der Bevölkerung mit dem Nötigsten war nicht immer gewährleistet. Während der Großen Hungersnot in Irland zwischen 1846 und 1851, die durch Kartoffel-Missernten ausgelöst wurde, starben nach Schätzungen mehr als eine Million Menschen. Die Einwohnerzahl des Landes sank aus diesem Grund um bis zu 25 %. Weitere rund 1,5 Millionen Menschen wanderten aus und versuchten ihr Glück in Kanada, Australien, den USA und den Industriezentren Englands.
Das wichtigste Getreide war lange Zeit Hafer, der zum Brotbacken verwendet wurde und als Grundlage von Porridge. Weizen wurde ebenfalls angebaut, war jedoch den Oberschichten vorbehalten. Helles Brot war ein Privileg der Wohlhabenden. Eine herausragende Rolle spielten seit jeher auch Milchprodukte. Frische Milch galt als wohlschmeckend und nahrhaft und wurde Gästen als Erfrischung serviert. Außerdem waren Butter, Quark und Käse wichtige Grundnahrungsmittel. Mit Wasser verdünnte Molke wurde vor allem in den Klöstern getrunken.
Fleisch stand bis ins 20. Jahrhundert hinein der Bevölkerungsmehrheit nur selten zur Verfügung und hatte den Status eines Luxuslebensmittels. Seit der Besiedelung Irlands wurden Rindfleisch und Lammfleisch gegessen, später kamen Schweinefleisch und Geflügel hinzu sowie Eier. An der Küste spielte naturgemäß auch Fisch eine wichtige Rolle, vor allem Schellfisch. Traditionell gehörten hier auch essbare Algen zu den Nahrungsmitteln. Die bekannteste Art ist Palmaria palmata (dulse), die roh als Salat gegessen wird oder gekocht als Beilage zu Kartoffeln oder Brot. Porphyra (sloke) wird gekocht und mit Butter und Gewürzen verfeinert als Gemüse mit Kartoffeln gegessen.
Die Kartoffel wurde Ende des 16. Jahrhunderts in Irland eingeführt und wurde von allen Schichten gegessen. Durch das um 1600 einsetzende starke Bevölkerungswachstum hing die Ernährung sehr stark von Getreideprodukten ab. Steigende Getreidepreise führten dazu, dass die ärmeren Schichten zunehmend von Kartoffeln lebten. Die Missernten von 1845 bis 1848 führten zu einer großen Hungersnot mit vielen Todesopfern. Die irische Alltagskost besteht auch heute noch vor allem aus Kartoffeln, Gemüse, Fleisch, Milch, Brot und Butter.
Ein traditionelles irisches Frühstück besteht aus Rashers (Bacon) und Black & White Pudding (je eine Scheibe gebratene Blutwurst und Leberwurst) sowie irische Schweins-Würstchen. Dazu werden Eier, als Rühr- oder Spiegelei, Bratkartoffeln oder Soda-Farls (Kartoffelpuffer), Pilze wie Champignons, gebackene Bohnen und gebratene Tomaten serviert. Toast, Wheaten oder Farmhouse Soda Bread (ein dunkles, unfermentiertes Sodabrot), Butter und verschiedene Marmeladen runden das Frühstück ab. Sehr beliebt sind außerdem Scones, die man mit Butter, Marmelade, Honig oder Ahornsirup verspeist.
Getrunken wird zum Frühstück der irische Schwarztee (Irish Breakfast), eine malzige, Assam-basierte Teemischung, und Orangensaft. So wie in Großbritannien wird auch in Irland der Tee grundsätzlich mit Milch getrunken.
Die als „traditionell“ beworbene Mahlzeit wurde allerdings meistens nur von der höheren, englischen Gesellschaft eingenommen, da sich die irische Bevölkerung oftmals kein Fleisch leisten konnte. Auch heute wird das Frühstück eher nur von Touristen konsumiert, kaum von Iren.
Obwohl die Gewässer Irlands fischreich sind, wird im Vergleich zu anderen Küstenländern relativ wenig Fisch gegessen. Erst mit zunehmendem Wohlstand wurden der recht teure Fisch und andere Meeresfrüchte regelmäßige Bestandteile des Irischen Speisezettels. Ernährungsgrundlage war und ist die Kartoffel. Auch in kleinen Läden finden sich bis zu zehn verschiedene Sorten. Daneben gilt Rindfleisch als wertvolle Mahlzeit. Es wird als Steak (Sirloin, Striploin, Fillet), Roasts (Schmor- und Bratenstücke) und Stewing Beef (Gulasch) angeboten. Für Ausländer gewöhnungsbedürftig ist, dass in Irland auch preiswertere Fleischteile, die sich aufgrund eines höheren Bindegewebsanteils eigentlich nicht zum Kurzbraten eignen, in Scheiben geschnitten als „Steaks“ (round steak) angeboten werden. Diese werden oftmals mechanisch bearbeitet, um sie zarter zu machen (tenderised). Schweinefleisch wird ungepökelt vorwiegend als Schweinefillet (pork steak) und Lende (pork loin) angeboten. Alle anderen Teile des Schweins werden gepökelt und als Speck (bacon) und Schinken (ham) angeboten, wobei Speck die (fetteren) Bauchteile und Schinken die (magerern) Keulenteile bezeichnet. Etwa 20% des in Irland verzehrten Fleisches ist Lammfleisch, wobei auch Innereien vom Lamm (Leber und Nieren) gerne verarbeitet werden. Hausgeflügel (Huhn und Truthahn) hat ebenfalls einen großen Anteil an der Irischen Ernährung, wobei Truthahn im ganzen gebraten (roast Turkey) traditionell an Festtagen zubereitet wird, wenn sich die Familie und Verwandte zum gemeinsamen Festmahl treffen.
Zum Stew (Eintopf), Steak oder Roast werden in der Regel Kartoffeln (in Form von Bratkartoffeln, Ofenkartoffeln, Pommes Frites oder Kartoffelpüree) gereicht. Dazu gibt es Gemüse (Erbsen, Karotten, Lauch, Pastinaken, Steckrüben und verschiedene Kohlsorten, sowie Brot und Butter. Zu Weihnachten wird traditionell Rosenkohl als Gemüsebeilage gereicht. Kopf- und andere Blattsalate werden in der Regel nur mit Essig und Öl angemacht. Zu einem Salatteller gehören auch Krautsalat (mit Mayonnaise angemachter Coleslaw), Kartoffelsalat (mit Frühlingszwiebeln, Essig und Mayonnaise angemaches, kalt serviertes Kartoffelpürree) sowie rohe und eingelegte Gemüse (vor allem rote Beete).
Irische Suppen zeichnen sich durch eine dicke, fast breiartige Konsistenz aus und sind immer püriert. Klassische Suppen sind Gemüsesuppe, Hühnersuppe und Rindfleischsuppe, wobei klare Suppen in Irland ganz unbekannt sind.
Während des Mittelalters waren Milch und Molke die wichtigsten Alltagsgetränke, während Bier ein festliches Getränk war. Das höchste Prestige hatte jedoch Met aus fermentiertem Honigwasser. Guinness wird abends im Pub getrunken und nicht zu den Mahlzeiten. Zum Essen gibt es Mineralwasser oder Lager. Abends trinken sie das schon erwähnte Guinness, aber auch Smithwicks (auf dem Kontinent besser unter der Marke Kilkenny bekannt), ein malzig schmeckendes Ale, oder Cider.
In Irland wird auch Poteen (irisch Poitín) getrunken, hierbei handelt es sich um schwarzgebrannten Whiskey (seltener auch Kartoffelschnaps, ähnlich dem Wodka), der je nach Herkunft entweder gute Qualität aufweist oder nur bedingt genusstauglich ist. Im 19. Jahrhundert ist Tee das wichtigste Alltagsgetränk der Iren geworden, ebenso wie in England.
Irish Stew, das traditionelle, mit Kümmel gewürzte Eintopfgericht aus Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln und Hammel- oder Rindfleisch, wird in Irland heute nicht mehr so häufig gegessen. Die gehobene Küche der Restaurants ist mittlerweile stark von anderen Küchen beeinflusst, darunter französisch und italienisch. Das in der hohen Gastronomie verwendete Lamm- und Rindfleisch stammt aus Freilandhaltung. Die irische gehobene Küche ist heute bekannt für ihre Meeresfrüchte: Austern, Venusmuscheln, Jakobsmuscheln, Hummer, Krabben und zahlreiche Süß- und Salzwasserfische. Vor allem der irische Lachs ist beliebt. Lachs wird sowohl gegrillt als auch pochiert und geräuchert.
Irish Whiskey
Irischer Whiskey, oft als „Irish Whiskey“ bekannt, ist ein weltweit geschätztes Getränk mit einer langen und traditionsreichen Geschichte. Er unterscheidet sich von anderen Whiskys, wie dem schottischen Whisky oder amerikanischen Bourbon, durch seine einzigartige Herstellung, seinen Geschmack und seine kulturelle Bedeutung. In diesem Text werfen wir einen Blick auf die Geschichte, Herstellung, Besonderheiten und die bekanntesten Marken des irischen Whiskeys.
Die Wurzeln des irischen Whiskeys reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück. Mönche sollen die Kunst der Destillation aus dem Mittelmeerraum nach Irland gebracht haben, ursprünglich zur Herstellung von Medizin. Der Begriff „Whiskey“ leitet sich vom gälischen Ausdruck „uisce beatha“ ab, was „Wasser des Lebens“ bedeutet. Im 19. Jahrhundert war Irland eines der weltweit führenden Länder in der Whiskeyproduktion, mit hunderten Destillerien, insbesondere in Dublin.
Allerdings erlebte die irische Whiskey-Industrie im 20. Jahrhundert Rückschläge durch politische Unruhen, den Unabhängigkeitskrieg, die Prohibition in den USA und wirtschaftliche Krisen. Viele Destillerien mussten schließen, und die Produktion konzentrierte sich auf wenige große Marken. Seit den 1980er Jahren erlebt irischer Whiskey jedoch eine Renaissance, mit neuen Destillerien und einem wachsenden globalen Interesse.
Irischer Whiskey wird nach strengen Vorschriften hergestellt, die sicherstellen, dass er seinen charakteristischen Geschmack und seine Qualität behält. Die wichtigsten Merkmale der Herstellung sind:
- Rohstoffe: Irischer Whiskey wird hauptsächlich aus Gerste (gemälzt oder ungemälzt), Mais, Weizen oder Roggen hergestellt. Wasser aus den klaren irischen Quellen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
- Destillation: Im Gegensatz zu schottischem Whisky, der meist zweifach destilliert wird, durchläuft irischer Whiskey in der Regel eine dreifache Destillation. Dies führt zu einem weicheren und leichteren Geschmack.
- Reifung: Der Whiskey muss mindestens drei Jahre in Eichenfässern reifen, oft in ehemaligen Bourbon-, Sherry- oder Weinfässern, die ihm komplexe Aromen verleihen.
- Arten: Es gibt verschiedene Arten von irischem Whiskey:
- Single Malt: Hergestellt aus gemälzter Gerste in einer einzigen Destillerie.
- Single Pot Still: Eine Mischung aus gemälzter und ungemälzter Gerste, typisch für Irland.
- Grain Whiskey: Aus Getreide wie Mais oder Weizen, oft für Blends verwendet.
- Blended Whiskey: Eine Mischung verschiedener Whiskeys, die den Großteil des Marktes ausmacht.
Irischer Whiskey ist bekannt für seinen sanften, weichen und oft fruchtigen Geschmack. Die dreifache Destillation sorgt für eine geringere Intensität von rauchigen oder torfigen Noten, wie sie bei schottischem Whisky häufig vorkommen. Typische Aromen umfassen Vanille, Karamell, Zitrusfrüchte, grüne Äpfel und manchmal würzige oder blumige Nuancen. Die Abwesenheit von Torfrauch macht ihn besonders zugänglich, auch für Whiskey-Neulinge.
Ein weiteres Merkmal ist die Vielfalt der Stile, die von leichten und frischen Blends bis hin zu komplexen Single Pot Still Whiskeys reicht. Die Verwendung von ungemälzter Gerste in Single Pot Still Whiskeys verleiht diesen Varianten eine einzigartige Textur und Würze. Einige der bekanntesten irischen Whiskeys und ihre Destillerien sind:
- Jameson: Der weltweit meistverkaufte irische Whiskey, ein Blend, der für seine Zugänglichkeit und Vielseitigkeit bekannt ist.
- Bushmills: Eine der ältesten Destillerien der Welt, bekannt für Single Malts und Blends aus Nordirland.
- Redbreast: Ein Premium Single Pot Still Whiskey, oft als einer der besten irischen Whiskeys gefeiert.
- Tullamore D.E.W.: Ein beliebter Blend mit einer weichen und ausgewogenen Geschmacksnote.
- Teeling: Eine moderne Destillerie aus Dublin, die innovative Whiskeys mit einzigartigen Fassreifungen produziert.
Irischer Whiskey ist tief in der irischen Kultur verwurzelt und wird oft bei gesellschaftlichen Anlässen, Festen oder als Geschenk genossen. Er eignet sich pur, auf Eis, in Cocktails wie dem Irish Coffee oder als Bestandteil von Mixgetränken. Die wachsende Popularität hat auch zu einer boomenden Whiskytourismus-Branche geführt, mit Besucherzentren in Destillerien wie Jameson in Dublin oder Bushmills in Nordirland.
Festkultur
In Irland gelten folgende offizielle Feiertage:
| Termin | Name | Bedeutung |
| 1. Januar | New Year's Day | Neujahr |
| 17. März | St. Patrick's Day | Feiertag des irischen Nationalheiligen |
| 10. April 2009 | Good Friday | Karfreitag (nur NI) |
| 13. April 2009 | Easter Monday | Ostermontag |
| 1. Mo. im Mai | May Bank Holiday | Bankfeiertag zum Tag der Arbeit |
| Letzer Mo. im Mai | Spring Bank Holiday | Bankfeiertag (nur NI) |
| 1. Mo. im Juni | June Bank Holiday | Bankfeiertag (nur ROI) |
| 12. Juli | Battle of the Boyne Day | Tag der Schlacht am Boyne (nur NI) |
| 1. Mo. im August | First Monday in August | Bankfeiertag |
| Letzter Mo. im Oktober | Last Monday in October | Bankfeiertag |
| 25. Dezember | Christmas Day | Weihnachten (1. Weihnachtsfeiertag) |
| 26. Dezember | Boxing Day | Weihnachten (2. Weihnachtsfeiertag) |
Irischer Nationalfeiertag ist der Saint Patricks Day am 17. März. Es ist dies der Gedenktag zu Ehren des irischen Nationalheiligen Padraig (Patrick). Er war der erste christliche Missionar in Irland. Der 17. März ist ein gesetzlicher Feiertag in der Republik Irland, in Nordirland, im britischen Überseegebiet Montserrat sowie der kanadischen Provinz Neufundland. Der St. Patrick's Day wird weltweit von Iren, irischen Emigranten und zunehmend auch von Nicht-Iren gefeiert. In Dublin und den meisten anderen irischen Städten machen große Paraden und vielfältige laute Aktivitäten den St. Patrick's Day zu einem bunten Volksfest. Die weltweit größten Paraden finden in Dublin, New York, Boston, New Orleans, Chicago, Manchester und Savannah statt; und selbst in der britischen Hauptstadt London finden jährlich eine Parade und ein Festival statt. Am 17. März ist Grün die vorherrschende Farbe der feiernden Iren in aller Welt; in einigen Städten (zum Beispiel Chicago) werden am St. Patrick's Day sogar die Flüsse grün eingefärbt. Auch Bier (aber nicht das irische Guinness) wird an diesem Tag manchmal grün eingefärbt.
Als christlicher Feiertag wird der St. Patrick's Day vor allem in der Römisch-Katholischen Kirche sowie der Church of Ireland, einer anglikanischen Kirchengemeinschaft begangen. Weil dort der St. Patrick's Day in die Fastenzeit fällt, ist den Iren an diesem Tag eine Fastenpause erlaubt. Im Jahr 2008 wurde der Feiertag von der römisch-katholischen Kirche auf den 15. März vorverlegt, da er sonst in die Karwoche gefallen wäre, was aber den Feiertag der Republik Irland nicht betrifft. Dieses Phänomen tritt nur sehr selten auf, zuletzt im Jahre 1940 und das nächste Mal im Jahre 2160.
Medien
In Irland werden seit drei Jahrhunderten Zeitungen herausgegeben. Das allererste Nachrichtenblatt mit dem Titel 'Eine Beschreibung der wichtigsten Begebenheiten' wurde im Februar 1659 veröffentlicht. Später, Ende des 17. /Anfang des 18. Jahrhunderts, enstanden eine Reihe von fundierteren Zeitungen, wie zum Beispiel Faulkners Dublin Journal, das 1725 gegründet wurde und ein Jahrhundert bestand, und Saunders News-Letter (1755 bis 1879). Von den in dieser Zeit gegründeten Zeitungen hat lediglich der Belfast Newsletter überlebt. Der Newsletter wurde 1734 zum ersten Mal herausgegeben und ist somit die älteste Zeitung des Landes.
Das 19. Jahrhundert brachte viele erfolgreiche Zeitungen hervor, unter ihnen die Dublin Evening Mail (1821 bis 1962) und Freeman's Journal (1763 gegründet), das 1924 in The Irish Independent, eine der heutigen nationalen Zeitungen, übergegangen ist. Viele Tages- und Wochenzeitungen wurden in den großen Städten publiziert. Unter den Titeln, die in Cork herausgegeben wurden, das 1851 eine Bevölkerung von 85.745 Einwohnern hatte, gab es The Free Press,The Herald und The Constitution. Im gleichen Jahr hatte Galway mit einer Bevölkerung von 23.695 sechs Zeitungen; inTralee, Co. Kerry, mit einer Bevölkerung von 15.156 gab es acht Zeitungen (fünf Wochenzeitungen und drei Abendzeitungen) und in Waterford, mit einer Bevölkerung von 11.257 wurden zwei Abendzeitungen herausgebracht.
Die erste Massenzeitung war The Irish Times, die 1859 von Major Lawrence Knox auf den Markt gebracht wurde. The Irish Independent wurde im Januar 1905 gegründet. Éamon De Valera, der damalige Führer der Fianna Fáil-Partei und spätere Taoiseach (Premierminister) und Präsident, gründete 1931 The Irish Press, deren Erfolg zur Einführung von The Sunday Press (1949) und The Evening Press (1954) führte. Die drei Irish Press-Titel werden seit 1995 nicht mehr publiziert. Es werden sieben Tageszeitungen am Morgen herausgegeben, drei davon in Dublin: The Irish Independent, The Irish Times und The Star; drei in Belfast: The Irish News, Daily Ireland und The News Letter, und eine, The Irish Examiner, in Cork. Es gibt ebenfalls vier Abendzeitungen: The Evening Herald und The Evening News (Dublin), The Belfast Telegraph und The Evening Echo (Cork). The Evening News erscheint seit September 1996 nicht mehr. In Dublin werden fünf Sonntagszeitungen herausgebracht: The Sunday Independent, The Sunday World, The Sunday Tribune, The Sunday Business Post und eine wöchentliche Sportzeitung, die jetzige Ireland on Sunday. The Sunday Life wird in Belfast publiziert.
Der irischsprachigen Gemeinde steht die erste Tageszeitung auf Irisch zur Verfügung, LÁ, die im April 2004 in Belfast gegründet wurde, sowie die Wochenzeitung FOINSE und eine Reihe von Zeitschriften wie Comhar, Feasta, Teanga, Teangeolas, an tUltach, Saol, Timire an Chroí Naofa. In der Irish Times wie auch in einer Reihe von Lokalzeitungen erscheinen ebenfalls regelmäßig Beiträge auf Irisch.
Es gibt mehr als 60 Lokalzeitungen, die meist wöchentlich erscheinen. The Kerryman ist mit einer Auflage von 34000 die am meisten verkaufte Lokalzeitung. Viele der Lokalzeitungen sind im Familienbesitz und unabhängig von den größeren Verlagshäusern. Es gibt ebenfalls ein breitgefächertes Angebot an Magazinen und Zeitschriften.
Radio Telefís Éireann (RTÉ) ist die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt. Seit 1. Januar 1926 gibt es Rundfunkübertragungen, und die erste Fernsehübertragung war am 31. Dezember 1961. Die RTÉ-Direktion besteht aus neun Mitgliedern, die von der Regierung ernannt werden. Geschäftsführer ist der Generaldirektor. Es gibt unterschiedliche Abteilungen für Rundfunk, Fernsehen und Nachrichten, mit Verwaltung, technischen Unterstützungssystemen, Fernsehproduktionseinrichtungen und Informationstechnologie. RTÉ erfüllt einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag, indem es ein umfangreiches Programm anbietet. Der Service besitzt ein landesweites Netzwerk mit steigender Betonung der lokalen Einspeisung und der Nachrichtenerfassung.
TG4, das 1996 als Teilifís na Gaeilge ans Netz ging, bietet Fernsehsendungen auf Irisch und ebenfalls zweisprachige und englischsprachige Programme. Dieser Sender wird täglich von etwa 800.000 Zuhörern eingeschaltet. TV3 ist Irlands erster kommerzieller Fernsehsender.
Rundfunksendungen werden über vier Sendenetze landesweit über FM in Stereo ausgestrahlt. Radio 1 sendet jährlich über 9.500 Stunden sowohl auf Irisch als auch auf Englisch. Die Programme umfassen Nachrichten, Zeitgeschehen, Musik, Drama und Varieté, Feuilleton, Landwirtschaft, Bildung, Religion und Sport. 2FM ist ein 24-Stunden Musik- und Unterhaltungskanal mit einem hohen Anteil Zeitgeschehen. Raidió na Gaeltachta sendet ausschließlich in irischer Sprache. Lyric FM bietet klassische Musik. RTÉ kann europaweit über Astra-Satellit und teilweise über den Galaxy 5 Satelliten in Nordamerika empfangen werden.
RTÉ Televsion strahlt landesweit auf RTÉ 1 und Network 2 aus. Beide Kanäle ergänzen sich, mit einer gesamten Sendezeit von 10.000 Stunden pro Jahr. Über die Hälfte der Produktionen werden selbst hergestellt mit einer Anteil von unabhängigen Produzenten. Die RTÉ-Belegschaft von etwa 2135 Mitarbeitern besteht aus Autoren, Journalisten, Musikern, Schauspielern, Sängern, Produzenten, Künstlern und Designern. Der Sender ist mit 140 Vollzeit-Musikern und vielen freien Mitarbeitern der größte Anbieter von Musikproduktionen aller Art. Der Sender finanziert sich aus Lizenzgebühren (zur Zeit 50% der Gesamteinnahmen), Einnahmen aus Werbung und zusätzlich kommerziellen Einnahmen. 2003 betrug das Gesamteinkommen zirka € 313 Millionen, mit einem Betriebsüberschuss von € 2.261.000. RTÉ Commercial Enterprises umfasst The RTÉ Guide, das meistverkaufte Magazin mit einer Auflage von 106.000.
Die Broadcasting Commission of Ireland (Rundfunkkommission von Irland) ist zuständig für eine Reihe von Schlüsselgebieten im Hinblick auf Rundfunk- und Fernsehübertragungen in Irland, gemäß den Bestimmungen des Radio and Television Act (Rundfunk- und Fernsehgesetz) von 1988 und dem Broadcasting Act (Übertragungsgesetz) von 2001. Diese beinhalten die Lizenzvergabe, Richtlinien und Bestimmungen, Kontrolle, Entwicklung, Forschung und Information. Die Kommissionsmitglieder wurden 2003 von der Regierung ernannt. Zur Zeit haben 48 Stationen die Lizenz für Rundfunkübertragungen. Es gibt ebenfalls eine unabhängige landesweite Rundfunksendung, Today FM.
Eine zentrale Rolle iunnerhalb der Medienlandschaft Nodirlands spielt der öffentlich-rechtliche Rundfunk BBC Northern Ireland, der lokale Fernsehsendungen, Radiosendungen und Online-Inhalte produziert. Speziell der Radiosender BBC Radio Ulster gilt als eine der wichtigsten Informationsquellen für aktuelle Nachrichten und gesellschaftliche Debatten. Daneben existiert mit UTV (Ulster Television) ein regionaler Ableger des britischen Senders ITV, der ebenfalls lokale Nachrichten und Unterhaltungsprogramme anbietet.
Im Bereich des Rundfunks sind auch private Radiostationen wie Cool FM, Downtown Radio und Q Radio weit verbreitet und erfreuen sich vor allem bei jüngeren Hörerinnen und Hörern großer Beliebtheit. Ein besonderes Merkmal der nordirischen Medienlandschaft ist zudem die Präsenz von Raidió Fáilte, einem irischsprachigen Sender, der die kulturelle und sprachliche Vielfalt der Region fördert.
Die Printmedien sind durch mehrere traditionsreiche Zeitungen geprägt. Die Belfast Telegraph gilt als eine der größten Tageszeitungen Nordirlands und verfolgt eine eher neutrale Linie. The Irish News steht tendenziell der nationalistischen und katholischen Gemeinschaft näher, während der News Letter eine unionistische und protestantische Perspektive einnimmt. Diese unterschiedlichen Ausrichtungen verdeutlichen, wie eng Medien und Politik in Nordirland miteinander verbunden sind.
Auch Online-Medien gewinnen zunehmend an Bedeutung. Plattformen wie Slugger O’Toole bieten Raum für politische Analysen und Diskussionen und werden häufig von Journalistinnen, Akademikern und politisch interessierten Bürgern genutzt.
Die sogenannten "alternativen Medien" in Irland und Nordirland heben sich von den etablierten Mainstream-Medien wie dem öffentlich-rechtlichen Sender RTÉ (in der Republik Irland) oder der BBC (in Nordirland) ab. Sie umfassen unabhängige, community-basierte oder satirische Formate, die investigative Berichterstattung, soziale Kritik oder kulturelle Inhalte bieten. Sie entstanden vor allem in den letzten Jahrzehnten als Reaktion auf wirtschaftliche Krisen, politische Skandale und die Dominanz großer Konzerne wie Independent News & Media, die den irischen Printmarkt weitgehend kontrollieren. In einer Zeit zunehmender Medienkonzentration dienen sie als Gegenstimme, sind jedoch selbst anfällig für Bias und Finanzierungsprobleme.
Die Wurzeln alternativer Medien reichen in Irland bis in die 1970er und 1980er Jahre zurück, als Pirate-Radio-Stationen als illegale Alternativen zu staatlichen Sendern wie Radio Telefís Éireann aufkamen. Diese boten nicht nur Musik, sondern auch unzensierte Diskussionen zu Themen wie der Rezession oder dem Nordirlandkonflikt. In Nordirland, das eng mit dem britischen Mediensystem verknüpft ist, spielte der Konflikt (The Troubles) eine zentrale Rolle: Hier entstanden community-basierte Formate, die Stimmen aus katholischen oder protestantischen Vierteln verstärkten, oft jenseits der neutralen BBC-Linie. Seit den 2000er Jahren hat das Internet den Aufschwung befeuert – von Blogs über Podcasts bis zu Online-Magazinen. Eine Blütezeit erlebten sie während der Finanzkrise ab 2008, als Mainstream-Medien wie die Irish Press scheiterten und alternative Plattformen Lücken füllten. Heute, im Jahr 2025, kämpfen sie mit sinkenden Werbeeinnahmen und der Konkurrenz durch Social Media, wo Echo-Chambers entstehen. Dennoch erreichen sie ein junges, kritisches Publikum, das nach "authentischen Stimmen" sucht, wie es Indymedia Ireland formuliert.
In der Republik Irland dominieren print- und onlinebasierte Alternativen mit Fokus auf Satire, Linkspolitik und Kultur. Ein Meilenstein ist Waterford Whispers News, ein satirischer Website seit 2011, der mit bissigen Parodien auf Politik und Gesellschaft (zum Beispiel zur Austeritätspolitik) Millionen Leser anzieht und oft näher an der Realität kratzt als seriöse Berichte. Ähnlich etabliert ist Gript.ie, ein konservatives Online-Portal, das Debatten zu Themen wie EU-Politik oder Einwanderung anregt und sich als "unfiltered" positioniert – es wird von Lesern finanziert, um Unabhängigkeit zu wahren. Auf der linken Seite steht Rabble.ie, ein kollektiv betriebenes Magazin, das muck-raking Journalism betreibt: Es deckt Korruption auf, feiert irische Subkulturen und kritisiert den "shambolic media"-Komplex. Indymedia Ireland, ein Volunteer-Netzwerk seit den 2000ern, priorisiert basisdemokratische Inhalte von Aktivisten und deckt Proteste oder Umweltthemen ab, die in Mainstream-Medien untergehen. Weitere Beispiele sind District Magazine, ein vierteljährliches Print-Format mit Fokus auf Musik und Kunst, oder Banshee, ein literarisches Journal, das soziale Narrative aus der Rezession heraus filtert. Radio-Alternativen wie 2XM (Indie-Musik) oder Onic Alternative ergänzen das Feld, indem sie lokale Talente fördern und pirate-Traditionen aufgreifen.
In Nordirland, wo Medien stärker mit dem UK-Rahmen (Ofcom-Regulierung) verflochten sind, haben alternative Formate oft eine regionale oder identitätspolitische Note. Das Magazin Alternative Ulster (AU), benannt nach dem Stiff-Little-Fingers-Song, startete 2002 als Radioshow auf Northern Visions und wurde zu einem Print- und Online-Medium für Indie-Musik und Subkulturen – es erreicht ein pan-irlandisches Publikum und thematisiert den Übergang von The Troubles zu moderner Jugendkultur. Shared Future News, ein digitales Portal, betont "constructive journalism" und lösungsorientierte Berichte zu geteilten Identitäten, was in einer polarisierten Gesellschaft wie Nordirland essenziell ist. Community-Radios wie Raidió Fáilte (irischsprachig in Belfast) oder Northern Visions bieten Plattformen für Minderheitenstimmen, inklusive Gälisch und lokaler Dialekte, und streben nationale Lizenzen an, um Grenzen zu überwinden. Historisch gab es Fortnight, ein monatliches Politikmagazin (jetzt eingestellt), das Brücken zwischen Unionisten und Nationalisten schlug. Heutige Herausforderungen umfassen die Abhängigkeit von Förderungen wie Northern Ireland Screen, die Film- und Medienproduktion unterstützen, aber politische Neutralität fordern.
Trotz Unterschieden verbinden alternative Medien in Irland und Nordirland Gemeinsamkeiten: Sie sind oft volunteer-getrieben, kämpfen um Nachhaltigkeit und nutzen Netzwerke wie das 2013 diskutierte "Alt-Media Network", das Ressourcen teilen und Kooperationen fördern soll. In einer Zeit, in der Social Media (zum Beispiel Reddit-Threads zu "reliable sources") Debatten anheizen, dienen sie als Korrektiv zu Konzernen. Kritiker werfen ihnen jedoch Bias vor – Linke wie Rabble werden als "echo chambers" gesehen, Rechte wie Gript als populistisch. Dennoch tragen sie zur Pluralität bei, besonders in einer Insel, die durch Brexit und den Nordirland-Protokoll weiter polarisiert ist. Für Leser empfehlenswert: Eine Mischung aus Quellen konsumieren, um Bias zu balancieren, und lokale Events wie die von District Magazine zu besuchen, um die Szene live zu erleben. Insgesamt beleben diese Medien die irische Debatte und erinnern daran, dass wahre Unabhängigkeit in der Vielfalt liegt.
Tageszeitungen:
Irland
- The Irish Times (Dublin, landesweit, englisch)
- Irish Independent (Dublin, landesweit, englisch)
- Evening Herald (Dublin, Regional; erscheint werktags, englisch)
- Irish Examiner (Cork, landesweit, englisch)
- Metro Herald (Dublin/Umgebung, englisch)
- The Sun Ireland (Boulevard; englisch)
- Sunday Tribune (ehemals; nur sonntags)
- Marine Times (Fachzeitung für maritime Themen)
- Enniscorthy Guardian (Regionale Zeitung, Wexford)
- The Western People (Region Connacht/Mayo)
- Leinster Leader (Region Leinster, Kildare)
- The Echo (Cork Echo) (Cork und Umland)
- Kerryman (County Kerry)
- Clare Champion (County Clare)
- Ulster Herald (Donegal, Cavan, Monaghan – Republik Ulster)
- Irish Daily Mail (Dublin/Britische Lizenz; Boulevard, englisch)
Nordirland
- The Belfast Telegraph (Belfast, landesweit, englisch)
- The Irish News (Belfast, katholisch/nationalistisch, englisch)
- News Letter (Belfast, protestantisch/unionistisch, englisch)
- Derry Journal (Derry, region westlich; englisch)
- North West Telegraph (Region Nordirland, englisch)
- Daily Ireland (ehemals, nationalistischer Fokus)
Radiostationen:
Irland
- National
- RTÉ Radio 1 (87.8–90.2 FM)
- RTÉ 2FM (90.4–92.2 und 97.0 FM)
- RTÉ Raidió na Gaeltachta (92.6–94.4 und 102.7 FM)
- RTÉ lyric fm (95.2 FM)
- Today FM (100–105.5 FM)
- Newstalk (106 FM)
- Dublin
- 98FM (97.4 & 98.1 FM)
- FM104 (103.1 & 104.4 FM)
- Q102 (101.5 & 102.2 FM)
- Radio Nova (95.7 & 100.1–100.5 FM)
- SPIN 1038 (103.5 & 103.8 FM)
- Sunshine 106.8 (106.6 & 106.8 FM)
- Cork
- C103 (102.6–103.9 FM)
- Cork's 96FM (95.6–96.8 FM)
- Red FM (104.2–106.1 FM)
- Connacht
- Galway Bay FM (95.8–97.4 FM)
- MidWest Radio (95.4–97.2 FM)
- Ocean FM (94.7, 102.5, 103.0, 105.0 FM)
- Shannonside FM (95.7, 97.2, 104.1 FM)
- Leinster
- East Coast FM (94.9–104.4 FM, Wicklow)
- KCLR 96FM (94.6 & 96.0–96.9 FM, Carlow/Kilkenny)
- Kfm (97.3 & 97.6 FM, Kildare)
- LMFM (95.5–96.5 FM, Louth/Meath)
- Midlands 103 (Laois, Offaly, Westmeath)
- South East Radio (95.6–96.4 FM, Wexford)
- Munster
- Clare FM (95.2–96.6 FM, Clare)
- Live 95 (95.0 & 95.3 FM, Limerick)
- Radio Kerry (96.2–97.6 FM)
- Tipp FM (Tipperary)
- WLR FM (Waterford)
- Ulster (Republik)
- Highland Radio (94.7–95.2, 102.1–104.7 FM, Donegal)
- Northern Sound (94.8, 96.3, 97.5 FM, Cavan/Monaghan)
Nordirland
- Belfast und Umgebung
- BBC Radio Ulster (93.1, 94.5, 95.3 FM)
- BBC Radio Foyle (Derry)
- Q Radio (Belfast, Newry, Mourne, 96.7, 100.5, 102.5 FM)
- U105 (105.8 FM)
- Cool FM (97.4 FM)
- Downtown Radio (103.1, 103.4 FM)
- Blast 106 (106.4 FM)
- Belfast 89FM (89.3 FM)
- Juice 1038 (103.8 FM)
- Raidió Fáilte (107.1 FM, irischsprachige Sendungen)
- BFBS Northern Ireland (101.0, 100.6, 106.5 FM – britische Militärstation)
- Energy 106 (Dance)
- Sunshine 104.9 FM
- Weitere landesweite Stationen
- BBC Radios 1, 2, 3, 4 (Mehrere UK-weite Frequenzen, teils digital)
- Classic FM (101.9 FM)
- Digital & Online
- Absolute Radio, Heart, Capital, Magic, Smooth, LBC, Virgin Radio, Jazz FM, Kerrang!, Hits Radio, Planet Rock (über Digitalradio/DAB verbreitet)
- Drive 105, Lisburn’s 98FM, Gold Radio, Soul Radio usw.
Fernsehsender:
| Rang | Channel | Besitzer |
| 1 | RTÉ One | Raidió Teilifís Éireann |
| 2 | TV3 Ireland | TV3 Group |
| 3 | RTÉ Two | Raidió Teilifís Éireann |
| 4 | BBC One Northern Ireland | BBC |
| 5 | UTV | UTV Media |
| 6 | Channel 4 NI | Channel 4 |
| 7 | BBC Two Northern Ireland | BBC |
| 8 | TG4 | Teilifís na Gaeilge |
| 9 | Sky1 | Sky Ireland |
| 10 | 3e | TV3 Group |
| 11 | E4 | Channel 4 |
| 12 | Living | Virgin Media Television |
| 13 | Sky News Ireland | Sky Ireland |
| 14 | Sky Sports 1 | Sky Ireland |
| 15 | Comedy Central | MTV Networks Europe |
| 16 | Sky Sports News | BSkyB |
| 17 | The Discovery Channel | Discovery Inc. |
| 18 | Setanta Ireland | Setanta Sports |
| 19 | Nickelodeon Ireland | MTV Networks Europe |
| 20 | Sky Sports 2 | Sky Ireland |
| 21 | Nick Jr | MTV Networks Europe |
| 22 | MTV | MTV Networks Europe |
| 23 | Comedy Central +1 | MTV Networks Europe |
| 24 | E! | Comcast |
| 25 | sonstige | verschiedene |
Kommunikation
Öffnungszeiten der Postämter sind Mo-Sa 09.00-13.00 Uhr und 14.15-17.30 Uhr. Das Hauptpostamt der Republik Irland befindet sich in der O’Connell Street, Dublin. Sie hat auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Mobil telefoniert wird über GSM 900/1800. Mobilfunkgesellschaften umfassen Vodafone, O2 Communications und Meteor.
Postdaten:
- Postanschrift: Ireland bzw. Northern Ireland
- Telefon-Vorwahl: 00353 (Irland), 0044 (Nordirland)
Sport
Die meisten Iren sind sportbegeistert, vor allem die beiden irischen Ballsportarten Gaelic Football und Hurling sind sehr beliebt. (Eine Variante des Gaelic Football wurde von irischen Auswanderern in Australien unter dem Namen Australian Football adaptiert.) Sowohl Gaelic Football als auch Hurling sind reine Amateursportarten. Die Spiele um die jährlich ausgetragenen All-Ireland Senior Football Championship bzw. All-Ireland Senior Hurling Championship locken viele Fans in die größten Stadien des Landes. Neben diesen beiden Wettbewerben der County-Auswahlteams gibt es auch Wettbewerbe auf Vereinsebene. Die Atmosphäre bei den Spielen ist meist friedlich. Trotz großer Rivalität zwischen den einzelnen Countys sind Ausschreitungen die Ausnahme. An öffentlichen, meist katholischen Schulen waren lange Zeit nur Hurling und Gaelic Football erlaubt.
Auch sehr populär sind Rugby und Fußball. Die Rugby-Nationalmannschaft gehört weltweit zu den Spitzenmannschaften. Sie nimmt an den vierjährlich stattfindenden Weltmeisterschaften und am jährlichen Sechs-Nationen-Turnier der besten Teams Europas teil. Das besondere an der irischen Nationalmannschaft ist, dass sie seit ihrer Gründung 1874 die gesamte Insel, heute also sowohl die Republik Irland als auch Nordirland repräsentiert. Die Auswahlen der vier irischen Provinzen Ulster, Munster, Leinster und Connacht spielen in der Celtic League, der höchsten professionellen Liga mit Mannschaften aus Irland, Wales und Schottland. Daneben gibt es nationale irische Meisterschaften. Nationalstadion ist das derzeit in Renovierung befindliche Stadion an der Lansdowne Road in Dublin. Es werden aber auch Länderspiele im Ravenhill Stadium in Belfast ausgetragen.
Die Fußballbegeisterung wurde geschürt, als Jack Charlton Anfang der 1980er Jahre Teamchef der irischen Fußballnationalmannschaft wurde. Da der Fußballsport in Irland damals noch in den Kinderschuhen steckte, bestand Charltons erste Amtshandlung darin, einen Ahnenforscher anzustellen, der ihm helfen sollte, in England nach Fußballprofis mit irischen Wurzeln zu suchen, um sie in die irische Nationalmannschaft berufen zu können. Das Team erreichte 1990 überraschend das Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Italien und qualifizierte sich zudem für die WM 1994 in den USA sowie für die WM 2002 in Japan und Südkorea. Die nationale Fußballliga heißt Eircom League. Sie besteht aus zwei Leistungsklassen und wird im Halb-Profibetrieb gespielt. Die Premier League besteht aus zwölf Vereinen, die First Division aus zehn. Die Liga wird vom irischen Fußballverband FAI organisiert.
Olympische Spiele
Irland nimmt seit 1924 regelmäßig an den Olympischen Spielen teil und ist seither fester Bestandteil der internationalen olympischen Bewegung. Nach der Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich im Jahr 1922 trat das Land erstmals bei den Sommerspielen in Paris 1924 mit einem eigenen Team auf. Davor starteten irische Athleten für Großbritannien. Das nationale Olympische Komitee Irlands ist die „Olympic Federation of Ireland“, die seither die Teilnahme irischer Sportlerinnen und Sportler an den Spielen organisiert.
Die größten Erfolge konnte Irland bislang bei den Sommerspielen feiern. Besonders im Boxen hat das Land eine starke Tradition und zahlreiche Medaillen gewonnen. Zu den bekanntesten Olympiasiegerinnen und -siegern gehören Ronnie Delany, der 1956 in Melbourne über 1500 Meter Gold in der Leichtathletik gewann, sowie die Boxer Michael Carruth (Gold 1992 in Barcelona), Katie Taylor (Gold 2012 in London) und Kellie Harrington (Gold 2020 in Tokio). Auch in anderen Disziplinen wie der Leichtathletik, im Segeln und im Pferdesport konnte Irland immer wieder Erfolge feiern. Insgesamt hat das Land bisher über 30 olympische Medaillen errungen.
Seit 1992 nimmt Irland auch an den Winterspielen teil. Zwar konnte das Land hier bislang keine Medaille gewinnen, doch irische Athletinnen und Athleten waren in verschiedenen Disziplinen wie Ski Alpin, Skeleton, Bobfahren und Snowboard vertreten.
Eine Besonderheit ergibt sich aus der politischen Situation der Insel: Sportlerinnen und Sportler aus Nordirland dürfen frei entscheiden, ob sie für Irland oder für Großbritannien (Team GB) antreten möchten, da viele von ihnen die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen. Das irische Team tritt bei den Spielen mit der eigenen Flagge, der grünen, weißen und orangen Trikolore, und der Nationalhymne „Amhrán na bhFiann“ an.
Medaillengewinner der Republik Irland
| Jahr | Name | Sportart | Medaille | Disziplin |
| 1928 | Pat O’Callaghan | Leichtathletik | Gold | Hammerwurf |
| 1932 | Pat O’Callaghan | Leichtathletik | Gold | Hammerwurf |
| 1932 | Bob Tisdall | Leichtathletik | Gold | 400 m Hürden |
| 1952 | John McNally | Boxen | Silber | Bantamgewicht |
| 1956 | Ron Delany | Leichtathletik | Gold | 1500 m |
| 1956 | Anthony Byrne | Boxen | Bronze | Leichtgewicht |
| 1956 | Johnny Caldwell | Boxen | Bronze | Fliegengewicht |
| 1956 | Frederick Gilroy | Boxen | Bronze | Bantamgewicht |
| 1956 | Frederick Tiedt | Boxen | Silber | Weltergewicht |
| 1980 | David Wilkins | Segeln | Silber | Flying Dutchman |
| 1980 | James Wilkinson | Segeln | Silber | Flying Dutchman |
| 1980 | Hugh Russell | Boxen | Bronze | Fliegengewicht |
| 1984 | John Treacy | Leichtathletik | Silber | Marathon |
| 1992 | Michael Carruth | Boxen | Gold | Weltergewicht |
| 1992 | Wayne McCullough | Boxen | Silber | Bantamgewicht |
| 1996 | Michelle Smith | Schwimmen | 3 × Gold, 1 × Bronze | 200 m Lagen; 400 m Freistil; 400 m Lagen; 200 m Schmetterling |
| 2000 | Sonia O’Sullivan | Leichtathletik | Silber | 5000 m |
| 2008 | Kenneth Egan | Boxen | Silber | Halbschwergewicht |
| 2008 | Paddy Barnes | Boxen | Bronze | Halbfliegengewicht |
| 2008 | Darren Sutherland | Boxen | Bronze | Mittelgewicht |
| 2012 | Katie Taylor | Boxen | Gold | Leichtgewicht (Frauen) |
| 2012 | John Joe Nevin | Boxen | Silber | Bantamgewicht |
| 2012 | Paddy Barnes | Boxen | Bronze | Halbfliegengewicht |
| 2012 | Michael Conlon | Boxen | Bronze | Fliegengewicht |
| 2012 | Cian O’Connor | Reiten | Bronze | Springreiten Einzel |
| 2012 | Robert Heffernan | Leichtathletik | Bronze | 50 km Gehen |
| 2016 | Annalise Murphy | Segeln | Silber | Laser Radial (Frauen) |
| 2016 | Gary & Paul O’Donovan | Rudern | Silber | Leichtgewichts-Doppelzweier |
| 2020 | Kellie Harrington | Boxen | Gold | Leichtgewicht (Frauen) |
| 2020 | Fintan McCarthy & Paul O’Donovan | Rudern | Gold | Leichtgewichts-Doppelzweier |
| 2020 | Aifric Keogh, Eimear Lambe, Fiona Murtagh, Emily Hegarty | Rudern | Bronze | Vierer ohne Steuerfrau |
| 2020 | Aidan Walsh | Boxen | Bronze | Weltergewicht |
| 2024 | Daniel Wiffen | Schwimmen | Gold & Bronze | 800 m Freistil (Gold), 1500 m Freistil (Bronze) |
| 2024 | Kellie Harrington | Boxen | Gold | Leichtgewicht (Frauen) |
| 2024 | Rhys McClenaghan | Turnen | Gold | Pauschenpferd |
| 2024 | Fintan McCarthy & Paul O’Donovan | Rudern | Gold | Leichtgewichts-Doppelzweier |
| 2024 | Daire Lynch & Philip Doyle | Rudern | Bronze | Doppelzweier |
| 2024 | Mona McSharry | Schwimmen | Bronze | 100 m Brust |
Gesamt (Stand 2024): 15 × Gold | 10 × Silber | 17 × Bronze = 42 Medaillen .
Nordirische Medaillengewinner bei Olympischen Spielen (für Großbritannien)
| Jahr | Name | Sportart | Medaille | Disziplin |
| 1956 | Hugh Russell | Boxen | Bronze | Fliegengewicht |
| 1972 | Mary Peters | Leichtathletik | Gold | Fünfkampf |
| 1984 | Greg Haughton | Leichtathletik | Bronze | 4 × 400 m (für GB) |
| 2012 | Wendy Houvenaghel | Radsport | Silber | Mannschaftsverfolgung (Frauen) |
Gaelic Football
Gaelic Football ist ein traditioneller irischer Sport, der sowohl in Irland als auch in Nordirland tief in der Kultur verwurzelt ist. Er ist ein schnelles, körperbetontes Spiel, das von zwei Teams mit jeweils 15 Spielern auf einem rechteckigen Rasenplatz ausgetragen wird und Elemente von Fußball, Rugby und Basketball vereint. Der Sport wird von der Gaelic Athletic Association (GAA) organisiert und ist neben Hurling einer der populärsten Sportarten in Irland.
Das Ziel des Spiels ist es, Punkte zu erzielen, indem der Ball ins gegnerische Tor gekickt oder geschlagen wird (3 Punkte) oder über die Querlatte zwischen den Torpfosten geschossen wird (1 Punkt). Spieler dürfen den Ball bis zu vier Schritte tragen, bevor sie ihn abprallen lassen oder einen „Solo“ ausführen (den Ball fallen lassen und mit dem Fuß zurück zu sich selbst kicken). Pässe werden per Hand (durch Schlagen) oder Fuß ausgeführt. Ein Spiel dauert in der Regel 60 bis 70 Minuten, aufgeteilt in zwei Halbzeiten von je 30 bis 35 Minuten. Gaelic Football ist ein Kontaktsport, der Schulter-an-Schulter-Kontakte erlaubt, jedoch keine Tacklings wie im Rugby.
In Irland ist Gaelic Football ein zentraler Bestandteil der nationalen Identität und wird auf Vereins-, County- und überregionaler Ebene gespielt. Die All-Ireland Senior Football Championship ist der Höhepunkt des Sports, deren Finale im Croke Park in Dublin ausgetragen wird und regelmäßig über 80.000 Zuschauer anzieht. Teams wie Dublin, Kerry und Galway gehören zu den erfolgreichsten. Jedes der 32 irischen Counties stellt ein Team, und die GAA organisiert Wettbewerbe wie die National Football League sowie Provinzmeisterschaften (Leinster, Munster, Meath, Ulster). Auf Vereinsebene sind die Clubs stark in den Gemeinden verankert und fördern lokalen Stolz. Bemerkenswert ist, dass der Sport Amateurstatus hat – die Spieler treten aus Leidenschaft an, nicht für Geld.
In Nordirland ist Gaelic Football besonders in der nationalistischen/katholischen Gemeinschaft populär, hat aber auch zunehmend Anklang in anderen Bevölkerungsgruppen gefunden. Der Sport wird vom Ulster GAA, einem der Provinzräte der GAA, verwaltet. Die Ulster Senior Football Championship ist ein bedeutendes Ereignis, bei dem Counties wie Tyrone, Armagh und Donegal regelmäßig um den Titel kämpfen. Nordirische Teams nehmen auch an der All-Ireland Championship teil. Aufgrund der politischen Teilung Nordirlands war der Sport historisch mit Spannungen verbunden, da er stark mit der irischen Identität assoziiert wird. Dennoch fördert die GAA durch Gemeindeprogramme die Inklusivität. Besonders in ländlichen Gebieten wie Derry oder Antrim ist Gaelic Football ein integraler Bestandteil der lokalen Kultur.
Rugby
Rugby Union, in Irland oft einfach als „Rugby“ bekannt, ist ein äußerst beliebter Mannschaftssport auf der gesamten Insel Irland, die sowohl die Republik Irland als auch Nordirland umfasst. Im Gegensatz zu Sportarten wie Fußball oder Feldhockey, bei denen Teams entlang politischer Grenzen geteilt sind, wird Rugby auf einer gesamtirischen Basis organisiert. Das bedeutet, dass Spieler, Teams und Wettbewerbe aus allen 32 Countys der Insel kommen, was eine seltene Einheit in einer historisch gespaltenen Region fördert. Der Dachverband, die Irish Rugby Football Union (IRFU), verwaltet alles vom lokalen Vereinssport bis hin zur Nationalmannschaft für beide Gebiete.
Rugby kam in den 1850er-Jahren nach Irland, eingeführt durch britische Soldaten und Studenten. Die IRFU wurde 1879 durch den Zusammenschluss zweier früherer Verbände gegründet: der Irish Football Union (für Leinster, Munster und Teile von Ulster) und der Northern Football Union (mit Schwerpunkt in Belfast). Trotz der Teilung Irlands 1921 in die unabhängige Republik Irland und Nordirland als Teil des Vereinigten Königreichs entschied sich die IRFU, ihre gesamtirische Struktur beizubehalten. Diese Entscheidung wurde in den 1950er-Jahren bekräftigt, als der Verband sich verpflichtete, alle vier traditionellen Provinzen – Leinster (Dublin und Umgebung), Munster (Süden, einschließlich Cork und Limerick), Connacht (Westen) und Ulster (Norden, einschließlich Nordirland und Teilen der Republik) – zu repräsentieren.
Während der Troubles (1968 bis 1998), einer Zeit schwerer konfessioneller Konflikte mit über 3.600 Toten, blieb Rugby ein neutraler Raum. Kein einziges Spiel zwischen Provinzen oder auf nationaler Ebene wurde wegen der Unruhen abgesagt. Der Sport half, Brücken zwischen Gemeinschaften zu schlagen, da protestantische und katholische Spieler gemeinsam trainierten und spielten. Der ehemalige irische Kapitän Willie John McBride betonte: „Während der Gewalt in Nordirland wurde kein einziges Rugbyspiel zwischen Teams aus dem Norden und dem Süden abgesagt.“ Auch heute, trotz Unsicherheiten durch den Brexit, bleibt Rugby ein Symbol für gemeinsame Identität jenseits politischer Grenzen.
Die irische Nationalmannschaft vertritt die gesamte Insel in internationalen Wettbewerben wie den Six Nations Championship (ein jährliches Turnier mit England, Schottland, Wales, Frankreich und Italien, das Irland zehnmal gewonnen und achtmal geteilt hat) und der Rugby-Weltmeisterschaft (wo Irland regelmäßig die Viertelfinals erreichte, außer 2023 mit einem Achtelfinal-Aus). Spieler werden aus beiden Seiten der Grenze ausgewählt, darunter bekannte Nordiren wie der ehemalige Kapitän Rory Best (Ulster). Irland führte 2019 erstmals die Weltrangliste an und war von 2022 bis 2023 erneut die Nummer eins.
Um die unterschiedlichen Identitäten zu respektieren, wird bei Auswärtsspielen die neutrale Hymne Ireland’s Call (komponiert 1995) gespielt, während bei Heimspielen in Dublin zusätzlich Amhrán na bhFiann, die Hymne der Republik, erklingt. Spiele finden abwechselnd im Aviva Stadium in Dublin (zirka 51.000 Plätze) und im Kingspan Stadium in Belfast (rund 18.000 Plätze) statt.
Die professionellen Teams Irlands treten in der United Rugby Championship (URC) an, einer Liga mit Teams aus Südafrika, Italien, Schottland und Wales. Dazu gehört Ulster Rugby (mit Sitz in Belfast, repräsentiert alle neun Countys von Ulster), das im Kingspan Stadium (ehemals Ravenhill) spielt und kürzlich 2025 einen URC-Sieg gegen die Vodacom Bulls feierte. Weitere Provinzteams sind Leinster (Dublin), Munster (Limerick/Thomond Park) und Connacht (Galway). Auf Vereinsebene gibt es über 250 Clubs mit etwa 200.000 registrierten Spielern (Männer, Frauen und Jugend). Besonders in den Schulen ist Rugby populär, vor allem in den kostenpflichtigen Schulen Leinsters und den protestantischen Gymnasien Nordirlands, obwohl es sich zunehmend auch in katholischen Schulen etabliert.
Rugby gilt oft als „Mittelklassesport“, besonders in Leinster und Cork, während es in Limerick weniger klassenabhängig ist. In Nordirland war Rugby historisch protestantisch geprägt, wird aber zunehmend inklusiver. Frauenrugby wächst rasant, und die irische Frauen-Nationalmannschaft tritt in den Women’s Six Nations und der Weltmeisterschaft an, mit einem historischen Spiel im Aviva Stadium 2025.
Fußball
Die Football Association of Ireland (FAI, irisch Cumann Peile na hÉireann) ist der Fußballverband in der Republik Irland. Er wurde 1921 in Dublin gegründet. Seikt 1923 ist sie Mitglied der FIFA. Die FAI organisiert unter anderem die Nationalmannschaften der Männer und der Frauen, den irischen Pokalwettbewerb und Ligapokal sowie seit der Fusion mit der Football League of Ireland die zwei Profiligen. Gemeinsam mit der nordirischen IFA veranstaltet die FAI seit 2005 den grenzüberschreitenden gesamtirischen Pokalwettbewerb Setanta Sports Cup.
Nach der Teilung Irlands lösten sich die drei in Dublin ansässigen Vereine von der gesamtirischen Irish Football League. Sie blieben jedoch zunächst noch in der Irish Football Association, die ihren Sitz in Belfast hatte, und spielten auch noch im Pokalwettbewerb. Nachdem die IFA im April 1921 das Wiederholungsspiel im Irish-Cup-Halbfinale zwischen Titelverteidiger Shelbourne (aus Dublin) und Glenavon (aus Lurgan) entgegen den Gepflogenheiten nicht in Dublin, sondern in Belfast durchführen wollte, war das Band endgültig zerrissen. Shelbourne trat nicht mehr an und verzichtete auf die weitere Teilnahme.
Im Juni 1921 trafen sich in Dublin Vertreter von Vereinen und Regionalverbänden und gründeten die Football League of Ireland, die zunächst mit acht Vereinen aus der Hauptstadt ihren Spielbetrieb aufnahm. Drei Monate später gründeten die Football League und die Regionalverbände aus Leinster und Munster die FAI als Fußballverband für Südirland. Ein eigener Pokalwettbewerb wurde ins Leben gerufen, der nach Gründung des Irischen Freistaats Free State Cup benannt wurde. Liga und Pokal gewann im ersten Jahr der St James's Gate F.C..
Aus Nordirland schloss sich die Falls League, eine Liga aus dem katholisch-republikanischen Westen Belfasts, der FAI an; der Verein Alton United aus dieser Liga gewann sogar 1923 den FAI Cup. Diese Verbindung über die Grenze endete mit der Aufnahme der FAI in die FIFA. Um in den Weltfußballverband eintreten zu können, musste sie ihren Namen in „Fußballverband des Irischen Freistaats“ (Football Association of the Irish Free State, FAIFS) ändern und sich auf die Zuständigkeit für die 26 Grafschaften innerhalb des Freistaates beschränken. (Diese Beschränkung gilt noch heute - mit einer Ausnahme: seit 1985 darf der nordirische Club Derry City dank einer Sonderregelung zwischen FIFA, IFA und FAI am Spielbetrieb in der Republik teilnehmen.)
Schon 1924 nahm eine Auswahl von Spielern der FAI als Mannschaft des Irischen Freistaats am olympischen Fußballturnier teil. Am 28. Mai 1924 gab es das erste Länderspiel im Olympiastadion von Colombes, die Iren besiegten Bulgarien mit 1:0. Damit waren sie fürs Viertelfinale qualifiziert, das sie mit 1:2 nach Verlängerung gegen die Niederlande verloren. Am Tag darauf gewannen sie noch ein Freundschaftsspiel gegen Estland. In Aufzeichnungen aus der Zeit, unter anderem in den Unterlagen der FAI, werden die Spiele als reguläre Länderspiele gewertet, obwohl es reine Amateurteams waren. Nach den 1960er Jahren wurden sie neu als Amateurländerspiele eingestuft; doch 1999 erklärte die FIFA, dass auch Länderspiele bei frühen Olympischen Wettbewerben als volle Länderspiele gewertet werden können. Das erste von der FAIFS selbst organisierte Länderspiel gab es im März 1926; in Turin verlor das Team gegen Italien mit 0:3. Im April 1927 folgte das erste Heimspiel in Dublin, ebenfalls gegen Italien. An der Lansdowne Road verfolgten 20.000 Zuschauer die 1:2-Niederlage.
Beide Verbände, IFA und FAI/FAIFS, beanspruchten für sich, die ganze Insel zu repräsentieren. In den folgenden Jahren gab es einige Versuche, beide Verbände zueinander zu führen, die aber an Diskrepanzen darüber scheiterten, welcher Verband die führende Rolle spielen solle. Während die FAIFS darauf verzichtete, Spieler aus Nordirland in ihre Nationalmannschaft zu berufen, hielt sich die IFA in dieser Hinsicht nicht zurück und setzte Aktive aus dem Freistaat in ihren Länderspielen ein. 1936 nahm die FAIFS im Vorfeld der Umbenennung des Staates in „Republik Irland“ ihren alten Namen Football Association of Ireland wieder an. Unter Berufung auf die Verfassung der Republik rekrutierte nun auch die FAI Spieler aus dem Norden für die irische Nationalmannschaft. Insgesamt waren es mindestens 38 Spieler, die sowohl in der FAI-Nationalmannschaft als auch in der IFA-Auswahl spielten. Die FAI ließ von dieser Praxis jedoch wieder ab, nachdem die IFA 1946 wieder in die FIFA eingetreten war; der Norden berief noch bis 1950 Spieler aus der Republik in sein Team.
Viele Jahre lang beschränkte sich die Popularität des Fußballs auf Dublin und wenige Städte in den Provinzen. In einigen Gegenden wurde soccer als das Spiel der Engländer angesehen und als „Garnisonsspiel“ abgetan, da oft Mannschaften der britischen Armee es in die Städte gebracht hatten. Auch in den Schulen wurde wenig Fußball gespielt; Rugby, Gaelic Football und ähnliche Ballsportarten waren beliebter. Die Gaelic Athletic Association schloss sogar bis 1971 Mitglieder aus, die „ausländische“ Sportarten spielten. Erst gegen Ende der 1960er Jahre begann das Fußballspiel sich auch hier durchzusetzen.
Die Nationalmannschaft konnte bis Mitte der 1980er Jahre keine großen Erfolge aufweisen. In den Qualifikationen für EM- oder WM-Turniere scheiterte sie regelmäßig, wenn auch oft nur knapp. In der Qualifikation zur EM 1980 kam es zum ersten Mal zum direkten Vergleich der Mannschaften der beiden irischen Verbände; dabei gab es, begleitet von Fanausschreitungen in Dublin am Tag des Matches, ein 0:0 im Dalymount Park; im Rückspiel siegte Nordirland mit 1:0.
Erst nachdem der englische Altinternationale Jack Charlton 1986 als Teammanager die Nationalelf übernommen hatte, stellte sich der Erfolg ein. Irland qualifizierte sich für die EM 1988 in Deutschland, verlor hier nur gegen den späteren Europameister Niederlande und ließ in den Gruppenspielen England hinter sich. Bei der WM 1990 in Italien schieden „Jack's Heroes“ erst im Viertelfinale gegen den Gastgeber aus. In den USA 1994 überstand das Team ebenfalls die Gruppenphase.
Mit den internationalen Erfolgen der Nationalmannschaft seit den 1980er Jahren erhielt Fußball mehr Medien- und insbesondere Fernsehpräsenz und damit mehr Fans und mehr Gelder für die FAI. Der Verband machte durch gute Jugendarbeit auf sich aufmerksam - 1997 wurde die U-20-Nationalmannschaft WM-Dritter, 1998 wurden die U-16- und U-18-Teams der Iren jeweils Europameister ihrer Altersklasse. Neben den Profiwettbewerben gibt es heute eine U-21-Liga sowie einen Junior Cup und einen Intermediate Cup für Vereine, die nicht in der FAI National League of Ireland spielen. Außerdem organisiert die FAI auch Fußballwettbewerbe an Schulen.
Die FAI eircom National League of Ireland, bis Ende 2006 Football League of Ireland auch unter der Kurzbezeichnung League of Ireland bekannt, ist der Name der in zwei Spielklassen eingeteilten Profifußballliga der Republik Irland. Sie entstand aus der Fusion des irischen Fußballverbandes FAI mit der alten irischen Profiliga League of Ireland zum Saisonbeginn 2007. Die höhere Spielklasse heißt FAI Premier Division, oder kurz Premier Division, die niedrigere FAI First Division, kurz First Division. Neben 21 Vereinen aus der Republik Irland nimmt mit dem Derry City F.C. auch eine Mannschaft aus dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland am Spielbetrieb teil. Neben dem Meisterschaftsbetrieb richtet die FAI National League auch seit 1973 einen ' Ligapokal, für den alle Vereine der beiden Divisions startberechtigt sind, aus. Der Sieger des Ligapokals sowie der Meister und der Vizemeister qualifizieren sich mit dem Sieger des irischen Pokals für den Setanta Sports Cup, dem seit 2005 ausgetragenen einzigen gesamtirischen Fußballpokalwettbewerb.
Die Saison richtet sich seit Mitte 2003 wie in Skandinavien und Russland und entgegen den Gepflogenheiten der größeren europäischen Verbände nach dem Kalenderjahr. Was dazu führt, dass in europäischen Wettbewerben stets die Sieger des Vorjahres antreten. Der Meister wird im reinen Ligamodus zwischen den zur Zeit elf Mannschaften der Premier Division ermittelt, die zehn Teams der First Division spielen gleichzeitig den Aufstieg in die höchste Klasse aus. Der Letzte der oberen Spielklasse steigt direkt ab, der erste der unteren Spielklasse direkt auf. Zwischen dem Zweiten und Dritten der First Division und dem Vorletzten der Premier Division findet dagegen ein Play Off um den letzten Platz statt. Einen echten Abstieg aus der League of Ireland gibt es nicht, allerdings muss die schlechteste Mannschaft der First Division die Mitgliedschaft erneut beantragen, was zugunsten neuer Vereine teils abgelehnt wird. In der First Division spielt jedes Team je vier mal gegen jedes andere, in der Premier Division je dreimal.
Die League of Ireland wurde 1921 nach der Unabhängigkeit Südirlands vom Vereinigten Königreich gegründet, in der ersten Saison 1921/22 nahmen acht Vereine am Ligabetrieb in einer Spielklasse teil. Erster Meister wurde St. James's Gate; einziges Gründungsteam, das seitdem ununterbrochen in der Liga verblieb, sind die Bohemians aus Dublin. Allerdings kamen die Shamrock Rovers bereits in der zweiten Saison in die Liga, sie gewannen bereits im ersten Jahr die Meisterschaft.
Bis in die 1960er Jahre schwankte die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften zwischen acht und zwölf. In der Hochzeit der Liga in den 60er und 70er Jahren, als bis zu 40.000 Zuschauer die Spiele der großen Dubliner Vereine live sehen wollten, stieg die Anzahl der Vereine dann immer weiter an. 1969 waren es bereits 14, 1977 16 und schließlich 1985 die heutige Anzahl von 22 Teams. Die damit verbundenen organisatorischen und anderen Belastungen führten zur Aufspaltung der bis dahin einheitlichen Liga in zwei Spielklassen, wie sie heute auch noch existieren.
In der Saison 1981/82 versuchte die League of Ireland durch ein besonderes Punktesystem offensives Spiel von Auswärtsmannschaften zu belohnen, dazu wurde für ein Jahr die 3-Punkte Regel mit der Besonderheit eingeführt, dass die Auswärtsmannschaften, soweit sie mindestens ein Unentschieden erreichten, einen Extrapunkt erhielten. In der Übersicht wurden Ergebnisse wie folgend gewertet: Niederlage kein Punkte; Unentschieden Heim ein Punkt; Unentschieden Auswärts zwei Punkte; Heimsieg drei Punkte und schließlich ein Auswärtssieg vier Punkte.
2003 wurden die Bohemians und Shelbourne innerhalb weniger Monate hintereinander Meister, da der Ligabetrieb vom üblichen Betrieb von Herbst bis Frühjahr auf einen Parallellauf mit dem Kalenderjahr umgestellt wurde. 2005 wurde die Premier Division zugunsten der First Division von zehn auf zwölf Teams vergrößert, da die First Division gleichzeitig um zwei Mannschaften verringert wurde, blieb die Anzahl von 22 Vereinen konstant.
Wegen der anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten der Liga, so zog sich Dublin City während der laufenden Spielzeit 2006 aus dem Betrieb zurück, kam es zum Jahreswechsel zur Fusion der bisher unabhängigen League of Ireland mit dem irischen Fußballverband FAI. Die Liga wurde daher in FAI National League umbenannt.
Zur Saison 2007 wurde die Liga umstrukturiert, so dass auch nach Ende der Spielzeit 2006 noch nicht feststand, welche Clubs in Premier bzw. First Division spielen werden. Fakt war jedoch, dass die FAI (Football Association of Ireland) die Liga übernimmt und sich alle Klubs 'bewerben' mussten und ein Gremium dann durch Punktevergabe entscheidet, wer in die Premier oder die First Devision kommt. Entscheidend dafür waren die Ergebnisse der letzten 5 Jahre und andere Kriterien, wie Infrastruktur, Führung, Finanzen, Jugendarbeit, Marketing, etc.
Mit der Übernahme durch die FAI werden jetzt auch erstmals Spielerverträge eingeführt, die die Bedingungen für die Spieler und die Übersicht für die Vereine einfacher machen sollen. Viele Vereine verkalkulieren sich regelmäßig mit den Spielergehältern und geben mehr aus, als sie eigentlich einnehmen. Die Gehälter der Spieler wurden immer in Netto ausgehandelt, was sich dann vernichtend auf die Buchhaltung ausgewirkt hat, wenn dann die Steuern bezahlt werden sollen. Das soll nun mit dem neuen einheitlichen Spielervertrag verhindert werden.
Für Dublin City, das sich bereits im Sommer 2006 aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hatte, und für den Limerick FC, dem eine Lizenz für die Saison 2007 für beide Spielklassen der League of Ireland verwehrt wurde, nahm die Liga zwei neu gegründete Teams auf: die Wexford Youths und Limerick 37, benannt nach dem Jahr in dem zuerst Profifußball in Limerick gespielt wurde. Zudem wurde dem amtierenden Meister und Pokalsieger Shelbourne FC die Lizenz für die Premier Division verwehrt, so dass die Shels ihren Titel nicht verteidigen können. Die Shels konnten erst durch Verhandlungen wenige Tage vor Beginn der Saison am 9. März 2007 die Lizenzbedingungen für die First Division erfüllen, so dass statt eines Ausschlusses aus der Liga lediglich der Zwangsabstieg angeordnet wurde.
Die bisherigen Meister waren:
Meister der Football League of Ireland
- 1921/22 St. James's Gate
- 1922/23 Shamrock Rovers
- 1923/24 Bohemians
- 1924/25 Shamrock Rovers
- 1925/26 Shelbourne
- 1926/27 Shamrock Rovers
- 1927/28 Bohemians
- 1928/29 Shelbourne
- 1929/30 Bohemians
- 1930/31 Shelbourne
- 1931/32 Shamrock Rovers
- 1932/33 Dundalk
- 1933/34 Bohemians
- 1934/35 Dolphin F.C.
- 1935/36 Bohemians
- 1936/37 Sligo Rovers
- 1937/38 Shamrock Rovers
- 1938/39 Shamrock Rovers
- 1939/40 St.James's Gate
- 1940/41 Cork United
- 1941/42 Cork United
- 1942/43 Cork United
- 1943/44 Shelbourne
- 1944/45 Cork United
- 1945/46 Cork United
- 1946/47 Shelbourne
- 1947/48 Drumcondra
- 1948/49 Drumcondra
- 1949/50 Cork Athletic
- 1950/51 Cork Athletic
- 1951/52 St Patrick's Athletic
- 1952/53 Shelbourne
- 1953/54 Shamrock Rovers
- 1954/55 St Patrick's Athletic
- 1955/56 St Patrick's Athletic
- 1956/57 Shamrock Rovers
- 1957/58 Drumcondra
- 1958/59 Shamrock Rovers
- 1959/60 Limerick F.C.
- 1960/61 Drumcondra
- 1961/62 Shelbourne
- 1962/63 Dundalk
- 1963/64 Shamrock Rovers
- 1964/65 Drumcondra
- 1965/66 Waterford
- 1966/67 Dundalk
- 1967/68 Waterford
- 1968/69 Waterford
- 1969/70 Waterford
- 1970/71 Cork Hibernians
- 1971/72 Waterford
- 1972/73 Waterford
- 1973/74 Cork Celtic
- 1974/75 Bohemians
- 1975/76 Dundalk
- 1976/77 Sligo Rovers
- 1977/78 Bohemians
- 1978/79 Dundalk
- 1979/80 Limerick
- 1980/81 Athlone Town
- 1981/82 Dundalk
- 1982/83 Athlone Town
- 1983/84 Shamrock Rovers
- 1984/85 Shamrock Rovers
Meister der Premier Division
- 1985/86 Shamrock Rovers
- 1986/87 Shamrock Rovers
- 1987/88 Dundalk
- 1988/89 Derry City
- 1989/90 St Patrick's Athletic
- 1990/91 Dundalk
- 1991/92 Shelbourne
- 1992/93 Cork City
- 1993/94 Shamrock Rovers
- 1994/95 Dundalk
- 1995/96 St Patrick's Athletic
- 1996/97 Derry City
- 1997/98 St Patrick's Athletic
- 1998/99 St Patrick's Athletic
- 1999/2000 Shelbourne
- 2000/01 Bohemians
- 2001/02 Shelbourne
- 2002/03 Bohemians
- 2003 Shelbourne
- 2004 Shelbourne
- 2005 Cork City
- 2006 Shelbourne
- 2007 Drogheda United
- 2008 Bohemians
- 2009 Bohemians
- 2010 Shamrock Rovers
- 2011 Shamrock Rovers
- 2012 Sligo Rovers
- 2013 St Patrick’s Athletic
- 2014 Dundalk FC
- 2015 Dundalk FC
- 2016 Dundalk FC
- 2017 Cork City
- 2018 Dundalk FC
- 2019 Dundalk FC
- 2020 Shamrock Rovers
- 2021 Shamrock Rovers
- 2022 Shamrock Rovers
- 2023 Shamrock Rovers
- 2024 Shelbourne FC
Meistertitel
| Rang | Verein | Meisterschaften |
| 1 | Shamrock Rovers | 21 |
| 2 | Dundalk FC | 14 |
| 3 | Shelbourne FC | 14 |
| 4 | Bohemians Dublin | 11 |
| 5 | St Patrick’s Athletic | 8 |
| 6 | Waterford United | 6 |
| 7 | Cork United | 5 |
| Drumcondra FC | 5 | |
| 9 | Sligo Rovers | 3 |
| Cork City | 3 | |
| 11 | Athlone Town | 2 |
| Cork Athletic | 2 | |
| Derry City | 2 | |
| Limerick FC | 2 | |
| St. James’s Gate FC | 2 | |
| 16 | Cork Celtic | 1 |
| Cork Hibernians | 1 | |
| Dolphin FC | 1 | |
| Drogheda United | 1 |
Die Nationalmannschaft der Republik Irland, oft liebevoll als „The Boys in Green“ bezeichnet, ist mehr als nur ein Fußballteam – sie ist ein Symbol nationaler Identität, das in einem Land mit über 5 Millionen Einwohnern eine geradezu religiöse Verehrung genießt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1924 durch den irischen Fußballverband (Football Association of Ireland, FAI) hat die Mannschaft eine wechselvolle Geschichte durchlaufen, geprägt von heroischen Kämpfen gegen stärkere Gegner, ikonischen Momenten der Ekstase und wiederkehrenden Enttäuschungen. Obwohl Irland nie eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft gewonnen hat, hat es sich durch unerschütterlichen Teamgeist und phänomenale Leistungen von Stars wie George Best – nein, warte, Best war Nordirland – oder vielmehr Liam Brady, Paul McGrath und Robbie Keane in die Annalen des internationalen Fußballs eingebrannt. Diese Mannschaft verkörpert den typisch irischen Charme: Kreativität gepaart mit Zähigkeit, und immer mit einem Hauch von Tragik.
Die Anfänge der irischen Nationalelf reichen zurück in die Zeit nach der Unabhängigkeit von Großbritannien. 1924 fand das erste offizielle Länderspiel statt, ein 1:1-Unentschieden gegen die Schweiz in Paris – passenderweise auf neutralem Boden, da die Teilung der Insel noch frisch war. In den frühen Jahrzehnten kämpfte Irland mit organisatorischen Problemen und einer schwachen Liga-Infrastruktur. Die Mannschaft trat anfangs sogar unter dem Namen „Irish Free State“ an und erzielte erste Erfolge in den 1930er Jahren, darunter ein sensationelles 2:1 gegen Deutschland 1936. Doch der Zweite Weltkrieg unterbrach den Spielbetrieb, und nach dem Krieg dauerte es Jahrzehnte, bis Irland wieder international relevant wurde. Die 1950er und 1960er waren mager: Kaum Qualifikationen, und die Mannschaft galt als Außenseiter. Erst in den 1970er Jahren, unter Trainer Johnny Giles, begann ein langsamer Aufstieg, der mit der Qualifikation für die EM 1988 seinen Höhepunkt fand.
Dieser Triumph war das Werk eines visionären Trainers: Jack Charlton, des englischen Ex-Weltmeisters von 1966, der 1986 das Ruder übernahm. Charlton revolutionierte den irischen Fußball mit einem pragmatischen, physisch ausgerichteten Stil, der auf Konter und Set-Pieces setzte – perfekt für die robusten, kampfesstarken Iren. Unter ihm qualifizierte sich Irland erstmals für eine große Turnier: Die EM 1988 in Westdeutschland. Die Grünen besiegten England 1:0 (dank Ray Houghtons Kopfball), spielten unentschieden gegen die Sowjetunion und scheiterten erst im Viertelfinale an den Gastgebern. Die Nation fieberte mit: Straßenfeste, grüne Flüsse in Dublin – es war der Beginn einer goldenen Ära. 1990 folgte die erste WM-Teilnahme in Italien. Irland überstand die Gruppenphase mit Unentschieden gegen England, Ägypten und den Niederlanden und scheiterte erst im Achtelfinale an Italien. David O'Leary, Kevin Moran und Tony Cascarino waren Helden, doch Paul McGrath stach als Innenverteidiger heraus: Trotz privater Dämonen war er ein Fels, der Angreifer wie Diego Maradona neutralisieren konnte.
Die 1990er waren die Blütezeit. Unter Charlton erreichte Irland 1994 die WM in den USA, wo es erneut die Gruppenphase überstand und erst im Achtelfinale an Mexiko scheiterte. Zu diesem Zeitpunkt war Robbie Keane, der junge Torjäger, bereits im Kommen, doch die Ära endete 1995 mit Charltonts Abschied. Sein Nachfolger Mick McCarthy baute auf, und 2002 qualifizierte sich Irland für die WM in Japan/Südkorea. Ein episches Play-off-Duell gegen Iran (1:1 in Teheran, 1:2 in Dublin) scheiterte haarscharf am Elfmeter-Drama – ein Moment, der die Iren bis heute schmerzt. In der Endrunde siegten sie gegen Saudi-Arabien und spielten Remis gegen Kamerun und Deutschland, schieden aber als Gruppenzweiter aus. Keane und Damien Duff glänzten, doch der Ausstieg war bitter.
Die 2000er brachten Höhen und Tiefen. Die EM 2002 in Belgien und den Niederlanden endete nach einer 1:3-Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale – ein Spiel, das Frankreichs Hand von Zidane in der WM-Quali 2004 überschattet hatte. Diese „Hand von Henry“ disqualifizierte Irland und führte zu einem FIFA-Skandal, der die Fairness des Sports in Frage stellte. Unter Steve Staunton (2006/07) und Giovanni Trapattoni (2008bis 2013) gab es weitere Qualifikationskämpfe, doch die EM 2012 in Polen/Ukraine wurde zur Katastrophe: Drei Niederlagen, 1:9 Tore – ein Tiefpunkt. Trapattoni, der Italiener, brachte Disziplin, scheiterte aber an der WM 2010 (Play-off-Verlust gegen Frankreich, wiederum mit Handschlag von Henry).
Martin O'Neills Amtszeit (2013 bis 2020) brachte frischen Wind. Mit Roy Keane als Assistent – dem ewigen Rebell der irischen Fußballgeschichte – qualifizierte sich Irland für die EM 2016 in Frankreich. Keane, der 1999 wegen eines Streits mit McCarthy die WM 2002 verpasst hatte, sorgte für Feuer. In der Endrunde besiegten die Iren Schweden 1:0 (Wes Hoolahans Tor) und Italien nicht, schieden als Gruppenletzter aus, erreichten aber das Achtelfinale und unterlagen Frankreich 2:1. Es war ein emotionaler Höhepunkt: 50.000 Fans in Paris, Keane's raue Motivation – pure irische Seele. Die WM 2018 scheiterte knapp an Dänemark im Play-off, und O'Neills Ära endete 2020 mit Entlassung.
Seit 2020 leitet Stephen Kenny die Mannschaft, ein junger, progressiver Trainer, der auf Angriffsfootball setzt. Die Pandemie und Qualifikationspech (unter anderem Verlust gegen Portugal 2021) machten es schwer, doch es gab Lichtblicke: Siege gegen Schweden und Luxemburg in der Nations League 2020/21. Die WM 2022 in Katar verpasste Irland, ebenso die EM 2024 – ein 0:1 gegen Frankreich im Play-off-Endspiel tat weh. Dennoch blüht eine neue Generation auf: Spieler wie Declan Rice (der 2023 zu England wechselte, was Trauer auslöste), Aaron Connolly, Troy Parrott und Callum Robinson tragen die grüne Weste. Der Kader mischt Premier-League-Profis (zum Beispiel Matt Doherty von Tottenham) mit aufstrebenden Talenten aus der heimischen Liga.
Heute, im Oktober 2025, steht Irland vor der Qualifikation zur WM 2026. Nach einer enttäuschenden Nations League (Abstieg in Liga C) sucht Kenny nach Stabilität. Die Mannschaft rangiert auf Platz 60 der FIFA-Weltrangliste, fern vom Glanz der 1980er und 1990er Jahre, doch der Geist lebt. Dublins Aviva Stadium, Heimat seit 2010, pulsiert bei Heimspielen mit Hymnen wie „Put 'Em Under Pressure“. Kritiker bemängeln die Jugendarbeit und Finanzierung des FAI, doch Fans bleiben treu: Die Diaspora in den USA und Großbritannien schickt Spieler und Unterstützung.
| Gegner | Region | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff | Anteil Siege |
| Ägypten | CAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Albanien | UEFA | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 75 % |
| Algerien | CAF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 50 % |
| Andorra | UEFA | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 100 % |
| Argentinien | CONMEBOL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | −5 | 0 % |
| Armenien | UEFA | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 60 % |
| Australien | AFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 50 % |
| Azerbaijan | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 50 % |
| Belgien | UEFA | 17 | 4 | 7 | 6 | 26 | 30 | −4 | 23.53 % |
| Bolivia | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 66.67 % |
| Bosnien und Herzegowina | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 66.67 % |
| Brasilien | CONMEBOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | −10 | 16.67 % |
| Bulgarien | UEFA | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | +7 | 40 % |
| Chile | CONMEBOL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 33.33 % |
| China | AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100 % |
| Kolumbien | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 % |
| Costa Rica | CONCACAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 % |
| Dänemark | UEFA | 19 | 5 | 10 | 4 | 23 | 23 | 0 | 27.78 % |
| Deutschland | UEFA | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 35 | −11 | 30 % |
| DDR | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 50 % |
| Ecuador | CONMEBOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 50 % |
| England | UEFA | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 30 | −16 | 15.79 % |
| Estonia | UEFA | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 80 % |
| Färöer | UEFA | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 100 % |
| Finland | UEFA | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 5 | +9 | 55.56 % |
| Frankreich | UEFA | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | −10 | 21.05 % |
| Georgien | UEFA | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 5 | +13 | 81.82 % |
| Gibraltar | UEFA | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 | 100 % |
| Griechenland | UEFA | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | −9 | 0 % |
| Iran | AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 66.67 % |
| Island | UEFA | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 62.5 % |
| Israel | UEFA | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 20 % |
| Italien | UEFA | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 20 | −10 | 21.43 % |
| Italien B | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 % |
| Jamaika | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 % |
| Kamerun | CAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 % |
| Kanada | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100 % |
| Kasachstan | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 100 % |
| Katar | AFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 50 % |
| Kroatien | UEFA | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 28.57 % |
| Kroatien | UEFA | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 28.57 % |
| Lettland | UEFA | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 100 % |
| Liechtenstein | UEFA | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 | 75 % |
| Litauen | UEFA | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 80 % |
| Luxemburg | UEFA | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | +14 | 75 % |
| Malta | UEFA | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 | 100 % |
| Marokko | CAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 % |
| Mexiko | CONCACAF | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | −3 | 0 % |
| Moldawien | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100 % |
| Montenegro | UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Niederlande | UEFA | 24 | 7 | 4 | 13 | 30 | 43 | −13 | 29.17 % |
| Neuseeland | OFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 50 % |
| Nigeria | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0 % |
| Nordirland | UEFA | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 4 | +13 | 36.36 % |
| Nordmakedonien | UEFA | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 66.67 % |
| Norwegen | UEFA | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 21 | +9 | 36.84 % |
| Oman | AFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 100 % |
| Österreich | UEFA | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 37 | −18 | 18.75 % |
| Paraguay | CONMEBOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100 % |
| Polen | UEFA | 28 | 6 | 11 | 11 | 30 | 44 | −14 | 21.43 % |
| Portugal | UEFA | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 26 | −15 | 25 % |
| Rumänien | UEFA | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 40 % |
| Russland | UEFA | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | −3 | 14.29 % |
| San Marino | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 100 % |
| Saudi Arabien | AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100 % |
| Schottland | UEFA | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 14 | −1 | 38.46 % |
| Schweden | UEFA | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | −3 | 27.27 % |
| Schweiz | UEFA | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 14 | +6 | 42.11 % |
| Senegal | CAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 % |
| Serbien (und Jugoslawien) | UEFA | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | −4 | 18.18 % |
| Slovakia | UEFA | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 20 % |
| Sowjetunion | UEFA | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 37.5 % |
| Spanien | UEFA | 26 | 4 | 7 | 15 | 18 | 54 | −36 | 15.38 % |
| Südafrika | CAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100 % |
| Trinidad und Tobago | CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 % |
| Tschechien | UEFA | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | −4 | 25 % |
| Tschechoslowakei | UEFA | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 29 | −15 | 33.33 % |
| Tunesien | CAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100 % |
| Türkei | UEFA | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 16 | +11 | 35.71 % |
| USA | CONCACAF | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | +8 | 60 % |
| Ukraine | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 % |
| Ungarn | UEFA | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 24 | −4 | 23.08 % |
| Uruguay | CONMEBOL | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 25 % |
| Wales | UEFA | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 19 | −1 | 31.58 % |
| Weißrussland | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 % |
| Zypern | UEFA | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 9 | +18 | 80 % |
| insgesamt | 83 | 627 | 241 | 175 | 211 | 846 | 763 | +83 | 38.44 % |
Die nordirische Fußballnationalmannschaft, bekannt als die „Green and White Army“, ist eine der ältesten Nationalmannschaften der Welt. Sie repräsentiert Nordirland unter der Schirmherrschaft der Irish Football Association (IFA), die 1880 gegründet wurde und seit 1911 Mitglied der FIFA ist. Bis zur Teilung Irlands in den frühen 1920er Jahren vertrat die Mannschaft ganz Irland. Seitdem agiert sie als eigenständige Auswahl Nordirlands, obwohl bis in die 1950er Jahre Spieler aus ganz Irland in beiden irischen Nationalmannschaften spielten. Mit einer Bevölkerung von nur etwa 1,9 Millionen Menschen ist Nordirland die kleinste Nation, die sich mehrfach für eine WM-Endrunde qualifiziert hat, was ihre Leistungen umso bemerkenswerter macht.
Die Wurzeln der nordirischen Nationalmannschaft reichen bis 1882 zurück, als eine gesamtirische Auswahl ihr erstes Spiel bestritt. Nach der Teilung 1921 übernahm die IFA die Verantwortung für Nordirland, während die Football Association of Ireland (FAI) die Republik Irland vertritt. Bis 1950 trat die nordirische Mannschaft teilweise noch als „Irland“ auf, was die historische Komplexität widerspiegelt.
Nordirlands größte Erfolge datieren auf die Weltmeisterschaften 1958, 1982 und 1986. 1958, unter der Leitung von Trainer Peter Doherty und angeführt von den Brüdern Jackie und Danny Blanchflower, erreichte die Mannschaft das Viertelfinale der WM in Schweden – ein historischer Meilenstein. Nach einem 1:0-Sieg gegen die Tschechoslowakei schieden sie gegen Frankreich aus. 1982 in Spanien, unter Trainer Billy Bingham, gelang ein weiterer Höhepunkt: Nordirland besiegte Gastgeber Spanien 1:0 und kam bis in die Zwischenrunde, scheiterte jedoch an Frankreich (1:4). 1986 in Mexiko war die letzte WM-Teilnahme, bei der die Mannschaft in der Vorrunde gegen Spanien (1:2) und Brasilien (0:3) ausschied.
Die erste Teilnahme an einer Europameisterschaft gelang 2016 in Frankreich. Nordirland qualifizierte sich durch einen 3:1-Sieg gegen Griechenland und erreichte als einer der besten Gruppendritten das Achtelfinale, wo sie durch ein Eigentor von Gareth McAuley gegen Wales (0:1) ausschieden. Dies war der erste Auftritt bei einem großen Turnier seit 1986.
Die Spielweise Nordirlands ist traditionell britisch geprägt: physisch robust, mit Fokus auf lange Bälle und Kampfgeist. Viele Spieler sind in den englischen oder schottischen Profiligen aktiv, was die Mannschaft wettbewerbsfähig macht. Die Heimspiele im Windsor Park in Belfast, der mit etwa 27.000 Plätzen eine elektrisierende Atmosphäre bietet, sind berüchtigt für ihre Intensität. Seit fast zwei Jahren ist Nordirland dort ungeschlagen, mit acht Siegen in neun Spielen und nur einem Gegentor – eine beeindruckende Heimstärke.
Die grünen Trikots symbolisieren die gesamtirischen Wurzeln, während die blauen Auswärtstrikots einen Kontrast zur rot-weißen Nationalflagge bilden. Seit 2012 ist Adidas wieder der offizielle Ausrüster.
Unter Trainer Michael O’Neill, der die Mannschaft seit 2011 mit Unterbrechungen führt, befindet sich Nordirland in der WM-Qualifikation 2026 in der Gruppe A gegen Deutschland, die Slowakei und Luxemburg. Die Qualifikation begann mit einer 0:2-Niederlage gegen die Slowakei, gefolgt von einem 1:3 gegen Deutschland in Köln, wo Isaac Price den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte. Ein 2:0-Sieg gegen die Slowakei in Belfast, durch ein Eigentor und ein Tor von Trai Hume, brachte Nordirland punktgleich mit Deutschland und der Slowakei an die Tabellenspitze. Am 13. Oktober 2025 traf die Mannschaft erneut auf Deutschland in Belfast, ein Spiel, das aufgrund von Kommentaren des deutschen Trainers Julian Nagelsmann über den „unansehnlichen“ Spielstil Nordirlands zusätzliche Brisanz erhielt.
Der aktuelle Kader setzt auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern wie Rekordnationalspieler Steven Davis und Kapitän Conor Bradley sowie jungen Talenten. Jonny Evans, ein Verteidiger mit Premier-League-Erfahrung, bleibt eine Schlüsselfigur. George Best, der größte nordirische Spieler aller Zeiten, verpasste leider die großen Turniere, bleibt aber eine Ikone.
Trotz der stolzen Geschichte kämpft Nordirland mit der geringen Bevölkerungsgröße und begrenzten Ressourcen. In der UEFA Nations League 2024/25 erreichte die Mannschaft in Liga C den 1. Platz (3 Siege, 2 Remis, 1 Niederlage), was Stabilität zeigt. Dennoch bleibt die Qualifikation für große Turniere eine Herausforderung, besonders gegen starke Gegner wie Dänemark oder Slowenien in der EM-Qualifikation 2024.
Hurling
Hurling ist ein traditioneller gälischer Sport, der in Irland und Nordirland tief verwurzelt ist und eine zentrale Rolle in der Kultur und Identität der Insel spielt. Als einer der ältesten Feldsportarten der Welt, dessen Ursprünge über 3000 Jahre zurückreichen, wird Hurling oft als das „schnellste Spiel auf Gras“ bezeichnet, da es Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und körperliche Robustheit vereint. Der Sport wird mit einem kleinen Lederball, dem sliotar, und einem Holzstock, dem hurley oder camán, gespielt, mit dem der Ball geschlagen, balanciert oder getragen wird.
In Irland und Nordirland wird Hurling unter der Schirmherrschaft der Gaelic Athletic Association (GAA) organisiert, die den Sport auf Amateur basis fördert. Die All-Ireland Senior Hurling Championship ist der prestigeträchtigste Wettbewerb, bei dem Mannschaften aus verschiedenen Countys um den Titel kämpfen. Besonders in Countys wie Kilkenny, Cork, Tipperary und Limerick ist Hurling extrem populär, und die Spiele ziehen Tausende von Zuschauern an, insbesondere das Finale im Croke Park in Dublin. In Nordirland ist der Sport vor allem in Countys wie Antrim und Derry verbreitet, wo die gälische Kultur ebenfalls stark ausgeprägt ist.
Hurling ist mehr als nur ein Sport; es ist ein Symbol für Gemeinschaft und Tradition. Die Spiele fördern lokale Rivalitäten, aber auch Stolz und Zusammenhalt. In Nordirland hat der Sport zudem eine besondere Bedeutung, da er oft mit der irischen Identität und dem kulturellen Erbe verbunden ist, was in der politisch komplexen Region eine zusätzliche Ebene der Symbolik schafft. Trotz der Teilung der Insel bleibt Hurling ein verbindendes Element, das in beiden Regionen leidenschaftlich ausgeübt und gefeiert wird.
Neben dem traditionellen Hurling gibt es auch Poc Fada, eine Variante, bei der Spieler den sliotar über lange Distanzen in möglichst wenigen Schlägen über hügeliges Gelände schlagen. Der Sport hat sich in den letzten Jahren auch international verbreitet, mit Hurling-Clubs in Ländern wie den USA, Australien und sogar Deutschland, wo irische Auswanderer und Enthusiasten den Sport lebendig halten.
Persönlichkeiten
Zu den wichtigsten irischen Persönlichkeiten gehören:
- Brian Boru (um 941 bis 1014), Hochkönig
- Jonathan Swift (1667 bis 1745), Schriftsteller, Satiriker
- Laurence Sterne (1713 bis 1768), Schriftsteller
- Arthur Guinness (1725 bis 1803), Unternehmer, Brauereigründer
- Edmund Burke (1729 bis 1797), Politiker, Philosoph
- Francis Beaufort (1774 bis 1857), Hydrograf, Erfinder der Beaufortskala
- Daniel O’Connell (1775 bis 1847), Politiker, Bürgerrechtler
- Thomas Moore (1779 bis 1852), Dichter
- Charles Stewart Parnell (1846 bis 1891), Politiker
- Bram Stoker (1847 bis 1912), Schriftsteller („Dracula“)
- Oscar Wilde (1854 bis 1900), Schriftsteller
- George Bernard Shaw (1856 bis 1950), Dramatiker, Literaturnobelpreisträger
- Douglas Hyde (1860 bis 1949), Präsident Irlands, Sprachwissenschaftler
- William Butler Yeats (1865 bis 1939), Dichter, Literaturnobelpreisträger
- Arthur Griffith (1872 bis 1922), Politiker
- Ernest Shackleton (1874 bis 1922), Polarforscher
- James Joyce (1882 bis 1941), Schriftsteller
- Eamon de Valera (1882 bis 1975), Politiker, Präsident von Irland
- Seán T. Ó Ceallaigh (1882 bis 1966), Präsident Irlands
- Erskine Hamilton Childers (1905 bis 1974), Präsident Irlands
- Seán MacBride (1904 bis 1988), Politiker, Friedensnobelpreisträger
- Samuel Beckett (1906 bis 1989), Schriftsteller, Literaturnobelpreisträger
- Patrick Kavanagh (1904 bis 1967), Dichter
- Iris Murdoch (1919 bis 1999), Schriftstellerin und Philosophin
- Richard Harris (1930 bis 2002), Schauspieler
- Peter O’Toole (1932–2013), Schauspieler
- Mary Robinson (* 1944), Politikerin, Präsidentin Irlands
- Bob Geldof (* 1951), Musiker, Aktivist
- Liam Neeson (* 1952), Schauspieler
- Pierce Brosnan (* 1953), Schauspieler
- Bono (Paul Hewson, * 1960), Sänger (U2)
- Enya (Eithne Ní Bhraonáin), * 1961), Sängerin, Musikerin
- Sinéad O’Connor (1966 bis 2023), Sängerin
- Colin Farrell (* 1976), Schauspieler
- Cillian Murphy (* 1976), Schauspieler
- Michael Fassbender (* 1977), Schauspieler
- Katie Taylor (* 1986), Boxerin, Olympiasiegerin
- Conor McGregor (* 1988), Kampfsportler
- Rory McIlroy (* 1989), Golfspieler
- Hozier (Andrew Hozier-Byrne, * 1990), Musiker
- Saoirse Ronan (* 1994), Schauspielerin
- Niall Horan (* 1993), Musiker (One Direction)
Fremdenverkehr
Die Insel Irland, oft liebevoll als „grüne Insel“ bezeichnet, ist ein Juwel des nordwestlichen Europas, umgeben von hunderten kleinerer Inseln wie den Aran Islands oder der Isle of Man. Getrennt durch die Irische See vom britischen Festland, teilt sich die Insel in die Republik Irland im Süden und Westen – ein EU-Mitglied – und Nordirland im Nordosten, das zum Vereinigten Königreich gehört. Diese Teilung, resultierend aus historischen Konflikten in den 1920er Jahren, beeinflusst den Tourismus nur minimal: Reisende bewegen sich weitgehend frei zwischen beiden Teilen, und die gemeinsame Kultur sowie die atemberaubende Natur laden zu nahtlosen Erkundungen ein. Der Tourismus ist ein zentraler Wirtschaftsfaktor für die gesamte Insel, der 2022 rund 5,8 Milliarden Euro einbrachte und etwa 1,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachte. Im Jahr 2019 zählte Irland insgesamt 10,95 Millionen internationale Touristen, und die Zahlen steigen weiter an – 2024 verzeichnete die Republik Irland einen Anstieg der Besucherzahlen um 4 Prozent aus Deutschland allein. Nordirland profitiert ebenfalls von diesem Boom, mit wachsenden Hotelkapazitäten um 4 Prozent und Events wie den Open Golf Championships 2025.
Irland und Nordirland faszinieren durch ihre vielfältige Landschaft, die von der Wild Atlantic Way – einer 2.500 Kilometer langen Küstenroute entlang der Westküste – bis zu den dramatischen Basaltformationen des Nordens reicht. In der Republik Irland dominieren smaragdgrüne Hügel, tückische Klippen und unberührte Nationalparks. Die Cliffs of Moher im County Clare ragen bis zu 214 Meter über den Atlantik empor und bieten atemberaubende Ausblicke auf tosende Wellen und Seevögel. Weiter südlich lockt der Killarney Nationalpark mit kristallklaren Seen, moosbedeckten Wäldern und dem imposanten Muckross House, einem viktorianischen Herrenhaus inmitten wilder Natur. Die Dingle Peninsula im County Kerry, oft als eine der schönsten der Welt gelobt, vereint keltische Ruinen, Delfinbeobachtungen und endlose Sandstrände – ideal für Wanderer und Naturliebhaber.
Im Westen Irlands erstreckt sich Connemara, eine Region von zerklüfteten Bergen, stillen Seen und weißgesprenkelten Schafen hinter Steinmauern, die an traditionelle irische Landschaften erinnern. Die Aran Islands, erreichbar per Fähre von Galway aus, bieten authentisches Inselleben mit gälisch sprechenden Bewohnern, prähistorischen Forts und endlosen Radwegen. Nordirland ergänzt dieses Spektrum mit seiner eigenen Dramatik: Der Giant's Causeway, ein UNESCO-Weltkulturerbe, besteht aus über 40.000 sechseckigen Basaltbasen, die wie ein gigantisches Puzzle aussehen und Legenden von Riesen wecken. Die Causeway Coastal Route führt von hier aus durch malerische Dörfer wie Bushmills, wo man in der ältesten Destillerie Irlands einen Whiskey probieren kann, bis hin zu den Ruinen des Dunluce Castle, das hoch über dem Meer thront. Der Glenveagh Nationalpark im Norden, mit seinen schimmernden Seen und mystischen Wäldern, ist ein Highlight für Naturräusche und Vogelbeobachtungen. Gemeinsam bilden diese Schauplätze eine durchgängige Attraktion: Viele Touristen starten in Dublin und reisen per Mietwagen oder Bus nahtlos in den Norden, um die gesamte Insel zu umrunden.
Der Reiz Irlands liegt nicht nur in der Natur, sondern in seiner lebendigen Kultur, die nahtlos über die Grenze hinweg pulsiert. Die Republik Irland präsentiert eine Fülle historischer Schätze: Das Blarney Castle nahe Cork, wo man den berühmten „Blarney Stone“ küsst, um Eloquenz zu erlangen; der Rock of Cashel, eine mittelalterliche Festung auf einem Kalkfelsen; oder die Bunratty Castle mit seinem mittelalterlichen Festbankett. Dublin, die pulsierende Hauptstadt, zieht mit dem Guinness Storehouse – einem Tempel des berühmten Stoats – und dem Trinity College, Heimat des illuminierten „Book of Kells“, Millionen an. Hier mischt sich lebhafte Pub-Kultur mit Straßenmusik und literarischen Spuren von Joyce bis Yeats. Galway, die „bohemische“ Stadt im Westen, lebt von Festivals, Street-Art und frischem Seafood.
Nordirland fügt dieser Palette urbane und historische Tiefe hinzu. Belfast, die Hauptstadt, hat sich von ihrer turbulenten Vergangenheit zu einer kreativen Metropole gewandelt: Das Titanic Belfast Museum erzählt eindrucksvoll die Geschichte des unglücklichen Schiffes, das hier gebaut wurde. Die Stadtmauern von Derry/Londonderry, die am besten erhaltenen in Europa, umgeben eine Altstadt voller Murals zur Troubles-Zeit und lebendiger Märkte. Armagh, die „geistliche Hauptstadt“, beeindruckt mit zwei prächtigen Kathedralen zu Ehren von St. Patrick und einer Sternwarte, in der man uralte Meteoriten berühren kann. Überall auf der Insel ist die irische Gastfreundschaft spürbar – ein warmer Willkommensgruß, ein Pint in traditionellen Pubs wie dem Crown Liquor Saloon in Belfast oder spontane Ceilidh-Tänze machen jeden Aufenthalt unvergesslich. Kulinarisch verbindet die Insel: Von irischem Stew und Soda Bread in Dublins Cafés bis zu frischem Räucherlachs in Cork, das sich zur „Food Capital“ mauserte.
Der beste Reisezeitraum ist Mai bis September, wenn die Temperaturen mild (10–20 °C) sind und die Landschaften in sattem Grün erstrahlen – ideal für Wandern oder Radtouren. Im Winter locken ruhige Besuche historischer Stätten und festliche Weihnachtsmärkte. Anreise erfolgt hauptsächlich über Flughäfen wie Dublin, Cork oder Belfast; von Deutschland aus gibt es direkte Flüge. Für Nordirland ist ab April 2025 eine ETA-Genehmigung (ca. 19 €) erforderlich, die Republik Irland bleibt schengenerleichtert. Mietwagen eignen sich perfekt für flexible Routen, achten Sie auf Vollkaskoversicherung wegen enger Straßen und Linksverkehr. Öffentliche Verkehrsmittel wie Bus Éireann oder Translink verbinden Städte effizient. Unterkünfte reichen von gemütlichen B&Bs bis Luxushotels; die Kapazitäten wachsen jährlich. Nachhaltigkeit ist ein Trend: Viele Routen fördern umweltfreundliches Reisen, wie E-Bike-Touren im Connemara oder geführte Naturwanderungen.
Ein- und Ausreise:
- Reisedokumente: Irland ist Mitglied der Europäischen Union. Ein einfacher Reisepass ist mit sich zu führen.
- Impfungen: Es gibt keine Impfvorschriften.
- Zollbestimmungen: Es gibt keine Beschränkungen und Formalitäten abgabenrechtlicher Art für das Reisegepäck und ausschließlich zu privaten Zwecken mitgeführter Waren. Verboten sind: Drogen, Waffen undsoweiter, Fleisch-, Geflügel- oder Molkereiprodukte sowie Frischgemüse. Problemlos können Privatpersonen Waren mitführen, die im EU- Mitgliedstaat des Einkaufs bereits versteuert (sogenannte verbrauchssteuerpflichtige) wurden (ohne nochmalige Besteuerung) und wenn sie ausschließlich für ihren Eigenbedarf, das heißt nicht zu gewerblichen/ kommerziellen Zwecken, erworben wurden. Höchstgrenzen zur Abgrenzung gewerblicher Verwendung sind: 800 Zigaretten, 200 Zigarren, 10 l Spirituosen, 45 l Wein und 55 l Bier. Für Waren aus Nicht-EU-Ländern bzw. Duty-Free-Shops gelten geringere Mengen.
- Reisen mit Kfz: Für das Lenken eines Kfz ist der jeweilige nationale Führerschein nötig.
- Umgangsformen: Handschlag ist selten, Umarmung noch seltener - bei der Beg5rüßung sind dennoch weniger steif als Briten. Man schätzt hier vor allem Witz, Humor, Gesang und vor allem Geselligkeit.
- Trinkgeld: Trinkgelder in Irland sind ein schwieriges Thema
- Ist die Bedienung ausdrücklich nicht enthalten, sind 10 bis 15 % des Rechnungsbetrags angemessen und werden auch erwartet. Außer, es wird bereits in der Rechnung eine eigene „Service Charge“ berechnet. Taxifahrern gibt man meist 10 % des Fahrpreises, Trägern maximal einen Euro oder ein Pfund pro Gepäckstück. Trinkgeld für Servicepersonal im Pub ist dem Kunden überlassen. An der Bar wird meistens kein Trinkgeld erwartet, man kann den Barkeeper jedoch zum Mittrinken einladen. Er wird meist den Preis eines Biers abrechnen und dies dann nicht zapfen oder gar trinken.
- Reisezeit: Vielleicht sollte man nicht unbedingt im Dezember oder Januar nach Irland reisen. Es ist dann extrem windig, kühl und feucht. Manchmal schneit es dann auch in Irland. Als optimale Reisezeit für Irland könnte man die wärmsten Monate Juli und August betrachten. Allerdings gilt als die beste Reisezeit für Irland bei überzeugten Irland Urlaubern eher das Frühjahr (April, Mai) und auch der Herbst (September, Oktober).
Literatur
- wikipedia = https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Republic_of_Ireland
- wikitrravel = https://wikitravel.org/en/Ireland
- wikivoyage = https://en.wikivoyage.org/wiki/Ireland
Reiseberichte
- Viel unterwegs = https://viel-unterwegs.de/reiseziele/irland/
- Zimtblume: Irland-Rundreise (21.9.2024) = https://www.zimtblume.de/irland-rundreise/
Videos
- Irland, 4k Drohnen Naturfilm = https://www.youtube.com/watch?v=B4YGdp29-hY
- Ireland in 4k Drone Fly By = https://www.youtube.com/watch?v=RNKWoqDlbxc
- Irland: Die grüne Insel im Atlantik. Reiusebericht = https://www.youtube.com/watch?v=Syqfas1QL3Y
- Die komplette Geschichte Irlands = https://www.youtube.com/watch?v=F2bAKb8EyKw
- The Entire History of Ireland = https://www.youtube.com/watch?v=ZcG4h3zqB1Y
- Irland - Geschichte zusammengefasst = https://www.youtube.com/watch?v=NqM-bZru2JY
- Die irische Revolution (Arte 2019) = https://www.youtube.com/watch?v=Ya3eY0MAevs
- Das gespaltene Königreich Großbritannien und Irland (Arte) = https://www.youtube.com/watch?v=DKEfeaKd5xw
- Irlands Küsten - Leben zwischen Land und Meer = https://www.youtube.com/watch?v=WcDzddkX4us
- Die große Hungernot in Irland = https://www.youtube.com/watch?v=-9QsALTOxIk
- Die gesamte Geschichte Irlkands zum Einbschlafen = https://www.youtube.com/watch?v=kL3aEE7N6X0
- Das Land der Mythen und Klippen = https://www.youtube.com/watch?v=bDYlFhUthKI
Atlas
- Irland, openstreetmap = https://www.openstreetmap.org/#map=7/53.488/-9.965
- Irland, ADAC = https://maps.adac.de/land/irland
- Irland,. Satellit = https://satellites.pro/Ireland_map
Reiseangebote
Irland-Reisen = https://www.ireland.com/de-at/
Irland, Studienreise = https://at.studienreisen.de/laender/Irland
Irland Adventures = https://www.discoverireland.ie/
Forum
Hier geht's zum Forum: