Jamaika (Jamaica)
Jamaika. ist bekannt als das Mutterland der Rastas und des Reggae. Hier gedieht einst die Kultur der Maroons, jener Schwarzen, die sich aus der Sklavenherrschaft befreit und nun einen eigenen Staat haben, dazu eine ganz eigene Sprache und Religion und überhaupt eine ganz eigene Welt.
Name
Bevor die Europäer die Insel sichteten, hieß sie bei den hier lebenden Taino Chaymakas und Xaymaca, was soviel bedeutet wie „Land der Quellen“ oder „Reichtum an Quellen“, nach einer etwas weiter ausholenden Interpretation „Land aus Holz und Wasser“. Dieser Name ist zugleich auch eine absolut zutreffende Beschreibung dieses an Quellen, Höhlen und Wäldern reichen Eilands.
Die angehenden spanische Kolonialherren hatten dvon freilich wieder mal keine Ahnung. Am 5. Mai 1494 landete der Entdeckungsreisende Cristoforol Colon alias Columbus an der Nordküste Jamaikas und gab der Insel den Namen Santa Gloria, „heilige Herrlichkeit“, weil er dessen Schönheit als überwältigend empfand und meinte, dies sei das schönste Land, das er je gesehen habe. 1509 nannte der eben zum Vizekönig ernannte Enterdeckerssohn Diego Columbus die Insel Santiago. Dieser Name bürgerte sich jedoch nie ein. Auch die Spanier gebrauchten schließlich den ursprünglichen indianischen Namen, den sie in Jamaica, bis ins 19. Jahrhundert auch Giamaica geschrieben, umwandelten.
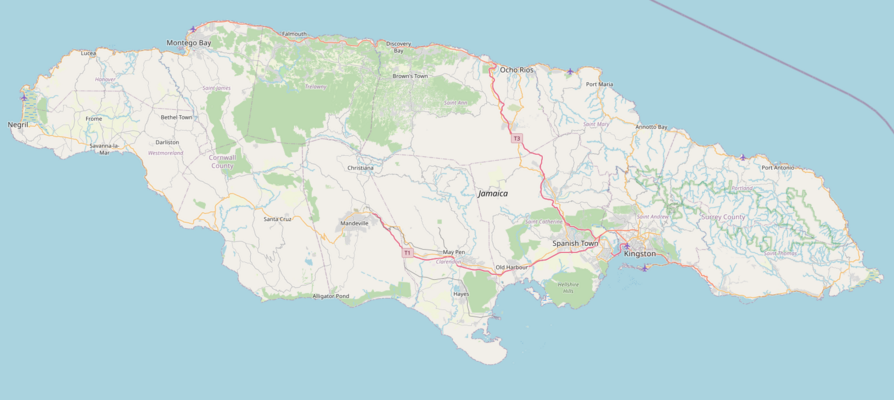
- abasisch: Ямайка [Jamajka]
- abchasisch: Ямайка [Jamajka]
- acehnesisch: Jamaika
- adygisch: Ямайкэ [Jamajkä]
- afrikaans: Jamaika
- akan: Gyameka
- albanisch: Xhamajka
- alemannisch: Dschamaika, Jamaika
- altaisch: Ямайка [Jamajka]
- amharisch: ጃማይካ [Jamayka]
- angelsächsisch: Iamaica
- arabisch: جامايكا [Ğāmāykā]
- aragonesisch: Chamaica
- arawak: Xaymaca
- armenisch: Յամայկա [Yamayka]
- aromunisch: Jamaica
- aserbaidschanisch: Јамајка [Yamayka]
- assamesisch: জামাইকা [Jāmāikā]
- asturisch: Xamaica
- awarisch: Ямайка [Jamajka]
- aymara: Xamayka
- bairisch-österreichisch: Dschamaika
- bambara: Zamayiki
- bandscharisch: Jamaika
- baschkirisch: Ямайка [Jamajka]
- baskisch: Jamaika
- bengalisch: জামাইকা [Jāmāikā], জ্যামেকা [Jæmekā]
- bhutanisch: ཇ་མའི་ཀ། [Ja.ma'i.ka]
- biharisch: जमाइका [Jamāikā]
- bikol: Yamaika
- birmanisch: Jámeka
- bislama: Jamaica
- bosnisch: Јамајка [Jamajka]
- bretonisch: Jamaika
- bulgarisch: Ямайка [Jamajka]
- burjatisch: Джамайка [Džamajka]
- cebuano: Jamaica
- chakassisch: Ямайка [Jamajka]
- chavakano: Jamaica
- cherokee: ᏣᎹᎢᎦ [Tsamaiga]
- chinesisch: 牙買加 / 牙买加 [Yámǎijiā]
- dari: جامایکا [Jāmāykā]
- dänisch: Jamaica
- deutsch: Jamaika
- dimli: Camayka
- dine: Jaméík’a
- emilianisch: Giamàica
- englisch: Jamaica
- esperanto: Jamajko
- estnisch: Jamaica
- estremadurisch: Jamaica
- ewe: Dzamaika nutome
- färingisch: Jameika
- fidschianisch: Jameka
- finnisch: Jamaika
- flämisch: Jamaica
- franko-provenzalisch: Jamayica
- französisch: Jamaïque
- friesisch: Jamaika
- friulanisch: Jamaica
- ful: Jamayka
- gagausisch: Ямайка [Yamayka]
- galizisch: Xamaica
- ganda: Jamayika
- gälisch: Siameuca, Iameuga, Iaimeuca
- georgisch: იამაიკა [Iamaika]
- griechisch: Τζαμάϊκα [Tzamáïka], Ζαμάϊκα [Zamáïka], Ἰαμάϊκα [Iamáïka], Ἰαμαϊκή [Iamaïkī́]
- grönländisch: Jamaika
- guarani: Jamaika
- gudscheratisch: જમાઈકા [Jamāīkā]
- guyanisch: Janmayk
- haitianisch: Jamayik
- hakka: Ngà-mâi-kâ
- hausa: Jamaica
- hawaiianisch: Iamaika
- hebräisch: ג׳מיקה [Jameyqah / Jamayqah], ג׳אמאיקה [Jâmâyqah], ג׳אמייקה [Jâmayqah / Jâmeyqah], ג׳מייקה [Jameyqah]
- hindi: जमैका [Jamækā], जमाइका [Jamāikā]
- ido: Jamaika
- igbo: Jameka
- ilokano: Jamaica
- indonesisch: Jamaika
- interlingua: Jamaica
- irisch: Iamáice
- isländisch: Jamaíka
- italienisch: Giamaica
- jakutisch: Дьамайка [D'amajka]
- jamaikanisch: Jumieka
- japanisch: ジャマイカ [Jamaika]
- javanisch: Jamaika
- jerseyanisch: Jamaïque
- jiddisch: יאַמײַקאַ [Yamayka]
- kabardisch: Ямайкэ [Jamajkă]
- kabiye: Camayiki
- kabylisch: Jamaika
- kalmükisch: Җамайкудин Орн [Šamajkudin Orn]
- kambodschanisch: ហ្សាម៉ាអ៊ិគ [Hsāmā'ik], ចាម៉ៃកា [Čāmaikā]
- kanaresisch: ಜಮೈಕ [Jamaika]
- kapverdisch: Jamaica
- karakalpakisch: Ямайка [Yamayka]
- karatschai-balkarisch: Ямайка [Jamajka]
- karelisch: Ямаика [Jamaika]
- kasachisch: Ямайка [Jamajka]
- kaschubisch: Jamajka
- katalanisch: Jamaica
- kikuyu: Jamaika
- kirgisisch: Ямайка [Jamajka]
- komi: Ямайка [Jamajka]
- kongolesisch: Jamaica
- koreanisch: 자마이카 [Jamaika], 자메이카 [Jameika]
- kornisch: Jamayka
- korsisch: Jamaica
- krimtatarisch: Ямаика [Jamaika]
- kroatisch: Jamajka
- kumükisch: Ямайка [Jamajka]
- kurdisch: جهماییکا [Cemayîka]
- kurmandschisch: Йамайка / یامایکا [Yamayka], Йамайк / یامایک [Yamayk]
- kvenisch: Jamaika
- ladinisch: Giamaica
- ladino: ז'אמאייקה [Jamayka]
- lakisch: Ямайка [Jamajka]
- laotisch: ຈາໄມກາ [Yamaika]
- lasisch: ჟამაიკა [Žamaika]
- lateinisch: Iamaica, Jamaica
- lesgisch: Ямайка [Jamajka]
- lettgallisch: Jamaika
- lettisch: Jamaika
- letzeburgisch: Jamaika
- ligurisch: Giamaica
- limburgisch: Jamaika
- lingala: Jamaike
- litauisch: Jamaika
- livisch: Jamaika
- lojban: djamaicas
- lombardisch: Giamaica
- luba-katanga: Jamaiki
- madegassisch: Jamaika
- makedonisch: Јамајка [Jamajka]
- malaisch: جامايكا [Jamaika]
- malayalam: ജമൈക്ക [Jamaikka]
- maldivisch: ޖެމެއިކާ [Jemeikā]
- maltesisch: Ġamajka
- manx: yn Yamaicey
- maori: Hamaika
- marathisch: जमाइका [Jamāikā]
- mari: Ямайка [Jamajka]
- maurizisch: Jamaica
- minangkabau: Jamaika
- mindeng: 嘉米加 [Gamiga]
- mingrelisch: იამაიკა [Iamaika]
- minnan: 嘉米加 [Kamika]
- mirandesisch: Jamaica
- moldawisch: Ямайка [Jamaica]
- mongolisch: Ямайк [Jamajk]
- mordwinisch: Ямайка [Jamajka]
- nahuatl: Xamaicān
- nauruanisch: Djamaica
- ndebele: Jamaika, Jamaica
- nepalesisch: जमाइका [Jamāikā]
- niederländisch: Jamaica
- niedersächsisch: Jamaika
- normannisch: Jamaïque
- norwegisch: Jamaica
- novial: Jamaika
- okzitanisch: Jamaica
- olonetzisch: Jamaika
- orissisch: ଜାମାଇକା [Jāmāikā]
- oromo: Jamaayikaa
- ossetisch: Ямайкæ [Jamajkä]
- pampangan: Jamaica
- pandschabisch: ਜੈਮਾਈਕਾ [Jæmāīkā]
- pandschabisch, west: جمائکا [Jamāʾikā]
- panganisan: Jamaica
- papiamentu: Hamaika
- paschtunisch: جامايکا [Jāmāykā], جميکا [Jamaykā]
- persisch: جامائیکا [Jāmā'īkā], ژامائیک [Žāmā'īk]
- piemontesisch: Jamaica
- pikardisch: Jamaique
- pitkernisch: Jamaeka
- plattdeutsch: Jamaika
- polnisch: Jamajka
- portugiesisch: Jamaica
- provenzalisch: Jamaica
- quetschua: Shamayka
- rätoromanisch: Giamaica
- ripuarisch: Jamaika
- romani: Jamaika
- rumänisch: Jamaica
- rundi: Jamayika
- russisch: Ямайка [Jamajka]
- ruthenisch: Ямайка [Jamajka]
- rwandesisch: Jamayika
- samisch: Jamaica, Jamaika
- samoanisch: Iamāika
- samogitisch: Jamaika
- sango: Zamaîka
- sardisch: Jamaica
- saterfriesisch: Jamaika
- schlesisch: Jamajka
- schottisch: Jamaica
- schwedisch: Jamaica
- schweizerdeutsch: Jamaika
- serbisch: Јамајка [Jamajka]
- seschellisch: Jamaica
- sindhi: جمیکا [Jamekā]
- singalesisch: ජැමෙයිකාව [Jameyikāva]
- sizilianisch: Giamaica, Jamaica
- slovio: Jamaika
- slowakisch: Jamajka
- slowenisch: Jamajka
- somalisch: Jameyka
- sorbisch: Jamaika
- spanisch: Jamaica
- sudovisch: Jamaika
- sundanesisch: Jamaika
- surinamesisch: Jamaica
- swahili: Jamaika
- swasi: Ijamayikha
- syrisch: ܓܡܝܩܐ [Gamyqa]
- tabassaranisch: Ямайка [Jamajka]
- tadschikisch: Ямайка [Jamajka], یمیکه [Yamaikâ]
- tagalog: Hamayka
- tahitianisch: Iamaika
- tamilisch: ஜமேக்கா [Jamēkkā9, ஜமைக்கா [Jamaikkā], ஜமைகா [Jamaikā]
- tatarisch: Ямайка [Yamayka]
- telugu: జమైకా [Jamaikā]
- thai: จาเมกา [Čāmēkā]
- tibetisch: ཡ་མས་ཁ། [Ya.mas.kʰa], ཇ་མའི་ཀ། [Ja.ma'i.ka]
- tigrinisch: ጃማይካ [Jamayka]
- timoresisch: Jamaika
- tonganisch: Samaneka
- tschechisch: Jamajka
- tschetschenisch: Ямайка [Jamajka]
- tschuwaschisch: Ямайкӑ [Jamajkă]
- turkmenisch: Ямайка [Ýamaýka]
- tuwinisch: Ямайка [Jamajka]
- türkisch: Jamaika, Jamayka
- twi: Jameka
- udmurtisch: Ямайка [Jamajka]
- uigurisch: يامايكا [Yamayka]
- ukrainisch: Ямайка [Jamajka]
- ungarisch: Jamaica
- urdu: جمیکا [Jamekā]
- usbekisch: Ямайка [Yamayka]
- venezianisch: Giamaica
- vietnamesisch: Ha-mai-ca
- visayan: Jamaika
- volapük: Camaykeän
- voronisch: Jamaika
- walisisch: Jamaica
- wallonisch: Djamayike
- weißrussisch: Ямайка [Jamajka]
- wepsisch: Jamaik
- winaray: Jamaica
- wolof: Jamaaik
- xhosa: Jamaika
- yoruba: Jamáíkà
- zazakisch: ژامائیکا [Jamaîka]
- zhuang: Kamjok
- zulu: iJamaika
Offizieller Name: Jamaica
- Bezeichnung der Bewohner: Jamaicans (Jamaikaner)
- adjektivisch: jamaican (jamaikanisch)
Kürzel:
- Landescode: JM / JAM
- Deutsch: JAM
- Alternativ: JMC
- Sport: JAM (1948 bis 1959 und seit 2000), BWI (1960 bis 1999)
- Kfz: JA (seit 1932)
- FIPS-Code: JM
- ISO-Code: JM, JAM, 388
- Internet: .jm
Lage
Jamaika gehört zu den Großen Antillen. Der Inselstaat liegt im Zentrum Mittelamerikas am Karibischen Meer auf durchschnittlich 18°05’ n.B. und 77°17’ w.L.. Er befindet sich auf der gleichen geografischen Brekte wie der südliche Teil der Insel Hispaniola, Puerto Rico, die Jungferninseln, Anguilla, das südliche Mauretanien, der Norden der afrikanischen Staaten Mali, Niger, Tschad und Sudan, der Süden Saudi-Artabiens und Omans, Zentral-Indien mit Puna und Warangal, Zentral-Birma mit Sandoway, Nord-Thailand mit Chiang Mai, Zentral-Laos, das nördliche Vietnam mit Vinh, der Süden der chinesischen Insel Hainan, der äußerste Norden der philippinischen Insel Luzon, die nördliche Marianen-Insel Pagan, das südliche Zentrum Mexikos mit Villahermosa und der Süden der Halbinsel Yucatan. Jamaika liegt im Karaibischen Meer mit einer Gesamtküstenlänge von 1022 km. Nächste Nachbarn sind Haiti, Kuba und die Cayman-Inseln.

Geografische Lage:
- nördlichster Punkt: 18°31’24“ n.B. (Little River)
- südlichster Punkt: 17°42’52“ n.B. (Portland Poinr) bzw. 16°47’00“ n.B. (Powell Knoll)
- östlichster Punkt: 76°10’55“ w.L. (Morant Point)
- westlichster Punkt: 78°24’08“ w.L. (South Negril Point)
Entfernungen:
- Great Goat Island 170 m
- Navassa Island 132 km
- Kuba 150 km
- Haiti 191 km
- Cayman Brac 216 km
- Cayman 308 km
- Raya (Nicaragua) 625,5 km
- Barranquilla (Kolumbien) 774 km
- Florida 794 km
- Puerto Rico 960 km
Zeitzone
In Jamaika gilt die Eastern Standard Time (Östliche Standard-Zeit), abgekürzt EST (OZ), von Ende April bis Oktober die Eastern Daylight Time (Östliche Sommerzeit), kurz EDT (OSZ), jeweils 5 Stunden hinter der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ, UTC-4). Die Realzeit liegt um 5 Stunden und 5 bis 14 Minuten hinter der Koordinierten Weltzeit (UTC), das heißt die Sonne geht um 6 Stunden und 10 bis 19 Minuten später auf als in Wien.
Fläche
Der Staat Jamaika hat offiziell eine Fläche von 10.911 km² bzw. 4.213 mi². Alternativ werden 10.991 bis 11.100 km² bzw. 4.444 mi² angegeben. Von Osten nach Westen durchmisst das Land 235 km bei einer maximalen Nord-Süd-Breite von 84 km. Die Küöstenlänge beträgt 1.022 km. Vor der Südwestküste liegt die Pedro Bank, eine unterseeische Erhebung, die auf einer Fläche von 8000 km² eine Wassertiefe von weniger als 100 m hat. In der Bank befinden sich die Pedro Cays, eine Inselgruppe mit einer Gesamtfläche von 26,9 ha. Das Staatsgebiet Jamaikas umfasst neben der Hauptinsel und den Pedro Cays noch die 60 km vor der Westküste gelegene Inselgruppe Morant Cays. Höchste Erhebung Jamaikas ist der Blue Mountain Peak mit 2256 m. Die tiefste Stelle befindet sich auf Meeresniveau mit einem Tidenhub von 0,3 bis 0,7 m (Montego Bay 0,55 m, Port Morant 0,44 m, Port Royal 0,39 m). Die mittlere Seehöhe beträgt rund 340 m.
Flächenaufteilung 2001:
Wiesen und Sträucher 4.566 km² 41,9 %
Waldland 3.390 km² 31,1 %
Agrarland 1.793 km² 16,4 %
Weiden 957 km² 8,8 %
Gewässer 160 km² 1,5 %
Verbautes Gelände 45 km² 0,4 %
Geologie
Jamaika liegt am Nordrand der karibischen Platte die sich direkt vor der Küste unter die Nordamerikanische Platte schiebt. Die Nähe zur Plattengrenze führt immer wieder zu starken Erdbeben wie dem, das 1692 unter anderem Port Royal zerstörte.
Die Karibik ist eine der geologisch komplexesten Regionen der Welt. Viele Details der Entstehung Jamaikas sind unbekannt oder umstritten. Die verbreitetste Theorie geht davon aus, dass sich der westliche Teil Jamaikas und die Blue Mountains im Osten in verschiedenen Regionen entwickelt haben und erst im Miozän vor etwa acht Millionen Jahren zusammentrafen.
Die Blue Mountains im Osten sind Teil eines Gebirges, dessen Bergketten sich auch auf Kuba und Hispaniola finden. Die geologischen Strukturen sind identisch mit den dort zu findenden. Die Berge wurden am Ende des Eozäns aus dem Wasser gehoben und sind seitdem permanent über dem Meeresspiegel. Es besteht die Möglichkeit einer kurzzeitigen Landbrücke zu Hispaniola vor etwa 35 Millionen Jahren.
Die westlichen Teile Jamaikas und die Pedrobank waren ursprünglich Teil des unterseeischen Nicaragua-Rückens von dem sie sich vor 40 Millionen Jahren abspalteten. Im Laufe der Kreidezeit bildeten sich in der Region eine Reihe von Unterwasservulkanen, von denen einzelne wahrscheinlich kurzzeitig die Meeresoberfläche durchbrechen konnten. Das älteste heute auf der Insel zu findende Gestein ist erkaltete Lava aus dieser Periode. Der gesamte Block wurde im späten Eozän durch tektonische Bewegungen, unterstützt durch einen stark fallenden Meeresspiegel, über die Oberfläche gehoben. Spätestens dabei endete der größte Teil der vulkanischen Aktivität. Nach weiteren 5 Millionen Jahren bedeckte der wieder steigende Meeresspiegel wieder große Teile der Fläche. Nachfolgend entstand ein mehrere hundert Meter dicker Kalksteinpanzer, der heute noch fast den gesamten Westen bedeckt. Es gibt Anzeichen, dass sich einige höher gelegene Teile in der Folge noch mehrmals über der Wasseroberfläche befunden haben. Die letzte große Hebung begann vor acht Millionen Jahren, zeitgleich mit dem Zusammentreffen mit den Blue Mountains.
Landschaft
Der Westen und die Mitte der Insel werden dominiert von mehreren hundert Meter dicken Kalksteinschichten die etwa zwei Drittel der Oberfläche bedecken. Die bis zu 900 Meter hohen Bergketten in Zentrum bestehen zu großen Teilen daraus. Im weichen Gestein haben sich tiefe Täler, Dolinen und Höhlen mit unterirdischen Flussläufen gebildet. Die Verkarstung ist besonders ausgeprägt im Cockpit County südlich von Montego Bay. Die Gebirge fallen an einigen Stellen im Norden über 500 m steil zur See ab. Dort beginnt unmittelbar vor der Küste der 7680 m tiefe Kaimangraben. Im Süden ist der Abstieg zum Meer flacher mit weiten Alluvialebenen die im Laufe der vergangenen acht Millionen Jahre von den Flüssen geschaffen wurden. Ausnahmen bilden zwei Bergketten in Westmoreland und Saint Elizabeth, die bis an die Küste reichen. Neben Kalk wird der Untergrund von erkalteter Magma, Gneise und Schiefer geformt. Der wichtigste Bodenschatz ist Bauxit, dessen Lagerstätten sich östlich von Montego Bay und westlich von Kingston im Inselinneren befinden. Außerdem werden Gips und Marmor abgebaut.
Der Osten wird von den Blue Mountains geprägt, einer Bergkette, die sich auf einer Länge von rund 100 km von Nordwesten nach Südosten erstreckt, mit zahlreichen Ausläufern nach Norden und Süden. Der höchste Punkt der Insel, die 2256 m hoch gelegene Blue Mountain Peak, befindet sich hier.
Jamaika wird von vielen kurzen Flüssen durchzogen. Aufgrund der Lage der Gebirge fließen diese meist nach Norden oder Süden. Die Menge des von ihnen geführten Wassers schwankt während der Regenzeiten stark. Im meist weichen Gestein können die Flüsse leicht ihren Lauf ändern oder über längere Strecken unterirdisch verlaufen. Häufig wird der Black River als längster Fluss Jamaikas genannt. Auf einer Länge von 53,4 km führt er ganzjährig oberirdisch Wasser und ist mit kleinen Booten schiffbar. Der eigentlich längste Fluss ist aber der Rio Minho mit 92,6 km, dessen Oberlauf jedoch regelmäßig trockenfällt und der nur in unmittelbarer Küstennähe schiffbar ist. Beide Flüsse liegen im Südwesten und werden durch die Clarendon-Wasserscheide getrennt. Ebenfalls auf Abschnitten schiffbar ist der 39,7 km lange Cabaritta River. Besondere wirtschaftliche Bedeutung hat der Rio Cobre, der in Saint Catherine eine Anbaufläche von 73 km² bewässert und Spanish Town mit Elektrizität versorgt.
Im porösen Kalkstein bilden sich nur selten Seen. Eine Ausnahme ist der Moneague Lake. In normalen Jahren belegt er nur eine sehr kleine Fläche oder trocknet ganz aus. Im Abstand von mehreren Jahrzehnten wächst er jedoch auf eine Fläche von 300 Hektar an, die er für mehrere Monate behält. Der Grund ist unbekannt, steht aber wohl in Zusammenhang mit Veränderungen im unterirdischen Abfluss.
Erhebungen
- Blue Mountain Peak (Blue Mountains) 2256 m
- High Peak (Blue Mountains) 2076 m
- Mossman’s Peak (Blue Mountains) 2043 m
- Sir Johns Peak (Blue Mountains) 1930 m
- John Crow Peak (Blue Moutains) 1753 m
- Catherine’s Peak (Blue Mountains) 1542 m
- Macca Sucker 1355 m
- Mount Telegraph (Blue Mountains) 1275 m
- John Crow Mountain (John Crow Mountains) 1050 m
Flüsse
- Rio Minho 92,5 km
- Black River 53,4 km
- Wa Water / Flint River 50,0 km
Flora und Fauna
Jamaika beherbergt eine vielfältige Flora mit über 3.500 Pflanzenarten, darunter etwa 900 endemische Arten, die in Regenwäldern, Trockenwäldern und Mangroven leben. Die Fauna umfasst zahlreiche endemische Vögel wie den Jamaika-Todi, verschiedene Reptilienarten, darunter die Jamaika-Boa, sowie Meerestiere in den umliegenden Korallenriffen.
Flora
Die Flora Jamaikas besteht aus drei Ökoregionen: den jamaikanischen Feuchtwald, den jamaikanischen Trockenwald und die Mangroven an der Küste. Jamaika war ursprünglich fast vollständig mit Wald bedeckt, es gab nur wenige offene Flächen. Durch Bebauung und Landwirtschaft wurden die meisten Gebiete zerstört. Etwa 6 % der Landfläche sind noch in ihrem ursprünglichen Zustand. 1995 wurde Jamaika vom World Resources Institute als Land mit der größten Abholzungsrate bestimmt. Unter dem Einfluss des zunehmenden Ökotourismus wurden Gesetze zum Schutz der verbleibenden Habitate erlassen, deren Durchsetzung aber schwierig ist.
Der Anteil endemischer Pflanzen ist sehr groß. Von den 3003 bekannten Blütenpflanzen kommen 28 % nur auf der Insel vor, bei den Farnen liegt der Anteil bei 14 %. Von den Bromelien und Orchideen sind knapp ein Drittel nur auf der Insel zu finden.
Der Trockenwald folgt der Küstenlinie in einem schmalen Streifen. Im Süden belegte er ursprünglich größere Flächen, diese sind aber fast vollständig abgeholzt und durch Felder ersetzt. Der Niederschlag liegt zwischen 700 und 1200 mm pro Jahr. Die Wälder reichen selten höher als 200 Meter über den Meeresspiegel. Was die Zerstörung betrifft ist der Trockenwald die am schwersten betroffene Region. Unter den endemischen Pflanzen sind die monotypischen Gruppen Portlandia und Jacaima die zur Unterfamilie der Seidenpflanzengewächse gehören.
Der Feuchtwald bedeckte die größten Teile des Landesinneren. Lediglich die höchsten Teile der Blue Mountains sind waldfrei. Der Niederschlag kann an den Hängen der höchsten Gipfel bis zu 5000 Millimeter pro Jahr betragen, vor allem zu den beiden Regenzeiten. Die Abholzung ist nicht so weit fortgeschritten wie in den tiefer liegenden Trockenwäldern, was vor allem an den Schutzgebieten im Cockpit Country liegt. Die dominierenden Arten sind die Westindische Zedrele (Cedrela odorata) und Mahoe (Hibiscus elatus).
Die Wälder in den Blue Mountains und in den benachbarten John Crow Mountains beherbergen 600 Blütenpflanzenarten und 275 Gefäßsporenpflanzen. Viele davon kommen sonst auf der Insel nicht vor. Der Wald im Cockpit Country ist immergrün und noch weitestgehend unberührt. Es gibt Pläne, die großen Bauxit-Vorkommen unter dem Gebiet abzubauen. Arten, die nur hier vorkommen, stammen vor allem aus den Familien Rubiaceae (11 Arten), Asteraceae (9), Gesneriaceae (8), Euphorbiaceae (7), Orchidaceae (7) und Myrtaceae (6). Die Erforschung des Gebietes ist nicht abgeschlossen, es ist also mit weiteren Entdeckungen zu rechnen.
Zehn Prozent der Küste Jamaikas sind mit Mangrovenwäldern bedeckt, etwa elf Prozent davon stehen unter Schutz. Die hier vorkommenden Pflanzenarten finden sich an allen Küsten der Großen Antillen. Die Seegrasfelder sind vor allem in der Pedrobank und entlang der südlichen Küste zu finden. Sie beherbergen zahlreiche Tierarten und sind bisher weitgehend intakt.
Fauna
Die Fauna Jamaikas ist, bedingt durch die Isolation der Insel, reich an endemischen Arten. Gleichzeitig ist die Insel aufgrund ihrer Lage in der Karibik Durchgangsstation oder Winterquartier zahlreicher nordamerikanischer Vogelarten.
Die Insel Jamaika entstand in ihrer heutigen Form vor etwa 10 Millionen Jahren, als eine große Kalksteinplatte durch tektonische Bewegungen aus dem Meer gehoben wurde. Die ältesten Teile der Insel sind jedoch vulkanischen Ursprungs und durchbrachen bereits vor 100 Millionen Jahren die Meeresoberfläche.
Man geht heute davon aus, dass sich große Teile der heutigen Landmasse bereits im Eozän gehoben hatten und später wieder versanken. Über die Fauna dieser versunkenen Insel ist nicht viel bekannt. Man hat 50 Millionen Jahre alte Fossilien kleiner Reptilien gefunden die auf eine umfangreiche Fauna schließen lassen. Diese wurde beim Versinken der Insel entweder vollständig vernichtet oder blieb nur in wenigen über Wasser verbliebenen Gebieten erhalten.
Lange Zeit wurde angenommen, dass Jamaika zu keinem Zeitpunkt durch eine Landbrücke mit den anderen Großen Antillen oder dem amerikanischen Festland verbunden war. Man vermutete, die ersten Tiere seien auf Treibhölzern oder auf dem Luftweg dorthin gelangt. Seit einigen Jahren wird die Möglichkeit einer Landverbindung zu Hispaniola in Betracht gezogen, über die die Vorfahren einiger heutiger Tierarten eingewandert sein könnten.
Insgesamt 80 Vogelarten brüten auf Jamaika, davon sind zwanzig endemisch, wie die Jamaikaeule und die Jamaika-Erdtaube. Maskentölpel und Rosenseeschwalbe haben hier ihre wichtigsten Brutreviere. Weitere Zugvogelarten nutzen das zentral im Golf von Mexiko gelegene Jamaika als Winterquartier oder als Zwischenstop auf dem Weg nach Norden oder Süden. Einige wenige Arten wie der Grünbürzel-Sperlingspapagei wurden erst später von den Siedlern eingeführt.
Der Wimpelschwanz, eine Kolibriart, ist der Nationalvogel Jamaikas. Er lebt wie die meisten Arten im Cockpit Country im Zentrum der Insel. Dort wurden Schutzgebiete eingerichtet; der WWF kritisiert jedoch, dass Schutzvorschriften nur unzureichend durchgesetzt werden.
Von den 49 heimischen Reptilien sind 27 endemisch, was einem Anteil von über 55 % entspricht. Bei den Amphibien liegt der Anteil noch höher (24 Arten, 21 endemisch). Die größten Tiere sind dasSpitzkrokodil und die Echte Karettschildkröte. Die weiteren Arten sind erheblich kleinere Leguanartige, wie der Jamaika-Anolis und der vom Aussterben bedrohte Jamaika-Wirtelschwanzleguan. Die Jamaikaboa, das größte Landraubtier, wurde nach der Insel benannt.
Obwohl Jamaika nicht über lange Flüsse verfügt, sind in den zahlreichen kurzen Wasserläufen und Seen mehrere Süßwasserfische heimisch. Nur wenige der 40 Arten sind endemisch, darunter Cubanichthys pengelleyi (Jamaican Killifish), aus der Ordnung der Zahnkärpflinge. Viele Arten wurden vom Menschen eingebracht, eventuell bereits von den Ureinwohnern um das Jahr 1000.
Die in der See anzutreffende Fischfauna ist typisch für die Großen Antillen. Es gibt drei Lebensräume, die Mangroven, die Korallenriffe und die Seegrasfelder, letztere besonders auf der Pedro Bank. Die meisten Regionen sind noch intakt, aber von Umweltverschmutzung und Tourismus bedroht. Entlang der Riffe leben 381 Fischarten, unter anderem Tiger- und Zitronenhai. Im Tiefwasser wurden bisher 42 Arten identifiziert, eine genaue Erforschung steht aber noch aus.
Auf Jamaika leben heute lediglich 36 Säugetierarten, fünf von ihnen werden als gefährdet angesehen. Die Fledertiere sind mit 23 Vertretern die artenreichste Ordnung auf der Insel. Drei Arten sind endemisch, darunter die bedrohte Ariteus flavescens. Ebenfalls nur auf dem jamaikanischen Land zu finden ist die Jamaikanische Baumratte (Geocapromys brownii).
Die weiteren Arten leben in den Gewässern vor der Küste und in der Pedro Bank. Aus der Ordnung der Cetacea kommen neben dem Gervais-Zweizahnwal acht Delphinarten vor, die entweder dauernd in dem Gebiet leben oder es regelmäßig aufsuchen.
Seit der Besiedlung durch die Europäer ab dem 16. Jahrhundert wurden zahlreiche Nutztiere auf die Insel gebracht. Mit den Spaniern kamen Pferd und Rind. Schafe, Ziegen und Hase folgten mit den Engländern. Daneben wurden auf den Schiffen Schädlinge wie Ratte und Maus eingeschleppt und verbreiteten sich schnell. Verwilderte Nutztiere, vor allem Hunde, und die Ratten haben der lokalen Fauna erheblichen Schaden zugefügt.
In der Vergangenheit gab es weitere Säugetiere auf Jamaika. Im Cockpit Country wurden Überreste eines ausgestorbenen Affen Xenothrix mcgregori und zweier Nagetierarten gefunden
Pflanzen-und Tierarten (endemisch):
Flora
- Blütenpflanzen 3.308 (920)
Fauna
- Salzwasserfische 381
- Vögel 80
- Reptilien 49 (27)
- Säugetiere 36
- Amfibien 24 (21)
Naturschutz
Durch den Tourismus hat sich auf Jamaika ein verstärktes Umweltbewusstsein entwickelt. Seit 2000 gibt es ein eigenständiges Umweltministerium. Etwa 9 % der Landfläche stehen unter Naturschutz, dazu kommen mehrere Seeschutzgebiete um die Pedro Cays und an den Korallenriffen. 1990 wurde der 79 Hektar große Crow Mountains National Park in den Blue Mountains eingerichtet. Jamaika hat das Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen und das Kyoto-Protokoll ratifiziert. Es unterstützt das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung und ist bemüht, die Übereinkunft zum Schutz der Meere vor Verschmutzung durch Schiffe einzuhalten.
Das größte Umweltproblem sind die Bauxitminen. Zum einen nehmen sie eine große Fläche ein und wachsen in Bereiche mit bislang intakter Umwelt. Zum anderen belastet der beim Abbau entstehende gesundheitsgefährdende Staub Landschaft und Städte, besonders Kingston. Die Flüsse sind durch ungeklärte Abwässer und Eintragungen von Dünge- und Spritzmitteln aus der Landwirtschaft verschmutzt. Das gleiche gilt für die Küstenabschnitte in der Nähe der Mündungen und großer industrieller Anlagen. 2000 bis 2005 lief das Jamaican Ridge bis Reef Watershed Project, das durch Maßnahmen auf lokaler Ebene die Qualität des Wassers steigern sollte. Unterstützt wurde es mit US-Entwicklungshilfen.
Klima
Auf Jamaika herrscht tropisches Monsunklima (Am nach der Köppen-Klassifikation). mit hohen Durchschnittstemperaturen das ganze Jahr über und einer ausgeprägten Regenzeit. Es wird vom Nordostpassat geprägt. Die Temperaturunterschiede sind im Jahresverlauf gering. In Kingston beträgt die mittlere Monatstemperatur im Januar 25°C und im Juli 27 °C, im zentralen Hochplateau ist sie rund drei Grad geringer. Die teilweise über 2000 m hohen Blue Mountains sind das ganze Jahr über schneefrei. Es gibt zwei deutlich ausgeprägte Regenzeiten in Mai und Juni und von September bis November. Die beiden Trockenzeiten fallen in die Monate Juli und August sowie Dezember bis April.
Die jährliche Niederschlagsmenge ist regional sehr unterschiedlich. Die Passatwinde laden ihre feuchte Fracht in erster Linie im Nordosten ab. Mehr als 5000 mm Regen fallen in den Bergen dieser Region, während die Südküste mit der Hauptstadt Kingston im Regenschatten liegt. Hier im Lee, an der wechselfeuchten Südküste, beträgt der Mittelwert rund 800 mm. Im Spätsommer und Frühherbst ziehen häufig Stürme über die Insel hinweg. In dieser Zeit besteht Gefahr durch Hurrikans - konkret waren dies:
Elf Hurricanes zwischen 1903 und 1950. Einer der regenreichsten und stärksten Stürme dieser Zeit war jener von 1915. Er verurachte massive Schäden an Gebäuden, Plantagen und Infrastruktur. 15 Menschen kamen dabei ums Leben, 17 weitere bei einem Hurrikan im Jahr darauf. 1928 kam es zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Und 1944 gab es Schäden an der Küste und in den Städten.- Hurrikan Charlie (1951): Ein hochgradiger Kategorie-3-Hurrikan, der als der tödlichste tropische Wirbelsturm in Jamaikas Geschichte gilt. Er forderte über 150 Todesopfer und verursachte Schäden von 50 Millionen US-Dollar. Wikipedia
- Hurrikan David (1979): Ein Kategorie-5-Hurrikan, der mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 km/h über Jamaika zog. Der Sturm verursachte schwere Schäden an Wohngebäuden und Infrastruktur, mit zahlreichen Todesopfern und erheblichen wirtschaftlichen Verlusten.
- Hurrikan Allen (1980): Ein Kategorie-5-Hurrikan, der mit Windgeschwindigkeiten von über 250 km/h über Jamaika zog. Der Sturm verursachte massive Schäden an Infrastruktur und Landwirtschaft, forderte zahlreiche Todesopfer und führte zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten.
- Hurrikan Gilbert (1988): Der stärkste und zerstörerischste Hurrikan in der Geschichte Jamaikas. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 km/h verursachte er massive Schäden an Infrastruktur, Landwirtschaft und Wohngebäuden. Es gab 49 Todesopfer und Schäden in Höhe von 700 Millionen US-Dollar. Wikipedia
- Hurrikan Georges (1998): Ein Kategorie-4-Hurrikan, der mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 km/h über Jamaika zog. Der Sturm verursachte Überschwemmungen, Erdrutsche und Schäden an Infrastruktur, mit mehreren Todesopfern und erheblichen wirtschaftlichen Verlusten.
- Hurrikan Dean (2007): Ein Kategorie-5-Hurrikan, der mit Windgeschwindigkeiten von über 250 km/h über Jamaika zog. Der Sturm verursachte schwere Schäden an Infrastruktur, Landwirtschaft und Wohngebäuden, mit mehreren Todesopfern und erheblichen wirtschaftlichen Verlusten.
- Hurrikan Ivan (2004): Ein Kategorie-4-Hurrikan, der mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 km/h über Jamaika zog. Besonders betroffen waren die östlichen und südlichen Parishes, mit Wellenhöhen zwischen 2,5 und 6 Metern. Es gab erhebliche Schäden an Infrastruktur und Landwirtschaft. My-Island-Jamaica.com
- Hurrikan Beryl (2024): Ein Kategorie-4-Hurrikan, der mit Windgeschwindigkeiten von 225 km/h über die südliche Küste Jamaikas zog. Der Sturm verursachte schwere Überschwemmungen, Erdrutsche und Schäden an Gebäuden. Mindestens sieben Todesopfer wurden gemeldet. The Guardian
Jamaika unterscheidet zwei Trocken- und zwei Regenzeiten. Die beiden Trockenzeiten fallen in die Monate Juli und August sowie Dezember bis April. Regen gibt es vorwiegend im Mai und Juni sowie von September bis November. Allerdings sind die zu erwartenden Regenmengen von Region zu Region verschieden. Die Passatwinde laden ihre feuchte Fracht in erster Linie im Nordosten ab, hier können einige Bergregionen bis zu 5000 Millimeter Niederschlag im Jahr erhalten. Dagegen liegt die Südküste im Regenschatten. Hier im Lee fallen die Niederschläge deutlich spärlicher aus.
In den 1990er Jahren wurden von internationalen Klimawissenschaftlern, insbesondere durch den Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), erste Projektionen zum Klimawandel für die Karibikregion einschließlich Jamaikas erstellt. Diese Prognosen basierten auf globalen Klimamodellen und beinhalteten eine Reihe konkreter Voraussagen. So würden die durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Karibischen Meeres bis zum Jahr 2050 um etwa 2°C und bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu 3°C steigen. Zudem wurde ein Anstieg des Meeresspiegels zwischen 0,09 und 0,88 m bis zum Jahr 2100 prognostiziert. Es wurde erwartet, dass die Anzahl der Regentage pro Jahr abnimmt, jedoch die tägliche Niederschlagsintensität zunimmt, was zu häufigeren Dürre- und Überschwemmungsereignissen führen könnte. Obwohl keine signifikante Veränderung in der Häufigkeit von Hurrikans erwartet wurde, postulierte man Hinweise auf eine mögliche Zunahme der Intensität um 10 bis 20 %. Eine faktische Untermauerung dieser Modellrechnungen konnte bislang nicht geliefert werden.
Klimastationsdaten:
Klimadaten für Kingston (17°58’ N, 76°48’ W, 35 m, 1961 bis 1990)
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
| Mitteltemperatur (°C) | 25,4 | 25,4 | 25,9 | 26,7 | 27,6 | 28,0 | 28,3 | 28,5 | 28,2 | 27,6 | 27,1 | 26,1 | 27,1 |
| Niederschlag (mm) | 20 | 18 | 10 | 37 | 138 | 114 | 51 | 92 | 86 | 168 | 52 | 25 | 811 |
| Niederschlagstage <1 mm | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 57 |
| Potentielle Verdunstung (mm) | 94 | 88 | 111 | 123 | 153 | 155 | 159 | 153 | 144 | 127 | 110 | 108 | 1520 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 73 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 71 | 76 | 78 | 81 | 78 | 74 | 75 |
| Tägliche Sonnenstunden | 8,2 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,3 | 7,8 | 8,4 | 8,5 | 7,6 | 7,3 | 9,3 | 7.7 | 8,2 |
Klimadaten für Norman Manley International Airport (1981 bis 2010, Extreme seit 1852)
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
| Höchstrekord (°C) | 35,1 | 34,8 | 35,1 | 35,7 | 35,0 | 36,9 | 37,1 | 36,1 | 35,8 | 35,4 | 37,1 | 35,0 | 37,1 |
| Mittelmaximum (°C) | 29,8 | 29,6 | 29,8 | 30,3 | 30,8 | 31,2 | 31,7 | 31,9 | 31,7 | 31,3 | 31,1 | 30,5 | 30,8 |
| Mittelminimum (°C) | 22,3 | 22,3 | 22,9 | 22,6 | 24,7 | 25,3 | 25,6 | 25,3 | 25,3 | 24,8 | 24,1 | 23,1 | 24,0 |
| Tiefstrekord (°C) | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 19,2 | 20,0 | 21,0 | 20,6 | 19,9 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 |
| Niederschlag (mm) | 18 | 16 | 14 | 27 | 100 | 83 | 40 | 81 | 107 | 167 | 61 | 31 | 745 |
| Niederschlagstage | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 105 |
| Luftfeuchtigkeit (% um 13:00) | 81 | 77 | 76 | 78 | 78 | 75 | 75 | 76 | 78 | 78 | 80 | 81 | 78 |
| Sonnenstunden | 226,3 | 211,9 | 241,8 | 228,0 | 229,4 | 234,0 | 266,6 | 254,2 | 234,0 | 232,5 | 225,0 | 226,3 | 2810 |
| Tägliche Sonnenstunden | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,8 | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,7 |
| Wassertemperatur (°C) | 27,1 | 26,9 | 27,2 | 27,6 | 28,1 | 28,4 | 28,8 | 29,4 | 29,5 | 29,3 | 28,9 | 28,2 | 28,3 |
Mythologie
Die Taino verehrten ihre Gottheiten, die sogenannten Zemi, die in geschnitzten Figuren dargestellt wurden und über Fruchtbarkeit, Natur und das tägliche Leben wachten. Bedeutende Gestalten waren Atabey, die Göttin des Wassers und der Geburt, sowie Yúcahu, der Gott von Maniok und Landwirtschaft. Mit der Eroberung und der Versklavung von Millionen Afrikanerinnen und Afrikanern gelangten deren Glaubensvorstellungen und Mythen nach Jamaika. Besonders prägend waren die Geschichten um Anansi, die listige Spinne aus der Akan-Tradition, die durch ihre Klugheit stärkere Gegner austrickste. Ebenso fest verankert ist der Glaube an Duppies, Geister der Verstorbenen, die sowohl helfen als auch Unheil bringen konnten. Mit den afrikanischen Traditionen kam auch die Praxis des Obeah auf, eine Form von spiritueller Heilkunst und Magie, die von den Kolonialmächten verfolgt, aber von den Versklavten bewahrt wurde.
Die Religion der Rastafari bildet heute so etwas wie die mythische Grundlage Jamaikas. Sie unterscheidet sich elementar vom europäischen Christentum. Zwar hatten auch die Rastas als Diener und Sklaven von Puritanern die Bibel als Basis ihres Glaubensbekenntnisses, doch wird diese als von den Sklavenhaltern manipuliert angesehen, weshalb nur bestimmte Teile, vor allem Moses und Jesaja, von ihnen akzeptiert werden. Gott ist in Haile Selassie Mensch geworden und lebt in dieser Welt und in diesem Leben, zu dem es keine Alternative gibt, da dies die beste aller Welten sei. So besteht Leben aus Reinkarnationen, was stark an die Ahnenkulte der Yoruba in Westafrika erinnert, die einen Großteil der Sklavenbevölkerung Jamaikas stellten. Zion sei gleichbedeutend mit Äthiopien und von Gott als auserwählt betrachtet worden, nachdem Israel Babylon verfiel.
Symbol der Rastafari ist der Löwe. Die Dreadlocks einiger von ihnen sollen an dessen Mähne erinnern, gleichzeitig symbolisiert er Afrika. Das Löwenemblem zeichnet das äthiopische Kaisertum aus. Zugleich ist das Lamm „Symbol des Königs der Könige“, das von den auserwählten Löwenmännern, den Rastafari geschützt wird. Durch die Selbstdefinition über die Bibel gelang es den Rastafari, sich aus der Fremddefinition als Sklaven zu befreien und ihr Leid in dieser Welt als Babylon, als Leben im Exil zu erklären. Dabei ist es unmöglich, die Geschichte der afrikanischen Deportation und die Kolonialherrschaft von der biblischen Tradition der Rastafari zu trennen, da in ihren eigenen Beschreibungen Literatur, Geschichte und Religion miteinander verschmelzen.
Emanzipatorisch ist daran, dass der afrikanische Gott auf eine Veränderung der Verhältnisse in dieser Welt geradezu drängt. Der Papst ist für Rastafari der Teufel, wohingegen JAH (Gott) mit dem Kaiser von Äthiopien verschmilzt. Auch wenn die Rastafari mit den Juden den Bezug auf Zion, das Alte Testament und die Diaspora teilen, hat der mythische Bezug auf Äthiopien niemals zu einem konkreten Nationalismus geführt, nachdem Marcus Garvey mit seiner Rückbringung scheiterte. Heute wird als Heimat der Rastafari eher Jamaika als Afrika angesehen. Durch die Betonung einer individuellen Gotteserfahrung, eng verbunden mit Marihuanagenuß, bleibt der Rastafarianismus im Vergleich zum klassischen Christentum undogmatisch und entspricht eher afrikanischen Traditionen. Zudem fehlt den Rasta-Brüdern in ihrer auf das Diesseits ausgerichteten Religion die Transzendenz, weshalb sie sich selbst eher als Wissende denn als Gläubige betrachten. Als Bezugssystem ehemaliger Sklaven ist Rasta stark auf die Handhabung der (materiellen) Realität bezogen. Ras bedeutet Fürst. Da aber jeder Rastabruder vor seinen Namen das Prefix Ras stellt, ist auch jeder von ihnen ein Fürst in dieser Welt. Religiöse Rastafari betrachten sich, verbunden durch die göttliche Einheit, als eine große Familie: sie sollen sich untereinander helfen, gegenseitig unterstützen, ihre materiellen Güter miteinander teilen. Die modernen Rastafari vertreten dabei nicht den Ausgrenzungsmechanismus von Marcus Garvey, sondern auch Weiße haben die Möglichkeit zur Erlösung, wenn sie Babylon abschwören. Sie sind tiefreligiös und viele verbringen den Großteil ihrer Zeit mit dem Bibelstudium. Abgesehen vom Kraut der Bibel, dem heiligen ganja (Marihuana), dürfen sie keine Drogen zu sich nehmen, insbesondere keinen Alkohol, kein Nikotin und kein ungesundes Essen, wozu auch Konservenbüchsen zählen. Rastafari dürfen nicht stehlen und kein Lebewesen ohne Grund töten.
Geschichte
Die Geschichte Jamaikas ist geprägt durch Indianer, spanische wie britische Kolonialherren, vor allem aber durch die Maroons, die Schwarzen, die sich hier mehr Rechte erstritten als anderswo. Und die hier auch eine eigene Religion formten, die Rastafari.
Indianische Zeit
Die erste nachgewiesene Besiedlung durch Vertreter der Redware-Kultur, einer frühen Gruppe von Seefahrern aus Südamerika, vermutlich aus dem Orinoco-Delta, wird auf die Zeit um 500 datiert. Diese nomadischen Siedler lebten von Fischerei, Jagd und dem Sammeln von Früchten. Archäologische Funde, wie einfache rote Keramik aus Stätten wie Alligator Pond oder Little River, belegen ihre Anwesenheit. Sie nutzten Höhlen als Schutz und lebten in kleinen, verstreuten Gemeinschaften entlang der Küste. Diese frühen Bewohner legten den Grundstein für die spätere Entwicklung der Insel.
Ab etwa 650 wanderten die Taíno in mehreren Wellen nach Jamaika ein und assimilierten oder verdrängten die Redware-Kultur. Als „Western Taíno“ oder „Yamaye Taíno“ bekannt, entwickelten sie eine blühende Gesellschaft, die zur Zeit ihres Höhepunkts (um 1200 bis 1493) etwa 30.000 bis 60.000 Menschen umfasste. Die Taíno lebten in matrilinearen Gemeinschaften, organisiert in etwa 200 Dörfern, die von Caciques (Häuptlingen) geführt wurden. Die Gesellschaft war hierarchisch aufgebaut, mit Nitainos (Adligen) und Naborias (Bauern und Handwerkern). Ihre Siedlungen, oft auf Hügeln oder in Höhlen wie in den Blue Mountains oder dem Cockpit Country, bestanden aus runden Bohíos, Häusern aus Holz und Palmblättern, die bis zu 100 Personen beherbergen konnten. Obwohl die Taíno friedlich waren, gab es gelegentliche Konflikte mit den Kariben, einem kriegerischen Volk von den Kleinen Antillen, die Raubzüge durchführten.
Die Wirtschaft der Taíno basierte auf Landwirtschaft, Fischerei und Handel. Sie kultivierten Conucos, erhöhte Felder, auf denen Maniok, Süßkartoffeln, Mais, Bohnen, Früchte und Tabak wuchsen. Maniok wurde zu Bammy verarbeitet, einem Brot, das bis heute in Jamaika bekannt ist. Männer fischten mit Kanus und Netzen oder jagten Tiere wie das mittlerweile ausgestorbene Jamaican Coney. Handwerklich waren die Taíno hochbegabt: Sie fertigten Werkzeuge aus Flint und Obsidian, Keramik mit feinen Mustern und Schmuck aus Muscheln oder Gold. Handelsnetzwerke verbanden sie mit Kuba und Hispaniola, wo sie Waren und Ideen austauschten.
Die spirituelle Welt der Taíno war ebenso reich. Sie verehrten Zemis, heilige Objekte aus Holz, Stein oder Ton, die Götter oder Ahnen darstellten. In Cohoba-Zeremonien nutzten sie halluzinogene Pflanzen, um mit Geistern zu kommunizieren, während Areito-Tänze und -Gesänge ihre Mythen und Geschichten weitergaben. Höhlenmalereien, wie in der Mountain River Cave, zeigen Petroglyphen mit mythischen Wesen, und geschnitzte Duhos (zeremonielle Stühle) zeugen von ihrer Kunstfertigkeit. Ihre Sprache, ein Arawak-Dialekt, prägte Wörter wie „Hurricane“, „Barbecue“ oder „Canoe“, die heute weltweit bekannt sind.
Im Laufe des 15. Jahrhunderts kamen kleine Gruppen der Kariben nach Jamaika. Im Gegensatz zur Praxis auf vielen anderen Inseln vertrieben sie die Taíno nicht, sondern lebten mit ihnen zusammen. Kolumbus’ Ankunft markierte jedoch den Anfang vom Ende. Krankheiten, Versklavung und Gewalt dezimierten die Bevölkerung innerhalb weniger Jahrzehnte. Dennoch überlebten Elemente ihrer Kultur in Ortsnamen wie Ocho Rios oder Liguanea, in genetischen Spuren (etwa 6 % der heutigen Jamaikaner haben Taíno-Abstammung) und in Traditionen wie dem Bammy. Moderne Gruppen wie die Yamaye Taíno setzen sich für die Anerkennung dieses Erbes ein. Die Geschichte der Taíno zeigt eine komplexe, lebendige Gesellschaft, deren Vermächtnis Jamaika bis heute prägt.
Spanische Kolonialzeit
Christoph Kolumbus, ein genuesischer Seefahrer im Dienst der spanischen Krone, landete am 5. Mai 1494 an der Nordküste Jamaikas, vermutlich in der Nähe des heutigen Saint Ann’s Bay, das er „Santa Gloria“ nannte. Er war von der Schönheit der Insel beeindruckt und beschrieb sie in seinen Berichten als üppig und fruchtbar. Die erste Begegnung mit den Taíno verlief friedlich, da die indigenen Bewohner die Spanier zunächst mit Neugier und Gastfreundschaft empfingen. Kolumbus nahm die Insel nominell für Spanien in Besitz, doch kam es vorerst zu keiner dauerhaften Ansiedlung.
Nach einem jahrelangen Streit zwischen Diego Kolumbus, dem Sohn von Christoph Kolumbus, und der spanischen Krone über den Besitz einiger Karibikinseln wurde er schließlich Vizekönig aller von seinem Vater entdeckten Inseln. Er erhielt das Recht, einen Anteil des dort gefundenen Goldes für sich zu behalten und Steuern zu erheben. 1509 ließ er Jamaika durch Juan Ponce de León einnehmen und nannte es Santiago, ein Name, der sich allerdings nie einbürgerte. Auch die Spanier gebrauchten die ursprünglichen indianischen Namen Chaymakas oder Xaymaca, i.n angepasster Schreibung Giamaica und schließlich Jamaica.
Die dauerhafte Kolonisierung begann 1510, als Juan de Esquivel, ein Vertrauter von Kolumbus’ Sohn Diego, als erster Gouverneur nach Jamaika entsandt wurde. In weniger als zehn Jahren zerfiel die Kultur der Ureinwohner, sie wurden durch eingeschleppte Krankheiten und die brutale Behandlung durch die Siedler dezimiert. Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gelten sie als ausgestorben. Um den Mangel an Arbeitskräften zu kompensieren, brachten die Spanier ab 1517 die ersten afrikanischen Sklaven auf die Insel, vorwiegend von der Gold- und Sklavenküste. 1611 wurden erstmals mehr schwarzafrikanische als europäische Einwohner gezählt. Hauptstadt wurde Nueva Sevilla, das heutige Spanish Town. Zunächst wurde in der Landwirtschaft das Verwaltungssystem Encomienda eingeführt. Spanier erhielten große Ländereien, zusammen mit den darauf lebenden Ureinwohnern, die sie zur Arbeit einsetzen konnten und die sie missionierten. Das System war menschenverachtend und trug entscheidend zum Aussterben der indianischen Kultur bei. Kurz vor der Eroberung durch England wurde auf das humanere Repartimiento umgestellt, bei dem indianische Dorfgemeinschaften zwei bis vier Prozent ihrer Arbeitskraft den Kolonialherren zur Verfügung stellen mussten.
Da keine Edelmetalle auf der Insel gefunden wurden, verlagerte sich das Interesse der spanischen Krone schnell nach Mexiko. Viele Siedler verließen die Insel wieder, zurück blieb eine schwache Garnison.
Britische Kolonialzeit
Nach der Niederlage der spanischen Armada 1588 konnte Spanien seine Besitzungen in der Karibik nicht mehr schützen. Am 10. Mai 1655 landeten englische Truppen unter Admiral William Penn sen. an der Stelle des heutigen Kingstons. Die Verwaltung in Spanish Town ergab sich am nächsten Tag, ein Teil der verbliebenen Spanier floh kampflos nach Kuba. In der Hoffnung eines Aufstandes hatten sie zuvor ihre Sklaven befreit und mit Waffen ausgestattet. Es kam zunächst nicht zu Kämpfen, da die ehemaligen Sklaven sich ins unzugängliche Landesinnere zurückzogen, wo sie unter der Bezeichnung Maroons lebten. Trotz der Kapitulation sammelte der letzte spanische Gouverneur Cristobal Arnaldo de Ysassi Guerillatruppen an der Nordküste und im Landesinneren. Zweimal erhielt er Unterstützung aus Kuba, musste aber nach zwei Niederlagen gegen die englische Armee 1657 und 1658 endgültig aufgeben. 1664 wurde eine gewählte Versammlung eingerichtet, die lokale Verwaltungsaufgaben wahrnahm. Jamaika ging 1670 durch den Vertrag von Madrid formal in den Besitz Großbritanniens über.
Die in der Plantagenwirtschaft Jamaikas erzeugten Güter machten die Insel über 150 Jahre lang zu einem wertvollen Besitztum der englischen Krone. Die Insel war eine bedeutende Anlaufstelle für Freibeuter und Piraten, die, meist mit britischer Duldung, die neu gegründete Hauptstadt Port Royal anliefen. Das Piratenzeitalter auf der Insel endete mit der Zerstörung der Stadt durch ein Erdbeben am 7. Juni 1692. Spanish Town wurde wieder Hauptstadt, bis sie 1755 durch Kingston abgelöst wurde. 1694 landete der Franzose Du Casse mit 1500 Soldaten im Norden und Osten Jamaikas. Sein Versuch, die Insel zu erobern, scheiterte am Widerstand der Siedler. Nach zehntägigen Kämpfen musste er sich auf seine Schiffe zurückziehen. Er zerstörte mehrere Plantagen und entführte etwa 1300 Sklaven. Der letzte Versuch der Eroberung der Insel scheiterte 1782, als die für die Invasion vorgesehene französische Flotte in der Schlacht von Les Saintes von den Engländern geschlagen wurde.
Ab den 1730er Jahren kam es immer öfter zu Konflikten mit den Maroons. Diese weigerten sich, entflohene Sklaven an die Engländer auszuliefern und unternahmen ihrerseits Versuche, weitere Sklaven zu befreien. Der erste Maroonkrieg erreichte seinen Höhepunkt 1734, als Nanny Town, eine der Maroon-Siedlungen in den Blue Mountains, zerstört wurde. Der Konflikt dauerte bis zum Friedensschluss 1739. Der von Granny Nanny ausgehandelte Vertrag sicherte den Maroon eine eigenständige Kolonie zu unter der Bedingung, dass sie entflohene Sklaven zurückführten und bei der Verteidigung der Insel halfen. Der zweite Maroonkrieg brach 1795 aus, nachdem die Maroon sich weigerten, weiterhin Menschen auszuliefern. Der Auslöser für die Kämpfe war die Folter zweier Sklaven. 5000 Soldaten sowie auf Menschenjagd abgerichtete Bluthunde schlugen den Aufstand nieder. Die Maroon-Anführer wurden gefangengenommen und nach Nova Scotia in Kanada deportiert, von wo aus sie später nach Sierra Leone gebracht wurden.
1807 wurde der Überseehandel mit Sklaven untersagt, das Arbeitssystem an sich blieb aber unverändert. Es kam zu mehreren kleineren Unruhen, bis 1831 unter der Führung von Samuel Sharpe der Weihnachtsaufstand in der Umgebung von Montego Bay ausbrach. Obwohl schnell und blutig niedergeschlagen, war er Teil einer Entwicklung, die 1834 zum Slavery Abolition Act, also zur Abschaffung der Sklaverei, führte. Bis zur Durchsetzung des neuen Gesetzes auf Jamaika dauerte es noch vier weitere Jahre. In den folgenden Jahren kamen immer mehr Einwanderer freiwillig auf die Insel, darunter eine Gruppe von Arbeitern aus Indien. Sie wurden auf den Plantagen eingesetzt, konnten aber den beginnenden Niedergang der Zuckerindustrie nicht aufhalten. Billiger Zucker aus Kuba überflutete den Markt.
Die Lebensbedingungen der befreiten Sklaven blieben katastrophal. Sie hatten zwar die Freiheit erlangt, waren aber meist besitzlos und konnten sich aufgrund einer Wahlsteuer nicht an der Verwaltung der Insel beteiligen. Die Wut und Verzweiflung der Bevölkerung entlud sich im Aufstand von Morant Bay unter Führung von Paul Bogle und George William Gordon. Der Aufstand wurde von den Briten im Auftrag des Gouverneurs mit massiver Gewalt niedergeschlagen, die lokale Verwaltung aufgelöst und Jamaika zur Kronkolonie erklärt. Mehr als 1000 Menschen, darunter Bogle und Gordon kamen ums Leben. Die ausgeübte Gewalt löste in Großbritannien Entsetzen aus und führte zu einer genaueren Überwachung der Gouverneure.
Wie in fast der gesamten Karibik verlassen seit Ende des 19. Jahrhunderts viele Menschen die Insel auf der Suche nach Arbeit und besserer Lebensqualität. Die Auswanderung geht zurück bis in die 1850er Jahre, als immer mehr Arbeiter von besseren Löhnen, beispielsweise in Trinidad und im heutigen Guyana angelockt wurden, wo sie auf Plantagen Arbeit fanden. Die erste große Welle verließ das Land ab 1881, um sich am Bau des Panamakanals zu beteiligen. Viele Arbeiter schickten Teile ihrer Löhne in die Heimat zurück. Das Panama money wirkte sich spürbar auf die Wirtschaft aus und brachte wichtige Devisen ins Land.
Mittel- und Südamerika sowie die USA waren Hauptziele der Auswanderer, bis in den 1930er Jahren verstärkt Einwanderungsgesetze erlassen wurden. So beschränkte der Immigration Act von 1924 die Einreise in die Vereinigten Staaten erheblich. Nach der Unabhängigkeit nutzten viele Einwohner die Reisefreiheit im Commonwealth, um nach Großbritannien zu gelangen, mehr als eine Million Menschen verließen die Insel seitdem. Von dort aus wanderten viele dann in die nordamerikanischen Staaten aus. Heute wird dieser Umweg nicht mehr so oft benutzt, da die meisten Emigranten direkt, teilweise illegal, in die USA und Kanada einreisen. Die Entwicklung wird häufig Jamaikanische Diaspora genannt. Besonders New York, Toronto und London beheimaten heute die größten Gruppen ehemaliger Jamaikaner. Sieben Prozent der 2,5 Millionen Einwohner Torontos stammen von der Insel. In den drei Städten leben zusammen mehr Jamaikastämmige als Jamaikaner im Heimatland.
Kronkolonialzeit
Mit dem neuen Gouverneur John Peter Grant begannen zahlreiche Reformen. Das Bildungssystem wurde größeren Bevölkerungsteilen zugänglich gemacht, die Arbeitsgesetze wurden verbessert. Außerdem wurde die Infrastruktur ausgebaut. Das Eisenbahnsystem erreichte seine größte Ausdehnung und ein Unterwasserkabel nach Europa wurde verlegt. 1914 wurde auf der Insel das Kriegsrecht verhängt, rund 10.000 jamaikanische Soldaten nehmen am Ersten Weltkrieg auf Seiten der Alliierten teil.
Ab den 1930er Jahren gab es, teilweise durch die Arbeit Marcus Garveys motiviert, Unruhen und Aufstände gegen die britische Herrschaft. Die Bewohner verlangten mehr Unabhängigkeit und eine gerechtere Besteuerung. 1938 wurde die People’s National Party (PNP), die erste der beiden großen Parteien, von Norman Washington Manley gegründet. 1944 trat eine neue Verfassung in Kraft, die dem Land wieder eine gewisse Selbstverwaltung zugestand. Im selben Jahr fanden die ersten freien, allgemeinen und gleichen Wahlen statt. 1953 wurden die gewährten Freiheiten noch einmal erweitert, die innere Verwaltung ging 1957 komplett an die Volksversammlung über. Der Chief Minister, ein Vorgänger des späteren Premierministers, leitete einen großen Teil der Geschicke des Landes.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde Jamaika von Großbritannien und den USA als Marinestützpunkt benutzt. Das Land selbst unterstützte die Alliierten mit Truppen und Geld. Nach dem Weltkrieg gab es Versuche, die westindischen Kolonien unter eine gemeinsame Verwaltung zu stellen. 1947 fanden in Montego Bay erste Verhandlungen zur Gründung der Westindischen Föderation statt, ein Jahr später wurde die University of the West Indies, eine gemeinsame Hochschule für 16 Karibikstaaten, in Mona bei Kingston gegründet. 1958 schlossen sich Jamaika und neun weitere britische Gebiete in der Karibik der Westindischen Föderation an, schieden aber bereits 1961 nach einem Referendum wieder aus.
Moderne Zeit
Die Unabhängigkeit von Großbritannien wurde am 6. August 1962 erlangt, am 18. September folgte die Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen. Jamaika ist seitdem freies Mitglied des Commonwealth. Der erste Premierminister war Alexander Bustamante von der Jamaica Labour Party (JLP), die bis 1972 an der Macht blieb. Die erste Sitzung des Parlaments wurde von Princess Margaret eröffnet. Jamaika trat in den folgenden Jahren mehreren internationalen Organisationen bei, darunter dem UN-Menschenrechtsausschuss.
1966 besuchten sowohl Elisabeth II. als auch der für die Rastafari wichtige Haile Selassie unter großem Jubel die Insel, im gleichen Jahr fand mit den British Empire and Commonwealth Games das größte sportliche Ereignis der Geschichte des Landes statt. Im Oktober führten Bandenkriege in Kingston zur Verhängung des Notstands. Polizei und Militär brauchten einen Monat, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Nach Ende seiner Amtszeit im Februar 1967 zog sich Bustamante aus der Führung seiner Partei zurück. Sein Nachfolger Donald Sangster konnte die Wahl mit 33 zu 20 Sitzen im Parlament gewinnen. Nur wenige Wochen später musste er nach einem Schlaganfall zur Behandlung nach Kanada geflogen werden, wo er am 11. April verstarb. Hugh Shearer regierte bis zum Ende der Legislaturperiode. In seine Amtszeit fielen die Umstellung auf das Dezimalsystem 1968 und die Einführung des Jamaika-Dollars 1971, aber auch eine Dürre in den Jahren 1967/68 und ein landesweiter Streik der Polizei für mehr Löhne.
Missglückte Maßnahmen zur Bekämpfung der Dürrefolgen und der Streik ließen in der Bevölkerung an der Führungsqualität Shearers zweifeln. Die People’s National Party (PNP) unter Michael Manley konnte sich bei den Wahlen 1972 mit 37 zu 19 Sitzen durchsetzen. In den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit hatte Jamaika eine pro−westliche Außenpolitik verfolgt. Manley hingegen erklärte den Demokratischen Sozialismus zur Staatsform und nahm Beziehungen zu sozialistischen Staaten auf. Es kam zu Verstaatlichungen und Käufen zahlreicher Unternehmen, besonders im Bergbaubereich. Die neue Politik war nicht direkt kommunistisch – die demokratischen Strukturen blieben bestehen und große Teile des Marktes waren weiterhin in Privatbesitz – wurde aber aufgrund einer engen Freundschaft Manleys zu Fidel Castro und einer Handelsmission in die Sowjetunion häufig so interpretiert. Trotz intensiver Verhandlungen brachen 1979 die Beziehungen zum Internationalen Währungsfonds ab, die Wirtschaft stagnierte. Kurz vor der Wahl deckte die Polizei Vorbereitungen eines Putschversuches der jamaikanischen Armee auf. 24 Soldaten und drei Zivilisten wurden verhaftet und zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.
Dennoch brachen die internationalen Beziehungen nicht ganz ab. Durch das Lomé-Abkommen von 1975 trat Jamaika den AKP-Staaten bei. Das Abkommen und sein Nachfolger, das Cotonou-Abkommen von 2002 sicherten dem Land Entwicklungshilfe und Zollpräferenzen, unter anderem auf dem europäischen Markt, zwang es aber auch, einen Teil seiner Märkte für ausländische Produkte zu öffnen. Viele der Vergünstigungen, vor allem auf dem Bananenmarkt, sind 2006 ausgelaufen.
Die verstärkte Armut infolge der internationalen Isolation verschaffte der JLP mit 51 zu 9 Sitzen einen deutlichen Sieg bei den 1980er-Wahlen, ein Erfolg, der sich bei den Kommunalwahlen ein Jahr später wiederholte. Der neue Premierminister Edward Seaga kehrte zu einer pro−westlichen Außenpolitik zurück. Manleys im Inland getroffene Maßnahmen, zu denen neben den Verstaatlichungen auch der Ausbau sozialer Einrichtungen gehörte, blieben weitestgehend bestehen. Die Beziehungen zum Währungsfond wurden wieder aufgenommen und die zu Kuba abgebrochen. Jamaika erhielt noch im selben Jahr von der UN die Zusicherung, dass das Hauptquartier der neu zu gründenden Meeresbodenbehörde in Kingston errichtet wird. Besonders die USA und die EU gewährten nun Kredite und Wirtschaftshilfen zur Stärkung der Wirtschaft und Verbesserung der maroden Infrastruktur. Dennoch verlor der Jamaika-Dollar bis 1983 gegenüber dem US-Dollar so stark an Wert, dass die Regierung sich gezwungen sah, Neuwahlen anzuordnen. Die PNP lehnte die Teilnahme ab, da sie sich durch die Einteilung der Wahlkreise benachteiligt fühlte. Die JLP gewann alle 60 Sitze und konnte so bis 1987 souverän regieren.
Im Oktober 1983 begann die eine Woche dauernde US-Invasion in Grenada. Nach offizieller Darstellung der USA war es unter anderem Jamaika, das in der Organisation Ostkaribischer Staaten den Wunsch geäußert hatte, die dortige kommunistische Regierung zu stürzen. In Wirklichkeit ging die Initiative jedoch von den USA aus. Das einzige Mal in seiner Geschichte stellte die Insel Soldaten für einen Auslandseinsatz zur Verfügung. Zusammen mit Antigua und Barbuda, Barbados, Dominica, St. Lucia und St. Vincent entsandte es 300 Mann, die aber nicht zu Kampfhandlungen eingesetzt wurden.
Am 12. September 1988 traf Hurrikan Gilbert Jamaika. Das Auge des Sturms überquerte die Insel auf der vollen Länge und richtete große Verwüstungen an. Es entstand ein Schaden von 4 Milliarden US-Dollar, 40 % der Anbauflächen wurden zerstört. Kingston und Saint Andrew Parish, sowie Hanover Parish waren am schlimmsten betroffen, hier brach die Versorgung mit Wasser und Elektrizität für mehrere Tage zusammen. In den folgenden Monaten kamen umfangreiche internationale Hilfen, die zwar aufgrund von Korruption und Unterschlagungen nur zum Teil bei den Menschen ankamen, die Wirtschaft aber wieder ankurbelten.
Verzögerungen beim Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur, besonders in den kleinen Gemeinden entlang der Küste, beeinträchtigten das Vertrauen der Bevölkerung in die Fähigkeiten der Regierung. Bei den 1989er Parlamentswahlen gewann sie nur 15 der 60 Mandate. Michael Manley wurde erneut Premierminister. 1992 musste er aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. Percival J. Patterson wurde sein Nachfolger und blieb bis 2006 im Amt. Dank internationaler Hilfen war die Wirtschaftslage 1990 wieder relativ günstig und förderte die Gründung vieler Banken und Versicherungen, die große finanzielle Risiken eingingen. 1996 führten unerwartet stark steigende Zinsen zu einem Zusammenbruch des gesamten Finanzsektors.
Jamaika ist seit einigen Jahren bemüht, sich an internationalen Organisationen zu beteiligen, um auf seine Probleme aufmerksam zu machen. So übernahm es 2001 zum Beispiel für ein Jahr den Vorsitz des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen.
Jamaika, die karibische Inselnation mit einer Bevölkerung von rund 2,8 Millionen Einwohnern, erlebte in den Jahren von etwa 2000 bis zur Corona-Pandemie 2020 eine Phase intensiver politischer, wirtschaftlicher und kultureller Entwicklungen. Als ehemalige britische Kolonie, die 1962 die Unabhängigkeit erlangte, kämpfte das Land mit anhaltenden Herausforderungen wie hoher Kriminalität, wirtschaftlicher Abhängigkeit vom Tourismus und Schuldenkrisen, während es internationale Erfolge in Sport und Musik feierte. Die Politik war geprägt von einem Wechsel zwischen den beiden großen Parteien – der sozialdemokratischen People's National Party (PNP) und der konservativen Jamaica Labour Party (JLP) –, begleitet von Reformen zur Kriminalitätsbekämpfung und Legalisierung kontroverser Themen. Die Wirtschaft erholte sich langsam von Rezessionen, gestützt durch internationale Hilfen und den Boom des Bauxit- und Tourismussektors, doch Hurrikane und globale Krisen warfen immer wieder Schatten. Kulturell strahlte Jamaika durch Reggae, Dancehall und den Sprint-Olympiasieg von Usain Bolt als globales Symbol der Vitalität.
Zu Beginn des neuen Millenniums wurde das Land für zwei Jahre in den UN-Sicherheitsrat gewählt, was seine Rolle in der globalen Diplomatie unterstrich. Die Regierung unter PNP-Premierminister Percival "P.J." Patterson, der seit 1992 im Amt war, konzentrierte sich auf wirtschaftliche Stabilisierung. Nach einer Phase hoher Inflation und Schulden in den 1990er Jahren – mit einem nominalen BIP-Wachstum von rund 4,5 Prozent im Jahr 2000 - profitierten Importe und private Kapitalzuflüsse von relativer Stabilität im Devisenmarkt. Patterson trat 2006 zurück und wurde von Portia Simpson-Miller abgelöst, der ersten weiblichen Premierministerin Jamaikas. Sie leitete Reformen ein, darunter den Kampf gegen Korruption und die Förderung von Frauenrechten. Politisch dominierte ein Zweiparteiensystem, in dem Machtwechsel selten waren; die PNP regierte bis 2007 durchgehend.
2007 markierte einen Wendepunkt: Die JLP unter Bruce Golding gewann die Wahlen und übernahm die Regierung, was zu einer Phase der Liberalisierung führte. Golding, der bis 2011 im Amt blieb, setzte auf Anti-Korruptionsmaßnahmen und die Auslieferung des Drogenbosses Christopher „Dudus“ Coke an die USA – ein Skandal, der 2010 zu einem Belagerungszustand in Kingston führte und über 70 Tote forderte. Dies unterstrich die anhaltende Herausforderung der Bandenkriminalität, die Jamaika zu einem der höchsten Mordraten weltweit machte. Wirtschaftlich litt das Land unter Hurrikanen: Ivan 2004, Dean 2007 und Gustav 2008 verursachten Schäden in Milliardenhöhe, besonders im Agrarsektor, der von Zuckerrohr und Bananen abhängt. Dennoch wuchs die Landwirtschaft bis 2001 um 5,5 Prozent, und der Tourismus – mit über 2 Millionen Besuchern jährlich – blieb ein Pfeiler, der rund 30 Prozent des BIP ausmachte.
Ein kultureller und sportlicher Höhepunkt kam 2008: Bei den Olympischen Spielen in Peking erzielte Jamaika seinen besten Erfolg mit 6 Gold-, 3 Silber- und 2 Bronzemedaillen, vor allem durch die Sprinter Shelly-Ann Fraser und Usain Bolt, der als „schnellster Mensch der Welt“ zur nationalen Ikone wurde. Bolts Siege in den 100 und 200 Metern – inklusive eines Weltrekords – katapultierten Jamaika in die globale Schlagzeilen und steigerten den Stolz der Nation. Musikalisch blühte der Dancehall auf: In den frühen 2000er Jahren erzielten Künstler wie Elephant Man, Tanya Stephens und Sean Paul Crossover-Erfolge in den USA und Europa. Später, Ende der 2000er, dominierten Acts wie Konshens, Vybz Kartel und Beenie Man die Charts, doch der Genre geriet in Kritik wegen homophober Texte. 2011 wurde Kartel, einer der einflussreichsten Dancehall-Stars, wegen Mordes verhaftet und 2014 zu lebenslanger Haft verurteilt – der längste Prozess der jamaikanischen Justizgeschichte, der Debatten über Gewalt in der Musikszene entfachte.
Die 2010er Jahre brachten weitere politische Turbulenzen und Reformen. 2011 übernahm die PNP unter Portia Simpson-Miller erneut die Macht, die sich auf soziale Programme konzentrierte, darunter Bildung und Armutsbekämpfung. 2014 wurde Asafa Powell, der ehemalige Weltrekordhalter im 100-Meter-Lauf, für 18 Monate wegen Doping gesperrt, was die Schattenseite des Sportbooms beleuchtete. Ein Meilenstein war die Dezentralisierung des Cannabis-Besitzes: Im Februar 2015 legalisierte das Parlament kleine Mengen für persönlichen, religiösen, medizinischen und wissenschaftlichen Gebrauch - ein Schritt, der auf Rastafari-Traditionen und wirtschaftliche Potenziale (zum Beispiel Export von medizinischem Marihuana) einging und Jamaika zu einem Pionier in der Karibik machte. Wirtschaftlich erholte sich das Land langsam: Nach der globalen Finanzkrise 2008 wuchs das BIP jährlich um 1 bis 2 Prozent, gestützt durch IWF-Kredite und Investitionen in Bauxit-Aluminium und Tourismus. Die Landwirtschaft boomte bis 2018 mit Zuwächsen bei Mais (7,9 Prozent), Bananen (10,4 Prozent) und Kokosnüssen (24,9 Prozent).
2016 gewann die JLP unter Andrew Holness die Wahlen, der sich auf Kriminalitätsreduktion und Infrastruktur fokussierte. Holness' Regierung senkte die Mordrate von über 40 pro 100.000 Einwohnern 2010 auf unter 30 bis 2019 und förderte den Ausbau der Hauptstadt Kingston. International positionierte sich Jamaika als Stimme der Karibik, etwa bei Klimaverhandlungen, da Hurrikane wie Matthew 2016 die Vulnerabilität der Insel unterstrichen. Kulturell blieb Sport dominant: Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio holte Bolt erneut dreifach Gold, und Jamaika gewann 11 Medaillen insgesamt. Die Musikszene evolvierte mit Reggaetón-Einflüssen, während Filme und Literatur (zum Beispiel Werke von Marlon James) globale Anerkennung fanden.
Bis 2019 stabilisierte sich die Wirtschaft mit einem Wachstum von rund 1,5 Prozent, doch soziale Ungleichheiten – mit Armutsquoten über 20 Prozent – blieben bestehen. Im Januar 2020 trat eine Dengue-Fieber-Epidemie auf, die die karibische Region traf und Jamaika zu einem Reiseverbot aus China veranlasste – ein Vorbote der globalen Pandemie. Die Corona-Zeit begann offiziell am 10. März 2020, als der erste COVID-19-Fall bestätigt wurde. Die Regierung unter Holness reagierte rasch mit Lockdowns, Grenzschließungen und Testprogrammen, was die Infektionszahlen niedrig hielt (im Vergleich zu Nachbarländern), aber den Tourismus - 25 Prozent des BIP - lahmlegte und zu einer Rezession führte. Die Pandemie unterbrach den Alltag und verstärkte Debatten über Gesundheitsreformen.
Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) postulierete Covid-19-Pandemie traf das Land inmitten einer Dengue-Fieber-Epidemie in Lateinamerika und der Karibik, die bereits das Gesundheitssystem belastete. Unter der Führung von Premierminister Andrew Holness und der Jamaica Labour Party (JLP) reagierte die Regierung mit einer Mischung aus strengen Lockdowns, Grenzschließungen und internationaler Unterstützung. Die Corona-Zeit begann offiziell am 10. März 2020 mit dem ersten bestätigten Fall, einem Jamaikaner, der aus dem Vereinigten Königreich zurückkehrte, und endete für Jamaika als akute Krise im Mai 2023, als die WHO den globalen Notstand aufhob.
Die frühe Phase der Covid-Zeit war geprägt von raschen Maßnahmen: Am 18. März 2020 verhängte die Regierung nach dem ersten bestätigten Coivid-19-Todesfall sofortige Reisebeschränkungen, Schulschließungen und einen landesweiten Lockdown. Die Ministry of Health and Wellness (MoHW) etablierte ein Emergency Operations Centre (EOC) und führte Curfews (militärisch kontrollierte Ausgangssperren) ein, die von 8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens galten. Im April 2020 sprach die Queen von Jamaika, Elizabeth II., in einer Fernsehansprache an die Nation und forderte „Zuversicht“, während die Bank of Jamaica Dividendenzahlungen für das Finanzjahr 2020 aussetzte, um Liquidität zu sichern. Hurrikane wie Laura im August 2020 verschärften die Lage. Die Regierung priorisierte unterdessen nichtpharmazeutische Interventionen wie Maskenpflicht und Distanzierung. Die Infektionsraten blieben im Vergleich zu Nachbarländern wie den Bahamas oder Haiti niedrig.
Wirtschaftlich trafen die Maßnahmen das Land hart. Der Tourismus, der rund 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachte und jährlich über 2 Millionen Besucher anlockte, brach ein, als Flughäfen schlossen und Hotels leerstanden. Die Rezession 2020 führte zu einem BIP-Rückgang von etwa 11 Prozent, begleitet von Massenentlassungen in der Gastgewerbe- und Agrarbranche. Die Regierung pumpte Milliarden in Hilfsprogramme, darunter das Social Protection Programme, das vulnerablen Haushalten Bargeldzuschüsse gewährte, und Kooperationen mit der Pan American Health Organization (PAHO) für Ausrüstung. Internationale Partner wie Kanada und die USA lieferten Impfstoffe und leisteten Finanzhilfen. Bis Oktober 2020 verlängerte Premierminister Holness die Maßnahmen bis November, inklusive vierzehntägiger Quarantäne für Reisende und negativer PCR-Tests vor Einreise. Die „Resilient Corridor“-Zone an der Nordküste erlaubte begrenzten Tourismus unter strengen Regeln.
Die mRNA-Impfkampagne startete im April 2021 mit Lieferungen von AstraZeneca und Sinopharm, doch sie fand bei der Bevölkerung nur geringe Zustimmung. Bis Februar 2023 hatten nur 29,97 Prozent der Bevölkerung die vollständige Initialdosis erhalten (wobei nicht klar ist, ob die Betreffenden tatsächlich geimpft waren oder sich den Impfpass erkauften). Dennoch blieben die Fallzahlen gering. Die Delta-Variante im August 2021 verursachte disproportional hohe Todesfälle, während Omicron ab Januar 2022 deutlich milder verlief. Insgesamt lag Jamaika bei der Impfquote aber weit hinten, schnitt bei den Fallzahlen aber gut ab.
Sozial und kulturell verstärkten die - international eingeforderten und von der Regierung umgesetzten - Maßnahmen Ungleichheiten. Armutsquoten stiegen über 20 Prozent, und psychische Belastungen durch Isolation und Jobverlust nahmen zu, während Musikszene und Sportevents wie Reggae-Festivals pausierten. Die Regierung integrierte Bürgerinitiativen, zum Beispiel Community-Testing, und nutzte die Krise für Gesundheitsreformen, inklusive Ausbau des Überwachungssystems. Bis 2023 erholte sich die Wirtschaft mit einem BIP-Wachstum von rund 2 Prozent, gestützt durch den Wiederanstieg des Tourismus und IWF-Kredite. Die Pandemie hinterließ Jamaika resilienter, aber mit bleibenden Narben: Niedrige Impfraten und Lücken in der Primärversorgung fordern anhaltende Investitionen.
Verwaltung
Nach mehr als 2000jähriger Besiedlung durch indianische Gemeinschaften reklamierten am 3. Mai 1494 die spanischen Entdecker die Insel für sich. Erst 1508/10 begann die Besiedlung durch europäische Kolonisatoren. Am 11. Mai 1655 okkupierten englische Truppen die Insel. Am 18. Juli 1670 trat Spanien im Vertrag von Madrid Jamaika an die Engländer ab, die das karibische Eiland fortan fast wie eine Strafkolonie hielten. Am 5. Mai 1953 erhielt Jamaika eine eigene Regierung. Von 3. Januar 1958 bis 31. Mai 1962 war es Teil der Federation of the West Indies. Seit 6. August 1962 ist Jamaika eine unabhängige parlamentarische Monarchie im britischen Commonwealth.
Herrschaftsgeschichte
- 5. Jahrhundert bis um 650 Redware-Gemeinschaften
- um 650 bis 3. Mai 1494 Stammesgemeinschaften der Taino
- 3. Mai 1494 bis 1510 Königreich Spanien (Reino de España)
- 1510 bis 11. Mai 1655 Kolonie Santiago (Isla Santiago bzw. Jamaica) als Teil der (Audiencia de Santo Domingo) des Königreichs Spanien (Reino de España)
- 11. Mai 1655 bis 18. Juli 1670 Königreich England (Kingdom of England)
- 18. Juli 1670 bis 17. Januar 1866 Kolonie Jamaika (Colony of Jamaica) des Königreichs England (Kingdom of England)
- 1. Mai 1707 bis 31. Dezember 1800 Kolonie Jamaika (Colony of Jamaica) des Königreichs Großbritannien (Kingdom of Great Britain)
- 1. Januar 1800 bis 17. Januar 1866 Kolonie Jamaika (Colony of Jamaica) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland)
- 17. Januar 1866 bis 3. Januar 1958 Kronkolonie Jamaika (Crown C olony of Jamaica) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland, ab 1927 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
- 3. Januar 1958 bis 6. August 1962 Provinz Jamaika (Province of Jamaica) innerhalb der Westindischen Föderation (Federation of the West Indies) als Teil des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
- seit 6. August 1962 Staat Jamaika (Jamaica) im Commonwealth der Nationen (Commonwealth of Nations)
Verfassung
Die 1962 durch einen gemeinsamen Ausschuss der im jamaikanischen Parlament vertretenen Parteien erarbeitete, am 25. Juli dieses Jahres dem Parlament präsentierte und von diesem angenommene Verfassung basiert auf dem System des Vereinigten Königreichs (Westminster-System).
Im Jahr 2003 begann eine breite Diskussion über einen neuen Status und eine neue Verfassung. Jamaika wollte 41 Jahre nach der Unabhängigkeit sein Staatsoberhaupt selbst wählen Beim Streit um die zukünftige Verfasstheit Jamaikas handelte es sich lediglich – wie Kritiker meinten – um ein Ablenkungsmanöver von wirklichen Problemen. Substantielle Veränderungen seien nicht vorgesehen. „Hier wird in einer politischen Suppe wild herumgerührt“, erklärte eine Sprecherin der außerparlamentarischen Oppostion in Montego Bay.
In der Tat schwelte die Verfassungsdiskussion seit mehr als einem Dutzend Jahren. Gestritten wurde in der ehemaligen britischen Kolonie, Teil des Commonwealth und zusammen mit zwölf anderen Karibikstaaten formell der britischen Königin unterstellt, seit 1991 über eine neue Verfassung. Im Dezember desselbes Jahres wurde eine Kommission eingesetzt, die dem Parlament 1994 ihren Schlussbericht vorlegen konnte. Nicht mehr als vier Gesetzesvorschläge konnten bis 1999 vorgelegt werden. Noch keine Entscheidung ist zu einer vor zwei Jahren eingereichten Erklärung der Bürgerrechte gefallen.
Die Regierungspartei People’s National Party (PNP) unter Premierminister Percival James Patterson kündigte an, innerhalb der kommenden 18 Monate eine seit zehn Jahren laufende Verfassungsreform zu Ende zu bringen. Konkret geht es bei den verbalen Auseinandersetzungen darum, sich von der britischen Königin und deren Stellvertreter, Generalgouverneur Howard Hanlan Cook, loszusagen, einen eigenen Staatspräsidenten zu wählen und auf diesem Weg weitere koloniale Bande zu kappen. So argumentiert Patterson verbal antikolonialistisch: „Nach 41 Jahren Unabhängigkeit ist es höchste Zeit, dass unser Staat durch eine Person repräsentiert wird, zu der wir eine tatsächliche Verbindung haben.“ Derweil favorisiert die oppositionelle Jamaica Labour Party (JLP) ein eingesetztes Staatsoberhaupt mit überwiegend zeremoniellen Aufgaben.
Kontrovers diskutiert wird ferner der Versuch, den ‘Privy Council’, das oberste Gericht der Commonwealth-Staaten, für Jamaika und einige andere Staaten in der Region durch einen eigenen Karibischen Gerichtshof auszutauschen. »Ich habe keinen Zweifel daran, daß die Mehrheit der Jamaikaner die letzten Spuren des Kolonialismus tilgen will und ein eigenes Oberstes Gericht und ebenso ein Staatsoberhaupt nach eigener Wahl haben möchte«, sagt Patterson.
Für die Vorsitzende der lokalen Menschenrechtsgruppe Jamaicans for Justice, Carolyn Gomes, sind solche Worte „hohles Pathos“ und die bisherige Arbeit an einer neuen Verfassung „bloßes Stückwerk“. „Wir brauchen einen breiten Dialog über eine neue Verfassung, nicht die kleinen Häppchen, die uns bislang vorgesetzt werden.“ Ähnlich enttäuscht zeigt sich Michael Williams vom Parteienzusammenschluß National Democratic Movement (NDM). Für ihn sind die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen reine Kosmetik. „Nur fundamentale Änderungen sind annehmbar«, sagte er unlängst in einem Interview mit Radio Jamaica. „Den Generalgouverneur auszutauschen und ihn Staatspräsidenten zu nennen, bedeutet keinen Fortschritt.“
Legislative und Exekutive
Das jamaikanische Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Die 60 Mitglieder des Repräsentantenhauses (Members of Parliament oder MPs) werden alle fünf Jahre direkt gewählt. Jamaika hat traditionell ein Zweiparteiensystem, einzig die People’s National Party (PNP) und die Jamaica Labour Party (JLP) sind im Parlament vertreten, beide stellten in der Vergangenheit mehrmals Premierminister. Bei der letzten Parlamentswahl am 3. September 2007 hat die PNP nach 18 Jahren die Mehrheit verloren, sie stellen nur noch 27 der 60 Abgeordneten. Andere Parteien und Koalitionen spielen keine Rolle. Die starke Position der Regierung beschränkt die tatsächlichen Einflussmöglichkeiten der Kammer.
Der Senat hat 21 Mitglieder. 13 Senatoren werden durch den Generalgouverneur und acht durch den Oppositionsführer benannt. Der Generalgouverneur muss allerdings den acht vom Oppositionsführer gestellten Kandidaten zustimmen. Ein Mitspracherecht bei politischen Entscheidungen besteht nur in wenigen Gebieten.
An der Spitze der Regierung steht der Premierminister. Er ist – wie bei Ländern mit Westminster-System üblich – mit umfangreichen Kompetenzen ausgestattet und kann viele wichtige Entscheidungen ohne Konsultation des Parlaments tätigen. Die eigentliche Verwaltung des Landes wird von Behörden übernommen, an deren Spitze ein Fachminister steht. Premierminister wird automatisch, nach Ernennung durch den Generalgouverneur, der Vorsitzende der Partei, die die Mehrheit im Parlament hält. Ein Wechsel in der Parteiführung führt binnen weniger Wochen zur Ernennung eines neuen Premierministers. Am 30. März 2006 ersetzte Portia Simpson-Miller von der PNP den aus Gesundheitsgründen zurückgetretenen langjährigen Premierminister Percival J. Patterson. Sie wurde damit die erste weibliche Regierungschefin ihres Landes. Bei den Parlamentswahlen vom 3. September 2007 verlor Simpson-Miller ihre Mehrheit knapp. Ihr Nachfolger als Premierminister wurde am 11. September der bisherige Oppositionsführer Bruce Golding.
Inseloberhaupt
Staatsoberhaupt ist der englische König. Er wird vertreten durch einen Generalgouverneur, der durch den Premierminister und sein Kabinett ernannt wird. Sowohl König als auch Generalgouverneur haben größtenteils zeremonielle Aufgaben, darunter die Ernennung des Premierministers und der Minister.
Gobernadores (Gouverneure)
- 1510 - 1514 Juan Esquivel (um 1480 - um 1519)
- 1514 - 1523 Francisco de Garay († 1523)
- 1523 - 1526 Pedro de Mazuelo
- 1526 Juan de Mendegurren
- 1526 - 1532 Alvaro Canelas
- um 1530 - 1532 Gonzalo de Guzman
- 1532 - 1533 Manuel de Rojas
- 1533 - 1534 Gil Gonzalez Dávila [amtierend]
- 1534 - 1539 Manuel de Rojas [2]
- 1539 - 1544 Pedro Cano
- 1544 - 1556 Francisco de Pina
- 1556 - 1558 Juan González de Hinojosa
- 1558 - 1565 Pedro Cano [2]
- 1565 - 1567 Blas de Melo
- 1567 - 1575 Juan de Gaudiel
- 1575 - 1577 Hernán Manrique de Rojas
- 1577 Iñigo Fuentes
- 1577 - 1578 Rodrigo Núñez de la Peña
- 1578 - 1582 Lucas del Valle Alvarado
- 1582 - 1583 Pedro Lopez [amtierend]
- 1583 - 1586 Lucas del Valle Alvarado [2]
- 1586 Delgado
- 1586 - 1591 Diego Fernández de Mercado
- 1591 - 1596 Lucas del Valle Alvarado [3]
- 1596 García del Valle
- 1596 - 1606 Fernando Melgarejo de Córdoba
- 1607 - 1611 Alonso de Miranda
- 1611 - 1614 Pedro Espejo Barranco
- 1614 - 1620 Andrés González de Vera
- 1620 - 1625 Sebastián Lorenzo Romano
- 1625 - 1632 Francisco Terril
1632 - 1637 Juan Martínez Arana
- 1637 - 1639 Gabriel Peñalver Angulo
- 1639 - 1640 Jacinto Sedeño Albornoz
- 1640 - 1643 Francisco Ladrón de Zegama
- 1643 - 1645 Alcaldes
- 1645 - 1646 Sebastián Fernández de Gamboa
- 1646 - 1650 Pedro Caballero
- 1650 Jacinto Sedeño Albornoz [2]
- 1650 - 1651 Francisco de Proenza
- 1561 - 27 Mai 1655 Juan Ramírez de Arellano
- 1655 - 1656 Francisco de Proenza [2] (in Opposition)
- 25 Okt 1656 - 1660 Cristóbal Arnaldo de Isasi (in Opposition)
English Commissioners (Englische Kommissäre)
- 11 Mai 1655 - 25 Jun 1655 William Penn (1621 - 1670)
- 10 Mai - 4 Jul 1655 Robert Venables (um 1613 - 1687)
- 25 Jun 1655 - 30 Jan 1657 William Goodsonn (1610 - um 1680)
- 4 Jul - 1 Okt 1655 Richard Fortescue († 1655)
- 1 Okt 1655 - 24 Mai 1656 Robert Sedgwick (um 1611 - 1656)
- 24 Mai - 14 Dez 1656 Edward D’Oyley (Doyley, 1617 - 1675)
- 14 Dez 1656 - 2 Sep 1657 William Brayne († 1657)
- 2 Sep 1657 - 1 Jun 1661 Edward D’Oyley (Doyley) [2]
Governors (Gouverneure)
- 1 Jun 1661 - 11 Aug 1662 Edward D’Oyley (Doyley)
- 11 Aug - 28 Okt 1662 Thomas Hickman Windsor, Lord Windsor (um 1627 - 1687)
- 28 Okt 1662 - 2 Mai 1663 Sir Charles Lyttelton [amtierend] (1629 - 1716)
- 2 Mai 1663 - 21 Mai 1664 Thomas Lynch [amtierend] (1630 - 1684)
- 21 Mai - 4 Jun 1664 Edward Morgan (um 1610 - 1665)
- 4 Jun 1664 - 1 Jul 1671 Sir James Modyford († 1674)
Lieutenant-governors (Generalgouverneure)
- 1 Jul 1671 - Nov 1674 Sir Thomas Lynch
- 7 Mar 1674 - 14 Mar 1675 Sir Henry Morgan [amtierend] (1635 - 1688)
- 14 Mar 1675 - 14 Mar 1678 John Vaughan, Lord Vaughan (1640 - 1730)
- 14 Mar - 19 Jul 1678 Sir Henry Morgan [2, amtierend]
- 19 Jul 1678 - 27 Mai 1680 Charles Howard, Earl of Carlisle (1629 - 1685)
- 27 Mai 1680 - 24 Aug 1682 Sir Henry Morgan [3, amtierend]
- 24 Aug 1682 - 24 Aug 1684 Sir Thomas Lynch [2]
- 24 Aug 1684 - 19 Dez 1687 Hender Molesworth [amtierend] (um 1638 - 1689)
- 19 Dez 1687 - 6 Okt 1688 Christopher Monck, Duke of Albemarle (1653 - 1688)
- 6 Okt 1688 - 31 Mai 1690 Sir Francis Watson [amtierend]
Governors (Gouverneure)
- 31 Mai 1690 - 16 Jan 1692 William O’Brien, Earl of Inchiquin (1640 - 1692)
- 19 Jan - 22 Aug 1692 John White [amtierend]
- 22 Aug 1692 - 9 Mar 1693 John Burden [amtierend]
- 9 Mar 1693 - 22 Jan 1702 Sir William Beeston [amtierend bis 1699] (1636 - 1702)
- 22 Jan - 4 Apr 1702 William Selwyn (1655 - 1702)
- 5 Apr - 4 Dez 1702 Peter Beckford [amtierend] (1643 - 1710)
- 4 Dez 1702 - 17 Jul 1711 Thomas Handasyde [amtierend bis 25 Mar 1704] (um 1645 - 1729)
- 11 Jul 1711 - 25 Jul 1716 Lord Archibald Hamilton (1673 - 1754)
- 21 Sep 1716 - 26 Apr 1718 Peter Heywood (1653 - 1725)
- 26 Apr 1718 - 22 Dez 1722 Sir Nicholas Lawes (1652? - 1731)
- 22 Dez 1722 - 4 Jul 1726 Henry Bentnick, Duke of Portland (1682 - 1726)
- 4 Jul, 1726 - 29 Jan 1728 John Ayscough [amtierend] († 1735)
- 29 Jan 1728 - 31 Mar 1734 Robert Hunter (um 1675 - 1734)
- 31 Mar 1734 - 29 Sep 1735 John Ayscough [2, amtierend]
- 29 Sep - 18 Dez 1735 John Gregory [amtierend] († 1764)
- 18 Dez 1735 - 15 Feb 1736 Henry Cunningham (um 1678 - 1736)
- 15 Feb 1736 - 29 Apr 1738 John Gregory [2, amtierend]
- 29 Apr 1738 - 19 Sep 1752 Edward Trelawny (1699 - 1754)
- 19 Sep 1752 - 27 Jan 1756 Charles Knowles (1704 - 1777)
- Okt 1755 - 3 Apr 1756 Sir Henry Moore [amtierend] (1713 - 1769)
- 3 Apr 1756 - 27 Jul 1759 George Haldane (1722 - 1759)
- 27 Jul 1759 - 20 Jan 1762 Sir Henry Moore [2, amtierend]
- 20 Jan 1762 - 2 Jun 1766 William Henry Lyttleton (1724 - 1808)
- 2 Jun 1766 - 30 Sep 1768 Roger Hope Elletson (um 1727 - 1775)
- 30 Sep 1768 - 11 Dez 1772 Sir William Trelawney (um 1722 - 1772)
- 11 Dez 1772 - 5 Jan 1774 John Dalling [amtierend] (um 1731 - 1798)
- 5 Jan 1774 - 15 Jun 1777 Sir Basil Keith (1734 - 1777)
- 15 Jun 1777 - 25 Nov 1781 John Dalling [2]
- 25 Nov 1781 - 7 Jul 1784 Archibald Campbell [amtierend bis Jun 1782] (1739 - 1791)
- 7 Jul 1784 - 17 Mar 1790 Alured Clarke (1745 - 1832)
- 17 Mar 1790 - 19 Nov 1791 Thomas Howard, Earl of Effingham (1746 - 1791)
- 19 Nov 1791 - 29 Apr 1795 Adam Williamson [amtierend] (ab 18 Nov 1794 Sir Adam Williamson, 1736 - 1798)
- 29 Apr 1795 - 29 Jul 1801 Alexander Lindsay, Earl of Balcares (1752 - 1825)
- 29 Jul 1801 - 20 Feb 1806 Sir George Nugent (1757 - 1849)
- 21 Feb 1806 - 26 Mar 1808 Sir Eyre Coote (1762 - 1824)
- 26 Mar 1808 - 26 Jun 1811 William Montague, Duke of Manchester (1771 - 1843)
- 26 Jun 1811 - 13 Jun 1813 Edward Morrison [amtierend] (um 1759 - 1843)
- 13 Jun 1813 - 30 Jul 1821 William Montague, Duke of Manchester [2]
- 31 Jul 1821 - 22 Dez 1822 Henry Couran [amtierend (1767 - 1829)
- 22 Dez 1822 - 2 Jul 1827 William Montague, Duke of Manchester [3]
- 3 Jul 1827 - 19 Feb 1829 Sir John Keane [amtierend] (1781 - 1844)
- 19 Feb 1829 - 11 Jun 1832 Somerset Lowry-Corry, Earl of Belmore (1774 - 1841)
- 13 Jun - 28 Jul 1832 George Cuthbert [amtierend] (1767 - 1835)
- 28 Jul 1832 - 15 Mar 1834 Constantine Henry Philips, Earl of Mulgrave (1797 - 1863)
- 15 - 29 Mar 1834 Sir Amos Goodsell Robert Norcot [amtierend] (1777 - 1838)
- 29 Mar - 7 Apr 1834 George Cuthbert [2, amtierend]
- 7 Apr 1834 - 2 Sep 1836 Howe Peter Browne, Marquess of Sligo (1788 - 1845)
- 2 Sep 1836 - 22 Sep 1839 Sir Lionel Smith (1778 - 1842)
- 26 Sep 1839 - 19 Mai 1842 Sir Charles Theophilus Metcalfe (1785 - 1846)
- 19 Mai 1842 - 25 Mai 1846 James Bruce, Earl of Elgin and Kincardine (1811 - 1863)
- 25 Mai - 21 Dez 1846 George Henry Frederick Berkeley [amtierend] (1785 - 1857)
- Feb 1847 - Okt 1853 Sir Charles Edward Grey (1785 - 1865)
- Okt 1853 - Mai 1856 Sir Henry Barkly (1815 - 1898)
- Mai 1856 - 24 Jul 1857 Edward Wells Bell [amtierend] (1789 - 1807)
- 24 Jul 1857 - 25 Mar 1862 Charles Henry Darling (1809 - 1870)
- 25 Mar 1862 - 16 Jul 1865 Edward John Eyre [amtierend bis 1864] (1815 - 1901)
- 12 Dez 1865 - 5 Aug 1866 Sir Henry Knight Storks (1811 - 1874)
- 5 Aug 1866 - 25 Jan 1874 Sir John Peter Grant (1807 - 1893)
- 25 Jan - 4 Apr 1874 William Alexander George Young [amtierend] (1827 - 1885)
- 4 Apr 1874 - 10 Mar 1877 Sir William Grey (1818 - 1878)
- 10 Mar - 10 Aug 1877 Edward Everard Rushworth [amtierend] (1818 - 1877)
- 10 - 23 Aug 1877 James Robert Mann [amtierend] (1823 - 1915)
- 24 Aug 1877 - 20 Apr 1883 Sir Anthony Musgrave (1828 - 1888)
- 8 Okt 1879 - 4 Jun 1880 Edward Newton [amtierend für Musgrave] (1832 - 1897)
- 20 Apr - 4 Mai 1883 Somerset Molyneux Wiseman Clarke [amtierend] (1803 - 1905)
- 4 Mai - 21 Dez 1883 Dominic Jacotin Gamble [amtierend] (1823 - 1887)
- 21 Dez 1883 - 2 Jan 1889 Sir Henry Wylie Norman (1826 - 1904)
- 10 Dez 1885 - 29 Mar 1886 Somerset Molyneux Wiseman Clarke [2, amtierend für Norman]
- 2 Jan - 9 Mar 1889 William Clive Justice [amtierend] (1835 - 1908)
- 9 Mar 1889 - 18 Jan 1898 Sir Henry Arthur Blake (1840 - 1918)
- 18 Jan - 11 Feb 1898 Henry Jardine Hallowes [amtierend] (1838 - 1926)
- 11 Feb 1898 - 25 Mai 1904 Sir Augustus William Lawson Hemming (1842 - 1907)
- 25 Mai - 15 Sep 1904 Sydney Haldane Olivier [amtierend] (1859 - 1943)
- 15 - 30 Sep 1904 Hugh Clarence Bourne [amtierend] (1858 - 1909)
- 30 Sep 1904 - 15 Mai 1907 Sir James Alexander Swettenham (1846 - 1933)
- 15 - 16 Mai 1907 Hugh Clarence Bourne [2, amtierend]
- 16 Mai 1907 - 18 Jan 1913 Sydney Haldane Olivier [2]
- 18 Jan - 7 Mar 1913 Philip Clark Cork [amtierend] (1854 - 1936)
- 7 Mar 1913 - 11 Mai 1918 Sir William Henry Manning (1863 - 1932)
- 11 Mai - 11 Jun 1918 Robert Johnstone [amtierend] (1861 - 1944)
- 11 Jun 1918 - 16 Jun 1924 Sir Leslie Probyn (1862 - 1938)
- 4 Sep - 14 Nov 1922 Herbert Bryan [amtierend für Probyn] (1865 - 1950)
- 16 Jun - 29 Sep 1924 Herbert Bryan [2, amtierend]
- 29 Sep 1924 - 7 Jun 1925 Sir Samuel Herbert Wilson (1873 - 1950)
- 7 Jun - 23 Aug 1924 Sir Herbert Bryan [2, amtierend]
- 24 Aug - 5 Sep 1925 Arthur Mudge [amtierend] (1871 - 1958)
- 6 Okt 1925 - 26 Apr 1926 Arthur Selborne Jeef [amtierend] (1876 - 1947)
- 26 Apr 1926 - 9 Nov 1932 Sir Reginald Edward Stubbs (1876 - 1947)
- 9 Nov - 21 Nov 1932 Arthur Selborne Jeef [2, amtierend]
- 21 Nov 1932 - 10 Apr 1934 Sir Alexander Ransford Slater (1874 - 1940)
- 10 Apr - 24 Okt 1934 Arthur Selborne Jeef [3, amtierend]
- 24 Okt 1934 - 2 Jun 1938 Sir Edward Brandis Denham (1876 - 1938)
- 2 Jun - 19 Aug 1938 Charles Campbell Woolley [amtierend] (1893 - 1981)
- 19 Aug 1938 - Jul 1943 Sir Arthur Frederick Richards (1885 - 1978)
- Jul - 29 Sep 1943 William Henry Flinn [amtierend] (1895 - 1973)
- 29 Sep 1943 - 7 Apr 1951 Sir John Huggins (1891 - 1971)
- 7 Apr 1951 - 18 Nov 1957 Sir Hugh Mackintosh Foot (1907 - 1990)
- 18 Dez 1957 - 6 Aug 1962 Sir Kenneth William Blackburne (1907 - 1980)
Queen (Königin) und King (König)
- 6 Aug 1962 - 8 Sep 2022 Elizabeth [w] (1926 - 2022)
- seit 8 Sep 2022 Charles III (* 1948)
Governors-general (Generalgouverneure als Repräsentanten der britische Krone)
- 6 Aug - 30 Nov 1962 Sir Kenneth William Blackburne
- 1 Dez 1962 - 2 Mar 1973 Sir Clifford Campbell (1892 - 1991)
- 2 Mar - 27 Jun 1973 Sir Herbert Duffus [amtierend] (1908 - 2002)
- 27 Jun 1973 - 31 Mar 1991 Florizel Glasspole (ab 17 Apr 1981 Sir, 1909 - 2000)
- 31 Mar - 1 Aug 1991 Edward Zacca [interimistisch] (1931 - 2019)
- 1 Aug 1991 - 15 Feb 2006 Sir Howard Felix Hanlon Cooke (1915 - 2014)
- 15 Feb 2006 - 26 Feb 2009 Kenneth Oktavius Hall (* 1941)
- seit 26 Feb 2009 Patrick Linton Allen (ab 26 Mar 2009 Sir, * 1951)
Leader of the Government Business (Leiter der Regierungsangelegenheiten)
- 1945 - 5 Mai 1953 William Alexander Bustamente (1884 - 1977) JLP
- Chief ministers (Leitende Minister)
- 5 Mai 1953 - 2 Feb 1955 Alexander Bustamante (ab 1955 Sir, 1884 - 1977) JLP
- 2 Feb 1955 - 4 Jul 1959 Norman Washington Manley (1893 - 1969) PNP
Premiers (Premier)
- 4 Jul 1959 - 29 Apr 1962 Norman Washington Manley PNP
- 29 Apr - 6 Aug 1962 Sir Alexander Bustamante JLP
Prime ministers (Premierminister)
- 6 Aug 1962 - 23 Feb 1967 Sir Alexander Bustamante JLP
- Feb 1964 - 23 Feb 1967 Donald Burns Sangster [amtierend für Bustamante] (1911 - 1967) JLP
- 23 Feb - 11 Apr 1967 Donald Burns Sangster (ab 6 Apr 1967 Sir) JLP
- 11 Apr 1967 - 2 Mar 1972 Hugh Lawson Shearer (1923 - 2004) JLP
- 2 Mar 1972 - 1 Nov 1980 Michael Manley (1924 - 1997) PNP
- 1 Nov 1980 - 10 Feb 1989 Edward Seaga (1930 - 2019) JLP
- 10 Feb 1989 - 30 Mar 1992 Michael Manley [2] PNP
- 30 Mar 1992 - 30 Mar 2006 Percival Noel James Patterson (* 1935) PNP
- 30 Mar 2006 - 11 Sep 2007 Portia Simpson Miller [w] (* 1945) PNP
- 11 Sep 2007 - 23 Okt 2011 Bruce Golding (* 1947) JLP
- 23 Okt 2011 - 5 Jan 2012 Andrew Holness (* 1972) JLP
- 5 Jan 2012 - 3 Mar 2016 Portia Simpson Miller [w, 2] PNP
- seit 3 Mar 2016 Andrew Holness [2] JLP
Das Kabinett von Jamaika (Cabinet of Jamaica) ist das oberste Entscheidungsgremium der Exekutive innerhalb des Westminster-Systems der Regierung in der traditionellen Verfassungstheorie. Das Kabinett von Jamaika ist das wichtigste Instrument der Regierungspolitik. Es besteht aus dem Premierminister und mindestens 13 weiteren Ministern der Regierung, die Mitglieder einer der beiden Kammern des Parlaments sein müssen. Nicht mehr als vier Mitglieder des Kabinetts dürfen Mitglieder des Senats sein. Der Finanzminister muss ein gewähltes Mitglied des Repräsentantenhauses sein. Das Schattenkabinett von Jamaika gilt als Alternative zum Kabinett von Jamaika, wird vom Oppositionsführer (Jamaika) geleitet und hat die Aufgabe, die Politik der Regierung fair zu kritisieren und Alternativen zu ihren Vorschlägen zu unterbreiten. Das mit 11. Januar 2022 angelebte Kabinett hat folgendde Zusammensetzung:
Ministers of Second Administration
| Ministerium | Minister | Ministerialtitel |
| Office of the Prime Minister | Andrew Holness, MP | Prime Minister; Minister of Defence, Economic Growth and Job Creation (re-incorporates the Housing, Urban Renewal, Environment and Climate Change Portfolio formerly under the Ministry of Housing and Urban Renewal) |
| Ministry of Tourism | Edmund Bartlett, OJ, CD, MP | Minister of Tourism |
| Ministry of Science, Energy, Telecommunication and Transport | Daryl Vaz, MP | Minister of Science, Energy, Telecommunications and Transport |
| Ministry of National Security | Dr. Horace Chang, OJ, CD, MP | Deputy Prime Minister & Minister of National Security |
| Ministry of Local Government and Community Development | Desmond McKenzie, CD, MP | Minister of Local Government and Community Development |
| Ministry of Legal and Constitutional Affairs | Marlene Malahoo Forte, KC, MP | Minister of Legal and Constitutional Affairs |
| Ministry of Labour and Social Security | Pearnel Charles Jr, MP, JP | Minister of Labour and Social Security |
| Ministry of Justice | Delroy Chuck, KC, MP | Minister of Justice |
| Ministry of Industry, Investment and Commerce | Sen. Aubyn Hill | Minister of Industry, Investment and Commerce |
| Ministry of Health and Wellness | Dr. Christopher Tufton, MP | Minister of Health and Wellness |
| Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade | Sen. Kamina Johnson-Smith, MP | Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade |
| Ministry of Finance and the Public Service | Fayval Williams, MP | Minister of Finance and the Public Service |
| Ministry of Education, Skills, Youth and Information | Dana Dixon, CD, MP | Minister of Education, Skills, Youth and Information |
| Ministry of Culture, Gender, Entertainment and Sports | Olivia Grange, CD, MP | Minister of Culture, Gender, Entertainment and Sports |
| Ministry of Agriculture and Fisheries | Floyd Green, MP | Minister of Agriculture, Fisheries, and Mining |
| Attorney General Department | Derrick McKoy | Attorney General |
Minister ohne Portfolio
| Ministerium | Minister | Ministerialtitel |
| Ministry of Economic Growth & Job Creation | Robert Nesta Morgan, MP | Minister without Portfolio in the Ministry of Economic Growth & Job Creation with responsibility for Works |
| Office of the Prime Minister | Homer Davis, CD, MP | Minister without Portfolio in the Office of the Prime Minister (formerly Minister of State in the Ministry of Local Government and Rural Development) assigned to Office of the Prime Minister in Western Jamaica (OPM West) to oversee and coordinate special projects and major developments (eg. Montego Bay Perimeter Road) in western parishes. |
| Ministry of Economic Growth and Job Creation | Sen. Matthew Samuda, MP | Minister without Portfolio in the Ministry of Economic Growth and Job Creation with responsibility for Water, Environment & Climate Change |
Staatsminister
| Ministerium | Minister | Ministerialtitel |
| Ministry of Labour and Social Security | Dr. Norman Alexander Dunn, MP | Minister of State in the Ministry of Labour and Social Security |
| Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade | Alando Terrelonge, MP | Minister of State in the Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade |
| Ministry of Science, Energy, Telecommunications and Technology | William J.C. Hutchinson, CD, MP | Minister of State in the Ministry of Science, Energy, Telecommunications and Technology |
| Ministry of National Security | Juliet Cuthbert-Flynn, MP | Minister of State in the Ministry of National Security |
| Office of the Prime Minister | Homer Davis, MP | Minister of State in the Office of the Prime Minister |
| Ministry of Finance and the Public Service | Zavia Mayne, MP | Minister of State in the Ministry of Finance and Public Service |
| Ministry of Agriculture and Fishries | Franklyn Witter, JP, MP | Minister of State in the Ministry of Agriculture and Fishries |
Politische Gruppierungen
Schon vor der Unabhängigkeit Jamaikas etablierte sich ein Zweiparteiensystem. Sowohl die People′s National Party (PNP), als auch die Jamaican Labour Party (JLP) waren seit 1962 mehrmals an der Macht. Andere Parteien sind unbedeutend und zurzeit nicht im Parlament vertreten.
Beide Parteien sind eng mit je einer der beiden großen Gewerkschaften, Bustamante Industrials Trade Union (BITU) und Trade Union Congress (TUC), verbunden. Aus der 1938 von Alexander Bustamante gegründeten BITU ging 1943 die JLP hervor, die nach der Unabhängigkeit die ersten Premierminister stellte. Bustamantes Cousin Norman Washington Manley gründete 1938 die PNP, in deren Umfeld sich die TUC formierte. Beide Parteien bezeichnen sich als sozialdemokratisch und unterscheiden sich in ihren heutigen Parteiprogrammen kaum.
Viele Seiten werfen den Parteien vor, bewaffnete Banden zu unterhalten und ganze Stadtteile Kingstons gewaltsam zu kontrollieren. Tatsächlich kam es bei allen bisherigen Wahlen zu Unruhen, meistens mit mehreren Toten.
Aktive Parteien
- JLP = Jamaica Labour Party (Arbeiterpartei von Jamaika, sozialdemokratisch)
- NDM = National Democratic Movement (National-Demokratische Berwegung, konservativ)
- NNC = New Nation Coalition (Koalition Neue Nation)
- PNP = People's National Party (Nationale Volkspartei)
Nicht mehr bestehende Parteien
- AIP = Agricultural Industrial Party (Landwirtschafts- und Industrie-Partei)
- CP = Coloured Party (Farbigen-Partei, Bürgerrechtspartei der 1820er Jahre)
- FCA = Federation of Citizen's Association (Föderation der Bürgervereinigung)
- FF = Farmers' Federation (Bauern-Föderation)
- IEWFP = Imperial Ethiopian World Federation Incorporated Political Party (Inkorporierte Politische Partei der Weltföderation des Äthiopischen Reichs)
- JANU = Jamaica Alliance for National Unity (Jamaikanische Allianz für Nationale Einheit)
- JDP = Jamaica Democratic Party (Jamaikanische Demokratische Partei)
- JLP = Jamaica Liberal Party (Liberale Partei von Jamaika)
- JRWU = Jamaica Radical Workers Union (Radikale Arbeiterunion von Jamaika)
- JSP = Jamaica Socialist Party (Sozialistische Partei von Jamaika)
- JUP = Jamaica United Party (Vereinigte Partei von Jamaika, ursprünglich UWIP)
- NJA = New Jamaica Alliance (Neue Jamaika-Allianz)
- NLP = National Labour Party (National-Liberale Partei)
- PLM = Progressive Labour Movement (Fortschrittliche Arbeiterbewegung, bald nach ihrer Gründung 1961 mit der PPP vereinigt)
- PPP = People's Political Party (Politische Volkspartei, 1929 von Marcus Garvey gegründete erste Partei des Landes)
- RPJ = Republican Party of Jamaica (Republikanische Partei von jamaika)
- UPJ = United Party of Jamaica (Vereinigte Partei von Jamaika)
- UPP = United People's Party (Vereinigte Volkspartei)
- UWIP = United West Indian Party (Vereinigte Westindische Partei, später JUP)
- WPJ = Workers Party of Jamaica (Arbeiterpartei von Jamaika, marxistisch)
Wahlen
Wahlen finden alle vier Jahre statt. Wahlberechtigt ist jeder Bürger ab 18 Jahren. Praktisch alle Regierungsorganisationen haben ihren Sitz in der Hauptstadt Kingston. Frauen dürfen seit 1944 wählen. Die letzten Wahlen vom 3. September 2025 brachten folgende Ergebnisse:
| Partei | Stimmen | % | Sitze | +/- |
| Jamaica Labour Party | 412,668 | 50.54 | 35 | –14 |
| People's National Party | 401,435 | 49.16 | 28 | +14 |
| Jamaica Progressive Party | 2,040 | 0.25 | 0 | neu |
| United Independents' Congress of Jamaica | 181 | 0.02 | 0 | neu |
| Independents | 269 | 0.03 | 0 | 0 |
| insgesamt | 100,0 | 63 | 0 |
Justizwesen und Kriminalität
Das Rechtssystem orientiert sich am englischen Common Law. Die Richter werden von Generalgouverneur auf Empfehlung das Justizkomitees ernannt. Im Falle der Gerichtspräsidenten haben Premierminister und Oppositionsführer ein Mitspracherecht.
Der oberste Gerichtshof im Land ist der Court of Appeal unter dem Vorsitz des Chief Justice in Kingston. Er ist eine reine Berufungsinstanz für die untergeordneten Gerichte. Wie alle jamaikanischen Gerichte ist er sowohl für das Zivil- als auch für das Strafrecht zuständig. Schwere Vergehen und zivilrechtliche Auseinandersetzungen werden vor dem Supreme Court verhandelt. Bei Kapitalverbrechen werden Entscheidungen von Geschworenen getroffen. Der Supreme Court ist zentral organisiert, die Verhandlungen finden aber in der Regel in den entsprechenden Parishes statt.
Zur Behandlung geringerer Delikte verfügt jeder Parish über einen Resident Magistrate's Court, unterteilt in Fachgerichte. Berufungen dieser Instanz überspringen den Supreme Court und werden direkt an den Court of Appeal gerichtet. Die unterste Stufe der Gerichtsbarkeit sind die Petty Sessions. Sie unterstehen den örtlichen Magistrate's Courts und fungieren als Schiedsamt in Zivilfällen und verhandeln über Ordnungsgelder. Als Berufungsinstanz ist der Magistrate's Court zulässig.
Noch über dem Court of Appeal steht der Justizausschuss des Privy Council in London. Wie viele anderen Staaten der Karibik lässt Jamaika dort Revisionen bei besonders schweren Vergehen verhandeln. Seit 1970 versucht Jamaika mit anderen Staaten einen gemeinsamen Gerichtshof für die Karibik aufzubauen. Im Februar 2001 wurde zwischen 12 Ländern ein Abkommen zur Einrichtung des Caribbean Court of Justice (CCJ) unterzeichnet. Seit 2005 ist der Gerichtshof mit Sitz in Port of Spain, Trinidad und Tobago einsatzbereit, wurde aber noch nicht von der jamaikanischen Gesetzgebung berücksichtigt, er kann also noch nicht angerufen werden. Bruce Golding kündigte kurz nach seiner Wahl an den CCJ mit einem Referendum zur letzten Berufungsinstanz machen zu wollen.
Jamaika hält an der Todesstrafe fest. Diese wurde in den letzten Jahren aber nur selten vollstreckt, da das Privy Council die Strafe immer in lebenslange Haft umgewandelt hat wenn es angerufen wurde. Gegner des CCJ argumentieren, dieser sei nur geschaffen worden um diese Begnadigungen zu verhindern. In einer ersten Entscheidung hat das Gericht aber eine Hinrichtung auf Barbados verhindert.
Bei der Umsetzung der Empfehlungen eines im Juni 2007 erschienenen Berichts der Arbeitsgruppe für die Reform des Justizsystems (Justice System Reform Task Force) gab es einige Fortschritte, so bei der Einstellung von zusätzlichem Gerichtspersonal. Allerdings wurde die Mehrzahl der Empfehlungen bisher noch nicht implementiert. Über die Gesetzgebung, durch die das spezielle Amt eines Coroners (Beamter, der die Todesursache in Fällen gewaltsamen oder unnatürlichen Todes untersucht) geschaffen werden soll, wurde Ende 2008 noch immer beraten. Mit der Einrichtung eines solchen Amtes sollen die Untersuchungen neuer Fälle von Schusswaffengebrauch mit Todesfolge durch die Polizei beschleunigt und die bisher noch unbearbeiteten Fälle abgearbeitet werden. Auch das Gesetzesvorhaben zur Schaffung des Amtes eines speziellen Staatsanwalts für die Untersuchung von Korruption durch Staatsbedienstete befand sich am Jahresende noch im Beratungsstadium. Im September verabschiedete das Parlament Gesetze, durch die die Zahl der Richter beim Obersten Gericht und beim Berufungsgericht erhöht werden soll. Trotz dieser Maßnahmen wiesen nationale Menschenrechtsorganisationen auf die fortbestehenden chronischen Probleme bei der Rechtsprechung hin. Dazu gehörten schwerwiegende Fälle von Verzögerungen bei der Anhörung von Fällen, die fehlende Verfügbarkeit von Geschworenen, das Nichterscheinen von Zeugen und die unregelmäßige Festsetzung von Gerichtsterminen.
In Jamaika gilt nach wie vor die Todesstrafe. Im jahr 2008 mindestens ein neues Todesurteil wurde gefällt, doch fanden keine Hinrichtungen statt. Neun Menschen befanden sich zum Jahresende im Todestrakt. Im November stimmte die Abgeordnetenkammer Jamaikas für die Beibehaltung der Todesstrafe. Im Dezember stimmte Jamaika gegen die Resolution der UN-Generalversammlung für ein weltweites Hinrichtungsmoratorium.
Übergriffe auf missliebige Personengruppen sind in Jamaika an der Tagesordnung - auch innerhalb der „Sicherheitskräfte“. Mit 222 Personen, die allein im Jahr 2009 vermutlich durch Polizisten getötet wurden, war das Ausmaß der von der Polizei verübten Tötungen weiterhin hoch. Viele davon geschahen unter Umständen, die den Verdacht aufkommen ließen, dass sie unrechtmäßig waren, obwohl die Polizei immer wieder behauptete, dass sie das Resultat von Schießereien mit kriminellen Banden waren. Zu den Bemühungen der Regierung, gegen die Straflosigkeit der Polizei und die fehlende Rechenschaftspflicht vorzugehen, gehörten Parlamentsberatungen über einen Gesetzentwurf zur Schaffung einer unabhängigen Kommission zur Untersuchung von Verstößen der Sicherheitskräfte.
Sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist nach wie vor weit verbreitet. Gemäß den Polizeistatistiken wurden zwischen Januar und Oktober 2008 insgesamt 655 Frauen vergewaltigt. Ein Gesetzentwurf über sexuelle Delikte, der Frauen und Kindern, die Opfer sexueller Gewalt wurden, besseren Rechtsschutz gewähren sollte, war bis zum Jahresende noch immer nicht dem Parlament vorgelegt worden. Der Gesetzentwurf war 2007 fertiggestellt worden und bedeutete den Höhepunkt der 1995 mit dem Ziel begonnenen Bemühungen, die bestehende Gesetzgebung, die Frauen diskriminiert, neu zu fassen.
Streitkräfte
Die jamaikanische Armee heißt Jamaica Defence Force (JDF). Sie besteht aus 3.500 aktiven Soldaten sowie ungefähr 700 Reservisten. Es gibt keine Wehrpflicht. Die Hauptaufgabe der JDF ist der Schutz des Landes und die Gewährleistung der inneren Sicherheit. Sie untersteht dem Premierminister, vertreten durch den Minister für Sicherheit und Justiz. Oberbefehlshaber ist mit Stand 2025 Vice Admiral Antonette Wemyss Gorman.
Gegründet wurde die JDF am 31. Juli 1962, also wenige Tage vor der Unabhängigkeit Jamaikas am 6. August. Sie ging aus dem West Indies Regiment hervor. Während der beiden Weltkriege hatte es bereits eine Freiwilligenarmee gegeben, die Großbritannien unterstützte. Die JDF gleicht in ihrer Organisation der britischen Armee, Ausbildung, verwendete Waffensysteme und Traditionen sind mit denen anderer Commonwealth-Staaten vergleichbar. Der Verteidigungsetat 2003 belief sich auf 31,17 Millionen US-Dollar, rund 0,4 % des Staatshaushaltes. 1998 gab es 3.320 Berufssoldaten, 90 % waren beim Heer, je 5 % bei Marine und Luftwaffe. Offiziersanwärter werden größtenteils im Ausland ausgebildet, hauptsächlich in Großbritannien und Kanada. Im Laufe ihrer Karriere kehren sie zu Fortbildungen dorthin zurück. Soldaten unterer Ränge erhalten ihr Training in einer heimischen Kaserne.
In den vergangenen Jahren übernahm das Militär immer wieder Polizeiaufgaben. Es wurde vor allem zur Bekämpfung des Drogenhandels und krimineller Banden eingesetzt. 2001 war sie in Unruhen in der Hauptstadt Kingston verwickelt, bei denen 140 Menschen zu Tode kamen. In der Folge wurde das Land immer wieder von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen verurteilt. 1983 war die JDF mit einigen Soldaten an der Invasion Grenadas beteiligt. Sie bewachten gefangengenommene Gegner und sicherten Hafenanlagen für den Nachschub.
Das Heer ist mit einer Mannstärke von rund 3.000 Mann die größte Teilstreitkraft. Es besteht aus zwei Bataillonen sowie einer Reserve. Neben der Kriminalitätsbekämpfung ist die wichtigste Aufgabe der Katastrophenschutz. Außer einer kleinen Anzahl gepanzerter Fahrzeuge vom Typ Cadillac V-150 stehen vor allem geländegängige Transportfahrzeuge zur Verfügung.
Die Marine bzw. Küstenwache (Coast Guard, etwa 300 Soldaten) ist der technisch bestausgestattete Teil der Armee. Neben zwei modernen, in den Niederlanden gefertigten Fregatten kommen eine Reihe kleinerer Boote zum Einsatz, vor allem in Küstennähe. Zusammen mit der US−Marine führt sie Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenschmuggels durch und überwacht die Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen.
Neben der Küstenwache gibt es noch die Luftwaffe (rund 200 Soldaten). Ihr stehen einige Helikopter vom Typ Bell sowie unbewaffnete Flächenflugzeuge zur Verfügung. Zusammen mit der Marine überwachen sie den Schiffsverkehr. Schwerpunkt ist dabei die Suche nach Schmugglern und illegalen Einwanderern sowie Umweltverschmutzungen.
Internationale Beziehungen
Jamaika ist Mitglied einer großen Zahl internationaler Organisationen, darunter die Karibische Gemeinschaft (CARICOM), die karibische Entwicklungsbank, die UNO und Interpol. Seit vielen Jahren ist es einer der Wortführer der karibischen Staaten, 2005 führte es den Vorsitz der Entwicklungsländerkonferenz G77. Jamaika ist in keine internationalen Konflikte verwickelt, seine Soldaten werden nicht außerhalb des Landes eingesetzt. In den letzten Jahren gab es Unstimmigkeiten mit der US-Regierung, die die Parteien verdächtigt, Banden in Kingston beim Drogenschmuggel aus Süd- nach Nordamerika zu unterstützen und vor dem Polizeizugriff zu schützen. Abgesehen davon ist die Beziehung zwischen beiden Staaten gut, Jamaika erhielt 2004 18,5 Millionen US-Dollar Wirtschaftshilfen.
Die Beziehungen zur Europäischen Union haben sich verschlechtert, nachdem diese ihre Märkte für Produkte aus weiteren Ländern zugänglich gemacht hat. Die erhöhte Konkurrenz gefährdet den ohnehin in einer Krise steckenden Anbau von Bananen und Zuckerrohr. Von der EU finanzierte Infrastrukturprojekte sollen dem Land helfen, die Probleme zu überwinden. Jamaika unterhält Botschaften in fast allen europäischen Ländern. Traditionell spielt der Handel eine wichtige Rolle für die internationalen Beziehungen, weshalb Handels- und Außenministerium unter Minister Anthony Hylton zusammengefasst sind.
Internationale Mitgliedschaften:
- African, Caribbean, and Pacific Group of States (ACP)
- Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean (OPANAL)
- Caribbean Community and Common Market (Caricom)
- Caribbean Development Bank (CDB)
- Commonwealth of Nations
- Food and Agriculture Organization (FAO)
- Group of 15 (G15)
- Group of 77 (G77)
- Inter-American Development Bank (IADB)
- International Atomic Energy Agency (IAEA)
- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
- International Civil Aviation Organization (ICAO)
- International Criminal Court (ICCt) - Signaturstaat
- International Criminal Police Organization (Interpol)
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCS)
- International Finance Corporation (IFC)
- International Fund for Agricultural Development (IFAD)
- International Hydrographic Organization (IHO)
- International Labour Organization (ILO)
- International Maritime Organization (IMO)
- International Monetary Fund (IMF)
- International Olympic Committee (IOC)
- International Organization for Migration (IOM)
- International Organization for Standardization (ISO)
- International Red Cross and Red Crescent Movement (ICRM)
- International Telecommunication Union (ITU)
- International Telecommunications Satellite Organization (ITSO)
- Latin American Economic System (LAES)
- Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
- Nonaligned Movement (NAM)
- Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
- Organization of American States (OAS)
- United Nations (UN) seit 18. September 1962
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)
- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
- Universal Postal Union (UPU)
- World Customs Organization (WCO)
- World Federation of Trade Unions (WFTU)
- World Health Organization (WHO)
- World Intellectual Property Organization (WIPO)
- World Meteorological Organization (WMO)
- World Tourism Organization (UNWTO)
- World Trade Organization (WTO)
Flagge und Wappen
Die Flagge Jamaikas wurde am 6. August 1962 offiziell eingeführt. Die Flagge Jamaikas besteht aus einem gelben Andreaskreuz und vier dreieckigen Farbflächen in schwarz und grün: Grün steht für die Hoffnung und für die Landwirtschaft. Gelb bzw. Gold symbolisiert die reichen Naturschätze Jamaikas und die Schönheit des Sonnenlichts. Schwarz erinnert an die schweren Tage der Vergangenheit und an die Gegenwart (Armut). In Anspielung auf die Farbgebung wurde in Deutschland der Begriff Jamaika-Koalition geprägt, der bei der Bundestagswahl 2005 allgemeine Bekanntheit erlangte.
Das Wappen Jamaikas ist eines der ältesten kolonialen Wappen. Es ist ein silberner Schild mit einem roten Kreuz, das mit fünf goldenen Ananasfrüchten nach der Figur belegt ist. Auf dem Wappenschild ruht ein königlicher goldener Helm mit roter Mütze und einer gold-silbernen Helmdecke. Der Helmwulst ist rot und silbern. Die Helmzier ist ein grünes Krokodil auf einem Baumstamm in natürlicher Farbe.
Die Schildhalter sind Menschen in natürlicher Farbgebung und mit unbedeckten Oberkörper. Links ein mit Federkrone geschmückter Arawak-Mann einen Bogen mit der linken Hand halten, rechts eine Arawak-Frau mit einem Korb mit Früchten unter dem rechten Arm haltend. Beide sind rot und weiß gekleidet und mit roten Federn, die Frau mit einem Hermelin-Stirnband geschmückt. Unter dem Schild befindet sich ein silbernes Spruchband mit dem Staatsmotto in schwarzen Majuskeln Out Of Many - One People („Aus vielen - ein Volk“).
Das Rot wird heute außer im Innern des Helms und im Kreuz auf dem Schild in einer pink-ähnlichen, beinahe purpurnen Farbe dargestellt. Das Spruchband wird ebenfalls in dieser Farbe abgebildet. Das rote Kreuz entspricht dem Georgskreuz in der Flagge Englands, das Spitzkrokodil ist das größte indigene Landtier Jamaikas, die Ananas wurde schon vor dem Eintreffen Columbus‘ in Jamaika kultiviert. Die Arawak waren die indigenen Einwohner Jamaikas.
Das Wappen wurde der Kolonie Jamaika im Februar 1662 verliehen und ist damit eines der ältesten kolonialen Wappen. Es soll vom späteren 79. Erzbischof von Canterbury, William Sandcroft, oder von seinem Vorgänger William Luxon entworfen worden sein. Seine Elemente wurden in verschiedenen Varianten auf der kolonialen Flagge (Blue Ensign) verwendet, zunächst als Plakette, ab 1906 auch als Wappen in einer weißen Scheibe.
Erste kleine Änderungen sind für 1692 belegt, Änderungen im Jahr 1957 betrafen unter anderem die Farbgebung des Helms (ursprünglich silbern) und der Helmdecke (ursprünglich rot statt golden). Mit der Unabhängigkeit Jamaikas 1962 wurde der alte, lateinische Wahlspruch Indus uterque serviet uni („Beide Indien werden einem dienen“) durch den heutigen englischen ersetzt. Die Farbe des Spruchbandes war zu Beginn Silbern, änderte sich später in Gold und schließlich zum heutigen Purpur.
Nationale Symbole:
- Farben: grün-gold-schwarz
- Pflanze: guayacan (Guajak, lignum vitae)
- Baum: blue mahoe (Blauer Hibiskus, talipariti elatum)
- Tier: green-and-black streamertail (Grün-schwarzer Wimperschwanz, trochilus polytmus)
- Motto: Indus uterque serviet uni („Beide Indien werden einem dienen“)
- Helden: Sir Alexander Bustamante, Norman Washington Manley, Paul Bogle, Geroge William Gordon,Marcus Mosiah Garvey, Sam Sharp, Nanny of The Maroons
Hymne
Jamaica, Land We Love („Jamaika, das Land, das wir lieben“) ist die Nationalhymne von Jamaika. Der Text stammt von Hugh Sherlock, die Musik von Robert Lightbourne. Text und Musik sind unabhängig voneinander entstanden und wurden von Mapletoft Poulle zu einem Lied zusammengefügt. 1962 (Unabhängigkeit von Großbritannien) wurde das Stück zur Nationalhymne Jamaicas.
Originaltext (englisch)
Eternal Father bless our land,
Guard us with Thy mighty hand;
Keep us free from evil pow’rs,
Be our light through countless hours.
To our leaders, Great Defender,
Grant true wisdom from above,
Justice, Truth be ours forever,
Jamaica, land we love,
Jamaica, Jamaica, Jamaica, land we love.
Teach us true respect for all,
Stir response to duty’s call;
Strengthen us the weak to cherish,
Give us vision lest we perish,
Knowledge send us, heavenly Father,
Grant true wisdom from above.
Justice, Truth be ours forever,
Jamaica, land we love,
Jamaica, Jamaica, Jamaica, land we love
In der ursprünglichen Version stand in der zweiten Zeile das Wort Guide anstelle von Guard.
Hauptstadt
1534 gründete Diego Kolumbus als Villa de la Vega. Die Ortschaft wurde als Santiago de la Vega Hauptstadt Jamaikas. Unter britischer Herrschaft ab 1655 wurde daraus Spanish Town. Hier befanden sich auch weiterhin Regierungssitz und Verwaltungsgebäude. Am 7. Juni 1692 zerstörte ein schweres Erdbeben die Hauptsiedlung Port Royal, das ab 1670 als inoffizielle Hauptstadt der Insel gedient hatte. In dessen unmittelbarer Nähe wurde noch im selben Jahr Kingston gegründet. Mit dessen Wachstum und seiner zunehmenden Bedeutung als Handels- und Wirtschaftszentrum verlagerte sich das politische Leben immer stärker dorthin. 1755 entschied der Gouverneur die Regierungsbüros nach Kingston zu verlegen. Sein Nachfolger hob den Beschluss aber wieder auf. Die reichen Händler Stadt bemühten sich weiter, das Vewaltungszentrum dorthin zu verlegen. Im Jahr 1872 wurde Kingston schließlich offiziell zur Hauptstadt Jamaikas erklärt und löste damit Spanish Town in dieser Rolle ab. Seither ist Kingston nicht nur das politische Zentrum des Landes, sondern auch das kulturelle Herz Jamaikas.
Verwaltungsgliederung
Jamaika besteht aus drei Grafschaften (counties), die wiederum in insgesamt 14 historisch gewachsene Parishes (Landkreise) zerfallen. Die Verwaltungsgliederung in parishes existiert seit 1655, als Jamaika britisch wurde. Früher gab es jedoch mehr parishes als heute. Die meisten existierten 1865, als Jamaika in 22 parishes gegliedert wurde. Die heutige Einteilung in 14 parishes existiert seit 1867, als acht davon aufgelöst wurden. Die aktuellen parishes sind nach dem Zensus von 2001:
| Parish | HASC | ISO | FIPS | Einwohner | Fläche (km²) | Fläche (mi²) | Cty | Hauptstadt |
| Clarendon | JM.CL
|
13
|
JM01
|
237 024 | 1 196 | 462 | M | May Pen |
| Hanover | JM.HA
|
09
|
JM02
|
67 037 | 450 | 174 | C | Lucea |
| Kingston | JM.KI
|
01
|
JM17
|
96 052 | 22 | 8 | S | Kingston |
| Manchester | JM.MA
|
12
|
JM04
|
185 801 | 830 | 320 | M | Mandeville |
| Portland | JM.PO
|
04
|
JM07
|
80 205 | 814 | 314 | S | Port Antonio |
| Saint Andrew | JM.SD
|
02
|
JM08
|
555 828 | 431 | 166 | S | Half Way Tree |
| Saint Ann | JM.SN
|
06
|
JM09
|
166 762 | 1 213 | 468 | M | Saint Anns Bay |
| Saint Catherine | JM.SC
|
14
|
JM10
|
482 308 | 1 192 | 460 | M | Spanish Town |
| Saint Elizabeth | JM.SE
|
11
|
JM11
|
146 404 | 1 212 | 468 | C | Black River |
| Saint James | JM.SJ
|
08
|
JM12
|
175 127 | 595 | 230 | C | Montego Bay |
| Saint Mary | JM.SM
|
05
|
JM13
|
111 466 | 611 | 236 | M | Port Maria |
| Saint Thomas | JM.ST
|
03
|
JM14
|
91 604 | 743 | 287 | S | Morant Bay |
| Trelawny | JM.TR
|
07
|
JM15
|
73 066 | 875 | 338 | C | Falmouth |
| Westmoreland | JM.WE
|
10
|
JM16
|
138 947 | 807 | 312 | C | Savanna-la-Mar |
| Jamaika | 2 607 632 | 10 991 | 4 243 | |||||
Verwaltungseinheiten:
3 counties (Grafschaften)
14 parishes (Gemeinden)
Bevölkerung
In Jamaika leben mehr als 2,6 Millionen Menschen - mit streigender Tendenz trotz nach wie vor anhaltender Abwandeurng. Im Folgenden die Entwicklung der Bevölkerungszahl samt Dichte, bezogen auf die offizielle Fläche von 10.991 km².
Bevölkerungsentwicklung:
Jahr Einwohner Dichte (E/km²)
1700 124 000 11,28
1740 164 000 14,92
1770 202 000 18,38
1800 250 000 22,75
1820 305 000 27,75
1825 321 000 29,21
1834 311 700 28,36
1851 388 000 35,30
1861 441 300 40,15
1871 506 200 46,06
1877 541 000 49,22
1881 580 800 52,84
1891 639 500 58,18
1896 694 900 63,22
1901 755 700 68,76
1906 820 400 74,64
1911 831 400 75,64
1916 850 000 77,34
1921 858 100 78,07
1926 916 600 83,40
1931 1 050 700 95,60
1936 1 130 000 102,81
1940 1 228 000 111,73
1943 1 237 100 112,47
1946 1 298 000 118,10
1949 1 365 000 124,19
1950 1 403 000 127,65
1951 1 430 000 130,11
1952 1 457 000 132,56
1953 1 486 000 135,20
1954 1 518 000 138,11
1955 1 542 000 140,30
1956 1 564 000 142,30
1957 1 575 000 143,30
1958 1 585 000 144,21
1959 1 595 000 145,12
1960 1 609 800 146,47
1961 1 646 000 149,76
1962 1 660 000 151,03
1963 1 696 000 154,31
1964 1 740 000 158,31
1965 1 760 000 160,13
1966 1 784 000 162,31
1967 1 802 000 163,95
1968 1 821 000 165,68
1969 1 844 000 167,77
1970 1 860 600 169,28
1971 1 901 000 172,96
1972 1 932 000 175,78
1973 1 972 000 179,42
1974 2 008 000 182,69
1975 2 021 000 183,88
1976 2 045 000 186,06
1977 2 072 000 188,52
1978 2 088 000 189,97
1979 2 104 000 191,43
1980 2 133 000 194,07
1981 2 168 000 197,25
1982 2 190 357 199,29
1983 2 196 000 199,80
1984 2 210 000 201,07
1985 2 227 000 202,62
1986 2 280 000 207,44
1987 2 300 000 209,26
1988 2 325 000 211,54
1989 2 351 000 213,90
1990 2 355 000 214,31
1991 2 366 067 215,27
1992 2 378 000 216,36
1993 2 415 000 219,73
1994 2 496 000 227,09
1995 2 522 000 229,46
1996 2 547 000 231,74
1997 2 554 000 232,37
1998 2 565 000 233,37
1999 2 576 000 234,37
2000 2 598 000 236,38
2001 2 607 632 237,25
2002 2 620 000 238,38
2003 2 633 000 239,56
2004 2 645 000 240,65
2005 2 656 000 241,65
2006 2 667 300 242,68
2007 2 675 504 243,43
2008 2 687 852 244,55
2009 2 693 000 245,02
2010 2 697 000 245,38
2011 2 697 983 245,39
2012 2 707 805 246,37
2013 2 708 552 246,16
2014 2 711 000 246,66
2015 2 715 000 257,02
2016 2 720 000 247,48
2017 2 726 667 248,08
2018 2 808 570 255,53
2019 2 823 271 256,88
2020 2 830 739 257,55
2021 2 837 682 258,18
2022 2 839 144 258,32
2023 2 839 786 259,37
2024 2 839 175 258,32
Die Bevölkerung wuchs von 1981 bis 2001 um durchschnittlich 1,014 % pro Jahr. Die Fruchtbarkeitsrate lag 2008 bei 2,25 Kindern pro gebärfähiger Frau, das Durchschnittsalter bei 23,7 Jahren. Die mittlere Lebenserwartung liegt bei etwa 73,5 Jahren.
Lebenserwartung in Jahren: 2009
insgesamt 73,53
Männer 71,83
Frauen 75,30
Regionale Verteilung
Die Einwohnerzahlen der parishes entwickelten sich wie folgt:
| Name | Z 1881 | Z 1891 | Z 1911 | Z 1921 | Z 1943 | Z 1970 | Z 1982 | Z 1991 | Z 2001 | Z 2011 | S 2019 |
| Clarendon | 49.800 | 57.100 | 73.900 | 82.600 | 123.500 | 176.600 | 203.132 | 214.706 | 237.024 | 245.103 | 247.112 |
| Hanover | 29.600 | 32.100 | 37.400 | 38.200 | 51.700 | 59.000 | 62.837 | 66.104 | 67.037 | 69.533 | 72.519 |
| Kingston | 38.600 | 48.500 | 59.700 | 63.700 | 110.100 | 110.000 | 104.041 | 103.771 | 96.052 | 89.057 | 90.544 |
| Manchester | 48.500 | 55.500 | 65.200 | 63.900 | 92.700 | 123.500 | 144.029 | 159.603 | 185.801 | 189.797 | 191.720 |
| Portland | 28.900 | 32.000 | 49.400 | 49.000 | 60.700 | 68.500 | 73.656 | 76.317 | 80.205 | 81.744 | 80.921 |
| St. Andrew | 35.000 | 37.900 | 52.800 | 54.600 | 128.100 | 440.100 | 482.889 | 535.872 | 555.828 | 573.369 | 571.947 |
| St. Ann | 46.600 | 54.100 | 70.700 | 70.900 | 96.200 | 121.300 | 137.745 | 149.424 | 166.762 | 172.362 | 177.054 |
| St. Catherine | 61.100 | 65.500 | 88.100 | 96.600 | 121.000 | 186.000 | 332.674 | 381.974 | 482.308 | 516.218 | 520.804 |
| St. Elizabeth | 54.400 | 62.300 | 78.700 | 79.300 | 100.200 | 126.000 | 136.897 | 145.651 | 146.404 | 150.205 | 151.911 |
| St. James | 33.600 | 35.100 | 41.400 | 41.900 | 63.500 | 103.700 | 135.959 | 154.198 | 175.127 | 183.811 | 191.737 |
| St. Mary | 36.600 | 39.800 | 69.900 | 71.400 | 90.900 | 100.000 | 105.969 | 108.780 | 111.466 | 113.615 | 115.090 |
| St. Thomas | 33.900 | 32.200 | 39.300 | 42.500 | 60.700 | 71.400 | 80.441 | 84.700 | 91.604 | 93.902 | 94.391 |
| Trelawny | 32.100 | 31.000 | 35.500 | 34.600 | 47.500 | 61.300 | 69.466 | 71.209 | 73.066 | 75.164 | 78.487 |
| Westmoreland | 49.000 | 53.500 | 66.500 | 68.900 | 90.100 | 113.200 | 120.622 | 128.362 | 138.947 | 144.103 | 149.857 |
| Jamaica | 577.700 | 636.400 | 828.300 | 858.100 | 1.237.100 | 1.760.600 | 2.190.357 | 2.380.666 | 2.607.632 | 2.697.983 | 2.734.093 |
Volksgruppen
Die Ureinwohner Jamaikas waren die Taíno, ein indigenes Volk der Karibik. Sie gaben der Insel den Namen Xaymaca. Ihre Zahl ging nach der Ankunft der Spanier im frühen 16. Jahrhundert jedoch dramatisch zurück – vor allem durch eingeschleppte Krankheiten, Zwangsarbeit und Gewalt. Schon im 17. Jahrhundert war die Taíno-Bevölkerung nahezu ausgelöscht, wenngleich kulturelle Spuren, etwa in Ortsnamen, bis heute erhalten geblieben sind.
Mit der Kolonialisierung begann der transatlantische Sklavenhandel, durch den Hunderttausende Afrikaner nach Jamaika verschleppt wurden. Sie stammten überwiegend aus westafrikanischen Regionen wie Ghana, Nigeria, Kamerun und dem Kongo. Ihre Nachkommen bilden heute die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung Jamaikas. Afrikanische Traditionen prägen Sprache, Religion, Musik und Mythen bis heute maßgeblich – besonders sichtbar etwa in den Anansi-Geschichten, im Obeah-Glauben oder in Trommel- und Tanztraditionen.
Eine besondere Gruppe innerhalb der afrikanischen Nachfahren stellen die Maroons dar. Dabei handelt es sich um Nachkommen geflohener Sklaven, die sich in den schwer zugänglichen Bergen und Wäldern der Insel niederließen. Dort gründeten sie eigenständige Gemeinschaften, die ihre afrikanischen Bräuche und Sprachen bewahrten. Trotz zahlreicher militärischer Auseinandersetzungen mit den Briten gelang es den Maroons, ihre Freiheit zu behaupten. Im 18. Jahrhundert erzwangen sie Verträge, die ihre Unabhängigkeit anerkannten. Bis heute existieren Maroon-Gemeinden, zum Beispiel in Accompong oder Moore Town, die stolz ihre kulturelle Eigenständigkeit pflegen.
Neben der großen Mehrheit afrikanischstämmiger Jamaikaner gibt es auch kleinere Volksgruppen. Europäer, vor allem Briten, stellten während der Kolonialzeit die herrschende Schicht. Nach der Abschaffung der Sklaverei im Jahr 1834 holten die Plantagenbesitzer Arbeitskräfte aus anderen Regionen: Inder (ab 1845) und Chinesen (ab 1854) kamen als Vertragsarbeiter nach Jamaika und gründeten eigene Gemeinschaften, die bis heute im Handel, in der Gastronomie und in der Kultur sichtbar sind. Später siedelten sich auch Libanesen und Syrer an, die insbesondere im Geschäftsleben und im Einzelhandel Einfluss gewannen.
Sprachen
Offizielle Amtssprache ist Englisch, das mit der britischen Herrschaft im 17. Jahrhundert eingeführt wurde und bis heute in Schulen, Behörden, Gerichten und den Medien verwendet wird. Im Alltag sprechen die Menschen aber meist Jamaican Patois (Patwa). Dieses sogenannte „jamaikanische Englisch“ ist jedoch keine bloße Abwandlung, sondern eine eigenständige Kreolsprache mit eigenen Regeln, Vokabeln und Strukturen, die tief in der Geschichte der Insel verwurzelt ist.
Patwa entstand in der Zeit der Sklaverei, als Menschen aus verschiedenen Regionen West- und Zentralafrikas nach Jamaika verschleppt wurden und mit den englischen Kolonialherren sowie untereinander kommunizieren mussten. Aus diesem Sprachkontakt entwickelte sich ein neues System, das englischen Wortschatz mit afrikanischen grammatischen Strukturen verband. Patwa hat eine eigene Grammatik: Verben werden nicht wie im Englischen konjugiert, sondern durch kleine Partikel ergänzt. So bedeutet etwa „mi deh go“ „ich gehe“ oder „ich bin unterwegs“, während „im a nyam“ „er isst“ heißt. Viele Wörter stammen zwar aus dem Englischen, haben aber eine eigene Bedeutung oder eine stark veränderte Aussprache. Afrikanische Begriffe, vor allem aus den Bereichen Religion, Musik und Alltag, sind ebenfalls ein fester Bestandteil der Sprache.
Neben den afrikanischen Einflüssen trugen auch andere Volksgruppen zur Sprachentwicklung bei. Inder, Chinesen, Syrer und Libanesen, die im 19. Jahrhundert als Vertragsarbeiter oder Händler nach Jamaika kamen, hinterließen einzelne Wörter im Patwa, besonders in der Küche und im Handel. So ist Patwa ein Spiegel der gesamten Migrationsgeschichte der Insel. Auch das amerikanische Englisch hat zum jamaikanischen Englischdialekt beigetragen. Diese Einflüsse lassen sich auf die Entwicklung engerer sozialer und wirtschaftlicher Beziehungen zu den Vereinigten Staaten ab dem späten 19. Jahrhundert zurückführen, die Popularität des kulturellen Angebots der USA, darunter Filme, Musik, Fernsehserien und -komödien sowie den Tourismus.
Jamaikanisches Patois wird mittlerweile auch im Radio und in den Nachrichten verwendet. Standard-Englisch hingegen ist die Sprache der Bildung, der Hochkultur, der Regierung, der Medien und der offiziellen/formellen Kommunikation. Es ist auch die Muttersprache einer kleinen Minderheit der Jamaikaner (in der Regel der Oberschicht und der oberen Mittelschicht). Personen, die die Standardvariante sprechen, werden oft als Angehörige einer höheren sozialen Schicht angesehen. Menschen, die mehr Standard-Englisch als Patois sprechen, werden als „Uptown“ bezeichnet. Die meisten kreolischsprachigen Sprecher verfügen durch ihre Schulbildung und den Kontakt mit der offiziellen Kultur und den Massenmedien über gute Englisch- und Standardenglischkenntnisse; ihre rezeptiven Fähigkeiten (Verständnis des Standardenglischen) sind in der Regel viel besser als ihre produktiven Fähigkeiten (ihre eigenen beabsichtigten Standardenglisch-Äußerungen zeigen oft Anzeichen des Einflusses des jamaikanischen Kreolisch).
Sprachen in Jamaika (nach etzhnologue):
- Englisch (English) [eng] Einordnung: Indo-European, Germanic, West, English
- Jamaikanisch (Jamaican Creole English) [jam] 2.670.000 in Jamaika (2001). Gesamtsprecherzahl: 3.202.600. Auch in Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Großbritannien, Kanada, Panama und den Vereinigten Staaten. Alternativbezeichnungen: Bongo Talk, Limon Creole English, Panamanian Creole English, Patois, Patwa, Quashie Talk, Southwestern Caribbean Creole English. Dialects: Die Grundlage bildet Englisch, ist aber teilweise unverständlich (Voegelin and Voegelin 1977, LePage 1960, Adler 1977). Wird teilweise gut verstanden von Sprechern des Cameroon Pidgin [wes] und Krio [kri] in Sierra Leone, wo Jamaikaner leben, die zwischen 1787 und 1860 dorthin auswanderten. Teilweise verständlich auch für Kreolsprecher in Panama und Costa Rica. Sehr ähnlich Belize Creole [bzj], ähnlich Grenada, Saint Vincent, unterschiedlich vom Kreol von Tobago, Guyana, Barbados, den Leeward und Windward Islands. Lexikalische Ähnlichkeit: 25 % mit Guyanese Creole English [gyn], 13 % mit Belize Kriol English [bzj], 9 % mit Trinidadian Creole English [trf], 8 % mit Bajan [bjs], 5 % mit Nicaragua Creole English [bzk]. Einordnung: Creole, English based, Atlantic, Western
Religion
Knapp zwei Drittel der Einwohner gehören einer protestantischen Kirche an, ein Ergebnis der britischen Herrschaft über die Insel. Die wichtigsten sind die Church of God (etwa 21,2 %), die Baptisten (etwa 8,8 %), die Anglikaner (etwa 5,5 %), die Siebenten-Tags-Adventisten (etwa 9 %), die Pfingstler (etwa 7,6 %), die Methodisten (etwa 2,7 %), die United Church of Christ (etwa 2,7 %), die Brethren (etwa 1,1 %), die Zeugen Jehovas (etwa 1,6 %) und die Herrnhuter (etwa 1,1 %). Die ursprünglich von den Spaniern verbreitete Römisch-katholische Kirche hat heute einen Anteil von lediglich 4 %. Dennoch besteht eine Erzdiözese in Kingston und Diözesen in Mandeville und Montego Bay. Die anglikanische Kirche auf Jamaika gehört zur Church of the Province of the West Indies, vertreten durch Bischof Alfred Charles Reid in Kingston.
Einige der von Sklaven auf die Insel mitgebrachten Naturreligionen konnten überleben. Mehr oder weniger stark übernahmen sie Elemente anderer Kulturen und Religionen, was zu einer Vielzahl kleiner Glaubensgruppen führte, die mit den Santería auf Kuba und den Voodoo auf Haiti vergleichbar sind. Daneben gibt es Minderheiten, die dem Islam, dem Judentum, sowie dem Buddhismus angehören. Die jüdische Gemeinde in Spanish Town existiert seit dem 16. Jahrhundert und verfügt seit 1704 über eine eigene Synagoge. Eine weitere große jüdische Gemeinde lebt in Kingston.
Römisch-Katholische Kirche
Seit dem 16. Jahrhundert sind katholische Missionare und Geistliche auf der Insel tätig. Aber erst am 10. Januar 1837 wurde das Apostolische Vikariat von Giamaica geschaffen. Die Diözese von Kingston entstand am 20. Februar 1956. Am 14. September 1967 wurde sie zun Erzbistum Kingston in Jamaika (lateinisch Archidioecesis Regiopolitana in Iamaica) und damkit zur höchsten kirchlichen Instganz des Inselstaats erhoben. Am 10. Januar 1837 wurde mit dem Breve „Ex munere pastoralis“ durch Papst Gregor XVI. aus Gebietsabtretungen des Apostolischen Vikariates Trinidad als Apostolisches Vikariat Jamaika errichtet. Am 10. Juni 1888 gab das Apostolische Vikariat Jamaika Teile seines Territoriums zur Gründung der Apostolischen Präfektur Britisch Honduras ab. Das Apostolische Vikariat Jamaika wurde am 29. Februar 1956 durch Papst Pius XII. zum Bistum erhoben und in Bistum Kingston umbenannt.
Das Bistum wurde am 14. September 1967 durch Papst Paul VI. mit der Apostolischen Konstitution Christi gregem zum Erzbistum erhoben und in Erzbistum Kingston in Jamaika umbenannt. Am gleichen Tag entstand das Bistum Montego Bay. Am 15. April 1991 gab das Erzbistum Teile seines Territoriums zur Gründung des Apostolischen Vikariats (mittlerweile Bistums) Mandeville ab. Eine weitere Gebietsabtretung erfolgte am 14. Juli 2000 zur Gründung der Mission sui juris Kaimaninseln. Das Erzbistum selbst umfasst den Landkreis Saint Catherine Parish und die Grafschaft Surrey im Osten der Insel. Im Jahr 2015 bestand die Kirchenprovinz aus 31 Pfarreien, die von 25 Diözesan- und 26 Ordenspriestern, dazu 35 ständigen Diakonen, 193 Ordensbrüdern und 90 Ordensschwestern betreut wurden bei einem Gläubigenanteil von nur 4 %.
Apostolic Vicars of Jamaica (Apostolische Vikare von Jamaika)
- 1837 - 1855 Benito Fernández OFM
- 1855 - 1872 James Eustace Dupeyron SJ
- 1872 - 1877 Joseph Sidney Woollett SJ
- 1877 - 1888 Thomas Porter SJ
- 1889 - 1906 Charles Menzies Gordon SJ
- 1907 - 1918 John Joseph Collins SJ
- 1919 - 1926 William O’Hare SJ
- 1927 - 1930 Joseph Dinand SJ
- 1930 - 1949 Thomas Addis Emmet SJ
- 1950 - 1956 John Joseph McEleney SJ
Bishop of Kingston (Bischof von Kingston)
- 1956 - 1967 John Joseph McEleney SJ, 1956 - 1967
Erzbischöfe von Kingston in Jamaika (Erzbischöfe von Kingston in Jamaika)
- 1967 - 1970 John Joseph McEleney SJ
- 1970 - 1994 Samuel Emmanuel Carter SJ
- 1994 - 2004 Edgerton Roland Clarke
- 2004 - 2008 Lawrence Aloysius Burke SJ
- 2008 - 2011 Donald James Reece
- 2011 - 2016 Charles Henry Dufour
- seit 2016 Kenneth David Oswin Richards
Judentum
Die ersten jüdischen Siedler kamen im 16. und 17. Jahrhundert nach Jamaika. Viele von ihnen waren Sepharden – Nachkommen von Juden, die während der Inquisition aus Spanien und Portugal fliehen mussten. Unter spanischer Herrschaft war Jamaika jedoch ein gefährlicher Ort für Juden, da die Inquisition auch dort tätig war. Erst mit der britischen Eroberung der Insel im Jahr 1655 änderte sich ihre Situation grundlegend: Die Briten gewährten den jüdischen Einwanderern mehr Toleranz und erlaubten ihnen, Handel zu treiben, Land zu besitzen und Gemeinden zu gründen.
Schon im 17. Jahrhundert entstand eine der ältesten Synagogengemeinden der Karibik in Port Royal, dem damaligen Handelszentrum der Insel. Nach dem großen Erdbeben von 1692, das Port Royal weitgehend zerstörte, verlagerten viele jüdische Familien ihren Lebensmittelpunkt nach Spanish Town und später nach Kingston. Dort entwickelte sich eine lebendige Gemeinde mit Synagogen, Schulen und Friedhöfen.
Besonders prägend war die Sephardische Tradition, die bis heute den Charakter des jamaikanischen Judentums bestimmt. Eine Besonderheit ist die Synagoge Shaare Shalom in Kingston, die bis heute in Betrieb ist und einen Boden aus weißem Sand hat – ein Brauch, der aus der Zeit der Inquisition stammt, als Juden in Geheimverstecken auf Sand beteten, um ihre Schritte zu dämpfen. Diese Synagoge ist heute die einzige aktive jüdische Gemeinde Jamaikas und steht im Zentrum des religiösen Lebens.
Im 18. und 19. Jahrhundert spielten Juden eine wichtige Rolle im Wirtschaftsleben Jamaikas, insbesondere im Handel, in der Medizin und im Finanzwesen. Viele Familien assimilierten sich jedoch über die Jahrhunderte, und durch Auswanderung, vor allem nach den USA, Kanada und Israel, nahm die Zahl der Mitglieder stark ab. Heute wird die jüdische Bevölkerung Jamaikas auf nur einige Hundert Personen geschätzt, doch ihr historischer Beitrag ist bis heute sichtbar.
Islam
Die ersten Muslime kamen vermutlich im Zuge des transatlantischen Sklavenhandels nach Jamaika. Viele versklavte Afrikaner stammten aus westafrikanischen Regionen, in denen der Islam verbreitet war, etwa aus Gebieten des heutigen Senegal, Mali oder Nigeria. Allerdings konnten sie ihre Religion unter den Bedingungen der Sklaverei oft nicht offen praktizieren. Viele islamische Traditionen und Bräuche gingen so im Laufe der Zeit verloren oder wurden mit afrikanischen, christlichen und lokalen Praktiken vermischt.
Im 19. Jahrhundert zogen indische Muslime als Vertragsarbeiter nach Jamaika, nachdem die Sklaverei 1834 abgeschafft worden war. Diese Gruppe brachte den Islam wieder gezielt auf die Insel und gründete erste Gemeinden. In der Folge etablierten sich Moscheen und religiöse Organisationen, insbesondere in Städten wie Kingston, Montego Bay und Spanish Town.
Heute wird die muslimische Bevölkerung Jamaikas auf etwa 1 % der Gesamtbevölkerung geschätzt. Die Gemeinschaft ist ethnisch vielfältig: Neben Nachkommen der indischen Vertragsarbeiter gibt es auch afrikanischstämmige Muslime, Konvertiten und kleinere Gruppen aus Nahost. Die Muslime Jamaikas betreiben Moscheen, Schulen und soziale Einrichtungen und beteiligen sich aktiv am öffentlichen Leben.
Rastafari
Kaum eine Gruppe prägte und prägt das Bild Jamaikas im Ausland mehr als die Rastafari. Diese Bewegung entstand in Jamaika in den 1930er Jahren als religiöse und kulturelle Strömung, die eng mit der afro-jamaikanischen Identität, Widerstand gegen Unterdrückung und der Suche nach spiritueller Befreiung verbunden ist. Sie entwickelte sich vor dem Hintergrund von Armut, sozialer Ausgrenzung und Rassendiskriminierung während der britischen Kolonialzeit. Viele Afro-Jamaikaner suchten nach einem Weg, ihre afrikanischen Wurzeln zu bewahren und sich gegen die Ungerechtigkeiten der Gesellschaft zu behaupten.
Ein zentraler Bezugspunkt der Rastafari ist Haile Selassie I., der 1930 zum Kaiser von Äthiopien gekrönt wurde. Seine Krönung wurde von vielen Jamaikanern als Erfüllung einer biblischen Prophezeiung interpretiert, und Haile Selassie wurde als göttliche Inkarnation verehrt. Äthiopien wurde zum Symbol für Freiheit, Würde und spirituelles Zuhause – das sogenannte „Zion“. Gleichzeitig steht „Babylon“ für Unterdrückung, Kolonialismus und materialistische Gesellschaften, gegen die sich die Bewegung wendet.
Die Rastafari-Bewegung legt großen Wert auf eine natürliche Lebensweise, vegetarische Ernährung (Ital Food) und die Ablehnung von Alkohol und Drogen, mit Ausnahme des rituellen Konsums von Ganja. Musik, insbesondere Reggae, Gebet und Meditation sind zentrale Ausdrucksformen des Glaubens, der die Einheit von Gott, genannt Jah, betont. Bei alledem steht das Individuum ins Zentrum, das einerseits frei von Gesetzen und Vorschriften leben, die Reinheitsvorschriften des Alten Testaments aber befolgen soll. Viele „Rasta“ zeigen ihre Glaubenszugehörigkeit durch das Tragen von Dreadlocks. Häufig wird die Glaubensrichtung zu Unrecht auf diese Merkmale reduziert. Bekannt wurde die Bewegung im Ausland vor allem durch Reggae-Sänger wie Bob Marley und Peter Tosh.
Ab den 1960er Jahren verbreitete sich die Bewegung international, stark geprägt durch Musiker wie Bob Marley, Peter Tosh und Burning Spear. Rastafari beeinflusste nicht nur die Musik, sondern auch Mode, Spiritualität und politische Bewegungen weltweit. In Jamaika selbst prägt sie bis heute die Kultur und Identität der Bevölkerung. Sie steht als Ausdruck von Widerstand gegen Unterdrückung, afrozentristischer Selbstbehauptung und spiritueller Suche und ist zu einem unverwechselbaren Symbol der jamaikanischen Kultur geworden.
Siedlungen
Aufgrund des bergigen Inlands befinden sich die meisten Siedlungszentren an der Küste oder in den großen Ebenen. Die Hauptstadt Kingston ist die größte Stadt des Landes. Zusammen mit der nahe gelegenen Planstadt Portmore bildet sie ein Ballungszentrum, in dem rund ein Viertel der Gesamtbevölkerung lebt. Neben praktisch allen Regierungseinrichtungen befinden sich hier die größte Universität und der größte Flughafen der Insel. Kingston hat, besonders seit Beginn der 1990er Jahre, große Kriminalitätsprobleme. Teile der Stadt werden von Banden beherrscht, die sich in den vergangenen Jahren sowohl gegenseitig bekämpften als auch offene Auseinandersetzungen mit Polizei und Militär führten.
Die Stadt wurde 1692 gegründet, nachdem ein Erdbeben die nahegelegene Stadt Port Royal zerstört hatte, die zuvor das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Region war. Kingston entwickelte sich schnell zu einem Handels- und Verwaltungszentrum und wurde später das politische Herz Jamaikas.
Heute ist Kingston nicht nur das politische und wirtschaftliche Zentrum, sondern auch das kulturelle Herz der Insel. Die Stadt ist weltbekannt als Geburtsort des Reggae und des Rastafari-Glaubens. Besonders der Stadtteil Trenchtown hat internationale Berühmtheit erlangt, da hier viele Musiker, darunter Bob Marley, aufgewachsen sind und ihre Karrieren begannen.
Die Stadt vereint moderne Hochhäuser und Geschäftsviertel mit historischen Gebäuden und Altstadtvierteln. Sie beherbergt Regierungsgebäude, Universitäten, Museen und kulturelle Einrichtungen. Kingston ist zudem ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt Jamaikas mit Hafenanlagen, Straßen- und Schienenverbindungen. Trotz ihrer urbanen und industriellen Struktur hat die Stadt lebendige Nachbarschaften, Märkte, Musikszene und kulturelle Veranstaltungen, die das pulsierende Leben Kingstons ausmachen.
Portmore ist vor allem als „Schlafstätte“ Kingstons bekannt. Die Stadt entstand in den 1960er und 1970er Jahren, um den wachsenden Wohnbedarf für die Bevölkerung Kingstons zu decken. Portmore zeichnet sich durch dicht besiedelte Wohngebiete, Einkaufszentren und Schulen aus und dient als Wohnraum für viele Pendler, die täglich nach Kingston zur Arbeit fahren. Obwohl die Stadt hauptsächlich modern und funktional geprägt ist, entwickelt sie sich zunehmend auch kulturell und wirtschaftlich, mit eigenen Gemeinden, Sporteinrichtungen und Freizeitangeboten.
Einige Kilometer westlich liegt das mit 145.845 Einwohnern deutlich kleinere Spanish Town. Die Stadt ist Zentrum eines Anbaugebietes für Bananen und Zuckerrohr, die hier weiterverarbeitet werden. Sie wurde 1534 von den Spaniern unter dem Namen Villa de la Vega gegründet und war während der spanischen Kolonialzeit die erste Hauptstadt der Insel. Nach der britischen Übernahme Jamaikas 1655 blieb Spanish Town bis 1872 die offizielle Hauptstadt, bevor sie von Kingston abgelöst wurde. Die Stadt ist reich an historischer Architektur, darunter alte Kolonialgebäude, Kirchen und das Parlamentsgebäude. Besonders bekannt ist die Santiago de la Vega-Kathedrale, eine der ältesten Kirchen Jamaikas. Spanish Town war lange das politische und administrative Zentrum der Insel, und noch heute spiegeln Straßen, Plätze und Denkmäler die koloniale Vergangenheit wider. Die Stadt ist zudem ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und hat kulturelle Bedeutung als Ort, an dem sich die Geschichte Jamaikas besonders gut ablesen lässt.
Im Nordwesten, ganz in der Nähe des Punktes, an dem Christoph Kolumbus als erster Europäer die Insel betrat, liegt Montego Bay, lokal kurz MoBay genannt. Die Stadt ist vor allem als touristisches Zentrum bekannt und zieht mit ihren Stränden, Resorts und Freizeitmöglichkeiten zahlreiche Besucher an. Montego Bay hat einen internationalen Flughafen, der als wichtiges Tor für den Tourismus in Jamaika dient. Neben dem Tourismussektor ist die Stadt auch ein Handels- und Industriezentrum. Historisch war Montego Bay ein wichtiger Ort für Zuckerplantagen und den Export von Zucker und Rum. Heute verbindet die Stadt wirtschaftliche Bedeutung mit einem lebendigen kulturellen Leben: Reggae, Rastafari-Kultur und lokale Feste prägen das Stadtbild.
May Pen liegt im zentralen Süden Jamaikas in der Parish Clarendon und ist die größte Stadt der Region. Sie entstand als Verwaltungs- und Handelszentrum für die umliegenden landwirtschaftlich genutzten Gebiete. Die Stadt ist besonders bekannt für den Landwirtschaftssektor, vor allem Zuckerrohr, Bananen und andere tropische Produkte, die in der Region angebaut werden. May Pen dient als wichtiger Umschlagplatz für Waren und hat eine lebendige lokale Wirtschaft mit Märkten, Geschäften und Dienstleistungsunternehmen. Trotz ihrer industriellen und landwirtschaftlichen Bedeutung bewahrt die Stadt auch ein traditionelles jamaikanisches Flair, das sich in Festen, Musik und lokalen Bräuchen widerspiegelt.
Mandeville liegt im Herzen von Jamaika in der Parish Manchester und ist bekannt für seine höhere Lage in den Bergen, wodurch die Stadt ein kühleres Klima hat als die Küstenregionen. Mandeville wurde im 19. Jahrhundert gegründet und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Verwaltungs- und Handelszentrum für das Landesinnere. Die Stadt war lange Zeit ein bevorzugter Ort für wohlhabende Jamaikaner und Kolonialbeamte, was sich in ihrer Architektur und der gepflegten Infrastruktur widerspiegelt. Heute ist Mandeville ein Zentrum für Bildung, Handel und Gesundheitswesen, mit Schulen, Krankenhäusern und Einkaufszentren. Außerdem ist die Stadt ein Ausgangspunkt für den Tourismus in die umliegenden Bergregionen und Naturschutzgebiete Jamaikas.
Savanna-la-Mar ist die Hauptstadt der Parish Westmoreland an der Südwestküste Jamaikas. Die Stadt liegt direkt an der Karibikküste und fungiert als wichtiger Hafen- und Handelsort für die Region. Sie entstand im 18. Jahrhundert und entwickelte sich zunächst als Zentrum für Landwirtschaft und Handel, insbesondere für Zuckerrohr, Bananen und andere tropische Produkte, die in der Umgebung angebaut wurden. Savanna-la-Mar ist bekannt für ihre historische Bedeutung während der Kolonialzeit. Viele alte Gebäude aus der britischen Epoche zeugen noch heute von der Vergangenheit der Stadt als Handels- und Verwaltungszentrum.
Port Antonio ist eine Küstenstadt im Nordosten Jamaikas im Parish Portland. Die Stadt liegt an einem natürlichen Hafen, der von Bergen und üppiger tropischer Vegetation umgeben ist, und gilt als eine der landschaftlich schönsten Städte der Insel. Historisch entwickelte sich Port Antonio im 18. und 19. Jahrhundert zunächst als Handels- und Exporthafen für Bananen, Kaffee, Zucker und andere landwirtschaftliche Produkte aus der fruchtbaren Region von Portland. Die Stadt profitierte stark vom Bananenhandel, der zu jener Zeit von US-amerikanischen Unternehmen dominiert wurde.
Die mit Abstand größte Agglomeration in Jamaika ist Kingston mit einer Einwohnerzahl von 943.107 (Stand 1. Januar 2006). Damit konzentrieren sich rund ein Drittel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. Im Folgenden die Einwohnerzahlen der Ortschaften Jamaikas. Sie beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.
| Name | Z 1891 | Z 1911 | Z 1921 | Z 1943 | Z 1960 | Z 1970 | Z 1982 | Z 1991 | Z 2001 | Z 2011 |
| Annotto Bay | 2.800 | 3.600 | 4.355 | 5.533 | 5.423 | 6.017 | ||||
| Balaclava | 2.703 | 2.770 | ||||||||
| Bath | 2.144 | 2.115 | ||||||||
| Black River | 1.300 | 2.000 | 3.100 | 2.701 | 3.601 | 3.610 | 4.095 | 5.352 | ||
| Bog Walk | 9.096 | 11.241 | 9.431 | |||||||
| Brown's Town | 2.700 | 3.900 | 5.474 | 6.351 | 6.874 | 8.054 | 9.031 | |||
| Buff Bay | 3.285 | 2.596 | 4.210 | 4.678 | ||||||
| Chapelton | 1.281 | 3.930 | 4.556 | 4.363 | ||||||
| Christiana | 7.368 | 8.276 | 8.430 | |||||||
| Claremont | 1.970 | 1.773 | ||||||||
| Clark's Town | 1.952 | 3.139 | 3.953 | 3.003 | ||||||
| Darliston | 2.529 | 2.328 | ||||||||
| Discovery Bay | 1.814 | 2.230 | 2.518 | 2.446 | ||||||
| Duncans | 2.132 | 2.686 | ||||||||
| Ewarton | 4.247 | 8.758 | 8.742 | 10.807 | 9.753 | |||||
| Falmouth | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.600 | 3.700 | 3.855 | 6.713 | 8.039 | 8.188 | 8.686 |
| Frankfield | 2.958 | 3.373 | 3.625 | 3.507 | ||||||
| Gayle/Lucky Hill | 4.148 | 3.260 | ||||||||
| Grange Hill | 2.406 | 6.150 | 6.530 | 7.591 | 6.922 | |||||
| Hayes | 4.258 | 6.457 | 8.447 | 10.098 | 10.639 | |||||
| Highgate | 5.636 | 5.975 | 5.482 | 6.051 | 6.375 | |||||
| Junction | 3.524 | 4.034 | ||||||||
| Kingston (in Kingston & St. Andrew) | 56.500 | 57.400 | 95.000 | 289.000 | 376.500 | 473.700 | 524.638 | 565.876 | 579.137 | 584.627 |
| Linstead | 2.300 | 3.500 | 5.996 | 9.204 | 14.630 | 15.660 | 15.231 | |||
| Lionel Town | 3.262 | 4.664 | 3.568 | 3.609 | ||||||
| Lucea | 1.400 | 2.000 | 2.800 | 3.579 | 5.652 | 5.479 | 6.245 | 7.131 | ||
| Mandeville | 8.400 | 13.681 | 34.502 | 40.680 | 47.467 | 49.695 | ||||
| May Pen | 6.000 | 14.100 | 25.425 | 40.962 | 48.262 | 57.334 | 61.548 | |||
| Montego Bay | 4.800 | 6.600 | 8.000 | 11.500 | 23.600 | 43.251 | 70.265 | 85.097 | 96.477 | 110.115 |
| Morant Bay | 3.700 | 5.100 | 3.482 | 8.828 | 9.711 | 10.782 | 11.052 | |||
| Negril (in Westmoreland & Hanover) | 1.166 | 2.500 | 4.040 | 5.854 | 7.832 | |||||
| Ocho Rios | 4.600 | 5.851 | 7.777 | 8.325 | 15.769 | 16.671 | ||||
| Old Harbour | 5.097 | 15.407 | 17.778 | 23.823 | 28.912 | |||||
| Old Harbour Bay | 6.344 | 5.872 | ||||||||
| Oracabessa | 2.216 | 4.066 | 4.230 | 4.398 | ||||||
| Port Antonio | 6.700 | 7.100 | 6.300 | 5.500 | 7.800 | 10.426 | 12.285 | 13.261 | 14.568 | 14.816 |
| Port Maria | 6.700 | 2.800 | 2.500 | 3.200 | 4.000 | 5.441 | 7.508 | 7.171 | 7.439 | 7.463 |
| Port Morant | 4.400 | 3.007 | 2.905 | |||||||
| Portmore | 5.100 | 73.426 | 97.024 | 156.469 | 182.153 | |||||
| Porus | 3.821 | 4.922 | 5.189 | 5.924 | 6.009 | |||||
| Runaway Bay | 1.116 | 2.838 | 5.749 | 5.840 | 8.640 | |||||
| Saint Ann's Bay | 2.600 | 2.100 | 3.100 | 5.100 | 7.101 | 9.058 | 11.143 | 10.441 | 11.173 | |
| Santa Cruz | 2.050 | 5.979 | 8.189 | 10.785 | 10.423 | |||||
| Savanna-la-Mar | 3.000 | 3.400 | 3.400 | 4.000 | 9.800 | 11.604 | 14.912 | 16.629 | 19.893 | 22.633 |
| Spaldings (in Clarendon & Manchester) | 3.225 | 4.373 | ||||||||
| Spanish Town | 5.000 | 7.100 | 8.700 | 12.000 | 14.700 | 39.204 | 89.097 | 114.175 | 131.515 | 147.152 |
| Yallahs | 4.396 | 6.835 | 6.902 | 9.888 | 10.849 |
Verkehr
Jamaika zählt zu den infrastrukturell am besten entwickelten Staaten in der Karibik. Das Land ist international vernetzt und intern durch ein dichtes Straßennetz erschlossen.
Straßenverkehr
Von den für 2010 angegebenen 16.425 km Straßen waren 4.737 km Haupt- sowie 11.688 Nebenstraßen, letztere nur teilweise für Kraftfahrzeuge benutzbar. Das Straßennetz wurde bis 2025 auf 21.000 km ausgebaut, von denen 15.000 km asfaltiert waren. Ländliche Wege sind oft schmal, kurvenreich und in schlechtem Zustand. Schlaglöcher, unzureichende Beschilderung und plötzliche Hindernisse wie Fußgänger, Radfahrer oder sogar Vieh sind alltäglich. In Städten wie Kingston und Montego Bay kommt es zu starken Staus, die durch Urbanisierung und hohes Fahrzeugaufkommen entstehen – Pendler verbringen im Durchschnitt 90 Minuten täglich im Verkehr.
Gefahren wird links. Der Fahrstil der Jamaikaner ist oft aggressiv und hektisch: Fahrer überholen riskant, nutzen die Hupe als Kommunikationsmittel (zum Beispiel für Warnungen oder Grüße) und ignorieren häufig Verkehrsregeln. Geschwindigkeitslimits betragen typischerweise 50 km/h in Ortschaften und 80 km/h außerorts, aber sie werden selten eingehalten. Für Touristen wird defensives Fahren empfohlen, und Überlandfahrten nach Einbruch der Dunkelheit sollten vermieden werden.
Der Bestand an registrierten Personenkraftwagen belief sich 2010 auf 44.500 Einheiten. Die PKW-Dichte betrug 18,8 Personenkraftwagen je 1000 Einwohner. Ferner gab es 20.700 Kraftomnibusse und Lastkraftwagen sowie 6000 Motorräder.
Der Busverkehr ist das Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs und günstig (ca. 100–200 JMD pro Fahrt), aber unzuverlässig und oft überfüllt. Es gibt keine festen Fahrpläne – Busse und Minibusse (Coaster) fahren, wenn sie voll sind. Die Jamaica Urban Transit Company (JUTC) betreibt den organisierten Service in Kingston, Montego Bay und Umgebung mit über 400 gelben Bussen, die täglich 250.000 Passagiere befördern. Für längere Strecken eignen sich Express-Busse wie der Knutsford Express (Kingston–Montego Bay, rund 2.000 JMD, feste Zeiten).
Route Taxis (PKWs mit rotem Kennzeichen) und Coaster-Minibusse ergänzen das Netz und erreichen Dörfer, die JUTC-Busse nicht bedienen. Sie starten von Transport Centers in Städten wie Half Way Tree (Kingston) oder Montego Bay Bus Terminal.
Bahnverkehr
Wie die meisten ehemaligen britischen Kolonien verfügte Jamaika über ein umfangreiches, insgesamt 420 km langes Schienennetz. 272 km wurden in 1,435 m Schienenbreite angelegt. Die Hauptstrecke führte von Kingston über Spanish Town und May Pen, wo eine Nebenstrecke nach Frankfield abzweigte, nach Montego Bay. Die Jamaica Railway Corporation erhielt das Netz bis 1992 aufrecht, als 207 km stillgelegt wurden. Heute werden noch 57 km von der Minengesellschaft ALCAN betrieben und vor allem zum Bauxittransport benutzt.
Ab 1845 verband die Jamaica Railway Company Städte wie Kingston, Montego Bay und Port Antonio über ein 350 km langes Schienennetz. Bis in die 1970er Jahre fuhren Personenzüge, doch aufgrund von Unwirtschaftlichkeit, Naturkatastrophen wie Hurrikanen und der Konkurrenz durch Busse und Autos wurde der Personenverkehr 1992 eingestellt. Güterverkehr, hauptsächlich für Bauxit-Transporte, lief bis 2014 weiter, bevor auch dieser gestoppt wurde.
Mit Stand 2025 gibt es keine funktionierenden öffentlichen Zugverbindungen. Die Infrastruktur ist größtenteils verfallen, Schienen sind verrostet oder überwachsen, und viele Bahnhöfe stehen leer oder wurden umfunktioniert. Es gibt jedoch touristische Initiativen: Die Jamaica Railway Corporation (JRC) plant, Abschnitte der Strecke für touristische Ausflugszüge zu reaktivieren, etwa zwischen Montego Bay und Appleton Estate für Rum-Touren. Solche Projekte sind jedoch noch in der Planung, und konkrete Fahrpläne oder regelmäßige Verbindungen existieren nicht.
Schiffsverkehr
Der Hafen von Kingston ist das zentrale Handels- und Logistikdrehkreuz Jamaikas und einer der bedeutendsten Häfen der Karibik. Gelegen im Kingston Harbour, dem siebtgrößten Naturhafen der Welt, an der Südküste der Insel, wird er von der Port Authority of Jamaica verwaltet und umfasst mehrere Terminals für Container, Massengut und Kreuzfahrtschiffe. Das Kingston Container Terminal (KCT), betrieben von Kingston Freeport Terminal Limited (Teil der CMA CGM Group), ist das Herzstück des Hafens. Mit einer Kapazität von etwa 3,2 Millionen TEU (Twenty-Foot Equivalent Units) jährlich dient es als wichtiger Umschlagplatz für Transshipments in die USA, Südamerika und andere Karibikstaaten. Ausgestattet mit modernen Super-Post-Panamax-Kränen, kann der Hafen große Containerschiffe effizient abfertigen. Rund 70 % des Im- und Exports Jamaikas, darunter Bauxit, Zucker, Kaffee und Industriegüter, laufen über Kingston, was den Hafen zu einem wirtschaftlichen Motor macht, der jährlich etwa 200 Millionen USD erwirtschaftet und Tausende Arbeitsplätze schafft.
Neben dem Güterverkehr spielt der Hafen eine Rolle im Tourismus, da ein spezielles Terminal in der Innenstadt Kreuzfahrtschiffe abfertigt. Passagiere nutzen Kingston als Ausgangspunkt für Ausflüge nach Downtown, Port Royal oder ins Landesinnere. Die Infrastruktur umfasst mehrere Liegeplätze, moderne Lagerhallen und Logistikanlagen, wobei ein Tiefgang von bis zu 13 Metern auch großen Schiffen die Anfahrt ermöglicht. Dennoch steht der Hafen vor Herausforderungen: Der Straßenverkehr in Kingston ist oft überlastet, was den Transport von Gütern verzögert, trotz guter Anbindung an Hauptstraßen wie die A1. Staus sind alltäglich, da Pendler in der Stadt oft 90 Minuten im Verkehr verbringen. Zudem kann Kriminalität in Teilen Kingstons ein Sicherheitsrisiko darstellen, obwohl das Hafengelände selbst gut gesichert ist. Hurrikane und tropische Stürme bedrohen saisonal den Betrieb, da Jamaika in einer wettergefährdeten Region liegt.
Weitere wichtige Seehäfen sind Port Royal und Montego Bay. Über sie wird der größte Teil der Einfuhren abgewickelt. Abseits von Kingston haben sich die übrigen Häfen auf den Export bestimmter Güter spezialisiert, so Port Antonio auf Bananen und Zucker sowie Port Rhoades, Port Kaiser und Ocho Rios auf Bauxit. Mitte der 1970er Jahre gründete Jamaika zusammen mit Costa Rica, Kolumbien, Kuba und Nicaragua die multinationale Schiffahrtsgesellschaft Namucar, der seit dem weitere karibische Staaten beigetreten sind.
Die wichtigste Schifffahrtsroute zum Panamakanal verläuft nur 32 Seemeilen südlich. Die Port Authority verwaltet das Gebiet mit zwei modernen Containerterminals mit einer Kapazität von rund 1,3 Millionen ISO-Containern und einer Freihandelszone. 1960 wurde in Port Kaiser im Saint Elizabeth Parish ein Tiefwasserpier gebaut, um den Abtransport des dort vorhandenen Bauxits zu beschleunigen. Weitere große Hafenanlagen entstanden in Port Esquivel, Port Rhoades und Rocky Point. Die Handelsmarine umfasst zehn Schiffe mit mehr als 1000 BRT, die alle im Besitz ausländischer Unternehmen sind.
Flugverkehr
Aufgrund der großen Bedeutung des Tourismus verfügt die Insel über zwei internationale Flughäfen, Norman Manley International Airport in Kingston, mit rund 1,7 Millionen Besuchern im Jahr, und Sir Donald Sangster International Airport in Montego Bay. Fast alle großen Fluglinien fliegen zumindest einen der beiden Flughäfen an. Seit 2004 befindet sich die einzige Fluggesellschaft der Insel wieder in Staatsbesitz. Air Jamaica fliegt vor allem Ziele in Nord- und Südamerika sowie in Großbritannien an. Ihre Tochtergesellschaft Jamaica Air Express konzentriert sich auf Inlandsflüge und Verbindungen zu den anderen Karibikinseln. Beide Gesellschaften verfügen zusammen über 16 Flugzeuge der Firma Airbus und mehrere kleine Maschinen vom Typ De Havilland Canada DHC-8.
| Ort | Parish | ICAO | IATA | Name | Koordinaten | Status |
| Internationale Flughäfen | ||||||
| Kingston | Kingston / St. Andrew | MKJP | KIN | Norman Manley International Airport | 17°56′08″N 76°47′15″W | Operational |
| Montego Bay | Saint James | MKJS | MBJ | Sangster International Airport | 18°30′13″N 77°54′48″W | Operational |
| Ocho Rios/Boscobel | Saint Mary | MKBS | OCJ | Ian Fleming International Airport | 18°24′15″N 76°58′08″W | Operational |
| Regionalflughäfen | ||||||
| Kingston | Kingston / St. Andrew | MKTP | KTP | Tinson Pen Aerodrome | 17°59′18″N 76°49′25″W | Operational |
| Mandeville | Manchester | MVJ | Marlboro Airport (Marlborough Airport) | 18°01′11″N 77°29′42″W | Closed | |
| Negril | Westmoreland | MKNG | NEG | Negril Aerodrome | 18°20′24″N 78°20′08″W | Operational |
| Port Antonio | Portland | MKKJ | POT | Ken Jones Aerodrome | 18°11′55″N 76°32′04″W | Operational |
| Rocky Point | Clarendon | Rocky Point Airstrip | 17°46′37″N 77°15′36″W | Closed | ||
| Militärflughäfen | ||||||
| Kingston | Kingston / St. Andrew | Up Park Camp | 17°59′18″N 76°46′34″W | Operational | ||
| Moneague | Saint Ann | Moneague Training Camp | 18°16′56″N 77°06′18″W | Operational | ||
| Vernam Field | Clarendon | Vernam Field | 17°53′18″N 077°18′11″W | Closed | ||
| Private Flughäfen | ||||||
| Bath | Saint Thomas | Bath Airfield | 17°56′24″N 76°18′27″W | Unknown | ||
| Bog Walk | Saint Catherine | Tulloch Airfield | 18°06′15″N 76°59′20″W | Operational | ||
| Discovery Bay | Saint Ann | Discovery Bay Airfield | 18°27′59″N 77°23′41″W | Operational | ||
| Duncans | Trelawny | Braco Airfield | 18°28′39″N 77°29′18″W | Closed | ||
| Ewarton | Saint Catherine | Ewarton Airfield | 18°10′26″N 77°04′07″W | Operational | ||
| Manchioneal | Portland | Hectors River Airfield | 18°03′17″N 76°16′59″W | Unknown | ||
| Nain | Saint Elizabeth | Nain Airfield | 17°58′36″N 77°36′24″W | Operational | ||
| Old Harbour Bay | Saint Catherine | Port Esquivel Airfield | 17°53′28″N 77°08′08″W | Operational | ||
| Spanish Town | Saint Catherine | Caymanas Airfield | 18°00′52″N 76°55′27″W | Closed | ||
| Williamsfield | Manchester | Kirkvine Works Airfield | 18°04′44″N 77°28′41″W | Operational | ||
Der Norman Manley International Airport ist der einzige internationale Verkehrsflughafen Jamaikas. Er ist mit über 1,7 Millionen Passagieren im Jahr 2006 vor Montego Bay der größte Flughafen des Landes und dient als Drehkreuz für Air Jamaica. Der Flughafen befindet sich etwa vier Kilometer südlich von Kingston auf einer der Küste vorgelagerten Landzunge und fertigt bis zu 130 internationale Flügen pro Woche ab. Neben zahlreichen Verbindungen innerhalb der Karibik sowie nach Nordamerika, darunter nach Havanna, Nassau, Miami und New York, bieten derzeit British Airways und Virgin Atlantic mit Verbindungen nach Gatwick auch Direktflüge zu einem Ziel in Europa.
Bis 2003 wurde der Flughafen, der mit rund 3500 Mitarbeitern einer der wichtigsten Arbeitgeber Kingstons ist, von der Airports Authority of Jamaica verwaltet, bis diese die Aufgabe für 30 Jahre an ihre Tochter NMIA Airports Limited übertrug. Am 26. November 1962 verunglückte eine Curtiss C-46A der kolumbianischen Lineas Aereas La Urraca (Luftfahrzeugkennzeichen HK-354X) auf ihrem Überführungsflug von Fairbanks (Alaska) über Miami nach Bogota beim Zwischenstopp in Kingston (Jamaika). Das Flugzeug war mit vier Reservetriebwerken und anderen Ersatzteilen schwer beladen. Nach einem langen Startlauf auf dem Flughafen Jamaika-Palisadoes kollidierte die Maschine drei Minuten nach dem Abheben während einer flachen Steigflugkurve in einer Höhe von nur rund 200 Metern mit dem Hügel Port Henderson Hill und fing Feuer. Alle 3 Insassen, der einzige Pilot und die beiden Passagiere, von denen einer im Cockpit saß, wurden getötet.
| Airlines | Ziele |
| Aerogaviota | Havana, Santiago De Cuba |
| Air Canada Rouge | Toronto–Pearson |
| American Airlines | Miami |
| British Airways | London–Gatwick |
| Caribbean Airlines | Antigua, Barbados, Fort Lauderdale, Nassau, New York–JFK, Orlando, Port of Spain, Sint Maarten, Toronto–Pearson |
| Cayman Airways | Grand Cayman |
| Copa Airlines | Panama City |
| Delta Air Lines | Atlanta, New York–JFK (ab 20. Dezember 2018) |
| Fly Jamaica Airways | Georgetown–Cheddi Jagan, New York–JFK, Toronto–Pearson |
| InterCaribbean Airways | Montego Bay, Providenciales |
| JetBlue Airways | Fort Lauderdale, New York–JFK |
| Spirit Airlines | Fort Lauderdale |
| WestJet | Toronto–Pearson |
Norman Manley International Airport
- Code: KIN / MKJP
- Lage: 17°56‘08“ N, 76°47‘16“ W
- Seehöhe: 3 m (10 ft)
- Entfernung: 4 km südlich von Kingston
- Inbetriebnahme: 1930
- Betreiber: NMIA Airports Limited
- Terminal: 1
- Rollbahn: 1
- Länge der Rollbahn: 2713 m (Asfalt)
- Fluggesellschaften: 13
- Flugzeug-Standplätze: ca. 100
- jährliche Passagierkapazität:
- jährliche Frachtkapazität:
- Flughafen-Statistik: Jahr Flugbewegungen Passagiuere Fracht in t
2006 23 286 1 715 179 16 124
2020 830 500
Wirtschaft
Nach dem Zweiten Weltkrieg wandelte sich die in kolonialer Zeit entstandene, rein agrarische Volkswirtschaft Jamaikas, die vor allem auf dem Zuckerrohrbau basierte, allmählich zu einem stärker diversifizierten Wirtschaftsgefüge, so dass mittlerweile sowohl der Bauxitbergbau und die Bauxitverarbeitung als auch die verarbeitende Klein- und Mittelindustrie einen größeren Beitrag zum Sozialprodukt leisten als die Landwirtschaft. Dennoch bleibt Landwirtschaft mit den Hauptanbauprodukten Zuckerrohr, Bananen, Zitrusfrüchte, Tabak, Kaffee, Kakao und Gewürzen von entscheidender beschäftigungspolitischer Bedeutung für Jamaika. Den 4.500 in der Bauxitindustrie Beschäftigten stehen etwa. 300.000 landwirtschaftliche Arbeitnehmer gegenüber. In den 1950er und 1960er Jahren war die jamaikanische Wirtschaftsentwicklung durch relativ hohe Wachstumsraten und ein schnelles Industrialisierungstempo geprägt. Beträchtliche Auslandsinvestitionen, ermutigt durch weitgehende Industrieförderungsgesetze, flossen in die Bauxitindustrie und Hotelwesen. Außerdem entstanden - vor allem im Großraum Kingston-Spanish Town - zahlreiche mittlere Betriebe der verarbeitenden Industrie, insbesondere in den Bereichen Textilien, Schuhe, Nahrungs- und Genussmittel, Möbel sowie Chemie. Als hemmende Faktoren, die einer umfassenden Industrialisierung entgegengestanden und -stehen, wirklich sich jedoch neben der Hypothek kolonialer Verhaltensmuster - die Knappheit an Rohstoffen, in erster Linie an Energie, der Mangel an qualitativ wettbewerbsfähigen Produkten eigener Fertigung sowie die Vernachlässigung der Inlandsmarktes aus. Nach dem Zeiten des relativen Booms in den frühen 1970er Jahren folgte eine Stagnationsphase, die angesichts der extremen Aussenhandelsabhängigkeit Jamaikas im Gefolge der Weltwirtschaftsrezession und der Ölpreisexplosion noch verstärkt wurde. Darüber hinaus verschlechterte sich die wirtschaftliche und politische Situation des Landes auch aufgrund einer radikalen „Drittwelt-Rhetorik” der Regierung Manley und seiner People National Party (PNP). Ausländisches Kapital und viele qualifizierte Jamaikaner verliessen aus diesem Grund die Insel. Die politische Polarisierung erreichte ihren Höhepunkt in den durch extreme Gewaltkriminalität gekennzeichneten Parlamentswahlen vom 30. Oktober 1980 (etwa 800 Wahlkampftote).
Die Oppositionspartei Jamaica Labour Party (JLP) unter Edward Seage errangt bei diesen Wahlen einen eindeutigen Sieg. Seage übernahm die Aufgabe, das Vertrauen des In- und Auslandes wiederherzustellen und mit Hilfe der USA, des IWF, der Weltbank sowie anderer westlicher Geber die Wirtschaft und Finanzen des Landes zu sanieren. Er setzte dabei auf ein ökonomisches Lieberalisierungsprogramm, Strukturanpassungsmassnahmen und ausländische Investitionen. Seine Konsequente Reform- und Sanierungspolitik, restriktive Haushalts- und Geldpolitik sowie Preiserhöhungen aufgrund der Abwertungen und Entlassungen im aufgeblähten öffentlichen Dienst führten jedoch zu weitverbreiteter Unzufriedenheit. Diese brachte im Februar 1989 erneut eine PNP-Regierung, wieder unter Manley an die Macht.
Die Regierung Manley machte deutlich - nicht zuletzt unter dem Eindruck der weltpolitischen Entwicklungen -, dass es keine neuen „sozialistischen Experimente” mehr geben werde. Vielmehr verkündete der Premierminister im September 1990 die unwiderrufliche Entscheidung der Regierung, Jamaika in eine Marktwirtschaft umzuwandeln, das Übermass an staatlichen Kontrollen abzubauen, Staatsbetriebe zu privatisieren und den Devisenhandel zu liberalisieren.
Im September 1991 wurde der Wechselkurs des Jamaika-Dollar völlig freigegeben. Dieser Schritt kann nach Ansicht von Beobachtern zu Recht als wichtigste wirtschaftspolitische Massnahme seit der Unabhängigkeit bezeichnet werden; wird Jamaika doch dadurch gezwungen, seine Exportanstrengungen zu erhöhen und seine Importabhängigkeit bei Konsumgütern durch Eigenproduktion abzubauen.
Gleichfalls ersetzte die Regierung Manley im Oktober 1991 die Vielzahl von Steuerarten durch eine einheitliche 10 %, seit Juni 1993 12,5 % umfassende Umsatzsteuer, General Consuption Tax (CGT). Sie hat sich als sehr erfolgreich erwiesen und bringt der Regierung inzwischen etwa ein Drittel der Budgeteinnahmen ein.
Nach dem Gesundheitlich bedingten Rücktritt von Manley im März 1992 wurde P.J. Patterson neuer Premierminister Jamaikas. Patterson, der aus den letzten Parlamentswahlen vom 30.03.1993 als klarer Sieger mit einem eindeutigen Mandat hervorging, hat deutlich gemacht, dass die Liberalisierungs- und Deregulierungspolitik, die die Transformation der jamaikanischen Wirtschaft, insbesondere die Stärkung des Privatsektors und der unternehmerischen Basis zum Ziel hat, durch seine Regierung konsequent fortgeführt werden wird. Die Regierung will dabei ihre Sparpolitik, die bereits zu einer Verringerung von Inflation und Arbeitslosigkeit geführt hat, zielbewußt weiterverfolgen.
Patterson wird in der jamaikanischen Öffentlichkeit als Verdienst angerechnet, den Jamaika-Dollar stabilisiert und die Inflation von 105 % in den Jahren 1991 und 1992 auf etwa 22 % heruntergefahren zu haben. Ebenfalls positiv wirkte sich für seine Regierung die gute Entwicklung im Tourismussektor aus, der im Jahr 1992 rund 850 Millionen US $, Im Jahre 1991 760 Millionen US $, Einnahmen erwirtschaftete.
Landwirtschaft
Rund ein Drittel der Erwerbstätigen sind in der Landwirtschaft beschäftigt. Ihr Anteil an der Entstehung des Bruttoinlandsprodukts betrug 1985 5,9 %, 1980 8,3 %. und 2023 9,0 % Die Agrarproduktiion ist stark exportorientiert. Wichtigstes landwirtschaftliches Ausfuhrprodukt ist Zucker. Zuckerrohr wird hauptsächlich in Plantagen angebaut. Bananen und Zitrusfrüchte liefern meist bäuerliche Betriebe, deren Absatz in genossenschaftlichen Vermarktungsformen organisiert ist. Die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen liegen in den Küstenniederungen (mit dem Hauptanbaugebiet für Zuckerrohr und Bananen im Ostteil der Nordküste) und in den Tälern im Inneren des Landes, an deren Hängen Kaffee angebaut wird, insbesondere die hochwertigen Arabica-Sorten aus den Blue Mountains. Weitere wichtige Produkte sind Banenen, Yamswurzeln, Kokosnüsse, Kakao, Pimento (Allspice) und Zitrusfrüchte. Diese landwirtschaftlichen Erzeugnisse, insbesondere Zucker, Bananen und Kaffee, sind entscheidend für die Deviseneinnahmen, obwohl der Bauxit-Abbau (Aluminiumerz) mittlerweile fast zwei Drittel der Exporteinnahmen ausmacht.
Etwa 41 % der Landesfläche, also rund 4.500 km², werden landwirtschaftlich genutzt. Von der Gesamtfläche wird rund ein Viertel für Ackerland und Dauerkulturen und 18 % als Wiesen und Weiden genutzt. Die Waldfläche nimmt mit 190.000 ha rund 17 % der Fläche ein. Die bewässerten Flächen, welche 16,4 % des Ackerlandes ausmachen, liegen überwiegend in der südlichen Küstenzone. Etwa drei Fünftel der landwirtschaftlichen Fläche werden durch Plantagen bewirtschaftet, die mit modernen Anbau- und Erntemethoden arbeiten. Die übrige Fläche wird von bäuerlichen Betrieben eingenommen, die meist nicht größer als 2 ha sind.
Zur Vergrößerung der Anbaufläche werden Neukultivierungen vorgenommen. Im Rahmen einer Landreform wird durch kauf- oder Pachtverträge von den Plantagenbesitzern Land erworben und unter günstigen Bedingungen Kleinbauern zur Verfügung gestellt. Ausserdem werden Massnahmen zur Ent- und Bewässerung der Nutzflächen so wie Beratungsmassnahmen zur besseren Bodenbearbeitung durchgeführt. Die Bergbaugesellschaften sind verpflichtet, nach Beendigung der Schürfarbeiten die Flächen zu rekultivieren und sie der landwirtschaftlichen Nutzung (meist als Weideland) zuzuführen.
Tropische Stürme bedrohen immer wieder die Erträge, während hohe Energiekosten die Produktion belasten. Im dritten Quartal 2024 generierte die Landwirtschaft etwa 12,5 Milliarden US-Dollar, was einen Rückgang gegenüber dem Vorquartal darstellt, wobei Prognosen für 2025 bis 2027 eine Stabilisierung andeuten. Viele Arbeitskräfte sind in kleinen Familienbetrieben oder Plantagen tätig, was die Bedeutung der Landwirtschaft für die lokale Bevölkerung unterstreicht.
Das landwirtschaftliche Entwicklungsprogramm der Regierung, AGRO 21 genannt, das 1983 begonnen wurde und sich zunächste auf die Exportproduktion konzentriert hat, fördert seit 1984 gezielt ein Selbstversorgungsprogramm. Der jahrelang vernachlässigte Landwirtschaftsbereich ist inzwischen einer der staatlichen Investitionsschwerpunkte. 1987 lagen die Schwerpunkte der Regierungsprogramme beim Ausbau der Bewässerungsanlagen, beim Agrarkreditwesen und bei der Förderung kleinbäuerlicher Betriebe.
Weinbau
Der Weinbau auf Jamaika ist ein hochgradig unkonventionelles und experimentelles Unterfangen in einem tropischen Klima, das sich grundsätzlich nicht für den klassischen Anbau von Weintrauben eignet. Mit einer Lage auf 18° nördlicher Breite liegt die Insel weit außerhalb des traditionellen Weinbaugürtels, der zwischen den Breitengraden 30 und 50 optimal für Vitis vinifera-Reben ist. Das heiße, feuchte Wetter mit hoher Luftfeuchtigkeit und Hurrikanrisiken stellt enorme Herausforderungen dar, darunter Pilzinfektionen, unzureichende Säure in den Trauben und ein Mangel an Kälteperioden für die Reifung. Dennoch gibt es Pionierprojekte, die zeigen, dass tropischer Weinbau möglich ist – vor allem durch den Einsatz hitze- und feuchtigkeitsresistenter Rebsorten wie Chenin Blanc, Colombard oder lokale Hybride. Der Fokus liegt weniger auf Massenproduktion als auf Nischenprodukten, die das karibische Terroir widerspiegeln: fruchtige, leichte Weine mit tropischen Noten.
Der Weinbau auf Jamaika hat keine lange Tradition wie in Europa oder sogar in anderen karibischen Ländern wie Kuba oder der Dominikanischen Republik. Erste Versuche reichen in die Kolonialzeit zurück, als spanische Siedler Reben einführten, doch der Fokus lag immer auf Zuckerrohr und Rum. Moderne Initiativen begannen in den 1990er Jahren mit der Einführung verbesserter Pflanzmethoden, um höhere Erträge und bessere Aromen zu erzielen. Heute ist der Sektor klein und fragmentiert, mit Schwerpunkten in Regionen wie St. Thomas, St. Ann und der Südostküste. Ein Meilenstein ist die Gründung der Journeys End Wine Company im Jahr 2012 durch den Unternehmer Howard Coxe, der „Flavours of the Past“ - Weine aus lokalen Früchten und Trauben - produziert. In den 2010er Jahren wuchs das Interesse durch Tourismus und Experimente mit exotischen Früchten wie Lychee, Mango oder Ingwer, die zu innovativen „Tropenweinen“ führen.
Jamaikas Weinbau ist dezentral und oft auf kleinen Plantagen oder Familienbetrieben beschränkt. Geeignete Gebiete nutzen fruchtbare Böden und Mikroklimata
:
- St. Thomas (zum Beispiel Yallahs Valley): Bekannt für exotische Weinberge wie den in Country Walk, wo Trauben seit den 2000er Jahren angebaut werden. Hier gedeihen hitzetolerante Sorten, und es gibt Ernten von bis zu mehreren Tonnen pro Jahr.
- Südostküste und St. Ann: Heiße, feuchte Bedingungen fördern rote Sorten wie Red Jamaica; kleine Weinberge produzieren leichte Rotweine mit fruchtigem Abgang.
- St. Elizabeth: Neuere Projekte wie „The Vineyard“ von Dr. Lennox Rowe, einem Physiker, der seit 2024 solarbetriebene Anlagen für Trauben- und Fruchtweine nutzt. Sein Fokus liegt auf nachhaltigen, gesundheitsfördernden Weinen aus lokalen Zutaten.
Größere Produzenten sind rar; stattdessen dominieren Kleinstbetriebe und Importe (Jamaika importiert jährlich Weine im Wert von Millionen). Der Marktumsatz für Wein (hauptsächlich importiert) liegt 2025 bei etwa 16,2 Millionen Euro, mit steigender Nachfrage nach Premium- und Bio-Varianten.
Die Produktion umfasst Stillweine (weiß, rot, rosé) mit fruchtigen Aromen und würzigem Finish, oft angereichert mit Kräutern für Einzigartigkeit. Trauben werden auf Spalieren gezogen, um Feuchtigkeit zu reduzieren, und Erträge sind saisonal (zwei bis drei Ernten pro Jahr möglich). Allerdings kämpft der Sektor mit Klimarisiken: Hurrikane wie Beryl 2024 zerstörten Anlagen, und der Klimawandel verstärkt Trockenperioden. Chemische Mittel werden minimiert, um Nachhaltigkeit zu fördern, doch fehlende Expertise und hohe Kosten bremsen Wachstum. Trotzdem wächst der Tourismussektor: Weinproben und -touren boomen, mit Angeboten in Kingston oder Ocho Rios, die lokale Weine mit Cocktails kombinieren.
Forstwirtschaft
Etwa 48 Prozent der Landesfläche, rund 5.275 km², sind bewaldet, darunter 23 Prozent oder etwa 122.000 Hektar auf Crown Lands, die vom Staat verwaltet werden. Die Wälder, vorwiegend feuchte Laubwälder, decken 85 Prozent der Insel ab und erstrecken sich über Regionen wie die Blue Mountains, John Crow Mountains und das Cockpit Country. Sie beherbergen über 1.500 vaskuläre Pflanzenarten, von denen etwa 400 endemisch sind, sowie 207 Vogelarten, darunter 28 endemische. Wichtige Baumarten umfassen den Blue Mahoe (Nationalbaum), Spanish Elm, Cedar, Guango, Jamaica Mahogany und Lignum Vitae mit der Nationalblume. Diese Vielfalt unterstreicht die ökologische Bedeutung, doch die Forstwirtschaft trägt wirtschaftlich nur marginal zum BIP bei – zusammen mit Landwirtschaft und Fischerei etwa 6 Prozent im Jahr 2010, mit einem Fokus auf nachhaltige Nutzung statt intensiver Holzproduktion.
Das Forestry Department, die zentrale Behörde seit dem Forest Act von 1996, verwaltet rund 117.000 Hektar Wälder und setzt auf Schutzmaßnahmen wie die Gazettierung neuer Reservate, etwa die Bogue 2 Forest Reserve mit 455 ha im Jahr 2016. Die Mission lautet: „Manage Jamaican forest ecosystems according to national environmental policies.“ Programme wie die National Tree Planting Initiative zielen auf die Aufforstung von drei Millionen Bäumen in drei Jahren ab, um den Waldverlust zu bekämpfen und die Klimawiderstandsfähigkeit zu stärken. Internationale Ziele wie Vision 2030 (Ziel 4: Gesunde natürliche Umwelt) und die Sustainable Development Goals (SDGs) werden durch Initiativen wie Adopt-A-Trail unterstützt, die Wanderwege fördern und den Ökotourismus ankurbeln. Im Jahr 2025 hat das Department die Registrierung für Forest Trek II gestartet – eine Wanderung im Blue Mountain Forest Reserve am 2. November –, um Gesundheit und Naturverbundenheit zu propagieren. Zudem engagiert sich eine CSO-Koalition für partizipative Budgetierung im Forstsektor, um mehr Mittel für 2024/25 zu sichern und lokale Gemeinschaften einzubinden.
Trotz dieser Bemühungen steht die Forstwirtschaft vor drängenden Herausforderungen. Jamaika verliert jährlich Waldflächen: 2020 waren es 1,55 kha natürlicher Wald, was 802 kt CO₂-Emissionen entsprach und den Waldanteil auf 59 Prozent der Fläche reduzierte. Ursachen sind illegale Abholzung – bekämpft von 40 Forest Rangers –, Landnutzungsänderungen durch Bergbau (speziell Bauxit), Landwirtschaft und urbane Expansion sowie Klimawandel-Effekte wie Hurrikane und Dürren. Mangrovenwälder, die Küsten schützen und Fischbrutstätten bieten, sind besonders gefährdet. Die aktualisierte Nationally Determined Contribution (NDC) integriert den Forstsektor, um Emissionen bis 2030 zu senken, und der Forest Stewardship Council (FSC) etabliert Standards für nachhaltige Praktiken. Innovationen wie participatory forest management und EU-finanzierte Projekte fördern Erholung und grünes Wachstum.
Fischerei
Jamaika konzentriert sich auf den Fang von pelagischen Fischen wie Sardinen, Makrelen und Thunfischen, während Pedro Bank, ein Unterwasserplateau 100 km südwestlich der Insel, als zentrales Fischgrundgebiet dient. Der Sektor umfasst hauptsächlich handwerkliche (artisanal) Fischerei, die 92 % der Meeresproduktion ausmacht, ergänzt durch industrielle Aktivitäten und Aquakultur, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Tilapia ist die führende Aquakulturart, die sowohl für den lokalen Markt als auch für Exporte produziert wird.
Wirtschaftlich trägt die Fischerei erheblich zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei: Im Jahr 2022 belief sich ihr Beitrag auf 17,7 Milliarden Jam-Dollar (rund 113 Millionen USD), ein Plus von 16 % gegenüber dem Vorjahr, und sie generiert jährlich Exporte im Wert von 11 bis 12 Millionen USD, darunter Hummer, Schnecken und Fischprodukte. Der gesamte Sektor schafft direkte und indirekte Beschäftigung für über 40.000 Personen, vor allem in ländlichen Küstengemeinden, und deckt einen Pro-Kopf-Fischverzehr von etwa 19,6 kg ab. Der Süden Jamaikas dominiert mit 69 % der Meeresfischproduktion, während der Exportanteil bei 8 % der landwirtschaftlichen Exporte liegt. Die Regierung fördert den Sektor durch Programme wie das Promoting Community-Based Climate Resilient Fisheries Project, das neue, klimafeste Praktiken einführt und Einkommensdiversifikation unterstützt. Bis 2025 hat die IrieFins-Plattform der NFA über 5.615 Fischereilizenzanträge bearbeitet, was die Digitalisierung und Legitimierung des Gewerbes vorantreibt.
Trotz des Wachstums – die Meeresfischproduktion stieg von April bis September 2024 – steht die Fischerei vor Herausforderungen: Überfischung, Korallenriff-Schäden durch Trawling, Hurrikane und der Klimawandel bedrohen Bestände, während Tiefseebergbau-Risiken (diskutiert bei der Internationalen Meeresbodenbehörde in Kingston) die Fischgründe um bis zu 14 % wirtschaftlich gefährden könnten. Die Regierung reagiert mit dem Fisheries Act von 1976, Jahresschutzzeiten für Hummer (April–Juni) und Investitionen in Aquakultur sowie marikulture Projekte. Der Strategische Geschäftsplan des MOAF für 2025 priorisiert Innovationen, um den Sektor bis 2030 inklusiv und wettbewerbsfähig zu machen, inklusive Ausbau der „Blue Economy“ und der nicht unproblematischen Partnerschaft mit der Weltbank.
Bergbau
Unter dem feuchtwarmen Klima sind die Kalksteine zu tiefgründigen Böden verwittert, die einen hohen Aluminiumanteil aufweisen und teilweise als Bauxit abgebaut werden. Wichtigstes Exportgut der Insel ist Bauxit, ein Erz, aus dem Aluminium gewonnen wird. Es macht zwei Drittel der Exporteinnahmen aus. 2005 waren 3939 Menschen in diesem Wirtschaftszweig beschäftigt. In Nain in Saint Elizabeth wurde für 125 Millionen US-Dollar eine Verarbeitungsanlage errichtet. In der Nähe, sowie in Saint Ann wurden wichtige Tiefwasserpiere angelegt. Das Bauxit wird unbearbeitet oder zu Aluminiumoxid veredelt verschifft. Für eine Verarbeitung zu Aluminium fehlt es an billiger Energie wie sie zum Beispiel in der Nähe der Bauxitvorkommen auf Neuseeland oder Island zur Verfügung steht.
Der Bergbau, insbesondere der Abbau von Bauxit zur Aluminiumherstellung, ist ein zentraler Wirtschaftszweig Jamaikas und trägt maßgeblich zu den Exporteinnahmen bei. Die Insel, die seit 1952 Bauxit abbaut, ist der weltweit neuntgrößte Produzent dieses Rohstoffs und deckt etwa 0,78 % der globalen Produktion ab. Obwohl der Sektor in den letzten Jahren Schwankungen zeigt, generierte er 2023 Exporteinnahmen in Höhe von 551,5 Millionen USD – ein Plus von 68 % gegenüber 2022, aber immer noch 32,3 % unter dem Höchststand von 2019 mit 814,2 Millionen USD. Die Regierung fördert den Sektor durch die Jamaica Bauxite Mining Limited (JBM), ein staatliches Unternehmen, das seit 50 Jahren aktiv ist und kürzlich für nachhaltige Entwicklungen wie die Modernisierung des Reynold’s Piers in Ocho Rios gelobt wurde. Dieser Mehrzweckhafen dient nicht nur dem Export von Bauxit, sondern auch von Zucker und Kalkstein und unterstützt den Tourismus.
Bauxit ist das einzige metallische Mineral, das derzeit abgebaut wird, und Grundlage für die Aluminiumproduktion. Die Förderung sank 2023 um 17,29 % gegenüber 2022, mit einer erwarteten leichten Erholung (CAGR von 0,64 % bis 2027). Große Produzenten wie United Company RUSAL dominieren, wobei der Export hauptsächlich in die USA geht. Alumina wird aus Bauxit verarbeitet und exportiert. Jamaika verfügt über vier große Raffinerien. Kalkstein (Produktion 2023: 1,9 Millionen Tonnen, ein deutlicher Rückgang gegenüber den Vorjahren) für Bauzwecke und Zement; Whiting (gemahlener Kalkstein) für Industrie, Farben und Pharmazeutika.
Neben Bauxit wird auch Gips abgebaut, jedoch mit deutlich geringerem wirtschaftlichen Erfolg. Versuche, eine umfangreiche Zementindustrie aufzubauen − es entstanden mehrere große Verarbeitungsanlagen unter anderem in Mona − scheiterten an fehlenden Investitionen aus dem Ausland und einer zunächst zu geringen Nachfrage. 2005 wurde die Einfuhrsteuer auf Zement von 15 auf 40 Prozent angehoben, was aber nicht zu einer erhöhten Produktion im Land, sondern zu einem Rohstoffmangel in der Bauindustrie führte. Zu alledem kommen kleinere Vorkommen von Kupfer, Gold und Mangan, aber ohne nennenswerte kommerzielle Bedeutung.
Der Abbau erfolgt hauptsächlich durch Tagebau in Regionen wie St. Ann, Manchester und Clarendon, wo Unternehmen wie Alcoa und Noranda operieren. Die Mines and Geology Division (MGD) reguliert den Sektor unter Gesetzen wie dem Mining Act und dem Quarries Control Act.
Der Bergbau ist ein Motor des Wachstums: 2023 trug er 120 % zum BIP-Wachstum bei und schafft Tausende Jobs, obwohl der Gesamtanteil am BIP bei etwa 5 bis 7 % liegt. Er konkurriert mit Tourismus und Landwirtschaft, generiert aber Devisen und unterstützt verwandte Industrien wie die Verarbeitung. Die Weltbank prognostiziert für 2025 ein Wirtschaftswachstum von 1,7 %, getrieben unter anderem durch Bergbau und Bauwesen. Die JBM feierte 2025 ihr 50-jähriges Jubiläum unter dem Motto „Navigating New Waters and Sustaining Our Assets“, mit Fokus auf nachhaltige Investitionen und Partnerschaften, etwa mit dem Jamaica Institute of Engineers.
Trotz der Vorteile ist der Bergbau umstritten: Offenabbau zerstört Waldflächen, verschmutzt Gewässer mit „Red Mud“ (rötlicher Schlamm aus der Verarbeitung, der Schwermetalle enthält) und beeinträchtigt die Luft- und Wasserqualität. Studien wie die „Red Dirt Study“ (2020) schätzen jährliche soziale Kosten von 2,9 bis 13 Milliarden USD, weit höher als die Einnahmen von ca. 1 Milliarde USD. In Gebieten wie Gibraltar (St. Ann) reicht der Abbau bis an Schulen heran, was Gesundheitsrisiken birgt. Der Klimawandel und Hurrikane verstärken die Vulnerabilität, während sinkende Einnahmen seit den 1970er Jahren Debatten über die Zukunft des Sektors anheizen. Die Regierung setzt auf Rehabilitation abgebauter Flächen, strengere Vorschriften und grüne Praktiken, um den Bergbau langfristig zu sichern.
Handwerk
Ein zentrales Element des jamaikanischen Handwerks ist die Holzschnitzerei, die häufig Mahagoni oder den Blue Mahoe, Jamaikas Nationalbaum, verwendet. Kunsthandwerker stellen Skulpturen, Masken und Dekorationsgegenstände her, die auf Märkten wie dem Kingston Craft Market oder in Touristenhochburgen wie Montego Bay und Ocho Rios verkauft werden. Korbmacherei, oft aus einheimischen Materialien wie Stroh oder Schilf, produziert Körbe, Hüte und Matten, die sowohl lokal genutzt als auch exportiert werden. Textilhandwerk, einschließlich Batik und Stickerei, zeigt farbenfrohe Muster, die von der Rastafari-Kultur und karibischen Motiven geprägt sind. Schmuck aus Perlen, Muscheln oder Halbedelsteinen ist ebenfalls beliebt, insbesondere bei Touristen, die authentische Souvenirs suchen.
Wirtschaftlich gesehen ist das Handwerk ein wichtiger Beschäftigungssektor, insbesondere für Frauen und Jugendliche in ländlichen Gebieten. Laut Schätzungen der Jamaica Business Development Corporation (JBDC) sind Tausende von Handwerkern in Kleinbetrieben tätig, oft in informellen Strukturen. Der Sektor wird durch Initiativen wie das „Things Jamaican“-Programm gefördert, das lokale Produkte für den Export zertifiziert und vermarktet. Im Jahr 2025 unterstützt die Regierung handwerkliche Kooperativen und bietet Schulungen in Unternehmertum und Design an, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Der Tourismus, der etwa 30 % des BIP ausmacht, treibt die Nachfrage nach handgefertigten Produkten, da Besucher traditionelle Waren als Souvenirs kaufen. Exporte von Kunsthandwerk, obwohl kleiner im Vergleich zu Bauxit oder landwirtschaftlichen Produkten, wachsen stetig, mit Märkten in den USA, Kanada und Europa.
Trotz seines Potenzials steht das Handwerk vor Herausforderungen. Der Zugang zu Rohstoffen wie hochwertigem Holz oder Textilien ist durch Umweltverluste und Importkosten eingeschränkt. Der Klimawandel und Hurrikane bedrohen die Verfügbarkeit natürlicher Materialien, während der Wettbewerb mit billigen, importierten Massenwaren die Margen drückt. Viele Handwerker kämpfen zudem mit begrenzten Marketingressourcen und fehlendem Zugang zu digitalen Plattformen. Die Regierung und NGOs wie die JBDC fördern daher E-Commerce-Programme und Handwerksmessen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ein Beispiel ist die jährliche „Artisan Village“-Veranstaltung in Kingston, die lokale Produkte präsentiert und den Tourismus mit Handwerk verbindet.
Industrie
Die Industrie auf Jamaika ist ein zentraler Pfeiler der Wirtschaft, der etwa 20 bis 25 % zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beiträgt und eine Schlüsselrolle bei der Diversifizierung neben Tourismus, Bergbau und Landwirtschaft spielt. Der Sektor umfasst die Verarbeitung von Bauxit zu Aluminiumoxid (Alumina), die Lebensmittel- und Getränkeproduktion, die chemische Industrie sowie kleinere Bereiche wie Textil- und Möbelherstellung. Trotz ihrer Bedeutung steht die Industrie vor Herausforderungen wie hohen Energiekosten, globaler Konkurrenz und Umweltproblemen, bleibt jedoch ein wichtiger Arbeitgeber und Exportfaktor, insbesondere durch den Bauxit- und Aluminiumsektor.
Seit den 1990er Jahren gibt es Vergünstigungen wie zollfreie Einfuhr und Steuerbefreiungsprogramme, um Industrieansiedlungen zu fördern. Neben der angestammten Nahrungs- und Genussmittelindustrie wurden Unternehmen, die unter anderem Textilien, Schuhe, Farben, Landwirtschaftsmaschinen, Transistorradios, Zement und Kunstdünger herstellen, angesiedelt. Die Erdölraffinerie in Kingston erzeugt genügend Brennstoff, um die Hälfte des nationalen Bedarfs zu decken.
Der dominante Industriezweig ist die Bauxit- und Aluminiumverarbeitung. Jamaika, der weltweit neuntgrößte Bauxitproduzent, fördert diesen Rohstoff vor allem in Regionen wie St. Ann, Manchester und Clarendon durch Tagebau. Die vier großen Raffinerien, betrieben von Unternehmen wie Alcoa und Noranda, verarbeiten Bauxit zu Alumina, die hauptsächlich in die USA exportiert wird. 2023 generierte der Sektor Exporteinnahmen von 551,5 Millionen USD, trotz eines Produktionsrückgangs von 17,29 % gegenüber dem Vorjahr. Die staatliche Jamaica Bauxite Mining Limited (JBM) fördert Modernisierungsprojekte, etwa den Mehrzweckhafen in Ocho Rios, der Bauxit, Kalkstein und Zucker exportiert und den Tourismus unterstützt. Prognosen deuten auf eine leichte Erholung mit einem jährlichen Wachstum (CAGR) von 0,64 % bis 2027 hin.
Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist ein weiterer wichtiger Zweig, der landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Zuckerrohr, Kaffee, Kakao und tropische Früchte verarbeitet. Produkte wie Rum (zum Beispiel von Appleton Estate), Säfte, Gewürze und Konserven sind sowohl für den lokalen Markt als auch für den Export relevant. Rum ist ein global anerkanntes Aushängeschild Jamaikas und trägt erheblich zu den Deviseneinnahmen bei. Die chemische Industrie produziert unter anderem Düngemittel und Pestizide für die Landwirtschaft, während Kalksteinverarbeitung (1,9 Millionen Tonnen im Jahr 2023) für Bauzwecke, Zement und industrielle Anwendungen wie Farben und Pharmazeutika genutzt wird. Kleinere Sektoren wie Textilien, Möbel und Verpackungsmaterialien ergänzen das industrielle Portfolio, sind jedoch weniger bedeutend und kämpfen mit Importkonkurrenz.
Wirtschaftlich gesehen schafft die Industrie Tausende Arbeitsplätze, insbesondere in ländlichen Gebieten, und stärkt verwandte Sektoren wie Logistik und Bauwesen. Die Weltbank prognostiziert für 2025 ein Wirtschaftswachstum von 1,7 %, angetrieben durch Bergbau und verarbeitende Industrie. Dennoch belasten hohe Energiekosten - Jamaika ist von importierten fossilen Brennstoffen abhängig - die Wettbewerbsfähigkeit. Umweltprobleme sind ein weiteres Hindernis: Der Bauxitabbau verursacht Landschaftszerstörung, Luftverschmutzung und Wasserverschmutzung durch „Red Mud“, einen giftigen Verarbeitungsrückstand. Studien schätzen die sozialen und ökologischen Kosten auf 2,9 bis 13 Milliarden USD jährlich, weit über den Einnahmen von etwa einer Milliarde USD. Hurrikane und der Klimawandel verschärfen diese Probleme, während sinkende Bauxitpreise die Rentabilität drücken.
Die Regierung reagiert mit Reformen, darunter strengere Umwauflagen, die Förderung erneuerbarer Energien zur Kostensenkung und die Rehabilitation abgebauter Flächen. Programme wie der Strategic Business Plan des Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Bergbau zielen auf nachhaltige Industrialisierung und Innovationen ab. Initiativen wie der Forest Stewardship Council (FSC) setzen Standards für umweltfreundliche Praktiken, während Investitionen in Infrastruktur, wie der modernisierte Hafen, die Effizienz steigern. Bis 2030 könnte die Industrie durch Diversifikation, etwa in erneuerbare Energien oder hochwertige Lebensmittelverarbeitung, und eine stärkere Integration in globale Lieferketten weiter wachsen. Jamaikas Industrie bleibt somit ein dynamischer, wenn auch herausgeforderter Sektor mit Potenzial für nachhaltiges Wachstum.
Wasserwirtschaft
Die Wasserwirtschaft des Inselstaats wird von der National Water Commission (NWC) und dem Water Resources Authority (WRA) verwaltet, die unter dem Ministry of Economic Growth and Job Creation operieren. Diese Institutionen gewährleisten die Bereitstellung von sauberem Wasser, die Regulierung von Wasserquellen und die Förderung nachhaltiger Praktiken, während sie auf eine wachsende Nachfrage und Umweltprobleme reagieren.
Jamaika verfügt über reichliche Wasserressourcen, mit etwa 84 Flüssen, 10 hydrologischen Becken und bedeutenden Grundwasserreserven, die etwa 90 % des Trinkwasserbedarfs decken. Hauptquellen wie der Hope River, der Rio Cobre und die Black River sowie Grundwasserleiter in Kalksteinformationen versorgen städtische Zentren wie Kingston und Montego Bay sowie landwirtschaftliche Regionen. Etwa 93 % der städtischen Bevölkerung und 83 % der ländlichen Bevölkerung hatten 2023 Zugang zu Trinkwasser, doch etwa 30 % der Haushalte, insbesondere in abgelegenen Gebieten, sind nicht an das zentrale Wassernetz angeschlossen und nutzen Regenwasser oder lokale Quellen. Die Landwirtschaft, die 41 % der Landesfläche nutzt, verbraucht rund 75 % des verfügbaren Wassers, vor allem für den Anbau von Zuckerrohr, Bananen und Kaffee.
Die Wasserinfrastruktur umfasst Staudämme, wie den Mona Reservoir in Kingston, und Bewässerungssysteme, die von der National Irrigation Commission (NIC) verwaltet werden. Die NWC betreibt über 400 Wasseraufbereitungsanlagen und Pumpstationen, doch veraltete Leitungen verursachen Verluste von bis zu 50 % des behandelten Wassers durch Lecks. Abwasserentsorgung ist eine weitere Herausforderung: Nur etwa 20 % der Haushalte sind an ein Kanalisationssystem angeschlossen, und viele ländliche Gebiete nutzen Klärgruben, die oft unzureichend gewartet werden. Dies führt zu Grundwasserverschmutzung, insbesondere durch Bauxitabbau („Red Mud“) und landwirtschaftliche Abflüsse mit Pestiziden.
International wird die Wasserversorgung von diversen Klimaschutz-Organisationen und der Weltbank kritisch unter die Lupe genommen und ein Austrocknen des Landes in Aussicht gestellt. Die dafür als Basis genommenen Annahmen lassen sich faktisch jedoch nicht untermauern. Die Studie Long term trends in precipitation and temperature across the Caribbean (1901-2012) schlussfolgert, dass für Jamaika bzw. die Karibikregion kein klarer, signifikanter Trend für den Niederschlag durchgehend feststellbar ist. Es gebe Dekaden mit feuchteren Phasen und Dekaden mit trockeneren Phasen, aber kein gleichmäßiges Ansteigen oder Absinken über alle 100 Jahre. Auch die Befunde bezüglich einer Zunahme von Extremwetterereignissen haben Unsicherheiten bezüglich der Datenqualität.
Energiewirtschaft
Die Energiewirtschaft auf Jamaika ist geprägt von einer starken Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen, die etwa 80 Prozent der Stromerzeugung ausmachen, und einem ambitionierten Übergang zu erneuerbaren Energien, um Kosten zu senken und die Energieunabhängigkeit zu fördern (internationalen Vorgaben entsprechend wird auch der Klimawandel immer wieder ins Treffen geführt). Jamaika verbraucht jährlich etwa 3,7 TWh Strom, wobei der Tourismus, die Industrie und Haushalte die Hauptverbraucher sind. Die Jamaica Public Service Company (JPS), das staatlich regulierte Energieversorgungsunternehmen, betreibt ein Netz mit einer Kapazität von über 926 MW, das aus Öl-, Gas-, Diesel-, Hydro- und Windkraftanlagen besteht. Ergänzt wird dies durch unabhängige Stromerzeuger (IPPs) wie Jamaica Energy Partners und Wigton Wind Farm, die zusammen etwa 297 MW beisteuern. Trotz Fortschritten bleibt der Sektor anfällig für globale Ölpreisschwankungen und Hurrikane, was die Preise – die höchsten in der Karibik – in die Höhe treibt.
Der aktuelle Energiemix basiert zu rund 87 Prozent auf fossilen Brennstoffen, darunter Öl (über 80 Prozent) und zunehmend Flüssigerdgas (LNG), das seit 2020 importiert wird. Erneuerbare Energien machen derzeit etwa 12,5 Prozent aus, hauptsächlich durch Wind (rund 6 Prozent), Hydrokraft (zirka 3 Prozent) und Solar (rund 1 Prozent). Wichtige Anlagen sind der Wigton Wind Farm in Rose Hill mit 63 MW, der Paradise Park Solar Farm in Westmoreland mit 51 MWp und kleinere Hydroprojekte. Im Jahr 2024 stieg der Anteil der Erneuerbaren auf 12 Prozent, und bis Mai 2025 erreichte er 12,5 Prozent, was auf den Ausbau von 100 MW neuen Kapazitäten zurückzuführen ist. Jamaika produziert insgesamt etwa 5 Milliarden kWh Strom, was den Eigenbedarf von 3,7 Mrd. kWh übersteigt und Überschüsse exportiert.
Die Regierung treibt den Übergang durch die 2010 ins Leben gerufene National Energy Policy voran, die ursprünglich 20 Prozent Erneuerbare bis 2030 vorsah, aber 2018 auf 50 Prozent bis 2030 (und 33 Prozent bis 2025) angehoben wurde – ein Ziel, das Experten als ambitioniert, aber erreichbar betrachten. Der aktualisierte Integrated Resource Plan (IRP-2) von 2024 priorisiert Solar, Wind, Hydro und Batteriespeichersysteme (BESS) für Netzstabilität. Im November 2024 vergab die Generation Procurement Entity (GPE) 99,83 MW Solar an Wigton Energy und Sunterra Energy, die bis 2027 online gehen. Für 2025 sind weitere 220 MW Utility-Scale-Renewables mit Speicher geplant, ergänzt um 300 MW Ausschreibungen. Insgesamt sollen bis 2025 268 MW aus Erneuerbaren beschafft werden, darunter 320 MW Solar/Wind und 74 MW Hydro/Biomasse. Förderungen umfassen eine Senkung der Körperschaftsteuer für IPPs von 33,3 auf 25 Prozent bei mindestens 75 Prozent Erneuerbarenanteil sowie Net-Billing-Regulierungen, die den Verkauf von Überschussstrom erlauben.
Wirtschaftlich trägt der Energiesektor etwa 5–7 Prozent zum BIP bei, belastet aber durch Importkosten von über 1 Mrd. USD jährlich den Haushalt. Der Übergang zu Erneuerbaren verspricht Kosteneinsparungen von bis zu 20 Prozent, Job-Schaffung (Tausende in Solar- und Windprojekten) und Attraktivität für Investoren – Jamaika stieg 2024 im BloombergNEF Climatescope-Index um acht Plätze auf Rang 39 weltweit und 10. in der Karibik. Projekte wie der 200-MW-Solar-Ausbau in Spanish Town und Vernamfield sowie eine 300-Mio.-USD-Investition der JPS in 45 MW Solar unterstreichen den Schwung. Dennoch fordern Herausforderungen: Hohe Anfangsinvestitionen, Netzinfrastruktur-Upgrades, Speicherlösungen für intermittierende Quellen und soziale Auswirkungen auf fossile Jobs. Der Klimawandel verstärkt dies durch Stürme wie Beryl 2024, die Anlagen beschädigen. Kritik gibt es an Transparenzmängeln und Abhängigkeit von Privatinvestoren, die Profitabilität priorisieren.
Energieproduktion 2004/05
Produktion 6.985 mio. kWh
Verbrauch 6.429 mio. kWh
Verbrauch pro Person pro Jahr 2430,6 kWh
Abfallwirtschaft
Zuständig für Sammlung und Entsorgung ist die National Solid Waste Management Authority (NSWMA), die seit 2001 existiert. Trotz eines gesetzlichen Rahmens und erheblicher Investitionen – in den vergangenen fünf Jahren wurden rund 32 Milliarden jamaikanische Dollar ausgegeben – bleiben viele Probleme ungelöst.
Jährlich fallen auf der Insel fast eine Million Tonnen Festmüll an, darunter große Mengen Plastik, die nicht nur im Inland, sondern auch durch den Tourismus entstehen. Ein erheblicher Teil dieser Abfälle gelangt aufgrund unzureichender Sammel- und Entsorgungsstrukturen in Flüsse, an Strände oder ins Meer. Die bestehenden Deponien wie Riverton oder Retirement entsprechen oft nicht internationalen Standards; es fehlen Abdichtungen, Systeme zur Gas- oder Sickerwasserbehandlung, wodurch Boden, Wasser und Luft belastet werden.
Hinzu kommt, dass die Müllabfuhr in manchen Regionen unregelmäßig oder gar nicht funktioniert. Fehlen die Sammelfahrzeuge, greifen Bewohner häufig auf illegales Ablagern oder Verbrennen zurück – mit negativen Folgen für Gesundheit und Umwelt. Gleichzeitig ist Recycling noch wenig etabliert, Abfalltrennung meist auf Pilotprojekte beschränkt, und das Bewusstsein für Abfallvermeidung wächst nur langsam.
Die Regierung hat allerdings erste Schritte unternommen: Einwegplastik und Styropor wurden verboten, es laufen Pilotprojekte zur Mülltrennung in Städten wie Montego Bay, und die Flotte der Sammelfahrzeuge wurde erweitert. Zudem ist ein umfassendes „Total Waste Management System“ in Planung, das neue Transferstationen, eine moderne Abfall-zu-Energie-Anlage und den schrittweisen Ersatz alter Deponien durch ein saniertes, umweltgerechtes Endlager vorsieht.
Handel
Während der internationale Handel durch Exporte wie Bauxit, Aluminiumoxid und landwirtschaftliche Produkte geprägt ist, dominiert der nationale Handel den Einzel- und Großhandel mit Fokus auf Importe und lokalen Verbrauch. Ergänzt wird dies durch moderne Einkaufszentren, die Tourismus und Retail verbinden. Trotz eines chronischen Handelsdefizits – das 2024 auf 5,421 Milliarden USD sank – trägt der Sektor etwa 73 % zum BIP bei und schafft Tausende Jobs. Im Folgenden ein Überblick basierend auf aktuellen Daten.
Jamaikas internationaler Handel ist stark exportorientiert, mit einem Fokus auf Rohstoffe und Agrarprodukte, während Importe Verbrauchsgüter und Maschinen umfassen. Die USA sind der größte Partner mit über 40 % des Gesamthandels, gefolgt von China, Brasilien, Japan und Kolumbien. 2024 beliefen sich die Exporte auf etwa 1,901 Millionen USD (in Tausend USD), hauptsächlich Bauxit, Aluminiumoxid, Rum, Kaffee und Bananen, während Importe bei 7,731 Millionen USD lagen – ein Defizit von 5,830 Millionen USD. Die Top-Exportziele waren die USA (mit einem Zuwachs von 20 % auf 1,390 Millionen USD), Russland, Niederlande, Kanada und Island. Importe umfassen Nahrungsmittel, Kraftstoffe, Maschinen und Konsumgüter, wobei der Verbrauch für den Tourismus (30 % des BIP) und die Industrie hoch ist. Jamaika profitiert von Freihandelsabkommen wie CARICOM und dem CAFTA-DR, was den Zugang zu Märkten in der Karibik und den USA erleichtert. Der Sektor wird vom Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade (MFAFT) und JAMPRO gefördert, mit Prognosen für ein moderates Wachstum bis 2025 durch Diversifikation in Dienstleistungen wie Tourismus-Exporte (4,5 Milliarden USD im Jahr).
Daten für 2015:
Export Import
USA 44,99 % USA 43,69 %
Niederlande 12,00 % Japan 6,29 %
Kanada 9,59 % China 6,27 %
Island 3,88 % Trinidad & Tobago 5,14 %
Russland 3,75 % Kolumbien 4,86 %
Frankreich 1,99 % Mexiko 3,64 %
Georgien 1,60 % Nigeria 2,08 %
China 1,42 % Deutschland 2,08 %
Hongkong 1,35 % Thailand 1,98 %
Kamerun 1,34 % Kanada 1,68 %
Ghana 1,30 % Dominik. Republik 1,64 %
Trinidad & Tobago 1,30 % Panama 1,58 %
Barbados 1,11 % Brasilien 1,36 %
Kaimaninseln 1,10 % Indien 1,05 %
Arabische Emirate 1,09 % Costa Rica 1,00 %
Gibraltar 1,00 % Frankreich 0,91 %
Japan 0,94 % Türkei 0,87 %
Mexiko 0,76 % Niederlande 0,86 %
Venezuela 0,74 % Spanien 0,80 %
Saint Lucia 0,70 % Irland 0,78 %
Guyana 0,70 % Guyana 0,72 %
Antigua & Barbuda 0,56 % Surinam 0,70 %
Surinam 0,44 % Venezuela, Guatemala je 0,67 %
Der nationale Handel, der den Inlandsmarkt umfasst, dreht sich um den Einzel- und Großhandel, der stark von Importen abhängt und durch Distributoren, Agenten und Endverbraucher organisiert wird. Der Retail-Sektor ist dynamisch, mit über 2.500 Unternehmen, die von Supermärkten über kleine Läden bis zu Online-Plattformen reichen. Der E-Commerce boomt dank hoher Mobilfunkpenetration (über 100 %) und Diensten wie dem MultiLink-Netzwerk für Zahlungen, das 1,86 Millionen Debitkarten abdeckt. Lokale Produkte wie Rum, Kaffee und Handwerkskunst werden über Märkte und Geschäfte vertrieben, während Importe (zum Beispiel Elektronik, Kleidung) den Löwenanteil ausmachen. Der Großhandel konzentriert sich auf Häfen wie Kingston, von wo aus Waren per Lkw verteilt werden. Herausforderungen sind hohe Energiekosten und Wettbewerb, doch Reformen seit 2013 (IMF-Programme) haben die Wirtschaft stabilisiert: Schuldenquote sank auf 90 % des BIP, Arbeitslosigkeit auf 4,5 %. Der Handel schafft Jobs in ländlichen Gebieten und unterstützt den Tourismus durch Souvenirläden. JAMPRO fördert lokale Exporte und Investitionen, um den Sektor resilienter zu machen.
Einkaufszentren (Shopping Malls) sind Hotspots für Retail und Tourismus, die Luxus, lokale Produkte und Unterhaltung verbinden. Sie sind vor allem in Touristenorten wie Montego Bay und Ocho Rios konzentriert, mit Fokus auf Duty-Free-Shops und Handwerk. Beliebte Zentren umfassen
:
- Main Street Rose Hall (Montego Bay): Das Top-Mall Jamaikas (TripAdvisor-Rang 1), mit Luxusmarken wie Cartier, Dior und Chanel, sowie lokalen Souvenirs, Uhren und Schmuck. Es bietet Restaurants, Rum-Tastings und interaktive Murals – ideal für Touristen.
- City Centre Shopping Mall (Montego Bay): Zentrales Einkaufszentrum mit Mode, Elektronik, Apotheken und Food Courts; praktisch für Alltagsbedarf und in der Nähe des Flughafens.
- Pavilion Mall (Kingston): Sicheres, vielfältiges Zentrum mit Kleidung, Büchern, Elektronik und Banken; beliebt bei Einheimischen für regionale Küche und Bequemlichkeit.
- Times Square Mall (Negril): Duty-Free-Optionen für Souvenirs, Badebekleidung und Accessoires; günstig und touristenfreundlich.
- Sovereign Centre (Kingston): Exklusives Mall mit Kindermode, Haushaltswaren, Supermarkt und Apotheke; bietet ein premium Einkaufserlebnis.
- Taj Mahal Shopping Center (Ocho Rios): Kleineres Zentrum mit Währungsumtausch und ATM; gut für schnelle Einkäufe.
Finanzwesen
Der Jamaika-Dollar ist die Währung Jamaikas und wird von der Bank of Jamaica ausgegeben. 1 Dollar ist in 100 Cent unterteilt. Banknoten gibt es in den Stückelungen 50, 100, 500 und 1000 Dollar, Münzen in den Werten 1, 10 und 25 Cent sowie 1, 5, 10 und 20 Dollar. Letztere ähnelt stark der 1-Euro-Münze. Umgangssprachlich wird der Jamaika-Dollar auch als „Jay“ bezeichnet. Das ist besonders für Touristen hilfreich, da die inoffizielle Zweitwährung des Landes der US-Dollar ist und so Verwechslungen ausgeschlossen werden können. Am 30. Januar 1968 beschloss das Repräsentantenhaus, die Währung zu dezimalisieren und das dem Pfund Sterling entsprechende jamaikanische Pfund (Jamaican pound) durch den Jamaika-Dollar zu ersetzen. Ab dem 8. September 1969 wurden die auf den Jamaika-Dollar lautenden Banknoten und Münzen ausgegeben.
Finanzwesen:
Währung: 1 Jamaika-Dollar (Jamaican Dollar) = 100 Cent
Kürzel: J$
ISO-Code: JMD
Wechselkurs:
26.9.2009 1 EUR = 130,4 JMD 100 JMD = 0,76687 EUR
4.12.2010 1 EUR = 113,95 JMD 100 JMD = 0,87756 EUR
3.9.2011 1 EUR = 120,78 JMD 100 JMD = 0,82799 EUR
6.5.2012 1 EUR = 112,91 JMD 100 JMD = 0,88569 EUR
11.3.2016 1 EUR = 139,87 JMD 100 JMD = 0,71498 EUR
20.3.2018 1 EUR = 154,53 JMD 100 JMD = 0,64714 EUR
3.2.2019 1 EUR = 151,11 JMD 100 JMD = 0,66177 EUR
23.12.2020 1 EUR = 172,89 JMD 100 JMD = 0,57841 EUR
23.2.2023 1 EUR = 164,7 JMD 100 JMD = 0,60717 EUR
Oberste Aufsichtsbehörde des Finanzsektors ist die Bank of Jamaica, die 1961 gegründet wurde und als Zentralbank für die Geldpolitik, die Preisstabilität und die Regulierung der Finanzmärkte verantwortlich ist. Sie steuert den jamaikanischen Dollar, überwacht die Inflation und sorgt dafür, dass das Finanzsystem liquide und stabil bleibt.
Der Banken- und Finanzsektor Jamaikas setzt sich aus einer Reihe von Geschäftsbanken, Merchant Banks, Kreditinstituten sowie Finanzgesellschaften zusammen. Viele der großen Institute – wie National Commercial Bank (NCB), Scotiabank Jamaica, Sagicor Bank oder FirstCaribbean International Bank – sind sowohl national als auch regional aktiv. Neben den Geschäftsbanken gibt es auch Kreditgenossenschaften (credit unions), die besonders für die Finanzierung kleinerer Unternehmen und privater Haushalte eine wichtige Rolle spielen.
Das jamaikanische Finanzwesen ist eng mit internationalen Märkten verbunden. Ausländische Direktinvestitionen, Rücküberweisungen aus der Diaspora sowie Tourismus- und Bauxit-Einnahmen beeinflussen die Finanzströme erheblich. Seit den 1990er Jahren hat Jamaika tiefgreifende Strukturreformen und Deregulierungen im Finanzsektor durchgeführt, nachdem eine Bankenkrise zu Instabilität und Vertrauensverlust geführt hatte. Heute gilt das Bankensystem als vergleichsweise stabil, unterliegt aber weiterhin Schwankungen durch externe Faktoren wie Rohstoffpreise, Naturkatastrophen oder globale Krisen.
Ein wichtiges Thema ist die Finanzinklusion: Viele Jamaikaner, insbesondere in ländlichen Gebieten, haben keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu klassischen Bankdienstleistungen. Deshalb fördern Regierung und Banken den Ausbau digitaler Zahlungsdienste, Online-Banking und mobiler Finanzlösungen. Gleichzeitig gewinnt die Regulierung im Bereich Fintech an Bedeutung, da neue Anbieter innovative, aber auch risikobehaftete Dienstleistungen auf den Markt bringen.
Soziales und Gesundheit
In sozial ausgegrenzten Innenstadtvierteln wurden 2008 sowohl zahlreiche Morde begangen als auch viele Tötungsdelikte durch Polizisten verübt. Um die Sicherheitskrise zu meistern, nahm die Regierung einige Reformen des Polizei- und Justizsystems in Angriff. Frauen und Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen lebten, waren weit verbreiteter Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt. Mindestens eine Person wurde zum Tode verurteilt, Hinrichtungen fanden jedoch nicht statt.
Die Krise der inneren Sicherheit führte Berichten zufolge zur Ermordung von 1611 Menschen. Die Mehrzahl der Opfer stammte aus marginalisierten Innenstadtvierteln. Eine große Anzahl von Entwürfen zu sogenannten Anti-Verbrechens-Gesetzen wartete zum Jahresende auf die Verabschiedung durch das Parlament. Zu diesem Gesetzespaket gehörten die Erweiterung der Polizeibefugnisse zur Festnahme, Verlängerungen der Kautionszeiten sowie die Anhebung von Mindeststrafen für Verbrechen mit Schusswaffengebrauch. Nationale Menschenrechtsorganisationen stellten die Verfassungsmäßigkeit einiger Bestimmungen dieser Gesetze infrage und gaben ihrer Sorge Ausdruck, dass die vorgesehenen zusätzlichen Befugnisse von Polizei und Justiz Missbrauch zur Folge haben könnten. Die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte besuchte Jamaika im Dezember. In ihren vorläufigen Bemerkungen bekundete die Kommission, dass sie „ein alarmierendes Ausmaß der Gewalt“, die alle Bereiche der Gesellschaft beträfe, vorgefunden habe. Die Kommission wies darauf hin, dass anhaltende Defizite bei den Sicherheitskräften und im Justizsystem sowie weit verbreitete Korruption und Armut die hauptsächlichen Gründe für die sich zunehmend verschlechternde Situation der inneren Sicherheit seien.
Das Durchschnittsalter liegt bei 23 Jahren, etwa ein Drittel der Bevölkerung ist jünger als 14 Jahre. Lediglich 7,3 % haben das 64. Lebensjahr vollendet. Damit ist die Bevölkerung im Vergleich zu den meisten Industriestaaten sehr jung. Von 1000 lebend geborenen Kindern sterben im Durchschnitt 16, die Lebenserwartung liegt zurzeit für Frauen bei 75 und für Männer bei 71 Jahren. Das Bevölkerungswachstum hat sich seit 1960 von 1,6 % auf 0,5 % im Jahr 2005 reduziert, es ist also zu erwarten, dass sich das Durchschnittsalter in Zukunft erhöhen wird, auch weil viele junge Menschen die Insel verlassen.
In Jamaika sind hygienebedingte Krankheiten, aber auch Aids und Tuberkulose ein Problem. Malaria gibt es hier auch, allerdings selten. Ganzjährig werden vereinzelte Malariaerkrankungen auf Jamaika registriert. Grundsätzlich besteht in Jamaika jedoch ein sehr geringes Malariarisiko. Im Jahr 2009 wurden insgesamt 11 bestätigte Malaria tropica-Fälle in Portmore registriert. Seit 2006 treten auf der Insel wieder Malaria-Fälle auf. Rund 370 Malariafälle wurden im Jahr 2007 berichtet. Seit 1965/66 wurden auf Jamaika keine Malariafälle mehr registriert. Dem Wiederauftreten der Infektionskrankheit und der weiteren Ausbreitung versuchen die Gesundheitsbehörden seither durch umfangreiche Mückenbekämpfungsmaßnahmen entgegenzuwirken. Bei allen Erkrankungsfällen handelte es sich um die so genannte Malaria tropica - die gefährlichste Form der Malaria. Nach Angaben des lokalen Gesundheitsministeriums wurden die Fälle in der Region Greenwich, einem Stadtteil von Kingston registriert. Auch außerhalb der Stadt in den umliegenden Gemeinden von St. Catherine und Carendon wurden in den letzten Jahren Malariafälle gemeldet. Reisenden wird eine reisemedizinische Beratung durch einen Arzt rechtzeitig vor der Reise empfohlen. In einer gründlichen Nutzen-Risiko Abwägung kann dort in einem persönlichen Gespräch die richtige Malariaprophylaxe individuell festgelegt werden.
Das Gesundheitswesen des Landes steht unter der Aufsicht des Ministry of Health and Wellness steht. Die Regierung verfolgt das Prinzip einer universellen Basisversorgung, die für alle Bürger kostenfrei in staatlichen Einrichtungen zugänglich ist. Öffentliche Krankenhäuser und Gesundheitszentren bilden daher das Rückgrat der medizinischen Versorgung. Sie werden größtenteils über Steuermittel finanziert und sollen eine flächendeckende Grundversorgung sicherstellen.
Trotz dieses Prinzips steht der Gesundheitssektor vor erheblichen Herausforderungen. Viele öffentliche Einrichtungen leiden unter chronischer Unterfinanzierung, was sich in Engpässen bei Personal, Medikamenten und Medizintechnik niederschlägt. Lange Wartezeiten und Überlastung in Krankenhäusern sind keine Seltenheit, insbesondere in den großen Ballungszentren wie Kingston oder Montego Bay. Ein Teil der Bevölkerung weicht daher auf private Kliniken und Arztpraxen aus, die meist besser ausgestattet sind, aber kostenpflichtig und für ärmere Haushalte schwer zugänglich bleiben.
Ein wachsendes Problem ist zudem die Abwanderung von Fachpersonal: Viele gut ausgebildete Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte wandern aufgrund besserer Arbeitsbedingungen nach Nordamerika oder Europa aus, was den Fachkräftemangel im Land verschärft. Die Regierung versucht, durch Ausbildungsprogramme, Anreizsysteme und internationale Kooperationen gegenzusteuern, doch die Versorgungslücken bleiben sichtbar.
Auf der positiven Seite gibt es eine zunehmende Hinwendung zu Gesundheitsförderung und Prävention. Kampagnen gegen Tabak- und Alkoholkonsum, für gesunde Ernährung und körperliche Aktivität sollen die hohen Raten von Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Auch Programme im Bereich Mutter-Kind-Gesundheit und Impfungen zeigen Erfolge: Die Kindersterblichkeit ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gesunken, und das Land hat hohe Impfraten bei gängigen Kinderkrankheiten erreicht.
Krankheiten
Was Krankheiten betrifft, so bestehen zum einen Probleme mit Infektionskrankheiten wie Dengue-Fieber, Chikungunya oder neuerdings Zika, die durch tropische Bedingungen und Mückenüberträger begünstigt werden. Zum anderen nehmen nichtübertragbare Krankheiten (NCDs) wie Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs stark zu. Diese „doppelte Krankheitslast“ belastet das System erheblich, da Prävention, Langzeitbehandlung und Akutversorgung parallel sichergestellt werden müssen.
Malaria spielt auf Jamaika heute praktisch keine Rolle mehr, da die Krankheit seit Jahrzehnten weitgehend unter Kontrolle ist. Durch gezielte Bekämpfungsprogramme, darunter Mückenbekämpfung, Entwässerung von Brutgebieten und Gesundheitskampagnen, gelang es der Regierung in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Übertragung einzudämmen. Bereits in den 1960er Jahren erklärte die WHO Jamaika offiziell für malariafrei. Seither gibt es keine dauerhaft zirkulierende Malaria auf der Insel. In seltenen Fällen wurden in den letzten Jahrzehnten importierte Malariafälle registriert – also Erkrankungen bei Personen, die sich außerhalb Jamaikas infiziert und die Krankheit dann ins Land gebracht haben. Diese Fälle blieben jedoch Einzelfälle und führten nicht zu einer erneuten lokalen Ausbreitung.
Bildung
Bis zum Ende der Sklaverei im 19. Jahrhundert gab es kein flächendeckendes Schulsystem. Vor der Unabhängigkeit wurde zwar eine Reihe von Schulen aufgebaut; viele Kinder, besonders aus den armen Bevölkerungsschichten, konnten sie aber nicht besuchen. Erst in den 1970er Jahren wurden die Schulen für den Großteil der Bevölkerung zugänglich.
Die Grundschule kann kostenlos besucht werden, für eine weitere Ausbildung muss ein Schulgeld entrichtet werden. Eine allgemeine Schulpflicht besteht nicht. Das Bildungssystem ist zentralisiert, Lehrpläne und Schulbuchlisten werden vom Bildungsministerium vorgegeben. Die Alphabetisierungsrate Jamaikas liegt bei 79,9 %, verglichen mit der restlichen Karibik eher ein schlechter Wert. Analphabeten sind vor allem unter den Erwachsenen zu finden.
Die Schulpflicht umfasst Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren (Primary Education). Lediglich Vorschulen oder Kindergärten sind flächendeckend vorhanden, 86,8 % der Drei- bis Fünfjährigen besucht eine solche Einrichtung. Der Anteil der Sechs- bis Elfjährigen, die die Grundschule besuchen liegt bei 98,9 %. Nach der sechsten Klasse folgt ein Leistungstest, der entscheidet, ob eine weiterführende Schule besucht werden kann.
Konkret setzt sich das jamaikanische Schulsystem wie folgt zusammen:
- Early Childhood Education: Vorschulen und Kindergärten für Kinder von 3 bis 5 Jahren.
- Primary Education (Grades 1–6): Pflichtschulzeit von 6 bis 11 Jahren. Am Ende steht die Teilnahme an standardisierten Tests (Primary Exit Profile – PEP).
- Secondary Education (Grades 7–11/13): Untere und obere Sekundarstufe. Schülerinnen und Schüler legen am Ende nationale Prüfungen ab, z. B. CSEC (Caribbean Secondary Education Certificate) oder CAPE (Caribbean Advanced Proficiency Examination).
- Tertiary Education: Universitäten, Colleges und Fachhochschulen, darunter die renommierte University of the West Indies (UWI), das University of Technology (UTech) sowie Lehrerausbildungs- und Fachhochschulinstitute.
Der Zugang zur Grundschule ist nahezu flächendeckend: Die Einschulungsrate liegt sehr hoch, und die Alfabetisierungsrate beträgt über 85 %. Dennoch zeigen sich bei der Qualität der Ausbildung Unterschiede. In ländlichen Gebieten fehlt es häufig an ausreichend ausgebildeten Lehrkräften, an moderner Ausstattung und an Lernmaterialien. Auch die Klassengrößen sind teilweise groß.
Ein wiederkehrendes Problem ist die Abbruchquote in der Sekundarstufe. Viele Jugendliche verlassen die Schule vorzeitig, oft aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten, um ihre Familien zu unterstützen. Damit sinken ihre Chancen auf weiterführende Bildung und qualifizierte Arbeitsplätze.
Neben staatlichen Schulen gibt es eine Vielzahl privater und konfessioneller Schulen, die häufig eine bessere Ausstattung bieten, jedoch Gebühren verlangen. Die Diaspora trägt ebenfalls zur Finanzierung bei - viele Schulen profitieren von Spendenprogrammen und Partnerschaften mit jamaikanischen Gemeinden im Ausland.
In den letzten Jahren wird verstärkt in digitale Bildungstechnologien investiert, insbesondere seit der COVID-19-Pandemie. Gleichzeitig steht die Verbesserung von Lehrerausbildung, Schulmanagement und frühkindlicher Bildung im Fokus. Ziel ist es, die Lernleistungen nachhaltig zu verbessern und die Kluft zwischen städtischen und ländlichen Regionen zu verringern.
Höhere Bildung
Auf Jamaika gibt es eine ganze Reihe angesehener Highschools und Colleges entwickelt, die von 84,1 % eines Jahrgangs besucht werden. Neun von zehn Schülern erhalten nach fünf bis sieben Jahren einen Abschluss. Die bekannteste Hochschule der Insel ist die 1948 gegründete University of the West Indies, die eine ihrer Zweigstellen in einem Vorort von Kingston unterhält. Besonders angesehen ist sie wegen ihrer medizinischen Fakultät. Dazu kommen unter anderem die Technische Universität, die Northern Caribbean University und das University College of The Caribbean. Zusammen studieren etwa 44.000 Menschen im Land.
Hochschulen und Universitäten:
Universities
- University of the West Indies
- University of Technology (U-Tech)
- Mico University College
- Northern Caribbean University (NCU)
- University College of The Caribbean (UCC)
- International University of the Caribbean (IUC)
- Caribbean Institute of Technology (CIT)
- Colbourne College
- B&B University College
- Caribbean Aerospace College
- Western Hospitality Institute
- Caribbean Aviation Training Center
- Caribbean Maritime Institute (CMI)
- Khanan University
Teacher Training Colleges (insgesamt 12)
- Bethlehem Moravian College
- Sam Sharpe Teachers College
- Shortwood Teacher College
- Churches Teachers College
- Catholic College of Mandeville
- Community Colleges (insgesamt 14)
- Knox Community College {Cobbla}
- Knox Community College {Mandeville}
- Knox Community College {May Pen}
- Knox Community College {Spalding}
- Saint John's College {Nursing}
- Moneague Community College {St. Mary}
- Portmore Community College Portmore
- Portmore Community College Old Harbour
- Undergrad College Montego Bay
Sonstige Colleges
- Durham College of Commerce (Kingston, Jamaica)
- Edna Manley College of Visual and Performing Arts )
- College of Agriculture, Science and Education (CASE)
- G. C. Foster College of Physical Education and Sports
- United Theological College of the West Indies
- Brown's Town Community College
- Midland Bible Institute
- Montego Bay Community College (MBCC)
- Monegue Teachers College
- Bethel Bible College
- Caribbean Graduate School of Theology
- Catholic College of Mandeville
- College of Insurance and Professional Studies
- Crowne Professional College
- Jamaica Bible College
- Jamaica Theological Seminary
- Management Institute for National Development
- Mel Nathan College
- Vector Technology Institute
- Vocational Training Development Institute
Sonstige Institutionen
- 1 dental auxiliary school
- 1 Vocational Training Development Institute
- 29 vocational training centres
- 6 Human Employment and Resources Training (HEART) Institutions
Die University of the West Indies (UWI) ist die führende Universität Jamaikas und eine der bedeutendsten Hochschulen der Karibik. Der Campus in Jamaika befindet sich in Mona, einem Stadtteil von Kingston, und ist Teil eines regionalen Systems, das weitere Standorte in Trinidad und Tobago, Barbados und anderen karibischen Ländern umfasst.
Der Mona-Campus wurde 1948 gegründet und spielt seitdem eine zentrale Rolle in Bildung, Forschung und wissenschaftlicher Entwicklung in Jamaika und der gesamten Karibik. Die Universität bietet Studiengänge in Bereichen wie Natur- und Ingenieurwissenschaften, Medizin, Geistes- und Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht an. Besonders bekannt ist sie für die Fakultät für Medizin, die zahlreiche Fachkräfte für das Gesundheitssystem der Region ausbildet.
Die UWI ist nicht nur eine Bildungseinrichtung, sondern auch ein Zentrum für Forschung und Innovation. Sie arbeitet eng mit internationalen Universitäten zusammen und leistet Beiträge in Bereichen wie Tropenmedizin, Karibik-Studien, Umweltforschung und Wirtschaftsentwicklung. Der Campus bietet zudem kulturelle und sportliche Aktivitäten, Studentenorganisationen und Community-Programme, die das soziale und kulturelle Leben der Studierenden bereichern.
Bibliotheken und Archive
Zentrale Institution ist die National Library of Jamaica (NLJ), die 1979 aus der West India Reference Library hervorging. Sie ist die wichtigste Sammelstelle für das schriftliche Kulturerbe des Landes und beherbergt Manuskripte, Zeitungen, Karten, Fotografien, Tonaufnahmen und digitale Bestände zur Geschichte und Kultur Jamaikas. Ihre Aufgabe ist nicht nur die Archivierung, sondern auch die Bereitstellung von Ressourcen für Forschung, Bildung und Öffentlichkeit. Daneben nimmt das Jamaica Archives and Records Department (JARD) eine Schlüsselrolle ein. Dieses staatliche Archiv existiert seit 1955 und bewahrt Regierungs- und Verwaltungsdokumente vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Es dient sowohl der historischen Forschung als auch der Verwaltungstransparenz.
Das Bibliothekswesen selbst ist landesweit über die Jamaica Library Service (JLS) organisiert. Dieses System wurde bereits 1948 gegründet und betreibt ein Netz von öffentlichen Bibliotheken und mobilen Bibliotheksdiensten, die besonders ländliche Gemeinden versorgen. Ziel ist es, allen Bürgerinnen und Bürgern kostenlosen Zugang zu Büchern, Information und Weiterbildung zu ermöglichen. Die JLS bietet darüber hinaus spezielle Programme zur Förderung von Lesekompetenz bei Kindern und Erwachsenen, organisiert kulturelle Veranstaltungen und baut digitale Angebote kontinuierlich aus.
Neben diesen staatlichen Einrichtungen spielen auch Universitäts- und Fachbibliotheken eine große Rolle. An erster Stelle steht die Bibliothekssystem der University of the West Indies (UWI), Campus Mona, die umfangreiche wissenschaftliche Sammlungen, Spezialsammlungen zur Karibikforschung und digitale Ressourcen bereitstellt. Auch die University of Technology (UTech) sowie verschiedene Teacher’s Colleges und Fachhochschulen unterhalten eigene Bibliotheken.
Kultur
Die Herkunft der Jamaikaner aus fast allen Teilen der Erde führte in allen Bereichen zu einer sehr abwechslungsreichen Kulturszene. Besonders auffällig sind afrikanische Einflüsse, aber auch europäische und asiatische Traditionen haben sich ausgewirkt. Unter der Kolonialherrschaft war die Entwicklung einer eigenen Kultur kaum möglich, sie setzte erst Anfang des 20. Jahrhunderts ein.
Museen
Die wohl bekannteste und meist besuchte Einrichtung ist ist das Bob Marley Museum in Kingston, das ehemalige Wohn- und Aufnahmesstudio des Reggae-Ikons von 1975 bis zu seinem Tod 1981 beherbergt. Hier erfährt man alles über Marleys Leben, seine Musik und die Gründung des Tuff Gong Labels – von Führungen durch das Haus bis hin zu Audioaufnahmen und Memorabilien. Es ist ein Muss für Musikfans und symbolisiert Jamaikas globalen kulturellen Einfluss. Ähnlich ikonisch ist das Peter Tosh Museum, das dem anderen Reggae-Pionier gewidmet ist und seine Erbschaft durch Ausstellungen und ein Mausoleum ehrt. In der Nähe liegt das Institute of Jamaica mit der National Gallery of Jamaica, die seit 1974 jamaikanische und karibische Kunst präsentiert, darunter zeitgenössische Werke und temporäre Ausstellungen zu Themen wie Identität und Umwelt. Der Eintritt ist oft kostenlos am letzten Sonntag im Monat, was den Zugang für Einheimische erleichtert.
Mit der Geschichte des Landes beschäftigt sich in erster Linie das National Museum Jamaica, eine Abteilung des IOJ. Mit über 30.000 Artefakten spannt es den Bogen von der Taíno-Zeit bis heute, inklusive afrikanischer Einflüsse wie Yoruba-Kola-Nuss-Schalen und kolonialer Relikte. Es bietet Outreach-Programme für Schulen und Communities, um die Geschichte lebendig zu machen. Das People's Museum of Craft and Technology, ebenfalls unter dem IOJ, beleuchtet die Kreativität emanzipierter Jamaikaner nach 1838, mit Exponaten zu Handwerk und Technologien in ehemaligen Sklavendörfern. In Montego Bay präsentiert das Museum of St. James lokale Geschichte, während das Jamaica Military Museum & Library in Up Park Camp (und Newcastle) Uniformen, Waffen und Memorabilien aus Jahrhunderten militärischer Vergangenheit zeigt, von Kolonialkämpfen bis zu Friedensmissionen.
Ebenfalls von Bedeutung sind Plantagen und koloniale Stätten. Das Rose Hall Great House in Montego Bay, ein stattliches georgianisches Gebäude, erzählt von der Plantagenzeit mit Geistergeschichten um die Besitzerin Annie Palmer und bietet Panoramablicke auf die Küste. Das Devon House in Kingston, eine restaurierte Villa aus dem 19. Jahrhundert, widmet sich dem Leben des Unternehmers George Stiebel und beherbergt heute eine Eisdiele und Gärten – ein Symbol für schwarzen Wohlstand. Das Firefly in St. Mary, das Zuhause des Künstlers Ian Fleming, enthüllt Geheimnisse der James-Bond-Schöpfung. Weitere sehenswerte Museen sind das Columbus Park Museum in Discovery Bay mit Taíno-Artefakten und dem Fokus auf Christoph Kolumbus' Landung sowie das kommende Port Royal Museum, das die versunkene Piratenstadt von 1692 mit geborgenen Schätzen beleuchten wird.
Der Coyaba River Garden and Museum in Ocho Rios ist eine Kombination aus tropischem Garten, Wasserlandschaft und kulturhistorischem Museum. Besucher spazieren durch üppige Vegetation mit exotischen Pflanzen, kleinen Wasserfällen und natürlichen Pools. Das Museum im Herzen des Gartens präsentiert Artefakte und Ausstellungen zur Geschichte der Insel – von der Taíno-Kultur über die Kolonialzeit bis hin zum Leben der Maroons. Ebenfalls in Ocho Rios befindet sich das Reggae Xplosion Museum, das der jamaikanischen Musik gewidmet ist. Es beleuchtet die Entstehung und Entwicklung von Reggae, Rocksteady und Dancehall und stellt die bedeutendsten Künstler, darunter Bob Marley, Peter Tosh oder Jimmy Cliff, in den Mittelpunkt.
Das People's Museum of Craft & Technology in Spanish Town konzentriert sich auf die Alltags- und Kulturgeschichte Jamaikas. Es zeigt Handwerkskunst, Werkzeuge und Technologien aus verschiedenen Epochen – von den indigenen Völkern über die Plantagenwirtschaft bis hin zum modernen Jamaika.
Die Hope Botanical Garden and Zoo in Kingston, oft einfach „Hope Gardens“ genannt, ist der größte botanische Garten der Karibik und ein beliebtes Erholungsgebiet. Er wurde im 19. Jahrhundert angelegt und umfasst weitläufige Grünflächen mit Palmen, Orchideen, Bambus und anderen tropischen Pflanzen. Angeschlossen ist ein Zoo, in dem sowohl einheimische Tiere wie das Jamaika-Boa und die Manatee als auch exotische Arten zu sehen sind.
Architektur
Die Architektur reicht von den einfachen Hütten der Taíno über prächtige Plantagenhäuser der Kolonialzeit bis hin zu modernen Resorts und urbanen Entwicklungen in Städten wie Kingston und Montego Bay. Sie ist nicht nur funktional, sondern auch ein Ausdruck der jamaikanischen Identität, die afrikanische, europäische und karibische Elemente vereint.
Die frühesten Spuren der Architektur stammen von den Taíno, den indigenen Bewohnern Jamaikas, die vor der Ankunft von Christoph Kolumbus 1494 einfache, runde Hütten aus Holz und Stroh bauten, sogenannte bohíos. Diese Strukturen waren an das tropische Klima angepasst, mit offenen Wänden für Ventilation und erhöhten Böden gegen Feuchtigkeit. Mit der spanischen Kolonisierung (1509 bis 1655) entstanden erste Steinbauten, wie Kirchen und Festungen, etwa in Port Royal, das bis zu seinem Erdbeben 1692 ein Handelszentrum war.
Die britische Kolonialzeit (1655 bis 1962) prägte die Insel nachhaltig mit der georgianischen Architektur, die sich in Plantagenhäusern wie dem Rose Hall Great House in Montego Bay zeigt. Diese Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, oft aus Kalkstein und Holz, weisen symmetrische Fassaden, große Veranden und hohe Decken auf, um die Hitze zu regulieren. Devon House in Kingston, erbaut 1881 von George Stiebel, ist ein weiteres Beispiel für koloniale Eleganz mit jamaikanischen Verzierungen wie Jalousien und Holzschnitzereien.
Die Architektur der versklavten Bevölkerung und ihrer Nachkommen spiegelt sich in einfachen, funktionalen Strukturen wider, wie den Hütten in den „Free Villages“, die nach der Emanzipation 1838 entstanden. Diese nutzten lokale Materialien wie Lehm, Holz und Stroh, oft mit afrikanischen Bautechniken wie Flechtwänden. Die Rastafari-Kultur brachte später farbenfrohe, eklektische Designs mit Symbolen in Rot, Gelb und Grün, die bis heute in informellen Siedlungen sichtbar sind.
Die moderne Architektur Jamaikas entwickelte sich nach der Unabhängigkeit 1962, mit einem Fokus auf Funktionalität und touristische Attraktivität. In Städten wie Kingston entstanden Betonbauten, darunter Verwaltungsgebäude und Hochhäuser wie die Bank of Jamaica oder das New Kingston Business District, das moderne Skylines prägt. Die Tourismusindustrie, die etwa 30 % des BIP ausmacht, trieb den Bau von Resorts und Hotels voran, insbesondere in Montego Bay, Negril und Ocho Rios. Diese Gebäude nutzen tropische Designelemente wie offene Räume, große Fenster und pastellfarbene Fassaden, um die karibische Ästhetik mit Komfort zu verbinden. Beispiele sind das Half Moon Resort oder das Sandals Royal Caribbean, die luxuriöse Architektur mit nachhaltigen Materialien wie lokalem Holz kombinieren.
Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung, da der Klimawandel und Hurrikane wie Beryl 2024 die Bauweise beeinflussen. Moderne Architekten integrieren klimaresiliente Techniken, wie erhöhte Fundamente, sturmfeste Dächer und Solarpanels. Projekte wie die Eco-Villages in ländlichen Gebieten fördern umweltfreundliche Materialien wie Bambus und recycelten Beton. Zudem gibt es Bestrebungen, traditionelle jamaikanische Elemente, wie Veranden und Jalousien, in moderne Designs einzubinden, um Ventilation ohne Klimaanlagen zu ermöglichen.
Die Architektur ist aktuell betroffen von hohen Baukosten, eingeschränktem Zugang zu nachhaltigen Materialien und der Notwendigkeit, historische Gebäude vor Verfall zu schützen. Viele koloniale Strukturen, wie in Port Royal, leiden unter mangelnder Finanzierung für Restaurierungen. Urbanisierung und informelle Siedlungen in Kingston führen zu unregulierten Bauten, die Sicherheitsrisiken bergen. Dennoch bleibt die Architektur ein Ausdruck der kulturellen Vielfalt: Sie verbindet Taíno-Wurzeln, afrikanische Einflüsse, koloniale Pracht und moderne Innovation. Organisationen wie das Jamaica National Heritage Trust setzen sich für den Erhalt von Stätten wie Seville Great House ein, während Architekten wie Evan Williams mit Designs für soziale Projekte wie Schulen und Gemeindezentren die Zukunft gestalten.
Bildende Kunst
Wie in praktisch allen anderen kulturellen Bereichen dauerte es bis ins 20. Jahrhundert, bevor sich auf Jamaika eine eigenständige Kunstszene entwickelt hat. Edna Manley, die Frau Norman Manleys war die erste, die in ihren Statuen und Bildern afrikanische Traditionen aufgriff. Als ihr wichtigstes Werk gilt die Statue Negro Aroused, deren Nachbildung aus Bronze heute in Kingston steht und im Stil afrikanischer Künstler einen sich erhebenden Mann zeigt. Manley gründete 1941 am Institute Of Jamaica (IOJ) das erste Junior Center mit dem Ziel, junge Künstler zu fördern. Seit 1996 besteht ein zweites Zentrum in Portmore. Beide werden über das IOJ vom Staat und durch Spenden finanziert. Nach Manley ist auch das Manley College Of Visual And Performing Arts benannt, an dem in verschiedenen künstlerischen Bereichen Abschlüsse erworben werden können.
Zu den bekanntesten Malern zählen Barrington Watson, Eugene Hyde und Karl Parboosingh. Alle drei wurden im Ausland ausgebildet und malten expressionistisch. Im Gegensatz dazu orientierten sich John Dunkley (1891 bis 1947) an afrikanischen Traditionen, genauso wie seit den 1980er Jahren Robert Cookhorn (genannt Omari Ra), Douglas Wallace (genannt Khalfani Ra) und Valentine Fariclough (genannt Tehuti Ra). Die aus Afrika stammenden Künstlernamen sollen die Verbundenheit zum Kontinent unterstreichen.
Neben der Malerei fertigen zahlreiche Künstler Holz- oder Steinfiguren nach afrikanischer Tradition. Motive sind vor allem Tiere, darunter die Spinne Anansi. Die Produktion dieser Werke ist teilweise industrialisiert, um den Touristenmarkt zu bedienen.
Literatur
Die jamaikanische Literatur lässt sich grob in drei Bereiche unterteilen: Kolonialliteratur, Antikolonialliteratur und Postkolonialliteratur. Die ältesten auf Jamaika verfassten literarischen Werke stammen von Briten, die die Kolonie ab 1655 besuchten. Die Werke waren meist von der europäischen Kultur geprägte Reiseberichte oder Gedichte über die Zustände in den Kolonien. Sie unterscheiden sich kaum von Werken, die zur gleichen Zeit im Rest der Westindischen Inseln entstanden. Viele Autoren versuchten, in ihren Werken die Vorherrschaft der Europäer über die Sklaven zu begründen, andere wie Frances Saymore sprachen sich dagegen aus. Eine Ausnahme stellte Francis Williams dar. Der Sohn ehemaliger Sklaven wurde Anfang des 18. Jahrhunderts vom Duke of Montagu zur Ausbildung nach England geschickt. Nach seiner Rückkehr auf die Insel 1738 eröffnete er eine Schule in Spanish Town und verfasste Gedichte, meist in lateinischer Sprache. Er gilt als einer der ersten karibischstämmigen Literaten.
Erst um 1900 entwickelte sich eine von der Kolonialmacht Großbritannien unabhängige Literaturszene auf der Insel. Claude McKay war 1912 der erste, der mit dem Gedichtband Songs of Jamaica ein Werk in Patois veröffentlichte. In seinem Roman Banana Bottom beschreibt er das ländliche Jamaika und stellt als einer der ersten eine Verbindung zwischen dem Land und der afrikanischen Kultur her. McKay verließ die Insel 1914 und wurde in New York einer der wichtigsten Autoren der Harlem Renaissance und der Négritude-Bewegung. Einige Jahre später begann Una Marson, ihre Gedichte zu veröffentlichen. Sie setzte sich vor allem für die jamaikanischen Frauen ein und gilt als eine der ersten Feministinnen mit dunkler Hautfarbe. Die Unabhängigkeitsbewegung in den 1930er Jahren brachte verstärkt Autoren hervor, die sich der Bedeutung der afrikanischen Kultur für die Insel bewusst waren und darin ein Mittel zur Schaffung eines nationalen Bewusstseins sahen. Ein Beispiel ist Roger Mais. Bis 1940 verbüßte er eine Freiheitsstrafe für seine Beteiligung an den 1938er-Arbeiteraufständen. Während der Zeit im Gefängnis schrieb er The Hills Were Joyful Together, einen Roman, der die Probleme der Arbeiterklasse in Kingston thematisiert. In späteren Werken sympathisierte er mit der Rastafari-Bewegung. Marcus Garvey machte die Wiederbesinnung auf die afrikanischen Wurzeln zum Mittelpunkt seiner Gedichte. Auch er verließ die Insel in Richtung USA, wo er die Bürgerrechtsbewegung UNIA-ACL gründete.
Für Autoren war es immer schwer, in Jamaika mit ihrer Tätigkeit genug Geld zu verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Es fällt ihnen schwer, von der Karibik aus auf sich aufmerksam zu machen, da es kaum Verlage gibt, die ihre Werke verbreiten können. Seit den 1950er Jahren verließen viele Schriftsteller die Insel, um ihre Karrieren im Ausland fortzusetzen. Besonders in Kanada und Großbritannien haben sich mit der Zeit „Kolonien“ jamaikanischer Künstler gebildet. Einige Autoren wie Erna Brodber (Jane and Louisa Will Soon Come Home 1980) haben auch im Ausland ihren Bezug zu Jamaika behalten, während andere sich mit der Zeit der lokalen Kulturszene anpassten. So sind viele Werke aus der Zeit nach der Unabhängigkeit nicht auf Jamaika entstanden. Die eigene Identität ist ein wichtiges Thema der jüngeren Autoren, ebenso wie die sozialen Umstände und Entwicklungen in ihrer alten Heimat. In The Painted Canou (1983) gibt Antony C. Winkler einen Einblick in das Leben eines einfachen Fischers. Ein anderes immer wiederkehrendes Thema ist die schlaue Spinne Anansi (auf Jamaika meist Anancy geschrieben). Ursprünglich eine westafrikanische Spinnengottheit, ist sie ein Symbol für die afrikanische Herkunft der Bevölkerung. Sie wird meist, unter anderem von Louise Bennett-Coverly, als schlaues Tier beschrieben, das sich mit List gegen übermächtig erscheinende Gegner durchsetzt,.
Theater
Die Engländer brachten das europäische Theater nach Jamaika. Die erste Spielstätte wurde vermutlich 1682 in Spanish Town errichtet, weitere folgten in Port Royal und später in Kingston. Aufgeführt wurden Werke englischer Autoren. Besucher waren zunächst nur die wohlhabenden weißen Landbesitzer, Anfang des 19. Jahrhunderts auch Sklaven in abgetrennten Bereichen. Die afrikanischen und indianischen Traditionen wurden unterdrückt, nur zu einzelnen Anlässen waren Vorführungen erlaubt. 1813 kam es im Royal Theatre in Kingston mehrfach zu Unruhen, die der Abtrennung der Sitzplätze ein Ende bereiteten. 1853 konnte Charles Shanahan, ein Sohn ehemaliger Sklaven, seine Satire The Mysteries of Vegetarianism aufführen.
Die in den 1930er Jahren aufkommenden nationalen Bewegungen vergrößerten auch den Einfluss afrikanischer Traditionen auf das Theater. Marcus Garvey schrieb Stücke, die die breite Bevölkerung ansprachen. Er gründete mit Edelweiss Park ein Kulturzentrum, in dem zahlreiche Stücke mit afrikanischem Hintergrund aufgeführt wurden. Aufbauend auf englischen Traditionen entwickelte sich die „Pantomime“, zur Zeit der Unabhängigkeit die populärste Unterhaltungsform. Im Unterschied zur herkömmlichen Pantomime gibt es hier Dialoge, meist in Patois, die musikalisch hinterlegt sind. Teilweise werden Passagen improvisiert oder das Publikum in Szenen eingebunden. Grundsätzlich kann alles Thema einer Aufführung sein, besonders beliebt sind aber Aufführungen zum Anansi-Thema. In den 1960er und 1970er Jahren waren die Theater gut besucht und lockten Zuschauer auf der ganzen Insel an. Die meisten Spielstätten befinden sich in Kingston, darunter auch das Jamaican Theatre mit 1750 Sitzplätzen und das 1912 gegründete Ward Theatre.
Heute leidet das Theater unter der schlechten wirtschaftlichen Situation. Auf der Insel ist es schwer, genügend Zuschauer zu finden, um professionelle Vorstellungen auf die Beine stellen zu können. Die meisten Beteiligten arbeiten nebenbei in einem anderen Beruf. Besonders das Ward Theatre leidet unter finanziellen Engpässen und ist dringend renovierungsbedürftig. Der Staat unterstützt Schauspieler über das Institut of Jamaica und die University of the Westindies. Außerdem ist die Ausbildung an Drama schools kostenlos.
Film
Die vielfältige Landschaft Jamaikas wird seit den 1950er Jahren von ausländischen Produktionen als Drehort verwendet, zum Beispiel für die James-Bond-Filme Leben und sterben lassen und James Bond jagt Dr. No. Zur Entwicklung einer landeseigenen Filmindustrie fehlten die finanziellen Mittel. Die erste lokale Produktion, die internationale Bekanntheit erlangte war The Harder They Come (1972) in dem die Geschichte von Ivanhoe „Rhygin′“ Martin, eines Sängers und Gangsters erzählt wird. Seit 2006 wird das Werk als Musical in London aufgeführt. In der Folge wählten zahlreiche weitere Filme das Thema Musik. Der wohl bekannteste Schauspieler Jamaikas ist Paul Campbell, der vor allem mit seinen Rollen im Musikfilm Dancehall Queen und in dem kommerziell erfolgreichen Polizeifilm Third World Cop.
Die 1984 gegründete Jamaica Film Commission soll im Auftrag der Regierung Investoren suchen und Projekte koordinieren.
Musik und Tanz
Die von den Sklaven aus Afrika mitgebrachte Musik hatte oft religiösen Charakter. Im Wechsel trägt ein Sänger einen Text vor und ein anderer erwidert darauf; wichtigstes Musikinstrument ist die Trommel. Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich daraus der Mento, die erste eigene Musikform der Insel, die auch Ska und Reggae wesentlich beeinflusst hat. Der Stil war vor allem in den 1940er und 1950er Jahren populär. Lord Flea und Count Lasher sind zwei der erfolgreichsten Mento-Künstler. Bekannte Mento-Songs sind unter anderem „Day-O“, „Jamaica Farewell“ und „Linstead Market“. Mento wird oft mit Calypso-Musik verwechselt. Aus ihm entwickelten sich die späteren Musikrichtungen und der jamaikanische Volkstanz. Die direkten, teilweise pornographischen Texte, wurden auf Druck der Kirche häufig im Geheimen vertrieben.
Wie auf vielen anglokaribischen Inseln ist aus Trinidad und Tobago stammende Calypso Teil der jamaikanischen Kultur geworden. Jamaikas eigene lokale Musikrichtung Mento wird oft mit Calypso-Musik verwechselt. Obwohl beide viele Gemeinsamkeiten aufweisen, handelt es sich um zwei unterschiedliche Musikformen. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Mento mit Calypso verwechselt und häufig als Calypso, Kalypso und Mento Calypso bezeichnet; Mento-Sänger verwendeten häufig Calypso-Songs und -Techniken. Wie im Calypso verwendet auch Mento aktuelle Texte mit humoristischer Note, die sich mit Armut und anderen sozialen Themen befassen. Sexuelle Anspielungen sind ebenfalls häufig. Zu den beliebten Calypso-Künstlern aus Jamaika zählen Byron Lee, Fab 5 und Lovindeer. Harry Belafonte (geboren in den USA, aufgewachsen in Jamaika im Alter von 5 bis 13 Jahren) machte das amerikanische Publikum mit der Calypso-Musik bekannt und wurde als „King of Calypso” bezeichnet.
Ende der 1950er Jahre entstand die sogenannte erste Welle des Ska in den armen Wohnvierteln Kingstons. Neben dem Mento wurde er von amerikanischen Rhythm and Blues und Jazz beeinflusst, eine der ersten bedeutenden Vertreter war die Gruppe The Skatalites, von denen wahrscheinlich auch der Name Ska stammt. Ursprünglich waren die meisten Interpreten durch die Unabhängigkeit des Landes 1962 optimistisch und sangen von einer besseren Zukunft. Die sich verschlechternden Lebensbedingungen führten zu einer Radikalisierung, die Interpreten begannen soziale Probleme zu thematisieren. Die Besetzung einer Skaband besteht üblicherweise aus einer Rhythmusgruppe mit Gitarren, Bass, Klavier oder Orgel und Schlagzeug und Blasinstrumenten wie Saxophon, Trompete oder Posaune. Der zum Ska gehörende Tanz heißt Skank.
Musikhistoriker unterteilen die Geschichte des Ska in der Regel in drei Perioden: die ursprüngliche jamaikanische Szene der 1960er Jahre (erste Welle), das englische 2-Tone-Ska-Revival der späten 1970er Jahre (zweite Welle) und die dritte Ska-Bewegung, die in den 1980er Jahren begann (dritte Welle) und in den 1990er Jahren in den USA populär wurde. Das jüngste Revival des Ska-Jazz Jamaican Jazz versucht, den Sound der frühen jamaikanischen Musikkünstler der späten 1950er Jahre wieder aufleben zu lassen.
Ende der 1960er Jahre entwickelte sich die bekannteste Musikrichtung Jamaikas, der Reggae. Der bekannteste Interpret ist Bob Marley mit seiner Band The Wailers. Neben Blasinstrumenten und Trommeln kommen elektronische Musikinstrumente und Studioeffekte zum Einsatz. Zwei Formen haben sich im Land besonders durchgesetzt. Roots-Reggae ist stark von den Rastafari beeinflusst. Neben religiösen Themen geht es in den Texten vor allem um Armut und soziale Ungerechtigkeit. Die ersten Lieder, die als Roots-Reggae bezeichnet werden können entstanden 1969, wobei vor allem Satta Masa Gana von den Abbyssinians erwähnt werden muss. Die Popularität hat mittlerweile stark abgenommen, der Reggae wird aber immer noch praktiziert. Dancehall ist vom Hip-Hop beeinflusst, die Texte sind häufig gewaltverherrlichend und homophob. Zu den bekanntesten Interpreten zählen Bounty Killer, Beenie Man, Elephant Man und Sean Paul.
Mit dem Aufstieg des Ska kam auch die Popularität von DJs wie Sir Lord Comic, King Stitt und dem Pionier Count Matchuki, die begannen, stilistisch über die Rhythmen populärer Songs in Soundsystemen zu sprechen. In der jamaikanischen Musik ist der Deejay derjenige, der spricht (anderswo als MC bekannt), und der Selector ist die Person, die die Platten auswählt. Die Popularität der Deejays als wesentlicher Bestandteil des Soundsystems schuf einen Bedarf an Instrumentalstücken sowie Instrumentalversionen populärer Gesangsstücke.
Toasting ist eine Art lyrischer Gesang über den Beat. Bei Dancehall-Musik sind zwar auch Deejays beteiligt, aber sie sind diejenigen, die über den Rhythmus oder Track singen oder summen. Mit dem Aufkommen vieler verschiedener Genres wurde Toasting in den 1960er und 1970er Jahren in Jamaika populär.
In den späten 1960er Jahren begannen Produzenten wie King Tubby und Lee Perry, die Gesangsstimmen aus den für Soundsystem-Partys aufgenommenen Tracks zu entfernen. Mit den nackten Beats und dem Bassspiel und den Lead-Instrumenten, die in den Mix ein- und ausstiegen, begannen die Deejays zu toasten, das heißt humorvolle und oft provokante Sticheleien gegen andere Deejays und lokale Prominente zu liefern. Im Laufe der Zeit wurde das Toasten zu einer immer komplexeren Aktivität und entwickelte sich zu einer ebenso großen Attraktion wie die Dance-Beats, die im Hintergrund gespielt wurden. Im Laufe der Zeit wurde das Toasten zu einer immer komplexeren Aktivität und entwickelte sich zu einem ebenso großen Publikumsmagneten wie die dahinter spielenden Dance-Beats.
Rocksteady war Mitte der 1960er Jahre die Musik der Rude Boys Jamaikas, als The Wailers und The Clarendonians die Charts dominierten. Desmond Dekkers „007” machte das neue Genre international bekannt. Der Mix legte großen Wert auf die Basslinie, im Gegensatz zu den starken Bläsern des Ska, und die Rhythmusgitarre begann auf dem Upbeat zu spielen. Session-Musiker wie Supersonics, Soul Vendors, Jets und Jackie Mittoo (von den Skatalites) wurden in dieser Zeit populär.
Hip-Hop - prahlerische Raps, rivalisierende Posses, Uptown-Throwdowns und politische Kommentare - sind ebenfalls Teil der jamaikanischen Musik. Als Rocksteady- und Reggae-Bands versuchten, ihre Musik zu einer Form des nationalen und sogar internationalen Widerstands der Schwarzen zu machen, griffen sie auf die jamaikanische Kultur zurück. Die jamaikanische Musik bewegte sich zwischen prahlerischen und toastenden Songs voller „Slackness” und sexuellen Anspielungen und einem aktuelleren, politischeren, „bewussteren” Stil hin und her.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts brachte Jamaika viele namhafte Jazzmusiker hervor. Einen großen Einfluss hatte dabei die fortschrittliche Politik der Alpha Boys‘ School in Kingston, die ihren Schülern eine musikalische Ausbildung ermöglichte und sie in diesem Bereich förderte. Bedeutend war auch die Brassband-Tradition der Insel, die durch Möglichkeiten zur musikalischen Arbeit und Ausbildung im militärischen Kontext gestärkt wurde. Da es jedoch nur begrenzte Möglichkeiten gab, in Jamaika eine Karriere als Jazzmusiker zu machen, verließen viele lokale Jazzmusiker die Insel, um sich in London oder den Vereinigten Staaten niederzulassen.
Zu den bekanntesten jamaikanischen Jazzmusikern, die im Ausland Karriere machten, gehörte der Altsaxophonist Joe Harriott, der heute international als einer der originellsten und innovativsten Jazzkomponisten gilt. Ebenfalls international erfolgreich waren die Trompeter Dizzy Reece, Leslie „Jiver” Hutchinson und Leslie Thompson, der Bassist Coleridge Goode, der Gitarrist Ernest Ranglin und der Pianist Monty Alexander.
Harriott, Goode, Hutchinson und Thompson bauten ihre Karrieren in London auf, zusammen mit vielen anderen Instrumentalisten wie dem Pianisten Yorke de Souza und dem herausragenden Saxophonisten Bertie King, der später nach Jamaika zurückkehrte und eine Band im Mento-Stil gründete. Reece und Alexander arbeiteten in den USA. Der Saxophonist Wilton „Bogey” Gaynair ließ sich in Deutschland nieder und arbeitete hauptsächlich mit Kurt Edelhagens Orchester zusammen.
Bis 1973 hatte sich Dub zu einem eigenständigen Reggae-Genre entwickelt und läutete den Beginn des Remix ein. Dub wurde von Plattenproduzenten wie Lee „Scratch” Perry und King Tubby entwickelt und zeichnete sich durch zuvor aufgenommene Songs aus, die mit einem Schwerpunkt auf dem Bass neu abgemischt wurden. Oftmals wurden die Lead-Instrumente und der Gesang in den Mix ein- und ausgeblendet und manchmal stark mit Studioeffekten bearbeitet. King Tubbys Vorteil lag in seiner umfassenden Kenntnis der Audiogeräte und seiner Fähigkeit, eigene Soundsysteme und Aufnahmestudios zu bauen, die denen der Konkurrenz überlegen waren. Er wurde berühmt für seine Remixe von Aufnahmen anderer Künstler sowie für diejenigen, die er in seinem eigenen Studio aufgenommen hatte.
Weitere beliebte Musikformen, die in den 1970er Jahren entstanden sind, sind: Briton (Linton Kwesi Johnsons Dub-Poesie); Sly & Robbies Rockers Reggae, der sich an Augustus Pablos Melodica orientierte und bei Künstlern wie The Mighty Diamonds und The Gladiators beliebt wurde; Joe Gibbs' sanfterer Rockers Reggae, darunter Musik von Culture und Dennis Brown; Burning Spears unverwechselbarer Stil, vertreten durch die Alben Marcus Garvey und Man in the Hills; und harmonische, spirituell orientierte Rasta-Musik wie die von The Abyssinians, Black Uhuru und Third World. 1975 landete Louisa Mark mit „Caught You in a Lie” einen Hit und begründete damit einen Trend britischer Interpreten, romantischen, balladenorientierten Reggae zu machen, der als Lovers Rock bekannt wurde.
Reggae und Ska hatten einen massiven Einfluss auf britische Punkrock- und New-Wave-Bands der 1970er Jahre, wie The Clash, Elvis Costello and the Attractions, The Police, The Slits und The Ruts. Ska-Revival-Bands wie The Specials, Madness und The Selecter entwickelten das 2-Tone-Genre.
In den 1980er Jahren waren Dancehall und Ragga die beliebtesten Musikstile in Jamaika. Dancehall ist im Wesentlichen eine Art Redekunst mit musikalischer Begleitung, einschließlich eines einfachen Schlagzeugbeats (meistens auf einem E-Drum-Set gespielt). Die Texte entfernten sich von den politischen und spirituellen Themen, die in den 1970er Jahren beliebt waren, und konzentrierten sich mehr auf weniger ernste Themen. Ragga zeichnet sich durch den Einsatz computergesteuerter Beats und sequenzierter Melodien aus.
Ragga soll mit dem Song „Under Mi Sleng Teng” von Wayne Smith erfunden worden sein. Ragga verdrängte Dancehall in den 1980er Jahren knapp als dominierende Form der jamaikanischen Musik. DJ Shabba Ranks und das Sängerteam Chaka Demus und Pliers erwiesen sich als dauerhafter als die Konkurrenz und trugen dazu bei, eine aktualisierte Version der Rude-Boy-Kultur namens Ragga Muffin zu inspirieren.
Dancehall war manchmal gewalttätig in seinen Texten, und mehrere rivalisierende Künstler sorgten mit ihren Fehden in ganz Jamaika für Schlagzeilen (vor allem Beenie Man gegen Bounty Killer). Dancehall entstand aus den bahnbrechenden Aufnahmen von Barrington Levy Ende der 1970er Jahre, mit Roots Radics als Begleitband und Junjo Lawes als Produzent. Die Roots Radics waren die herausragende Begleitband für den Dancehall-Stil. Yellowman, Ini Kamoze, Charlie Chaplin und General Echo trugen zusammen mit Produzenten wie Sugar Minott zur Popularisierung des Stils bei.
In den 1980er Jahren erlebte die Reggae-Musik außerhalb Jamaikas einen Aufschwung. In dieser Zeit beeinflusste Reggae insbesondere die afrikanische Popmusik, wo Sonny Okusuns, John Chibadura, Lucky Dube und Alpha Blondy zu Stars wurden. In den 1980er Jahren endete die Dub-Ära in Jamaika, obwohl Dub in Großbritannien und in geringerem Maße auch in Europa und den USA ein beliebter und einflussreicher Stil geblieben ist. Dub verschmolz in den 1980er und 1990er Jahren mit elektronischer Musik.
Ende der 2000er Jahre feierten Dancehall-Künstler wie Popcaan, Vybz Kartel, Shalkal, Konshens, Mr. Vegas und Mavado große lokale Erfolge. Im folgenden Jahrzehnt stiegen auch andere Künstler wie Tommy Lee Sparta, Alkaline und Cashtro Troy in der Dancehall-Szene auf. Ende der 2010er Jahre war in der Musik der westlichen Märkte der Einfluss von Dancehall in der Popmusik zu spüren, darunter Drakes „One Dance” und „Controlla” (2016) sowie Rihannas „Work” (2016).
Reggae Fusion entstand Ende der 1990er Jahre als beliebtes Subgenre. Es handelt sich um eine Mischung aus Reggae oder Dancehall mit Elementen anderer Genres. Sie ist eng mit der Ragga-Musik verwandt. Sie hat ihren Ursprung in Jamaika. Zu den Reggae-Fusion-Künstlern aus Jamaika mit einem Nummer-1-Hit in den US Billboard Hot 100 gehören Ini Kamoze mit „Here Comes the Hotstepper” aus dem Jahr 1994, Super Cat (zu hören in Sugar Rays Song „Fly”), Shaggy (2 Nummer-1-Hits, darunter „Angel”), Rikrok (zu hören in Shaggys Song „It Wasn't Me”), Sean Paul (3 Nummer-1-Hits, darunter „Get Busy”), Sean Kingston mit „Beautiful Girls” im Jahr 2007 und OMI (Sänger) mit „Cheerleader” im Jahr 2015. Mit Ausnahme von Ini Kamoze, Rikrok und OMI stammen alle aus Kingston.
Die Bongo Nation ist eine eigenständige Gruppe von Jamaikanern, die möglicherweise vom Kongo abstammen. Sie sind bekannt für Kumina, was sowohl eine Religion als auch eine Musikform bezeichnet. Der unverwechselbare Trommelstil von Kumina wurde zu einer der Wurzeln des rastafarischen Trommelns, das wiederum die Quelle des unverwechselbaren jamaikanischen Rhythmus ist, der in Ska, Rocksteady und Reggae zu hören ist. Die moderne Verflechtung von jamaikanischer Religion und Musik lässt sich bis in die 1860er Jahre zurückverfolgen, als die Pocomania- und Revival-Zion-Kirchen afrikanische Traditionen aufgriffen und Musik in fast alle Bereiche des Gottesdienstes integrierten. Später breitete sich dieser Trend auch in hinduistischen Gemeinschaften aus und führte zur Baccra-Musik.
Die Verbreitung des Rastafari-Glaubens im urbanen Jamaika der 1960er Jahre veränderte die jamaikanische Musikszene, die Trommeln (gespielt bei Grounation-Zeremonien) integrierte und zur heutigen Populärmusik führte. Viele der oben genannten Musik- und Tanzformen wurden von Rex Nettleford, künstlerischer Leiter (emeritierter Professor und Vizekanzler der University of the West Indies), und Marjorie Whyle, musikalische Leiterin (karibische Musikwissenschaftlerin, Pianistin, Trommlerin, Arrangeurin und Dozentin an der University of the West Indies), untersucht. Seit 1962 hat diese ehrenamtliche Gruppe von Tänzern und Musikern viele dieser Tänze in ihr Kernrepertoire aufgenommen und weltweit vor großem Publikum aufgeführt, darunter auch vor der britischen Königsfamilie.
Weitere Trends waren minimalistische digitale Tracks, die 1995 mit Dave Kellys „Pepper Seed“ begannen, sowie die Rückkehr von Liebesballaden-Sängern wie Beres Hammond. Amerikanische, britische und europäische Elektronikmusiker verwendeten reggaeorientierte Beats, um weitere hybride elektronische Musikstile zu schaffen. Dub, Weltmusik und elektronische Musik beeinflussen auch in den 2000er Jahren weiterhin die Musik. Eine der neuesten Entwicklungen ist eine Musikform namens Linguay, die 2013 vom Plattenproduzenten Lissant Folkes gegründet wurde.
JaFolk Mix ist ein Begriff, der vom jamaikanischen Musiker Joy Fairclough geprägt wurde und die Mischung von jamaikanischer Volksmusik mit ausländischen und lokalen Musikstilen und die Entwicklung eines neuen Sounds bezeichnet, der durch ihre Verschmelzung entsteht. Dies ist die neueste stilistische Entwicklung der jamaikanischen Musik des späten 20. und 21. Jahrhunderts. Jamaikanische Musik beeinflusst weiterhin die Musik der Welt. Viele Bemühungen, jamaikanische Musik zu studieren und zu kopieren, haben der Welt diese neue Musikform nähergebracht, da die kopierten Stile mit sprachlichen und musikalischen Akzenten aufgeführt werden, die denen des Heimatlandes entsprechen, in dem sie studiert, kopiert und aufgeführt werden.
Die traditionellen Wurzeln des jamaikanischen Tanzes reichen bis in die afrikanischen Kulturen der versklavten Menschen zurück. Tänze wie Kumina, Dinki Mini oder Gerreh sind eng mit Ritualen, Festen und religiösen Zeremonien verknüpft. Kumina etwa stammt aus Zentralafrika und wird bis heute bei spirituellen Feiern mit Trommeln, Gesang und ekstatischen Bewegungen praktiziert. Dinki Mini ist ein Trauertanz, der bei Totenwachen aufgeführt wird, während Gerreh Lebensfreude und Trost bei Beerdigungen vermittelt.
Während der Kolonialzeit und danach entstanden Mischformen, in denen afrikanische, europäische und kreolische Elemente verschmolzen. So entwickelte sich Quadrille – ein Gesellschaftstanz europäischer Herkunft – auf Jamaika zu einer eigenen Variante mit afrikanischen Rhythmen und lebendigeren Bewegungen.
Im 20. Jahrhundert gewann die Tanzkultur durch die enge Verbindung zur Musikszene internationale Bedeutung. Mit Mento, Ska, Rocksteady und schließlich Reggae entstanden jeweils eigene Tanzstile, die häufig improvisiert und von rhythmischer Körperarbeit geprägt sind. Später brachte die Dancehall-Bewegung eine Vielzahl an innovativen Schritten hervor, die nicht nur auf Jamaika, sondern weltweit Anklang fanden. Viele dieser Dancehall-Moves – etwa „Bogle“ oder „Pon di River“ – wurden zu globalen Trends.
Parallel dazu entwickelte sich eine professionelle Tanzszene: Die National Dance Theatre Company of Jamaica (NDTC), gegründet 1962, verbindet folkloristische Traditionen mit moderner Bühnentanzkunst und ist international renommiert. Durch sie wurden jamaikanische Tanzformen weltweit bekannt und als ernstzunehmende Kunst etabliert.
Kleidung
In Jamaika dominiert Rastafari-Outfit. Rastafari haben zwar keine Bekleidungsvorschriften, jedoch muss auch beim Gewand darauf geachtet werden, dass man Babylon nicht unterstützt. Das heißt, man sollte nur Kleidung tragen, die aus Baumwolle, Kokosfasern oder Fasern von Hanf gefertigt wurde. Genauso sollte keine Kleidung getragen werden, die gesundheitsschädlich, also nicht ital ist. Daraus folgt, daß man keine zu engen Hosen oder Röcke - Frauen dürfen keine Hosen tragen - anziehen sollte.
Es gibt keine wirklich typische Kleidung unter den Rastafari. Wenn man jedoch erkennen soll, dass jemand ein rasta brother ist (zum Beispiel aus Gründen der Publicity), werden oft T-Shirts oder Pullover getragen, die die typischen Rastafarben Rot, Gold, Grün tragen. So beschreibt zum Beispiel Mario Vargas Llosa im Artikel „Mein Sohn, der Rastafari“ über den ersten Anblick, den er am Flughafen von seinem Sohn erhaschen konnte: „Ein absonderlicher Sack mit Löchern für die Extremitäten diente als Gewand, verfertigt wie aus Fetzen eines unerfindlichen Materials. Miteinander verfeindete Farben wucherten darauf, vor allem Rot, Grün und Gold. In seiner Formlosigkeit, den grotesken Farbvermengungen und den Knöpfen a la Sonnenblumen hatte es eine vage Verwandtschaft zur Gewandung eines Clowns oder einer Vogelscheuche. [Aber ihr] fehlte jegliche Fröhlichkeit; etwas Ernsthaftes oder Beunruhigendes war darin, wie in Mönchskutten oder Militäruniformen (später begriff ich, daß es eine Mischung von beidem war). Seine [klebrigen] Schuhe schienen weder aus Leder noch aus Tuch, sondern aus Ölhaut oder Knorpelgewebe zu sein, und auf ihnen waren sämtliche Farben des Regenbogens vertreten. Sie reichten von den Zehen bis zur Wade, verfügten aber weder über Sohle noch über Absatz noch über irgendeine Struktur [...]“
Dieses Bild beschreibt aber nicht den „typischen“ Rasta. Das einzige, was man bei der Kleidung als typisch bezeichnen könnte, ist die Baumwollmütze, das tam. Diese Mütze kann verschieden groß sein, bedeckt aber meistens den ganzen Kopf. Sie ist manchmal in den Farben Rot – Gold – Grün gehalten, manchmal sind auch schwarze Stellen eingebunden. Ein tam symbolisiert den Glauben und die Kraft, die Rastas erlangt haben, bietet aber auch den Dreadlocks Schutz vor Schmutz, Hitze und anderen „Entehrungen“.
Kulinarik und Gastronomie
Die jamaikanische Küche ist sehr vielfältig und sowohl von afrikanischen als auch europäischen und asiatischen Einflüssen geprägt. Sie ist bekannt für ihre scharfen Saucen und würzige Speisen. Es wird vor allem lokal angebautes Obst und Gemüse sowie Geflügel (Jerk Chicken) und Salzwasserfisch verwendet. Obwohl besonders im Westen Jamaikas Rinder und Schweine gezüchtet werden wird ihr Fleisch eher selten zubereitet, es geht zu großen Teilen in den Export. Eine traditionelle Zubereitungsart ist das Marinieren und anschließende Braten im offenen Feuer oder in aufgeschnittenen Metallfässern. Als Dessert werden gerne süße Gerichte aus Mango und Soursopeis gegessen. Die Rastafari, die den Konsum von Schweinefleisch und Alkohol ablehnen, pflegen eine eigene Küche.
Traditionell werden auf Jamaika verschiedene Spirituosen hergestellt, vor allem auf der Basis von Rum. Eine der bekanntesten Marken ist Captain Morgan, der zu den weltweit meistverkauften Rummarken gehört. Sehr beliebt ist auch das jamaikanische Lagerbier, wie zum Beispiel das Red Stripe, das von zwei Brauereien auf der Insel hergestellt wird. Der seit einigen Jahren verstärkt angebaute Kaffee bleibt teilweise im Land und wird genau wie Tee sowohl zu Mischgetränken verarbeitet als auch direkt getrunken. Das Wort Tea bezeichnet meist alle Arten heißer Getränke, meist auch alkoholische.
Die jamaikanische Küche zeichnet sich durch intensive Gewürze, frische Zutaten und einfache, aber herzhafte Zubereitung aus. Zu den Grundpfeilern gehören:
Jerk: Die ikonischste Spezialität, bei der Fleisch (vor allem Hühnchen oder Schwein) mit einer Marinade aus Piment, Scotch Bonnet Chilischoten, Thymian, Ingwer und Knoblauch gewürzt, über Pimentholz langsam gegrillt wird. Jerk-Stände, wie die berühmten Boston Jerk Centres in Port Antonio, sind landesweit beliebt.
Ackee und Saltfish: Jamaikas Nationalgericht, eine Kombination aus gesalzenem Kabeljau und der Ackee-Frucht, die wie Rühreier aussieht, oft mit Kochbananen, Yamswurzeln oder Dumplings serviert.
Curry: Beeinflusst durch indische Einwanderer, sind Currys mit Ziegenfleisch, Hühnchen oder Meeresfrüchten weit verbreitet, gewürzt mit Kurkuma und Kreuzkümmel.
Patties: Teigtaschen mit würzigen Füllungen wie Rind, Huhn oder Gemüse, ein beliebter Snack, erhältlich in Ketten wie Tastee oder Juici Patties.
Meeresfrüchte: Dank der 1.022 km langen Küstenlinie sind Hummer, Garnelen und Fisch (zum Beispiel Snapper) zentral, oft gegrillt oder in Escovitch-Sauce mit Essig und Paprika zubereitet.
Lokale Zutaten wie Kokosnüsse, Yamswurzeln, Maniok, Piment und tropische Früchte (Mango, Ananas, Guave) prägen die Gerichte. Reis und Erbsen (oft mit Kokosmilch gekocht) sind typische Beilagen, während Getränke wie Rum, Red Stripe Bier, Ingwerbier und Fruchtsäfte das Angebot ergänzen. Der weltberühmte jamaikanische Rum, etwa von Appleton Estate, ist ein Exportschlager, mit einem Produktionswert von Millionen USD jährlich.
Die Gastronomie reicht von informellen Straßenständen bis zu gehobenen Restaurants, die sowohl Einheimische als auch Touristen ansprechen. In Kingston bieten Orte wie Usain Bolt’s Tracks & Records moderne jamaikanische Küche mit internationalem Flair, während Gloria’s in Port Royal für Meeresfrüchte bekannt ist. In Montego Bay und Negril locken Strandrestaurants wie Scotchies mit authentischem Jerk und entspannter Atmosphäre. Luxusresorts, etwa Sandals oder Half Moon, integrieren lokale Gerichte in Gourmet-Menüs, oft mit internationalen Köchen, die Fusion-Küche kreieren. Straßenmärkte wie der Coronation Market in Kingston bieten frische Produkte und Snacks, während Food-Festivals wie das Jamaica Food and Drink Festival (jährlich in Kingston) die Vielfalt feiern, von veganer Küche bis zu traditionellem Jerk.
Die Gastronomie ist eng mit dem Tourismus verknüpft, der 2024 etwa 4,5 Milliarden USD generierte. Restaurants und Food-Touren, etwa in Falmouth oder Ocho Rios, sind bei Besuchern beliebt, die authentische Erlebnisse suchen. Die Landwirtschaft, die 7 % zum BIP beiträgt, liefert die Rohstoffe – etwa 75 % des Wassers gehen in die Bewässerung von Kulturen wie Zuckerrohr und Kaffee. Die Fischerei, mit einem Beitrag von 113 Millionen USD im Jahr 2022, versorgt die Küche mit frischen Meeresfrüchten, insbesondere von Pedro Bank.
Die jamaikanische Gastronomie steht vor Herausforderungen wie hohen Importkosten für Zutaten, die nicht lokal produziert werden, und steigenden Energiepreisen, die Restaurants belasten. Hurrikane wie Beryl 2024 bedrohen die Versorgungskette, während der Klimawandel die Verfügbarkeit von Fisch und landwirtschaftlichen Erzeugnissen beeinträchtigt. Dennoch wächst die Branche durch Trends wie nachhaltige Küche und Farm-to-Table-Konzepte. Restaurants wie Stush in the Bush in St. Ann setzen auf biologische, lokale Zutaten und vegane Optionen, die auch die Rastafari-Kultur („Ital“-Küche) widerspiegeln. Digitalisierung fördert den E-Commerce, etwa durch Lieferdienste wie 7Krave, die den Zugang zu jamaikanischen Speisen erleichtern.
Festkultur
Jamaikanischer Nationalfeiertag ist der 6. August zur Erinnerung an die Unabhängigkeit im Jahr 1962. Von besonderer Wichtigkeit ist auch der 1. August als Gedenktag an die Sklavenbefreiung 1834. Ansonsten gelten auf Jamaika die üblichen kirchlichen Feiertage.
Feiertage:
| Datum | Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung | Bemerkungen |
| 1. Januar | New Year′s Day | Neujahr | Unveränderlicher Feiertag |
| Februar/März | Ash Wednesday | Aschermittwoch | |
| März/April | Good Friday | Karfreitag | |
| März/April | Easter Monday | Ostermontag | |
| 22. Mai | Labour Day | Tag der Arbeit | Unveränderlicher Feiertag |
| 1. August | Emancipation Day | Befreiungstag (von der Sklaverei) | Unveränderlicher Feiertag |
| 6. August | Independence Day | Unabhängigkeit | Unveränderlicher Feiertag |
| Oktober | National Heroes Day | Tag der Nationalhelden | Am dritten Montag im Oktober |
| 25. Dezember | Christmas Day | 1. Weihnachtsfeiertag | Unveränderlicher Feiertag |
| 26. Dezember | Boxing Day | 2. Weihnachtsfeiertag | Unveränderlicher Feiertag |
Jamaika feiert die staatlichen und nationalen Feiertage mit festlichem Charakter, darunter Independence Day (6. August), der die Unabhängigkeit von Großbritannien 1962 markiert, und Emancipation Day (1. August), der an die Abschaffung der Sklaverei erinnert. Diese Tage werden mit Paraden, Konzerten, Reden und kulturellen Darbietungen begangen und fördern das kollektive Bewusstsein für Geschichte, Identität und Freiheit.
Eines der bekanntesten traditionellen Feste ist der Jamaica Carnival, der mit bunten Paraden, aufwändig gestalteten Kostümen und Karnevalsbands gefeiert wird. Er findet in mehreren Städten statt, besonders in Kingston und Montego Bay, und zieht sowohl Einheimische als auch internationale Besucher an. Musik spielt eine zentrale Rolle, vor allem Soca, Reggae und Dancehall, und Tanz begleitet jede Parade. Auch spezielle Musikfestivals wie das Reggae Sumfest in Montego Bay sind feste Bestandteile der Festkultur. Dieses Festival feiert den Reggae und lockt weltbekannte Künstler sowie Fans aus aller Welt an.
Viele Feste Jamaikas haben religiöse Wurzeln. Weihnachten und Ostern werden mit Kirche, Musik und Familienfeiern begangen. Besonders bemerkenswert sind afro-jamaikanische Rituale wie Jonkonnu oder Kumina-Feste, die auf die Zeit der Sklaverei zurückgehen. Diese Veranstaltungen kombinieren Trommelmusik, Tänze und Masken und dienen sowohl spirituellen Zwecken als auch sozialem Zusammenhalt.
Kulinarik ist eng mit der Festkultur verbunden. Feste wie das Jamaica Food & Drink Festival oder regionale Märkte bieten Spezialitäten wie Ackee and Saltfish, Jerk Chicken und tropische Früchte an. Solche Veranstaltungen verbinden Musik, Tanz und Gastronomie und betonen die kulturelle Vielfalt der Insel.
Medien
Auf Jamaika gibt es zurzeit zwei große Sendeanstalten, die sowohl Fernseh- als auch Radioprogramme übertragen. Die wichtigsten landesweiten Sender sind CVM und Television Jamaica. Dazu kommen Spartensender wie Reggae Sun Television und Hype TV, die vor allem Musik übertragen. Zusätzlich können viele nordamerikanische und britische Sender über Satellit empfangen werden. Die BBC besitzt auch eine eigene Sendelizenz für terrestrische Übertragungen. Einige Sender werden auch über das Internet verbreitet. Die Auswahl an Radiosendern ist groß, sowohl lokal als auch landesweit. Der erste Sender erhielt seine Lizenz bereits 1940. Heute verfügen 19 Unternehmen und Organisationen über eine Sendeerlaubnis. Der Staat hat sich seit Ende der 1990er Jahre aus dem Medienbereich zurückgezogen. Lediglich ein Radiosender verbleibt in öffentlicher Hand.
Trotz der weiten Verbreitung von Fernsehen und Radio sind Tageszeitungen nach wie vor die wichtigste Informationsquelle für die Bevölkerung. Vier Zeitungen erreichen eine Auflage von mehr als 100.000 Exemplaren, Daily Gleaner, Daily Star, Jamaica Observer und Jamaica Herald. Der Gleaner wurde 1834 gegründet und ist die älteste noch existierende Zeitung der Karibik.
Zeitungen:
- Jamaica Gleaner, Oldest Jamaican daily
- Jamaica Observer, Jamaican daily
- Jamaica Star, Jamaican daily
- Western Mirror
- Jamaica Information Service (JIS)
Radiosender:
| Sendername | Frequenz | Genres | Standort |
| RJR 94 FM | 94.1 MHz | Reggae, Nachrichten, Talk | Kingston |
| Nationwide 90FM | 90.3 MHz | Nachrichten, Talk, Sport | Kingston |
| Fame FM | 95.7 MHz | Hip-Hop, R&B, Pop, Reggae | Kingston |
| Hitz 92 FM | 92.1 MHz | Talk, Reggae, Pop | Kingston |
| Love 101 FM | 101.1 MHz | Gospel, Talk, Nachrichten | Kingston |
| Mello FM | 88.1 MHz | Reggae, Talk, Nachrichten | Montego Bay |
| Gospel JA | 91.7 MHz | Gospel, Reggae, Caribbean Music | Kingston |
| IRIE FM | 107.1–107.9 MHz | Reggae, Dancehall | Ocho Rios |
| Kool 97 FM | 97.1 MHz | R&B, Soul, Jazz, Reggae | Kingston |
| Zip 103 FM | 103.0 MHz | Top 40, Caribbean Music | Kingston |
| Roots 96.1 FM | 96.1 MHz | Reggae, Dancehall, Talk, Gospel | Kingston |
| NCU FM | 91.1–91.5 MHz | Gospel, Bildung, Wellness, Talk | Mandeville |
| TBC Radio 88.5 | 88.5 MHz | Nachrichten, Talk, Gospel | Kingston |
| KLAS Omega | 89.1–89.9 MHz | Sport, Nachrichten, Talk, Gospel | Kingston |
| SunCity 104.9 FM | 104.9 MHz | Reggae, Rock, Nachrichten | Montego Bay |
Fernsehsender:
Kingston
- Ination TV
- Love TV Channel 6, Kingston, Jamaica / St. Andrew
- TVJ ZQI-TV Channel 11, Kingston
- Love TV Channel 17, Kingston, Jamaica / St. Andrew
- CETv! The Family Network (Cable)
- ( CVM TV Channel 9, (Kingston / St. Andre)
- HYPE TV (cable & DirecTV)
- RE TV (cable only)
- JUICE TV (Mandeville, Jamaica)
- Mercy and Truth Ministries Television channel 671, channel 94 and channel 745(MTM TV), Kingston Jamaica
- SportsMax (cable only)
Montego Bay
- Love TV Channel 2 Montego Bay
- TVJ Channel 9, Montego Bay / Flower Hill, Jamaica
- CVM TV Channel 11 Montego Bay, Jamaica / Flower Hill, Jamaica
- Mercy and Truth Ministries Television (MTM TV) Channel 671 on FLOW
Port Antonio
- TVJ Channel 8, Port Antonio
- CVM TV Channel 13, Port Antonio
- Ocho Rios (Lillyfield)
- Love TV Channel 3 Ocho Rios, Jamaica (Lillyfield)
- CVM TV Channel 10 Ocho Rios, Jamaica (Lillyfield)
- Mercy and Truth Ministries Television (MTM TV) channel 68
Coopers Hill
- TVJ Channel 7, Coopers Hill, Jamaica
- CVM TV Channel 9, Coopers Hill, Jamaica
Andere Gebiete in Jamaika
- CVM TV Channel 4, Marley Hill, Jamaica
- Love TV Channel 8, Huntley, Jamaica
- TVJ Channel 9, Yallahs, Jamaica
- TVJ Channel 10
- CVM TV]Channel 12, Cabbage Hill, Jamaica
- TVJ Channel 12, Oracabessa, Jamaica
- TVJ Channel 13, Huntley, Jamaica
- CETv! The Family Network Portmore, Spanish Town, St. Andrew
- TVJ Channel 10, Morant Bay, St. Thomas
- CVM TV Channel 12, Morant Bay, St. Thomas
- MTM TV channel 69 (St. Ann) Channel 671 FLOW
- Kabelsender
- Hype TV - Premiere Caribbean Entertainment TV Station mit Sitz in Kingston
- Logic One Limited - Digital Picture Perfect Cable Tv
- RE TV - Musik und Unterhaltung
- TVJ SPORTS NETWORK - Sportsender mit Sitz in Kingston
- CVM PLUS - Sportsender mit Sitz in Kingston
- CaribV Tv - karibische Familienunterhaltung
- CTV - führender Kultursender des Landes
- SportsMax - einziger 24-Stunden-Kanal mit Sitz in Kingston
- JUICE TV Jamaica - Kultur- und Unterhaltungskanal mit Sitz in Mandeville
Kommunikation
Jamaika hat die Telefonvorwahl 001876. Das Land verfügt über ein Kommunikationssystem mit vollautomatischer Vermittlung. Seit 1997 wird das ehemalige Monopol des Anbieters Cable and Wireless immer weiter aufgehoben. 2001 erhielten die irische Digicel und Oceanic Digital die Lizenz zum Betrieb eines Funktelefonnetzes, die Telefonleitungen blieben im Besitz von Cable and Wireless. In der Folge reduzierte sich die Anzahl der Festnetzanschlüsse von über einer Million auf 390.700 im Jahr 2004, während sich die Zahl der benutzten Mobiltelefone auf über 2,2 Millionen erhöhte. Der Mobilmarkt ist unter den drei Anbietern umkämpft. Alle haben in den vergangenen Jahren große Summen in den Ausbau ihrer Netze investiert, die heute fast vollständig mit dem GSM Standard arbeiten. Auslandsgespräche werden entweder über Satelliten der Firma Intelsat abgewickelt oder über eines der drei unterseeischen Datenkabel.
2005 benutzten rund eine Million Menschen das Internet. Die meisten besuchten Internetcafés, die vor allem in den Städten zu finden sind. In Bibliotheken und Schulen stehen meistens Rechner zur Verfügung, der Zugang zum Internet ist meist auf freigegebene Seiten (jugendfrei, nicht gewaltverherrlichend) beschränkt.
Das Postwesen wurde 1663 von Gouverneur Thomas Lynch eingeführt und ist damit das älteste in einer englischen Kolonie. Es war auf Kingston beschränkt und hatte keinen langen Bestand. 1846 wurden die ersten Briefmarken eingeführt und seit 1858 lag die Kontrolle über das Postsystem in Händen der Lokalverwaltung. Heute ist die staatliche Postal Corporation of Jamaica für Brief- und Paketversand zuständig. Sie ist in verschiedenen anderen Geschäftsbereichen tätig, wie etwa im Finanzsektor. Einem Postmaster General und zwei Stellvertretern unterstehen 2600 Mitarbeiter. Dazu kommen private Geschäftsleute, die im Auftrag der Post Agenturen in ihren Läden führen.
Sport
Die am weitesten verbreitete Sportart in Jamaika ist Cricket. Es kam mit den Briten auf die Insel und verbreitete sich ab dem Ende des 19. Jahrhunderts unter der Bevölkerung. Die ersten international erfolgreichen Sportler des Landes waren Cricketspieler, die vor allem in Großbritannien unter Vertrag standen. Diese Erfolge in einer Sportart, die ursprünglich von den Kolonialherren dominiert wurde, trugen zur Bildung des Nationalbewusstseins der Jamaikaner bei. Heute stehen zwei große Cricketstadien zur Verfügung, Sabina Park in Kingston mit einer Kapazität von 21.000 und das neu errichtete Greenfield Stadium im Trewlany Parish mit 25.000 Sitzplätzen. Auf internationaler Ebene tritt Jamaika zusammen mit anderen Karibikstaaten im West Indian cricket team auf. 2007 wurde unter anderem eines der Halbfinale des Cricket World Cup 2007 auf der Insel ausgetragen.
Die größte internationale Aufmerksamkeit erregten die Leichtathleten. Bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki gewann die 4x400-Meter-Staffel Gold gegen die favorisierten US-Amerikaner. Dazu kam noch eine weitere Goldmedaille über 400 Meter und drei Silbermedaillen. Die beteiligten Sportler werden auf Jamaika heute noch als Helden verehrt. Gerade die Läufer konnten sich bei Olympia und den Commonwealth Games immer wieder durchsetzen. Bei den Commonwealth Games 2006 belegte das Land den 7. Platz mit 10 Goldmedaillen, bei den Olympischen Sommerspielen 2004 gewann Veronica Campbell die Goldmedaillen im 200-Meter-Lauf, ebenso war die 4x100-Meter-Staffel der Frauen erfolgreich. Bei beiden Veranstaltungen war Jamaika, gemessen an der Einwohnerzahl, eines der erfolgreichsten Länder. Jamaikanische Läufer verbesserten immer wieder Weltrekorde, zuletzt Usain Bolt über 100 und 200 Meter. Die Basis in der Leichtathletik ist groß, viele Kinder und Jugendliche versuchen ihren Idolen nachzueifern und sich nicht zuletzt eine sichere Einnahmequelle zu sichern. Es gibt verschiedene Programme, in denen durch Sport die Jugendlichen von der Straße geholt und damit dem Einfluss der kriminellen Banden entzogen werden sollen.
Das bisher größte sportliche Ereignis auf Jamaika war die Ausrichtung der British Empire and British Empire and Commonwealth Games 1966 in Kingston, an denen 1300 Sportler beteiligt waren. Das größte Stadion der Insel, Independence Park mit 36.000 Plätzen, wurde zu diesem Anlass errichtet.
Die Reggae Boyz, so der Spitzname der jamaikanischen Fußballnationalmannschaft, feierten 1998 ihren größten Erfolg bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. Nach der bisher einzigen erfolgreichen Qualifikation für die Endrunde schied die Mannschaft nach zwei Niederlagen und einem Sieg aus. 1991, 1998 und 2005 gewann sie die Fußball-Karibikmeisterschaft. Fußball hat es trotz der immer weiter steigenden Beliebtheit noch nicht geschafft, Cricket als beliebteste Sportart abzulösen.
Die jamaikanische Bobmannschaft erlangte Berühmtheit, als sie 1988 in Calgary an den Olympischen Winterspielen teilnahm. Der Film Cool Runnings erzählt die Geschichte.
Olympische Spiele
Die Jamaica Olympic Association wurde 1936 gegründet. Seit 1948 nehmen Sportler aus Jamaika an Olympischen Spielen teil. 1960 starteten die Jamaikaner für das Team der Westindischen Föderation.
Bislang konnten Sportler aus Jamaika 55 olympische Medaillen erringen (13 Gold, 25 Silber, 17 Bronze). 54 der Medaillen wurden in der Leichtathletik gewonnen, 51 davon in Sprint- und Hürdenlauf-Disziplinen, zwei im 800-Meter-Lauf und eine im Weitsprung. 2008 wurden im 100-m-Finale der Damen zwei Silbermedaillen vergeben, da Sherone Simpson und Kerron Stewart zeitgleich ins Ziel kamen.
| Olympische Spiele | Athleten | Gold | Silber | Bronze | gesamt | Rang |
| 1948 London | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| 1952 Helsinki | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 |
| 1956 Melbourne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1960 Rom | Teil der British West Indies (BWI) | |||||
| 1964 Tokyo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1968 Mexico City | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 |
| 1972 München | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| 1976 Montreal | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 1980 Moskau | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 |
| 1984 Los Angeles | 45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 |
| 1988 Seoul | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 |
| 1992 Barcelona | 36 | 0 | 3 | 1 | 4 | 38 |
| 1996 Atlanta | 46 | 1 | 3 | 2 | 6 | 39 |
| 2000 Sydney | 45 | 0 | 6 | 3 | 9 | 54 |
| 2004 Athen | 47 | 2 | 1 | 2 | 5 | 35 |
| 2008 Beijing | 50 | 5 | 4 | 2 | 11 | 15 |
| 2012 London | 50 | 4 | 5 | 4 | 13 | 18 |
| 2016 Rio de Janeiro | 56 | 6 | 3 | 2 | 11 | 16 |
| 2020 Tokyo | 48 | 4 | 1 | 4 | 9 | 21 |
| 2024 Paris | 58 | 1 | 3 | 2 | 6 | 44 |
| insgesamt | 27 | 39 | 28 | 94 | 38 | |
Medaillengewinner
| Spiele | Sportart | Disziplin | Name |
| 1948 London | Leichtathletik | 400 Meter | Arthur Wint |
| 1952 Helsinki | Leichtathletik | 400 Meter | George Rhoden |
| 4 × 400-Meter-Staffel | Arthur Wint
Leslie Laing Herb McKenley George Rhoden | ||
| 1976 Montreal | Leichtathletik | 200 Meter | Donald Quarrie |
| 1996 Atlanta | Leichtathletik | 400 Meter Hürden | Deon Hemmings |
| 2004 Athen | Leichtathletik | 200 Meter | Veronica Campbell-Brown |
| 4 × 400-Meter-Staffel | Tayna Lawrence
Sherone Simpson Aleen Bailey Veronica Campbell-Brown Beverly McDonald | ||
| 2008 Peking | Leichtathletik | 100 Meter | Usain Bolt |
| 200 Meter | Usain Bolt | ||
| 100 Meter | Shelly-Ann Fraser-Pryce | ||
| 200 Meter | Veronica Campbell-Brown | ||
| 400 Meter Hürden | Melaine Walker | ||
| 2012 London | Leichtathletik | 100 Meter | Usain Bolt |
| 200 Meter | Usain Bolt | ||
| 4 × 100-Meter-Staffel | Nesta Carter
Michael Frater Usain Bolt Yohan Blake | ||
| 100 Meter | Shelly-Ann Fraser-Pryce | ||
| 2016 Rio de Janeiro | Leichtathletik | 100 Meter | Usain Bolt |
| 200 Meter | Usain Bolt | ||
| 4 × 100-Meter-Staffel | Asafa Powell
Yohan Blake Nickel Ashmeade Usain Bolt Kemar Bailey-Cole Jevaughn Minzie | ||
| 110 Meter Hürden | Omar McLeod | ||
| 100 Meter | Elaine Thompson | ||
| 200 Meter | Elaine Thompson | ||
| 2020 Tokio | Leichtathletik | 110 Meter Hürden | Hansle Parchment |
| 100 Meter | Elaine Thompson-Herah | ||
| 200 Meter | Elaine Thompson-Herah | ||
| 4 × 100-Meter Staffel | Briana Williams
Elaine Thompson-Herah Shelly-Ann Fraser-Pryce Shericka Jackson Natasha Morrison Remona Burchell | ||
| 2024 Paris | Leichtathletik | Diskuswurf | Rojé Stona |
Silbermedaillen
| Spiele | Sportart | Disziplin | Name |
| 1948 London | Leichtathletik | 400 Meter | Herb McKenley |
| 800 Meter | Arthur Wint | ||
| 1952 Helsinki | Leichtathletik | 100 Meter | Herb McKenley |
| 400 Meter | Herb McKenley | ||
| 800 Meter | Arthur Wint | ||
| 1968 Mexiko-Stadt | Leichtathletik | 100 Meter | Lennox Miller |
| 1976 Montreal | Leichtathletik | 100 Meter | Donald Quarrie |
| 1984 Los Angeles | Leichtathletik | 4 × 100-Meter-Staffel | Albert Lawrence
Greg Meghoo Donald Quarrie Raymond Stewart |
| 1988 Seoul | Leichtathletik | 4 × 400-Meter-Staffel | Howard Davis
Devon Morris Winthrop Graham Bert Cameron |
| 200 Meter | Grace Jackson | ||
| 1992 Barcelona | Leichtathletik | 400 Meter Hürden | Winthrop Graham |
| 100 Meter | Juliet Cuthbert | ||
| 200 Meter | Juliet Cuthbert | ||
| 1996 Atlanta | Leichtathletik | Weitsprung | James Beckford |
| 100 Meter | Merlene Ottey | ||
| 200 Meter | Merlene Ottey | ||
| 2000 Sydney | Leichtathletik | 4 × 400-Meter-Staffel | Michael Blackwood
Greg Haughton Christopher Williams Danny McFarlane Sanjay Ayre Michael McDonald |
| 400 Meter | Lorraine Fenton | ||
| 400 Meter | Deon Hemmings
Hürden | ||
| 100 Meter | Tayna Lawrence | ||
| 4 × 100-Meter-Staffel | Merlene Frazer
Tayna Lawrence Veronica Campbell-Brown Beverly McDonald Merlene Ottey | ||
| 4 × 400-Meter-Staffel | Sandie Richards
Catherine Scott Deon Hemmings Lorraine Fenton Charmaine Howell Michelle Burgher | ||
| 2004 Athen | Leichtathletik | 400 Meter Hürden | Danny McFarlane |
| 2008 Peking | Leichtathletik | 100 Meter | Sherone Simpson |
| 100 Meter | Kerron Stewart | ||
| 400 Meter | Shericka Williams | ||
| 2012 London | Leichtathletik | 100 Meter | Yohan Blake |
| 200 Meter | Yohan Blake | ||
| 200 Meter | Shelly-Ann Fraser-Pryce | ||
| 4 × 100-Meter-Staffel | Veronica Campbell-Brown
Shelly-Ann Fraser-Pryce Sherone Simpson Kerron Stewart | ||
| 2016 Rio de Janeiro | Leichtathletik | 4 × 400-Meter-Staffel | Nathon Allen
Fitzroy Dunkley Javon Francis Peter Matthews Rusheen McDonald |
| 4 × 100-Meter-Staffel | Christania Williams
Elaine Thompson Veronica Campbell-Brown Shelly-Ann Fraser-Pryce | ||
| 4 × 400-Meter-Staffel | Christine Day
Chrisann Gordon Shericka Jackson Anneisha McLaughlin-Whilby Stephenie Ann McPherson Novlene Williams-Mills | ||
| 2020 Tokio | Leichtathletik | 100 Meter | Shelly-Ann Fraser-Pryce |
| 2024 Paris | Leichtathletik | Weitsprung | Wayne Pinnock |
| Dreisprung | Shanieka Ricketts | ||
| 100 Meter | Kishane Thompson |
Bronzemedaillen
| Spiele | Sportart | Disziplin | Name |
| 1972 München | Leichtathletik | 100 Meter | Lennox Miller |
| 1980 Moskau | Leichtathletik | 200 Meter | Donald Quarrie |
| 200 Meter | Merlene Ottey | ||
| Radsport | 1000 Meter Zeitfahren | David Weller | |
| 1984 Los Angeles | Leichtathletik | 100 Meter | Merlene Ottey |
| 200 Meter | Merlene Ottey | ||
| 1992 Barcelona | Leichtathletik | 200 Meter | Merlene Ottey |
| 1996 Atlanta | Leichtathletik | 4 × 400-Meter-Staffel | Gregory Haughton
Michael McDonald Roxbert Martin Davian Clarke Dennis Blake Garth Robinson |
| 4 × 100-Meter-Staffel | Michelle Freeman
Juliet Cuthbert Nikole Mitchell Merlene Ottey Gillian Russell Andria Lloyd | ||
| 2000 Sydney | Leichtathletik | 400 Meter | Gregory Haughton |
| 200 Meter | Beverly McDonald | ||
| 100 Meter | Merlene Ottey | ||
| 2004 Athen | Leichtathletik | 100 Meter | Veronica Campbell-Brown |
| 4 × 400-Meter-Staffel | Ronetta Smith
Novlene Williams-Mills Nadia Davy Sandie Richards Michelle Burgher | ||
| 2008 Peking | Leichtathletik | 200 Meter | Kerron Stewart |
| 4 × 400-Meter-Staffel | Shericka Williams
Shereefa Lloyd Rosemarie Whyte Novlene Williams-Mills Bobby-Gaye Wilkins | ||
| 2012 London | Leichtathletik | 110 Meter Hürden | Hansle Parchment |
| 200 Meter | Warren Weir | ||
| 100 Meter | Veronica Campbell-Brown | ||
| 4 × 400-Meter-Staffel | Christine Day
Shereefa Lloyd Rosemarie Whyte Shericka Williams Novlene Williams-Mills | ||
| 2016 Rio de Janeiro | Leichtathletik | 100 Meter | Shelly-Ann Fraser-Pryce |
| 400 Meter | Shericka Jackson | ||
| 2020 Tokio | Leichtathletik | 110 Meter Hürden | Ronald Levy |
| 100 Meter | Shericka Jackson | ||
| 100 Meter Hürden | Megan Tapper | ||
| 4 × 400 Meter Staffel | Roneisha McGregor
Janieve Russell Shericka Jackson Candice McLeod Junelle Bromfield Stacey-Ann Williams Tovea Jenkins Stephenie Ann McPherson | ||
| 2024 Paris | Leichtathletik | 110 Meter Hürden | Rasheed Broadbell |
| Kugelstoßen | Rajindra Campbell |
Fußball
Der Fußball Jamaikas wird von der Jamaica Football Federation organisiert. Sie wurde bereits 1910 gegründet, ist aber erst seit 1962 Mitglied der FIFA und seit 1965 der CONCACAF. Höchste Division im Klubfußball ist die Jamaican National Premier League, in der seit 1972 insgesamt 12 Mannschaften um den Landesmeistertitel kämpfen. Die bisherigen jamaikanischen Fußballmeister waren:
- 1973/74 Santos F.C.
- 1974/75 Santos F.C.
- 1975/76 Santos F.C.
- 1976/77 Santos F.C.
- 1977/78 Arnett Gardens F.C.
- 1978/79 abandoned
- 1979/80 Santos F.C.
- 1980/81 Cavaliers F.C.
- 1981/82 no competition
- 1982/83 Tivoli Gardens F.C.
- 1983/84 Boys' Town F.C.
- 1984/85 Jamaica Defence Force
- 1985/86 Boys' Town F.C.
- 1986/87 Seba United F.C.
- 1987/88 Wadadah F.C.
- 1988/89 Boys' Town F.C.
- 1989/90 Reno F.C.
- 1990/91 Reno F.C.
- 1991/92 Wadadah F.C.
- 1992/93 Hazard United F.C.
- 1993/94 Violet Kickers F.C.
- 1994/95 Reno F.C.
- 1995/96 Violet Kickers F.C.
- 1996/97 Seba United F.C.
- 1997/98 Waterhouse F.C.
- 1998/99 Tivoli Gardens F.C.
- 1999/2000 Harbour View F.C.
- 2000/01 Arnett Gardens F.C.
- 2001/02 Arnett Gardens F.C.
- 2002/03 Hazard United F.C.
- 2003/04 Tivoli Gardens F.C.
- 2004/05 Portmore United F.C.
- 2005/06 Waterhouse F.C.
- 2006/07 Harbour View F.C.
- 2007/08 Portmore United F.C.
- 2008/09 Tivoli Gardens F.C.
- 2009/10 Harbour View F.C.
- 2010/11 Tivoli Gardens F.C.
- 2011/12 Portmore United F.C.
- 2012/13 Harbour View F.C.
- 2013/14 Montego Bay United
- 2014/15 Arnett Gardens
- 2015/16 Montego Bay United
- 2016/17 Arnett Gardens
- 2017/18 Portmore United
- 2018/19 Postmore United
- 2021 Cavalier
- 2022 Harbour View
- 2022/23 Mount Pleasant
- 2023/24 Cavalier
- 2024/25 Cavalier
Meistertitel:
| Club | Meister | Meistertitel |
| Portmore United | 7 | 1992/93, 2002/03, 2004/05, 2007/08, 2011/12, 2017/18, 2018/19 |
| Arnett Gardens | 5 | 1977/78, 2000/01, 2001/02, 2014/15, 2016/17 |
| Harbour View | 5 | 1999/00, 2006/07, 2009/10, 2012/13, 2022 |
| Tivoli Gardens | 5 | 1982/83, 1998/99, 2003/04, 2008/09, 2010/11 |
| Santos | 5 | 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1979/80 |
| Cavalier | 4 | 1980/81, 2021, 2023/24, 2024/25 |
| Montego Bay United | 4 | 1986/87, 1996/97, 2013/14, 2015/16 |
| Boys' Town | 3 | 1983/84, 1985/86, 1988/89 |
| Reno | 3 | 1989/90, 1990/91, 1994/95 |
| Waterhouse | 2 | 1997/98, 2005/06 |
| Violet Kickers | 2 | 1993/94, 1995/96 |
| Wadadah | 2 | 1987/88, 1991/92 |
| Jamaica Defence Force | 1 | 1984/85 |
| Mount Pleasant | 1 | 2022/23 |
Die jamaikanische Fußballnationalmannschaft, auch The Reggae Boyz genannt, ist die Auswahlmannschaft des karibischen Inselstaates Jamaika. Den bislang größten Erfolg konnte der jamaikanische Fußball in der Vorrunde der Fußballweltmeisterschaft 1998 in Frankreich feiern, wo man jedoch nach zwei Niederlagen gegen Argentinien (0:5) und Kroatien (1:3) und nur einem Sieg gegen Japan (2:1) scheiterte. Darüber hinaus gewann Jamaika die Fußball-Karibikmeisterschaft in den Jahren 1991, 1998, und 2005.
Im Rahmen der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika traf das Team in der zweiten Runde der CONCACAF-Zone auf die Bahamas. Mit einem Gesamtscore von 13:0 konnte man sich für die dritte Runde qualifizieren, wo man auf Mexiko, Honduras sowie Kanada trifft. Das erste Gruppenspiel gegen Kanada in Toronto endete 1:1. Das Gesamtscore der jamaikanischen Fußballnationalmannschaft bis Sepltember 2025 sieht wie folgt aus:
| Gegner | Sp | S | U | N | T+ | T- |
| Ägypten | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Antigua und Barbuda | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 5 |
| Argentinien | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| Aruba | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Australien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Bahamas | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Barbados | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 10 |
| Belize | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bermuda | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 |
| Bolivia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Bonaire | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Brasilien | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Britische Jungferninseln | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Bulgarien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cayman Inseln | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 8 |
| Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Costa Rica | 31 | 4 | 12 | 15 | 19 | 56 |
| Curaçao | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Dominica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Dominikanische Republik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ecuador | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| El Salvador | 33 | 10 | 8 | 5 | 26 | 16 |
| England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Frankreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Französisch Guyana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Grenada | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 9 |
| Guadeloupe | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| Guatemala | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 19 |
| Guyana | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 |
| Haiti | 33 | 19 | 4 | 10 | 50 | 36 |
| Honduras | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 48 |
| Indien | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Indonesien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Iran | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Irland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jordanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Japan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Kamerun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kanada | 27 | 8 | 7 | 12 | 24 | 35 |
| Katar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kolumbien | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Kuba | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 31 |
| Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Martinique | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Mexiko | 33 | 5 | 5 | 23 | 20 | 76 |
| Marokko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Neuseeland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Nicaragua | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Nigeria | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 |
| Nordmakedonien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Norwegen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Panama | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 31 |
| Paraguay | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| Peru | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| Puerto Rico | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| Saint Kitts und Nevis | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 7 |
| Saint Lucia | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 6 |
| Saint Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Saint Vincent und die Grenadinen | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 8 |
| Sambia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Saudi Arabien | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 |
| Schweden | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Schweiz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Serbien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Sint Maarten | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Südafrika | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| Südkorea | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Suriname | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 11 |
| Trinidad und Tobago | 75 | 32 | 15 | 28 | 91 | 91 |
| Uruguay | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| USA | 35 | 3 | 10 | 22 | 24 | 61 |
| U.S. Jungferninseln | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Venezuela | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cricket
Cricket ist eine der wichtigsten Sportarten der Insel dar, die von der britischen Kolonialzeit geprägt wurde. Als Teil der West Indies Cricket-Region hat Jamaika eine reiche Tradition im Cricket, die von legendären Spielern und Erfolgen geprägt ist, obwohl der Sport in den letzten Jahren vor Herausforderungen steht. Die Jamaica Cricket Association (JCA) verwaltet den nationalen Verband, und das Cricket wird auf allen Ebenen gespielt – von lokalen Schulmannschaften bis hin zu internationalen Wettbewerben. Mit einer Bevölkerung von rund 2,8 Millionen Menschen ist Cricket nicht nur ein Zeitvertreib, sondern ein Symbol für Disziplin, Gemeinschaft und nationalen Stolz, das eng mit dem Tourismus und der Jugendförderung verknüpft ist.
Die Wurzeln des Crickets auf Jamaika reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Der erste dokumentierte Match fand 1895 statt, als eine jamaikanische Auswahl gegen eine tourende englische Mannschaft unter Slade Lucas antrat. Aufgrund der geografischen Isolation spielte Jamaika jedoch erst ab 1964 regelmäßiges First-Class-Cricket. Als Gründungsmitglied der West Indies Cricket Board (heute Cricket West Indies) debütierten die ersten Jamaikaner 1928 im Test-Cricket: Freddie Martin und Karl Nunes traten im ersten Test der West Indies gegen England an. In den 1960er und 1970er Jahren erlebte das Cricket seinen Höhepunkt, als die West Indies unter Führung jamaikanischer Stars wie Michael Holding und Courtney Walsh zur dominanten Test-Macht wurde. Die 1980er und 1990er waren die "Ära des West Indies-Dominanz", mit Jamaika als Talentschmiede. Heute kämpft der Sport mit sinkender Popularität gegenüber Fußball und Leichtathletik, was durch begrenzte staatliche Förderung und fehlende internationale Matches in Jamaika verstärkt wird – so fand das T20 World Cup 2024 keinen einzigen Spieltag in Sabina Park statt.
Jamaika hat keine eigenständige internationale Mannschaft, sondern tritt als Region in karibischen Wettbewerben an. Das Jamaica Scorpions-Team (früher Jamaica national cricket team) ist die First-Class- und List-A-Auswahl, die in der Regional Four Day Competition und der Regional Super50 antritt. Die Scorpions haben 12 First-Class-Titel und 9 One-Day-Siege errungen, was sie zur zweiterfolgreichsten Regionalmannschaft macht. Im T20-Format vertraten bis 2023 die Jamaica Tallawahs Jamaika in der Caribbean Premier League (CPL). Sie gewannen den Titel 2013 und 2016, spielten aber 2024 nicht mehr, da der Franchise nach Antigua verlegt wurde. Die Frauenmannschaft, die Jamaica Women‘s National Cricket Team, ist hoch erfolgreich: Sie gewann 2024 sowohl die Women's Super50 Cup als auch die Twenty20 Blaze und hat in der Vergangenheit dreimal die Regionalmeisterschaft geholt. Auf Schulebene, etwa an der Jamaica College, blüht der Sport besonders, mit Turnieren wie dem Issa T20. Jamaika hat unzählige Ikonen hervorgebracht, die die West Indies prägten. Zu den Legenden zählen:
- George Headley (1909 bis 1983): Der „Black White“ war der erste große jamaikanische Batsman und erzielte über 2.000 Test-Runs.
- Michael Holding („Whispering Death“): Der schnelle Fast-Bowler dominierte in den 1970er/80er Jahren mit 249 Test-Wickets.
- Courtney Walsh: Mit 519 Test-Wickets der erfolgreichste jamaikanische Bowler, der bis 2001 spielte.
- Chris Gayle („Universe Boss“): Der T20-Rekordhalter mit über 14.000 Runs, der Jamaika in der CPL glänzen ließ.
- Andre Russell: Allrounder und T20-Spezialist, der mit explosiven Schlägen und Bowls international glänzt.
- Frauenstars wie Stafanie Taylor, die als Kapitänin und Allrounderin die Women's Super50 dominierte.
Insgesamt haben 83 Jamaikaner für die West Indies getestet, was 21,6 % der Gesamtspieler ausmacht. Auch der Schiedsrichter Steve Bucknor OJ ist ein jamaikanisches Urgestein.
Baseball
Obwohl es nie zu einem Massensport wurde, hat Jamaika dennoch talentierte Spieler hervorgebracht, die in den Major Leagues (MLB) glänzten, und eine nationale Mannschaft, die sporadisch an internationalen Wettbewerben teilnimmt. Der Sport wird von der Jamaica Baseball Association (JBA), gegründet 1933, organisiert, die lokale Ligen fördert und den Fokus auf Jugendentwicklung legt. In einer Zeit, in der Leichtathletik Jamaika weltberühmt macht, bleibt Baseball ein Symbol für kulturellen Austausch und individuelle Erfolge.
Die Wurzeln des Baseballs auf Jamaika reichen in die Kolonialzeit zurück. Erste Spiele wurden in den 1890er Jahren in Kingston gespielt, wo amerikanische Einflüsse stark waren. In den frühen 1900er Jahren entstanden erste lokale Teams in Gemeinden, und der Sport gewann an Popularität als Freizeitaktivität. Die JBA wurde 1933 gegründet, um den Baseball zu regulieren und Turniere zu organisieren. Ein Meilenstein war die Einladung zur Amateur World Series 1939 in Havanna, Kuba, die Jamaika jedoch ablehnte. In den 1950er und 1960er Jahren wuchs der Sport durch Auswanderung und Medien, doch die Integration in die MLB blieb selten. Der erste Jamaikaner in der MLB war Patrick „Pat“ Corcoran 1953, aber der Durchbruch kam in den 1980er Jahren mit Spielern wie Devon White. Heute ist Baseball vor allem in urbanen Zentren wie Kingston und Montego Bay verbreitet, mit Fokus auf Jugendprogramme, die durch die JBA und internationale Partner wie MLB International unterstützt werden. Trotz Hurrikanen und begrenzter Ressourcen hält der Sport an, oft verbunden mit der Diaspora in den USA.
Jamaika hat keine professionelle Liga auf dem Niveau der MLB, sondern regionale und nationale Wettbewerbe. Die JBA organisiert die Jamaica Baseball League, eine Amateurliga mit Teams aus Kingston, St. Ann und anderen Parishen, die jährlich Meisterschaften austrägt. Lokale Clubs wie die Kingston Dodgers oder die Montego Bay Yankees inspirieren sich an US-Teams und dienen der Talentförderung. Die Jamaica National Baseball Team repräsentiert das Land international und hat an Events wie dem Caribbean Baseball Cup und den Pan American Games teilgenommen, wo es gegen Nachbarn wie die Dominikanische Republik antritt. Auf Schulebene blühen Programme in Institutionen wie der Jamaica College, die Baseball als Alternative zu Cricket anbieten. Die Liga umfasst etwa 20–30 Teams, mit Spielen auf Feldern wie dem National Baseball Stadium in Kingston, das für internationale Matches genutzt wird.
Jamaika hat sechs Spieler hervorgebracht, die in der MLB gespielt haben - eine kleine Zahl, die den Status des Sports unterstreicht. Die wichtigsten Baseballspieler sind:
- Devon White (geb. 1962 in Kingston): Der erfolgreichste Jamaikaner, ein 3-facher All-Star und Gold-Glove-Gewinner als Center Fielder. Er gewann mit den Toronto Blue Jays die World Series 1992 und 1993 sowie mit den Florida Marlins 1997. White spielte von 1985 bis 2001 für Teams wie die Angels und Yankees und ist ein Idol für jamaikanische Jugendliche.
- Chili Davis (geb. 1960, jamaikanische Wurzeln): Ein vielseitiger Outfielder und DH, der von 1981 bis 1999 aktiv war. Er gewann mit den New York Yankees die World Series 1998 und 1999 und ist einer der wenigen Jamaikaner mit über 1.500 MLB-Hits.
- Patrick „Pat“ Corcoran (geb. 1931): Der erste Jamaikaner in der MLB (1953 mit den Boston Red Sox), ein Pitcher mit kurzer Karriere.
- Aktuelle Stars: Triston McKenzie (Pitcher für die Cleveland Guardians, jamaikanische Herkunft) und Josh Naylor (First Baseman bei den Guardians), die seit 2020 spielen und die jamaikanische Legacy fortsetzen. Sie haben 2023 über ihre Wurzeln gesprochen und betonen die Rolle von Jackie Robinson für schwarze Spieler.
Diese Spieler haben Jamaika international bekannt gemacht und inspirieren Programme wie MLB's „Jamaica Baseball Development“.
Basketball
Basketball auf Jamaika ist ein dynamischer und wachsender Sport, der in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen hat, obwohl er im Schatten der dominierenden Disziplinen Leichtathletik und Cricket steht. Die Insel hat sich eine starke Präsenz in der Karibik und international erarbeitet, insbesondere durch die Nationalmannschaft und NBA-Talente. Der Sport wurde in den 1950er Jahren durch US-Einflüsse eingeführt und wird von der Basketball Federation of Jamaica (BFJ), gegründet 1961, organisiert. Basketball dient nicht nur als Freizeitaktivität, sondern fördert auch Jugendentwicklung, Gemeinschaft und den Tourismus, mit Events in urbanen Zentren wie Kingston und Montego Bay. Im Jahr 2025 bereitet sich Jamaika auf die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2028 vor, unterstützt durch Programme wie den National Youth Basketball League.
Basketball kam in den 1950er Jahren über amerikanische Missionare und Militärbasen auf die Insel, mit ersten organisierten Spielen in Schulen und Gemeindezentren. Die BFJ trat 1963 der FIBA bei, was den Einstieg in internationale Wettbewerbe ermöglichte. Der erste Meilenstein war die Teilnahme an den Pan American Games 1967. In den 1980er und 1990er Jahren wuchs die Popularität durch die NBA und Stars wie Patrick Ewing, was zu einer Boom-Phase führte. Die 2000er Jahre markierten den Aufstieg der Nationalmannschaft, die 2006 erstmals bei der FIBA Americas teilnahm. Ein Höhepunkt war die Qualifikation für die Basketball-Weltmeisterschaft 2019 in China, wo Jamaika in der Vorqualifikation glänzte. Die COVID-19-Pandemie bremste den Sport, doch 2024 feierte die Mannschaft Erfolge in der AmeriCup-Qualifikation. Bis 2025 hat die BFJ über 50.000 registrierte Spieler, mit Fokus auf Inklusion von Frauen und Jugendlichen.
Die Jamaica National Basketball Team, bekannt als „Reggae Boyz“ (im Basketball-Kontext), ist die Männerauswahl, die in FIBA-Wettbewerben antritt. Sie erreichte 2019 ihr bisheriges Highlight und qualifizierte sich 2025 für die FIBA AmeriCup, wo sie gegen Teams wie die USA und Puerto Rico antrat. Die Frauenmannschaft, die „Reggae Girlz“, ist ebenfalls aufstrebend und gewann 2023 die Caribbean Basketball Championship. Auf nationaler Ebene dominiert die National Basketball League (NBL) of Jamaica, eine professionelle Liga mit acht Teams wie den Titans, Stingers und Wolmers, die seit 2015 jährlich ausgetragen wird. Die Jamaica Senior Basketball League (JSBL) ergänzt sie für Amateure. Auf Schulebene fördern Turniere wie die Inter-Secondary Schools Sports Association (ISSA) Championships den Nachwuchs, mit starken Programmen an der Wolmers School und der Jamaica College. Internationale Spiele finden oft im National Indoor Sports Centre (NISC) in Kingston statt, das Tausende Fans anzieht.
Jamaika hat mehrere NBA-Stars hervorgebracht, die den Sport global bekannt machten:
- Patrick Ewing: Der legendäre Center der New York Knicks (1985 bis 2000) gewann 11 All-Star-Auszeichnungen und führte die Knicks zu zwei NBA-Finals. Als Jamaikaner (geboren in Kingston) ist er ein Pionier und Hall-of-Famer.
- Sam Dalembert: Center, der für Teams wie die 76ers und Bucks spielte (2001 bis 2017), bekannt für seine Block-Shots und Rebounds.
- Nick Fazekas: Forward mit jamaikanischen Wurzeln, der in der NBA und Europa aktiv war.
- Aktuelle Stars: Chasson Randle (Point Guard, spielte für die Knicks und Warriors) und Kassius Robertson (Guard, der 2024 in der G-League glänzte). Frauen wie Asha Daniels und Trinidad Lofton dominieren die karibische Szene. Viele Spieler, darunter Ewing, engagieren sich in der Diaspora und fördern Camps auf der Insel.
Im Jahr 2025 ist Basketball auf Jamaika im Aufwind: Die Nationalmannschaft qualifizierte sich für die FIBA Olympic Qualifying Tournament 2024 (obwohl nicht qualifiziert, ein Fortschritt) und plant für 2025 eine Tour durch die USA. Die NBL expandiert mit neuen Sponsoren wie Red Stripe, und Jugendprogramme wie „Hoop Life“ erreichen über 10.000 Kinder. Herausforderungen umfassen begrenzte Finanzierung, veraltete Infrastruktur und die Konkurrenz durch andere Sportarten, doch Partnerschaften mit der NBA (z. B. Basketball Without Borders) und der FIBA stärken den Sektor. Der Klimawandel und Hurrikane wie Beryl 2024 beeinträchtigen Trainings, doch resiliente Communitys halten den Sport am Leben.
Leichtathletik
Jamaika hat bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften eine beeindruckende Medaillenbilanz, die von ikonischen Athleten wie Usain Bolt, Shelly-Ann Fraser-Pryce und Elaine Thompson-Herah geprägt ist. Der Erfolg basiert auf einer Kombination aus Talentförderung, kultureller Leidenschaft für den Sport und einem robusten System aus Schulwettbewerben und Vereinen. Die Leichtathletik trägt zudem zum Tourismus bei, etwa durch Events wie die Racers Grand Prix, und stärkt die Wirtschaft durch Sponsoring und internationale Anerkennung.
Die Leichtathletik auf Jamaika hat ihre Wurzeln in der Kolonialzeit, als britische Schulen wie die Jamaica College Sportprogramme einführten. Der Durchbruch kam jedoch nach der Unabhängigkeit 1962, als Jamaika begann, bei internationalen Wettbewerben wie den Olympischen Spielen aufzutreten. Der erste große Star war Herb McKenley, der 1948 und 1952 olympische Medaillen gewann. Seit den 1980er Jahren dominieren jamaikanische Sprinter die Weltranglisten, insbesondere in den Disziplinen 100 m, 200 m und 4x100 m Staffel. Der kulturelle Stellenwert des Sports zeigt sich in den Inter-Secondary Schools Sports Association (ISSA) Championships, auch bekannt als „Champs“, die jährlich in Kingston Tausende begeistern und als Talentschmiede gelten. Diese Veranstaltung, die über 30.000 Zuschauer anzieht, hat Stars wie Bolt und Fraser-Pryce hervorgebracht. Die Leichtathletik ist ein Symbol für jamaikanische Resilienz und Stolz, inspiriert durch die Rastafari-Philosophie und den Slogan „One Love“.
Jamaika hat eine Reihe von Weltklasse-Athleten hervorgebracht, die Rekorde und Medaillen sammelten:
- Usain Bolt: Der „schnellste Mann der Welt“ hält die Weltrekorde über 100 m (9,58 Sekunden) und 200 m (19,19 Sekunden) und gewann acht olympische Goldmedaillen (2008–2016). Sein Charisma machte ihn zur globalen Ikone.
- Shelly-Ann Fraser-Pryce: Die „Pocket Rocket“ gewann drei olympische Goldmedaillen (100 m, 200 m) und zahlreiche WM-Titel; 2025 ist sie noch aktiv und ein Vorbild für junge Athletinnen.
- Elaine Thompson-Herah: Mit fünf olympischen Goldmedaillen (100 m, 200 m, 4x100 m) setzte sie 2021 bei den Tokyo Olympics neue Maßstäbe.
- Veronica Campbell-Brown: Mehrfache Olympiasiegerin über 200 m und in der Staffel, bekannt für ihre Konstanz.
- Männliche Stars wie Michael Frater, Asafa Powell und Yohan Blake prägten ebenfalls die Sprintszene, während Shericka Jackson 2024 die 200 m dominierte.
Seit 1948 hat Jamaika über 80 olympische Medaillen in der Leichtathletik gewonnen, davon die meisten im Sprint und in der Staffel. 2024 sicherten Athleten wie Kishane Thompson und Oblique Seville Medaillen bei den Paris Olympics, während Jaydon Hibbert im Dreisprung glänzte.
Die Jamaica Athletics Administrative Association (JAAA) ist der Dachverband, der nationale und internationale Wettbewerbe organisiert, darunter die JAAA National Championships, die als Qualifikation für globale Events dienen. Vereine wie MVP Track Club und Racers Track Club, geleitet von Trainern wie Glen Mills, sind für die Talentförderung entscheidend. Schulen wie Calabar High und St. Jago High dominieren die Champs, während die University of Technology (UTech) und die G.C. Foster College Trainer und Athleten ausbilden. Die Regierung unterstützt den Sport durch das Sports Development Agency (SDA), das Stipendien und Infrastruktur wie das National Stadium in Kingston finanziert. Internationale Sponsoren wie Puma und Digicel fördern Stars wie Bolt, während Veranstaltungen wie der Racers Grand Prix und der Gibson McCook Relays die Insel auf die Weltbühne bringen.
Problembereich der jamaikanischen Leichtathletik SIND Finanzierungsmangel für Nachwuchsprogramme, begrenzte Trainingsinfrastruktur in ländlichen Gebieten und die Konkurrenz durch andere Sportarten wie Fußball bedrohen das Wachstum. Dopingvorwürfe haben den Ruf einzelner Athleten belastet, obwohl strenge Kontrollen durch die Jamaica Anti-Doping Commission (JADCO) bestehen. Der Klimawandel, mit Hurrikanen wie Beryl 2024, beeinträchtigt Trainingsbedingungen und Veranstaltungen. Dennoch bleibt der Ausblick positiv: Die JAAA plant, bis 2030 die Jugendförderung durch digitale Plattformen und internationale Partnerschaften auszubauen, etwa mit der World Athletics. Neue Talente wie Tina Clayton und Briana Lyston signalisieren eine starke Zukunft.
Wassersport
Jamaika bietet ein ideales Umfeld für Aktivitäten wie Tauchen, Schnorcheln, Surfen und Bootsfahrten, die eng mit dem Tourismus verknüpft sind, der etwa 30 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmacht. Die warmen Karibikwässer mit Sichtweiten von bis zu 30 Metern und einer reichen Unterwasserwelt laden zu ganzjährigem Sport ein, wobei Orte wie Montego Bay, Negril, Ocho Rios und Port Antonio als Hotspots gelten. Viele Hotels und Resorts integrieren Wassersportangebote direkt, oft mit Ausrüstung und Kursen für Anfänger und Profis. Trotz Hurrikanrisiken wie Beryl 2024 bleibt der Sektor resilient, mit Fokus auf Nachhaltigkeit durch Korallenriff-Schutz und umweltfreundliche Praktiken.
Die vielfältigen Wassersportarten spiegeln die geographische Vielfalt Jamaikas wider. Tauchen und Schnorcheln dominieren, dank gesunder Riffe wie denen in Montego Bay Marine Park, wo Taucher Ammenhaie, Stachelrochen, Meeresschildkröten und bunte Korallenformationen beobachten können. Beliebte Spots umfassen Shark's Reef mit faulenzenden Haien oder das Wrack-Tauchspot in 18 Metern Tiefe, der zu den besten in Jamaika zählt. PADI-zertifizierte Zentren in Negril oder Port Antonio bieten Kurse und geführte Touren, die Delfine und tropische Fische garantieren. Für Oberflächenaktivitäten eignen sich Wasserski, Jetski und Parasailing, die in Resorts wie denen in Seven Mile Beach angeboten werden, wo man bei Sonnenuntergang über das glasklare Meer gleitet.
Surfen, Windsurfen und Kitesurfen ziehen Adrenalinjunkies an, besonders an der Südwestküste in Negril, das als Paradies für Wellenreiter gilt. Hier können Anfänger und Profis Wellen mit bis zu zwei Metern Höhe reiten, während Stand-up-Paddling (SUP) für entspanntere Touren durch Mangroven oder Buchten ideal ist. An der Ostküste in Bull Bay finden Windsurfer starke Winde, und Camps wie Jamnesia bieten günstige Unterkünfte und Ausrüstung. Bootsfahrten und Kreuzfahrten, etwa auf dem Black River, kombinieren Sport mit Natur: Mit Kayaks oder Bambusflößen durch Flüsse gleiten, Krokodile und Vögel beobachten oder raften – ein Abenteuer, das in Port Antonio besonders authentisch ist. Wasserrutschen an Wasserfällen wie denen in Dunn's River oder das Reiten auf Pferden ins Meer runden das Angebot ab.
Wirtschaftlich ist der Wassersport ein Motor des Tourismus, der 2024 über 4,5 Milliarden USD einbrachte und Tausende Jobs schafft, von Guides bis zu Ausrüstungsverleihern. Die Regierung fördert den Sektor durch Programme wie den Blue Economy Plan, der nachhaltige Praktiken priorisiert, um Riffe vor Übernutzung zu schützen. Beliebte Veranstalter wie Tripadvisor und Viator listen Top-Touren, darunter Sunset-Cruises oder Delfin-Begegnungen, die oft mit Snacks und Cocktails einhergehen. Für Familien sind ruhige Buchten in Ocho Rios perfekt, während Abenteurer in Port Antonio die ursprüngliche Seite Jamaikas erleben.
Persönlichkeiten
Die wichtigsten aus Jamaika stammenden Persönlichkeiten sind:
- Nanny of the Maroons (um 1686 bis um 1733), Maroon-Führerin und Nationalheldin
- Mary Seacole (1805 bis 1881), Krankenschwester und Heldin des Krimkriegs
- Sam Sharpe (1801 bis 1832), Sklavenaufständischer und Nationalheld
- Paul Bogle (um 1822 bis 1865), Baptistenprediger und Unabhängigkeitskämpfer
- George William Gordon (1820 bis 1865), Politiker und Abolitionist
- H.G. de Lisser (1878 bis 1944), Schriftsteller und Journalist
- Alexander Bustamante (1884 bis 1977), Gewerkschafter und erster Premierminister
- Marcus Garvey (1887 bis 1940), Panafrikanist und Aktivist
- Claude McKay (1889 bis 1948), Dichter und Schriftsteller der Harlem Renaissance
- Norman Manley (1893 bis 1969), Politiker und Nationalheld
- Edna Manley (1900 bis 1987), Bildhauerin und Künstlerin
- Una Marson (1905 bis 1965), Dichterin, Dramatikerin und Rundfunkpionierin
- Roger Mais (1905 bis 1955), Schriftsteller und Journalist
- Louise Bennett-Coverley (1919 bis 2006), Folkloristin und Dichterin
- Arthur Wint (1920 bis 1993), Leichtathlet und Olympiasieger
- Herb McKenley (1922 bis 2004), Leichtathlet
- Harry Belafonte (1927 bis 2023), Sänger, Schauspieler und Bürgerrechtsaktivist (jamaikanischer Abstammung)
- George Rhoden (1930 bis 2022), Leichtathlet und Olympiasieger
- Rex Nettleford (1936 bis 2010), Choreograf und Kulturtheoretiker
- Lee „Scratch“ Perry (1936 bis 2021), Reggae-Produzent und Musiker
- Millicent Stephenson (* 1936), Leichtathletin
- Toots Hibbert (1942 bis 2020), Ska- und Reggae-Musiker
- Jimmy Cliff (* 1944), Reggae-Musiker und Schauspieler
- Peter Tosh (1944 bis 1987), Reggae-Musiker und Aktivist
- Bob Marley (1945 bis 1981), Reggae-Musiker und Songwriter
- Portia Simpson-Miller (1945 bis ), Politikerin und ehemalige Premierministerin
- Bunny Wailer (1947 bis 2021), Reggae-Musiker und Wailers-Mitgründer
- Grace Jones (* 1948), Sängerin, Model und Schauspielerin
- Gregory Isaacs (1951 bis 2010), Reggae-Sänger
- Michael Holding (* 1954), Cricketspieler und Kommentator
- Dennis Brown (1957 bis 1999), Reggae-Sänger
- Merlene Ottey (* 1960), Leichtathletin und Sprinterin
- Courtney Walsh (* 1962), Cricketspieler
- Ziggy Marley (* 1968), Reggae-Musiker und Produzent
- Shaggy (* 1968), Reggae- und Dancehall-Musiker
- Sean Paul * (1973), Dancehall-Musiker und Rapper
- Buju Banton (* 1973), Reggae- und Dancehall-Musiker
- Beenie Man (* 1973), Dancehall-Musiker
- Vybz Kartel (* 1976), Dancehall-Musiker
- Damian Marley (* 1978), Reggae-Musiker und Rapper
- Chris Gayle (* 1979), Cricketspieler
- Veronica Campbell-Brown (* 1982), Leichtathletin und Sprinterin
- Asafa Powell (* 1982), Leichtathlet und Sprinter
- Tessanne Chin (* 1985), Sängerin und The Voice-Siegerin
- Usain Bolt (* 1986), Leichtathlet und Sprinter
- Shelly-Ann Fraser-Pryce (* 1986), Leichtathletin und Sprinterin
- Yohan Blake (* 1989), Leichtathlet und Sprinter
- Naughty Nykel (* 1990), Reggae- und Dancehall-Sängerin
- Chronixx (* 1992), Reggae- und Roots-Musiker
- Elaine Thompson-Herah (* 1992), Leichtathletin und Sprinterin
Fremdenverkehr
Jamaika, welche Flagge auf der Folie zu sehen ist, ist als Ferienziel von uns Europäern nicht sehr beliebt. Dies widerspiegelt sich darin, dass von allen Besuchern auf Jamaika nur gerade 7,9 % aus Europa her stammen. Das Problem liegt wohl darin, dass die Flugstrecke von Europa nach Jamaika einfach zu groß ist und dass Jamaika zu wenig für uns Europäer zu bieten hat.
Der Auslandsreiseverkehr hat seit den 1950er Jahren einen raschen Aufschwung genommen und ist inzwischen zum wichtigsten Devisenbringer geworden. Die Deviseneinnahmen aus dem Tourismus sind bis 1987 auf 595 Millionen US-$ gestiegen. Diese Einnahmen haben in den letzten Jahren die Höhe der Abgaben aus dem Bauxitsektor übertroffen. Das Land besitzt infolge der natürlichen Gegebenheiten (feinsandige Strände, klares Wasser, reiche Flora und Fauna) eine große Anziehungskraft für ausländische Besucher, die überwiegend aus den Vereinigten Staaten kommen.
Von den insgesamt 1,03 Millionen Auslandsgästen im Jahre 1987 waren 715.200 Langzeitbesucher mit einer Aufenthaltsdauer von drei und mehr Nächten, 23.700 waren Kurzzeitbesucher mit einer Aufenthaltsdauer von bis zu zwei Nächten und 291.900 Kreuzfahrtteilnehmer. Nahezu alle Besucher, die Kreuzfahrtgäste ausgeschlossen, kamen mit dem Flugzeug ins Land.
Der Ausbau des Reiseverkehrs wurde in den vergangenen Jahren unter anderem durch Steuervergünstigungen und Zollbefreiungen bei der Einfuhr von Bau- und Aurüstungsmaterialien für Hotelneu- und - Erweiterungsbauten gefördert. Die staatliche Reiseverkerhsbehörde (Jamaica Tourist Board) stellt Mittel für den Bau von Hotels bereit und fördert die Besucherwerbung enorm. Die Regierung Jamaikas hat die Absicht sich in diesem Sektor in ungeahnte Tiefen zu begeben, denn der Tourismus hält fast unerschöpfliche Ressourcen für Jamaika bereit.
Ein- und Ausreise:
Reisedokumente: Als Tourist (EU Bürger) braucht man für einen Aufenthalt unter 90 Tagen nur ein Touristen-Visum, das Sie bei der Einreise erhalten. Voraussetzung ist der jeweilige Reisepass mit einer Gültigkeit von mindestens 6 Monaten über den beabsichtigten Abreisezeitpunkt hinaus.
Impfungen: In Jamaika sind keine Impfungen gesetzlich vorgeschrieben, trotzdem sollte man auf einen ausreichenden Schutz gegen Tetanus, Diphtherie, Hepatitis A und B, sowie Polio nicht verzichten. Wer sich länger als 4 Wochen auf Jamaika aufhalten möchte, sollte sich auch gegen Tollwut und Typhus impfen lassen. Auf Jamaika besteht ein latentes Malariarisiko, deshalb auf konsequenten ganztägigen Mückenschutz achten. Auch Notfallmedikamente gegen Malaria, bzw. eine Chemoprophylaxe sind empfohlen. Da auf Jamaika auch die Mücken vorkommen, die das Dengue Fieber verursachen, gilt das konsequente Praktizieren von effektivem Mückenschutz auch hier.
Zollbestimmungen: Erwachsene (über 18 Jahre alt) können folgende Waren zollfrei einführen: 50 Zigarren oder 200 Zigaretten oder 1/2 Pfund (225 g) Tabak; ein Quart (0,946 l) Spirituosen und 336 ml Eau de Toilette. Für folgende Waren gilt ein Einfuhrverbot: Schnittblumen, Pflanzen, Honig, Obst, Fleisch und Gemüse (außer in Dosen), Kaffee (jeder Art), Waffen, Sprengstoffe und Rauschgift, wie zum Beispiel Marihuana. Für koschere Speisen sind besondere Unterlagen erforderlich.
Ausfuhr: Besucher dürfen 200 Zigaretten, 50 Zigarren, 1/2 Pfund Tabak, einen Liter Spirituosen, sowie Waren für den persönlichen Bedarf ausführen. In Jamaica hergestellte Waren sind zollfrei.
Reisen mit Kfz: Es gibt international bekannte Firmen aber auch zuverlässige kleinere Firmen. Einige haben Konzessionen für die internationalen Flughäfen, andere operieren in den Urlaubsgebieten. Das erforderliche Mindestalter für das Mieten eines Autos beträgt im Normalfall 25 Jahre. Einige Unternehmen gestatten Fahrern zwischen 21 und 25 Jahren das Mieten eines Autos - der Abschluss einer Zusatzversicherung wird dann allerdings vorausgesetzt. Der Mieter muss nur einen gültigen Führerschein vorlegen und als Pfand Bargeld, eine Kreditkarte oder Reiseschecks hinterlegen. Tankstellen haben sieben Tage in der Woche geöffnet. Eine Liste der Firmen ist beim Jamaica Tourist Board erhältlich.
Umgangsformen: Zur Begrüßung gibt man sich die Hand. Viele Jamaikaner sind sehr gastfreundlich, und man wird nicht selten zum Essen eingeladen. In diesem Fall ist ein kleines Geschenk angebracht. Außerhalb von Kingston nimmt man das Leben recht gelassen, die Leute sind gastfreundlich und offen. Afrikanische Kultur und Musik sind allgegenwärtig, der englische Einfluss aus der Kolonialzeit ist ebenso unverkennbar. Oft stößt man auf Schilder, die Jah Lives verkünden („Gott Lebt“, Jah ist der Name der Rastafarier für Gott). Der Besitz von Marihuana kann zu Gefängnisstrafen und Ausweisung führen. Vor allem sollte man nicht versuchen, Marihuana aus dem Land zu schmuggeln, Gefängnisstrafen drohen.
Kleidung: Tagsüber ist Freizeitkleidung üblich, Badebekleidung und Shorts gehören an den Strand oder Swimmingpool. Die Abendgarderobe reicht von lässig in Negril bis formell in anderen Touristengebieten, in denen in der Wintersaison unter Umständen Jackett und Krawatte zum Abendessen erwartet werden. Im Sommer ist die Garderobe ungezwungener.
Trinkgeld: In den meisten Hotels wird ein Bedienungsgeld von 10 bis 15 % berechnet. Darüber hinaus wird ein kleines Trinkgeld gerne gesehen. Ein Betrag in ähnlicher Höhe wird im allgemeinen in den Restaurants erwartet. In den meisten All-Inclusive Hotels ist das Geben von Trinkgeld unerwünscht. Bei Sehenswürdigkeiten erwarten die Guides ein kleines Trinkgeld.
Reisezeit: In der Regel wird der Zeitraum von Dezember bis April pauschal als die optimale Reisezeit für Jamaika bezeichnet. Die trockensten Monate sind dabei normalerweise Januar bis März. Als Monat mit den höchsten Niederschlagsmengen wird normal der Oktober bezeichnet.
Literatur
- wikipedia = https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Jamaica
- wikitravel = https://wikitravel.org/de/Jamaika
- wikivoyage = https://de.wikivoyage.org/wiki/Jamaika
Reiseberichte
- My Travel World: Reisebericht Jamaika = https://www.my-travelworld.de/jamaika/reisebericht-jamaika/
- ÖAMTC: Jamaika - mehr als Karibik-Klischees = https://www.oeamtc.at/autotouring/reise/reisebericht-jamaika-mehr-als-karibik-klischees-80638673
- Jamaika Rundreisen = https://www.jamaika-rundreisen.de/jamaika-reisebericht/
- Urlaubswelt: Reisebericht Jamaika = https://www.urlaubswelt.com/reiseberichte/reisebericht-jamaika/
Videos
- Flying over Jamaica = https://www.youtube.com/watch?v=4gy8uXH-E7Y
- Jamaica drone video = https://www.youtube.com/watch?v=_MZ7UZ5frCI
- Earth Stories: Jamaika = https://www.youtube.com/watch?v=9_VbKXtIdTc
- Grenzelos die Welt entdecken - Jamaika = https://www.youtube.com/watch?v=HkIBIENYydo
- Wonders of Jamaica = https://www.youtube.com/watch?v=ZRLLhoNmfMk
- Jamaika: Kingston, Dancehall, Biker-Gang = https://www.youtube.com/watch?v=AlkbxkPE1rM
- Real Stories: Das Leben auf der Reggaea-Insel = https://www.youtube.com/watch?v=g5YFN6uRajo
- Ganja, Rasta, Reggae - eine Geschichte von Jamiaka = https://www.youtube.com/watch?v=4lV151h69FE
- How Did Jamaica Become a County? = https://www.youtube.com/watch?v=pT0qnFO4gm0
Atlas
- Jamaika, openstreetmap = https://www.openstreetmap.org/#map=9/17.660/-77.646
- Jamaika, ADAC = https://maps.adac.de/land/jamaika
- Jamaika, Satellit = https://satellites.pro/Google/Jamaica_map
Reiseangebote
Jamaika Tourismus = https://www.visitjamaica.com/
Jamaika Studienreisen = https://at.studienreisen.de/laender/Jamaica
Forum
Hier geht’s zum Forumn: