Falkland (East Falkland): Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Seit fast zwei Jahrhunderten sind sie ein Zankapfel, die Falkland-Inseln. Frankreich hatte sie, Argentinien möchte sie und Großbritannien besitzt sie. Die wenigen Einwohner sind mit den Briten als Machthabern zufrieden. Die wahren Herren aber sind die Pinguine - mit mehr als einer Million Exemplaren gegenüber knapp 3.500 von der menschlichen Spezies bilden sie eindeutig die Bevölkerungsmehrheit. == '''Name''' == Als im Jahr 1520 der spanische Kapitä…“ |
|||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Mit dieser Namensgebung konnten sich die anderen Seemächte freilich nicht abfinden. Der französische Weltumsegler Louis-Antoine de Bougainville führte 1764 die Bezeichnung '''''Isles Malouines''''' ein. Der französische Ausdruck ''malouin'' bezieht sich auf den Heimathafen des Forschers, ''Saint-Malo'' in der Bretagne. Die Inselgruppe hieß demnach „Inseln von Saint-Malo“. Die spanischsprachigen Nachbarn machten daraus '''''Islas Malvinas''''' - und so nennt man die Inselgruppe in der romanischen Welt noch heute. | Mit dieser Namensgebung konnten sich die anderen Seemächte freilich nicht abfinden. Der französische Weltumsegler Louis-Antoine de Bougainville führte 1764 die Bezeichnung '''''Isles Malouines''''' ein. Der französische Ausdruck ''malouin'' bezieht sich auf den Heimathafen des Forschers, ''Saint-Malo'' in der Bretagne. Die Inselgruppe hieß demnach „Inseln von Saint-Malo“. Die spanischsprachigen Nachbarn machten daraus '''''Islas Malvinas''''' - und so nennt man die Inselgruppe in der romanischen Welt noch heute. | ||
[[Datei:Falkland Islands map.png|rechts]] | |||
* abchasisch: Фолклэнд [Folklend] | * abchasisch: Фолклэнд [Folklend] | ||
| Zeile 262: | Zeile 263: | ||
== '''Lage''' == | == '''Lage''' == | ||
Die Falkland-Inseln alias Malvinas liegen vor der Küste Argentiniens im südlichen Atlantik auf durchschnittlich 51°56’ s.B. und 59°31’ w.L.. Die zentralen Koordinaten für die Hauptinsel East Falkland lauten 51°55‘ s.B. und 58°33‘ w.L.. Sie befinden sich auf der gleichen geografischen Breite wie die zu Neuseeland gehörigen Auckland Islands sowie der äußerste Süden Chiles und Argentiniens. Die Falkland-Inseln sind 473 km von der patagonischen Küste entfernt. Ihre Küstenlänge beträgt insgesamt 3980 km. | Die Falkland-Inseln alias Malvinas liegen vor der Küste Argentiniens im südlichen Atlantik auf durchschnittlich 51°56’ s.B. und 59°31’ w.L.. Die zentralen Koordinaten für die Hauptinsel East Falkland lauten 51°55‘ s.B. und 58°33‘ w.L.. Sie befinden sich auf der gleichen geografischen Breite wie die zu Neuseeland gehörigen Auckland Islands sowie der äußerste Süden Chiles und Argentiniens. Die Falkland-Inseln sind 473 km von der patagonischen Küste entfernt. Ihre Küstenlänge beträgt insgesamt 3980 km. | ||
[[Datei:East Falkland.png|rechts|776x776px]] | |||
| Zeile 2.243: | Zeile 2.245: | ||
== '''Persönlichkeiten''' == | == '''Persönlichkeiten''' == | ||
Die wichtigsten Persönlichkeiten der Falklandinseln | Die wichtigsten mit Falkland verbundenen Persönlichkeiten sind: | ||
* James Strong (erwähnt 1690): Britischer Kapitän, der als erster die Meerenge zwischen den Falklandinseln „Falkland Channel“ nannte, nach der der Inselname abgeleitet wurde. | |||
* Louis-Antoine de Bougainville (1729 bis 1811): Französischer Offizier und Entdecker, der 1764 die erste dauerhafte Siedlung auf East Falkland gründete. Er nannte die Inseln „Îles Malouines“, woraus später der spanische Name „Malvinas“ entstand. | |||
* Luis Elías Vernet (1791 bis 1871): Ein Kaufmann mit US-amerikanischem Pass, der von der argentinischen Regierung 1828 zum ersten Gouverneur der Falklandinseln ernannt wurde. Er versuchte, die Robbenjagd zu regulieren und begründete wichtige Ansprüche Argentiniens auf die Inseln. | |||
* Gerald Cheek (* 1941): um 1980 Direktor der Zivilen Luftfahrt, spielte eine Schlüsselrolle beim Wiederaufbau des Flugdienstes nach dem Falklandkrieg | |||
== '''Fremdenverkehr''' == | == '''Fremdenverkehr''' == | ||
| Zeile 2.270: | Zeile 2.277: | ||
== '''Literatur''' == | == '''Literatur''' == | ||
* wikipedia = | * wikipedia = https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Falkland_Islands | ||
* wikitravel = | * wikitravel = https://wikitravel.org/en/Falkland_Islands | ||
* wikivoyage = | * wikivoyage = https://de.wikivoyage.org/wiki/Falklandinseln | ||
=== '''Reiseberichte''' === | === '''Reiseberichte''' === | ||
* The British Shop: Falklandinseln - eine Reise zum Ende der Welt (27.7.2024) = https://blog.the-british-shop.de/page/view/2024/07/die-falkland-inseln-eine-reise-zum-ende-der-welt<br />Sandra Schänzer: Falklandinseln (11. bis 18.1.2025) = https://www.sandra-schaenzer.de/falklandinseln.php | |||
* Travel Inspired: Falklandinseln - Reiseberichte = https://travelinspired.de/antarktis/falklandinseln/ | |||
=== '''Videos''' === | === '''Videos''' === | ||
* Falkland | * Falkland Islands 4k = https://www.youtube.com/watch?v=WOkAyEtVq8w | ||
* Der Falkland Krieg. Die wahre Geschichte des Konmflikts um die Malwinas = https://www.youtube.com/watch?v=Pqfzs9J4CvM | |||
* Warum die Briten die Dalklandinseln nicht abgeben = https://www.youtube.com/watch?v=5PzVhrHUHB8 | |||
* Warum will jemand auf den Falklandinseln leben = https://www.youtube.com/watch?v=RvYarKCId5c | |||
* Travel Discovery: Falkland Islands = https://www.youtube.com/watch?v=Np_kuhzwfVU | |||
=== '''Atlas''' === | === '''Atlas''' === | ||
* Falkland, openstreetmap = | * Falkland, openstreetmap = https://www.openstreetmap.org/#map=8/-51.971/-60.529 | ||
* Falkland, Satellit = | * Falkland, Satellit = https://satellites.pro/Falkland_Islands_map | ||
== '''Reiseangebote''' == | == '''Reiseangebote''' == | ||
Falkland Tourism = https://www.falklandislands.com/ | |||
Falklandinseln, Urlaub für Naturliebhaber = https://www.diamir.de/falklandinseln | |||
== '''Forum''' == | == '''Forum''' == | ||
Hier geht’s zum Forum: | Hier geht’s zum Forum: | ||
Version vom 3. Oktober 2025, 17:12 Uhr
Seit fast zwei Jahrhunderten sind sie ein Zankapfel, die Falkland-Inseln. Frankreich hatte sie, Argentinien möchte sie und Großbritannien besitzt sie. Die wenigen Einwohner sind mit den Briten als Machthabern zufrieden. Die wahren Herren aber sind die Pinguine - mit mehr als einer Million Exemplaren gegenüber knapp 3.500 von der menschlichen Spezies bilden sie eindeutig die Bevölkerungsmehrheit.
Name
Als im Jahr 1520 der spanische Kapitän Esteban Gómez im Dienste des spanischen Weltumseglers Fernão de Magalhães an der Inselgruppe vorbeisegelte, nannte er sie San Antonio gemeint hat, den heiligen Antonius. Seine Mannschaft aber hatte einen anderen Namen parat: Islas de Sansón y de los Patos „Inseln Samsons und der Enten“. Sebastian Cabot übernahm 1544 diese Bezeichnung und formte sie in Yas de Sansne um. Bartholomew Olives machte daraus 1562 Islas Santon, während Juan Martinez nach 1580 von den Islas de los Patos, den „Enteninseln“, berichtete.
Spätere Besucher benannten die Inseln nach sich selbst. John Davis etwa schrieb 1592 von Davis’ Southern Islands „Davis’ südliche Ländereien“, Richard Hawkins 1594 von Hawkins’ Maiden Land „Hawkins Jungfrauenland“ und der Holländer Sebald de Werth im Jahr 1600 von den Islas Sebaldinas („Sebaldinische Inseln“) bzw. Sebaldes. So blieb es eine Zeitlang, bis 1690 John Strong mit seiner Expedition hierhergelangte. Zum Dank an den Finanzier seiner Reise nannte er die die die Inselgruppe durchziehende Meerenge Falkland Channel nach Anthony Cary Fifth Viscount Falkland (1659 bis 1694). Woodes Rogers machte daraus 1708 die Bezeichnung Falkland’s Land. Der Name Falkland Islands findet sich erstmals im Jahr 1766 bei Captain John McBride.
Mit dieser Namensgebung konnten sich die anderen Seemächte freilich nicht abfinden. Der französische Weltumsegler Louis-Antoine de Bougainville führte 1764 die Bezeichnung Isles Malouines ein. Der französische Ausdruck malouin bezieht sich auf den Heimathafen des Forschers, Saint-Malo in der Bretagne. Die Inselgruppe hieß demnach „Inseln von Saint-Malo“. Die spanischsprachigen Nachbarn machten daraus Islas Malvinas - und so nennt man die Inselgruppe in der romanischen Welt noch heute.
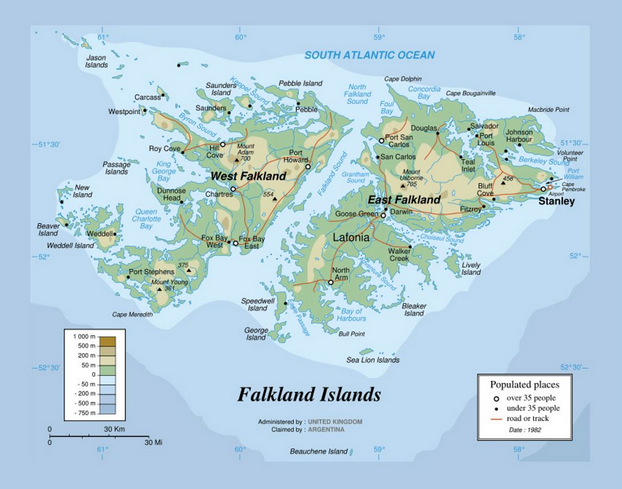
- abchasisch: Фолклэнд [Folklend]
- acehnesisch: Falkland
- adygisch: Фолклэнд [Folklend]
- afrikaans: Falkland
- akan: Fɔlkman Aeland
- albanisch: Ishujt Falkland
- alemannisch: Falkland
- altaisch: Фaкляндия [Fakljandija]
- amharisch: ፋልክላንድ [Falkland]
- angelsächsisch: Falkland
- arabisch: جزر فوكلاند [Juzur Fuklānd]
- aragonesisch: Islas Malbinas
- armenisch: Ֆալկլանդիա [Falklandia], Ֆոլկլենդյան կղզիներ [Folk’lendyan kghziner]
- aromunisch: Falkland
- aserbaidschanisch: Folkland
- assamesisch: ফকল্যান্ড [Fôkland]
- asturisch: Islles Malvinas
- awarisch: Фолклэнд [Folklend]
- aymara: Malvina
- bairisch-österreichisch: Foiklånd
- bambara: Maluwini Gun
- bandscharisch: Falkland
- baschkirisch: Фолкланд [Folkland]
- baskisch: Falklandak, Malvinak
- bengalisch: ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ [Fôkland Dwipponjo]
- bhutanisch: ཕཱལ་ཀ་ལནཌ་ [Phal-ka-land]
- biharisch: फॉकलैंड [Phokland]
- bikol: Islang Falkland
- birmanisch: ဖောက်လန်ကျွန်း ]Phauklan Kyun]
- bislama: Falkland
- bosnisch: Фокландска oстрва [Foklandska ostrva]
- bretonisch: Inizi Falkland
- bulgarisch: Фолкландските острови [Folklandskite ostrovi], Малвински острови [Malvinski ostrovi]
- burjatisch: Фoлклeнди [Folklendi]
- cebuano: Kapupud-ang Falkland
- chakassisch: Фoлкляндия [Folkljandija]
- chavakano: Falkland
- chinesisch: 福克兰群岛 [Fú kèlán qúndǎo]
- dari: Fōklend
- dänisch: alklandsøerne
- deutsch: Falkland, Falkland-Inseln
- emilianisch: Falkland
- englisch: Falkland, Falkland Islands
- esperanto: Falklandoj
- estnisch: Falklandi saared
- estremadurisch: Islas Malvinas
- ewe: Falkland ƒudomekpowo nutome
- färingisch: Falklandsoyggjar
- fidschianisch: Falkland
- finnisch: Falklandinsaaret
- flämisch: Falkland
- franko-provenzalisch: Iles Malvines
- französisch: Îles Malouines, Îles Falkland
- friesisch: Falklâneilannen
- friulanisch: Falkland
- ful: Duuɗe Falkland
- gagausisch: Falkland Adaları
- galizisch: Illas Malvinas
- ganda: Bizinga by'eFalikalandi
- gälisch: Eileanan Falkland
- georgisch: ფალკლენდის კუნძულები [Ṗoklandin kundzulebi]
- griechisch: Νήσοι Φώκλαντ [Nésoi Fôklant], Φόκλαντ [Fóklant], Φώλκλαντ [Fôlklant], Φάλκλαντ [Fálklant]
- grönländisch: Falklandi Qeqertaq
- guarani: Malvina
- gudscheratisch: ફૉકલૅન્ડ દ્વીપસમૂહ [Phōklæṇḍ Dvīpasamūh]
- guyanisch: Faklan
- haitianisch: Fokland, Foklann
- hakka: 法克蘭 [Fat-khak-lân]
- hausa: Tsibiran Falkilan
- hawaiianisch: Palakalan
- hebräisch: איי פוקלנד [ha-Iyim P’okland]
- hindi: फॉकलैंड [Phokland]
- ido: Falklandi
- igbo: Fokland
- ilokano: Falkland
- indonesisch: Falkland
- interlingua: Falkland
- irisch: Oileáin Falkland
- isländisch: Andkínaeyjar, Suðurfareyjar, Falklandseyjar
- italienisch: Isole Falkland
- jakutisch: Фолклэнд Aрыылара [Folklend Aryylara]
- jamaikanisch: Foklend
- japanisch: フォークランド諸島 [Fōkurando Shotō]
- jerseyanisch: Îles Malvines
- jiddisch: פֿאלקלאַנד [Falkland]
- kabardisch: Фолклэнд тIыгухэр [Folklend tygucher]
- kabylisch: Falkland
- kalmükisch: Фолкленд [Folkland]
- kambodschanisch: កោះហ្វូលខ្លែន [Kaoh Falkland]
- kanaresisch: ಫಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು [Phāklyānḍ dvīpagaḷu]
- kapverdisch: Ilhas Falkland
- karakalpakisch: Folklend Atawları
- karatschai-balkarisch: Фолкленд [Folkland]
- karelisch: Фaлкланд [Falkland]
- kasachisch: Фолкленд Aралдары [Folklend Arallary]
- kaschubisch: Falklandy, Malwiny
- katalanisch: Illes Malvines
- kikuyu: Visiwa vya Falkland
- kirgisisch: Фолкленд аралдары [Folkland araldary]
- komi: Фoлкляндия [Folkljandija]
- kongolesisch: Falkland
- koreanisch: 포클랜드 제도 [Pokŭllendŭ Jedo]
- kornisch: Ynysow Falkland
- korsisch: Isule Falkland
- krimtatarisch: Фалклендлap [Falklendlar]
- kroatisch: Falklandski otoci, Malvinski otoci
- kumükisch: Фoлклянд [Folkljand]
- kurdisch: Fôklanda
- ladinisch: Falkland
- laotisch: ເກາະຟອກແລນ [Kao Falkland]
- lateinisch: Malvinae Insulae
- lesgisch: Фoлклянд [Folkljand]
- lettisch: Folklenda salas, Malvinu salām
- letzeburgisch: Falkland Inselen
- ligurisch: Isoe Falkland
- limburgisch: Falklandeilen
- lingala: Bisanga bya Maluni
- litauisch: Folklando salos, Malvinų salos
- livisch: Falkland
- lombardisch: Isol Falkland
- luba-katanga: Lutanda lua Maluni
- madegassisch: Fokland
- makedonisch: Фaлкландски Острови [Falklandski Ostrovi]
- malaisch: Falkland
- malayalam: ഫോക്ക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ [Phokklāṇḍ Dvīpukaḷ]
- maltesisch: Gżejjer Falkland
- manx: Ellanyn ny Falkland
- maori: Fakalan
- marathisch: फॉकलैंड [Phokland]
- mari: Фолкленд Oшмаотывлӓ [Folklend Ošmaotyvjä]
- mindeng: 法克蘭 [Hók-lân]
- mingrelisch: ფოლკლენდიშ კოკეფი [Ṗoklandit Lolepi]
- minnan: 法克蘭 [Huat-khì-lân]
- mirandesisch: Illas Falkland
- moldawisch: Фaлкланд Инcyлe [Falkland Insule]
- mongolisch: Фолклендийн арлууд [Folklandiyn arluud]
- mordwinisch: Фoлклeнд [Folklend]
- nahuatl: Falklantlān
- nauruanisch: Fakland
- nepalesisch: फॉकलैंड [Phokland]
- niederländisch: Falklandeilanden
- norwegisch, volkssprachlich: Falklandsøyene
- norwegisch, hochsprachlich: Falklandsøyane
- novial: Falklande Isles
- okzitanisch: Isclas Falkland
- orissisch: ଫଲ୍କଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ [Phalklyāṇḍ Dweepapunja]
- oromo: Fooklaandi
- ossetisch: Фoлкляндия [Folkljandija]
- pampangan: Falkland
- pandschabisch: ਫਾਕਲੈਂਡ [Phākalaiṇḍ]
- panganisan: Falkland
- papiamentu: Falkland
- paschtunisch: فالکلېنډ [Falkland]
- persisch: جزایر فالکلند ]Jazāyer-e Falkland]
- piemontesisch: Isole Falkland
- pitkernisch: Falkland Ailen
- polnisch: Falklandy, Malviny
- portugiesisch: Malvinas, Falklands
- provenzalisch: Iles Malvines
- quetschua: Malvina
- rätoromanisch: Falkland
- ripuarisch: Falkland Inselen
- romani: Falkland
- rumänisch: Insulele Falkland
- rundi: Izinga rya Filikilandi
- russisch: Фолклендские острова [Folklendskije ostrova], Мальвинские острова [Mal’vinskije ostrva]
- ruthenisch: Фaлклендові Острови [Falklendovi Ostrovy]
- rwandesisch: Ibirwa bya Folukilande
- samisch: Falkland
- samoanisch: Fakalan
- samogitisch: Falkland Salas, Malvėnu Salas
- sango: Âzûâ tî Mälüîni
- sardisch: Falkland
- saterfriesisch: Falklound-Ailounde
- schwedisch: Falklandsöarna
- serbisch: Фокландска Острва [Foklandska Ostrva]
- seschellisch: Iles Falkland
- shona: Zvitsuwa zveFalklands
- sindhi: فڪلينڊ [Fakland]
- singalesisch: ෆොක්ලෑන්ඩ් දිවයින [Phoklānd Divaina]
- sizilianisch: Ìsuli Falkland
- slovio: Falkland
- slowakisch: Falklandské ostrovy
- slowenisch: Falklandsko otočje
- somalisch: Jaziiradaha Fooklaan
- sorbisch: Falklandske Kupy
- spanisch: Islas Malvinas
- sudovisch: Falkland
- sundanesisch: Kapulöoan Falkland
- surinamesisch: Falkland
- swahili: Visiwa vya Falkland
- syrisch: ܦܐܠܟܠܢܕ [Falkland]
- tabassaranisch: Фолкленд [Folkland]
- tadschikisch: Ҷазираҳои Фолкланд [Časirachoi Folkland]
- tagalog: Kapuluang Falkland
- tahitianisch: Fakalan
- tamilisch: ஃபாக்லாந்து தீவுகள்
- tatarisch: Фолкланд утравы [Folkland utravy]
- telugu: ఫాక్లాండ్ దీవులు [Phāklāṇḍ Dīvulu]
- thai: หมู่เกาะฟอล์คลันด์ [Mū̂k̀x Foklǣnd]
- tibetisch: ཕཱལ་ཀ་ལནཌ་ [Phal-ka-land]
- tigrinisch: ፋልክላንድ [Falkland]
- timoresisch: Falkland
- tok pisin: Falkland
- tonganisch: ʻOtumotu Fākalani
- tschechisch: Falklandy, Malviny
- tschetschenisch: Фолкленд [Folkland]
- tschuwaschisch: Фолкленд [Folkland]
- turkmenisch: Falkland adalary
- tuwinisch: Фолкланд аралдары [Folkland araldary]
- türkisch: Falkland Adaları
- udmurtisch: Фолкленд [Folkland]
- uigurisch: فوكىلاند ئاراللىرى [Fokiland Aralliri]
- ukrainisch: Фaлклендові Острови [Falklendovi Ostrovy]
- ungarisch: Falkland-szigetek, Malvin-szigetek
- urdu: فاکلینڈ ]Fākland]
- usbekisch: Falkland orollari
- venezianisch: Ìxołe de Falkland
- vietnamesisch: Quần đảo Phôk Lan
- visayan: Falkland
- volapük: Falklandäns, Malvinäns
- voronisch: Falklandisaart
- walisisch: Ynysoedd y Falkland
- wallonisch: Iyes Falkland
- weißrussisch: Фальклендзкія выспы [Fal’klendzkija vyspy], Мальвінскія выспы [Mal’vinskija vyspy]
- wepsisch: Falkland
- winaray: Kapuropud-an Falkland
- wolof: Dunu Falkland, Dunu Fooklaand
- xhosa: Falkland
- yoruba: Àwọn Erékùṣù Falkland, Orílẹ́ède Etikun Fakalandi
- yukatekisch: Malvina
- zazakisch: Fôklanda
- zulu: Ama-Falkland
Offizieller Name: East Falkland bzw. Falkland Islands
- Bezeichnung der Bewohner: Falkland Islanders (Falkländer)
- adjektivisch: falkland (falkländisch)
Kürzel:
- Landescode: FK / FLK
- Deutsch: FLK
- Alternativ: FLD
- Sport: FLK (inoffiziell)
- Kfz: FK (inoffiziell)
- FIPS-Code: FK
- ISO-Code: FK, FLK, 238
- Internet: .fk
Lage
Die Falkland-Inseln alias Malvinas liegen vor der Küste Argentiniens im südlichen Atlantik auf durchschnittlich 51°56’ s.B. und 59°31’ w.L.. Die zentralen Koordinaten für die Hauptinsel East Falkland lauten 51°55‘ s.B. und 58°33‘ w.L.. Sie befinden sich auf der gleichen geografischen Breite wie die zu Neuseeland gehörigen Auckland Islands sowie der äußerste Süden Chiles und Argentiniens. Die Falkland-Inseln sind 473 km von der patagonischen Küste entfernt. Ihre Küstenlänge beträgt insgesamt 3980 km.

Geografische Lage:
- nördlichster Punkt: 51°13‘58“ s.B. (Cape Dolphin) bzw. 50°59’55“ s.B. (Northwest Jason)
- südlichster Punkt: 52°32‘20“ s.B. (Bull Point) bzw. 52°55’04“ s.B. (Beauchêne Island)
- östlichster Punkt: 57°42’53“ w.L. (Cape Pembroke)
- westlichster Punkt: 59°44‘46“ w.L. (Ruggles Point) bzw. 61°19’33“ w.L. (Landsend Bluff auf New Island)
Entfernungen:
- Staten Island / Feuerland (Cabo San Juan) 334 km
- Patagonien / Argentinien (Punta Medanosa) 473 km
- Antarktis (Trinity Peninsula) 1185 km
- South Georgia (Willis Islands) 1455 km
- Uruguay (Punta del Este) 1790 km
- Tristan da Cunha (Anchorstock Point) 3990 km
- Gough Island (West Point) 4340 km
- Saint Helena (Speery Island) 5980 km
Zeitzone
Auf den Falkland-Inseln gilt die Atlantic Standard Time (Atlantische Zeit), abgekürzt AST (AZ), 5 Stunden hinter der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ, UTC-4). Vom ersten Sonntag im September bis zum ersten Sonntag nach dem 15. April gilt die Atlantic Daylight Time (Atlantische Sommerzeit), 4 Stunden hinter der MEZ. Die Realzeit liegt um 3 Stunden 24 Minuten bis 51 Minuten (East Falkland 24 bis 32 Minuten) hinter der Koordinierten Weltzeit (UTC).
Fläche
Die Falkland-Inseln bestehen aus zwei Haupt- und 776 kleineren Inseln, die durch die Falkland-Meerenge in zwei Hauptgruppen unterteilt werden. Die Gesamtfläche der Inseln beträgt 12.173 km² bzw. 4.692 mi² inklusive Flutbereich 12.177 km². Die größten Inseln sind Ost-Falkland, das mit 6.605 km² rund die Hälfte des Archipels einnimmt, und West-Falkland mit 5.413 km². Bis 1985 gehörten die Insel Südgeorgien (3.755 km², rund 1290 km südöstlich der Falkland-Inseln) und die Süd-Sandwich-Inseln (337 km², rund 750 km südöstlich von Südgeorgien) zu den Falkland-Inseln. Der West-Ost-Durchmesser zwischen New Island / Landsend Bluff und Cape Pembroke beträgt 248,2 km, die Nord-Süd-Breite zwischen Eddystone Rock und Sea Lion Island 138,9 km. Die Hauptinsel East Falkland durchmisst von Nordosten nach Südwesten 146,6 km, von Nordwesten nach Südosten 82,9 km. Höchster Punkt der Inselgruppe ist der Mount Usborne auf East Falkland mit 708 m. Die tiefste Stelle liegt auf Meeresniveau, die mittlere Seehöhe bei 41 m.
Flächenaufteilung:
- Wiesen und Weiden 11 300 km² (92,8 %)
- Moore und Gewässer 853 km² (7,2 %)
- Verbautes Gelände 20 km² (0,0 %)
Maximaler Tidenhub:
- Egg Harbour 4,2 m
- Dyke Island 3,9 m
- Gull Harbour 3,9 m
- Saunders Island 3,8 m
- Westpoint Island 3,8 m
- Chartres 3,7 m
- Port Egmont 3,7 m
- Keppel Sound 3,5 m
- Roy Cove 3,5 m
- New Island 3,4 m
- Hill Cove 3,2 m
- Pebble Island 2,9 m
- Northwest Islands 2,7 m
- Port Salvador Entrance 2,7 m
- Ajax Bay 2,6 m
- Port San Carlos 2,6 m
- Tamar Pass 2,6 m
- Brenton Loch 2,5 m
- Golding Island 2,4 m
- Swan Island 2,4 m
- Port Howard 2,3 m
- Berkeley Sound 2,0 m
- Fitzroy Creek 1,9 m
- Stanley 1,9 m
- Lively Settlement 1,7 m
- Walker Creek 1,7 m
- Great Island 1,6 m
- Mare Harbour 1,6 m
- Port Stanley 1,6 m
- Port Louis / Berkeley Sound 1,5 m
- Port Stephens 1,5 m
- Bleaker Island 1,4 m
- Darwin Harbour 1,4 m
- Albemarle 1,3 m
- Fanny Cove Creek 1,3 m
- Adventure Sound 1,2 m
- North Arm 1,1 m
- Fox Bay 0,9 m
- Speedwell Island 0,8 m
Grenzverlauf
Der Falkland-Archipel wurde am 2. Januar 1842 britisch-koloniales Territorium. Von 21. Juli 1908 bis 3. März 1962 gehörten dazu auch die South Shetland Islands, die South Orkney Islands und Grahamland auf der Antarktis sowie bis 3. Oktober 1985 Südgeorgien.
Geologie
Die heutige Landschaft der Falklandinseln wurde durch die wiederholten Vergletscherungen im Eiszeitalter geformt. Dabei bildete sich vor allem eine glaziale Abtragungslandschaft. Fjorde, Rundhöcker und durch das Eis geformte Seen sind typisch. In der Nacheiszeit sind viele Landstriche aufgrund des feuchtkalten Klimas vermoort.
Als vor etwa 400 Millionen Jahren der Superkontinent Gondwana auseinanderbrach, löste sich zwischen dem heutigen Südafrika und der Antarktis ein kleineres Stück, die heutigen Falkland Inseln. Während in der Folgezeit die Erdteile weiter auseinander drifteten, wanderten die Falkland Inseln mit einer Geschwindigkeit von etwa 4 cm pro Jahr (entspricht der Wachstumsgeschwindigkeit von Fingernägeln) nach Westen, wobei sie sich um 180 Grad drehten. Vor etwa 150 Millionen Jahren liefen sie am Patagonischen Schelf des Südamerikanischen Kontinents auf. Aus geologischer Sicht sind die Falkland-Inseln daher kein Bestandteil Südamerikas, vielmehr hat die ursprüngliche Nähe zu Südafrika dazu geführt, dass auf den Falklands seit mehreren Jahren nach Gold und Diamanten gesucht wird, bisher jedoch ohne größeren Erfolg. Die Falkland Inseln bestehen überwiegend aus Quarzit und Sandstein. Zahlreiche Funde von Fossilien, besonders im Bereich von Lafonia im Südteil der Ost-Falklands, sind auch Zeugnis von einer Hebung des Meeresbodens. Die jüngste geologische Lage bildet die alles überlagernde Torfschicht. Der Torf stellte bis in die jüngste Vergangenheit die Haupt-Energiequelle zum Heizen und Kochen dar. Erst vor wenigen Jahren wurde die Versorgung auf andere Energiequellen wie Öl, Wind- und Solarenergie umgestellt. Durch das intensive Torfstechen kam es in Stanley im Jahre 1886 zu einer Katastrophe: Durch ungewöhnlich starke Regenfälle füllten sich die ausgestochenen Torffelder mit Wasser. Daraufhin wurde eine Schlammlawine ausgelöst, die quer durch Stanley verlief und zwei Todesopfer forderte sowie Kirche, Schule und zahlreiche Häuser zerstörte.
Ein besonderes landschaftliches Merkmal der Falkland-Inseln sind die so genannten stone runs („Steinflüsse“). Diese zum Teil mehrere Kilometer langen und mehrere Hundert Meter breiten Felsformationen bildeten sich während der letzten Eiszeit. Durch den Frost wurden Blöcke unterschiedlicher Größe von den höher gelegenen Felsformationen abgesprengt. Diese glitten dann auf dem geforenen und von einer dünnen Schlammschicht bedeckten Boden langsam talwärts. Unterstützt durch den Wechsel von Tau- und Frostperioden wurden sie dabei der Größe nach sortiert, so dass im Querschnitt eine deutliche Schichtung mit von unten nach oben immer größer werdenden Felsbrocken erkennbar wird.
Landschaft
Die Falklandinseln bestehen aus fast 800 Inseln, deren wichtigste Westfalkland und Ostfalkland sind. Die nördlichen Teile der beiden Hauptinseln sind von Hügelketten überzogen. Sie verlaufen in West-Ost-Richtung und erreichen im Mount Usborne (spanisch Cerro Alberdi) auf Ostfalkland 708 m Höhe. Der zweithöchste Berg heißt Mount Adam (spanisch Monte Independencia) und befindet sich auf Westfalkland.
Zwischen Ost- und Westfalkland verläuft der breite Falklandsund (spanisch Estrecho de San Carlos), an dem Port Howard (spanisch Puerto Mitre) liegt. Auch die Ostinsel selbst wird von einem langen Fjord (bei Darwin) beinahe in zwei Hälften geteilt; an ihrer zum Atlantik blickenden Ostküste liegt die Hauptstadt Stanley mit rund 2.000 Einwohnern. Von den übrigen 200 Inseln sind nur etwa fünf größer als 10 km².
Erhebungen
- Mount Usborne 708 m
- Mount Wickham 628 m
See
- Lake Sulivan 6,9 km²
Fluss
- San Carlos River 38,5 km
Inseln Fläche Ausmaße Seehöhe
East Falkland 6605,0 km² 146,6 x 82,9 km 705 m
West Falkland 4530,8 km² 149,8 x 86,2 km 700 m
Weddell Island 254,0 km² 24,4 x 21,9 km 383 m
Saunders Island 124,0 km² 20,3 x 17,9 km 488 m
Pebble Island 103,4 km² 29,7 x 8,7 km 277 m
Lively Island 55,9 km² 14,5 x 11,5 km 37 m
Speedwell Island 51,5 km² 22,0 x 6,9 km 45 m
Beaver Island 48,6 km² 10,9 x 8,7 km 234 m
Bleaker Island 48,5 km² 19,0 x 2,5 km 29 m
Keppel Island 36,3 km² 11,0 x 6,8 km 341 m
George Island 24,0 km² 12,4 x 5,0 km 35 m
Carcass Island 18,9 km² 10,5 x 4,0 km 304 m
West Point Island 12,6 km² 6,5 x 4,2 km 369 m
Sea Lion Island 9,1 km² 7,8 x 2,6 km 18 m
Flora und Fauna
Die Flora der Falklandinseln ist geprägt von Graslandschaften, Mooren und robusten Pflanzen wie Tussockgras, während größere Bäume aufgrund des rauen Klimas fehlen. Die Fauna umfasst zahlreiche Seevögel, darunter Pinguine und Albatrosse, sowie Meeressäuger wie Seelöwen, Seeelefanten und Wale.
Flora
Insgesamt verzeichnet die Flora der Falklands 278 Arten. Das subantarktische Klima erlaubt nur das Wachstum von kleinen, maximal 1 m hohen Zwerg-Birken. Die Inseln sind überzogen von zahlreichen Gräsern – meist Seggen- und Rispengräserarten – sowie verschiedenen Kleearten, eine Besonderheit ist die ansonsten nur in Südamerika heimische Arachnitis uniflora.
Mehr oder weniger die gesamten Falkland.Inseln sind von ausgedehnten Tangwäldern, dem sogenannten Kelp, umgeben. Damit werden verschiedene Arten von Braunalgen der Ordnung Laminariales bezeichnet, die sich mit ihren Scheinwurzeln, den sogenannten Rhizoiden, an den Felsen festsetzen. Das Wachstum dieser Algen kann unter günstigen Nährstoff- und Lichtverhältnissen pro Tag über 1 cm betragen, und eine Art, Macrocystis pyrifera, kann eine Gesamtlänge von über 60 m erreichen. Der dadurch entstehende „Unterwasserdschungel“ bietet Lebensraum für zahlreiche Meereslebewesen und dient vielen auch als Kinderstube. Dem Kelp haben die Falkländer auch ihren Spitznamen Kelper zu verdanken.
Das Tussockgras (Poa flabellata) bildete einst ein schier undurchdringliches Dickicht entlang der gesamten Küstenlinie der Falkland-Inseln. Die teilweise über 3 m hoch werdende Pflanze wurde, aus der Ferne und von See aus betrachtet, von den frühen Entdeckern für einen Baum gehalten. Ökologisch betrachtet ist diese Verwechslung gar nicht so unsinnig, denn viele Vogelarten nutzen das Tussockgras zum Nisten: Sturmvögel und Magellanpinguine graben ihre Bruthöhlen in den Fuß des Tussockgrases, Singvögel bruten zwischen den Halmen und einige Raubvogelarten nisten oben auf den Bulten. In der Vergangenheit ist das Tussockgras durch Überweidung bis auf wenige Restbestände auf kleineren, vorgelagerten Inseln und geschützten Gebieten entlang der Hauptinsel fast vollständig verschwunden, und damit auch der Lebensraum für viele Tierarten. In den letzten Jahren wird aber zunehmend versucht, die noch vorhandenen Bestände zu schützen bzw. neue anzupflanzen.
Eine weitere, kaum zu übersehende Pflanze ist die Krähenbeere (Empetrum rubrum), die von den Falkländern als „Diddle-Dee“ bezeichnet wird. Dieser mehrjährige Zwergstrauch ist ein typisches Hochmoor-Gewächs. Die Krähenbeere blüht im Oktober und die Früchte dienen besonders den Magellangänsen als Nahrung. Die Falkländer stellten in früheren Jahren auch Marmelade aus den Beeren her, die ziemlich bitter schmeckte. Daher ist diese Tradition auch mehr oder weniger ausgestorben, aber an und an findet man in den Läden noch kleine Gläschen für den touristischen Bedarf.
Eine sehr auffällige Pflanze, besonders in der Nähe von Siedlungen, ist der Stechginster (Ulex europaea). Wie der wissenschaftliche Name schon verrät, handelt es sich dabei um eine eingeschleppte Pflanzenart, die von den Siedlern als blühender Zaun-Ersatz gepflanzt wurde. Besonders im Frühling bringen die gelben Blüten des Stechginsters einen deftigen Farbklecks in die ansonsten recht eintönige Landschaft der Falkland-Inseln. Ebenfalls nur an geschützten Stellen im Bereich von Siedlungen findet man vereinzelt Bäume; dabei handelt es sich ausnahmslos um eingeführte Arten, da die starken Westwinde und der saure Boden eine natürliche Ansiedlung von Bäumen auf den Falkland-Inseln verhindert haben.
Fauna
Es gab auf den Falklandinseln nur ein heimisches Landsäugetier, den Falklandfuchs, der im 19. Jahrhundert ausgerottet wurde. Daneben gibt es 63 heimische Vogelarten, darunter Albatrosse, Versicolorenten, Geierfalken und den endemischen Falklandpieper. An den Küsten brüten Pinguinkolonien, die mehrere Millionen Individuen umfassen. Außerdem findet man an den Küsten Kolonien von Seelöwen und See-Elefanten. Heute gibt es auf den Inseln neben den sehr häufigen Schafen zahlreiche eingeschleppte Tiere, wie etwa Ratten, Mäuse, Kaninchen und Katzen
Unter den Seevögeln sind besonders der Schwarzbrauenalbatros (Diomedea melanophris), der Dünnschnabel-Sturmvogel (Pachyptila belcheri) und der Felsenpinguin (Eudyptes chrysochome) zu erwähnen, die alle drei ihre weltweit größten Brutbestände auf den Falklands haben. Sowohl die Bestände des Schwarzbrauenalbatrosses als auch der der Felsenpinguine sind in den letzten Jahrzehnten stark rückläufig, was auf ozeanografische Veränderungen in den umliegenden Meeresgebieten und die kommerzielle Fischerei zurückgeführt wird. Durch umfangreiche Forschungsprogramme soll dieser Trend nun genauer analysiert und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Es brüten noch weitere vier Pinguinarten (Königs-, Esels-, Magellan und Goldschopfpinguin) und diverse Sturmvogelarten auf den Falklands. Aus Südamerika kommen zahlreiche Wasser-, Wat-, Raub- und Singvogelarten, darunter auch zwei endemische Arten, die Falkland-Dampfschiffente (Tachyeres brachypterus) und Cobb’s Hauszaunkönig (Troglodytes cobbi). Fast überall trifft man auf Magellangänse (Chloephaga picta), obwohl diese früher als Nahrungs-Konkurrent für die Schafe angesehen und heftig verfolgt wurden. Ein ähnliches Schicksal teilten die Falkland-Caracaras (Phalcoboenus australis), die mit insgesamt weniger als 1000 Brutpaaren zu den seltensten Raubvögeln der Welt gehören, und nur auf den Falkland-Inseln und einigen, Kap Hoorn vorgelagerten Inseln vorkommen. Inzwischen sind sie, wie die meisten anderen Tierarten auf den Falklands, unter Schutz gestellt worden. Auf Ratten-freien Inseln ist zudem eine reichhaltige Singvogel-Welt anzutreffen, darunter der sehr zutrauliche und neugierige Einfarb-Uferwipper („Tussockvogel“, Cinclodes antarcticus).
Besonders hervorzuheben aber sind die Pinguine. Auf den Falklandinseln finden sich auf so kleinem Raum gleich fünf verschiedenen Arten an Pinguinen. Die ulkigen Magellan-Pinguine tragen als besonderes Merkmal eine weiße Umrandung um die Augen. Es macht gar den Eindruck als trügen sie eine Brille und bildeten so eine Gruppe Gelehrter der Insel. Die Magellan-Pinguine leben in Höhlen an den Küsten der Falklandinseln. Für Besucher ist es nach wie vor ein Erlebnis, wenn die Tiere wie auf ein Kommando scharenweise ins Meer tauchen um nach Fisch zu jagen. Neben den Magellan–Pinguinen findet man die Esels–, Fels– und Königspinguine. Daneben sind in ihrer jeweiligen Brutzeit auch die Goldschopf– und Sclater–Pinguine anzutreffen. Wie der Name einer der Nebeninseln vermuten lässt, sind weitere Meeresbewohner auf den Falklandinseln zu erwarten. Seelöwen – daher auch Sea Lion Island – tummeln sich in kleinen bis größeren Herden im pazifischen Gewässer rund um die Falklands. Sind Sie gerade einmal nicht auf Beutezug ruhen sie sich aus und liegen sich kaum rührend und scheinbar immer müde auf den schroffen und felsigen Küstenstreifen umher. Ein Blick in den Himmel lohnt sich ebenfalls. Die majestätischen Albatrosse gleiten durch die Lüfte. Mit ihren weiten Flügeln schneiden sich scheinbar durch die kalten Winde und schießen blitzartig herunter um sich ihre Nahrung zu fischen. Weiterhin sind durchaus auch schon Wale und Delfine vor den Falklands gesichtet worden.
Dem einzigen natürlich auf den Falkland-Inseln vorkommenden Landsäuger ging es relativ schnell an den Kragen. Der „Warrah“ war dem Patagonischen Fuchs sehr ähnlich und fand sich ausschließlich auf Ost-Falkland. Im Zuge der Besiedlung der Falklands wurde diese Tierart, die sehr zahm war und keine Scheu vor dem Menschen zeigte, sehr bald ausgerottet. Noch vor den ersten Siedlern hatten Walfänger und Robbenschläger die Meeressäuger stark reduziert. See-Elefanten waren bereits um 1871 nahezu ausgerottet und die kommerzielle Jagd auf Südamerikanische See-Löwen (Otaria bryonina) und See-Bären (Arctocephalus australis) musste um 1951 eingestellt werden, da sich die Bestände bis auf kleine Restgruppen auf unzugänglichen Inseln dezimiert hatten. Heute stehen alle diese Arten unter Schutz, haben sich aber noch längst nicht auf ihre ursprünglichen Bestände erhohlt.
Eine ganze Reihe von Walen und Delfinen werden regelmäßig in den Küstengewässern der Falkland-Inseln gesichtet. Vor der Aufnahme des Walfangs brachten Südkaper in den Buchten ihre Jungen zur Welt. Heute gibt es keine regelmäßig vorkommenden Bestände an Bartenwalen mehr auf den Falklands, dafür aber verschiedene Delfinarten wie Peale’s (Lagenorhynchus australis) und Commerson’s Delfin (Cephalorhynchus commersonii) sowie Pilotwale (Globicephala melaena). Bei Sea Lion Island kreuzt jedes Jahr eine Gruppe von Schwertwalen (Orcinus orca) auf, und hin und wieder stranden verschiedene Schnabelwal-Arten (Ziphiidae).
Natürlich wurden auf den Falkland-Inseln im Zuge der Besiedlung durch den Menschen auch zahlreiche Haustier- und andere Tierarten eingeführt, wie Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen, Hunde und Katzen, aber auch Mäuse und Ratten. Vor wenigen Jahren wurden im Zuge einer Diversifizierung der Agrarwirtschaft sogar Rentiere aus Südgeorgien auf den Falklands importiert, Guanakos aus Südamerika leben seit 1937 zusammen mit Patagonischen Füchsen auf Staats Island. Während die Weidegänger die natürliche Flora, insbesondere das Tussockgras, abweideten und dadurch den Lebensraum für viele Vogelarten zerstörten, stellen die Ratten eine massive Bedrohung für alle kleineren Vogelarten dar, die aufgrund des Fehlens von Bäumen auf dem Boden bzw. im Tussockgras brüten mussten und den Angriffen der Ratten dort schutzlos ausgeliefert waren, die deren Gelege als eine willkommene Abwechslung im Speiseplan zu nutzen wissen. Seit wenigen Jahren werden auf kleinen, der Küste vorgelagerten Inseln intensive Programme zur Ausrottung der Ratten durchgeführt, woraufhin diese Inseln wieder von Singvögeln besiedelt werden.
Pflanzen-und Tierarten (in Klammern endemisch)
Flora
- Blütenpflanzen 171 (13)
- Farne 21 (1)
Fauna
- Vögel 203 (12)
- Säugetiere 28 (1)
Naturschutz
Auf den Falklandinseln gibt es insgesamt 33 ausgewiesene Schutzgebiete, darunter National Nature Reserves, Ramsar-Gebiete und Important Bird Areas (IBAs). Diese Gebiete umfassen sowohl terrestrische als auch marine Lebensräume und sind entscheidend für den Schutz zahlreicher Vogelarten, darunter Pinguine, Albatrosse und Enten. Spezielle Schutzgebieete sind:
- Port Harriet: Ein Naturschutzgebiet in der Nähe von Stanley, das für seine Brutkolonien von Eselspinguinen und anderen Vögeln bekannt ist.
- Volunteer Point: Ein National Nature Reserve seit 1968, bekannt für seine Kolonien von Königspinguinen und anderen Seevögeln.
- Sea Lion Island: Ein Ramsar-Gebiet und IBA, das 2017 zum National Nature Reserve erklärt wurde. Es beherbergt eine Vielzahl von Seevögeln und ist für seine natürliche Schönheit bekannt.
- Kidney Island: Eine kleine Insel von 33 ha, die als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist und eine der wenigen Stellen ist, an denen noch Tussacgras vorkommt.
- Bertha's Beach: Ein Küstenfeuchtgebiet von 3.300 ha, das sowohl als IBA als auch als Ramsar-Gebiet anerkannt ist und eine wichtige Raststätte für Zugvögel darstellt.
Die Schutzgebiete der Falklandinseln decken insgesamt etwa 354 km², davon rund 160 km² auf East Falkland, ab, was weniger als 3 % der gesamten Landfläche des Gebiets entspricht. Obwohl dieser Anteil relativ gering ist, spielen diese Gebiete eine entscheidende Rolle im globalen Naturschutz, insbesondere für die Erhaltung der Biodiversität im Südatlantik.
Klima
Das Klima ist kühl gemäßigt, der Köppen-Klimaklassifikation wird es als subpolar-ozeanisch (Typ Cfc) eingestuft. An rund 250 Tagen im Jahr fällt Niederschlag. Es ist ganzjährig kalt, regnerisch und vor allem windig. Dennoch liegen die durchschnittlichen Niederschläge nicht allzu hoch. In Stanley zum Beispiel fallen rund 650 mm Niederschlag im Jahr, im Westen der Inseln im Durchschnitt nur gute 400 mm. Ganzjährig ist es sehr wechselhaft, Wolken, Regen und blauer Himmel wechseln durch den stetig wehenden Wind schnell einander ab.
Die jährliche Durchschnittstemperatur liegt bei nur 5°C. Verglichen mit London oder Köln, die auf derselben (nördlichen) Breite liegen, ist das ein Unterschied von fast 5°C. Dies hängt vor allem mit der Landverteilung Nord-Süd, der Ekliptik (Perihel im Nordwinter) sowie dem das Klima der Nordhalbkugel beeinflussenden Golfstrom zusammen. Nur in den Hochsommermonaten Dezember, Januar und Februar steigt die Temperatur an ganz wenigen Tagen im Jahr auf annähernd 20°C. Ansonsten liegt die durchschnittliche Tagestemperatur auch zwischen Oktober und April eher bei 8 bis 12°C. Verglichen mit europäischen klimatischen Verhältnissen herrschen also auf den Falklands selbst in den Frühling- und Sommermonaten eher spätherbstliche Temperaturen vor.
Die kälteste Zeit ist zwischen Mai und September, dann herrscht häufig Frost. Zumindest tagsüber steigt in diesen Monaten die Temperatur selten auf über knapp 1 bis 3°C. Auf Grund des ozeanisch geprägten Klimas sind aber strenge Fröste von unter -15°C eher die Ausnahme. Daneben regnet oder schneit es an durchschnittlich 200 Tagen im Jahr.
Klimadaten für Port Stanley (1961 bis 1990)
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
| Mitteltemperatur (°C) | 8,5 | 8,9 | 8,1 | 6,1 | 3,8 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 3,9 | 5,3 | 6,9 | 8,2 | 5,7 |
| Frosttage | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 55 |
| Niederschlag (mm) | 71 | 58 | 64 | 66 | 66 | 53 | 51 | 51 | 38 | 41 | 51 | 71 | 681 |
| Niederschlagstage < 1 mm | 17 | 12 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 162 |
| Potenzielle Verdunstung (mm) | 85 | 68 | 62 | 41 | 27 | 17 | 17 | 22 | 32 | 48 | 59 | 75 | 553 |
| Sonnenstunden pro Tag | 6,4 | 5,7 | 5,5 | 3,8 | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 4,3 | 6,1 | 6,7 | 6,4 | 5,5 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 78 | 79 | 82 | 86 | 88 | 89 | 89 | 87 | 84 | 80 | 75 | 77 | 78 |
| Mittlere Winbdgeschwindigkeit (km/h) | 28 | 27 | 28 | 27 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 33 | 33 | 30 | 28 |
Klimadaten für Stanley (1991 mbis 2020)
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jahr | ||
| Höchstrekord (°C) | 21,73 | 24,84 | 19,66 | 16,56 | 12,42 | 10,35 | 10,35 | 11,38 | 12,42 | 15,52 | 19,66 | 20,76 | 24,84 | |
| Mittelmaximum (°C) | 13,45 | 13,35 | 12,06 | 9,69 | 7,74 | 5,78 | 5,04 | 5,7 | 6,81 | 8,87 | 11,1 | 12,28 | 9,32 | |
| Mitteltemperatur (°C) | 11,99 | 11,84 | 10,68 | 8,49 | 6,8(44,24) | 4,98 | 4,19 | 4,68 | 5,66 | 7,53 | 9,72 | 10,91 | 8,12 | |
| Mittelminimum (°C) | 8,49 | 8,36 | 7,75 | 6,33 | 4,86 | 3,06 | 2,33 | 2,69 | 3,22 | 4,47 | 6,3 | 7,35 | 5,43 | |
| Tiefstrekord (°C) | 3,1 | 2,07 | 2,07 | -2,07 | -4,14 | -5,17 | -6,21 | -9,31 | -7,24( | -3,1 | 0,0 | 1,03 | -9,31 | |
| Niederschlag (mm) | 35,12 | 30,7 | 27,49 | 34,45 | 37,67 | 32,44 | 26,47 | 34,93 | 26,45 | 22,72 | 27,83 | 27,02 | 30,28 | |
| Niederschlagstage (≥ 1.0 mm) | 8,0 | 7,91 | 7,24 | 8,85 | 8,46 | 9,5 | 7,81 | 7,91 | 6,58 | 6,02 | 7,43 | 7,81 | 7,79 | |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 74,81 | 76,05 | 78,48 | 81,35 | 82,7 | 83,15 | 83,07 | 82,11 | 81,19 | 77,75 | 75,01 | 73,42 | 79,09 | |
| Wassertemperatur (°C) | 9,5 | 9,8 | 9,2 | 7,7 | 6,5 | 5,6 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 5,3 | 6,8 | 8,4 | 6,94 | |
Mythologie
Frühe europäische Seefahrer berichteten im 16. und 17. Jahrhundert von „Geisterinseln“ im Südatlantik, die schwer zu finden waren und manchmal wieder verschwanden – Legenden, die mit der unklaren Kartografie jener Zeit zusammenhängen. Noch heute ranken sich Mythen darum, wer die Inseln wirklich zuerst entdeckte: Während britische Quellen Francis Drake oder John Davis nennen, verweisen spanische und argentinische Traditionen auf andere Expeditionen.
Auch die Herkunft des Namens ist von symbolischer Bedeutung und Gegenstand von Geschichten: Der englische Name „Falkland“ geht auf den Schatzmeister Anthony Cary, 5. Viscount of Falkland, zurück, während der spanische Name „Islas Malvinas“ von französischen Siedlern aus Saint-Malo abgeleitet wurde – zwei Bezeichnungen, die die bis heute bestehende politische Spannung widerspiegeln. In der lokalen Folklore gibt es zudem kleinere Mythen über geheimnisvolle Lichter, ungewöhnliche Wetterphänomene und Begegnungen von Fischern mit „Seemonstern“, die in den stürmischen Gewässern gesichtet worden sein sollen.
Geschichte
Die Falklandinseln wurden im 16. Jahrhundert von europäischen Seefahrern entdeckt und im 18. Jahrhundert sowohl von Frankreich, Spanien und Großbritannien beansprucht. Seit 1833 stehen sie unter britischer Kontrolle, was immer wieder zu Spannungen mit Argentinien führte, das die Inseln als „Islas Malvinas“ betrachtet. Der Höhepunkt dieses Konflikts war der Falklandkrieg von 1982, nach dem die britische Verwaltung samt militärischer Kontrolle gestärkt und die Selbstverwaltung der Inselbewohner ausgebaut wurde.
Indianische Frühzeit
Historische Berichte und frühe Erkundungen, beginnend mit der möglichen Sichtung durch den Engländer John Davis im Jahr 1592 und der ersten Landung durch John Strong 1690, beschrieben die Inseln als menschenleer, ohne Anzeichen permanenter Siedlungen. Diese Annahme basierte auf der Abwesenheit indigener Bevölkerungen bei der europäischen Kolonisierung und der geografischen Isolation der Inseln durch starke Strömungen und Winde. Allerdings haben archäologische Untersuchungen in den letzten Jahrzehnten Hinweise auf vorübergehende Besuche indigener Gruppen geliefert, insbesondere der Yahgan (auch Yámana genannt), eines nomadischen, seefahrenden Volkes aus der Region Tierra del Fuego. Diese Besuche deuten auf kurzfristige Aufenthalte hin, wahrscheinlich zur Jagd auf marine Ressourcen wie Seehunde und Pinguine, und werfen neue Fragen zur prähistorischen Besiedlung Südamerikas und der Herkunft des ausgestorbenen Falkland-Wolfs (Warrah, Dusicyon australis) auf. Im Folgenden stelle ich die verfügbaren Hinweise ausführlich dar, basierend auf wissenschaftlichen Studien, archäologischen Funden und historischen Kontexten, wobei ich auch auf Debatten und Unsicherheiten eingehe.
Die stärksten Belege für prähistorische menschliche Aktivitäten stammen aus einer interdisziplinären Studie, die 2021 in der Zeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde. Unter Leitung von Kit M. Hamley von der University of Maine untersuchten Forscher Sedimentkerne, Knochenhaufen und Artefakte auf den Inseln, um Spuren menschlicher Präsenz vor der europäischen Ankunft zu finden. Die Analyse ergab mehrere Linien von Evidenz, die auf menschliche Besuche zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert hinweisen, also Jahrhunderte vor den Europäern.
Ein Schlüsselindikator sind plötzliche Anstiege von Holzkohle (Charcoal) in Sedimenten, die auf Feuer hindeuten. Diese "Charcoal spikes" wurden an mehreren Standorten datiert, darunter ein signifikanter Peak um 1400 auf New Island, einer der westlichen Inseln. Solche Feuer könnten absichtlich gelegt worden sein, um Wildtiere anzulocken oder zu jagen – eine Technik, die bei indigenen Völkern Südamerikas bekannt ist. Ergänzend dazu entdeckten die Forscher große Knochenablagerungen (Bone piles oder Middens) von Südamerikanischen Seelöwen (Otaria flavescens) und Felsenpinguinen (Eudyptes chrysocome), die auf menschliche Jagdaktivitäten hindeuten. Diese Haufen, datiert auf 1275 bis 1420, zeigen Schnittspuren, die auf Zerlegung durch Werkzeuge hinweisen, und enthalten Tausende von Knochen, die als Überreste von Jagdlagern interpretiert werden. Ein weiterer Fund ist eine Quarzit-Pfeilspitze (Arrowhead), die 1979 auf New Island entdeckt wurde und aus lokalem Stein hergestellt scheint, was auf vor-Ort-Produktion hinweist. Ähnliche Pfeilspitzen wurden in Lafonia auf East Falkland gefunden, zusammen mit Resten eines Holzkanus, die auf seefahrende Besucher hindeuten.
Diese Funde deuten auf kurzfristige, saisonale Besuche hin, nicht auf permanente Siedlungen. Die Inseln boten reiche Ressourcen wie Seevögel und Meeressäuger, die für nomadische Jäger attraktiv waren, aber das raue Klima und die Isolation machten eine dauerhafte Besiedlung unwahrscheinlich. Radiokarbondatierungen (C-14-Methode) und paläoökologische Analysen (zum Beispiel Pollen und Sporen in Sedimenten) unterstützen diese Datierungen und schließen natürliche Ursachen für die Feuer aus, da sie mit menschlichen Mustern übereinstimmen.
Die Hinweise werden stark mit den Yahgan assoziiert, einem indigenen Volk aus Tierra del Fuego, das für seine Kanus (aus Rinde gebaut) und maritime Lebensweise bekannt ist. Die Yahgan reisten regelmäßig zu den Diego Ramírez-Inseln (rund 100 km südlich von Kap Hoorn) und besaßen die Fähigkeiten, die 500 km weite Überfahrt zu den Falklands zu meistern. Ihre Kultur umfasste Jagd auf Seehunde und Pinguine mit Speeren und Feuer, was zu den Knochenhaufen und Charcoal-Spuren passt. Es gibt auch Spekulationen, dass die Yahgan den Warrah mitbrachten – ein canidenartiges Tier, das Darwin 1833 als "rätselhaft" beschrieb, da es isoliert evolviert schien, aber genetische Analysen deuten auf eine Einführung durch Menschen hin. Andere indigene Gruppen wie die Tehuelche oder Selk'nam aus Patagonien werden weniger stark verknüpft, da sie weniger seefahrend waren, aber gemischte Besuche sind möglich.
Spätere historische Kontakte bestätigen indigene Präsenz: Im 19. Jahrhundert siedelten Missionare Yahgan-Familien auf Keppel Island um, was einige Artefakte erklären könnte, aber die prähistorischen Datierungen schließen das aus. Orale Überlieferungen der Yahgan erwähnen Reisen zu fernen Inseln, die mit den Falklands übereinstimmen könnten, obwohl direkte Belege fehlen.
Trotz dieser Funde bleibt die Debatte kontrovers. Eine Review-Studie von 2022 von Atilio Francisco J. Zangrando und Luis A. Borrero argumentiert, dass die Beweise – wie Knochenhaufen und Pfeilspitzen – nicht eindeutig prähistorisch sind und natürliche Ursachen (z. B. Vogelkolonien) oder post-europäische Kontamination haben könnten. Frühere paläoökologische Studien aus den 1990er Jahren (zum Beispiel von Buckland und Edwards) fanden Hinweise auf mögliche prähistorische Feuer, aber ohne klare menschliche Spuren. Kritiker betonen, dass die Inseln zu ressourcenarm für regelmäßige Besuche waren und dass fehlende permanente Siedlungen (z. B. Hüttenreste) die These schwächen. Dennoch hat die 2021-Studie die Debatte revitalisiert, und weitere Ausgrabungen könnten Klarheit schaffen.
Entdeckungszeit
Wann die ersten Europäer des Archipels ansichtig wurden, ist umstritten. Dass sie die ersten Menschen waren, die hierher gelangten, galt lange Zeit als Faktum. Mittlerweile ist klar, indianische Gruppen, vermutlich die feuerländischen Yahgan, waren schon lange vorher da. Auch wenn sie nicht dauerhaft geblieben sind, haben sie doch Spuren hinterlassen. An der Küste von West Falkland hat man Überreste ihrer Kanus gefunden, aber auch Abfallstätten. Sie waren es vermutlich auch, die den Falkland-Fuchs (Dusicyon australis) hierher.
Verschiedene Sichtungen der Inselgruppe sind verzeichnet aber umstritten bzw. gelten als unsicher. So könnten 1501 Amerigo Vespucci, 1520 Esteban Gomez (einer der Kapitäne Ferdinand Magellans auf seiner Weltumseglung) und 1540 Francisco de Camargo die Inseln gesichtet haben.
Die erste als gesichert geltende Sichtung erfolgte 1592 durch den Engländer John Davis mit dem Schiff Desire, als er Thomas Cavendish auf seiner letzten Fahrt begleitete. Der Engländer Richard Hawkins erreichte 1594 die Inselgruppe und benannte sie als eine Kombination aus seinem eigenen Namen und dem Namen der englischen Königin Elisabeth I., der Maid, in Hawkins' Maidenland.
Der Niederländer Sebald de Weert besuchte das Archipel am 24. Januar 1600 und gab ihm den Namen Sebald Eilands. Dieser Name und auch die spanischen Entsprechungen Islas Sebaldinas bzw. Sebaldes wurden auf Seekarten bis in das 19. Jahrhundert hinein benutzt.
Im Jahre 1690 wurden die Inseln erstmals durch John Strong betreten, der den Falklandsund entdeckt und nach Anthony Cary, 5. Viscount Falkland, einem schottischen Politiker, zur Zeit der Expendition als Treasurer of the Navy verantwortlich für die Finanzen der Royal Navy, benannte. Der moderne Name der Inselgruppe geht letztendlich auf die Bezeichnung des Sunds zurück.
Pionierzeit
Die erste Ansiedlung errichtete der Franzose Louis Antoine de Bougainville 1764 auf Ostfalkland am Berkely Sound. Die Siedlung wurde nach Ludwig XV. in Port Louis benannt. Nach der späteren spanischen Übernahme wurde der Ort in Puerto Soledad umbenannt. Der französische Name der Inselgruppe Les Nouvelles Malouines geht auf bretonische Siedler aus Saint-Malo zurück und ist der Ursprung des bis heute gebräuchlichen spanischen Namens Islas Malvinas bzw. Malwinen. Der Brite John Byron landete 1765 in der Bucht Port Egmont und nahm die Inseln in Besitz der britischen Krone.
Wahrscheinlich ohne Kenntnis der französischen Bemühungen gründete John McBride 1766 auf Saunders Island nordwestlich von Westfalkland den ersten britischen Stützpunkt Port Egmont. Ziel der Ansiedlung war die Sicherung der strategisch wichtigen Seewege durch die Magellanstraße und die Drakestraße um das Kap Hoorn.
1765 entdeckte James Cook die Südsandwichinseln und benannte sie nach dem unbeliebten ersten Lord der Admiralität. Er erwähnte in seinem Reisebericht Port Egmont mehrfach, obwohl er den Ort nie besucht hat.
Wenig später im Jahre 1767 verkauften die Franzosen unter militärischem Druck ihre Besitzungen an die Spanier, die inzwischen an einer Kontrolle des gesamten Inselgebietes interessiert waren. Deshalb landeten 1770 starke spanische Kräfte in Port Egmont, die die weit unterlegenen Briten kampflos gefangen nahmen und vertrieben. Infolgedessen drohte England Spanien mit Krieg, woraufhin längere Verhandlungen zwischen Spanien, England und Frankreich folgten, in deren Ergebnis 1771 die Spanier einer Rückkehr der Briten nach Port Egmont zustimmen mussten.
Drei Jahre später 1774 gaben die Briten ihren Stützpunkt aus wirtschaftlichen Gründen auf. Ein weiterer Grund war der Ausbruch der Amerikanischen Revolution, die eine Umgruppierung der britischen Kräfte erforderte. Allerdings gaben die Briten ihren Anspruch auf die Inseln nie auf und hinterließen an ihrem Stützpunkt eine Fahne und eine Bleiplakette, die den Anspruch manifestieren sollten.
Argentinische Zeit
Nach der argentinischen Mai-Revolution am 25. Mai 1810 mussten die Spanier 1811 die Inseln räumen. 1816 erreichte das Vizekönigreich des Río de la Plata die endgültige Unabhängigkeit von Spanien. Argentinien wurde als neuer Staat gebildet und erhob Anspruch auf die Inseln. Ab 1820 begannen die ersten argentinischen Ansiedlungsbemühungen. 1823 vergab Argentinien die Fischfang- und Jagdrechte an die privaten Investoren Jorge Pacheco und Luis Vernet.
1829 wurde der Hamburger Kaufmann Luis Vernet offiziell zum Gouverneur der Inseln ernannt. Er versuchte ein Monopol bei benannten Fischfang- und Jagdrechten durchzusetzen, weshalb US-amerikanische Walfänger angegriffen wurden. Infolgedessen griff die US-Navy die argentinischen Siedlungen an und zerstörte Puerto Soledad. Die USA erklärten 1831 die Inseln zum Niemandsland und dass sie jede argentinische Ansiedlung auf den Inseln als Piratennest betrachten würden.
Britische Kolonialzeit
1832 kehrten die Briten nach Port Egmont zurück. Am 2. Januar 1833 ankerte das britische Kriegsschiff Clio im Hafen von Puerto Louis. Der an Bord kommende argentinische Offizier wurde aufgefordert, die argentinische Flagge einzuholen, die britische aufzuziehen sowie die Inseln mitsamt der argentinischen Administration zu verlassen, was am 5. Januar geschah. So wurden die Inseln offiziell von Großbritannien in Besitz genommen, wogegen die USA nichts unternahmen. Seit dieser Zeit protestieren die Argentinier und bestehen auf ihrem Anspruch. 1837 wurde eine Kolonialverwaltung eingerichtet und 1843 Port Stanley gegründet, welches 1845 zur Hauptstadt erklärt wurde. 1859 erkannte Spanien die Unabhängigkeit Argentiniens an, gab aber keine Aussage zu den Falklandinseln.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Inseln war vor allem von der Schafzucht geprägt. Ab den 1860er-Jahren begannen britische Siedler großflächige Schafbetriebe anzulegen, deren Wolle hauptsächlich nach Großbritannien exportiert wurde. Damit wurde die Wolle zur Haupteinnahmequelle der Inseln. Fischerei und Robbenjagd verloren im Laufe des 19. Jahrhunderts an Bedeutung, während der Ausbau der Infrastruktur, wie Straßen, Häfen und Telegraphenverbindungen, Stanley und andere Siedlungen besser mit dem Festland und Großbritannien verband.
Die Bevölkerung blieb trotz dieser Entwicklungen klein und bestand überwiegend aus britischen Siedlern, insbesondere aus England, Schottland und Irland. Gleichzeitig wuchs die strategische Bedeutung der Falklands für Großbritannien, insbesondere als Südatlantikstützpunkt der Marine. Obwohl Argentinien Anspruch auf die Inseln erhob, blieb die britische Kontrolle in diesem Zeitraum unangefochten.
Weltkriegsära
Im Jahr 1905 wurde in Stanley ein Flottenstützpunkt errichtet und ausgebaut und die Inseln von Schafzüchtern dünn besiedelt. Im Ersten Weltkrieg dienten die Inseln als relativ unbedeutender Marinestützpunkt. Allerdings kam es am 8. Dezember 1914 zum Seegefecht bei den Falklandinseln, bei dem das deutsche Ostasiengeschwader fast vollständig vernichtet wurde.
Im Zweiten Weltkrieg wurde die Besatzung der Inselgruppe verstärkt, da eine japanische Invasion befürchtet wurde. Der Marinestützpunkt diente als strategische britische Bastion im Südatlantik und hatte bei der Vernichtung der Admiral Graf Spee einige Bedeutung.
Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte die UNO mehrfach, den Falklandkonflikt zu lösen. Unter anderem forderte sie 1965 mit der UN-Resolution 2065 sowohl Argentinien als auch Großbritannien auf, den Konflikt friedlich und im Sinne der Einwohner der Inselgruppe zu lösen.
1966 kam es zu einer privaten argentinischen Invasion auf dem Flugfeld von Stanley. Die beiden Staaten verständigten sich 1971 auf eine gewisse Zusammenarbeit. Unter anderem wurde die gemeinsame Nutzung von Krankenhäusern und Schulen auf dem Festland geregelt. Weitere Gespräche erfolgten in der Zeit zwischen 1980 und 1982.
Im Laufe der Jahre wandelte sich die Bedeutung der Inseln. Seit längerer Zeit wurden im Seegebiet der Inseln große Vorkommen an fossilen Brennstoffen vermutet. Außerdem bieten die Inseln eine ideale Basis für Gebietsansprüche in der Antarktis. Diese Gründe und innenpolitische Probleme führten letztlich zum Krieg.
Falklandkrieg
1979 gewann die konservative Margaret Thatcher in Großbritannien die Wahlen. 1981 putschte sich General Galtieri in Buenos Aires an die Macht. Die argentinische Militärdiktatur stand vor einem wirtschaftlichen Scherbenhaufen und musste nach längeren blutigen Unruhen um die Macht fürchten.
Der unmittelbare Auslöser lag in Argentiniens innerer Krise: Die Militärjunta unter General Leopoldo Galtieri litt unter wirtschaftlicher Rezession, Inflation und Menschenrechtsverletzungen während der "Schmutzigen Krieges". Eine Invasion der Malvinas sollte nationale Einheit schaffen und die Junta popularisieren. Großbritannien, unter Premierministerin Margaret Thatcher, hatte die Verteidigung der Inseln vernachlässigt – die Royal Navy reduzierte ihre Präsenz, und es gab nur eine kleine Garnison von 68 Royal Marines. Dies signalisierte Argentinien Schwäche. Zudem hatte die argentinische Marine bereits im März 1982 Südgeorgien, eine abhängige Inselgruppe, besetzt, was als Testballon diente.
Am frühen Morgen des 2. April 1982 landeten argentinische Spezialeinheiten (Comando Anfibio) unter dem Kommando von Admiral Carlos Büsser auf den Falklandinseln. Die Operation "Rosario" begann mit der Landung von 600 Mann in der Nähe von Stanley (heute Port Stanley), der Hauptstadt. Die britischen Marines verteidigten sich im Government House, doch nach kurzem Gefecht mit minimalen Verlusten (keine Toten auf britischer Seite) kapitulierte Gouverneur Rex Hunt. Bis Mittag hissten die Argentinier ihre Flagge, und General Mario Menéndez wurde als Gouverneur eingesetzt. Gleichzeitig eroberten argentinische Truppen Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln.
Die Invasion wurde in Argentinien als nationaler Triumph gefeiert, mit Massendemonstrationen in Buenos Aires. International jedoch verurteilte der UN-Sicherheitsrat die Aktion in Resolution 502 und forderte den Rückzug. Die USA, anfangs neutral, unterstützten später Großbritannien durch Geheimdienstinformationen und Logistik.
Großbritannien reagierte entschlossen: Thatcher berief das Kriegskabinett ein und entsandte eine Task Force unter Admiral John "Sandy" Woodward. Diese umfasste über 100 Schiffe, darunter die Flugzeugträger HMS Hermes und HMS Invincible, 8.000 Soldaten (einschließlich Paras, SAS und Royal Marines) sowie Harrier-Jets. Die Flotte verließ Portsmouth am 5. April und erreichte nach 12.000 km die Ascension-Inseln als Stützpunkt. Die Logistik war enorm: Treibstoff, Munition und Vorräte wurden per Luftbrücke transportiert.
Argentinien stationierte rund 13.000 Mann auf den Inseln, verstärkt durch Pucará-Kampfflugzeuge und Exocet-Raketen. Beide Seiten etablierten Ausschlusszonen: Großbritannien eine 200-Meilen-Zone um die Inseln, Argentinien eine ähnliche.
Der Krieg gliederte sich in See-, Luft- und Landkämpfe, geprägt von der Isolation der Inseln und rauen Witterungsbedingungen. Am 2. Mai torpedierte das britische U-Boot HMS Conqueror den argentinischen Kreuzer ARA General Belgrano außerhalb der Zone, was 323 Tote forderte – der größte Einzelverlust des Krieges. Dies zwang die argentinische Flotte in die Häfen zurück. Argentinien konterte mit dem Versenken des Zerstörers HMS Sheffield durch eine Exocet-Rakete am 4. Mai (20 Tote). Weitere Verluste: Die Briten verloren HMS Ardent, HMS Antelope und den Frachter Atlantic Conveyor.
Die britischen Harrier-Jets dominierten den Luftraum trotz argentinischer Überzahl (ca. 200 Flugzeuge vs. 42 britische). Argentinische Skyhawks und Daggers bombardierten britische Schiffe in der San-Carlos-Bucht (21. Mai, "Bomb Alley"), versenkten HMS Coventry und beschädigten andere. Insgesamt verlor Argentinien 86 Flugzeuge, Großbritannien 10.
Die Briten landeten am 21. Mai in San Carlos mit 4.000 Mann. Die erste große Schlacht war Goose Green (28./29. Mai): 600 britische Paras unter Colonel H. Jones eroberten den Ort gegen 1.200 Argentinier. Jones fiel, doch die Argentinier kapitulieren (17 britische, 47 argentinische Tote). Weitere Kämpfe: Mount Longdon, Two Sisters und Mount Tumbledown (11. bis 14. Juni), wo britische Truppen unter hohen Verlusten vorrückten. Die finale Offensive auf Stanley führte zur Kapitulation.
Am 14. Juni 1982 kapitulierte General Menéndez in Stanley. Der Krieg dauerte 74 Tage. Argentinien verlor 649 Soldaten, Großbritannien 255, plus drei Zivilisten auf den Inseln. Insgesamt gab es über 2.000 Verletzte. Die Briten nahmen 11.400 Argentinier gefangen. Der Sieg stärkte Thatchers Position und führte zu ihrer Wiederwahl 1983. In Argentinien stürzte die Junta; Galtieri trat zurück, und Demokratie kehrte 1983 zurück.
Falkland erhielt eine verstärkte Verteidigungspräsenz (Mount Pleasant Airbase) und wirtschaftlichen Aufschwung durch Fischerei. Aufgrund des argentinischen Angriffes wurden starke britische Land- und Luftstreitkräfte auf den Inseln stationiert, die bis heute (2007) dort verbleiben. Die Bevölkerung ist probritisch. Der Konflikt aber bleibt bestehen.
Erst 1990 nahmen Argentinien und Großbritannien wieder diplomatische Beziehungen auf. Argentinien besteht bis zum heutigen Tag genauso auf seinem Anspruch wie Großbritannien bis heute Alternativen zum momentanen Status ablehnt. Ein Referendum 2013 bestätigte den britischen Status mit 99,8 %. International wurde der Krieg als Testfall für das Selbstbestimmungsrecht gesehen. Bis heute gedenken beide Seiten der Toten, und Minenräumung dauerte bis 2020.
Moderne Zeit
Nach dem Ende des Falklandkriegs am 14. Juni 1982, als britische Truppen die argentinische Besatzungstruppe in Stanley zur Kapitulation zwangen, begann für die Falklandinseln eine Phase intensiver Erholung und Modernisierung. Der Krieg hatte die Inseln verwüstet: Drei Einheimische und 255 britische Soldaten waren getötet worden, während Argentinien 649 Tote zu beklagen hatte. Die britische Regierung unter Margaret Thatcher verstärkte die militärische Präsenz massiv, um zukünftige Aggressionen zu verhindern. Bis 1985 entstand die RAF Mount Pleasant, eine große Luftwaffenbasis südlich von Stanley, die als Symbol der britischen Entschlossenheit diente und den Inseln direkte Flugverbindungen nach Großbritannien ermöglichte. Gleichzeitig wurden rund 20.000 Landminen, die die Argentinier verlegt hatten, zu einem langjährigen Problem – erste Räumungsversuche scheiterten 1983 an hohen Verlusten, doch ab 2009 wurde das Programm fortgesetzt und 2020 abgeschlossen.
Politisch blieb der Souveränitätsstreit mit Argentinien der dominante Faktor. Die Inseln, als britisches Überseegebiet, lehnten Verhandlungen über eine Übergabe ab und betonten das Selbstbestimmungsrecht der Bewohner. Diplomatische Beziehungen zwischen London und Buenos Aires wurden 1990 wieder aufgenommen, doch ohne Fortschritte bei der Souveränitätsfrage. Der Shackleton-Report von 1982, der bereits 1976 empfohlen hatte, die Wirtschaft zu diversifizieren, wurde zum Blaupause für die Entwicklung: Die Falklands etablierten 1986 eine exklusive Wirtschaftszone (EEZ), die Fischereilizenzgebühren zu einer Haupteinnahmequelle machte (bis zu 50–60 % des BIP). Argentinien protestierte regelmäßig, etwa gegen Ölbohrungen in den 1990er Jahren oder die Fischereipolitik. Ein Höhepunkt war das Referendum vom 11. März 2013: Von 1.517 Wählern stimmten 99,8 % für den Verbleib beim Vereinigten Königreich – eine klare Botschaft an Argentinien und die Welt. Die Bevölkerung wuchs langsam von etwa 1.800 (1982) auf 3.662 (2021), dank Einwanderung aus Großbritannien, St. Helena und Chile; der Zensus 2012 ergab eine multikulturelle Gesellschaft mit 59 % Falklandern, 29 % Briten und 9,8 % St.-Helenern.
Wirtschaftlich wandelten sich die Falklands von einer schafzüchtenden Monokultur zu einem stabilen, diversifizierten Sektor. Die Schafzucht, die 1982 noch 700.000 Tiere umfasste, litt unter Marktrückgängen und synthetischen Fasern, doch Fischerei und Tourismus boomten. Ab den 1990er Jahren zogen Kreuzfahrtschiffe und Ökotouristen (z. B. Pinguinbeobachter) an, unterstützt durch bessere Infrastruktur wie Straßennetze und das King Edward VII Memorial Hospital in Stanley. Öl- und Gasexploration begann ernsthaft in den 2010er Jahren; 2010 entdeckte Rockhopper Exploration vielversprechende Vorkommen, doch Preisschwankungen und Streitigkeiten mit Argentinien verzögerten Kommerzialisierung. Die Arbeitslosigkeit lag 2016 bei nur 1 %, die Inflation bei 1,4 % (2014), und das BIP pro Kopf war hoch. Gesellschaftlich blieb die Kultur britisch geprägt: Englisch als Amtssprache, anglikanisches Christentum dominant (66 % der Bevölkerung 2012), und ein Bildungssystem nach englischem Vorbild mit kostenloser Pflichtschulbildung bis 16 Jahre.
Die 2010er Jahre brachten weitere Herausforderungen: Argentinien unter Präsident Cristina Fernández de Kirchner intensivierte Proteste gegen Ölbohrungen und Flugverbindungen, inklusive diplomatischer Vorfälle wie der Blockade von Fischereikonferenzen. Dennoch feierten die Falklands Meilensteine wie die Eröffnung des 2013 eingeweihten argentischen Kriegerdenkmals in Darwin oder die Teilnahme an Commonwealth-Spielen seit 1982.
Während der Corona-Zeit 1921 bis 1922 war die Inselgruppe aufgrund ihrer isolierten Lage und der geringen Bevölkerungszahl vom Weltgeschehen abgeschirmt. Die Inselregierung führte frühzeitig strikte Quarantänemaßnahmen, Reisebeschränkungen und Gesundheitskontrollen ein. Die Inseln setzten auf strenge Grenzkontrollen und Testregime. Die Corona-Zeit war geprägt von Vorsichtsmaßnahmen, insbesondere im Hinblick auf den eingeschränkten Reiseverkehr. 2022 wurde das Territorium für Reisende wieder problemlos zugänglich.
Chronologie:
1501 Mögliche Sichtung durch Amerigo Verspucci.
1520 Sichtung der Inselgruppe durch Esteban Gómez.
1540 Sichtung durch Francisco de Camargo.
1592 Sichtung der Inseln durch John Davis, Kapitän auf der Desire.
1594 Sichtung durch Richard Hawkins.
1600 Sichtung durch den Holländer Sebald de Weert.
1690 Erste Landung durch John Strong, Kapitän der Welfare. Der Kanal zwischen den beiden Hauptinseln wird nach Viscount Falkland, dem Schatzmeister der Royal Navy benannt.
1764 Louis Antoine de Bougainville gründet Fort Saint Louis auf Ost-Falkland
1765 Flottenadmiral John Byron landet ohne Kenntnis der französischen Siedlung auf Saunders Island im Westen der Falklands und nimmt die Falklands für die englische Krone in Besitz.
1766 Kaptiän John MacBride gründet die britische Siedlung Port Egmont auf Saunders Island. Die französische Siedlung Fort Saint Louis wird an Spanien verkauft und von diesen in Puerto de la Soledad umbenannt.
1770 Die Spanier vertreiben die Briten aus Port Egmont.
1771 Großbritannien übt massiven politischen Druck auf Spanien aus und erhältPort Egmont zurück.
1774 Aus ökonomischen Gründen geben die Briten Port Egmont auf, hinterlassen aber eine Inschrift, in der die Falklands als Teil des Empires deklariert werden.
1811 Die Spanier verlieren zunehmend an Einfluss in Südamerika und ziehen sich aus Puerto de la Soledad zurück.
1816 Argentinien erklärt seine Unabhängigkeit von Spanien.
1820 US-Amerikaner vertreiben auf argentinischen Wunsch britische Walfänger von Ostfalkland.
1826 Unter Louis Vernet, einem in Argentinien eingebürgerten Franzosen deutscher Abstammung, wird Puerto de la Soledad erneut besiedelt.
1829 Argentinien ernennt Vernet zum Gouverneur der Falklands und von Feuerland und erhebt Anspruch auf diese Gebiete als Rechtsnachfolger Spaniens. Großbritannien protestiert und erneuert seinen Souveränitätsanspruch.
1831 Vernet beschlagnahmt drei amerikanische Schiffe, die Robbenjagd auf den Falklands betreiben. Das amerikanische Kriegsschiff Lexington zerstört daraufhin Puerto de la Soledad, die Siedler werden vertrieben.
1833 Kapitän Onslow übernimmt Port Louis (das ehemalige Fort) und nimmt die Falklands erneut für Großbritannien in Besitz. Seitdem befinden sich die Falklands unter britischer Verwaltung (mit Ausnahme einer 10-wöchigen Unterbrechung 1982).
1843 Gründung von Port Jackson, nachmals (Port) Stanley.
1845 Der Hauptsitz der Inseln wird von Port Louis nach Stanley verlegt.
1914 Im Ersten Weltkrieg wird ein deutsches Flottengeschwader unter Admiral Graf von Spee bei den Falklands vernichtend von den Briten geschlagen.
1965 Auf Initiative Argentiniens verabschieden die Vereinigten Nationen die Resolution 2065, in der Argentinien und Großbritannien aufgefordert werden, über eine friedliche Lösung der Gebietsansprüche zu verhandeln, was anschließend auch geschieht.
1982 Am 2. April besetzen die Argentinier die Falklands. Großbritannien antwortet mit der Entsendung einer Task Force, um die Falklands zurückzuerobern. Argentinien kapituliert am 14. Juni.
1990 Die diplomatischen Beziehungen zwischen Argentinien und Großbritannien werden wieder aufgenommen.
1999 Am 14. Juli wird ein Vertrag unterzeichnet, in dem die Beziehungen zwischen den Falklands und Argentinien neu geregelt werden. Der Vertrag soll in erster Linie das Vertrauen zwischen Argentiniern und Falkländern wieder herstellen
Verwaltung
1690 landeten erstmals britischen Siedler auf den Falkland-Inseln, die sie damit für ihr Mutterland in Besitz nahmen. 1764 errichteten Franzosen auf Ostfalkland eine Siedlung, die sie am 1. April 1767 der spanischen Herrschaft unterstellten. 1774 wurden die Briten vertrieben, ihren Anspruch auf die Inselgruppe gaben sie jedoch nicht auf. Im Februar 1811 vertrieben die Briten die Spanier. Unterdessen erhob Argentinien - ab 1820 offiziell - Anspruch auf die Inselgruppe. Als sich 1828 der Franzose Louis Vernet hier ansiedelte, erteilten ihm die argentinischen Behörden alle Vollmachten zur Nutzung des Landes. In dieser Situation entschloss sich die britische Kolonialmacht zum Eingriff. Am 3. Januar 1833 setzte sie den argentinischen Gouverneur ab, am 9. Januar 1834 okkupierte sie die Falkland-Inseln. Am 2. Januar 1842 wurden sie britische Kronkolonie, am 6. März 1892 eine einfache Kolonie. Von 21. Juli 1908 bis 3. März 1962 gehörten zu deren Territorium auch die South Shetland Islands, die South Orkney Islands und Grahamland auf der Antarktis sowie bis 3. Oktober 1985 Südgeorgien. Von 2. April bis 14. Juni 1982 waren die Inseln von Argentinien besetzt.
Herrschaftsgeschichte
- 2. Februar 1594 Herrschaftsanspruch durch die Republik der Vereinigten Niederlande (Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden)
- 1. Februar 1690 bis 1. Mai 1707 Königreich England (Kingdom of England)
- 1. Mai 1707 bis 27. Januar 1764 Vereinigtes Königreich von Großbritannien (United Kingdom of Great Britain)
- 27. Januar 1764 bis 3. April 1767 Königreich Frankreich (Royaume de France)
- 3. April 1767 bis 22. Januar 1771 Königreich Spanien (Reino de España)
- 22. Januar 1771 bis 20. Mai 1774 Königreich Spanien (Reino de España), in Port Egmond Vereinigtes Königreich von Großbritannien (United Kingdom of Great Britain)
- 20. Mai 1774 bis 8. Oktober 1811 Königreich Spanien (Reino de España)
- 8. Oktober 1811 bis 8. November 1820 argentinische Gauchos in herrschaftsfreiem Raum
- 8. November 1820 bis 20. Dezember 1832 Vereinigte Provinzen von Rio de la Plata (Provincias Unidas del Río de la Plata)
- 20. Dezember 1832 bis 6. März 1892 Abhängiges Gebiet Falkland-Inseln (Dependency of the Falkland Islands) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland)
- 6. März 1892 bis 2. April 1982 Kronkolonie Falkland-Inseln (Colony of the Falkland Islands) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland, ab 12. April 1927 United Kingdom of Great Britain and Northeren Ireland)
- 2. April bis 14. Juni 1982 Militärregion Falkland-Inseln, Südgeorgien und Südliche Sandwich Inseln (Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur) der Republik Argentinien (Republica Argentina)
- seit 14. Juni 1982 Übersee-Territorium Falkland-Inseln (Overseas Territory of the Falkland Islands) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Northeren Ireland)
Verfassung
Seit 1985 hat Falkland eine eigene Verfassung. Die letzte Änderung erfolgte 1998. Als Übersehgebiet eines europäischen Mitgliedsstaates, wird den Inseln ein spezieller rechtlicher Status im Rahmen der Römischen Verträge und des Vertrags von Maastricht zugestanden. In Wahrheit wird das Archipel im Südatlantik aber von der EU nicht als britisches Übersehgebiet anerkannt. Die Falkland-Inseln haben allerdings ein auf der Overseas Association Decision basierendes Abkommen getroffen, das die zollfreie Einfuhr von Produkten aus den Überseeländern und Territorien zusichert. Als britische Bürger können die Falkland-Bewohner in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union reisen und arbeiten. Andersherum funktioniert das jedoch nicht: britische Festlandbewohner müssen einen Beitrag für den freien Personenverkehr, ähnlich wie für den Zoll zahlen.
Legislative und Exekutive
Das Parlament (Legislative Council) besteht aus dem Governor, dem Chief Executive sowie acht auf vier Jahre gewählten Mitgliedern. Da auf Falkland Parteien keine Bedeutung haben, handelt es sich um unabhängige Vertreter der falkländischen Bevölkerung.
Die Regierung (Executive Council) setzt sich zusammen aus dem Gouverneur, dem Chief Executive, dem Financial Secretary und drei Mitgliedern des Parlaments. Die Parlamentsmitglieder werden in die Regierung jeweils für ein Jahr vom Parlament gewählt.
Inseloberhaupt
Höchster Repräsentant Falklands ist der Gouverneur. Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln werden vom Gouverneur in Personalunion als Commissioner mitverwaltet.
Gouverneurs (Gouverneure, bis 1774 nur in Ost-Falkland)
- 5 Apr 1764 - 1 Apr 1767 Louis Antoine de Bougainville de Nerville (1729 - 1811)
- 2 Apr 1767 - 23 Jan 1773 Felipe Ruíz Puente (1724 - 1779)
- 23 Jan 1773 - 5 Jan 1774 Domingo Chauri [interimistisch] (1722 - um 1790)
- 5 Jan 1774 - 1 Feb 1777 Francisco Gil de Taboada y Lemos (1736 - 1809)
Gobernadores Comandantes (Kommandierende Gouverneure)
- 1 Feb 1777 - 22 Nov 1779 Ramón de Carassa y Sousa [interimistisch] (1740 - nach 1790)
- 22 Nov 1779 - 26 Feb 1781 Salvador de Medina y Juan (1755 - nach 1790)
- 26 Feb 1781 - 1 Apr 1783 Jacinto Mariano del Carmen Altolaguirre (1754 - 1787)
- 1 Apr 1783 - 28 Jun 1784 Fulgencio Montemayor y Sanchez (1745 - nach 1790)
- 28 Jun 1784 - 15 Mai 1785 Agustín Figueroa y Jimenez Montalvo
- 15 Mai 1785 - 25 Mai 1786 Ramón de Clairac y Villalonga (1748 - 1814)
- 25 Mai 1786 - 15 Mai 1787 Pedro de Mesa y Castro (1752 - nach 1800)
- 15 Mai 1787 - 10 Apr 1788 Ramón de Clairac y Villalonga [2]
- 10 Apr 1788 - 16 Mai 1789 Pedro de Mesa y Castro [2]
- 16 Mai 1789 - 30 Jun 1790 Ramón de Clairac y Villalonga [3]
- 20 Mai 1790 - 1 Mar 1791 Juan José de Elizalde y Ustariz
- 1 Mar 1791 - 1 Mar 1792 Pedro Pablo Sanguineto (1760 - 1806)
- 1 Mar 1792 - 20 Feb 1793 Juan José de Elizalde y Ustariz [2]
- 20 Feb 1793 - Apr 1794 Pedro Pablo Sanguineto [2]
- Apr 1794 - 15 Jun 1795 José de Aldana y Ortega (1758 - nach 1800)
- 15 Jun 1795 - 15 Mar 1796 Pedro Pablo Sanguineto [3]
- 15 Mar 1796 - 20 Feb 1797 José de Aldana y Ortega [2]
- 20 Feb 1797 - 17 Mar 1798 Luis de Medina y Torres
- 17 Mar 1798 - Apr 1799 Francisco Xavier de Viana y Alzaibar (1764 - 1820)
- Apr 1799 - 15 Mar 1800 Luis de Medina y Torres [2]
- 15 Mar 1800 - 31 Mar 1801 Francisco Xavier de Viana y Alzaibar [2]
- 31 Mar 1801 - 17 Mar 1802 Ramón Fernández de Villegas
- 17 Mar 1802 - Feb 1803 Bernardo de Bonavía
- Feb 1803 - 21 Mar 1804 Antonio Leal de Ibarra y Oxinando
- 21 Mar 1804 - 21 Mar 1805 Bernardo de Bonavía [2]
- 21 Mar 1805 - 20 Mar 1806 Antonio Leal de Ibarra y Oxinando [2]
- 20 Mar 1806 - Aug 1808 Bernardo de Bonavía [3]
- Aug 1808 - Jan 1810 Gerardo Bordas (1757 - nach 1810)
- Jan 1810 - 13 Feb 1811 Pablo Guillén Martínez
- 6 Nov 1820 - Feb 1821 David Jewett (1772 - 1842)
- Mai - Jun 1821 Guillermo Mason
- 2 Feb - Aug 1824 Pablo Areguati (Militärkommandant, 1780 - 1831)
Governors (Gouverneure)
- 30 Aug 1829 - 10 Sep 1831 Louis Élie Vernet (1792 - 1871)
- 28 Dez 1831 Silas Duncan (US-Kommandant)
- Dez 1831 - Okt 1832 William Dickinson [amtierend]
- 10 Okt - 30 Nov 1832 Juan Francisco Esteban Francisco Mestivier [intereimistischer Militärkommandant] (Joseph François Étienne Mestevier,, † 1832)
- 29 Dez 1832 - 3 Jan 1833 José María Pinedo (Garnisonskommandant, 1795 - 1885)
- 3 Jan - 26 Aug 1833 Juan (Jean) Simón [amtierender Militärkommandant] (1802 - 1833)
- Mai - 26 Aug 1833 Matthew Brisbane (Superintendent, 1797 - 1833)
Naval officers-in-charge (Diensthabende Marineoffiziere)
- 20 Dez 1832 - 5 Jan 1833 John James Onslow (britischer Kommandant, 1785 - 1856)
- 5 Jan - 26 Aug 1833 William Dickson [amtierend] (britischer Repräsentant)
- Apr - Aug 1833 Matthew Brisbane [amtierend]
- 9 Jan 1834 - 30 Nov 1837 Henry Smith (1797 - 1854)
- 30 Nov 1837 - Aug 1839 Robert Lowcay (1792 - 1853)
- Aug - 23 Dez 1839 William Robinson [amtierend]
- 23 Dez 1839 - 22 Jan 1842 John Tyssen
Lieutenant governor (Vizegouverneur)
- 22 Jan 1842 - 28 Nov 1843 Richard Clement Moody (1813 - 1887)
Governors (Gouverneure, 1962 - 1990 auch High Commissioners of British Arntarctic Territory; und ab 1985 auch Commissioners for South Georgia and South Sandwich Islands)
- 28 Nov 1843 - 15 Jul 1848 Richard Clement Moody
- 15 Jul 1848 - 5 Nov 1855 George Rennie (1802 - 1860)
- Nov 1855 - 1862 Thomas Edward Laws Moore (1819 - 1872)
- 1862 - 1866 James George Mackenzie (1803? - 1879)
- 24 Jun 1866 - 5 Apr 1870 William Francis Cleaver Robinson (1834 - 1897)
- 6 Apr 1870 - 30 Apr 1876 George Abbas Kooli D’Arcy (1818? - 1885)
- 30 Apr 1886 - 15 Mai 1878 Jeremiah Thomas Fitzgerald Callaghan (1827 - 1881)
- 15 Mai - 20 Dez 1878 Arthur Bailey [amtierend] (1818 - 1883)
- 20 Dez 1878 - 6 Apr 1880 Jeremiah Thomas Fitzgerald Callaghan [2]
- 6 Apr - 24 Nov 1880 Robert Christopher Packe [amtierend] (1824 - 1893)
- 24 Nov 1880 - 3 Mar 1886 Thomas Kerr (1818 - 1907)
- 3 Mar - 16 Dez 1886 Arthur Cecil Stuart Barkly (1843 - 1890)
- 16 Dez 1886 - 31 Jul 1889 Thomas Kerr [2]
- 31 Jul 1889 - 19 Feb 1890 Edward Pakanham Brooks [amtierend] ((1849 - 1896)
- 19 Feb 1890 - 28 Mar 1891 Thomas Kerr [3]
- 28 Mar - 13 Apr 1891 Frederick Shedden Sanguinetti [amtierend] (1847 - 1906)
- 13 Apr 1891 - 13 Apr 1893 Sir Roger Tuckfield Goldsworthy (1839 - 1900)
- 13 Apr - 14 Okt 1893 George Melville [amtierend] (1842 - 1924)
- 14 Okt 1893 - 18 Jul 1894 Sir Roger Tuckfield Goldsworthy [2]
- 18 Jul - 4 Nov 1894 Thomas Augustus Thompson [amtmierend] (1851 - nach 1924)
- 4 Nov 1894 - 17 Apr 1897 Sir Roger Tuckfield Goldsworthy [3]
- 17 Apr - 20 Okt 1897 Fred Craigie Halkett [amtierend] (1852 - 1899)
- 20 Okt 1897 - 1 Mai 1902 William Grey-Wilson (1852 - 1926)
- 1 Mai - 1 Nov 1902 William Hart Bennett [amtierend] (1861 - 1918)
- 1 Nov 1902 - 22 Jun 1904 William Grey-Wilson [2]
- 22 Jun - 1 Sep 1904 William Hart Bennett [2, amtierend]
- 1 Sep 1904 - 24 Apr 1907 William Lamond Allardyce (1861 - 1930)
- 24 Apr - 25 Sep 1907 Henry Eugene Wealter Grant [amtierend] (1855 - 1934)
- 25 Sep 1907 - 29 Dez 1909 William Lamond Allardyce [2]
- 29 Dez 1909 - 15 Dez 1910 Thomas Alexander Varis Best [amtierend] (1870 - 1941)
- 15 Dez 1910 - 21 Apr 1913 William Lamond Allardyce [3]
- 21 Apr 1913 - 30 Apr 1914 John Quayle Dickson [amtierend] (1860 - 1944)
- 30 Apr 1914 - 2 Apr 1914 William Lamond Allardyce [4]
- 2 Apr - 15 Mai 1915 Claude Forlong Condell [amtierend] (1865 - 1922)
- 15 Mai 1915 - 27 Sep 1919 William Douglas Young (ab 27 Jun 1919 Sir, 1859 - 1943)
- 27 Sep 1919 - 1 Apr 1920 Thomas Reginald Saint Johnson [amtierend] (1881 - 1950)
- 1 Mai 1920 - 1 Jun 1923 John Middleton (ab 3 Jun 1924 Sir, 1870 - 1954)
- 1 Jun 1923 - 8 Mai 1924 Herbert Henniker Heaton [amtierend für Middleton] (1880 - 1961)
- 8 Mai 1924 - 9 Mai 1926 John Middleton [2]
- 9 Mai 1926 - 8 Jun 1927 Alexander Elder Beattie [amtierend] (1888 - 1951)
- 9 Jun 1927 - 11 Jun 1928 Sir Arnold Wienholt Hodson (1881 - 1944)
- 11 Jun 1928 - 9 Jan 1929 John Medlicott Ellis [amtierend] (1895 - 1949)
- 9 Jan 1929 - 3 Feb 1931 Sir Arnold Wienholt Hodson [2]
- 3 Feb 1931 - 11 Feb 1934 Sir James O‘Grady (1866 - 1934)
- 11 Feb 1934 - 10 Feb 1935 John Medlicott Ellis [amtierend] (1895 - 1949)
- 10 Feb 1935 - 28 Jan 1941 Herbert Henniker Heaton [2] (ab 1 Feb 1937 Sir)
- 28 Jan 1941 - 26 Jul 1946 Allan Wolsey Cardinall (ab 1943 Sir, 1887 - 1956)
- 26 Jul - 26 Nov 1946 Arnold Burnett Mathews [amtierend] (1898 - 1990)
- 26 Nov 1946 - 9 Mar 1954 Geoffrey Miles Clifford (ab 9 Jun 1949 Sir, 1897 - 1986)
- 9 Mar 1954 - 28 Feb 1957 Oswald Raynor Arthur (ab 1 Jan 1957 Sir, 1905 - 1973)
- 28 Feb 1957 - 11 Mai 1964 Edwin Porter Arrowsmith (ab 1959 Sir, 1909 - 1992)
- 11 Mai 1964 - 27 Sep 1970 Cosmo Dugal Patrick Thomas Haskard (ab 1965 Sir, 1916 - 2017)
- 27 Sep 1970 - 8 Jan 1971 John Ashley Jones [amtierend] (1921 - 2016)
- 8 Jan 1971 - 20 Jan 1975 Ernest Gordon Lewis (1918 - 2006)
- 27 Jan 1975 - 2 Dez 1976 Neville Arthur Irwin French (1920 - 1996)
- 16 Dez 1976 - 31 Jan 1980 James Roland Walter Parker (1919 - 2009)
- 31 Jan - 27 Feb 1980 Francis Eustace „Dick“ Baker [amtierend] (1933 - 2023)
- 27 Feb 1980 - 2 Apr 1982 Rex Masterman Hunt (1926 - 2012)
Gobernadores militares (Argentinische Militärgouverneure)
- 2 - 3 Apr 1982 Osvaldo Jorge Garcia [interimistisch] (1949 - 1982)
- 3 Apr - 14 Jun 1982 Mario Benjamín Menéndez (1930 - 2015)
- 14 - 21 Jun 1982 Enrique Félix Peralta Martinez [amtierend]
British Military Commander (Britischer Militärkommandant)
- 14 Jun - 25 Jun 1982 John Jeremy Moore (1928 - 2007)
Civil Commissioner (Zivilikommandant)
- 25 Jun 1982 - 16 Okt 1985 Rex Masterman Hunt (ab 11 Okt 1982 Sir)
Governors (Gouverneure)
- 16 Okt 1985 - Nov 1988 Gordon Wesley Jewkes (* 1931)
- 8 Aug 1987 - 6 Jan 1988 Brian Raymond Cummings [amtierend für Jewkes] (* um 1942)
- Nov 1988 - 22 Jul 1992 William Hugh Fullerton (* 1939)
- Aug 1992 - Dez 1995 David Everard Tatham (* 1939)
- 8 Jan 1996 - Mai 1999 Richard Peter Ralph (* 1946)
- 12 Mai 1999 - 23 Nov 2002 Donald Alexander Lamont (* 1947)
- 23 Nov - 3 Dez 2002 Russ Jarvis [amtierend] (* 1947)
- 3 Dez 2002 - 5 Aug 2006 Howard John Stredder Pearce (* 1949)
- 5 - 28 Aug 2006 Harriet Hall [w, 2, amtierend]
- 28 Aug 2006 - 18 Sep 2010 Alan Edden Huckle (* 1948)
- 18 Sep - 16 Okt 2010 Ric Nye [amtierend]
- 18 Okt 2010 - 25 Feb 2014 Nigel Robert Haywood (* 1955)
- 25 - 27 Feb 2014 Sandra Tyler-Haywood [w, amtiuerend]
- 27 Feb - Apr 2014 John Duncan [amtierend] (* 1958)
- 29 Apr 2014 - 18 Jul 2017 Colin Roberts (* 1959)
- 18 Jul - 12 Sep 2017 Richard Alexander „Alex“ Mitham [amtierend]
- 12 Sep 2017 - 1 Jul 2022 Nigel James Phillips (* 1963)
- 1 - 23 Jul 2022 Dave Morgan [amtierend]
- seit 23 Jul 2022 Allison Mary Blake [w]
Chief Executives (Leitende Geschäftsführer)
- Dez 1985 - Apr 1987 David George Pendleton Taylor (1933 - 2007)
- Apr 1987 - 20 Mai 1988 Brian Raymond Cummings
- 4 Jun - Aug 1988 Colin Frank Redston [amtierend] (* 1939)
- Aug - 2Sep 1988 Rex Browning [amtierend] (um 1935 - 2020)
- 2 Sep 1988 - Apr 1989 David George Pendleton Taylor [2, interimistisch]
- Apr 1989 - Sep 1994 Ronald Sampson
- Sep 1994 - Nov 1999 Andrew Murray Gurr (* 1944)
- Jan 2000 - Mar 2003 Michael Dennis Blanch (* 1947)
- Mar 2003 - 12 Sep 2007 Chris John Simpkins (* 1952)
- 12 Sep 2007 - 3 Jan 2008 Michael Dennis Blanch [2, interimistisch]
- 3 Jan 2008 - 1 Feb 2012 Timothy „Tim“ Rupert Thorogood (* 1962)
- 1 Feb 2012 - 3 Okt 2016 Keith Padgett [interimistisch bis 6 Mar 2012]
- 3 Okt 2016 - 30 Apr 2021 Barry Alan Rowland (* 1961)
- 30 Apr 2021 - 30 Apr 2025 Andy Keeling (* 1968)
- seit 30 Apr 2025 Andrea Patricia Clausen [w] (* 1971)
Politische Gruppierungen
Es gibt keine aktiven politischen Parteien in den Falklandinseln. Alle Abgeordneten treten als Unabhängige (non-partisan) an und werden gewählt. Dies ist seit Jahrzehnten so und wird durch die Verfassung von 2009 unterstützt. Es existiert keine formale Opposition, und Entscheidungen werden oft konsensorientiert getroffen. Die Regierungsabläufe orientieren sich eng am britischen Modell. In der Vergangenheit gab es einige kurzlebige Parteien, die jedoch alle erloschen sind:
- Falkland Islands National Party, gegründet in den 1980er Jahren, fokussierte auf Unabhängigkeit oder engere Bindung an Großbritannien; aufgelöst nach der Falklandkrise 1982)
- Falkland Islands People's Party, existierte von den 1940er Jahren bis in die 1960er Jahren, spieltenaber keine dauerhafte Rolle.
Seit der Falklandkrise 1982 und dem Referendum 2013 (99,8 % für den Verbleib bei Großbritannien) hat sich die Politik auf lokale Themen wie Wirtschaft, Fischerei und Souveränitätsfragen konzentriert, ohne parteipolitische Strukturen.
Justizwesen und Kriminalität
Das Justizwesen der Falklandinseln basiert auf dem britischen Common Law und ist eng an das Rechtssystem des Vereinigten Königreichs angelehnt. Die geltenden Gesetze sind in einer eigenen Gesetzessammlung (Statute Law Database) erfasst und werden regelmäßig überarbeitet. Für die Durchsetzung des Rechts existiert ein gestuftes Gerichtssystem mit Summary Court, Magistrate’s Court, Supreme Court und Court of Appeal. Strafrechtliche Verfahren werden in der Regel von der Staatsanwaltschaft („Prosecution Service“) geführt, die unabhängig von Polizei und Regierung agiert und sowohl die Beweislage als auch das öffentliche Interesse prüft, bevor Anklage erhoben wird. Rechtsbeistand kann über ein Legal-Aid-System gewährt werden, das abhängig von Einkommen und Umständen teilweise oder vollständige Unterstützung bietet.
Die Polizei wird durch die Royal Falkland Islands Police gestellt, die in enger Zusammenarbeit mit der Justiz arbeitet. Das Kriminalitätsniveau auf den Inseln ist insgesamt sehr niedrig. Schwerere Gewaltverbrechen oder organisierte Kriminalität treten nur in Ausnahmefällen auf, und auch Diebstähle oder andere Eigentumsdelikte sind selten. Trotz der im Verhältnis zur Bevölkerung hohen Zahl an registrierten Schusswaffen – vor allem für die Jagd – gilt die Mordrate als extrem gering. Reisewarnungen bestätigen, dass die Falklandinseln für Besucher und Einwohner ein sehr sicheres Umfeld darstellen.
Ein besonderes Sicherheitsrisiko ergibt sich weniger aus Kriminalität als aus der Geschichte: In einigen Gebieten gibt es noch immer Relikte aus dem Falklandkrieg von 1982, etwa Landminen, die jedoch weitgehend markiert und abgesperrt sind. Drogenbesitz und -handel sind wie im Vereinigten Königreich streng verboten und werden konsequent strafrechtlich verfolgt. Vorkommnisse innerhalb der Polizei selbst, wie etwa die Verhaftung eines Polizeibeamten im Jahr 2025, zeigen, dass interne Kontrollmechanismen existieren und auch gegenüber staatlichen Organen rechtsstaatliche Prinzipien durchgesetzt werden. Insgesamt kennzeichnen die Falklandinseln ein transparentes Justizsystem und ein hohes Maß an öffentlicher Sicherheit.
Sicherheitskräfte
Infolge des Falklandkrieges, an dessen Anfang die wenigen britischen Soldaten auf den Inseln den argentinischen Truppen chancenlos unterlegen waren, wurde die Präsenz der britischen Streitkräfte deutlich verstärkt. Im Jahr 2005 waren noch etwa 1700 Soldaten aller drei Teilstreitkräfte auf den Inseln stationiert. Der zentrale Stützpunkt ist Mount Pleasant. Die British Army hat dort Infanterie-, Pionier- und Kommandoeinheiten stationiert. Neben der Überwachung der Inseln sind diese vorrangig für das Räumen von Minen und Munition aus Zeiten des Falklandkrieges zuständig, die noch heute Teile der Inseln zu Sperrgebieten machen.
Die Royal Air Force hat in Mount Pleasant ein Vickers VC10-Tankflugzeug, vier Tornado F3-Abfangjäger, ein Hercules-Transportflugzeug, sowie mehrere Transport- und SAR-Hubschrauber stationiert. Der Stützpunkt dient zudem der zivilen Versorgung der Inseln im Überseeverkehr.
Mount Pleasant wird zudem von der Royal Navy genutzt, die dort eine Korvette der Castle-Klasse sowie einen Lenkwaffenzerstörer oder eine Fregatte stationiert hat. Zudem patrouillieren regelmäßig britische Atom-U-Boote im Südatlantik, deren Fahrten allerdings geheim gehalten werden. In Notfällen kann zudem das Antarktispatrouillenschiff HMS Endurance hinzugezogen werden. In Mount Pleasant ist außerdem eine Abordnung der Royal Marines stationiert. Die britischen Streitkräfte können zudem im Ernstfall von der Falkland Islands Defence Force unterstützt werden. Diese setzt sich aus Bewohnern der Inseln zusammen und ist im Stil einer militärischen Reserveeinheit organisiert.
Internationale Beziehungen
Die Regierungsvertreter der Falkland-Inseln und Vertreter der Europäischen Kommission treffen sich einmal jährlich zum EU-OCT-Forum, das sich aus Repräsentanten der Europäischen Union und der OCT-Staaten (Überseeländer und Territorien) zusammensetzt. Andrea Clausen vermerkte dazu 2007: „Wir werden versuchen noch intensiver mit der Europäischen Kommission zusammenzuarbeiten, um den kontinuierlichen Marktzutritt und die finanzielle Unterstützung aufrecht zu erhalten. Damit können wir langfristig unsere Infrastruktur weiterentwickeln.“
Unter Präsident Néstor Kirchner haben sich die Beziehungen mit dem benachbarten Argentinien in der Heimat allerdings ernsthaft verschlechtert. Kirchner hatte sich zuerst in gewinnbringenden Geschäften kooperativ gezeigt, wie zum Beispiel bei der Erhaltung gemeinsam nutzbarer Fischvorkommen. Heute vergibt Argentinien einseitige Auflagen, die die Wirtschaft der Falkland-Inseln untergraben. Beispielsweise verhängte die Regierung eine Sperre für Charterflüge auf die Inseln und versucht bis dato zu verhindern, dass Unternehmen aus der Kohlenwasserstoff-Branche auf den Falkland-Inseln investieren.
Während die Bewohner des Eilands die argentinische Unterdrückungsmentalität verurteilen, haben einige Argentinier auf der Inselgruppe ein zu Hause gefunden und sich bestens in die Gesellschaft integriert. Generell sind Falkland-Bewohner äußerst stolz auf ihre kulturellen Wurzeln. Aber hin und wieder beschwert man sich gern über den Identitätsverlust des „kleinen Englands“. Alec Betts, der jetzt Alejandro heißt, ist im Juni 1982 endgültig nach Argentinien ausgewandert und unterstützt nun öffentlich dessen Rechtsanspruch auf die Falkland-Inseln. Anfang 2007 war er Kandidat für das Amt des Bürgermeisters in einer kleinen argentinischen Stadt und hat die Ansprüche seiner Wahlheimat vor der Vereinten Nationen in New York vorgetragen.
Flagge und Wappen
Die heutige Flagge der Falklandinseln wurde am 29. September 1948 eingeführt. Wie bei Kolonialflaggen britischer Überseegebiete üblich, führt sie auf blauem Tuch am Top der Mastseite einen Union Jack als Zeichen der Verbundenheit zum Mutterland und auf der Außenseite das Wappen der Falklandinseln.
Seit 1865 durften Schiffe britischer Kolonialregierungen einen Blue Ensign mit einem Badge (Abzeichen) im fliegenden Ende führen. Die jeweiligen Regierungen sollten entsprechende Bagdes zur Verfügung stellen. Handelsschiffe und seefahrende Privatpersonen aus Kolonien dürfen nur dann einen Red Ensign mit Badge führen, wenn von der britischen Admiralität eine entsprechende Erlaubnis für die Kolonie erteilt wurde.
Bei britischen Kolonien und abhängigen Gebieten kann die Darstellung des Badge (Wappen) im fliegenden Ende des Ensigns auf einer weißen Scheibe erfolgen. Ist dies nicht der Fall, wird das Wappen vergrößert dargestellt. Dabei gibt es noch die Möglichkeit, dass entweder nur das Wappenschild oder das komplette Wappen gezeigt wird. Beide Varianten sind möglich.
Anstelle eines Badge erscheint das Wappen der Falkland-Inseln, auf dem ein Schaf auf einer Insel dargestellt ist, und ein Schiff mit englischen Flaggen an den Masten, darunter ein Spruchband mit dem Motto der Inseln. Das Motto lautet: Desire the Right, was soviel heißt wie „Wünsche das Gute“. Die Flagge wurde 1948 eingeführt.
Blau mit der Flagge Großbritanniens oben links und dem Wappen Falklands rechts außen. Das Wappen enthält einen weißen Schafbock (Schafzucht ist die wichtigste wirtschaftliche Tätigkeit auf den Falklands); darüber ist das Segelschiff Desire zu sehen, dessen Crew die Insel entdeckte, darunter der Schriftzug Desire the right.
Das Wappen der Falklandinseln ist in dieser Form seit dem 29. September 1948 in Gebrauch. Es zeigt ein Schild, in dessen oberen Teil sich ein Widder befindet. Dieser symbolisiert die Wichtigkeit der Schafzucht für die Insel. Im unteren Teil sind Wellen dargestellt, auf denen sich ein Schiff befindet. Dieses soll die Desire sein, das Schiff mit dem John Davis die Insel 1592 entdeckte. Darunter befindet sich ein Spruchband mit dem englischen Nationalmotto des Britischen Überseegebietes: Desire the Right („Begehre das Rechte“).
Nationale Symbole:
- Farbe: blau
- Pflanze: pale maiden (Blasse Jungfrau, olysnium filifolium)
- Tier: penguin (Pinguin, spheniscida)
- Motto: Desire the Right („Begehre das Rechte“)
- Helden: Terry Peck, Trudi McPhee, Steve Whitley und Roger Middleton (Widerstä-ndler gegen die argentinischen Besatzer 1982)
Hymne
Die offizielle Hymne des Landes ist die britische, aktuell God Save the Queen. Als inoffizielle Hymne wird der Song of the Falklands („Falkland-Lied“) gesungen. Das Stücke wurde in den 1930er Jahren von Christopher Lanham, einem Lehrer aus Hampshire, während seiner Arbeit auf West Falkland komponiert.
Originalversion (englisch)
In my heart there’s a call for the isles far away
Where the wind from the Horn often wanders at play.
Where the kelp moves and swells to the wind and the tide
And penguins troop down from the lonely hillside.
Chorus:
Those isles of the sea are calling to me
The smell of the camp fire a dear memory.
Though far I may roam, some day I’ll come home
To the islands, the Falklands, the isles of the sea.
There’s a camp house down yonder I’m longing to see,
Though it’s no gilded palace it’s there I would be.
Just to be there again I would race o’er the foam,
For that lone house so far is my own home sweet home.
Chorus
Now we’re off to the Falklands, so wild and so free,
Where there’s tussock and kelp and the red diddle-dee,
And the wild rugged beauty that thrills more than me
Is bred in the bones on the isles of the sea.
Chorus
Hauptstadt
1764 gründeten die Franzosen in Port Louis die erste Siedlung auf der Inselgruppe, 1765 folgte mit Port Egmont der erste britische Stützpunkt. Beide Siedlungen dienten vor allem als militärische Stützpunkte oder Handelsposten, wechselten zeitweise zwischen britischer und spanischer Kontrolle, hatten aber nie den Status einer offiziellen Hauptstadt. 1845 verlegte man den Hauptsitz der Inselgruppe von Port Louis nach (Port) Stanley, das zwei Jahre zuvor als Port Jackson gegründet worden war. Damit wurde die Verwaltung der Falklands zentralisiert, und die Stadt entwickelte sich zum politischen und wirtschaftlichen Zentrum der Inselgruppe.
Verwaltungsgliederung
Falkland besteht aus zwei Landesteilen mit 30 Siedlungen sowie der Hauptstadt Stanley. Die Verwaltungseinheiten der Falkland-Inseln sind:
| Division | Fläche (km²) | Bevölkerung 2001 | E/km² |
| East Falkland | 6 740 | 742 | 0,11 |
| Stanley | 20 | 1 989 | 99,45 |
| West Falkland | 5 413 | 182 | 0,04 |
| Falkland | 12 173 | 2 913 | 0,18 |
Verwaltungseinheiten:
2 island districts bzw. divisions (Inselbezirke): East- und West Falkland
6 locations (Lokalitäten), davon 4 auf East Falkland
1 town (Stadtbezirk) auf East Falkland
30 settlements (Siedlungen), davon 24 auf East Falkland
Bevölkerung
Erstmals wurde das Gebiet der heutigen Falklandinseln am Ende des 16. Jahrhunderts erwähnt. Ihre eigentliche Besiedlung fand allerdings weitaus später statt. Die Bevölkerung stammt überwiegend von Einwanderern von den Britischen Inseln ab, die in den 1830er Jahren auf die Inseln kamen. Sie waren durchweg nordenglischen und schottischen Ursprungs. In den 1840er Jahren wanderten auch einige Menschen aus St. Helena und Chile ein. Im Folgenden die Entwicklung der Einwohnerzahl samt Dichte, bezogen auf die Fläche von 12.173 km².
Bevölkerungsentwicklung:
Jahr Einwohner Dichte (E/km²)
1764 28 0,00
1765 80 0,00
1785 100 0,00
1800 50 0,00
1810 50 0,00
1825 100 0,00
1851 287 0,02
1861 541 0,04
1871 811 0,07
1881 1 510 0,12
1885 1 760 0,15
1891 1 789 0,15
1898 2 000 0,16
1901 2 043 0,17
1911 2 272 0,18
1921 2 094 0,17
1924 2 197 0,17
1925 2 252 0,18
1931 2 392 0,20
1936 2 399 0,20
1946 2 239 0,18
1949 2 245 0,18
1950 2 249 0,18
1951 2 255 0,18
1952 2 255 0,18
1953 2 230 0,18
1954 2 216 0,18
1955 2 230 0,18
1956 2 276 0,18
1957 2 273 0,18
1958 2 250 0,18
1959 2 206 0,18
1960 2 150 0,17
1961 2 113 0,17
1962 2 172 0,17
1963 2 136 0,17
1964 2 268 0,18
1965 2 090 0,17
1966 2 131 0,17
1967 2 112 0,17
1968 2 002 0,17
1969 2 098 0,17
1970 2 045 0,17
1971 2 001 0,17
1972 1 957 0,16
1973 1 766 0,15
1974 1 799 0,15
1975 1 905 0,16
1976 1 963 0,16
1977 1 805 0,15
1978 1 867 0,15
1979 1 776 0,15
1980 1 813 0,15
1981 1 861 0,15
1982 1 870 0,15
1983 1 880 0,15
1984 1 890 0,15
1985 1 900 0,16
1986 1 916 0,16
1987 1 930 0,16
1988 1 940 0,16
1989 1 950 0,16
1990 1 958 0,16
1991 2 121 0,17
1992 2 150 0,17
1993 2 175 0,17
1994 2 220 0,18
1995 2 261 0,18
1996 2 221 0,18
1997 2 430 0,20
1998 2 432 0,20
1999 2 491 0,20
2000 2 882 0,23
2001 2 924 0,24
2002 2 947 0,24
2003 2 951 0,24
2004 2 954 0,24
2005 2 939 0,24
2006 2 921 0,24
2007 2 907 0,23
2008 2 885 0,23
2009 2 867 0,22
2010 2 852 0,22
2011 2 856 0,22
2012 2 858 0,22
2013 2 870 0,22
2014 2 887 0,23
2015 2 898 0,23
2016 2 910 0,23
2017 2 922 0,23
2018 3 398 0,28
2019 3 377 0,28
2020 3 480 0,29
2021 3 528 0,30
2022 3 490 0,29
2023 3 477 0,29
2024 3 470 0,29
Die Bevölkerung wuchs von 1981 bis 2001 um durchschnittlich 1,693 % pro Jahr.
Bevölkerungsaufteilung:
Bevölkerungszahl 2001 insgesamt 2 491
davon unter 15jährig 375 15,04 %
15 bis 64 Jahre alt 1 989 79,78 %
über 64jährig 129 5,18 %
Das Durchschnittsalter lag 2005 bei etwa 36 Jahren. Die mittlere Lebenserwartung liegt bei rund 76 Jahren. Die Zahl der Haushalte beträgt insgesamt etwas mehr als 1000.
Haushalte: 1991 1996 2001
Gesamtzahl 774 842 1061
Personen pro Haushalt 2,740 3,045 2,746
Regionale Verteilung
Zwei Drittel der Einwohner leben in der Hauptstadt Stanley. Die restlichen Falklandinsulaner verteilen sich auf die kleineren Orte und den Siedlungen auf den Nebeninseln.
| Division | Z 1972 | Z 1986 | Z 1991 | Z 1996 | Z 2001 | S 2006 |
| East Falkland | 257 | 389 | 311 | 753 | 742 | 194 |
| Stanley | 1 320 | 1 232 | 1 582 | 1 636 | 1 989 | 2 115 |
| West Falkland | 380 | 265 | 198 | 175 | 182 | 169 |
| Falkland | 1 957 | 1 916 | 2 121 | 2 564 | 2 913 | 2 478 |
Volksgruppen
Die Falkländer, die sich selbst auch als Kelpers (kelp ist das englische Wort für "Tang", also etwa "die im Tang Lebenden“) bezeichnen, sprechen Englisch mit einem Akzent, der sich an das Schottisch- und das Norfolk-Englisch anlehnt. Des Weiteren gibt es viele Lehnwörter, die aus dem Spanischen kommen, besonders die Viehhaltung und den Umgang mit Pferden betreffend (Gaucho-Tradition).
Möglicherweise werden die Falkland-Inseln in Zukunft multikultureller werden. 394 Bewohner kommen ursprünglich von der britischen Überseeinsel St. Helena im Südatlantik (13 Prozent), andere Einwanderer kommen aus Chile. Zwischen 2001 und 2005 ist die Zahl der chilenischen Einwanderer um 4 %, von 65 auf 131 Bewohner gestiegen.
„Die Falkland-Gesellschaft konnte von ihrer eigenen kulturellen Vielfalt profitieren", vermerkte dazu John Clifford, ein Regierungsvertreter St. Helenas. „Die Falkland-Inseln bekommen die Einwohner und Arbeitskräfte, die sie benötigen, und St. Helenas Auswanderer eine sichere Einkommensquelle und Jobangebote in Verantwortungspositionen. Viele Saints akzeptieren die Falkland-Inseln als ihr neues zu Hause und haben dort in ihre Zukunft investiert.“
Nationalitäten 1996:
Falklander 1 267 49,41 %
British 885 34,52 %
Helenians 264 10,30 %
Americans 33 1,29 %
Europeans 26 1,01 %
sonstige 88 3,43 %
Volksgruppen 2001:
Falkländer 1 325 45,5 %
Briten 704 24,2 %
Helenianer 133 4,6 %
Chilenen 65 2,2 %
Australier 33 1,1 %
Argentinier 25 0,9 %
Russen 13 0,4 %
Filipinos 12 0,4 %
sonstige 100 3,4 %
Sprachen
Die offizielle Sprache der Falklandinseln ist Englisch, das von nahezu allen Einwohnern gesprochen wird. Es handelt sich um eine Variante des britischen Englisch (Falkland Islands English), die durch die Isolation der Inseln einen eigenen Dialekt ("Falkland English") entwickelt hat. Dieser Dialekt zeigt Ähnlichkeiten zu australischem, neuseeländischem oder westbritischem Englisch und ist in ländlichen Gebieten ("Camp") stärker ausgeprägt.
Spanisch wird von 10 bis 12 % der Bevölkerung gesprochen, hauptsächlich von Einwanderern aus Chile oder Argentinien (zum Beispiel Arbeiter und Expats). Es dient oft geschäftlichen Zwecken. Aufgrund der multikulturellen Einwanderung aus St. Helena, von den Philippinen oder aus Simbabwe hört man gelegentlich Filipino (Tagalog) und Shona. Historisch gab es Einflüsse von Französisch (frühe Kolonisation), Schottisch-Gälisch (frühe Siedler) und Yaghan (indigen, aber ausgestorben und spurlos).
Religion
Die Falklandinseln sind stark christlich geprägt. Laut dem Zensus von 2016 gehören etwa 65 bis 70 % der Bevölkerung von rund 3.660 Einwohnern christlichen Konfessionen an. Die Anglikanische Kirche (Church of England) ist die größte Glaubensgemeinschaft, und die Christ Church Cathedral in Stanley, die südlichste anglikanische Kathedrale der Welt, dient als religiöses und kulturelles Zentrum. Eine bedeutende Minderheit gehört der römisch-katholischen Kirche an, vor allem durch Einwanderer aus Chile und Argentinien.
Kleinere Gemeinden umfassen Presbyterianer, Methodisten und evangelikale Gruppen. Nicht-christliche Religionen wie Islam, Hinduismus oder Buddhismus sind selten und treten nur vereinzelt durch Einwanderer aus Ländern wie den Philippinen oder Simbabwe auf. Eine jüdische Gemeinde existiert nicht. Etwa 20 bis 25 % der Bevölkerung bezeichnen sich als nicht religiös, agnostisch oder atheistisch, in Übereinstimmung mit Trends in westlichen Ländern. Indigene Glaubensrichtungen gibt es nicht mehr, da die ursprüngliche Yaghan-Bevölkerung ausgestorben ist. Religion spielt eine moderate Rolle im Alltag, mit regelmäßigen Gottesdiensten in Stanley, wobei die Christ Church Cathedral eine zentrale Bedeutung hat.
Religionsbekenntnisse 2001:
Anglikaner 1 111 38,14 %
Protestanten 814 27,94 %
Katholiken 762 26,16 %
freie Christen 21 0,73 %
sonstige Christen 39 1,33 %
Bahai 10 0,30 %
sonstige 58 2,00 %
Bekenntnislose 99 3,40 %
Siedlungen
Zwei Drittel der rund 2500 Einwohner (ohne das in Mount Pleasant konzentrierte Militär) wohnen in der Hauptstadt Stanley, die auch zugleich Hauptort von Ost-Falkland ist. Der Hauptort von West-Falkland, Port Howard, der über eine eigene asphaltierte Landebahn verfügt, hat nur rund 120 Einwohner. Von den übrigen Siedlungen auf den beiden Inseln haben weniger als zehn mehr als 50 Einwohner. Die restlichen Siedlungen verteilen sich über eine große Fläche und sind so genannte camp settlements, vergleichbar mit Weilern, bisweilen sogar nur camps, also Einzelhöfe.
| Z 1986 | Z 1991 | Z 1996 | Z 2001 | Z 2006 | Z 2012 | Z 2016 | |
| Fox Bay (Bahía Fox) | 22 | ||||||
| Goose Green (Pradera del Ganso) | 90 | 70 | 68 | 40 | |||
| Hill Cove | 16 | ||||||
| Mount Pleasant (RAF Airbase) | 483 | 534 | 477 | 369 | 366 | ||
| North Arm | 20 | ||||||
| Port Howard (Puerto Mitre) | 60 | 34 | 22 | 20 | |||
| Stanley | 1,232 | 1,582 | 1,636 | 1,989 | 2,115 | 2,120 | 2,634 |
Stanley, auch bekannt als Port Stanley, ist die Hauptstadt und der größte Ort der Falklandinseln, einem britischen Überseegebiet im Südatlantik. Die Stadt liegt auf East Falkland auf einem nach Norden ausgerichteten Hang in einer der feuchtesten Regionen der Inselgruppe, direkt am südlichen Ufer der Port-William-Bucht. Mit einer Einwohnerzahl von rund 2.460 Menschen bei der Volkszählung von 2016 beherbergt Stanley etwa zwei Drittel der gesamten falkländischen Bevölkerung von knapp 3.400 Einwohnern. Als wirtschaftliches, administratives und kulturelles Zentrum der Inseln dient die Stadt als Drehscheibe für Handel, Tourismus und Regierungsgeschäfte. Die Geschichte Stanleys reicht zurück ins 19. Jahrhundert: Ursprünglich hieß der Ort Port Jackson, wurde aber 1845 zur offiziellen Regierungssitz und nach dem britischen Premierminister Lord Stanley umbenannt. Frühe Siedler wurden von den geschützten inneren und äußeren Häfen angezogen, die ideale Bedingungen für Segelschiffe boten. Heute ist Stanley ein gemütlicher, windgepeitschter Hafenort mit viktorianischem Flair, geprägt von pastellfarbenen Holzhäusern, gepflasterten Straßen und einer Mischung aus britischer Tradition und falkländischer Robustheit. Sehenswürdigkeiten umfassen das Falkland Islands Museum mit Ausstellungen zur Geschichte, Flora und Fauna, das 1892 erbaute Christ Church Cathedral mit seinem ikonischen Walbogen aus Rippenknochen vor dem Eingang, die Government House aus dem Jahr 1845 – das Wohnsitz des Gouverneurs – sowie zahlreiche Kriegsdenkmäler und Schiffswracks im Hafen, die an den Falklandkrieg von 1982 erinnern. Die Stadt bietet vier Pubs, elf Hotels und Gästehäuser, drei Restaurants sowie eine Fisch-und-Chips-Bude, und der Tourismus blüht besonders in der Sommersaison durch Kreuzfahrtschiffe. Wirtschaftlich dominiert die Wollproduktion als Exportgut, während Importe wie Lebensmittel, Petroleum und Bekleidung den Alltag sichern. Stanley verfügt über das King Edward VII Memorial Hospital als zentrales medizinisches Zentrum, den Falkland Islands Radio Station (FIRS) und die wöchentliche Zeitung Penguin News. Der nahegelegene Stanley Airport bedient Inlandsflüge, während internationale Verbindungen über die RAF Mount Pleasant erfolgen. Trotz der isolierten Lage – etwa 500 Kilometer östlich der patagonischen Küste Argentiniens – strahlt Stanley eine unerschütterliche britische Präsenz aus, geformt durch Kolonialgeschichte, den Konflikt von 1982 und die natürliche Schönheit der umliegenden Pinguinkolonien und Moore.
Mount Pleasant, etwa 53 km südwestlich von Stanley auf der Ostfalkland-Insel gelegen, ist als RAF Mount Pleasant bekannt, eine strategische Royal-Air-Force-Basis und das Herzstück der britischen Verteidigung der Falklandinseln. Die Anlage, offiziell als Mount Pleasant Complex (MPC) bezeichnet, wurde 1985 eröffnet – zunächst als Falkland Islands Strategic Airfield (FISA) von einem Konsortium britischer Bauunternehmen wie Mowlem, John Laing und Amey errichtet – und dient seitdem als modernste dauerhafte RAF-Basis weltweit. Mit dem Motto „Defend the right“ (während das der Inseln „Desire the right“ lautet) beherbergt sie zwischen 1.000 und 2.000 britische Militärpersonal und ist Teil der British Forces South Atlantic Islands (BFSAI). Die Basis entstand als direkte Reaktion auf den Falklandkrieg von 1982, um die Inseln vor weiteren Bedrohungen zu schützen, und ersetzte frühere Einrichtungen am Stanley Airport. Heute fliegen hier Eurofighter Typhoon FGR4 der No. 1435 Flight für die Luftverteidigung – eine Einheit mit Wurzeln bis in den Zweiten Weltkrieg zurück –, sowie die Air Tanker der No. 45 Squadron und No. 10 Squadron mit Airbus Voyager für Luftbetankung, Transport, Such- und Rettungseinsätze sowie maritime Patrouillen. Die Anlage ist international zertifiziert und ermöglicht zivile Flüge, darunter die wöchentliche „Air Bridge“-Verbindung nach RAF Brize Norton in England, kommerzielle Routen nach Chile und gelegentliche Charterflüge. Der Komplex umfasst eine 800 Meter lange Millennium Corridor (früher spöttisch „Death Star Corridor“ genannt), die Kasernen, Messe, Freizeit- und Wohlfahrtsräume verbindet, sowie Sportanlagen wie ein Gym, Fußballfelder und den einzigen Cricket-Platz der Falklands. Weitere Einrichtungen sind zwei NAAFI-Shops, ein Medical Centre, ein Bildungszentrum, BFBS Radio und ein kleiner Laden der Falkland Islands Company. Obwohl militärisch dominiert, bietet Mount Pleasant auch touristische Ansätze, wie geführte Touren zu Pinguinen oder Kriegsgedenkstätten in der Umgebung, und unterstreicht die anhaltende britische Präsenz seit dem Krieg, in dem 255 Briten, 649 Argentinier und drei Zivilisten starben. Als Bollwerk der Souveränität bleibt die Basis ein Symbol für Stabilität in dieser windigen, fernen Ecke der Welt.
Verkehr
Die Verkehrsverbindungen innerhalb Falklands sind begrenzt. Hauptverkehrsmittel sind Boote und Flieger.
Straßenverkehr
Geteerte Straßen findet man nur in den Städten, zwischen den Orten führen eher teilweise befestigte Pfade und Schotterwege. Von den 348 km Allwetterstraßen des Jahres 2000 (2025 waren es 440 km) waren 83 km asfaltiert, der Rest unbefestigte Schotterpisten. Die einzige ausgebaute Straße außerhalb der Ortschaften besteht zwischen Port Stanley und dem Militärstützpunkt Mount Pleasant (53 km).
Der Straßenverkehr hat sich seit den 1980er Jahren enorm entwickelt und verbindet heute die Siedlungen auf Ost- und Westfalkland. Insgesamt umfasst das Netz etwa 3.000 km, ideal für Geländewagen, weniger für normale Autos. Die Linksverkehrregelung gilt seit 1982, mit Geschwindigkeitslimits von 40 km/h außerorts und 64 km/h in bewohnten Gebieten. Wichtige Strecken sind die Darwin Road, eine gravelige Piste von Stanley nach Darwin, die atemberaubende Landschaften durchquert, und das Netz um Mount Pleasant. Autovermietungen bieten 4x4-Fahrzeuge an, und Fahrräder sind in Stanley beliebt, wenngleich hügeliges Gelände und Wind die Nutzung einschränken. Öffentliche Busse gibt es kaum; stattdessen organisieren Touranbieter geführte Fahrten. Die Straßen dienen primär dem Transport von Schafen (die Inseln haben über 500.000), Gütern und Touristen zu Pinguinkolonien. Seit dem Krieg wurden Brücken und Wege ausgebaut, um die Abhängigkeit von Flugzeugen zu reduzieren. Insgesamt ist der Straßenverkehr robust und abenteuerlich, mit Fokus auf Nachhaltigkeit – es gibt keine Ampeln, und die geringe Dichte minimiert Staus.
Bahnverkehr
Auf den Falklandinseln gibt es keinen aktiven Bahnverkehr mehr; die letzten Relikte stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert und dienen heute nur noch historischen oder musealen Zwecken. Die einzige nennenswerte Eisenbahn war die Camber Railway, eine Schmalspurbahn mit 610 mm Spurweite, die 1915/16 entlang des Stanley Harbour aufgebaut wurde. Diese 5,6 km lange Strecke transportierte Kohle für die Generatoren einer Admiralitäts-Funkstation und wurde bis in die 1920er Jahre betrieben. Zwei Dampflokomotiven der Kerr Stuart "Wren"-Klasse (eine sogar mit der humorvollen Beschriftung "Falkland Islands Express") zogen Waggons für Güter und Arbeiter. Die Gleise wurden später für Verteidigungsanlagen im Falklandkrieg 1982 umgenutzt, und Reste der Trasse sind heute noch sichtbar, inklusive verrotteter Schwellen und Schienenabschnitte. Historisch gab es zudem kurze Hand- oder Pferdebahnen an Jetty's für den Güterumschlag und eine Schmalspurgleis an einer Walfangstation auf New Island (1909 bis 1915).
Seit 1946, als der Gouverneur Sir Miles Clifford die Modernisierung einleitete, hat sich der Fokus auf Luft- und Straßenverkehr verlagert. Heutige Pläne für eine Wiederbelebung existieren nicht; stattdessen werden Hubschrauber und kleine Flugzeuge für ähnliche Aufgaben eingesetzt. Der Bahnverkehr bleibt somit ein faszinierendes Kapitel der Inselgeschichte, das in Briefmarken und Museen gewürdigt wird.
Schiffsverkehr
Der Schiffsverkehr ist der traditionelle und weiterhin wichtigste Weg, um die Falklandinseln mit der Außenwelt zu verbinden, da sie von Südamerika aus etwa 500 Kilometer entfernt liegen. Die beiden Hauptseaports sind Stanley auf Ostfalkland und Fox Bay auf Westfalkland. Stanley dient als zentraler Umschlagplatz für Güter, Treibstoff und Passagiere, während Fox Bay vor allem für landwirtschaftliche Produkte genutzt wird. Regelmäßige Frachtschiffe, oft aus dem Vereinigten Königreich oder Südamerika, versorgen die Inseln mit Lebensmitteln, Maschinen und Baumaterialien. Eine Besonderheit ist die Fähre MV Concordia der Workboat Services Ltd., die mehrmals wöchentlich zwischen New Haven (Ostfalkland) und Port Howard (Westfalkland) pendelt und Fahrzeuge sowie Fußgänger transportiert. Diese Verbindung dauert etwa zwei Stunden und bietet spektakuläre Ausblicke auf Meereslebewesen wie Robben und Pinguine.
+Für den Tourismus sind Kreuzfahrtschiffe entscheidend: Über 40 Schiffe pro Saison (November bis März) legen an, oft mit Zodiac-Booten für Landgänge an entlegenen Stränden. Die Mare-Harbour-Ro-Ro-Einrichtung, kürzlich modernisiert, ermöglicht den sicheren Anlegen von Versorgungsschiffen für die britische Militärpräsenz. Insgesamt transportiert der Schiffsverkehr jährlich Tausende Tonnen Güter und Hunderte Touristen, ist aber wetterabhängig – starke Stürme können Verspätungen verursachen. Die Falkland Islands Maritime Authority (FIMA) reguliert den Verkehr und erlaubt auch Privatjachten mit Genehmigung der Landbesitzer.
Luftverkehr
Die Falklandinseln können von Großbritannien aus mit der Britischen Luftwaffe (RAF) erreicht werden. Die RAF fliegt bis zu drei Mal wöchentlich mit Tristar-Transportflugzeugen zwischen Brize Norton in Oxfordshire und Mount Pleasant auf den Falklandinseln, die auch dem Zivilverkehr dienen. Von Mount Pleasant gibt es auch Flugverbindungen nach Chile. Eine Flugverbindung nach Argentinien existiert seit dem Falklandkrieg nicht mehr.
Der Inlandverkehr wird von der Falkland Island Gouvernment Airlines System (FIGAS) mit einer Flotte von sechs Britten-Norman BN-2 Islander gewährleistet, die ihre Flugpläne täglich auf Vorbestellung nach Bedarf zusammenstellt. Die Flugpläne werden am Vorabend per Radio bekannt gegeben. Der Inlandverkehr nutzt den Flugplatz von Port Stanley als Ausgangsbasis. Bei den über die Inseln verstreuten Siedlungen bestehen Landeplätze – oft nur Rasenstreifen oder ein geeigneter Strand.
Der Flugplatz Port Stanley ist ein kleiner Flughafen, rund 3 km von der Hauptstadt Stanley entfernt. Der Flugplatz ist der einzige zivile Flugplatz auf den Inseln mit einer asphaltierten Start- und Landebahn. Der Flugplatz wird von der Regierung der Falklandinseln unterhalten und er wird für Flüge zwischen den Inseln genutzt.
Vor 1972 gab es keinen Flughafen auf den Falklandinseln mit einer asphaltierten Start- und Landebahn. Man konnte die Inseln nur über den Wasserweg erreichen. In den frühen Siebzigern hat die "Falkland Islands Company" wegen der steigenden Beliebtheit der Luftwege nach Südamerika entschieden, die monatliche Schiffsverbindung nach Montevideo in Uruguay zu streichen. 1971 hatte die argentinische Luftwaffe die Isolation der Inseln mit Amphibienflugzeugen unterbrochen. Es handelte sich dabei um Flugzeuge des Typs Grumman HU-16, die von Comodoro Rivadavia aus starteten und deren Flüge von der LADE ausgeführt wurden. 1973 unterzeichnete das Vereinigte Königreich ein Abkommen mit Argentinien, um einen Flugplatz auf den Inseln zu finanzieren. Nun starteten die Flüge wieder von Comodoro Rivadavia, aber diesmal waren es Flugzeuge des Typs Fokker F28.
Bei der argentinischen Besetzung im April 1982 spielte der Flughafen in der Anfangsphase eine entscheidende Rolle, nur so konnte der Überraschungs-Coup, die Malvinas mit ihrer "Verteidigungsmacht" von 40 britischen Soldaten im Handstreich zu erobern, gelingen; erst dann konnten die Argentinier Schiffe mit Truppen nachschicken. Deshalb bombardierten die Briten beim Beginn der Rückeroberung einen Monat später, als erstes den Flughafen von Stanley (Operation Black Buck), um damit die argentinische Luftwaffe weitgehend auszuschalten, um sich dann auf die Seeschlacht und die Landung auf den Inseln (Falklandkrieg) konzentrieren zu können. Nach 72 Tagen argentinischer Besetzung waren die Falklandinseln wieder britisch, die Royal Air Force benutzte den Flugplatz auch für die Versorgung und Verstärkung der am Mount Pleasant stationierten britischen Soldaten, bis der Truppenstützpunkt mit seinen etwa 1500 Soldaten einen eigenen Militärflugplatz bekam. Der Flughafen von Stanley wird heutzutage weitgehend wieder zivil genutzt, vor allem für Flüge auf den Inseln und eine Flugverbindung nach Chile.
Die Regierung der Falklandinseln (Falkland Islands Government Air Service; kurz FIGAS) wickelt vor allem Flüge zwischen den Falklandinseln vom Flugplatz ab. Die British Antarctic Survey benutzt auch den Flugplatz. Der Port Stanley Airport wird dabei für Luftverbindungen zu den britischen Forschungsstationen in der Antarktis genutzt. Er wurde am 15. November 1972 durch die argentinische Luftwaffe eröffnet. Der argentinische Präsident Néstor Kirchner hat 2003 alle Flüge von Argentinien aus gestoppt. Seitdem kommen die meisten Flüge nun aus Punta Arenas in Chile kamen, die von den LAN Airlines nach Mount Pleasant durchgeführt werden.
Port Stanley Airport
- Code: PSY / SFAL
- Lage: 51°41‘08“ S, 57°46‘40“ W
- Seehöhe: 23 m (75 ft)
- Entfernung: 3,2 km ostnordöstlich von Stanley
- Inbetriebnahme: 1, Mai 1979
- Betreiber: Falkland Islands Government
- Terminal: 1
- Rollbahnen: 2
- Länge der Rollbahnen: 918 m und 338 m (beide Asfalt)
- Fluggesellschaft: 1
- Flugzeug-Standplätze: ca. 10
- jährliche Passagierkapazität:
- jährliche Frachtkapazität:
Wirtschaft
Falkland hat eine eigene Währung, das Falkland-Pfund. Dieses ist an das britische Pfund gebunden. Das BIP pro Kopf liegt bei etwa 20.800 Euro (2003). Die Arbeitslosigkeit liegt mit 6 % über dem Durchschnitt des Vereinigten Königreichs.
Bedeutsame Einnahmen erzielen die Falklandinseln durch das Vergeben von Lizenzen zum Fischfang an Unternehmen aus dem Ausland. Nicht selten kommt es deswegen zu Konflikten mit dem Nachbarland Argentinien. Neben den ökologischen Problemen, die eine Überfischung mit sich brächte, spielen nach wie vor politische Motive eine große Rolle. Ausgehend von der wirtschaftlichen Polarisation in Richtung Landwirtschaft und Fischproduktion bleibt allerdings die weitestgehend natürliche Beschaffenheit der Falklandinseln erhalten. Die reizvollen leicht bewachsenen Inseln sind nicht überbaut mit rauchenden Fabrikschornsteinen. So sind die Pinguine und die anderen seltenen Meeresbewohner kaum eingeschränkt und in ihrem natürlichen Umfeld gestört.
Landwirtschaft
Die Landwirtschaft, vor allem die Schafzucht, ist historisch der Kern der falkländischen Wirtschaft und nutzt die weiten, windigen Ebenen der Hauptinseln East und West Falkland optimal. Fast das gesamte Land außerhalb der Hauptstadt Stanley dient als Weidefläche für etwa 700.000 Schafe, hauptsächlich der Rassen Polwarth und Corriedale, die für feine Wolle gezüchtet werden. Die Falkland Islands Company spielte seit dem 19. Jahrhundert eine Schlüsselrolle, indem sie Cheviot-Schafe einführte und die Wollproduktion professionalisierte – Wollwolle ist bis heute das führende landbasierte Exportgut, vor allem nach Großbritannien. Mutton-Exporte in die UK begannen 2003 nach dem Bau einer Schlachtanlage 2002, und Politikwechsel in den 1980er Jahren förderten kleinere, lokale Farmen statt großer Konzerne.
Trotz Rückgängen beschäftigt der Sektor rund 10 % der Bevölkerung und trägt stabil zum BIP bei. Bis 2025 bleibt die Landwirtschaft eng mit dem Handwerk verknüpft: Lammfelle und Wolle dienen als Rohstoffe für lokale Produkte, während der Tourismus – mit Farm-Besuchen – zusätzliche Einnahmen generiert. Die wirtschaftliche Strategie der Regierung sieht in der Landwirtschaft Potenzial für nachhaltige Expansion, etwa durch Bio-Qualitätsmarken, um den Übergang zu diversifizierten Einkünften zu erleichtern.
Viehbestand: 1996 2021
Schafe 685 686 487 137
Rinder 4 365 4 276
Pferde 1 324 445
Fischerei
Die Fischerei ist der dominierende Sektor der falkländischen Wirtschaft und trägt zwischen 50 und 60 % zum Bruttoinlandsprodukt bei. Seit der Einführung einer exklusiven Wirtschaftszone 1987 verkauft die Regierung Fanglizenzen an ausländische Unternehmen, was jährlich Millionen einbringt – ein Schritt, der die Abhängigkeit von der traditionellen Landwirtschaft reduzierte. Hauptprodukte sind Tintenfisch (Loligo gahi) und Fische wie Hake und Merluza, die hauptsächlich exportiert werden. Die Verarbeitung erfolgt größtenteils im Ausland, etwa in Spanien, wo der Großteil des Zusatzwerts entsteht.
Die saisonale Fangquote wird streng reguliert, um Überfischung zu vermeiden; in den 1990er Jahren führte eine Krise zu Maßnahmen wie Fangquoten und Schutzgebieten. 2024 geriet der Tintenfischsektor in eine schwere Krise mit einem vorübergehenden Fangverbot, doch 2025 zeichnet sich eine Erholung ab, mit Erwartungen an ein Fünf-Jahres-Hoch. Parallel dazu plant die Regierung eine umfassende Konsultation zur Lachszucht (Salmon Farming) von Juni bis August 2025, einschließlich eines Joint-Ventures für eine Produktion von 50.000 Tonnen Atlantik-Lachs jährlich. Diese Initiative könnte die Fischerei diversifizieren und lokale Verarbeitung stärken, stößt aber auf Umweltbedenken und Kontroversen mit Argentinien. Insgesamt bleibt die Fischerei ein Bindeglied zu anderen Sektoren: Sie finanziert Infrastruktur und unterstützt den Tourismus durch nachhaltige Ökotouren zu Seevögeln und Meeressäugern.
Anlandungen in t insgesamt
1992 1 855
1993 1 985
1994 8 750
2004 55 369
Erdölwirtschaft
Die Geschichte der Erdölförderungm im Bereich der Falklandinseln reicht bis in die 1970er Jahre zurück, doch erst nach dem Falklandkrieg 1982 intensivierten britische Firmen die Suche. 2010 markierte ein Meilenstein mit den Entdeckungen im North Falkland Basin: Sea Lion, das größte konventionelle Ölfeld vor der afrikanischen Westküste, mit einer besten Schätzung von 730 Millionen Barrel, und das benachbarte Darwin-Gasfeld mit 3,2 Billionen Kubikfuß Gas sowie über 400 Millionen Barrel Kondensat und LPG. Diese Funde, bestätigt durch unabhängige Berichte wie den NSAI-Report von März 2025, zogen Investoren wie Rockhopper Exploration und Borders & Southern Petroleum an. Frühe Bohrungen in den 1990er Jahren hatten nur kleinere Funde erbracht, doch die jüngsten Entwicklungen – einschließlich Seismikdaten und Testbohrungen – haben das Vertrauen gestärkt. Bis 2025 hat die Regierung Lizenzen an Dutzende Blöcke vergeben, was jährliche Lizenzgebühren von Millionen generiert und den Übergang von reiner Exploration zur Entwicklung einleitet. Diese Entdeckungen verknüpfen sich nahtlos mit der breiteren Wirtschaft: Ölgelder könnten Infrastruktur wie den Stanley-Hafen oder erneuerbare Energien finanzieren, während der Sektor nur 5–10 % der aktuellen Arbeitsplätze beansprucht, aber langfristig Hunderte neue schaffen könnte.
Das Sea-Lion-Feld, 220 Kilometer nordöstlich der Hauptinseln gelegen, ist das Herzstück der falkländischen Erdölambitionen und befindet sich im Oktober 2025 in der finalen Vorbereitungsphase. Navitas Petroleum (65 % Anteil) als Operator und Rockhopper Exploration (35 %) treiben das Projekt voran, mit einem Fokus auf Phase 1, die 170 Millionen Barrel aus dem Northern Development Area fördert. Die Nutzung des umgerüsteten FPSO-Schiffs Aoka Mizu, das derzeit im Nordsee operiert, ermöglicht eine Peak-Produktion von 55.000 Barrel pro Tag, mit erstem Öl voraussichtlich im vierten Quartal 2027. Die FID, ursprünglich für Mitte 2025 geplant, wurde auf Ende 2025 verschoben, doch jüngste Fortschritte – darunter ein MoU für das FPSO im November 2024 und abgeschlossene Front-End-Engineering-Design-Studien – lassen Optimismus aufkommen. Rockhopper hat kürzlich 140 Millionen US-Dollar aufgebracht, die in Escrow warten, und plant eine Senior-Secured-Finanzierung von 1 Milliarde US-Dollar; insgesamt benötigt Phase 1 1,66 Milliarden US-Dollar bis zum Produktionsstart und 2,05 Milliarden bis zur Fertigstellung. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (EIS) wurde 2024 eingereicht, mit öffentlichen Konsultationen bis Juli 2025, die soziale und ökonomische Auswirkungen beleuchteten. Dieses Projekt verwebt sich mit der lokalen Wirtschaft: Es könnte das BIP um 20–30 % steigern, Steuereinnahmen generieren und den Tourismus durch verbesserte Logistik ergänzen, während es Umweltrisiken wie Ölunfälle minimiert.
Handwerk
Das Handwerk auf den Falklandinseln ist ein kleiner, aber lebendiger Sektor, der eng mit Landwirtschaft und Tourismus verwoben ist und lokale Identität schafft. Es konzentriert sich auf handgefertigte Souvenirs aus natürlichen Materialien wie Wolle, Sand und Glas, die in Stanley und umliegenden Ateliers produziert werden. Bekannte Produkte umfassen feine Silber- und Glas-Schmuckstücke, handgefertigte Seifen und Lotionen, Wandteppiche (Tapestry Weaving) sowie Papierausschnitte und Keramik. Läden wie Studio 52 bieten lokal designte Geschenke, Leinwanddrucke und Falkland-Sand-Schmuck an, während The Pink Shop Lammfelle, historische Karten und Kunstbedarf verkauft. Künstler wie die von Heart of the Falklands oder Swan Ceramics schaffen einzigartige Stücke, darunter baumelnde Sand-Juwelen oder keramische Objekte für den Touristenmarkt. Diese Aktivitäten blühen seit den 2010er Jahren auf, getrieben vom Ökotourismus, der jährlich Tausende Besucher anzieht.
Mit Stand 2025 bleibt das Handwerk ein Nischenbereich, mit Fokus auf Authentizität – etwa durch Ateliers wie G-Unique für farbenfrohe Accessoires oder Owl Tours & Crafts für personalisierte Stücke. Es schafft Jobs für Kreative und stärkt die Verbindung zur Landwirtschaft, indem Woll- und Fellreste recycelt werden. Die wirtschaftliche Strategie sieht hier Potenzial für Online-Verkäufe und Exporte, um den Sektor zu professionalisieren, ohne die handwerkliche Tradition zu verlieren.
Industrie
Die Industrie auf den Falklandinseln ist im Vergleich zu Fischerei und Landwirtschaft unterentwickelt, konzentriert sich aber auf verarbeitende und extraktive Bereiche mit hohem Wachstumspotenzial. Historisch diente der Hafen von Stanley als Umschlagplatz für Schiffe, doch seit den 1980er Jahren dominiert die Ölexploration: Seismische Studien deuten auf Reserven hin, und Lizenzen an Firmen wie Rockhopper Exploration laufen seit den 2010er Jahren. Bis 2025 verzögert sich die finale Investitionsentscheidung auf Mitte 2025, mit erstem Öl erst 2027 erwartet, was geopolitische Spannungen mit Argentinien schürt. Verarbeitung der Fischerei – wie Tiefkühlung von Tintenfisch – geschieht lokal begrenzt, mit Plänen für Ausbau durch die Lachszucht-Initiative. Weitere industrielle Aktivitäten umfassen Schiffswartung und Tourismusinfrastruktur, unterstützt durch den Militärflugplatz Mount Pleasant.
Der Sektor beschäftigt wenige, trägt aber durch Lizenzen und Dienstleistungen erheblich bei. Im Budget 2025/26 und der Entwicklungsstrategie bis 2040 wird Industrie als Diversifikationsmotor gefördert, etwa durch grüne Technologien und lokale Verarbeitung, um Importabhängigkeit (zu Beispiel von UK-Exporten im Wert von 177 Mio. Pfund 2025) zu senken. Die Verflechtung mit Fischerei und Landwirtschaft – etwa durch Bioenergie aus Abfällen – macht die Industrie zu einem Brückenbauer für eine nachhaltige Zukunft.
Beschäftigtenzahlen 1996:
Aktive Bevölkerung insgesamt 2 161 84,28 %
davon Männer 1 239 57,36 %
Frauen 922 42,64 %
davon in Beschäftigung 1 967 91,02 %
arbeitslos 194 8,98 %
Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen:
Fischerei, Land- und Forstwirtschaft 251 12,76 %
Handwerk und Industrie 339 17,23 %
Baugewerbe 181 9,20 %
Transport und Kommunikation 266 13,52 %
Handel und Gastgewerbe 127 6,46 %
Finanz- und Versicherungswesen 23 1,17 %
Dienstleistungen 708 35,99 %
Journalismus und Kunst 20 1.02 %
sonstige 52 2,64 %
Wasserwirtschaft
Die Verfügbarkeit von Süßwasser ist begrenzt. Die Hauptstadt Stanley und andere Siedlungen sind auf lokale Wasserquellen wie Regenwasser, kleine Flüsse und Grundwasser angewiesen. Aufgrund des rauen Klimas und der geringen Niederschläge in bestimmten Jahreszeiten wird Regenwasser häufig in Zisternen gesammelt. Des Weiteren gibt es Entsalzungsanlagen, die Meerwasser in Trinkwasser umwandeln, insbesondere in Zeiten hoher Nachfrage. Der Schutz der Wasserqualität ist entscheidend, da die empfindlichen Ökosysteme der Inseln durch Verschmutzung gefährdet sind. Maßnahmen zur Abwasserbehandlung und -entsorgung sind daher streng geregelt, um die Umweltbelastung zu minimieren.
Energiewirtschaft
Die Energiewirtschaft der Falklandinseln basiert hauptsächlich auf erneuerbaren Energien und fossilen Brennstoffen. Windenergie spielt eine zunehmend wichtige Rolle, da die Inseln starken Winden ausgesetzt sind, die eine zuverlässige Energiequelle darstellen. Windkraftanlagen in der Nähe von Stanley liefern einen erheblichen Teil des Strombedarfs. Dennoch werden Dieselgeneratoren weiterhin genutzt, um eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten, insbesondere in Zeiten geringer Windgeschwindigkeiten.
Die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen stellt eine finanzielle und ökologische Herausforderung dar, weshalb der Ausbau erneuerbarer Energien, wie Solar- und Gezeitenenergie, in Betracht gezogen wird. Energieeffizienzmaßnahmen und die Modernisierung der Infrastruktur sind ebenfalls zentrale Themen, um die Nachhaltigkeit zu fördern.
Energieproduktion 2006:
- Produktion 16,0 mio. kWh
- Verbrauch 14,9 mio. kWh
Abfallwirtschaft
Die Abfallwirtschaft auf den Falklandinseln steht vor Herausforderungen, die durch die isolierte Lage und die begrenzten Ressourcen bedingt sind. Müll wird in der Regel auf Deponien entsorgt, wobei Recycling-Programme in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Plastikmüll und andere Abfälle, die nicht biologisch abbaubar sind, stellen ein Problem dar, da sie aufgrund der begrenzten Infrastruktur oft nicht vor Ort verarbeitet werden können.
Es gibt etlicheInitiativen mit dem Ziel, die Abfälle zu reduzieren und die Wiederverwendung von Materialien zu fördern. Zudem wird verstärkt auf die Sensibilisierung der Bevölkerung geachtet, um die Müllmenge zu verringern und umweltfreundliche Alternativen zu fördern. Die Entsorgung von gefährlichen Abfällen, wie Batterien oder Chemikalien, erfordert besondere Sorgfalt, um die empfindliche Natur der Inseln zu schützen.
Handel
Das wichtigste Exportgut ist Wolle, Handelspartner ist hauptsächlich Großbritannien. Über Industrie, bzw. industrielle Produktion abgesehen von Fischfabriken oder Walzerlegung verfügen die Inseln indes nicht. Das Außenhandelsdefizit macht etwa die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts aus, die Inseln sind also völlig von Großbritannien abhängig.
Handelspartner 2006:
Export: Import:
Spanien 81,9 % Großbritannien 72,5 %
USA 6,0 % USA 15,1 %
Großbritannien 4,5 % Niederlande 8,5 %
Der Binnenhandel auf den Falklandinseln ist aufgrund der kleinen Bevölkerung und der begrenzten geografischen Ausdehnung überschaubar. Die Hauptstadt Stanley, wo etwa 80 % der Bevölkerung leben, ist das wirtschaftliche Zentrum. Der Handel deckt den Bedarf an alltäglichen Gütern wie Lebensmitteln, Kleidung, Baumaterialien und Treibstoff, die größtenteils importiert werden, da die lokale Produktion begrenzt ist.
Die Inseln importieren den Großteil der Konsumgüter aus dem Vereinigten Königreich (79 % der Importe) und den Niederlanden (16 %). Zu den Importen zählen Lebensmittel, Getränke, Elektronik und Baumaterialien. Der geschätzte Importwert lag 2004 bei etwa 90 Millionen USD, aktuelle Zahlen deuten auf ein ähnliches Niveau.
Die lokale Wirtschaft liefert vor allem landwirtschaftliche Produkte wie Lammfleisch und Wolle (670.000 Schafe, 2007) sowie begrenzte Mengen an frischem Fisch. Gemüse und andere Lebensmittel werden in kleinem Maßstab angebaut, oft in Gewächshäusern, um die kurze Vegetationsperiode zu nutzen. Einzelhandel und Dienstleistungen konzentrieren sich in Stanley, wo Supermärkte, kleine Geschäfte und Fachhändler (zum Beispiel für Fischereiausrüstung) tätig sind. Der Binnenhandel wird durch lokale Unternehmen und einige Filialen britischer Ketten dominiert.
Die Geschäftswelt der Falklandinseln ist klein, aber dynamisch, mit einem Fokus auf Flexibilität und Anpassung an die isolierte Lage. Die wichtigsten Akteure und Strukturen sind:
- Falkland Islands Chamber of Commerce: Diese Organisation vertritt den Privatsektor und unterstützt Unternehmen durch Beratung, Netzwerke und Lobbyarbeit.
- Falkland Islands Development Corporation (FIDC): Die FIDC fördert wirtschaftliches Wachstum durch Finanzhilfen, Förderprogramme und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Sie konzentriert sich auf nachhaltige Projekte, speziell in der Fischverarbeitung oder im Tourismus.
- Lokale Unternehmen: Zu den wichtigsten gehören Supermärkte (darunter West Store in Stanley), Logistikfirmen (für den Import) und Dienstleister für die Fischerei- und Tourismusbranche. Viele Unternehmen sind familiengeführt oder in britischem Besitz.
- Öffentlicher Sektor: Die Regierung spielt eine zentrale Rolle, da sie durch Fischereilizenzen (ca. 14,5 Mio. GBP Einnahmen 2009/10) und Steuern die Infrastruktur finanziert, die den Binnenhandel ermöglicht (zum Beispiel Hafen, Straßen, Energieversorgung).
Trotz der geringen Marktgröße gibt es Geschäftsmöglichkeiten, insbesondere in Nischenmärkten. Die Rahmenbedingungen sind attraktiv: niedrige Steuern (zum Beispiel keine Einkommenssteuer für Unternehmen unter bestimmten Bedingungen), stabile Währung (Falkland-Pfund, gebunden an GBP) und moderne Kommunikationsinfrastruktur (UTC-3).
Finanzwesen
Die Falkland Islands Government Treasury verwaltet die Finanzen mit einem Team von 19 Mitarbeitern und einem Haushalt, der von der Legislative Assembly genehmigt wird. Einnahmen stammen aus Fischereilizenzgebühren (rund 14,5 Millionen £ jährlich), Steuern und Tourismus, während Ausgaben in Infrastruktur, Bildung und Gesundheit fließen. Die Jahresabschlüsse werden von britischen Auditoren geprüft, und seit Februar 2025 verwaltet HSBC Private Banking UK ein 400-Millionen-£-Investmentportfolio, um Renditen zu maximieren. Steuern wie Einkommens- und Verbrauchssteuern fördern Nachhaltigkeit, etwa durch Umweltanreize. Die enge Bindung an die Bank of England sorgt für Währungsstabilität, schränkt aber die Autonomie ein – Gesetze zu Währung oder Banken benötigen die Zustimmung des britischen Außenministers. Die Isolation erschwert globale Transaktionen, doch digitale Lösungen wie Wise und Square haben seit 2020 die Zahlungslandschaft modernisiert, was besonders für den Tourismus wichtig ist.
Die Bankenlandschaft ist schlicht, mit nur einer physischen Filiale, der Standard Chartered Bank in Stanley, die seit 1983 Retail- und Corporate-Banking anbietet, einschließlich Geldwechsel und Kartenvorschüsse. Seit April 2025 ist Lloyds Bank International für Falklander zugänglich, jedoch ohne lokale Filiale, mit Online-Konten und KYC-Prüfungen. Die Gibraltar International Bank unterstützt Unternehmen durch UK-Konten und Kartenzahlungen via Square, was die Cashless-Optionen für Händler erweitert. Ein einziger Geldautomat an der Stanley Services-Tankstelle ist auf Geschäftszeiten beschränkt, und Bargeld bleibt in ländlichen Gebieten üblich. Die Einführung von Mastercard und Square seit 2020 hat den Tourismus gestärkt, da Besucher kontaktlose Zahlungen bevorzugen. Die Chamber of Commerce fördert digitale Innovationen, um die Isolation zu überwinden, während die Regierung mit UK-Banken kooperiert, um Services zu verbessern.
Das Falkland Pound (Falkland-Pfund) ist die Währung der Inselgruppe. Auch in Südgeorgien und den Südlichen Sandwichinseln, die verwaltungstechnisch zu den Falklandinseln gehören, wird es als Zahlungsmittel eingesetzt, obwohl das offizielle Zahlungsmittel dort das Pfund Sterling ist. Der ISO-4217-Code ist FKP.Eigene Banknoten werden seit 1921 verwendet, Münzen sind seit 1974 in Benutzung. Das Falkland-Pfund ist (ähnlich der Währungen der Britischen Kanalinseln) dem Pfund Sterling nachempfunden und steht mit ihm in einem festen Kursverhältnis von 1:1. Mit nur etwa 5000 Benutzern (davon sind zirka 4700 Einwohner der Falklandinseln einschließlich der ständig dort stationierten Militärangehörigen) ist das Falkland-Pfund die kleinste selbstständige Währung der Welt.
Finanzwesen:
Währung: 1 Falkland Pound (FKP) = 100 Pence
Wechselkurs:
17.3.2009 1 EUR = 0,9265 FKP 1 FKP = 1,0793 EUR
20.9.2011 1 EUR = 0,8723 FKP 1 FKP = 1,1464 EUR
24.5.2019 1 EUR = 0,88318 FKP 1 FKP = 1,1323 EUR
2.10.2025 1 EUR = 0,8721 FKP 1 FKP = 1,1467 EUR
Soziales und Gesundheit
Die Falklandinseln, ein britisches Überseegebiet im Südatlantik mit rund 3.500 Einwohnern, bieten ein eng mit dem britischen Modell verknüpftes soziales System, das durch hohe Einnahmen aus Fischereilizenzgebühren – über 40 Millionen US-Dollar jährlich – und Steuern finanziert wird. Dieses System zielt auf eine hohe Lebensqualität ab und umfasst Leistungen wie Einkommensunterstützung, Familienzulagen sowie Hilfe für vulnerable Gruppen wie Kinder, Familien, Ältere und Menschen mit Behinderungen. Die Arbeitslosigkeit liegt bei unter 1 Prozent, und soziale Dienste werden zentral in der Hauptstadt Stanley koordiniert, oft community-orientiert und präventiv ausgerichtet, um die Isolation der Inseln zu kompensieren. Beispielsweise gibt es seit 2021 ein vereinfachtes Einkommensunterstützungssystem für Bedürftige, das frühere Leistungen konsolidiert: Voraussetzungen sind mindestens drei Jahre Aufenthalt, ein Einkommen unter einer festgelegten Grenze (mit maximal 17.925 Pfund Haushaltssparen) sowie Arbeitslosigkeit oder Krankheit. Die maximale Leistung beträgt 182 Pfund pro Woche für Alleinerziehende mit einem Kind, zuzüglich Zuschläge pro weiterem Kind. Die Familienzulage ist kostenlos und steuerfrei für Kinder von Einwohnern mit Falkland-Status oder dreijährigem Aufenthalt. Weitere Unterstützungen umfassen kostenlose Grundschulausbildung in Stanley und ländlichen Gebieten, Wohnungsbeihilfen sowie Integrationshilfen für Neuzuzügler. Sozialdienste, erreichbar unter Telefon 500/27296 oder in der Adresse 20 Scoresby Close in Stanley, decken Bereiche wie Kinderschutz, Erwachsenenbetreuung und Probationswesen ab. Insgesamt ist das soziale Netz klein, aber effektiv, mit Fokus auf Selbstversorgung und lokaler Kooperation.
Eng verknüpft mit dem sozialen System ist das Gesundheitswesen der Falklandinseln, das öffentlich und für Einwohner sowie britische Staatsbürger kostenlos ist, dank eines reziproken Abkommens mit dem britischen National Health Service (NHS). Finanziert durch Fischereieinnahmen und Steuern (mit einem Budget von etwa 7,5 Millionen Pfund), wird es vom Department of Health and Social Services geleitet und erreicht einen hohen Standard, trotz der geografischen Isolation. Komplexe Fälle, die nicht vor Ort behandelt werden können, werden per Flugzeug oder Schiff nach Großbritannien, Chile oder Uruguay evakuiert – daher wird Reisenden eine umfassende Versicherung mit Evakuierungsdeckung (mindestens 2 Millionen US-Dollar) dringend empfohlen.
Das zentrale King Edward VII Memorial Hospital (KEMH) in Stanley, eröffnet 1915 und nach dem Falklandkrieg 1982 erweitert, verfügt über 24 Betten (darunter 18 akute, eine Entbindungsstation, eine Isolationsstation, zwei Intensivbetten und sieben für Langzeitpflege). Es bietet Notfallversorgung, Primär- und Sekundärmedizin, Gemeindegesundheitsdienste, Zahnarztpraxis, Apotheke und Labore.
Wöchentliche Hausbesuche erfolgen per Flugzeug des Falkland Islands Government Air Service (FIGAS) oder Boot für abgelegene Siedlungen, bekannt als "Camp". Ergänzt wird dies durch Telemedizin und spezielle "Medizin-Kästen" für Fernberatungen. Verschreibungen und Impfungen sind für Einwohner kostenlos, während Zahnbehandlungen, Brillen oder Reisimpfungen gebührenpflichtig sind. Touristen müssen für Behandlungen zahlen, außer in Notfällen für Briten, und eine Reiseversicherung ist obligatorisch. Zusätzlich unterstützt das System die militärische Basis RAF Mount Pleasant mit Sekundärversorgung. Insgesamt ist das Gesundheitswesen resilient, mit starkem Fokus auf Prävention, Selbstversorgung und Kooperation mit dem UK-NHS, was zu einer hohen Lebenserwartung und niedrigen Säuglingssterblichkeit führt.
Krankheiten
Trotz dieser soliden Strukturen birgt die Isolation der Falklandinseln spezifische Risiken für Krankheiten, wobei die allgemeine Gesundheit der Bevölkerung gut ist. Es gibt keine tropischen Endemien wie Malaria, aber Achtsamkeit bei Insektstichen (zum Beispiel Zecken oder Flöhe) und Umweltrisiken ist ratsam. Empfohlene Impfungen umfassen MMR, Tetanus und Hepatitis A/B, ohne dass Pflichtimpfungen bestehen; für aktuelle Warnungen sollten Quellen wie CDC oder NaTHNaC konsultiert werden.
Historisch endemisch in Tieren (insbesondere Schafen) war die zystische Echinokokkose durch Hundebandwurm, die durch ein über fünfzigjähriges Kontrollprogramm mit Fleischinspektionen und Entwurmungen fast eliminiert wurde. Risiken entstehen durch Kontakt zu infizierten Tieren oder Fäkalien, weshalb Hygiene und tierärztliche Maßnahmen entscheidend sind. Eine Bedrohung für Wildvögel wie Pinguine stellt die Vogelgrippe (HPAI H5N1) dar, die via Zugvögel eintreffen könnte - Menschen sind davon nicht betroffen. Meldepflichten sind hier notwendig. Avian Pox, die häufigste Vogelkrankheit bei Gentoo-Pinguinen, ist nicht auf Menschen übertragbar und erfordert lediglich Beobachtung.
Insektübertragene Krankheiten wie Lyme-Borreliose oder West-Nil-Virus bergen ein niedriges Risik – Prävention erfolgt durch Insektensprays und lange Kleidung. Saisonale Beschwerden wie Erkältungen oder Magen-Darm-Infekte hängen mit Reisen und Wasserqualität zusammen.
Bildung
Bildung ist kostenlos und obligatorisch für Kinder im Alter von 5 bis 16 Jahren und wird stark von der Falkland Islands Government subventioniert. Der Unterricht findet ausschließlich auf Englisch statt, mit Spanisch als Fremdsprache ab der Primarstufe. Alle Lehrkräfte sind in Großbritannien oder anderen englischsprachigen Ländern ausgebildet und qualifiziert. Aufgrund der geringen Bevölkerung von rund 3.500 Einwohnern – hauptsächlich in der Hauptstadt Stanley konzentriert – ist das Schulsystem kompakt und zentralisiert, wobei es besondere Anpassungen für die ländlichen Gebiete ("Camp") gibt. Die Education Directorate der Regierung koordiniert das gesamte System, das von der Kinderbetreuung bis hin zu lebenslangem Lernen reicht und auch Online-Kurse sowie Berufsförderung umfasst.
Die Grundbildung beginnt mit der Primarstufe für Kinder von 3 bis 11 Jahren (Foundation Stage bis Year 6) und folgt dem englischen National Curriculum. In Stanley betreibt die Infant and Junior School (IJS) den Großteil des Unterrichts, unterstützt von spezialisierten Lehrern aus der Sekundarstufe. Für Kinder in den entlegenen Camp-Gebieten gibt es ein dezentrales System: Kleine Camp Schools oder mobile Einrichtungen sorgen für den Unterricht vor Ort, was 2021 sein 125-jähriges Jubiläum feierte. Diese Schulen haben oft nur wenige Schüler und passen den Stundenplan an lokale Bedürfnisse an, wie zum Beispiel längere Ferien aufgrund wetterbedingter Reisehürden. Zusätzlich gibt es eine Primarschule bei der RAF Mount Pleasant, die vor allem Kinder britischer Militärangehöriger betreut. Inklusion steht im Vordergrund: Eine Shared Special Needs Coordinator (SENCo) und Lernbegleiter unterstützen Schüler mit besonderen Bedürfnissen in allen Einrichtungen.
Die Sekundarstufe umfasst die Altersgruppe von 11 bis 16 Jahren und wird zentral in der Falkland Islands Community School (FICS) in Stanley abgewickelt, die 1992 eröffnet wurde und nebenan zum Leisure Centre liegt. Die Schule folgt dem Key Stage 3 (11 bis 14 Jahre) und Key Stage 4 (14 bis 16 Jahre) des englischen Curriculums und ist gut ausgestattet mit Laboren für Naturwissenschaften, Werkstätten für Design und Technik sowie Räumen für Kunst, Musik und Informatik. Schüler absolvieren bis zu neun GCSE-Prüfungen (General Certificate of Secondary Education), die international anerkannt sind. Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, der Duke of Edinburgh Award und Sport sind integraler Bestandteil des Programms, um die einzigartige Inselumgebung zu nutzen. Kunst ist ein Highlight: Jährlich findet die Susan Whitley Memorial Exhibition statt, bei der alle Schüler ihre Werke ausstellen können. Berufsorientierung wird durch das Falkland College und Arbeitgeber vor Ort gefördert, inklusive eines jährlichen Careers Days. Kinder aus dem Camp können ab Year 5 (ca. 9 Jahre) in einem Boarding-Hostel in Stanley untergebracht werden, um den Schulbesuch zu erleichtern – eine Tradition, die aufgrund der großen Distanzen (bis zu einem Tag Reisezeit) notwendig ist.
Für die Oberstufe (ab 16 Jahren) fehlt es auf den Falklandinseln an eigenen Einrichtungen, weshalb die Regierung berechtigte Schüler finanziert, um A-Levels oder vergleichbare Level-3-Qualifikationen im Ausland zu absolvieren – meist in Großbritannien, seltener in Neuseeland oder Gibraltar. Die Kosten für Reise, Unterkunft und Studiengebühren werden übernommen, solange die Schüler dauerhaft ansässig sind und die Aufnahmevoraussetzungen erfüllen. Viele kehren nach dem Abschluss zurück, um in lokalen Berufen zu arbeiten. Ähnliche Förderprogramme gibt es für Erwachsene ab 18 Jahren, die höhere oder berufliche Qualifikationen anstreben. Die Christie Community Library, die 2020 in ein neues Gebäude umzog, dient als Ergänzung und Ressource für alle Altersgruppen.
Höhere Bildung
Erwachsenenbildung wird vom Falkland College in Stanley angeboten, das 2020 in ein modernes Zentrum umzog. Es bietet Apprenticeships, GCSE-Nachholkurse, NVQs (National Vocational Qualifications) und berufliche Programme – teils vor Ort, teils online. Das College kooperiert eng mit der Sekundarschule für Karriereberatung und unterstützt Weiterbildungen in Bereichen wie Handwerk oder Verwaltung. Die Education Directorate fördert kontinuierliche Professionalisierung der Lehrkräfte durch Partnerschaften mit britischen Institutionen wie dem University College London und Programme wie NPQSL (National Professional Qualification for Senior Leadership). Insgesamt zielt das System darauf ab, trotz Isolation und begrenzter Ressourcen, selbstständige, vielseitige Individuen zu fördern, die die Herausforderungen der Inselwelt meistern können. Die kleine Gemeinschaft schafft enge Beziehungen zwischen Schule, Familie und Arbeitgebern, was den Bildungserfolg unterstreicht – von GCSE-Erfolgen bis hin zu internationalen Anerkennungen.
Bibliotheken und Archive
Die Christie Community Library, benannt nach dem Paar William und Merle Christie, die sich um die Inselgemeinschaft verdient gemacht haben, ist die zentrale öffentliche Bibliothek der Falklandinseln. Ihre Geschichte reicht bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück, als die Falkland Islands Government die Leitung übernahm und sie zunächst im neu gebauten Town Hall in Stanley unterbrachte. 1944 zerstörte ein Brand die Einrichtung, die jedoch 1950 mit Spenden der Community und staatlicher Förderung wieder aufgebaut wurde. In den 1990er Jahren zog sie in die Falkland Islands Community School um, um Platz für die wachsende Schülerzahl zu schaffen. Seit Januar 2020 ist sie in einem modernen, zweckgebauten Anbau am Westende des Falkland College in der Magazine Valley in Stanley untergebracht – ein Umzug, der durch Bevölkerungswachstum und Bedarf an mehr Schulraum notwendig wurde. Im November 2021 wurde die Namensgebung offiziell mit einer Plakette gefeiert, die das Engagement der Christies ehrt.
Die Bibliothek ist kostenlos nutzbar und für alle Altersgruppen zugänglich: Mitgliedschaft erfordert lediglich einen persönlichen Besuch, bei dem Name und Kontaktdaten notiert werden – physische Karten gibt es nicht. Sie bietet eine vielfältige Sammlung aus Büchern, Magazinen, Hörbüchern, DVDs und digitalen Medien, mit Fokus auf aktuelle Literatur, lokale Geschichte und Bildungsmaterialien. Öffnungszeiten umfassen Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 13:30 bis 17:45 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Ergänzt wird das Angebot durch einen Outreach-Service, der Bücher und Medien an isolierte oder kranke Bewohner liefert, sowie Veranstaltungen wie Ferienlesechallenges, Storytime-Yoga, Halloween-Dekorationen oder Besuche von Tieren wie dem Biosecurity-Hund aus Südgeorgien. Seit 2020 existiert eine digitale Erweiterung über die App Libby, die E-Books und Hörbücher von internationalen Plattformen wie OverDrive bereitstellt. Die Bibliothek kooperiert eng mit lokalen Schulen und dem Falkland College, um Lernressourcen zu teilen, und verlinkt zu den Archives für tiefergehende Recherche.
Ergänzend zu den Bibliotheken steht die Jane Cameron National Archives als Kernbereich der historischen Dokumentation. Als offizielles Nationalarchiv der Falklandinseln sichert sie die langfristige Erhaltung und Zugänglichkeit von Aufzeichnungen, die seit 1833 die Geschichte und Verwaltung der Inseln widerspiegeln. Die Tradition begann 1841 unter dem ersten Gouverneur Richard Moody, der Regierungsdokumente in Stanley Town Hall und dem Secretariat Building lagerte. Trotz Bränden 1944 und 1959 blieben die Bestände weitgehend erhalten. 1989 schuf die Regierung die Stelle der Government Archivist, erstmals besetzt von Jane Cameron – einer Inseltochter, Enkelin eines ehemaligen Gouverneurs und Schwester der britischen Falkland-Repräsentantin Sukey Cameron. Sie widmete sich bis zu ihrem Tod der Erweiterung der Sammlungen, was 2010 zur Umbenennung in Jane Cameron National Archives führte.
Heute ist das Archiv in der Jeremy Moore Avenue in Stanley (Postfach 687, FIQQ 1ZZ) zu finden. Die Bestände umfassen Originaldokumente zu Geburten, Heiraten, Todesfällen, Immobilien, Einwanderung, Militär und Souveränitätsfragen – darunter Zertifikate der Nationalität (1919 bis 1969) und Berichte zur Migration aus Uruguay, Chile und Patagonien im 19. Jahrhundert. Viele Materialien sind digitalisiert und online verfügbar, einschließlich Fotos der Falkland Islands Company Ltd., Berichte zu Ereignissen wie dem May Ball oder Camp-Tänzen und Sammlungen zu Kultur und früher Geschichte. Das Archiv engagiert sich in Outreach, wie der ersten Teilnahme an der "Explore Your Archive Week" im November 2024, die über 200 Interaktionen und 47 Besucher generierte – beeindruckend in einer kleinen Community. Es hostet auch Work-Experience-Programme für Schüler und kooperiert mit internationalen Partnern wie FamilySearch, das mikrofilmete Kopien bereitstellt. Ergänzt wird es durch das Historic Dockyard Museum, das Artefakte und Ausstellungen zu Schifffahrt und Entdeckung beherbergt.
Kultur
In Stanley gibt es im Haus des letzten argentinischen Residenten ein Museum, das Gegenstände und Dokumente zur Geschichte der Inseln zeigt. Im Hafen von Stanley gibt es einen Lehrpfad entlang einer Reihe von Schiffswracks, die dort teilweise seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts liegen.
Museen
Das größte und zentralste Museum ist das Falkland Islands Museum and National Trust in Stanley, der Hauptstadt auf East Falkland. Es wird von der gemeinnützigen Organisation FIMNT (Falkland Islands Museum & National Trust) verwaltet und dient als nationales Zentrum für die Bewahrung des Kulturerbes.
Die Museen betonen die soziale und maritime Geschichte der Falklands, die natürliche Vielfalt (zum Beispiel Pinguine, Seevögel und einzigartige Pflanzen) sowie die Verbindungen zur Antarktis. Viele Ausstellungen stammen aus Spenden lokaler Familien, was den Alltagscharakter der Sammlungen unterstreicht. Ein Besuch lohnt sich besonders für Geschichtsinteressierte, Naturliebhaber und Reisende, die die "Essenz der Falklands" erleben möchten. Die Museen sind gut organisiert, mit informativen Tafeln und oft audiogeführten Touren. Eintrittspreise sind moderat (5 bis 10 GBP), und Kreuzfahrtschiffe sorgen häufig für erweiterte Öffnungszeiten.
Das Falkland Islands Museum and National Trust (Historic Dockyard Museum) liegt am historischen Dockyard in Stanley, direkt am Hafen auf Ross Road. Das Museum wurde 1989 eröffnet und ist in mehreren historischen Gebäuden untergebracht, darunter das "Britannia House" – ein ehemaliges argentinisch-britisches Gebäude aus der Zeit vor und nach dem Falklandkrieg. Es feiert die kulturelle Vielfalt der Inseln durch Galerien zu sozialer Geschichte, maritimer Tradition, Naturwissenschaften, dem Krieg von 1982 und der antarktischen Erkundung.
Die Idee zu einem Museum entstand bereits Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Frau des damaligen Gouverneurs, Sir William Allardyce, eine Sammlung von Artefakten aus der Kolonialzeit anregte. 1909 wurde eine erste kleine Ausstellung in einer alten Schule eröffnet, mit Kuriositäten wie Haaren eines prähistorischen Mylodon oder Eiern lokaler Vögel. In den 1960er Jahren wuchs die Sammlung in einem Gymnasiumsraum und zog schließlich 1989 in den Dockyard um. Heute umfasst sie Tausende Objekte, darunter eine vollständige Briefmarkensammlung von 1878 bis 1999. Das Museum hat keine starre Sammelrichtlinie, sondern fokussiert sich auf alles, was die falkländische Identität widerspiegelt – von Alltagsgegenständen wie alten Werkzeugen bis hin zu militärischen Relikten.
Der Großteil der Sammlung widmet sich dem Leben in den ländlichen Gebieten („Camp“ genannt), wo Schafzucht und Fischerei dominierten. Besucher finden Vitrinen voller Trinkets wie alten Farmgeräten, Unterhaltungsartikeln (zum Beispiel Grammofonen) und Geschichten von Siedlern aus den 1850er Jahren. Eine Rekonstruktion des Lebens in den 1940er und 1970er Jahren in Cartmell Cottage – einem der ältesten Häuser Stanleys – lässt die viktorianische Ära lebendig werden.
Ausstellungen zu Flora, Fauna und Geologie, inklusive Fossilien, Steinen aus Seelöwenmagen und Sammlungen von Vogeleiern. Die Falklands als Tor zur Antarktis werden thematisiert, z. B. durch die originale Reclus Hut – eine Hütte aus den 1950er Jahren, die die harten Bedingungen der Falkland Islands Dependencies Survey (FIDS) nachstellt, mit Windgeräuschen und Isolationsgefühl.
Eine bescheidene, aber eindringliche Galerie zeigt die Ereignisse aus Sicht der lokalen Bevölkerung. Es gibt Karten der Invasion und Befreiung, Zeitungen (britische vs. argentinische Perspektiven), Waffenexemplare und Fotos der 255 gefallenen britischen Soldaten sowie dreier ziviler Opfer. Die Ausstellung betont, dass der Krieg nur ein kurzes, wenn auch prägendes Kapitel ist. Der Komplex umfasst eine alte Schmiede, Bootschaft, ein Gefängnis und eine Relaisstation. Draußen stehen nautische Artefakte wie Anker und Boote.
Das Museum zieht jährlich Tausende Besucher an, darunter Kreuzfahrtpassagiere, und bietet Workshops, Vorträge und eine Bibliothek für Forscher. Es dauert 1 bis 2 Stunden, einen vollen Tag für Intensivbesucher. Öffnungszeiten: Di/Fre 10:30–12:00 und 14:00–16:00 Uhr, So 10:00–12:00 Uhr; Eintritt zirka 7 GBP.
Neben dem Hauptmuseum gibt es kleinere Einrichtungen, die oft kriegsbezogen oder landwirtschaftlich ausgerichtet sind. Sie sind über die Inseln verteilt und ergänzen das Angebot in Stanley:
- Goose Green Museum (San Carlos Museum): In Goose Green auf East Falkland, um 150 km südlich von Stanley. Es dokumentiert den Falklandkrieg, insbesondere die Kämpfe um San Carlos („Bomb Alley“). Ausstellungen zu lokalen Helden, Wracks und Alltagsleben während der Besatzung. Der Schlüssel wird im nahegelegenen Goose Green Galley Café abgeholt. Ideal für eine halbtägige Tour.
- North Arm Settlement Museum: Auf West Falkland, in einer ehemaligen Siedlung. Fokussiert auf Schafzucht, Siedlerleben und Kriegsmemorialien. Es zeigt Relikte aus der Landwirtschaft und bietet Einblicke in das isolierte Camp-Leben.
- Port Howard Museum: In Port Howard auf West Falkland, mit Ausstellungen zu Schafzucht, Walfang und dem Krieg. Es umfasst Reliquien wie Munition und Fotos, kombiniert mit Wanderungen in der Umgebung. Perfekt für Naturliebhaber.
- Blue Beach Military Museum: Bei Fitzroy, nahe dem Landungsstrand des Kriegs. Kleines, freiwilliges Museum mit Artefakten aus der britischen Landung 1982, inklusive Fahrzeugen und persönlichen Geschichten.
Architektur
Setzt man zum ersten Mal einen Fuß auf eine der Inseln ist man mitunter etwas verwundert was den Lebensstil der Einheimischen betrifft. Sie wohnen nicht wie gewohnt in Häusern in größeren Gemeinden. Die Bewohner der Falklandinseln leben in Camps oder Settlements. Man sollte jedoch nicht von Rückständigen sprechen. Die geringe Größe der Orte ist durch die wenig bebaubare Beschaffenheit der meisten Inseln bedingt.
Die Architektur der Falklands ist zweckmäßig und geprägt von der Notwendigkeit, den harschen Wetterbedingungen – starken Winden, Regen und kalten Temperaturen – standzuhalten. Die meisten Gebäude befinden sich in Stanley, der Hauptstadt auf East Falkland, die etwa 2.500 Einwohner zählt. Die Architektur lässt sich in drei Hauptkategorien einteilen: koloniale Gebäude, moderne Zweckbauten und landwirtschaftliche Strukturen im „Camp“ (dem ländlichen Gebiet außerhalb Stanleys).
Die ältesten Gebäude in Stanley stammen aus dem 19. Jahrhundert, als die Inseln als britischer Außenposten und Walfangstation dienten. Typisch sind niedrige, ein- bis zweistöckige Holzhäuser mit Satteldächern, oft aus vorgefertigten Bausätzen, die aus Großbritannien importiert wurden. Diese Häuser, wie das Cartmell Cottage (heute Teil des Falkland Islands Museums), sind aus Holz oder Wellblech gefertigt und mit bunten Farben (Rot, Blau, Grün) gestrichen, um der grauen Landschaft Farbe zu verleihen. Wellblech ist ein dominantes Material, da es langlebig, leicht zu transportieren und wetterbeständig ist. Viele dieser Gebäude haben kleine Veranden und erinnern an britische Landhäuser, angepasst an die insularen Bedingungen. Ein markantes Beispiel ist die Christ Church Cathedral (1892), die südlichste anglikanische Kathedrale der Welt, mit ihrem ikonischen Walbogen aus Walknochen am Eingang. Sie ist ein Ziegelbau mit gotischen Elementen, wie Spitzbogenfenstern, und symbolisiert die britische Präsenz. Das benachbarte Deanery und das Government House (1845, später erweitert) zeigen ebenfalls viktorianische Einflüsse, mit symmetrischen Fassaden und schlichten, funktionalen Designs.
Außerhalb Stanleys dominieren einfache Farmhäuser und Scheunen, die oft aus Holz, Wellblech oder lokalem Stein gebaut sind. Diese Gebäude, wie in den Siedlungen Goose Green oder Port Howard, sind rein funktional, mit flachen Dächern oder einfachen Giebeln, um Windlasten zu minimieren. Viele Farmen nutzen Windkraftanlagen oder Solarpanele, was die moderne Anpassung an die Isolation zeigt. Historische Strukturen wie die Reclus Hut (eine antarktische Forschungshütte, heute im Museum) verdeutlichen die extreme Schlichtheit, die für Überleben in rauen Klimazonen nötig ist.
Seit dem Falklandkrieg 1982 und dem dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Aufschwung (vor allem durch Fischerei) sind moderne Gebäude entstanden, insbesondere in Stanley. Diese umfassen funktionale Betonbauten wie Schulen, das Krankenhaus oder das Community Centre. Sie sind schlicht, oft einstöckig und auf Energieeffizienz ausgelegt, mit doppelt verglasten Fenstern und Isolierung gegen die Kälte. Einige neuere Wohnhäuser experimentieren mit skandinavisch inspirierten Designs, die Nachhaltigkeit und minimalistische Ästhetik betonen.
Bildende Kunst
Die bildende Kunstszene der Falklands ist klein, aber lebendig, und wird hauptsächlich von der Natur, der Tierwelt und der insularen Identität inspiriert. Es gibt keine großen Galerien oder Kunstinstitutionen, aber lokale Künstler, oft Amateure oder Selbsttaught, schaffen Werke, die in kleinen Ausstellungen, Cafés oder dem Falkland Islands Museum gezeigt werden. Die Kunstszene ist stark von der Gemeinschaft geprägt, mit regelmäßigen Workshops und Veranstaltungen, die von Organisationen wie dem Falkland Islands Arts & Crafts Association organisiert werden.
Die Landschaft der Falklands – weite Tundren, zerklüftete Küsten, Pinguinkolonien und Seevögel – ist das zentrale Motiv. Viele Künstler malen oder zeichnen realistische Darstellungen von Königspinguinen, Albatrossen oder der rauen See. Aquarell und Öl sind beliebte Medien, da sie die sanften Farben der Inseln einfangen. Auch maritime Szenen, wie Walfangboote oder Schiffswracks, sind häufig. Der Falklandkrieg von 1982 findet ebenfalls Eingang in die Kunst, oft in Form von Memorial-Gemälden oder Zeichnungen, die die Resilienz der Kelper betonen. Einige Künstler lassen sich von der antarktischen Verbindung inspirieren, mit abstrakten Darstellungen von Eis oder Polarlichtern. Handarbeiten wie Stricken, Filzen oder Keramik sind ebenfalls verbreitet, oft mit Motiven wie Schafen oder lokalen Pflanzen (z. B. der „Diddle-dee“-Beere).
Das Falkland Islands Museum and National Trust zeigt regelmäßig temporäre Ausstellungen lokaler Künstler, oft in Verbindung mit historischen Themen. Es verkauft auch Drucke und Postkarten mit Kunstwerken, die von der Inselnatur inspiriert sind. Die jährliche Falkland Islands Agricultural Show oder kleinere Gemeindefeste in Stanley bieten Künstlern eine Bühne, um Gemälde, Skulpturen oder Fotografien zu präsentieren. Fotografie ist besonders populär, da die Inseln ein Paradies für Naturfotografen sind. Viele Künstler verkaufen ihre Werke in kleinen Läden wie dem Pink Shop oder dem Gift Shop in Stanley, die Kunsthandwerk und Gemälde von Einheimischen anbieten.
Die Isolation der Falklands führt dazu, dass Materialien wie Farben oder Leinwände teuer importiert werden müssen, was die Kreativität der Künstler einschränkt, aber auch ihre Einfallsreichtum fördert. Viele nutzen recycelte Materialien oder digitale Medien. Es gibt keine formale Kunstakademie, aber Workshops, oft von Gastkünstlern aus Großbritannien, fördern den Austausch. Die Kunst bleibt bodenständig, mit einem Fokus auf Authentizität und persönlicher Verbindung zur Insel.
Architektur und Kunst auf den Falklands überschneiden sich in ihrer gemeinsamen Wurzel: der Darstellung der insularen Identität. Während die Architektur die physische Anpassung an die Umwelt zeigt, fängt die Kunst die emotionale und visuelle Essenz ein. Beispielsweise inspirieren die bunten Wellblechhäuser Künstler zu farbenfrohen Gemälden, und historische Gebäude wie die Christ Church Cathedral sind beliebte Motive in Zeichnungen. Umgekehrt beeinflusst die Kunst die Architektur, etwa durch dekorative Elemente wie Wandmalereien in Gemeindezentren oder Skulpturen in öffentlichen Gärten.
Literatur
Die Literatur der Falklandinseln ist vorwiegend nicht-fiktional und wird oft von Außenstehenden verfasst, da die kleine Bevölkerung eine begrenzte eigene Produktion ermöglicht. Viele Werke drehen sich um die Geschichte, die Natur und den Konflikt von 1982. Ein Meilenstein ist die offizielle Geschichte des Falklandkriegs in mehreren Bänden von Lawrence Freedman, die die Ursprünge und den Verlauf des Konflikts detailliert beschreibt. Ebenso populär ist "The Battle for the Falklands" von Max Hastings und Simon Jenkins, ein zeitgenössisches Sachbuch, das politische und militärische Aspekte beleuchtet und als Standardwerk gilt.
Lokale Stimmen finden sich in Memoiren wie "My Falkland Islands Life" von Jen Carter, das das Alltagsleben einer Familie auf Westfalkland während und nach dem Krieg schildert und Themen wie Isolation und Resilienz aufgreift. Poesie ist seltener, aber Ernest Spencer, ein Falkländer, schrieb "Motherland", ein Werk, das die emotionale Bindung an die Inseln einfängt. Argentinische Perspektiven, wie Jorge Luis Borges' Gedicht "Juan López y John Ward", thematisieren den Krieg aus einer neutralen, humanitären Sicht und kritisieren die "zu berühmten Inseln". Insgesamt dominiert die Sachliteratur, oft mit Fokus auf Umwelt und Kolonialgeschichte, wie in Mary Cawkells "The Falkland Story 1592-1982". Die Bibliographie der Falkland Islands Association listet Dutzende Titel, die von historischen Abhandlungen bis zu persönlichen Erzählungen reichen, und unterstreicht die wachsende Auseinandersetzung mit der Souveränitätsfrage.
Theater
Theater auf den Falklandinseln ist intim und community-orientiert, oft in Stanley, der Hauptstadt, angesiedelt. Aufgrund der geringen Einwohnerzahl gibt es keine professionellen Ensembles, sondern Amateurgruppen und Events, die britische Traditionen mit lokalen Geschichten verbinden.
Das Town Hall (Rathaus) in Stanley dient als zentrale Bühne für Aufführungen, wie Monologe von Alan Bennett während des Fringe Festivals 2022, das Burlesque-Abende, Poesie und Musik einbezog Einen Höhepunkt bildet "Falkland Sound" von Brad Birch, ein Stück der Royal Shakespeare Company, das die Auswirkungen des Kriegs auf eine kleine Gemeinde beleuchtet und 2018 uraufgeführt wurde – es verbindet persönliche Dramen mit historischen Reflexionen.
Lokale Initiativen wie der Falkland Islands Folk Dancing Society organisieren traditionelle Tänze und Theater-ähnliche Performances, die seit den 1950er Jahren dokumentiert sind und Elemente britischer Folklore einfließen lassen. Das 2023 eröffnete Festival of Lights in Stanley integrierte Tänzer und floats in eine Mischung aus Theater und Straßenkunst, was die wachsende kulturelle Vielfalt – mit über 60 Nationalitäten – unterstreicht. Diese Events fördern nicht nur Unterhaltung, sondern auch soziale Kohäsion in der isolierten Gesellschaft.
Film
Der Film auf den Falklandinseln ist eng mit dem Krieg und der Natur verbunden, wobei Produktionen oft dokumentarisch oder als Drehorte für internationale Filme dienen. Lokale Kinos wie das Harbour Lights Cinema in Stanley (55 Sitze, seit 2018) und das Phoenix Cinema auf der Militärbasis Mount Pleasant zeigen Blockbuster, Klassiker und Cult-Filme, inklusive Untertitel und Audiohilfen für Inklusion. Betreiber wie BFBS Cinemas sorgen für aktuelle Releases in dieser abgelegenen Region.
Wichtige Filme um den Konflikt sind "An Ungentlemanly Act" (1992), eine Emmy-prämierte TV-Produktion über die Invasion, die jedoch für Ungenauigkeiten kritisiert wurde, und "Tumbledown" (1988), das die Nachwirkungen für britische Soldaten thematisiert. Dokumentarfilme wie "Our Nowhere Lands" (2013) porträtieren das Leben der Kelpers zwischen Pinguinen und Minenfeldern, während "Fuckland" (2000) eine satirische argentinische Perspektive bietet – ein Magier plant, die Inseln durch "kulturelle Infiltration" zu erobern. Die Inseln als Drehort ziehen Wildlife-Filme an, zum Beispiel zu Darwin und Evolution oder Surf-Abenteuern in "Gauchos del Mar". Insgesamt dient Film hier als Brücke zwischen Kriegstrauma und natürlicher Schönheit.
Musik und Tanz
Musik und Tanz sind lebendige Ausdrucksformen der falkländischen Gemeinschaft, die britische Wurzeln mit lokalen Improvisationen mischen. Das inoffizielle Nationallied "Song of the Falklands" von Christopher Lanham (1930er) evoziert Heimweh und die windgepeitschten Inseln: "Those isles of the sea are calling to me". Events wie Falkstock, ein jährliches Rock- und Folk-Konzert im Town Hall, sammeln lokale Bands und internationale Acts, um Spenden zu erheben.
Die Falkland Islands Folk Dancing Society pflegt seit Jahrzehnten traditionelle Tänze wie Ceilidh, die bei Smoko-Pausen oder Festen aufgeführt werden. Das Fringe Festival 2022 und das Festival of Lights 2023 integrierten Musikgenres von Burlesque bis Poesie, mit Tänzern und floats. Mit zunehmender Multikulturalität (zum Beispiel chilenische und philippinische Einflüsse) entstehen Food-and-Music-Events, die Vielfalt feiern. Tanz dient der sozialen Bindung, oft spontan in Pubs oder bei Schafschur-Festen, und spiegelt die resiliente Inselmentalität wider.
Alljährlich im Juni wird das Falkland Traditional Music Festival veranstaltet. Auch bei privaten Festen wird gern musiziert. Dabei steht Volksmusik britischer bzw. keltischer Prägung im Vordergrund. Pop wird über Radio- und Fernsehsendungen konsumiert.
Kleidung
Die Kleidung auf den Falklandinseln ist funktional und wetterangepasst, da das Klima unvorhersehbar ist – "vier Jahreszeiten an einem Tag" mit starkem Wind und Regen. Traditionell britisch inspiriert, dominiert praktische Outdoor-Bekleidung: Wasserdichte Jacken, Schichten aus Merinowolle oder thermischen Materialien wie Uniqlo Heattech, um Wärme zu speichern.
In ländlichen Gebieten ("Camp") tragen Farmer robuste Arbeitskleidung für Schafzucht und Fischerei, oft importiert, da Kleidung zu den Hauptimportgütern zählt. Lokale Geschäfte wie DF Falklands bieten handgefertigte Wollprodukte und Geschenke an, die die Wollproduktion der Inseln widerspiegeln – Pullover aus heimischer Wolle sind typisch.
Für Touristen empfehlen Reiseführer Schichten und wasserdichte Stiefel, um die Moore zu erkunden. Kulturell gibt es keine ausgeprägte "traditionelle Tracht", aber bei Events wie dem Folk Dancing werden britische Folklore-Kostüme getragen. Die Mode bleibt unaufdringlich und community-orientiert, mit Fokus auf Langlebigkeit in der rauen Umwelt.
Kulinarik und Gastronomie
Geht man auf den Falklandinseln in ein Restaurants oder Wirtshaus bekommt nicht das Gefühl am südlichsten Zipfel Südamerikas zu sein. Auf den Karten findet man größtenteils typisch britische Gerichte und Speisen. In Sachen Getränke sind die Falklandinseln ein eher günstiges Land, da auf alkoholische Getränke keine Steuern erhoben werden. Kulinarisch ist es für alle, die sich der britischen Hausmannskost nicht bewusst sind, denn es ist immer eine neue Erfahrung auf den Falklands verköstigt zu werden. Hierzu zählen ohne weiteres Pasteten und große Steaks, in der Regel auf die enlische Variante rare – also noch blutig – zubereitet. Man bekommt aber ohne weiteres auf Wunsch auch ein medium oder well done zubereitetes Steak. Gleiches gilt auch für Roastbeef, ein ebenfalls typisch britisches Gericht. Daneben sind für eine Inselgruppe natürlich auch viele Fischgerichte auf den Speisekarten der Restaurants zu finden. Die obligatorische Ofenkartoffel ist eine willkommene Abwechselung zur Standardbeilage Pommes Frites. Empfehlenswert sind weiterhin die sogenannten Lamb Chops. Diese am Knochen gegarten Lammteile sind in verschiedenen Saucen zu bestellen. Typisch britisch ist hierbei ohne weiteres die Minzsauce, beliebter bei Nicht– Briten ist die leicht süßliche Variante Barbecue.
Die Einflüsse der lokalen zur Verfügung stehenden Rohstoffe sind nicht zu übersehen. Die lokalen Spezialitäten sind Gerichte mit Muscheln, Austern und Krabben. Aber auch gegrillter Fisch oder Fischsuppen in verschiedenen Variationen sollte man sich wohl zu Gemüte führen. Forelle und Dorsch sind regionale Spezialitäten. Man sollte daher nicht zögern sich auf diesem Wege auch mal in kulinarisches Neuland vorzuwagen.
Für einen Snack unterwegs gibt es in so gut wie jedem kleinen Cafe oder Pub die absolut typisch britischen Fish’ n’ Chips. Nicht für jeden Geschmack und auch nicht für jeden, der sich gerade auf Diät befindet, aber das richtige für den großen Hunger, der schnell und preiswert gestillt werden will.
Wer einen etwas anspruchsvolleren Gaumen hat, bestellt sich einen Teller gegrillten Tintenfisch. Leicht gewürzt mit Salz und Pfeffer und mit etwas Limetten- oder Zitronensaft abgeschmeckt benötigt diese Delikatesse der Tiefsee eigentlich keine Beilagen. Auch über die kleine Inselgruppe hinaus bekannt ist der Schwarze Seehecht, welcher ebenfalls durch seine spezielle Zubereitung sich einer steigenden Beleibtheit erfreut. Zu den herrlichen Fleisch– und Fischgerichten bekommt man die auf den Inseln angebauten Gemüsesorten. Die Portionen sind in der Regel immer ausreichend bis gut sättigend. Ein persönlicher Gruß an den Chef und seine Küchenmannschaft kann bei zufrieden
Festkultur
Nationalfeiertag ist der Liberation Day, der Befreiungstag von der argentinischen Besetzung im Jahr 1982. Dieser Tag wird jedes Jahr am 14. Juni gefeiert. Er geht zurück auf den Falklandkrieg zwischen Großbritannien und Argentinien um den Besitz der Falklandinseln. Zudem gilt der Geburtstag der englischen Queen als nationaler Feiertag. So erweist man der Königin Elizabeth II. am 8. Dezember die Ehre.
Feiertage:
- 1. Januar - New Year’s Day (Neujahrstag)
- Ende März / Anfang April - Easter (Ostern)
- 21. April - Queen’s Birthday (Geburtstag der Königin)
- 1. Mai - Labour Day (Tag der Arbeit)
- 14. Juni - Liberation Day (Befreiungstag)
- 8. Oktober - Spring Day (Frühlingsfeiertag)
- 8. Dezember - Falkland Day (Tag der Falklandschlacht 1914)
- 25. bis 28. Dezember - Christmas (Weihnachten)
Medien
Die Medien auf den Falklandinseln bestehen aus wenigen, aber zentralen Akteuren, die sich an den Bedürfnissen der kleinen Gemeinschaft orientieren. Die wichtigste Publikation ist die Wochenzeitung Penguin News, die seit 1979 erscheint und als das Hauptmedium für lokale Nachrichten gilt. Sie berichtet über Inselpolitik, Gemeindeereignisse, internationale Entwicklungen und den Fischereisektor, der die Wirtschaft dominiert. Penguin News wird von einer kleinen Redaktion in Stanley, der Hauptstadt, produziert und erscheint sowohl in gedruckter Form als auch digital, um auch die Diaspora der Inselbewohner zu erreichen. Die Zeitung ist unabhängig, steht jedoch unter dem Einfluss der lokalen Regierung, da sie gelegentlich finanzielle Unterstützung erhält.
Der Rundfunk wird durch die Falkland Islands Radio Service (FIRS) abgedeckt, die von der Regierung betrieben wird. FIRS sendet Nachrichten, Musik und Gemeindeankündigungen und ist für viele Bewohner die primäre Informationsquelle. Der Sender übernimmt Inhalte von der BBC, was die enge Verbindung zum Vereinigten Königreich widerspiegelt, bietet aber auch lokale Programme, die Themen wie Landwirtschaft, Wetterberichte und Gemeindeveranstaltungen abdecken. Fernsehen wird durch die Falkland Islands Television (FITV) bereitgestellt, die ebenfalls regierungsfinanziert ist und lokale Nachrichten, Dokumentationen und britische Programme ausstrahlt. FITV hat sich in den letzten Jahren durch Online-Plattformen wie YouTube weiterentwickelt, um jüngere Zielgruppen zu erreichen.
Internet und soziale Medien gewinnen zunehmend an Bedeutung, obwohl die Konnektivität durch die Abgelegenheit eingeschränkt ist. Satelliten-Internet, bereitgestellt durch Anbieter wie Starlink seit 2022, hat die Verbindung verbessert, bleibt aber teuer und unzuverlässig. Plattformen wie Facebook sind beliebt für lokale Diskussionen, Veranstaltungshinweise und den Austausch mit der Außenwelt. Dennoch bleibt die digitale Kluft ein Problem, besonders für ältere Bewohner oder abgelegene Farmen.
Zeitungen:
- Falkland Island News
- Penguin News
Internet Media:
- Falkland Islands Government
- Falkland Islands News Network
- EIN News
- Index Mundi
- Inside South America
- One World
- Sartma
- Topix
Radiostationen:
- Falkland Islands Radio Service (FIRS / Falklands Radio): MW 530 kHz (gesamtinsulär), FM 88.2 FM (North), 88.4 FM (West), 88.6 FM (South), 88.9 FM (East), öffentlicher Sender mit lokalem Programm, Nachrichten, Unterhaltung und anderes
- BFBS Falkland Islands: Verschiedene FM-Frequenzen wie 91.1-106.8 MHz (Burnside House), auch in Stanley auf 96.5 FM undsoweiter, Sender der British Forces, teils auf Militär- und Base-Publikum ausgerichtet, mit Unterhaltung, Musik undsoweiter.
- KTV Radio Nova / KTV Ltd.: Wird über KTV Ltd. als Teil des Subscription-DVB-/TV-/Radio-Pakets verbreitet; genaue lokale FM-Frequenzen variieren je nach Bereich, Rebroadcasts, vor allem aus dem Ausland, kombiniert mit lokalen/régionalen Angeboten.
Kommunikation
Seit Dezember 2005 gibt es ein GSM-basierendes Mobiltelefonnetz. Im Wesentlichen deckt es die Gebiete um Port Stanley und Mount Pleasant ab. Betrieben wird das Netz von Cable & Wireless Falkland Island.
Die Postleitzahl FIQQ 1ZZ gilt für das gesamte Territorium der Falklandinseln. Auf Grund der geringen Bevölkerungsdichte ist eine weiter gehende Differenzierung dieser Leitzahl nicht vonnöten. Die Falklandinseln geben eigene Briefmarken heraus. Die Zuständigkeit hierfür liegt beim staatlichen Falkland Islands Philatelic Bureau.
Kommunikationseinheit 2006 (pro 1000 Einwohner):
Telefonanschlusse 2 400 960,8
Mobiltelefone 2 400 960,8
Rundfunkgeräte 1 000 400,3
Fernsehgeräte 1 000 400,3
Postdaten:
- Postanschrift: Falkland Islands, South Atlnatic
- Telefon-Vorwahl: 00500
Sport
Nationalsport der Inselgruppe ist Reiten. Daneben werden auf den Falkland-Inseln folgende Sportarten betrieben: Badminton, Clay pigeon, Darts, Fußball, Cricket, Rugby, Karate, Marathonlauf, Golf, Hockey, Netball, Jacht-Segeln, Squash, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Schießen und Kayakfahren. Bekanntester Sportler der Inselgruppe ist Louis Baillon, der bei den Olympischen Spielen 1908 in der britischen Hockey-Nationalmannschaft spielte.
Reitsport
Der Reitsport spielt auf den Falklandinseln eine wichtige Rolle im Alltag und in der Kultur der Bewohner. Schon seit der Besiedlung durch britische Siedler im 19. Jahrhundert sind Pferde unverzichtbar für die Arbeit auf den weitläufigen Farmen, den sogenannten sheep stations. Auf diesen riesigen Schafweiden werden Pferde vor allem zum Hüten der Tiere eingesetzt, da Geländewagen in dem teils sumpfigen und unwegsamen Gelände oft an ihre Grenzen stoßen.
Aus dieser praktischen Nutzung hat sich auch eine starke Reittradition entwickelt. Besonders bekannt ist die enge Verbindung zu den Gaucho-Bräuchen aus Südamerika, die über die Nachbarländer Argentinien und Uruguay ihren Einfluss auf die Falklands fanden. So findet man hier eine Mischung aus britischem und südamerikanischem Reitstil.
Neben der Arbeit auf den Farmen hat das Reiten auch sportliche und gesellschaftliche Bedeutung. Bei Veranstaltungen und Dorffesten werden Reitwettbewerbe ausgetragen, darunter Geschicklichkeitsprüfungen, Wettreiten und Spiele zu Pferd. Diese Feste sind für die verstreut lebende Bevölkerung eine willkommene Gelegenheit, zusammenzukommen und ihre Traditionen zu pflegen.
Heute gehört das Reiten auf den Falklandinseln sowohl zum Alltag der Farmer als auch zur Freizeitgestaltung. Touristen können Reitausflüge in die offene Landschaft unternehmen und dabei die weite Natur und Tierwelt erleben. Somit ist der Reitsport auf den Falklands nicht nur ein praktisches Hilfsmittel, sondern auch ein lebendiger Teil der Kultur und Identität der Inselbewohner.
Fußball
Es gibt Berichte, dass auf den Falklandinseln bereits seit dem späten 19. Jahrhundert Fußball gespielt wurde. Die FIFL hat ihr erstes Spiel auf den Inseln für das Jahr 1892 verzeichnet. Dort trat eine Mannschaft der Falkland Islands Defence Force gegen die Garnison an. Während dieser Zeit, vor dem Ersten Weltkrieg, wurde der Sport unter den Bewohnern der Falklandinseln häufig ausgeübt. Im Falkland Islands Magazine gab es 1913 einen Bericht über eine Fußballliga, die aus fünf Mannschaften namens Dazzlers, Sappers, Crusaders, Corinthians und Malvinians bestand. Außerdem wurde über den Bau eines Pavillons in Mr Bradfields Yard berichtet.
Als erste organisierte Fußballmannschaft der Falklandinseln gilt der Stanley F.C., der unter der Leitung von Jack McNicholl gegründet wurde. Es gibt kein offizielles Datum, seit wann der Verein spielt, aber es wurde berichtet, dass er seit 1916 existiert. Das Falkland Islands Magazine berichtete darüber in seiner Ausgabe Nr. X, Band XXVIII vom Februar 1916 in einem Artikel mit dem Titel „The Stanley Football Club” und erklärte, dass der Verein „... zwei Mannschaften betreiben würde, wobei die Farben der 1. XI rote Trikots und die der 2. XI grüne Trikots sein würden: Beide würden in weißen Shorts spielen...”.
In den 1920er und 1930er Jahren wurden die meisten Fußballwettkämpfe auf den Falklandinseln von dort stationierten Soldaten über 18 Jahren ausgetragen. In der zweiten Hälfte der 1930er Jahre versuchten viele Jungen von den Falklandinseln, eine Freizeitliga auf der Insel zu organisieren, waren jedoch nie erfolgreich. Ihre Bemühungen führten jedoch dazu, dass in den 1950er Jahren zwei Jugendmannschaften gegründet wurden, die sich Jubilee Club und FI Volunteers Youth nannten und gelegentlich gegeneinander spielten.
Die Falkland Island Football League ist nicht Mitglied der FIFA. Die bisherigen Landesmeister waren:
- 1916: Stanley F.C.
- 1917: Stanley F.C.
- 1918: Stanley F.C.
- 1919: Stanley F.C.
- 1920: Stanley AC
- 1921: Stanley AC
- 1922: FI Volunteers
- 1923: Stanley AC
- 1924: FI Volunteers
- 1925: Stanley AC
- 1926: Stanley AC
- 1927: Stanley AC
- 1928: Stanley AC
- 1929: Stanley AC
- 1930: FI Volunteers
- 1931: Stanley AC
- 1932: FI Volunteers
- 1933: Stanley Service Corps I F.C.
- 1934: FI Volunteers
- 1935: Jubilee Club
- 1936: FI Volunteers
- 1937: FI Volunteers
- 1938: FI Volunteers
- 1939: FIDF
- 1940: FI Volunteers
- 1941: FIDF
- 1942: FIDF
- 1943: Stanley Service Corps I F.C.
- 1944: FIDF
- 1945: FIDF
- 1946: Hotspurs
- 1947: Stanley Redsox
- 1948: Stanley Redsox
- 1949: Stanley Redsox
- 1950: Stanley Redsox
- 1951: Stanley United
- 1952: Hotspurs
- 1953: Hotspurs
- 1954: Hotspurs
- 1955: Stanley Dynamos
- 1956: Stanley Redsox
- 1957: Stanley Redsox
- 1958: Hotspurs
- 1959: Hotspurs
- 1998/99: Kelper Store Celtics
- 1999/00: Hard Disc Rangers
- 2000/01: Kelper Store Celtics
- 2001/02: Kelper Store Celtics
- 2002/03: Kelper Store Celtics
- 2003/04: All Saints
- 2004/05: Kelper Store Celtics
- 2005/06: Penguin News
- 2006/07: Globe Tavern Wanderers
- 2007/08: Kelper Store Celtics
- 2008/09: Kelper Store Celtics
- 2009/10: SeaLed PR
- 2010/11: Sulivan Bluesox
- 2011/12: Chandlery FC
- 2012/13: Chandlery FC
- 2014/15: FIDF
- 2021/22: JK Marine Redsox
- 2022/23: CFL Hunters
- 2023/24: JK Marine Redsox
Meistertitel:
Stanley AC 9
FI Volunteers 7
Kelper Stone Celtics 7
FIDF 6
Hotspurs 6
Stanley Redsox 6
Stanley F.C. 4
Chandlery FC 2
Hotspurs 2
JK Marine Redsox 2
Stanley Service Corps I F.C. 2
All Saints 1
CFL Hunters 1
Globe Tavern Wanderers 1
Hard Disc Rangers 1
Jubilee Club 1
Penguin News 1
SeaLed PR 1
Stanley Dynamos 1
Sullivan Bluesox 1
Die Nationalmannschaft der Falkland-Inseln wird weder von der CONMEBOL noch von der FIFA als offizielles Mitglied anerkannt. Die Gegner der Mannschaft beschränken sich in der Regel auf andere Mannschaften des Vereinigten Königreichs oder Nationalmannschaften anderer autonomer Inseln. Die Mannschaft nimmt seit 2001 alle vier Jahre am Fußballturnier der Island Games teil. Die Mannschaft spielt meistens auf dem Fußballplatz im Sports Center in Stanley; seltener wird auch auf dem Platz der Stanley Community School gespielt.
Persönlichkeiten
Die wichtigsten mit Falkland verbundenen Persönlichkeiten sind:
- James Strong (erwähnt 1690): Britischer Kapitän, der als erster die Meerenge zwischen den Falklandinseln „Falkland Channel“ nannte, nach der der Inselname abgeleitet wurde.
- Louis-Antoine de Bougainville (1729 bis 1811): Französischer Offizier und Entdecker, der 1764 die erste dauerhafte Siedlung auf East Falkland gründete. Er nannte die Inseln „Îles Malouines“, woraus später der spanische Name „Malvinas“ entstand.
- Luis Elías Vernet (1791 bis 1871): Ein Kaufmann mit US-amerikanischem Pass, der von der argentinischen Regierung 1828 zum ersten Gouverneur der Falklandinseln ernannt wurde. Er versuchte, die Robbenjagd zu regulieren und begründete wichtige Ansprüche Argentiniens auf die Inseln.
- Gerald Cheek (* 1941): um 1980 Direktor der Zivilen Luftfahrt, spielte eine Schlüsselrolle beim Wiederaufbau des Flugdienstes nach dem Falklandkrieg
Fremdenverkehr
Der Tourismus nimmt immer mehr an Bedeutung zu am wirtschaftlichen Alltag auf den Falklandinseln. Jedoch bedingt durch das wenig verfügbare Land wird es kaum zu einem Massentourismus kommen. Weiterhin sind die Falklandinseln auch keineswegs für Bade– und Strandurlaub geeignet. Vielmehr lassen sich durch die kleineren Gruppen an Besuchern die herrliche Landschaft und die vielen seltenen Tiere beobachten.
Gästezahlen: insgesamt
1994 6 473
2004 36 000
2006 55 000
Ein- und Ausreise:
- Reisedokumente: Zur Einreise benötigt man einen Reisepass, der für die gesamte zeit des Aufenthalts gültig sein muss.
- Impfungen: Impfungen sind keine erforderlich.
- Zollbestimmungen: Es gelten die Zollbe4stimmungen des Vereinigten Königreichs.
- Reisen mit Kfz: Ein nationaler Führerschein ist für das Lenken eines Pkws auf der Inselgruppe erforderlich.
- Umgangsformen: Die Lebensart auf den Falkland-Inseln erinnert an kleine, abgeschiedene englische oder schottische Dörfer. Der Tourismus hat zugenommen, und die Inselbewohner genießen die zusätzlichen Einrichtungen, die die Anwesenheit der britische Truppen mit sich gebracht hat.
- Trinkgeld: 10 % sind angemessen, wenn die Rechnung noch kein Bedienungsgeld enthält. Taxifahrer erwarten Trinkgeld.
- Reisezeit: Zugvögel und Meeres-Säugetiere kommen zwischen Oktober und März zu den Strände und Halbinseln der Falklandinseln. Dezember und Januar sind die besten Monate für die Beobachtung von Tiere, ausserdem sind durch die länger scheinende Sonne auch andere Outdoor-Aktivitäten besser möglich. Allerdings sind Dezember und Januar auch die feuchtesten Monate. Von Oktober bis April ist der Höhepunkt touristischen Saison, was bei relativ geringen Besucherzahlen nicht viel bedeutet.
Literatur
- wikipedia = https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Falkland_Islands
- wikitravel = https://wikitravel.org/en/Falkland_Islands
- wikivoyage = https://de.wikivoyage.org/wiki/Falklandinseln
Reiseberichte
- The British Shop: Falklandinseln - eine Reise zum Ende der Welt (27.7.2024) = https://blog.the-british-shop.de/page/view/2024/07/die-falkland-inseln-eine-reise-zum-ende-der-welt
Sandra Schänzer: Falklandinseln (11. bis 18.1.2025) = https://www.sandra-schaenzer.de/falklandinseln.php - Travel Inspired: Falklandinseln - Reiseberichte = https://travelinspired.de/antarktis/falklandinseln/
Videos
- Falkland Islands 4k = https://www.youtube.com/watch?v=WOkAyEtVq8w
- Der Falkland Krieg. Die wahre Geschichte des Konmflikts um die Malwinas = https://www.youtube.com/watch?v=Pqfzs9J4CvM
- Warum die Briten die Dalklandinseln nicht abgeben = https://www.youtube.com/watch?v=5PzVhrHUHB8
- Warum will jemand auf den Falklandinseln leben = https://www.youtube.com/watch?v=RvYarKCId5c
- Travel Discovery: Falkland Islands = https://www.youtube.com/watch?v=Np_kuhzwfVU
Atlas
- Falkland, openstreetmap = https://www.openstreetmap.org/#map=8/-51.971/-60.529
- Falkland, Satellit = https://satellites.pro/Falkland_Islands_map
Reiseangebote
Falkland Tourism = https://www.falklandislands.com/
Falklandinseln, Urlaub für Naturliebhaber = https://www.diamir.de/falklandinseln
Forum
Hier geht’s zum Forum: