La Palma: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
La Palma war für viele europäische Exilanten - Aufsässigen in ihren Heimatländern - eine letzte Zuflucht. In den 1970er Jahren galt die Insel als Aussteigerparadies für Hippies und Öko-Freaks. Als Heimat von insgesamt 120 Vulkanen kann sie aber auch höllische Qualitäten entfalten. Eruptionen haben das Eiland geformt und immer wieder neu gestaltet. An der Schroffheit La Palmas sind einstmals schon die spanischen Eroberer verzweifelt. Die bestens an die schwierigen ökologischen Verhältnisse angepassten Ureinwohner waren nur durch Verrat zu bezwingen. Ihre in einer Vielzahl von Relikten erhalten gebliebene Kultur wurde während der Kolonisierungsphase wiéitgehend zerstört, wird aber in letzter Zeit wieder verstärkt gewürdigt. | La Palma war für viele europäische Exilanten - Aufsässigen in ihren Heimatländern - eine letzte Zuflucht. In den 1970er Jahren galt die Insel als Aussteigerparadies für Hippies und Öko-Freaks. Als Heimat von insgesamt 120 Vulkanen kann sie aber auch höllische Qualitäten entfalten. Eruptionen haben das Eiland geformt und immer wieder neu gestaltet. An der Schroffheit La Palmas sind einstmals schon die spanischen Eroberer verzweifelt. Die bestens an die schwierigen ökologischen Verhältnisse angepassten Ureinwohner waren nur durch Verrat zu bezwingen. Ihre in einer Vielzahl von Relikten erhalten gebliebene Kultur wurde während der Kolonisierungsphase wiéitgehend zerstört, wird aber in letzter Zeit wieder verstärkt gewürdigt. | ||
{{Inselsteckbrief|offizieller Name=Isla de San Miguel de La Palma|alternative Bezeichnungen=Iunonia, Junonia (um 50), Al-Ghanam (1124), Aragauia (1349/50), Liparme (1351), Ysla de Palme (1367), Palmaria (15. Jahrhundert), Benahoare (1590), Benahorare (1632), Planaria (1679), Benehoare (1764), Bena Hoave (1803), Benajoare, Banahoare (19. Jahrhundert), La Palma (ab 17. Jahrhundert)|Kategorie=Meeresinsel|Inseltyp=echte Insel|Inselart=vulkanische Insel (Hot Spot)|Gewässer=Atlantischer Ozean (Oceano Atlantico)|Inselgruppe=Kanarische Inseln (Islas Canarias)|politische Zugehörigkeit=Staat: Spanien (Reino de España)<br>Region: Kanarische Inseln (Comunidad Autónoma de Canarias)<br>Provinz: Santa Cruz de Tenerife|Gliederung=14 municipios (Großgemeinden)<br>136 barríos (Stadtteile), pueblos (Dörfer) und caseríos (Hofgemeinschaften)|Status=Inselgemeinschaft (comunidad insular)|Koordinaten=28°37‘ N, 17°52‘ W|Entfernung zur nächsten Insel=50 m (Roque de las Tabaibas), 54 km (Gomera)|Entfernung zum Festland=445 km (Cap Bojador / Marokko)|Fläche=708,16 km² / 273,42 mi² (mit Nebeninseln 708,32 km² / 273,48 mi²)|geschütztes Gebiet=236 km² / 91 mi² (33,3 %)|maximale Länge=45,3 km (N-S)|maximale Breite=27,9 km (W-O)|Küstenlänge=155,6 km|tiefste Stelle=0 m (Atlantischer Ozean)|höchste Stelle=2426 m (Roque de los Muchachos)|relative Höhe=2426 m|mittlere Höhe=560 m|maximaler Tidenhub=2,3 bis 2,5 m (Santa Cruz de La Palma 2,4 m)|Zeitzone=HCE (Hora Central Europea / Mitteleuropäische Zeit, UTC+1)|Realzeit=UTC minus 12 Stunde 11 bis 12 Minuten|Einwohnerzahl=85.104 (2024)|Dichte=120,15|Inselzentrum=Santa Cruz de La Palma}} | |||
== '''Name''' == | == '''Name''' == | ||
La Palma, dieser Name erinnert schon vom Klang her an paradiesische Zustände, an Sonne, Strand und elysische Gefielde. Das Wort wird in der Regel als „Palmeninsel“ gedeutet, tatsächlich aber bezeichnet der spanische Ausdruck ''palma'' einen „Palmwedel“, wohingegen die „Palme“ in der gleichen Sprache ''palmera'' genannt wird. Aber wie auch immer, das Spanische bildet ja doch nur das letzte Glied in einer langen Namensgeschichte. | La Palma, dieser Name erinnert schon vom Klang her an paradiesische Zustände, an Sonne, Strand und elysische Gefielde. Das Wort wird in der Regel als „Palmeninsel“ gedeutet, tatsächlich aber bezeichnet der spanische Ausdruck ''palma'' einen „Palmwedel“, wohingegen die „Palme“ in der gleichen Sprache ''palmera'' genannt wird. Aber wie auch immer, das Spanische bildet ja doch nur das letzte Glied in einer langen Namensgeschichte. | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
Die geschichtlich tatsächlich belegbaren ersten Fremdkolonisatoren, eine von Alonso Fernandez de Lugo befehligte spanische Schlägerertruppe, begann am 29.9., dem Tag des heiligen Michael, im Jahre 1492 von Tazacorte aus mit der Eroberung des Eilands. In Erinnerung an diesen barbarischen Akt der Gewalt wird die Insel seit damals verschiedentlich '''''San Miguel de La Palma''''' genannt. Als weitee Bezeichnungen haben sich in den letzten Jahren - von Touristenkreisen ausgehend - anheimelnde Namen wie '''''Isla Verde''''', „grüne Insel“, oder '''''Isla Bonita''''', „liebliche, nette, kleine Insel“, eingebürgert. Bei deutschsprechenden Besuchern, deren manche sich mittlerweile dauerhafter auf La Palma niedergelassen haben, ist verschiedentlich auch von der „Schweiz der Kanaren“ oder von der „drittschönsten Insel der Welt - nach Bora Bora und Hawaii“ (Reifenberger 1991:6) die Rede. | Die geschichtlich tatsächlich belegbaren ersten Fremdkolonisatoren, eine von Alonso Fernandez de Lugo befehligte spanische Schlägerertruppe, begann am 29.9., dem Tag des heiligen Michael, im Jahre 1492 von Tazacorte aus mit der Eroberung des Eilands. In Erinnerung an diesen barbarischen Akt der Gewalt wird die Insel seit damals verschiedentlich '''''San Miguel de La Palma''''' genannt. Als weitee Bezeichnungen haben sich in den letzten Jahren - von Touristenkreisen ausgehend - anheimelnde Namen wie '''''Isla Verde''''', „grüne Insel“, oder '''''Isla Bonita''''', „liebliche, nette, kleine Insel“, eingebürgert. Bei deutschsprechenden Besuchern, deren manche sich mittlerweile dauerhafter auf La Palma niedergelassen haben, ist verschiedentlich auch von der „Schweiz der Kanaren“ oder von der „drittschönsten Insel der Welt - nach Bora Bora und Hawaii“ (Reifenberger 1991:6) die Rede. | ||
* international: La Palma | |||
* altkanarisch: Benahoare, Benahorare | * altkanarisch: Benahoare, Benahorare | ||
* amharisch: ላ ፓልማ [La Palma] | |||
* arabisch: لابالما [la Bālmā] | * arabisch: لابالما [la Bālmā] | ||
* armenisch: Պալմա [Palma] | * armenisch: Պալմա [Palma] | ||
* bengalisch: লা পালমা [La Palma] | |||
* birmanisch: လာပါလ်မား [La Palma] | |||
* bulgarisch: Палма [Palma] | * bulgarisch: Палма [Palma] | ||
* chinesisch: 拉帕爾馬島 [lā pà ěr mǎ dǎo] | * chinesisch: 拉帕爾馬島 [lā pà ěr mǎ dǎo] | ||
* georgisch: პალმა [Palma] | * georgisch: პალმა [Palma] | ||
* griechisch: Λα Πάλμα [La Pálma] | * griechisch: Λα Πάλμα [La Pálma] | ||
* gudscheratisch: લા પાલ્મા [La Palma] | |||
* hebräisch: לה פלמה [La Palma] | * hebräisch: לה פלמה [La Palma] | ||
* hindi: ला पाल्मा [La Palma] | * hindi: ला पाल्मा [La Palma] | ||
* japanisch: ラ・パルマ島 [pa ru ma tō] | * japanisch: ラ・パルマ島 [pa ru ma tō] | ||
* kambodschanisch: ឡាផាល់ម៉ា [La Palma] | |||
* koreanisch: 라팔마섬 [ra pal ma seom] | * koreanisch: 라팔마섬 [ra pal ma seom] | ||
* laotisch: ລາປາມາ [La Palma] | |||
* lateinisch: Iunonia, Junonia | * lateinisch: Iunonia, Junonia | ||
* malayalam: ല പാം [La Palma} | |||
* maldivisch: ލާ ޕާލްމާ [La Paalma] | |||
* orissisch: ଲା ପାଲ୍ମା [La Palma] | |||
* pandschabisch: ਲਾ ਪਾਮਾ [La Palma] | |||
* russisch: Пальма [Pal‘ma] | * russisch: Пальма [Pal‘ma] | ||
* serbisch: Ла Палма [La Palma | * serbisch: Ла Палма [La Palma] | ||
* singhalesisch: ලා පාල්මා [La Palma] | |||
* tamilisch: ல பாமா [La Palma] | |||
* thai: ลาปามา [La Palma] | |||
* tibetisch: ལ་པཱམ་ [La Palma] | |||
* ukrainisch: Ла-Палма (La-Palma] | * ukrainisch: Ла-Палма (La-Palma] | ||
* urdu: لا پالما [La Palma] | |||
* weißrussisch: Пальма [Pal‘ma] | * weißrussisch: Пальма [Pal‘ma] | ||
'''Offizieller Name''': Isla de San Miguel de La Palma | |||
* Bezeichnung der Bewohner: Palmeros (Palmerer) | |||
* adjektivisch: palmero (palmerisch) | |||
''' | '''Kürzel:''' | ||
* | * Code: LP / LPA | ||
* | * Kfz: - | ||
* ISO-Code: ES.CI.LP | |||
== '''Lage''' == | == '''Lage''' == | ||
| Zeile 44: | Zeile 66: | ||
Die Erdkugelkoordinaten von La Palma sind 17°50’ w.L. und 28°35’ n.B.. Die Insel liegt damit auf in etwa gleicher Höhe wie der Südrand des marokkanischen Atlas-Gebirges, das Plateau du Tademaït in Algerien, die ägyptische Oase Bahariya, Bani Mazar im Niltal, das Sinai-Gebirge, die Südgrenze Kuwaits, die iranische Hafenstadt Bushehr, die zentralpakistanische Region um Sukkur am Indus, Delhi, der Chomolungma bzw. Mount Everest, der Südrand Tibets und der Norden Bhutans, die chinesischen Großstädte Yiyang, Nanchang und Changrao, die nördliche Ryukyu-Insel Oshima, der westliche Hawaii-Vorposten Kure, der zentrale Teil von Baja California, die mexikanische Metropole Chihuahua, Beeville und Port Lavaca im Süden von Texas und Orlando in Florida. Nördlichster Punkt der Insel ist der Punta de Juan Adalid bei El Palmar auf 28°51’15“ n.B., südlichster der Punta Fuencaliente auf 28°25’07“ n.B.. Den östlichsten Vorposten La Palmas bildet der Punta Salinas bei Puntallana auf 17°43’42“ w.L., den westlichsten der von Puntagorda aus erreichbare Punta del Serradero auf 18°00’15“ w.L.. | Die Erdkugelkoordinaten von La Palma sind 17°50’ w.L. und 28°35’ n.B.. Die Insel liegt damit auf in etwa gleicher Höhe wie der Südrand des marokkanischen Atlas-Gebirges, das Plateau du Tademaït in Algerien, die ägyptische Oase Bahariya, Bani Mazar im Niltal, das Sinai-Gebirge, die Südgrenze Kuwaits, die iranische Hafenstadt Bushehr, die zentralpakistanische Region um Sukkur am Indus, Delhi, der Chomolungma bzw. Mount Everest, der Südrand Tibets und der Norden Bhutans, die chinesischen Großstädte Yiyang, Nanchang und Changrao, die nördliche Ryukyu-Insel Oshima, der westliche Hawaii-Vorposten Kure, der zentrale Teil von Baja California, die mexikanische Metropole Chihuahua, Beeville und Port Lavaca im Süden von Texas und Orlando in Florida. Nördlichster Punkt der Insel ist der Punta de Juan Adalid bei El Palmar auf 28°51’15“ n.B., südlichster der Punta Fuencaliente auf 28°25’07“ n.B.. Den östlichsten Vorposten La Palmas bildet der Punta Salinas bei Puntallana auf 17°43’42“ w.L., den westlichsten der von Puntagorda aus erreichbare Punta del Serradero auf 18°00’15“ w.L.. | ||
'''Geografische Lage:''' | '''Geografische Lage:''' | ||
nördlichster Punkt: 28°51’15“ n.B. (Punta de Juan Adalid) | * nördlichster Punkt: 28°51’15“ n.B. (Punta de Juan Adalid) | ||
* südlichster Punkt: 28°25’07“ n.B. (Punta Fuencaliente) | |||
südlichster Punkt: 28°25’07“ n.B. (Punta Fuencaliente) | * östlichster Punkt: 17°43’42“ w.L.(Punta Salinas) | ||
* westlichster Punkt: 18°00’15“ w.L. (Punta del Serradero) | |||
östlichster Punkt: 17°43’42“ w.L.(Punta Salinas) | |||
westlichster Punkt: 18°00’15“ w.L. (Punta del Serradero) | |||
'''Entfernungen:''' | '''Entfernungen:''' | ||
Gomera / Kanaren (Punta del Peligro) | * Gomera / Kanaren (Punta del Peligro) 54 km | ||
* Hierro / Kanaren (Punta Norte) 69 km | |||
Hierro / Kanaren (Punta Norte) | * Teneriffa / Kanaren (Punta del Ancon) 85 km | ||
* Gran Canaria / Kanaren (Punta de la Aldea) 196 km | |||
Teneriffa / Kanaren (Punta del Ancon) | * Fuerteventura / Kanaren (Punta Cotillo) 313 km | ||
* Lanzarote / Kanaren (Punta Gines) 385 km | |||
Gran Canaria / Kanaren (Punta de la Aldea) | * Madeira (Ponta da Cruz) 432 km | ||
* Westsahara / Marokko (Cap Bojador) 445 km | |||
Fuerteventura / Kanaren (Punta Cotillo) | * Santa Maria / Azoren (Punta do Castelo) 1110 km | ||
* Algarve / Portugal (Cabo de São Vicente) 1240 km | |||
Lanzarote / Kanaren (Punta Gines) | * Spanien (CapTrafalgar) 1380 km | ||
* Santo Antão / Kapverden (Ponta do Sol) 1390 km | |||
Madeira (Ponta da Cruz) | * Bermuda (Great Head) 4500 km | ||
Westsahara / Marokko (Cap Bojador) | |||
Santa Maria / Azoren (Punta do Castelo) | |||
Algarve / Portugal (Cabo de São Vicente) | |||
Spanien (CapTrafalgar) | |||
Santo Antão / Kapverden (Ponta do Sol) | |||
=== '''Zeitzone''' === | |||
Auf La Palma gilt die '''Hora Central Europea''' bzw. '''Central European Time''' (Mitteleuropäische Zeit), abgekürzt HCE bzw. CET (MEZ), eine Stunde vor der Koordinierten Welötzeit (UTC+1). Die Realzeit liegt um eine Stunde und 11 bis 12 Minuten hinter der Koordinierten Weltzeit (UTC). | |||
'''Zeitzone''' | |||
Auf La Palma gilt die | |||
== '''Fläche''' == | == '''Fläche''' == | ||
La Palma ist eine äußerst lebendige Insel, die einerseits durch Verwitterung und ozeanische Abtragungen schrumpft, andererseits durch vulkanische Aktivitäten immer wieder neues Land dazu gewinnt. Es ist also nicht leicht, dauerhaft genaue Angaben über die Gesamtfläche des kanarischen Eilands zu machen. Inoffizielle Darstellungen schwanken üblicherweise zwischen 705 und 708 km², doch wurde die Inselfläche bis in die achtziger Jahre hinein verschiedentlich auch auf 726 bis 730 km² veranschlagt bzw. auf „um 700 km²“ (Marco Polo 1994:5) abgerundet. Amtliche Angaben verlautbarten bis in die 1980er Jahre hinein 704,25 km² als Landfläche La Palmas, neueste Vermessungen ergaben jedoch um etliches mehr, nämlich 708,32 km² bzw. 273,48 mi², wobei sich dieser Wert bei Ebbe auf annähernd 709 km² erhöht. Zur Hauptinsel mit 708,1 km² kommen insgesamt 102 Felseninseln mit zusammen 16,2 ha. Größter der vorgelagerten Felsblöcke ist der Roque de las Taibadas vor Garafía mit einer Größe von 1,4 ha bzw. 260 mal 120 m und einer Höhe von 65 m. | La Palma ist eine äußerst lebendige Insel, die einerseits durch Verwitterung und ozeanische Abtragungen schrumpft, andererseits durch vulkanische Aktivitäten immer wieder neues Land dazu gewinnt. Es ist also nicht leicht, dauerhaft genaue Angaben über die Gesamtfläche des kanarischen Eilands zu machen. Inoffizielle Darstellungen schwanken üblicherweise zwischen 705 und 708 km², doch wurde die Inselfläche bis in die achtziger Jahre hinein verschiedentlich auch auf 726 bis 730 km² veranschlagt bzw. auf „um 700 km²“ (Marco Polo 1994:5) abgerundet. Amtliche Angaben verlautbarten bis in die 1980er Jahre hinein 704,25 km² als Landfläche La Palmas, neueste Vermessungen ergaben jedoch um etliches mehr, nämlich 708,32 km² bzw. 273,48 mi², wobei sich dieser Wert bei Ebbe auf annähernd 709 km² erhöht. Zur Hauptinsel mit 708,1 km² kommen insgesamt 102 Felseninseln mit zusammen 16,2 ha. Größter der vorgelagerten Felsblöcke ist der Roque de las Taibadas vor Garafía mit einer Größe von 1,4 ha bzw. 260 mal 120 m und einer Höhe von 65 m. Die Küste ist insgesamt 155,6 km lang. Davon sind 128,5 km Fels- und Steilkpste, 8,2 km Kiesstrand, 5,1 km Hafenbereiche und 13,8 km sonstiges. Der Tidenhub beträgt 2,3 bis 2,5 m, in Santa Cruz de La Palma 2,4 m. | ||
Die Küste ist insgesamt 155,6 km lang. Davon sind 128,5 km Fels- und Steilkpste, 8,2 km Kiesstrand, 5,1 km Hafenbereiche und 13,8 km sonstiges. Der Tidenhub beträgt 2,3 bis 2,5 m, in Santa Cruz de La Palma 2,4 m. | |||
Die zwischen dem Punta de Juan Adalid und dem Punta Fuencaliente, großteils durch die Bergkette der Cumbre verlaufende Nord-Süd-Achse La Palmas ist 45,3 km lang. Die das Herz der Insel, die Caldera de Taburiente, querende West-Ost-Breite zwischen dem Punta del Serradero und dem Punta Salinas beträgt 27,9 km. Die mittlere palmerische Seehöhe liegt bei etwa 560 m. Höchster Gipfel ist der Roque de los Muchachos am Nordrand der Caldera de Taburiente mit 2426 m. | Die zwischen dem Punta de Juan Adalid und dem Punta Fuencaliente, großteils durch die Bergkette der Cumbre verlaufende Nord-Süd-Achse La Palmas ist 45,3 km lang. Die das Herz der Insel, die Caldera de Taburiente, querende West-Ost-Breite zwischen dem Punta del Serradero und dem Punta Salinas beträgt 27,9 km. Die mittlere palmerische Seehöhe liegt bei etwa 560 m. Höchster Gipfel ist der Roque de los Muchachos am Nordrand der Caldera de Taburiente mit 2426 m. | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
'''Flächenaufteilung''' 1991: | '''Flächenaufteilung''' 1991: | ||
Agrarland | * Agrarland 360,12 km² (50,8 %) | ||
** Äcker und Gärten 73,26 km² | |||
** Weide- und Brachland 286,86 km² | |||
* Waldland 292,28 km² (41,3 %) | |||
* )Siedlungs- und Ödland 55,86 km² (7,9 % | |||
Waldland | |||
Siedlungs- und Ödland | |||
== '''Landschaft''' == | == '''Landschaft''' == | ||
| Zeile 154: | Zeile 150: | ||
''' | '''Erhebungen''' | ||
Caldera de Taburiente: | |||
Cruz del | * Roque de los Muchachos 2426 m | ||
* Cruz del Fraile 2376 m | |||
* Fuente Nueva 2372 m | |||
* Roque Chico 371 m | |||
* Pico de La Cruz 2351 m | |||
* Fuente Nueva 2350 m | |||
* Morro Negro 2322 m | |||
* Roque Palmero 2306 m | |||
* Pico del Ataúd 2144 m | |||
* Roque de la Fortaleza 2090 m | |||
Cumbre Vieja: | |||
Roque | * Desedada 1933 m | ||
* Montaña del Fraile 1908 m | |||
* Montaña del Cabrito 1868 m | |||
* Montaña la Barquita 1809 m | |||
* Volcán El Charco 1740 m | |||
* Montaña de la Monteca 1699 m | |||
* Montaña el Caldero 1626 m | |||
* Montaña de Magdalena 1593 m | |||
* Montaña Andrés Martin 1544 m | |||
* Montaña de la Venta 1513 m | |||
* Volcán de San Martin 1487 m | |||
* Montaña Pelada 1445 m | |||
* Volcán Tacande 1365 m | |||
* Volcán Bernardino 1275 m | |||
* Montaña de los Faros 1266 m | |||
* Mantaña de Fuego 1249 m | |||
* Volcán de la Deseada 1238 m | |||
* Volcán Tajuya 1219 m | |||
* Roque de Tamanca 1129 m | |||
* Volcán de Tajogaite 1120 m | |||
* Pico de los Arreboles 1030 m | |||
* Volcán de San Antonio 656 m | |||
* Volcán de Teneguía 428 m | |||
'''See''' | |||
* Laguna de Barlovento 0,25 km² (Tiefe 50 m) | |||
'''Fluss''' | |||
* Barranco de las Angustias 21 km | |||
| Zeile 528: | Zeile 498: | ||
'''Klimadaten für Santa Cruz de La Palma''' (25 m, 1961 bis 1990) | |||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable" | |||
| | | | ||
|Jan | |'''Jan''' | ||
|Feb | |'''Feb''' | ||
|Mar | |'''Mar''' | ||
|Apr | |'''Apr''' | ||
|Mai | |'''Mai''' | ||
|Jun | |'''Jun''' | ||
|Jul | |'''Jul''' | ||
|Aug | |'''Aug''' | ||
|Sep | |'''Sep''' | ||
|Okt | |'''Okt''' | ||
|Nov | |'''Nov''' | ||
|Dez | |'''Dez''' | ||
|Jahr | |'''Jahr''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Mitteltemperatur (°C)''' | ||
|17, | |17,7 | ||
|16,9 | |16,9 | ||
| | |18,3 | ||
| | |18,6 | ||
|19, | |19,4 | ||
| | |21,0 | ||
|22, | |22,4 | ||
|23, | |23,5 | ||
|23,4 | |||
|22,6 | |22,6 | ||
|21, | |21,1 | ||
| | |18,9 | ||
|'''20,3''' | |||
|''' | |||
|- | |- | ||
| | |'''Niederschlag (mm)''' | ||
|89 | |||
|15 | |||
|25 | |||
|48 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |1 | ||
| | |14 | ||
| | |26 | ||
| | |76 | ||
| | |106 | ||
|'''409''' | |||
|''' | |||
|- | |- | ||
| | |'''Niederschlagstage''' | ||
| | |16 | ||
|6 | |6 | ||
| | |10 | ||
|9 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|2 | |2 | ||
| | |7 | ||
| | |12 | ||
|0 | |12 | ||
|0 | |14 | ||
| | |'''100''' | ||
|6 | |- | ||
| | |'''Luftfeuchtigkeit (%)''' | ||
| | |71 | ||
|''' | |70 | ||
|72 | |||
|73 | |||
|72 | |||
|74 | |||
|75 | |||
|74 | |||
|74 | |||
|75 | |||
|74 | |||
|74 | |||
|'''72,5''' | |||
|- | |||
|'''Tägliche Sonnenstunden ''' | |||
|4,5 | |||
|5,5 | |||
|6,0 | |||
|7,0 | |||
|8,0 | |||
|9,5 | |||
|10,5 | |||
|9,5 | |||
|8,0 | |||
|6,0 | |||
|5,5 | |||
|5,0 | |||
|'''7,5''' | |||
|- | |- | ||
|Wassertemperatur (°C) | |'''Wassertemperatur (°C)''' | ||
|19 | |19 | ||
|18 | |18 | ||
| | |19 | ||
|19 | |||
|19 | |19 | ||
|20 | |20 | ||
|22 | |22 | ||
|23 | |23 | ||
|22 | |22 | ||
|22 | |||
|21 | |||
|20 | |20 | ||
|'''20, | |'''20,5''' | ||
|} | |||
'''Klimadaten für Tazacorte''' | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|'''Jan''' | |||
|'''Feb''' | |||
|'''Mar''' | |||
|'''Apr''' | |||
|'''Mai''' | |||
|'''Jun''' | |||
|'''Jul''' | |||
|'''Aug''' | |||
|'''Sep''' | |||
|'''Okt''' | |||
|'''Nov''' | |||
|'''Dez''' | |||
|'''Jahr''' | |||
|- | |- | ||
| | |'''Mittelmaximum (°C)''' | ||
| | |17,0 | ||
| | |16,9 | ||
|5 | |17,5 | ||
|4 | |17,4 | ||
| | |19,1 | ||
| | |20,0 | ||
| | |22,3 | ||
| | |23,2 | ||
| | |22,6 | ||
|3 | |21,3 | ||
| | |19,0 | ||
| | |17,2 | ||
|''' | |'''19,5''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Mittelminimum (°C)''' | ||
| | |12,2 | ||
| | |11,6 | ||
| | |11,9 | ||
| | |11,9 | ||
| | |13,2 | ||
| | |14,5 | ||
| | |16,4 | ||
| | |17,4 | ||
| | |17,2 | ||
| | |16,6 | ||
| | |14,9 | ||
| | |12,8 | ||
|''' | |'''14,2''' | ||
| | |- | ||
|'''Niederschlag (mm)''' | |||
|159 | |||
|112 | |||
|75 | |||
|23 | |||
|12 | |||
|8 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|10 | |||
|104 | |||
|224 | |||
|126 | |||
|'''857''' | |||
|- | |||
|'''Niederschlagstage''' | |||
|7 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|'''45''' | |||
|- | |||
|'''Luftfeuchtigkeit (%)''' | |||
|71 | |||
|70 | |||
|68 | |||
|69 | |||
|69 | |||
|71 | |||
|72 | |||
|72 | |||
|73 | |||
|72 | |||
|72 | |||
|70 | |||
|'''70,8''' | |||
|- | |||
|'''Tägliche Sonnenstunden ''' | |||
|3,8 | |||
|4,5 | |||
|5,1 | |||
|4,9 | |||
|4,7 | |||
|5,0 | |||
|7,0 | |||
|6,8 | |||
|5,2 | |||
|3,9 | |||
|3,2 | |||
|4,0 | |||
|'''4,8''' | |||
|- | |||
|'''Wassertemperatur (°C)''' | |||
|19 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|19 | |||
|20 | |||
|21 | |||
|22 | |||
|23 | |||
|23 | |||
|23 | |||
|22 | |||
|20 | |||
|'''20,7''' | |||
|} | |||
== '''Mythologie''' == | |||
Die ursprünglichen Bewohner La Palmas waren, wie ein früher Besucher der Insel vermerkte, „Götzendiener, weil sie den Teufel in Gestalt eines Hundes verehrten, den sie Haguanran nannten. Sie sagten von ihm, er wohne im Himmel, der von ihnen Tigotan genannt wird, und auf der Erde am Gipfel der Tedote genannten Berge, wo sie ihre Gebete und Opfer von Milch und Butter verrichteten.“ (Leonardo Torriani nach Castro-Eigen-Goebel 1985:194) Viele der Geschichten, die man sich auf La Palma erzählt, wurzeln in derartigen Vorstellungen aus archaischen Zeiten. Sie handeln von Abora, dem durch missionarische Einflussnahme mit christlichen Attrtibuten versehenen Schöpfergott der alten Kanaren, und von seinem Gegenstück, dem teuflischen Higuanran alias Guayote, dem „Kojoten im Vulkan“. Um den Diabolo Volcánico, den „Vulkanteufel“, wie er heutzutage auch genannt wird, zu besänftigen, pflegt man vielerorts recht zünftige Bräuche. Auf diese und all die anderen Sitten und Festlichkeiten La Palmas wird später noch näher eingegangen werden. | |||
Am Anfang, so wird von Palmeros unter Berufung auf ihre Altvorderen gemunkelt, war Abora. „Vor ihm gab es nur das Nichts und die Leere; das Meer spiegelte noch nicht den Himmel wider, und das Licht hatte noch keine Farben.“ Da schuf er die Luft und das Wasser, den gewaltigen Ozean, und er schuf das Feuer und mit dessen Hilfe das Land. Nach und nach hauchte er dieser Welt Leben ein, formte Pfalnzen und Tiere. Alle „Geschöpfe verdankten ihm ihr Dasein.“ So auch die Menschen, die er als letzte schuf und auf die Inseln brachte, „damit auch sie das Erschaffene bewunderten, es gebrauchten und es erhielten ...“ (Castellano Gil-Macías Martín 1994:152) | |||
Aber am Anfang war auch Higuanran, der sich bisweilen vom Himmel auf die Erde begab und es sich hier gemütlich machte. Er hauste dann auf Berggipfeln und ließ manch einen dieser Kegel Feuer speien. Higuanran nahm zumeist, wie es heißt, die Gestalt eines Hundes an. Als gewalttätige Menschen übers Meer kamen, um die Insel zu unterjochen, empfing er sie mit dumpfem Brausen. Die Neuankömmoinge jedenfalls hassten ihn und setzten ihn als Guayote, dem „Kojoten im Vulkan“, mit dem Teufel gleich. Den allerdings hatten sie selber mitgebracht und ihn auf der Insel so gewaltig wüten lassen, dass nicht mehr viel von der Ursprünglichkeit La Palmas geblieben ist. Aber ganz haben sie das Erbe des Higuanran denn doch nicht auslöschen können. | |||
La Palma ist reich an geheimnisvollen Plätzen, an Naturdenkmälern und historischen Stätten. Wie ein Herz ist die Insel dem Meer entwachsen, und mitten drin in diesem Gebilde liegt eine Stätte, die den Menschen seit jeher als heiliger, anbetungswürdiger Platz erschien: der Idafe. Dieser „Vulkan-Monolith“, offiziell heißt er Roque de Idafe, erhebt sich im Zentrum der Caldera de Taburiente und ragt hier bis auf 603 m empor. Sein Schicksal, so meinen viele Palmeros, und so meinten es auch schon die Ureinwohner, sei untrennbar mit dem der ganzen Insel verquickt. Um die Fruchtbarkeit und damit den weiteren Bestand La Palmas zu sichern, wurden hier einstmals Opfer dargebracht und rauschende Fest, vermutlich speziell zur Zeit der Sommersonnenwende, gefeiert. Jedesmal wenn der Stamm der Aceró, zu deren Bereich der Idafe gehörte, „ein Tier geschlachtet hatte, nahmen zwei Männer den mühseligen Aufstieg zum Fuß des fast unzugänglichen Felsens auf sich, um hier die Innereien darzubringen.“ Dabei sprach der eine: „Y iguida y iguan Idafe!“ Zu deutsch: „Er sagt, dass der Idafe fallen wird!“ Und der andere antwortete: „Que guerte yguan taro!“ Übersetzt in etwa: „Gibt ihm, was du bringst, und er wird nicht fallen!“ (Lipps 1994:156) | |||
Neben dem Idafe gab es vor der spanischen Kolonisierung zumindest noch elf weitere bedeutende Kultstätten auf La Palma - eine für jeden Stamm. Mit einiger Berechtigung als solcher ansprechen lässt sich El Time, die höchste Erhebung der Laderas de Amagar am Nordrand des Barranco de las Angustias. Dazu kommen unter anderem die Krater von Vaqueros und Barlovento im Norden der Insel sowie die Vulkankegel der Cumbre Vieja. Von besonderer Bedeutung waren vermutlich Höhlen, wie zum Beispiel die Cueva de Fraile bzw. „Mönchshöhle“ in der Gemeinde Garafía. Sie war als Felswohnung genauso in Gebrauch wie als Kultstätte. Die Cueva de Balmaco bei Tigalate im Süden der Gemeinde Mazo diente zeitweise wohl als Wohnplatz eines Häuptlings oder Priesters, doch wurden hier mit Sicherheit auch Rituale abgehalten. In den Höhlen darüber haben sich die Auaritas genannten Ureinwohner zur letzten Ruhe hingelegt. ''Vacaguaré'', „ich möchte sterben“ - diesen Ausspruch sollen sie noch getan haben, ehe man sie mit einem Krug Milch versehen in ihrer jeweiligen Höhle einmauerte. | |||
Die christlichen Missionare haben wohl verschiedentlich an alte Pilgertraditionen angeknüpft und etliche ihrer Kapellen und Kirchen auf altüberliefert heiligen Stätten errichtet. Hervorzuheben sind in diesem Zusamenhang die sogenannten Ermitás, „Einsiedeleien“. Eine davon befindet sich unmittelbar nördlich der Hauptstadt Santa Cruz in der kleinen Ortschaft Mirca. Sie trägt den Namen Ermità de Candelaria, „Lichtmess-Einsiedelei“. Im äußersten Südwesten La Palmas, im Bereich der Gemeinde Fuencaliente hat man mitten in pittoreske Lavafelder hinein die Ermità Santa Cecilia errichtet. Etwas weiter nördlich stößt man auf die Ermità del Buen Jesús südlich von Tijarafe. Unmittelbar bei dieser Ermità stehen zwei „von Schlackenkegeln umgebene, großartige Felsentore mit Wänden, die im Frühjahr prächtig von blauen und gelben Blumen und grünen Moosen umgeben sind.“ (Fleck 1994:87). Nicht weit von ihr entfernt, wiederum in Lavafelder eingebettet ist die Ermità San Nicolas, zu finden. Eine letzte bedeutende Kapelle dieser Art, die Ermita Virgen del Pino, wurde am Südrand der Caldera oberhalb des Ortes El Paso errichtet. Es ist dies DER „heilige Wallfahrtsort für alle Einwohner des Aridanetales“. Die uralte Kiefer, die hier bis vor kurzem - mit eingearbeitetem Bildnis der Madonna - verehrt wurde, ist mittlerweile gefällt. Ein nicht unbedingt gutes Omen für das spirituelle Geschick La Palmas. Immerhin aber findet in den letzten Jahren eine langsame Rückbesinnung auf die alten Überlieferungen statt - und das lässt wiederum auf eine bessere Zukunft hoffen. | |||
Die | |||
== '''Geschichte''' == | |||
Vulkane haben die Gestalt der Insel geprägt. In diesem zerklüfteten Stück Land haben die Ureinwohner eine eigenständige Kultur entwickelt. Die Spanier wiederum brauchten länger als anderswo, um das Eiland zu unterjochen. | |||
=== ''' | === '''Altkanarische Zeit''' === | ||
La Palma wurde im Neolithikum vom Volk der ''Benahoaritas'' (auch ''Auaritas'' genannt) besiedelt, Ihre Herkunft ist nicht eindeutig abschließend geklärt - DNA-Analysen deuten auf nähere Beziehungen zu den Berber-Völkern Nordwestafrikas. Die Frage, wie sie auf die Insel kamen, ist jedoch umstritten, und es gibt zwei Hypothesen. Die erste besagt, dass sie mehr oder weniger zufällig aus eigener Kraft auf die Insel gekommen sind, während die zweite davon ausgeht, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen oder als Ergebnis von Zwangsdeportationen nordafrikanischer Stämme durch die mediterranen Zivilisation Phöniziens bzw. Karthagos absichtlich auf die Insel gebracht wurden. Archäologen haben durch die Untersuchung von Unterschieden in der Gestaltung und Verzierung der Keramik der Ureinwohner festgestellt, dass mindestens zwei Kontingente von Menschen zu verschiedenen Zeiten auf La Palma angekommen sind. So kam eine erste Menschengruppe um die Mitte des -3. Jahrtausends aus dem westlichen Maghreb und dem Nordwesten der Sahara auf die Insel, während eine zweite Gruppe um das -7. Jahrhundert aus der zentralen und nordwestlichen Sahara kam. Andererseits hat die traditionelle Archäologie Parallelen zwischen den Petroglyphen auf der Insel und denen der frühbronzezeitlichen Bevölkerung der europäischen Atlantikküste wie der Bretagne und Irlands festgestellt. Die zweite Hypothese besagt, dass die Ureinwohner La Palmas aus der alten Konföderation der Berberstämme der Hawwara stammten, was auf die sprachliche Ähnlichkeit zwischen diesem Begriff und dem Namen Benahoare zurückzuführen ist, den die ersten Siedler der Insel gaben. Im Fall der Palmeros wurde der Name Benahoare der Insel von den ersten Bewohnern gegeben. | |||
Das früheste Datum für die Besiedlung von La Palma wurde mit Hilfe der Thermolumineszenztechnik in der Höhle von Tendal in der Gemeinde San Andrés y Sauces ermittelt, die auf das -4. Jahrtausend geschätzt werden. Die ältesten eindeutig belegbaren Funde aus der Begräbnisstätte La Palmera in Tijarafe werden auf die Mitte des -3. Jahrtausends datiert. | |||
Näheres zu Gesellschaft, Felszeichnungen und Religion der Benahoaritas erfährt man im Inselmuseum, im Besucherzentrum des Nationalparks ''Caldera de Taburiente'' sowie bei ''La Zarza'' und ''La Zarcita'' (seit 1998 erster Archäologischer Park der Kanaren). Die dortigen Felsbilder faszinieren durch ihre Mäander, Labyrinthe und Figuren. Ein zweiter Archäologiepark bei der ''Höhle von Belmaco'' ist mit knapp 4000 Jahren eine weitere Fundstelle der frühen altkanarischen Kultur der Insel. | |||
Diese blieb auch abseits der benahoaritischen Welt nicht unbemerkt. Phönizische Seefahrer dürften ab etwa -1200 auf den Kanaren gelandet sein und letztlich auch La Palma erreicht haben. Der numidische König Juba ließ um -25 die Inselgruppe erkunden und der Geograf Ptolemaios verzeichnete um die Mitte des 1. Jahrhunderts La Palma als ''Iunonia'' auf seiner Weltkarte. Im 3. Jahrhundert brachen im Zuge des Niedergangs des Römischen Reichs die Beziehungen zum Mittelmeerraum ab. Es folgte eine Zeit ungestnört isolierter Entwicklung. | |||
=== '''Mittelalter''' === | |||
Erst im 10. Jahrhundert gerieten die Kanaren wieder ins Blickfeld einer fremden Macht. Diesmal waren es arabische Autoren, die von Besuchen auf den entlegenen Inseln berichteten. Eine arabische Quelle aus dem Jahr 1124 berichtete von einer Expedition acht verschwägerter Araber aus Lissabon, die nach elf Tagen Fahrt eine Insel erreichten, die als ''El-Ghanam'' bezeichnet wurde. Ob dies La Palma oder eine andere Insel war, bleibt unklar. | |||
Im Jahre 1312 erreichte der Genuese Lancelotto Malocello - Namensgeber der Insel Lanzarote - die Kanaren. Ober er auch La Palma besuchte, ist unklar. Seine Berichte über den Aerchipel lockten indes weitere Europäer an. Niccoloso da Recco, ein Berichterstatter einer portugiesischen Expedition unter König Alfons IV., erwähnte 1341 La Palma in seinen Aufzeichnungen. Er beschrieb die Insel als felsig und regenreich, betrat sie jedoch vermutlich nicht. Ebenso Gonzalo Perez Martel, der 1393 eine andalusisch-baskische Sklavenfänger-Truppe anführte, die Gran Canaria und Lanzarote überfiel, La Palma aber nicht tangierte. | |||
Zwischen 1402 und 1405 landeten die Franzosen Jean de Béthencourt und Gadifer de la Salle mehrfach für jeweils nur kurze Zeit auf der Insel. Dabei kam es zwar zu Kontakten mit der Bevölkerung, nicht aber zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die Insulaner waren zu jener Zeit in 12 Stammesgemeinschaften organisiert: Aridane, Tihuya, Tamanca, Ahenguareme, Tigalate, Tedote, Tenagua, Adeyajamen, Tagaragra, Tagalgen, Tijarafe und Aceró. Diese wurden von jeweils bis zu drei Häuptlingen - in spanischer Diktion "Königen" bzw. "Fürsten" - geführt, die den Kontakt mit den Europäern regelten. Die Gesamtbevölkerung zu jener Zeit wird auf 4.000 bis 12.000 geschätzt. Die zahlreichen Reste ihrer "steinzeitlichen" Kultur sind heute noch vorhanden: Wohnhöhlen, Grabstätten, Steinwerkzeuge und die Petroglyphen – komplexe Steinritzungen mit unbekannter Bestimmung. Bemerkenswert sind die steingepflasterten Königswege, die die gesamte Insel überziehen und die verschiedenen ehemaligen Stammesgebiete miteinander verbinden. | |||
''' | === '''Eroberung''' === | ||
Im Jahr 1445 übertrug Guillén de Las Casas seine Rechte an den Kanarischen Inseln an Hernán Peraza (el Viejo) und dessen Kinder Inés und Guillen Peraza de Las Casas. Nachdem der Lehensherr seine Macht auf Lanzarote, Fuerteventura und El Hierro gefestigt hatte, entsandte er eine Flotte aus drei Schiffen mit 500 Mann zu der Insel, die bis dahin als unbezwingbar galt. Guillén Peraza de las Casas landete Ende 1447 mit 500 Männern aus Sevilla, Lanzarote und Fuerteventura in der Nähe des heutigen Tazacorte. Aber auch dieser Feldzug blieb für Eroberer - wie die vorangegangenen - ohne Erfolg. Die Soldaten kamen auf dem bergigen Gelände nicht zurecht. Sie wurden von allen Seiten mit Speeren und Steinen beworfen und verloren bei den erbitterten Kämpfen mit den Insulanern 200 Mann. Nachdem Guillén Peraza durch einen Stein tödlich am Kopf verletzt worden war, wurde der Angriff abgebrochen. | |||
Eine Eroberung La Palmas war damit vorerest vom Tisch. Man beließ es bei einzelnen Piratenüberfällen, die allerdings nicht näher dokumentiert sind. Als kastilische Truppen im Jahr 1478 über Gran Canaria herfielen - sie brauchten fünf Jahre, um die Insel unter ihre Herrschaft zu bringen -, taten sie dies, um Klarheit über die künftigen Machtverhältnisse zu schaffen. Im Vertrag von Alcáçovas von 1479 und der päpstliche Bulle ''Aeterni regis'' vom Juni 1481 wurde Kastilien das Recht an den Kanarischen Inseln bestätigt. Zwischen dem Ende des Jahres 1491 und April 1492 bereiteten der Gouverneur von Gran Canaria Francisco Maldonado und Pedro de Valdes die Eroberung der Inseln Teneriffa und La Palma vor. Zu diesem Zweck schickten sie Francisca de Gazmira eine aus La Palma stammende Frau als Vermittlerin zu den Herrschern der Stämme La Palmasl, um sie zu veranlassen, sich taufen zu lassen und der kastilischen Herrschaft zu unterwerfen. Francisca de Gazmira kehrte von ihrer Reise mit vier oder fünf der zwölf Häuptlinge der Insel nach Gran Canaria zurück. Die benahoaritischen "Fürsten" wurden getauft und kehrten nach La Palma zurück mit dem Auftrag, die Bewohner von der Aussichtslosigkeit eines Widerstands gegen die angehenden Kolonialherren zu überzeugen. Die Einverleibung dere Insel ins spanische Imperium sollte nur noch eine Formsache sein. | |||
Am 29. September 1492 – Christoph Kolumbus entdeckte in diesem Jahr Amerika – landete der auf Gran Canaria beheimatete General Alonso Fernández de Lugo mit einer Streitmacht von 900 Mann auf La Palma in der Nähe des Strandes von Tazacorte; er war von dem spanischen Herrscherpaar Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragón zu diesem Feldzug ermächtigt. Er hatte die früher von La Palma verschleppte ''Gasmirla la Palmens'' dabei und machte falsche Versprechungen. Die Bezirke ''Aridane'', ''Tihuya'', ''Tamanca'' und ''Ahenguarem'' unterwarfen sich. Die Herrscher von ''Tigalate'' allerdings leisteten starken Widerstand. Schließlich traten alle "Fürsten" der ''Benahoaritas'', der Ureinwohner La Palmas, zum Christentum über, bis auf den Bezirk der Caldera de Taburiente, der damals ''Aceró'' (starker Ort) hieß. Diese Gegend unterstand dem berühmten Tanausú, der sich widersetzte und nur durch einen Hinterhalt gefangen genommen werden konnte. De Lugo schickte der kastilischen Krone mehrere Gefangene zum Beweis seiner Eroberung, darunter auch Tanausú, der angesichts dieser Schande in den Hungerstreik trat und noch auf der Überfahrt starb. Am 3. Mai 1493, dem „Tag der Erhebung des Heiligen Kreuzes“, gründete Lugo an dem Ort, an dem sich die altkanarische Siedlung Apunyon (auch Auprón) befand, die Stadt Santa Cruz de La Palma. Dann begab er sich nach Gran Canaria zurück, um Vorbereitungen für die Einnahme von Teneriffa zu treffen, der letzten der sieben großen Kanarischen Inseln, die er schließlich nach einem zweijährigen Feldzug 1496 eroberte. | |||
Die Benahoaritas fochten keine großen Schlachten mit den Spaniern aus, kamen deshalb nicht in Massen um und ließen sich - nicht ohne Widerstand, aber letztlich dann doch - christianisieren. Für Alonso Fernández de Lugo, der den Finanziers seines Eroberungsunternehmens reichlich Sklaven versprochen hatte, waren sie ein schlechtes Geschäft. Der Verkauf von Ureinwohnern, die getauft waren oder kurz vor der Konversion standen, war nämlich durch eine königliche Erklärung vom 20. September 1477 verboten worden. Zudem verbot ein päpstlicher Erlass aus dem Jahr 1434, in dem Eugen IV. die Kanarier zu ''freien Leuten'' erklärt hatte, den Menschenhandel auf den Kanarischen Inseln. Letztendlich konnten nur die "heidnisch" gebliebenen Kämpfer von Tanausus Stamm Aceró versklavt werden. De Lugo wollte sich damit jedoch nicht abfinden und behandelte die Ureinwohner so übel, dass sie sich zur Wehr setzten. Dies und die kolonialbeamtliche Einschätzung der Rebellen als "Konversionsunwillig" nutzte de Lugo als Vorwand, um etwa 1.200 Benahoaritas als Sklaven zu verkaufen und 20.000 Stück Vieh zu beschlagnahmen. Francisca de Gazmira erhob mehrfach Beschwerden bei Königin Isabella und König Ferdinand gegen dieses Vorgehen - und hatte damit auch Erfolg.. | |||
=== '''Kolonialzeit''' === | |||
Die Spanier nutzten die Kanaren als wichtige Zwischenstation für die Überfahrt nach Westindien. La Palma bildete dabei den letzten Außenposten. Ausschlaggebend dafür war die geografische Lage in der nördlichen Passatzone, die schon Kolumbus nutzte. Er startete seine zur Epochenwende gewordene Überfahrt am 3, August 1492 in La Gomera - La Palma hat er nie betreten. | |||
Die Insel war auch sonst für eine koloniale Erschließung eher ungünstig und vor allem unergiebig. Schnellen Reichtum bot sie wegen fehlender Bodenschätze nicht. Gewinn versprachen trootz aller Abkommen lediglich die Einheimischen – als Sklaven. Schätzungen zufolge blieben nur rund 300 Familien (1.200 Menschen) von diesem Schicksal verschont. Diese ''Palmeros'' vermischten sich, nachdem sie ab 1514 den Spaniern rechtlich gleichgestellt worden waren, rasch mit den Konquistadoren sowie mit eingewanderten Portugiesen und Franzosen. Schon bevor sich der Sklavenhandel auf der Insel erschöpft hatte, verfolgte Alonso Fernández de Lugo ein weitaus lukrativer erscheinendes Ziel: den Anbau von Zuckerrohr, zur damaligen Zeit das den meisten Gewinn bringende Agrarprodukt. Europäische Kaufleute, Handwerker, Wein- und Ackerbauern wurden auf die Insel gerufen, um Kapital und Arbeitskraft in Zuckerverarbeitungsanlagen zu investieren. Die Landvergabe erolgte dabei wie im Zeitraffer. Im Jahr 1508 zu Beispiel verkaufte Juan Fernández de Lugo seine Zuckerverarbeitungs- und Bewässerungsanlage von Tazacorte und Argual an den Andalusier Dinarte. Dieser veräußerte sie ein Jahr später an die Augsburger Welser; wiederum ein Jahr später (1510) gelangten sie in Besitz des Antwerpener Kaufmannes Jakob Groenenberch (hispanisiert Jacomo Monteverde), von dem sie schließlich das Brüsseler Handelshaus Van de Valle erwarb. | |||
Ab 1553 lohnte der Zuckerrohranbau auf La Palma immer weniger. In Mittel- und Südamerika wurde preisgünstiger produziert. Viele nicht mehr rentable Zuckerrohrplantagen wurden in Weinfelder umgewandelt. Der vor allem im Süden der Insel auf jungvulkanischem Boden gedeihende süße Malvasia wurde das wichtigste Exportprodukt von La Palma. Hauptabnehmer des palmerischen Weins war England. Dieser für die Insel recht einträgliche Handel hielt bis Mitte des 19. Jahrhunderts an, dann führte ein sich ändernder Konsumentengeschmack zum Niedergang des Weinbaus. Erst seit dem späten 20. Jahrhundert wird wieder mit zunehmendem Erfolg Wein prooduziert. | |||
Im 16. Jahrhundert bekam La Palma nach Antwerpen und Sevilla das Privileg, mit Amerika Handel zu treiben. Schnell entwickelte sich Santa Cruz de La Palma zu einem der wichtigsten Häfen des spanischen Reiches. So lockte Santa Cruz de La Palma im Laufe des 16. Jahrhunderts immer wieder Piraten an, die sich der Reichtümer der Stadt bemächtigen wollten. Unter dem Befehl von François Le Clerc plünderten Franzosen 1553 die Hafenstadt. Was sie nicht mitnehmen konnten, brannten sie nieder. Nach dieser Katastrophe wurden Kirchen, Klöster und Häuser größer und prächtiger wieder aufgebaut. Neue Verteidigungsanlagen wurden errichtet. So konnte 1585 der Angriff des Engländers Francis Drake erfolgreich abgewehrt werden. Der Handel mit Amerika begünstigte das Aufkommen weiterer Erwerbszweige (Schiffbau, Herstellung von Segeltuch undsoweiter). Zahlreiche Kaufleute aus aller Welt kamen nach Santa Cruz de La Palma und verliehen dem Ort ein internationales Flair, viele fremdländisch klingende Straßennamen zeugen noch heute von dieser Epoche. Der Niedergang setzte jedoch bereits Mitte des 17. Jahrhunderts ein. Nach einem Erlass aus dem Jahre 1657 mussten alle Schiffe auf dem Weg nach Amerika auf Teneriffa registriert werden und dort ihre Abgaben entrichten. Der Handelsverkehr im Hafen von Santa Cruz de La Palma kam damit nahezu zum Erliegen. Zwar gab König Carlos III. 1778 den Amerikahandel für alle spanischen Häfen frei, doch konnte sich Santa Cruz de La Palma nie völlig von der Wirtschaftskrise erholen. | |||
Abgesehen von Piratenangriffen erlebte La Palma weitestgehend ruhige Zeiten. Von jeder Wirtschaftskrise erholte sich das zwar bodenschatzlose, aber sehr fruchtbare Eiland immer relativ schnell. Nach Zucker und Wein ließ sich auch mit Bienenwachs und -honig, mit Tabak sowie mit Seide gutes Geld verdienen. Bereits seit dem beginnenden 16. Jahrhundert pflanzte man in La Palma Maulbeerbäume an, jetzt war La Palma führend in der Seidenherstellung der Kanaren. Die Seidenverarbeitung der Insel galt als die fortschrittlichste des Kanarischen Archipels. Um 1830 wurde die aus Mexiko stammende Cochenille-Laus eingeführt, eine Schildlaus, die einen begehrten karmesinroten Farbstoff liefert. Mit der Entwicklung von Anilinfarbe um 1880 war diesem Wirtschaftszweig jedoch nur ein kurzer Gewinn beschert. Aus dieser Wirtschaftskrise half der Bananenanbau, den die beiden Gesellschaften Elder Dempster aus England und Fyffes aus Irland ab 1878 in großem Stil auf die Kanaren brachten. | |||
Das einfache Volk auf dem Lande profitierte von dem auf La Palma erwirtschafteten Reichtum kaum. Noch im 19. Jahrhundert lebten die meisten Inselbewohner in strohgedeckten Holzhütten, selbst wohlhabende Landbewohner konnten sich nur niedrige Bruchsteinhäuser leisten. Probleme bereitete oft die Versorgung mit Lebensmitteln. Da man auf der Insel vorwiegend Monokulturen anbaute, reichte die verbleibende Ackerfläche für den Anbau von Getreide und anderen Landwirtschaftserzeugnissen nicht aus. Schon im 16. Jahrhundert musste Getreide – zu hohen Preisen – importiert werden. Als das Domkapitel von La Palma einmal seinen Zehnten in Form von Weizen aus dem Getreidespeicher forderte, weigerte sich die Bevölkerung einmütig und entschlossen, auf diese Art ihre Steuern zu begleichen, woraufhin der Inquisitor über die Insel einen Kirchenbann verhängte und – infolge einer Missernte – einige Jahre lang niemand christlich beerdigt wurde. Die Armut auf dem Lande war so groß, dass in vielen Familien die „schlecht ernährten und schlecht gekleideten“ Männer und Frauen, wie 1758 der Missionar Juan de Medinilla in einem vertraulichen Bericht an seinen Bischof schrieb, sonn- und feiertags aus Mangel an Kleidung jeweils abwechselnd zur Messe gehen mussten. | |||
=== '''Weltkriegsära''' === | |||
Der Erste Weltkrieg (1914 bis 1918) hatte erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft der Insel. Der Bananenanbau, der um 1900 einen kurzlebigen Wohlstand gebracht hatte, geriet durch die Kriegsfolgen ins Stocken. Der Außenhandel kam weitgehend zum Erliegen, was die wirtschaftliche Lage der Insel weiter verschlechterte. Während des Krieges nutzte die deutsche Marine die strategische Lage der Kanarischen Inseln, um U-Boote im Atlantik zu positionieren. Diese sollten alliierte Schiffe angreifen, die den Atlantik überquerten. Nebst anderem Kriegsgerät verbrachte die deutsche Viermastbark ''Pamir'' den Ersten Weltkrieg im Hafen von Santa Cruz de La Palma.. | |||
Die wirtschaftliche Erholung setzte erst nach dem Krieg ein, als der internationale Handel wieder aufgenommen wurde. 1927 teilte man die Kanarischen Inseln in eine West- und Ostprovinz, wobei La Palma Teil der Westprovinz Santa Cruz de Tenerife wurde. Die immer wieder von "Ausgestoßenen" als Exil auserkorene Insel war zu jener Zeit eine Hochburg linker Kräfte – in Tazacorte wählten 1936 72 % den ''Frente Popular'', und auch nach der Franco-Diktatur blieb die Insel sozialistisch geprägt. | |||
Eine besondere Rolle spielte sie zu Beginn des Spanischen Bürgerkriegs im Rahmen der sogenannten ''Semana Roja'' ("Rote Woche") vom 18. bis 25. Juli 1936. Damals gelang es den Republikanern, den Putsch der Nationalisten unter Francisco Franco vorübergehend zu verzögern. Als Nachrichten vom Putsch Francos erreichten La Palma erreichten, organisierte die ''Frente Popular'' (Volksfront) Widerstand, rief den Generalstreik aus und bildete Volksmilizen. Putschkommandant Baltasar Gómez Navarro verfügte auf der Insel nur über 25 Soldaten, während die Republikaner unter Führung des Regieerungsdelegierten Tomás Yanes Rodríguez und des kubanischen Kommunisten José Miguel Pérez in Tazacorte starken Rückhalt hatten. Als das Kanonenboot ''Canalejas'' der Falangisten die Isel ansteuerte, beschloss die Regierungsdelegation in der Hoffnung auf Verstärkung aus Madrid, keinen bewaffneten Widerstand zu leisten. Die nachfolgende Machtübernahme der Frankisten brachte harte Repressionen mit sich. Mindestens 400 Menschen wurden auf den Kanaren getötet, darunter der sozialistische Bürgermeister von Los Llanos, Francisco Rodriguez Betancort. Oppositionelle wurden in Lager wie Mauthausen deportiert - erst 2011 wurden die Überreste der 1937 hingerichteten "13 von Fuencaliente" beigesetzt. Der kanarische Autor Alexis Ravelo verarbeitete die Ereignisse 2017 im Roman ''Los milagros prohibido.'' | |||
=== '''Moderne Zeit''' === | |||
Nach dem Zweiten Weltkrieg war La Palma zeitweise starken Repressionen seitens des Franco-Regimes ausgesetzt. Die Guardie Civil spielte dabei eine zentrale Rolle. Zur politisch prekären Lage kam der wirtschaftliche Niedergang. Der Bananenanbau, seit dem späten 19. Jahrhundert wichtigster Wirtschaftszweig, war nur noch durch Subventionen wettbewerbsfähig. Dazu kamen noch Vulkanausbrüche wie der des San Juan im Jahr 1949. Alles zusammen führt zu schweren Handelseinbußen und einer neuen Auswanderungswelle nach Südamerika. Erst mit dem Entstehen eines zaghaften Tourismus ab den 1950er Jahren konnte diese Entwicklung abgebremst werden. | |||
In den 1960er und 1970 Jahren wurde die Insel zu einem Aussteiger-Domizil zivilisationsmüder "Hippies" und Öko-Freaks - vor allem aus Deutschland. Zahl,reiche Bio- und sonstige "Läden" zeugen noch heute von deren Präsenz. Nach Francos Tod 1975 wurde La Palma 1982 Teil der Autonomen Gemeinschaft der Kanarischen Inseln. Ab den 1980er Jahren entwickelte sich der - zahlenmäßig freilich begrenzt bleibende - Tourismus zu einem stabilen Wirtschaftsfaktor, während die Landwirtschaft weiterhin von EU-Subventionen abhängig blieb. | |||
Zur Corona-Zeit war ab März 2020 La Palma von den in Madrid veranlassten Maßnahmen betroffen, blieb vom "pandemischen" Geschehen ansonsten aber weitgehend verschont. eine Geringe Fallzahlen und relativ lockere Handhabung vorgeschriebener Regularien sorgten für eine weitgehend ruhige Lage. Protestaktionen gab es nur vereinzelt. | |||
Mitten in diese Krisenzeit fiel der Vulkanausbruch vom 19. September 2021, der bis zum 13. Dazember andauerte und mit 85 Tagen und 18 Stunden den längsten dokumentierten Ausbruch auf der Insel darstellte. Über 7.000 Menschen wurden evakuiert, und etwa 3.000 konnten nicht mehr in ihre zerstörten Häuser zurückkehren. Die Lava zerstörte 1.345 Gebäude, darunter Schulen und Kirchen, und bedeckte fast 1.200 Hektar Land, zum Teil agrarische Nutzflächen. Die Schäden wurden auf über 900 Millionen Euro geschätzt.. | |||
Trotz des offiziellen Endes des Ausbruchs bleibt der Vulkan unberechenbar und Gasemissionen stellen weiterhin eine Gefahr dar. Forscher entdeckten eine riesige Magmablase unter La Palma, die mit großer Wahrscheinlichkeit zukünftige Eruptionen speisen wird. Zudem könnte die Vulkanflanke langsam in den Atlantik abrutschen, was weitere Risiken weit übere die Insel hinaus birgt. La Palma bleibt also ein Unruheherd. | |||
=== '''Chronologie''' === | |||
-2 mio. Hebung der Insel über die Meeresoberfläche | |||
-500.000 Der Taburiente ragt 3500 m über die Meeresoberfläche | |||
-2000 Möglicherweise Entdeckung der Insel durch mediterrane Megalithiker | |||
-4. Jh. Vermutlich Wiederentdeckung durch karthagische Seefahrer | |||
um -240 Besiedlung durch Altkanarier von Tenerife aus | |||
ab -200 Etablierung der urpalmerischen Kultur der „Benahoaritas“ | |||
um 1300 Die Insel ist in 12 benahoaritische Stammesdistrikte aufgeteilt | |||
1342/45 Schiffe des aragonischen Königs Pedro IV. ankern vor La Palma | |||
1402 Die spanische Krone erhebt Anspruch auf die gesamten Kanarischen Inseln | |||
1405 Ein erster Versuch Jean de Béthencourts, La Palma zu erobern, scheitert | |||
1407 Auch Béthencourts Neffe Maciot wird von den Benahoaritas zurückgeschlagen | |||
1443 Der Portugiese Conde Mandellacastillo wird bereits vor der Landung verjagt | |||
1447 Hernán Peraza muss sich nach schweren Verlusten zurückziehen | |||
1477 La Palma wird als „Isla Real“ formell direkt der spanischen Krone unterstellt | |||
um 1480 Lava entströmt der Montaña Quemada über Tacande | |||
1491 Alonso Fernández de Lugo erhält die Ermächtigung zur Eroberung La Palmas | |||
29.9.1492 Beginn der Conquista, in deren Folge Tausende Auaritas versklavt werden | |||
April 1493 Der letzte benahoaritische Häuptling Tanausu wird durch List überrumpelt | |||
3.5.1493 Offizielles Ende der Conquista | |||
Mai 1493 Gründung von Santa Cruz an Stelle der benahoaritischen Siedlung Apunyon | |||
1496 A.F. de Lugo macht seinen Neffen Juan zum Statthalter von La Palma | |||
ab 1496 La Palma untersteht formell dem Gouverneur von Teneriffa | |||
1508 Die Handelsbeschränkungen betreffs Amerika fallen | |||
ab 1508 Santa Cruz de la Palma entwickelt sich zu einer blühenden Handelsmetropole | |||
1509 Beginn der Landesveräußerung an flämische und deutsche Handelshäuser | |||
um 1510 Beginn des Zuckerrohranbaus durch den Kölner Jacob Grunenberg | |||
1514 Rechtliche Gleichstellung der Altkanarier mit den Spaniern | |||
um 1520 Die benahoaritische Kultur geht in der spanisch-christlichen auf | |||
ab 1520 Politisch und religiös Verfolgte Mitteleuropäer lassen sich La Palma nieder | |||
ab 1545 Die Kammwälder werden durch Beweidung nach und nach zerstört | |||
1553 Verheerender Überfall der französischen Piraten Le Clerq und Pie de Palo | |||
ab 1554 Der Zuckerrohranbau geht zurück, wird durch Weinbau ersetzt | |||
1556 In Santa Cruz wird die erste öffentliche Grammatikschule eröffnet | |||
1560 Luis Van de Walle stiftet ein „Getreidedepot der Armen“ | |||
1566 La Palma wird Sitz eines königlichen Verzollungs- bzw. Registergerichts | |||
1585 Eine Attacke des englischen Korsaren Francis Drake wird abgewehrt; Eruption des Tahuya | |||
1590 Der Flame Aventrot wird wegen seines Freiheitsstrebens ausgewiesen | |||
1599 Letzter großer Piratenüberfall durch den holländischen Admiral van der Does | |||
1610 Limitierung des Amerikahandels auf den gesamten Kanarischen Inseln | |||
ab 1610 Die palmerische Wirtschaft stagniert | |||
ab 1620 24 adelige Vogtsfamilien verprassen die Einkünfte aus der Pacht für die Insel | |||
1618 Ein algerischer Pirat wird noch auf See zurückgeschlagen | |||
1655 - 1667 Eine englische Gesellschaft monopolisiert den kanarischen Weinexport | |||
1657 Schließung des Registergerichts von Santa Cruz | |||
1659/60 Heuschrecken fressen die Insel kahl | |||
1677/78 Aus dem Explosionskrater des San Antonio bei Fuencaliente fließt Lava | |||
1712 Die Eruption des El Charco hinterlässt 12 Schlünde | |||
ab 1715 Der Weinexport geht zurück, die palmerische Wirtschaft liegt darnieder | |||
1752 Bei Mazo werden altkanarische Felsbilder und Inschriften entdeckt | |||
1760 Von Spanien ausgehend beginnt eine Phase politischer Liberalisierung | |||
1771 O’Daly erreicht durch eine Klage die Absetzung der absolutistischen Vögte | |||
1773 In Santa Cruz tagt der erste demokratisch gewählte Lokalrat Spaniens | |||
1778 König Carlos III. gibt den Amerikahandel wieder frei | |||
ab 1778 Die palmerische Wirtschaft erholt sich langsam | |||
ab 1808 Kurzzeitige Eigenverwaltung durch eine gewählte Inselversammlung | |||
1.9.1808 Absetzung des tenerifensischen Gouverneurs | |||
1811/12 Eine große Heuschreckenplage sucht die Insel heim | |||
1820 Legendäre Predigt des Manuel Diaz Hernández für mehr Demokratie | |||
1821 Hernándet errichtet eine erste kostenlose Volksschule | |||
1823 Die „liberalen Umtriebe“ werden durch Gouverneur Van de Walle gestoppt | |||
1829 Der tenerifensische Bischof kämpft per Hirtenbrief gegen die „Unmoral“ | |||
um 1830 Die Cochenille-Zucht löst den Weinexport als Haupteinnahmequelle ab | |||
1836 In Santa Cruz wird die erste Musikschule der Insel eingerichtet | |||
ab 1836 Die politische Liberalisierung in Spanien wird auch auf La Palma spürbar | |||
1841 Gründung der ersten Druckerei auf La Palma | |||
1844/45 Eine Heuschreckenplage verursacht Not und Hunger auf der Insel | |||
1852 Faulschimmel legt die Weinproduktion lahm; die Kanarischen Inseln werden Freihandelszone | |||
1863 Gründung der ersten palmensischen Wochenzeitung „El Time“ | |||
1878 Mehltau vernichtet die Weinproduktion endgültig | |||
um 1880 Der Cochenille-Handel kommt zum Erliegen | |||
1881 Eröffnung der „Cosmologica“, eines Museums mit Bibliothek | |||
1893 Mit dem Wasserkraftwerk von Barranco del Rio wird La Palma elektrifiziert | |||
1896 Einführung des Bananenanbaus durch englische Handelsfirmen | |||
1908 Streik der Tabakarbeiter gegen soziale Missstände | |||
1912 La Palma erhält spezielle Selbstverwaltungsrechte | |||
1927 Neuordnung der kanarischen Provinzen - La Palma kommt zu Tenerife | |||
1931 Bei den Gemeinderatswahlen erhalten die Monarchisten 51 von 65 Ratssitzen | |||
1932 Die kommunistische Federación de Trabajadores de La Palma tagt erstmals | |||
1936 Nach einwöchigen Kämpfen übernehmen Frankisten die Herrschaft | |||
25.6.1949 San Juan-Eruption am nördlichen Ende des Cumbre Vieja | |||
ab 1950 Auf La Palma wird wieder verstärkt in wirtschaftliche Projekte investiert | |||
1954 Gründung des Parque Nacional de la Caldera de Taburiente | |||
1966 Inbetriebnahme eines erdölbetriebenen Kraftwerkes bei Santa Cruz | |||
1970 Eröffnung eines internationalen Flughafens in Mazo | |||
24.10.1971 An der Südspitze La Palmas entsteht ein neuer Vulkan, der Teneguía | |||
ab 1975 Langsame Demokratisierung nach Francos Tod | |||
25.3.1981 Der 4690 ha große Nationalpark der Caldera wird gesetzlich verankert | |||
1982 Kanarisches Autonomiestatut mit neuer Sonderrechtsregelung für La Palma; die konservative Wahlmehrheit wird erstmals gebrochen | |||
1983 Einrichtung des 511 ha großen Biosphärenreservats Canal y Los Tilos | |||
1986 Beim Beitritt Spanien zur EG bleiben die Kanaren ausgeklammert | |||
ab 1986 Bürgerinitiativen finden verstärkt Zulauf | |||
1987 Große Protestaktionen anlässlich des ersten Charterfluges aus Deutschland | |||
1987 Auf den Kanarischen Inseln wird die Ehescheidung gesetzlich verankert | |||
1987 Errichtung des ersten Teleskops („NOT“) auf dem Roque de los Muchachos | |||
1987 Gründung der Naturschutzgruppe „Irichen“ („Weizen“) | |||
1987/89 Auf La Palma werden insgesamt 31 Naturschutzgebiete eingerichtet | |||
24.1.1991 Das Gesetz über den Artenschutz wird erlassen | |||
1991 Gründung der ersten palmerischen Frauengruppe in Santa Cruz | |||
1992 Entdeckung eines riesigen unterirdischen Wasserreservoirs in der Caldera; erstmalige Einführung einer geordneten Müllabfuhr | |||
1992/93 Die Ruta del Norte wird als letztes Teilstück der Inselrundfahrt asphaltiert | |||
1993 Integration der Kanaren und damit La Palmas in die Europäische Union; Gründung des ökologisch orientierten „Verbands Junger Unternehmer“ (AJE) | |||
== '''Verwaltung''' == | |||
La Palma ist seit 1927 eine selbstverwaltete Insel der Provincia Santa Cruz de Tenerife (Provinz Santa Cruz), die seit 1983 Teil der Region Autonoma de los Canares (Autonome Region der Kanarischen Inseln) des Königreichs Spanien (Reino de España) ist. | |||
'''Herrschaftsgeschichte''' | |||
* um -200 bis April 1493 eigenständige benahoaritische Häuptlingstümer ("Königreiche") | |||
* 1402 und 1477 Anspruch des Königreichs Kastilien (''Reino de Castilla'') auf La Palma | |||
* April 1493 bis 27. Juli 1496 Kolonie La Palma (''Colonia de San Miguel de La Palma'') des Königreichs Spanien (''Reino de España'') | |||
* 27. Juli 1496 bis 27. Januar 1822 La Palma als Teil der Kronolonie Kanarische Inseln (''Islas Canarias de Realengo'') des Königreichs Spanien (''Reino de España'') | |||
* 27. Januar 1822 bis 17. März 1852 Provinz Kanarische Inseln (''Provincia de Canarias'') des Königreichs Spanien (''Reino de España'') | |||
* 17. März 1852 bis 3. März 1854 Provinz Westliche Kanaren (''Provincia des Canarias Occidentales'') des Königreichs Spanien (''Reino de España'') | |||
* 3. März 1854 bis 23. September 1927 gesamtkanarische Provinz Santa Cruz de Tenerife (''Provincia de Santa Cruz de Tenerife'') des Königreichs Spanien (''Reino de España'') | |||
* 23. September 1927 bis 16. August 1982 westkanarische Provinz Santa Cruz de Tenerife (''Provincia de Santa Cruz de Tenerife'') des Königreichs Spanien (''Reino de España'') | |||
* seit 16. August 1982 Inselgemeinschaft La Palma (''Comunidad Insular de La Palma'') innerhalb der Provinz Santa Cruz de Tenerife (''Provincia de Santa Cruz de Tenerife'') der Autonomen Gemeinschaft Kanarische Inseln (''Comunidad Autónoma de Canarias'') des Königreichs Spanien (''Reino de España'') | |||
=== '''Legislative und Exekutive''' === | |||
Der '''Cabildo Insular de La Palma''' (Inselrat von La Palma) besteht aus 21 Abgeordneten, die direkt von der Bevölkerung in einer Listenwahl gewählt werden. Die Hauptfunktionen und Organe des Cabildo Insular von La Palma sind: | |||
* El Pleno: Die Versammlung besteht aus allen 21 gewählten Abgeordneten und fungiert als gesetzgebende Versammlung der Insel. | |||
* Las Comisiones del Pleno: Ausschüsse, die aus Vertretern der verschiedenen im Plenum vertretenen Parteien bestehen und Beschlüsse vorbereiten. | |||
* El Consejo del Gobierno: Der Regierungsrat ist das Exekutivorgan des Cabildos und besteht aus Mitgliedern der Mehrheitspartei bzw. der Koalitionsparteien. | |||
Der Cabildo Insular de La Palma ist zuständig für alle Bereiche, die die Insel in ihrer Gesamtheit betreffen, darunter Wirtschaft, Verkehr, Tourismus, Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Umweltschutz, Raumplanung, Soziales, Kultur und Sport1. Zudem fördert er die aktive Bürgerbeteiligung in Entscheidungsprozessen und bei der Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten auf der Insel. | |||
=== '''Inseloberhaupt''' === | |||
Höchster Repräsentant der Insel ist seit 1983 der Präsident der Inselregierung (''Presidente del Cabildo Insular de La Palma''). Er repräsentiert das Cabildo in der Öffentlichkeit, bestimmt die Richtlinien der Politik und leitet die Verwaltung. | |||
'''Presidentes del Cabildo Insular de La Palma''' | |||
* 1979 - 1982 Gregorio Guadalupe Rodríguez, Coalición Canaria | |||
* 1982 - 1991 José Ernesto Luis González Afonso, Partido Popular | |||
* 1991 - 1993 Gregorio Guadalupe Rodríguez, Coalición Canaria | |||
* 1993 - 1996 Felipe Hernández Rodríguez, Partido Socialista Obrero Español | |||
* 1996 - 2009 José Luis Perestelo Rodríguez, Coalición Canaria | |||
* 2009 - 2013 Guadalupe González Taño, Coalición Canaria | |||
* 2013 - 2019 Anselmo Pestana Padrón, Partido Socialista Obrero Español | |||
* 2019 Nieves Lady Barreto Hernández, Coalición Canaria | |||
* seit 2019 Mariano Hernández Zapata, Partido Popular | |||
=== '''Politische Gruppierungen und Wahlen''' === | |||
Auf La Palma sind folgende Parteien aktiv: | Auf La Palma sind folgende Parteien aktiv: | ||
| Zeile 1.000: | Zeile 1.050: | ||
* Partido Socialista Obrero Español (PSOE): eine der etablierten Parteien auf La Palma, die 5 Abgeordnete im Inselparlament stellt. | * Partido Socialista Obrero Español (PSOE): eine der etablierten Parteien auf La Palma, die 5 Abgeordnete im Inselparlament stellt. | ||
* Partido Popular (PP): ebenfalls eine bedeutende Partei auf der Insel mit 5 Abgeordneten im Inselparlament. | * Partido Popular (PP): ebenfalls eine bedeutende Partei auf der Insel mit 5 Abgeordneten im Inselparlament. | ||
=== '''Justizwesen und Kriminalität''' === | |||
Der Oberste Gerichtshof der Kanarischen Inseln hat seinen Sitz in den beiden Hauptstädten des Archipels und auch die wichtigsten Kammern sind in Las Palmas de Gran Canaria und Santa Cruz de Tenerife angesiedelt. Für La Palma bedeutet das, dass komplexere oder schwerwiegende Fälle oft an die Gerichte in den größeren Städten oder auf andere Inseln verwiesen werden. Vor Ort gibt es lokale Polizeistationen, etwa in Los Llanos, wo aktuell die Arrestzellen ausgebaut werden, um die Kapazitäten zu erhöhen. Dies soll die Sicherheit verbessern und die Arbeitsbedingungen der Beamten optimieren. Auch spezielle Räume, etwa für Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt, werden modernisiert5. Die Polizei auf La Palma besteht aus der lokalen Polizei, der Guardia Civil und seit 2024 verstärkt auch aus Beamten der Policía Canaria, die gemeinsam zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt werden. | |||
Die Kriminalität auf La Palma ist zuletzt deutlich gestiegen. Im Jahr 2023 wurden 2.229 Straftaten registriert – ein Anstieg um 33,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt La Palma kanarenweit an der Spitze des Kriminalitätsanstiegs, während der Durchschnitt auf dem Archipel bei einem Plus von 6 Prozent lag. Besonders auffällig war der Anstieg bei Internetdelikten (Cyberkriminalität), insbesondere Computerbetrug. Die häufigsten Delikte auf La Palma sind Diebstahl, Drogenhandel und Drogenbesitz. Die Polizei reagiert mit verstärkten Patrouillen, insbesondere in Randgebieten und in Häfen. Auch eine Hundestaffel wird im Hafen von Tazacorte eingesetzt. Im Vergleich zu anderen Kanarischen Inseln ist die Kriminalitätsrate in der Provinz Teneriffa, zu der La Palma gehört, überproportional gestiegen (+28 % im Jahr 2022). Auf den Kanaren insgesamt sind Diebstähle, Einbrüche und Sexualdelikte die häufigsten Straftaten. | |||
Die Kanarischen Inseln weisen laut einer aktuellen Studie die höchste Verbreitung politischer Korruption in Spanien auf. 69,3 Prozent der Gemeinden waren in Korruptionsfälle verwickelt, wobei 85,2 Prozent dieser Fälle auf kommunaler Ebene stattfanden. Besonders betroffen ist der Bereich Stadtplanung, gefolgt von Diebstahl öffentlicher Gelder und unerlaubten Absprachen bei öffentlichen Ausschreibungen. Von den abgeschlossenen Verfahren endeten 62 mit einer Verurteilung, wobei fast 63 Prozent dieser Urteile Haftstrafen zur Folge hatten. Die Justiz auf La Palma steht angesichts des Anstiegs der Kriminalität und der besonderen Herausforderungen – etwa durch die steigende Zahl von Migranten und die Überlastung der Aufnahmezentren – unter Druck. Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, NGOs und Justiz wird als herausragend beschrieben, insbesondere bei der Bewältigung der Migrationskrise und dem Schutz Minderjähriger. | |||
=== '''Flagge und Wappen''' === | === '''Flagge und Wappen''' === | ||
| Zeile 1.009: | Zeile 1.066: | ||
=== '''Hauptstadt''' === | === '''Hauptstadt''' === | ||
Hauptstadt der Insel ist seit ihrer Gründung am 3 Mai 1493 '''Santa Cruz de La Palma'''. | Hauptstadt der Insel ist seit ihrer Gründung am 3 Mai 1493 '''Santa Cruz de La Palma'''. Die Stadt entstand im Zuge der spanischen Kolonialisierung der Kanaren nach der Eroberung der Insel durch Alonso Fernández de Lugo zwischen 1492 und 1493. Sie wurde als zentraler Hafen- und Handelsort geplant und hat ihren Status als Hauptstadt nie verloren. Historisch war sie im 16. und 17. Jahrhundert einer der wichtigsten Seehäfen des Spanischen Reiches, was ihren Status festigte. | ||
=== '''Verwaltungsgliederung''' === | === '''Verwaltungsgliederung''' === | ||
La Palma besteht aus 14 Gemeinden | La Palma besteht aus 14 Gemeinden: | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Municipio''' | |||
|'''Fläche (km²)''' | |||
|'''Einwohner 2017''' | |||
|'''Dichte (E/km²)''' | |||
|- | |||
|Barlovento | |||
|43,55 | |||
|1.859 | |||
|42,69 | |||
|- | |||
|Breña Alta | |||
|30,82 | |||
|7.061 | |||
|229,10 | |||
|- | |||
|Breña Baja | |||
|14,2 | |||
|5.434 | |||
|382,68 | |||
|- | |||
|El Paso | |||
|135,92 | |||
|7.464 | |||
|54,91 | |||
|- | |||
|Fuencaliente | |||
|56,42 | |||
|1.695 | |||
|30,04 | |||
|- | |||
|Garafía | |||
|103,0 | |||
|1.584 | |||
|15,38 | |||
|- | |||
|Los Llanos de Aridane | |||
|35,79 | |||
|20.107 | |||
|561,83 | |||
|- | |||
|Puntagorda | |||
|31,1 | |||
|2.009 | |||
|64,60 | |||
|- | |||
|Puntallana | |||
|35,1 | |||
|2.429 | |||
|69,20 | |||
|- | |||
|San Andrés y Sauces | |||
|42,75 | |||
|4.135 | |||
|96,73 | |||
|- | |||
|Santa Cruz de La Palma | |||
|43,38 | |||
|15.581 | |||
|359,22 | |||
|- | |||
|Tazacorte | |||
|11,37 | |||
|4.620 | |||
|406,33 | |||
|- | |||
|Tijarafe | |||
|53,76 | |||
|2.590 | |||
|48,18 | |||
|- | |||
|Villa de Mazo | |||
|71,17 | |||
|4.782 | |||
|67,18 | |||
|- | |||
|'''La Palma''' | |||
|'''708,32''' | |||
|'''81.350''' | |||
|'''114,85''' | |||
|} | |||
'''Verwaltungseinheiten''': | '''Verwaltungseinheiten''': | ||
| Zeile 1.224: | Zeile 1.342: | ||
Ausländer 6 089 7,72 % | Ausländer 6 089 7,72 % | ||
'''Lebenserwartung''' 1996: | |||
* insgesamt 76,15 Jahre | |||
* Frauen 80,84 | |||
* Männer 71,54 | |||
* mittleres Alter 2002: 35 Jahre | |||
'''Haushalte 1990:''' | |||
* Gesamtzahl der Gebäude 24 262 | |||
* davon Einfamilienhäuser 22 662 | |||
* Personen pro Gebäude 3,251 | |||
* Wohnunghen 30 412 | |||
* Personen pro Wohnung 2,706 | |||
* Gesamtzahl der Familien 18 807 | |||
* Personen pro Familie 4,019 | |||
=== '''Volksgruppen''' === | |||
Die Bewohner La Palmas, zumindest jene, die hier „eingeboren“ sind, also in einer der 14 Inselgemeinden zur Welt, werden üblicherweise als ''Palmeros'' bezeichnet. Seit den 1960er Jahren hat sich die Insel zu einer Art „Aussteigerparadies“ entwickelt. Vor allem Deutsche haben sich hier angesiedelt und sichtbare Spuren hinterlassen. Die Zahl der Ausländere betrug im Jahr 2023 insgesamt 10.053, was einem Bevölkerungsanteil von 11,92 % entspricht. | |||
'''Ausländer''' 2011: | |||
* Venezuela 4.736 | |||
* Deutschland 4.392 | |||
* Kuba 1523 | |||
* Kolumbien 746 | |||
* Großbritannien 534 | |||
* Italien 340 | |||
* Schweiz 292 | |||
* Marokko 220 | |||
* Niederlande 210 | |||
* Frankreich 184 | |||
* Belgien 138 | |||
* Argentinien 133 | |||
* Portugal 122 | |||
Die Ureinwohner der Insel werden in der Fachliteratur ''Benahoaritas'' genannt - frühere Bezeichnungen wie ''Auaritas'', ''Avaritas'' oder ''Awaras'' sind nicht mehr gebräuchlich. Sie waren veremutlich mit den Berbern verwandt und siedelten sich ab dem -4. Jahrhundert auf der Insel an. Hier entwickelten sie äußerst komplexe soziale Strukturen und organisierten sich in Stammesgemeinschaften und Clans. Was das Aussehen der Benahoaritas betrifft, so heißt es in den frühen Kolonialberichten, dass sie die am größten gewachsene Ureinwohnergruppe der Kanarischen Inseln waren (Rodriguez 1992:13). Wissenschaftliche Studien an menschlichen Knochen aus der Zeit vor der Wiederentdeckung der Inseln durch die Europäer ermittelten eine mittlere Größe von 1,70 m für Männer und 1,65 für Frauen. | |||
Die Benahoaritas waren hauptsächlich Viehzüchter, im Speziellen Ziegenhirten. Sie lebten in natürlichen Höhlen und nutzten diese auch als Lagerstätten und Grabstätten. Ihre Nahrung bestand hauptsächlich aus Milch, Butter, Ziegen- und Schweinefleisch. Sie stellten Keramik her und trugen Ledertuniken oder Binsenkleidung. Die Benahoaritas praktizierten die Mumifizierung, insbesondere bei hochgestellten Persönlichkeiten. | |||
Auf La Palma gibt es noch heute archäologische Spuren der Benahoaritas, wie steingepflasterte Wege, die als Königswege bezeichnet werden, sowie Grabstätten und Steinritzungen. Diese Spuren zeugen von einer reichen Kultur, die jedoch nach der spanischen Eroberung weitgehend verloren ging. Trotz des Verlusts ihrer Kultur wird der letzte König der Benahoritas, Tanausú, noch heute verehrt. Die Geschichte und das Erbe der Benahoaritas sind ein wichtiger Teil der Identität La Palmas und werden durch Museen und archäologische Stätten bewahrt | |||
=== '''Sprachen''' === | |||
Offizielle Amtssprache ist Spanisch. Im Alltag gesprochen wird die palmerische Unterart des kanarischen Dialekts. Der Akzent klingt hier vergleichsweise melodischer, fast wie ein Singen. Obwohl die ursprüngliche Sprache der altkanarischen Ureinwohner ausgestorben ist, haben sich einige Wörter im heutigen kanarischen Dialekt erhalten. Zudem finden sich im kanarischen Dialekt, einschließlich des auf La Palma gesprochenen, Elemente aus dem lateinamerikanischen Spanisch. | |||
# Phonetische Besonderheiten: | |||
#* Aspiration des /s/-Lautes am Silbenende und vor Konsonanten | |||
#* Stimmhaftwerden stimmloser Plosive (/p,t,k/ werden zu /b,d,g/) | |||
#* Verlust des intervokalischen /d/ | |||
# Grammatikalische Merkmale: | |||
#* Häufige Verwendung von Diminutiven mit den Endungen -ito oder -illo | |||
#* Ersetzung von Possessivpronomen durch Dativformen | |||
#* Bevorzugung bestimmter Zeitformen wie Presente, Indefinido und Imperfecto | |||
# Lexikalische Besonderheiten: | |||
#* Verwendung des Verbs "aquellar", das n''ur noch auf La Palma zu finden i''st | |||
#* Einflüsse aus dem Portugiesischen, wobei La Palma neben Teneriffa die meisten "Lusismen" aufweist | |||
Die Sprache der Benahoariten, ''Ahuwwâra'' genannt, gehörte zur berberischen Sprachfamilie. In der Isolation entwickelte sie sich zu einem eigenständigen Idiom, das auf den anderen Inseln nur bedingt verständlich war. Im 17. Jahrhundert starb die Sprache aus. Nur wenige Begriffe - wie etwa ''roque'' für "Klippe" - überlebten. | |||
=== '''Religion''' === | |||
Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist römisch-katholisch. Die Insel gehört zur Diözese San Cristóbal de La Laguna mit Sitz auf Tenerife. Kirchen gibt es in allen Gemeinden, in Santa Cruz sogar sechs mit der Iglesia Matrz de El Salvador als Hauptkirche. Das Festleben der Palmeros ist stark nach dem christlichen Kalender ausgerichtet. In regelmäßigen Abständen werden die Heiligen aus bestimmten Kirchen mit Prozessionen geehrt. Diese Veranstaltungen verlaufen über mehrere Tage und werden durch ein Rahmenprogramm und ausgelassene Feiern begleitet. | |||
Neben der katholischen Kirche gibt es auf La Palma auch andere christliche Konfessionen und Religionsgemeinschaften: | |||
* diverse evangelische Kirchen | |||
* Russisch- und Rumänisch-Orthodoxe Kirche | |||
* Zeugen Jehovas mit einigen wenigen Mitgliedern | |||
* Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) mit ebenfalls nur wenigen Mitgliedern | |||
Darüber hinaus gibt es auf La Palma kleinere Gemeinschaften anderer Religionen wie Islam, Hinduismus und Buddhismus, wobei deren genaue Zahlen nicht bekannt sind. | |||
== '''Siedlungen''' == | |||
Die Einwohnerzahlen der Gemeinden entwickelte sich wie folgt: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Gemeinde''' | |'''Gemeinde''' | ||
|'''1900''' | |||
|'''1910''' | |||
|'''1920''' | |||
|'''1930''' | |||
|'''1940''' | |||
|'''1950''' | |||
|'''1960''' | |'''1960''' | ||
|'''1970''' | |'''1970''' | ||
| Zeile 1.304: | Zeile 1.437: | ||
|'''2010''' | |'''2010''' | ||
|'''2012''' | |'''2012''' | ||
|'''2020''' | |||
|- | |- | ||
|Barlovento | |Barlovento | ||
|1.986 | |||
|2.111 | |||
|2.414 | |||
|2.663 | |||
|3.069 | |||
|3.193 | |||
|2.764 | |2.764 | ||
|2.736 | |2.736 | ||
| Zeile 1.315: | Zeile 1.455: | ||
|2.296 | |2.296 | ||
|2.085 | |2.085 | ||
|1.926 | |||
|- | |- | ||
|Breña Alta | |Breña Alta | ||
|2.589 | |||
|2.863 | |||
|3.078 | |||
|3.437 | |||
|3.843 | |||
|4.049 | |||
|4.762 | |4.762 | ||
|4.290 | |4.290 | ||
| Zeile 1.326: | Zeile 1.473: | ||
|7.347 | |7.347 | ||
|7.298 | |7.298 | ||
|7.247 | |||
|- | |- | ||
|Breña Baja | |Breña Baja | ||
|1.816 | |||
|2.001 | |||
|1.839 | |||
|2.042 | |||
|2.364 | |||
|2.405 | |||
|2.505 | |2.505 | ||
|2.632 | |2.632 | ||
| Zeile 1.337: | Zeile 1.491: | ||
|5.259 | |5.259 | ||
|5.492 | |5.492 | ||
|5.821 | |||
|- | |- | ||
|Fuencaliente | |Fuencaliente | ||
|1.650 | |||
|1.833 | |||
|1.841 | |||
|1.966 | |||
|2.212 | |||
|2.270 | |||
|1.943 | |1.943 | ||
|1.749 | |1.749 | ||
| Zeile 1.348: | Zeile 1.509: | ||
|1.898 | |1.898 | ||
|1.840 | |1.840 | ||
|7.623 | |||
|- | |- | ||
|Garafía | |Garafía | ||
|2.718 | |||
|3.024 | |||
|3.240 | |||
|3.800 | |||
|4.419 | |||
|4.884 | |||
|4.405 | |4.405 | ||
|3.222 | |3.222 | ||
| Zeile 1.359: | Zeile 1.527: | ||
|1.714 | |1.714 | ||
|1.654 | |1.654 | ||
|1.751 | |||
|- | |- | ||
|Los Llanos de Aridane | |Los Llanos de Aridane | ||
|6.638 | |||
|7.214 | |||
|6.912 | |||
|5.786 | |||
|6.614 | |||
|7.696 | |||
|9.886 | |9.886 | ||
|12.118 | |12.118 | ||
| Zeile 1.370: | Zeile 1.545: | ||
|20.948 | |20.948 | ||
|20.895 | |20.895 | ||
|1.730 | |||
|- | |- | ||
|El Paso | |El Paso | ||
|4.038 | |||
|4.399 | |||
|4.665 | |||
|4.885 | |||
|5.087 | |||
|5.407i | |||
|5.591 | |5.591 | ||
|5.534 | |5.534 | ||
| Zeile 1.381: | Zeile 1.563: | ||
|7.837 | |7.837 | ||
|7.874 | |7.874 | ||
|20.760 | |||
|- | |- | ||
|Puntagorda | |Puntagorda | ||
|1.341 | |||
|1.359 | |||
|1.508 | |||
|1.633 | |||
|1.531 | |||
|1.706 | |||
|1.593 | |1.593 | ||
|1.287 | |1.287 | ||
| Zeile 1.392: | Zeile 1.581: | ||
|2.177 | |2.177 | ||
|1.940 | |1.940 | ||
|2.203 | |||
|- | |- | ||
|Puntallana | |Puntallana | ||
|2.152 | |||
|2.225 | |||
|2.230 | |||
|2.318 | |||
|2.494 | |||
|2.632 | |||
|2.321 | |2.321 | ||
|2.078 | |2.078 | ||
| Zeile 1.403: | Zeile 1.599: | ||
|2.425 | |2.425 | ||
|2.428 | |2.428 | ||
|2.553 | |||
|- | |- | ||
|San Andrés y Sauces | |San Andrés y Sauces | ||
|3.409 | |||
|3.977 | |||
|4.160 | |||
|4.616 | |||
|5.568 | |||
|5.990 | |||
|6.208 | |6.208 | ||
|5.399 | |5.399 | ||
| Zeile 1.414: | Zeile 1.617: | ||
|4.874 | |4.874 | ||
|4.637 | |4.637 | ||
|4.182 | |||
|- | |- | ||
|Santa Cruz de la Palma | |Santa Cruz de la Palma | ||
|7.024 | |||
|7.542 | |||
|7.258 | |||
|7.951 | |||
|11.605 | |||
|11.524 | |||
|12.967 | |12.967 | ||
|13.163 | |13.163 | ||
| Zeile 1.425: | Zeile 1.635: | ||
|17.128 | |17.128 | ||
|16.705 | |16.705 | ||
|15.695 | |||
|- | |- | ||
|Tazacorte | |Tazacorte | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|3.104 | |||
|3.728 | |||
|4.067 | |||
|4.587 | |4.587 | ||
|4.644 | |4.644 | ||
| Zeile 1.436: | Zeile 1.653: | ||
|5.697 | |5.697 | ||
|4.957 | |4.957 | ||
|4.601 | |||
|- | |- | ||
|Tijarafe | |Tijarafe | ||
|2.552 | |||
|2.694 | |||
|2.766 | |||
|2.733 | |||
|2.937 | |||
|3.041 | |||
|2.873 | |2.873 | ||
|2.662 | |2.662 | ||
| Zeile 1.447: | Zeile 1.671: | ||
|2.769 | |2.769 | ||
|2.765 | |2.765 | ||
|2.507 | |||
|- | |- | ||
|Villa de Mazo | |Villa de Mazo | ||
|4.081 | |||
|4.510 | |||
|4.651 | |||
|4.850 | |||
|5.062 | |||
|4.947 | |||
|4.726 | |4.726 | ||
|3.564 | |3.564 | ||
| Zeile 1.458: | Zeile 1.689: | ||
|4.955 | |4.955 | ||
|4.898 | |4.898 | ||
| | |4.859 | ||
|} | |} | ||
[[Datei:Santa Xruz de La Palma.png|rechts|Santa Cruiz de la Palma]] | |||
In der Hauptstadt '''Santa Cruz de La Palma''' an der zentralen Ostküste lebt rund ein Fünftel der plamerischen Bevölkerung. Der Ort liegt unterhalb der bewaldeten Berghänge der ''Cumbres'' auf der östlichen Seite der Insel. Die Bebauung reicht vom schmalen Uferstreifen bis ins bergige Gebiet. Der Altstadtkern ist ein kunsthistorisches Baudenkmal. Die Hauptdurchgangsstraße ist die Avenida Marítima, die nur auf der Landseite bebaute Uferstraße. Hier befinden sich neben neuen Gebäuden einige alte Häuser im kanarischen und kolonialen Stil mit kunstvoll verzierten Holzbalkonen. Auf der parallel verlaufenden Calle O’Daly, auch als Calle Real bezeichnet, befinden sich das Rathaus (im 16. Jahrhundert unter der Herrschaft von Philipp II. errichtet), die Plaza de España mit der Hauptkirche El Salvador, kleine Geschäfte, Cafeterias und Restaurants. Gegründet wurde die Stadt am 3. Mai 1493 von Alonso Fernández de Lugo. Sie entwickelte sich zunächst zu einem Handels- und Schmuggelzentrum, ehe sie ab Mitte des 17. Jahrhunderts einen wirtschaftlichen Niedergang erlebte. Erst durch den 1778 einsetzenden Amerikahandel konnte sich die Stadt wieder erholen. Heute ist sie mit ihrem nahegelenen Flughafen das „Eingangstor“ zur Insel. | |||
'''Los Llanos de Aridane''', die größte Ortschaft auf La Palma, liegt im Tal von Aridane auf der windabgewandten und sonnigen Seite der Insel, was eine sehr günstige Lage ist, abgesehen von der Tatsache, dass der westliche Teil der Insel recht gut bewässert ist und niedrigere Hänge hat als die anderen Gebiete, daher der Name der Stadt. Sie entstand 1522, als Jacomo de Monteverde die Kirche Nuestra Señora de Los Remedios erbauen ließ. Im späten 18. Jahrhundert wanderte ein großer Teil der Einwohner nach Amerika aus. 1868 erhielt Los Llanos per königlichem Dekret den Titel Villa, damit galt sie nach der Inselhauptstadt Santa Cruz de La Palma als die wichtigste Stadt der Insel. Die Gemeinde hat sich im Laufe der Zeit zur einwohnerstärksten der Insel entwickelt und damit in den 1990er Jahren Santa Cruz de La Palma übertroffen. Der zur Gemeinde Los Llanos gehörende Ort Puerto Naos ist, neben Los Cancajos in der Gemeinde Breña Baja, eines der beiden touristischen Zentren La Palmas. Heute ist Los Llanos de Aridane das wichtigste Wirtschaftszentrum im Westen der Insel. | |||
'''Tazacorte''', offiziell La Villa y Puerto de Tazacorte, liegt am mittleren Teil der Westküste dieser Insel. Hier begann 1492 die spanische Eroberung La Palmas. Aufgrund der guten klimatischen Lage und Wasserversorgung haben die Eroberer frühzeitig Zuckerrohr anbauen lassen, was über mehr als drei Jahrhunderte lang in der Gemeinde erfolgreich möglich war. Die heute noch existierenden Herrenhäuser zeugen von dieser Entwicklung. Die wesentlichen Erwerbsgrundlagen der Gemeinde sind heute ausgedehnte Bananenplantagen und der sanfte Tourismus. Besonderheiten der Gemeinde sind das historische Treppenviertel in Villa de Tazacorte und der Fischerei- und Yachthafen. | |||
''' | '''El Paso''' im Zentrum von La Palma gilt als das „Herz der Insel“. Im Gebiet der flächenmäßig größten Inselgemeinde befinden sich vorwiegend Ackerflächen und Kiefernwälder. Ein großer Teil der Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft. Die hauptsächlichen Erzeugnisse sind Wein, Mandeln und einige Fruchtarten. | ||
'''Fuencaliente''' befindeet sich im äußersten Süden der Insel. Der Name leitet sich von ''Fuente Caliente'' „heiße Quelle“ ab und bezieht sich auf die Heilquelle ''Fuente Santa'', die im 16. und 17. Jahrhundert genutzt und 2005 wiederentdeckt wurde. Nachdem sie beim Ausbruch des Vulkans San Antonio im Jahr 1677 unter Lavamassen begraben worden und 300 Jahre unentdeckt geblieben war, wurde der Ort in ''Los Canarios'' umbenannt. Heute sind beide Namensnennungen gebräuchlich. | |||
== '''Verkehr''' == | |||
Die Insel verfügt über ein gut ausgebautes Verkehrsnetz. | |||
=== '''Straßenverkehr''' === | |||
Mittlerweile ist das Straßennetz auf La Palma gut 1.200 Kilometer lang. Alle Hauptstraßen sind asphaltiert, landschaftsbedingt kurvenreich und in gutem Zustand. | |||
Um den abgelegenen Norden der Insel wirtschaftlich besser einzubinden, wurde Anfang 1992 eine asphaltierte Verbindungsstraße zwischen Garafia und Barlovento geschaffen. Lediglich einige abgelegene Ortschaften im Inselnorden sind nur über Erd- oder Betonpisten zu erreichen. | |||
Ein etwa 180 Kilometer langer Straßenring (Kartenbezeichnung LP-1 und LP-2) umläuft die gesamte Insel (Santa Cruz–Los Cancajos–Mazo–Fuencaliente–Los Llanos–Tijarafe–Puntagorda–Barlovento–San Andrés–Puntallana–Santa Cruz), weiterhin verbindet eine rund 35 Kilometer lange Straße (Kartenbezeichnung LP-3) über zwei Tunnel den Osten mit dem Westen der Insel (Los Llanos–Los Cancajos). Eine dritte Straße verbindet den Osten mit dem Nordwesten der Insel (Kartenbezeichnung LP-4) und führt über den höchsten Berg von La Palma, den Roque de los Muchachos. | |||
Der Öffentliche Personennahverkehr auf der Kanarischen Insel La Palma stützt sich auf die von Transportes Insular La Palma S. Coop. betriebenen Omnibuslinien. Die Linienbusse werden auch hier, wie auf den anderen zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln, als Guagua bezeichnet. | |||
Derzeit gibt es 16 Linien. Nachdem der Busverkehr über mehrere Jahre deutlich ausgebaut worden war, wurde im Zuge der Wirtschaftskrise mit einer Fahrplanänderung Ende 2012 die Bedienung auf einigen Linien wieder erheblich zusammengekürzt. Gleichzeitig wurde die Nummerierung der einzelnen Linien geändert. Die neue Nummerierung orientiert sich nun grob an der Bezeichnung der Hauptverkehrsstraßen, die den einzelnen Linien folgen. So folgt beispielsweise die 300 der LP-3 von Santa Cruz de La Palma nach Los Llanos de Aridane. Die wichtigsten Linien sind hierbei Santa Cruz mit Los Llanos: direkt (300), über den Inselnorden (100) oder den Inselsüden (200). Häufig befahren wird auch die Strecke von Santa Cruz zum Flughafen Santa Cruz de La Palma über den Touristenort Los Cancajos. In der Regel liegt ein Stundentakt vor, dieser ist an Sonntagen und Abends ausgedünnt. Einzelne Linien bieten vormittags einen Halbstundentakt. | |||
Jede Fahrt ist einzeln zu bezahlen, es gibt einen Orts- und einen Überlandpreis. Die Preise betragen 1,30 € und 2,00 € (Stand 2013). Rabatte sind durch eine Bonobus genannte Chipkarte möglich. Die übertragbare Bonobuskarte kann für 1€ beim Busfahrer erworben und dort mit einem beliebigen Betrag immer wieder aufgeladen werden. Der Fahrpreis wird mit einem Rabatt von rund 20 Prozent von dieser Karte abgebucht. Bonobuskarten können auch in einigen Kiosken in der Nähe der zentralen Bushaltestelle in Santa Cruz sowie am Busbahnhof in Los Llanos gekauft werden. | |||
'''Straßen''' 1992: | |||
* | * insgesamt 1.173 km | ||
* | * davon asfaltiert 355 km (0,503 km/km²) | ||
* | * Tankstellen 15 | ||
* | * Fahrzeugbestand insgesamt 30 449 (0,386 pro Person) | ||
* Pkw 20.473 | |||
* Motorräder / Mopeds 8.257 | |||
* Lkw 1.332 | |||
* Agrarfahrzeuge 80 | |||
* Autobusse 55 | |||
* sonstige 252 | |||
=== '''Schiffsverkehr''' === | |||
Die Bucht der Hauptstadt wird seit der Eroberung der Insel durch die Spanier als Hafen genutzt. Von Santa Cruz de La Palma werden diverse Fährverbindungen zu den Nachbarinseln und (wöchentlich) zum spanischen Festland, mit Zwischenstopps auf Lanzarote, Gran Canaria und Teneriffa, angeboten. Seit Januar 2008 verkehrt die Fähre ''El Fortuny'' der Gesellschaft ''Trasmediterránea'' auf der früher von der ''Juan J. Sister'' bedienten Route nach Cádiz auf dem spanischen Festland. | |||
Seit 2008 verkehrt auch eine Fähre der Naviera Armas, die ''Volcán de Tijarafe'', zwischen Portimão, Portugal via Funchal, Madeira nach Santa Cruz de Tenerife von wo aus man La Palma im Anschluss erreichen kann. Der großzügig ausgebaute Hafen an der Westküste in Puerto de Tazacorte war 2005/2006 kurzzeitig mit einer (wöchentlichen, nicht immer zuverlässig verkehrenden) Verbindung zur Insel Teneriffa über Santa Cruz de La Palma dem Fährverkehr angeschlossen. | |||
''' | '''Leuchttürme:''' | ||
''' | '''Areans Blancas''' | ||
* Standort: Arenas Blancas, 28°34‘ N, 17°46‘ W | |||
* Inbetriebnahme: | |||
* Turmhöhe: 31,5 m | |||
* Feuerhöhe: 41,5 m | |||
* Befeuerung: | |||
* Tragweite: 37 km | |||
'''Faro de Fuencaliente''' | |||
* Standort: Playa de Fuencaliente, 28°28‘ N, 17°51‘W | |||
* Inbetriebnahme: 1984 | |||
* Turmhöhe: 24 m | |||
* Feuerhöhe: 38 m | |||
* Befeuerung: | |||
* Tragweite: 26 km | |||
'''Faro de la Punta Cumplida''' | |||
* Standort: Barlovento, Punta Cumplida, 28°50‘ N, 17°47‘ W | |||
* Inbetriebnahme: 1867 | |||
* Turmhöhe: 34 m | |||
* Feuerhöhe: 83 m | |||
* Befeuerung: | |||
* Tragweite: 42 km | |||
'''Faro de la Punta Lava''' | |||
* Standort: Punta Lava, 28°35‘ N, 17°55‘ W | |||
* Inbetriebnahme: | |||
* Turmhöhe: 48 m | |||
* Feuerhöhe: 51 m | |||
* Befeuerung: | |||
* Tragweite: 37 km | |||
=== '''Flugverkehr''' === | |||
Der erste Flughafen von La Palma wurde bei Breña Alta in 350 Metern Höhe über dem Meeresspiegel mit einer Länge von tausend Metern errichtet und 1955 in Betrieb genommen. Er erhielt den Namen ''Buenavista''. Wegen der Nähe der Berge bestand das Problem der wechselnden Winde aus unterschiedlichen Richtungen, wiederholt auftretender Nebelbänke und Regenfälle, die in den folgenden Jahren über 15 Prozent Flugausfälle verursachten. Diese Umstände zwangen zu einer Neuplanung des Flughafenstandortes. Der Flughafen Buenavista wurde 1970 mit der Inbetriebnahme des neuen Flughafens stillgelegt, dessen Piste noch existiert und von der Hauptverbindungsstraße von der Ostseite der Insel zur Westseite überquert wird. | |||
Der neue Flughafen La Palma wurde in der Gemeinde Mazo entlang des Küstenstreifens errichtet. Aufgrund des zunehmenden Verkehrsaufkommens wurde 1980 die Landebahn durch Aufschüttung eines Damms im angrenzenden Meer verlängert. Seit 1987 ist er der sechste internationale Flughafen der Kanarischen Inseln, der mehrmals wöchentlich von mehreren europäischen Chartergesellschaften angeflogen wird. Vom Flughafen bestehen Linienverbindungen zu den Nachbarinseln und zur spanischen Hauptstadt Madrid, die durch die spanischen Fluggesellschaften Iberia sowie die lokale Gesellschaft Binter Canarias bedient werden. Das neue Flughafenterminal ist seit 2011 in Betrieb. | |||
Am 19. Februar 1921 erhielt die damalige Gesellschaft ''Marítimo Canaria'' vom Verkehrsministerium die Genehmigung, an der Küste von Tazacorte einen Luftverkehrsdienst einzurichten. Anfang der 1950er Jahre plante man einen neuen Flugplatz. Die Auswahl des Ortes war allerdings schwierig, da die Insel La Palma sehr gebirgig ist und kaum ebene Fläche in der Nähe der Hauptstadt bietet. So entschied man sich, den Flugplatz namens ''Buenavista de Arriba'' etwa drei Kilometer westlich der Inselhauptstadt Santa Cruz auf 400 Meter Höhe anzulegen. Dieser Flugplatz, mit einer etwa 1.000 Meter langen Piste, wurde am 22. September 1955 für die zivile Luftfahrt und die ersten Touristenflüge eröffnet. 1958 erhielt die Start- und Landebahn eine Asphaltdecke in Richtung 03-21. Es verkehrten Flugzeuge des Typs Junkers Ju 52/3m und Douglas DC-3. Vom alten Flughafen existieren noch die Landebahn sowie der Tower nebst Flughafengebäude, das mittlerweile zu einem Privathaus umgebaut wurde. Da aber auch dieser Flugplatz aufgrund der schwierigen Wind- und Wetterverhältnisse nicht mehr tragbar war, wurde in der Nähe von Mazo, etwa acht Kilometer südlich von Santa Cruz, am 15. April 1970 der neue Flughafen eröffnet. Aufgrund des großen Verkehrsaufkommens wurde die Landebahn 01-19 um etwa 500 Meter in Richtung Norden verlängert. Sie war am 1. April 1980 vollendet und blieb bis heute unverändert. | |||
Aber auch dieser Flughafen ist an einem windanfälligen Standort positioniert – bei seltenen Westwindwetterlagen entstehen an einigen Tagen im Jahr Fallwinde von den Berghängen, bei denen der Flugverkehr teilweise oder sogar ganz eingestellt werden muss. Bei einem der längsten Vorkommnisse dieser Art in der Zeit vom 6. bis 10. April 2008 fielen etwa drei Viertel aller Flugbewegungen aus, teilweise war der Airport komplett geschlossen. Viele Charterflüge wurden zum Flughafen Teneriffa Süd umgeleitet. Über 1.500 Fluggäste mussten Fährverbindungen nutzen oder auf Teneriffa bzw. den anderen Inseln ausharren. | |||
Im März 2005 wurde mit dem Ausbau des Flughafens begonnen. Das Investitionsvolumen beträgt 103,9 Millionen Euro und soll im Jahr im 2012 endgültig abgeschlossen sein. Geplant sind eine Vorfelderweiterung, der das alte Terminal weichen muss, ein neuer Tower sowie eine größere Abfertigungshalle (Terminal) mit Fluggastbrücken und einer Kapazität von bis zu drei Millionen Passagieren im Jahr. Es besteht aus insgesamt acht Ebenen mit einer Gesamtfläche etwa 95.000 m². Im obersten Stockwerk befinden sich diverse Restaurants und der Abflugbereich. In der mittleren Ebene befindet sich die Ankunft dessen Gepäckausgabe über fünf Gepäckbänder verfügt, ebenfalls auf dieser Ebene 24 Check-in Schalter, diverse Geschäfte und Informationsschalter. In den unteren Ebenen befindet sich ein zweistöckiges Parkhaus. Die Sicherheitseinrichtungen, wie beispielsweise die Feuerwehr, die gegenüber dem Terminal auf der anderen Seite des Rollfeldes in ein neues Gebäude verlagert wird, wurden umfangreich modernisiert. Außerdem plant der Flughafen den Bau eines Hangars. Am 6. Juli 2011 wurde das neue Terminal eröffnet und der Rückbau des alten Gebäudes eingeleitet. | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Airlines''' | |||
|'''Ziele''' | |||
|- | |||
|Air Europa Express | |||
|Tenerife-Nord | |||
|- | |||
|Binter Canarias | |||
|Gran Canaria, Tenerife–Nord | |||
|- | |||
|Condor | |||
|Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, saisonal: Düsseldorf | |||
|- | |||
|CanaryFly | |||
|Tenerife–Nord | |||
|- | |||
|easyJet | |||
|saisonal: Berlin-Schönefeld, London-Gatwick | |||
|- | |||
|Enter Air | |||
|Paris-Charles de Gaulle (Charter) | |||
|- | |||
|Eurowings | |||
|Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart | |||
|- | |||
|Germania | |||
|saisonal: Berlin-Tegel (ab 6. November 2018), Düsseldorf, Hamburg | |||
|- | |||
|Germania Flug | |||
|saisonal: Zürich | |||
|- | |||
|Iberia Express | |||
|Madrid | |||
|- | |||
|Primera Air | |||
|saisonal: Billund, Kopenhagen, Göteborg, Helsinki, Joensuu, Kokkola-Pietarsaari, Kuopio, Laappeenranta, Malmö, Oslo-Gardermoen, Oulu, Pori, Reykjavik-Keflavik, Stockholm-Arlanda | |||
|- | |||
|Small Planet Airlines | |||
|saisonal: Warschau-Chopin | |||
|- | |||
|Travel Service | |||
|Lyon, Nantes (beide Charter) | |||
|- | |||
|Transavia | |||
|Amsterdam | |||
|- | |||
|TUI Airways | |||
|London-Gatwick, Manchester | |||
|- | |||
|TUI fly Belgium | |||
|Brüssel | |||
|- | |||
|TUI fly Netherlands | |||
|Amsterdam | |||
|- | |||
|Vueling | |||
|Barcelona | |||
|} | |||
'''La Palma Airport''' | |||
* spanischer Name: Aeropuerto de La Palma | |||
* Code: SPC / GCLA | |||
* Lage: 28°37‘35“ N, 17°45‘20“ W | |||
* Seehöhe: 33 m (108 ft) | |||
* Entfernung: Mazo, 8 km südlich von Santa Cruz de La Palma | |||
* Inbetriebnahme: 15. April 1970 | |||
* Betreiber: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) | |||
* Terminal: 1 | |||
* Rollbahn: 1 | |||
* Länge der Rollbahn: 2200 m (Asfalt) | |||
* Fluggesellschaften: 18 | |||
* Flugzeug-Standplätze: ca. 30 | |||
* jährliche Passagierkapazität: ca. 1 mio. | |||
* jährliche Frachtkapazität: ca. 2000 t | |||
* Flughafen-Statistik: Jahr Flugbewegungen Passagiere Fracht in t | |||
1990 . 486 186 439 | |||
1995 11 966 716 295 1 650 | |||
1996 12 115 703 578 1 586 | |||
1997 11 751 719 278 1 537 | |||
1998 12 870 775 184 1 456 | |||
1999 13 777 853 959 1 604 | |||
2000 14 955 893 726 1 756 | |||
2001 14 673 943 688 1 647 | |||
2009 19 741 1 042 969 1 084 | |||
2011 19 455 1 067 431 851 | |||
2015 15 800 971 676 565 | |||
2016 17 296 1 116 146 577 | |||
2017 17 757 1 302 485 617 | |||
== '''Wirtschaft''' == | |||
Hauptwirtschaftszweige der Insel sind Landwirtschaft und Tourismus. | |||
=== '''Landwirtschaft''' === | |||
2006 wurde auf insgesamt 8.305 Hektar Landwirtschaft betrieben. Bananen und Wein nehmen dabei mit über 5.000 Hektar eine zentrale Rolle ein. Zunehmend wird die Landwirtschaft jedoch mit dem Anbau von Avocado, Zitrusfrüchten und Gemüse diversifiziert. | |||
Die Landwirtschaft wird durch ein einzigartiges Bewässerungssystem aus Wasserleitungen und Tunneln ermöglicht, die das Wasser aus den Bergen in die agrarisch genutzten Gebiete führen. Diese Tunnel sind zum Teil Hunderte von Metern durch Felsen getrieben und bringen das Wasser über mehrere Kilometer in die bewohnten Gebiete an der Küste. Allerdings führt der enorme Wasserverbrauch der Landwirtschaft, vor allem der Bananenanbau, zu einer beständigen Verknappung des Wassers auf der regenreichsten Kanareninsel. | |||
'''Landwirtschaft''' 1989: | |||
* Nutzfläche 22 138 ha | |||
* Agrarbetriebe 13 596 | |||
* Parzellen 69 625 (5,121 pro Betrieb) | |||
'''Viehbestand''': 1972 1982 1991 | |||
Geflügel 60 000 56 000 180 000 | |||
Kaninchen 0 200 52 000 | |||
Ziegen 18 656 17 130 20 730 | |||
Schweine 4 375 4 493 7 427 | |||
Rinder 5 425 2 274 1 309 | |||
Schafe 1 001 600 667 | |||
Esel und Maultiere 1 253 329 320 | |||
Pferde 223 111 100 | |||
=== '''Fischerei''' === | |||
Fischfang und hier speziell die Hochseefischerei, hat auf La Palma eine lange Tradition, wobei sowohl die kommerzielle als auch die Freizeitfischerei eine wichtige Rolle spielen. Die Insel gehört zu den westlichen Kanaren und ist bekannt für ihre vielfältigen Fischarten wie Thunfisch, Marlin, Schwertfisch, Wahoo, Amberjack, Großaugenbarsch, Degenfisch, Papageienfisch, Morena, Sama und viele mehr. La Palma ist ein Geheimtipp für Hochseefischen (Big Game Fishing) mit Möglichkeiten, große Fische wie Blue Marlin (bis 200 bis 300 kg), Thunfisch, Marlin, Wahoo und Rochen zu fangen. Die Fischereizonen liegen meist nahe der Küste, da der Meeresboden schnell bis zu 1.000 Meter oder mehr abfällt, was exzellente Fangmöglichkeiten bietet. | |||
Die traditionelle Fischerei wird von zwei Hauptfischereigenossenschaften betrieben: Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de Las Nieves in Santa Cruz de La Palma und Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Carmen in Tazacorte. Diese betreiben eine Flotte von etwa 40 Schiffen und fangen unter anderem Thunfisch, Sardinen, Garnelen und Papageienfische. Der Hafen von Tazacorte ist ein zentraler Ausgangspunkt für Hochseeangeltouren. Es gibt Anbieter, die moderne Boote und Ausrüstung bereitstellen, zum Beispiel die „Gatufas“, ein 8 Meter Sportfischerboot, das für Gruppen bis 5 Personen geeignet ist. Die Preise für Hochseefischen sind vergleichsweise günstig, und man muss meist nur wenige Minuten vom Hafen fahren, um in tiefes Wasser mit großem Fischreichtum zu gelangen. Brandungsangeln vom Ufer oder Hafenmolen ist ebenfalls möglich und wird von Einheimischen und Touristen mit Genehmigung praktiziert. Gute Plätze sind jedoch oft schwer zugänglich. | |||
'''Fischereidaten''' 1992: | |||
* Fischer 132 | |||
* Fischereibetriebe 104 | |||
* Fischerboote 106 | |||
* Anlandungen (1990) 2 017,5 t | |||
=== '''Industrie''' === | |||
Im Vergleich zur Landwirtschaft spielen Handwerk und Industrie auf La Palma nur eine untergeordnete Rolle. Die Insel besitzt lediglich einige kleine Betriebe, die Landwirtschaftsprodukte weiterverarbeiten bzw. Baustoffe oder Kunsthandwerk herstellen, sowie einige Baufirmen, die dank des Tourismus in den letzten Jahren einen Aufschwung zu verzeichnen hatten. Nur die Zigarettenfabrik in El Paso, in der etwa 300 Insulaner arbeiteten, produzierte bis Ende 2000 in größerem Umfang. Die Produktion wurde nach Deutschland verlagert. | |||
''' | '''Betriebe''' 1986 (mit Beschäftigtenzahl und Beschäftigten pro Firma): | ||
Industrie und Handwerk 233 1 204 3,6 | |||
Baugewerbe 36 2 376 66,0 | |||
=== '''Energiewirtschaft''' === | |||
Die Energieversorgung auf La Palma basiert derzeit zu über 90 % auf Dieselgeneratoren des Kraftwerks Los Guinchos in Breña Alta, das von Endesa betrieben wird. Ergänzt wird die Stromerzeugung durch Windkraftanlagen (ca. 6,6 %) und Photovoltaikanlagen (ca. 2,3 %) sowie kleinere Eigenverbrauchsanlagen mit Solarstrom. Der jährliche Strombedarf lag 2022 bei etwa 262 GWh, wovon der Großteil durch Dieselgeneratoren gedeckt wurde, was jedoch mit hohen CO2-Emissionen verbunden ist (rund 160 Millionen kg CO2 jährlich). | |||
Auf La Palma gibt es eine aktive Bürgerinitiative („Plataforma por un Nuevo Modelo Energético“), die sich für eine Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und den Ausbau erneuerbarer Energien einsetzt. Diese Initiative hat das „Manifiesto del Electrón“ initiiert, das von allen Gemeinden und der Inselregierung unterzeichnet wurde und eine 100 % erneuerbare Energieversorgung anstrebt. Ziel ist eine deutliche Steigerung der Leistung bis 2028 und eine Reduktion der Abhängigkeit von Diesel. Zusammenfassend ist La Palma derzeit noch stark von Dieselenergie abhängig, befindet sich aber in einem aktiven Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigeren, erneuerbaren Energieversorgung mit Wind, Solar und künftig auch Geothermie als zentralen Säulen. | |||
Das Projekt „La Palma Renovable“ koordiniert die Umsetzung der Energiewende mit Fokus auf dezentrale, effiziente Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen und fördert lokale Akteure, Bildung und technische Unterstützung. Die kanarische Regierung plant den Ausbau der Stromversorgung und Investitionen in erneuerbare Energien, darunter auch die Erschließung geothermischer Energie auf La Palma, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen und den Anteil erneuerbarer Energien zu steigern. La Palma wurde von der EU-Kommission als Pilotprojekt für saubere Energien ausgewählt, um beispielhaft die Energiewende und Autarkie auf Inseln zu demonstrieren. | |||
Kraftwerke 1992: | |||
Wasserkraftwerk 1 | |||
Erdölkraftwerk 1 | |||
Transformatoren 6 | |||
installierte Leistung 44,47 mwh | |||
Energieproduktion 131 788 mwh | |||
Elektrische Anschlüsse: | |||
insgesamt 1983 25 615 | |||
1992 32 334 | |||
Energieverbrauch 1992 117 271 mwh | |||
pro Kopf 1,475 mwh | |||
=== | === '''Wasserwirtschaft''' === | ||
Die Wasserwirtschaft auf La Palma ist geprägt durch eine einzigartige natürliche Wasserversorgung, die sich deutlich von den anderen Kanarischen Inseln unterscheidet. Die Insel profitiert von ausreichendem Wasser aus Passatwolken, das in den Bergen durch Nebelkondensation auf den Kiefern gefiltert und in das poröse Lavagestein versickert. Dieses Wasser wird über ein weit verzweigtes System von Stollen, sogenannten Galerien, sowie Brunnen und Quellen gesammelt und über ein ausgedehntes Netz von Kanälen und Rohrleitungen zu den Verbrauchern geleite. | |||
Hauptsächlich stammen die Wassermengen aus etwa 187 Galerien, von enen 94 aktiv genutzt, und rund 84 Brunnen, von denen etwa 23 aktiv sind. Die Galerien sind gewölbte Tunnel mit leichter Gefälle, die das Wasser mittels Schwerkraft ableiten. Der Lavastrom 2021 zerstörte wichtige Wasserleitungen in den Gebieten Puerto Naos, El Remo und La Bombilla, wodurch etwa 600 Hektar Bananenplantagen ohne Bewässerung blieben. Die Versorgung wird derzeit durch mobile Entsalzungsanlagen und Wassertransporte per Tankschiff sichergestellt. | |||
Das Wasser wird von den wasserreichen Nordregionen über mehrere große Rohrleitungsstränge (Canal General La Palma I, II, III und Conducción Aduares-Hermosilla) auch in die trockeneren Südregionen transportiert. Dabei müssen Höhenunterschiede von bis zu 635 Metern überwunden werden, was Pumpstationen erfordert. Etwa 85 % des Wassers werden für die Landwirtschaft verwendet, insbesondere für die intensive Bewässerung der Bananenplantagen, die eine zentrale Rolle in der Inselwirtschaft spielen. Die Bevölkerung verbraucht rund 11 %, der Tourismussektor etwa 3,4 %. | |||
Das Wasser gilt als besonders rein, da es durch das Lavagestein natürlich gefiltert wird. Die Wasserversorgung ist die einzige der Kanaren, die über ausreichend eigenes Wasser aus natürlichen Quellen verfügt. Kritisiert wird mangelnde Kontrolle und Regulierung der Wassernutzung durch Wassergemeinschaften. Es gibt Probleme mit Wasserverlusten, Spekulation und fehlender Verbrauchskontrolle, was die nachhaltige . Wasserversorgung gefährdet. Forderungen nach besserer Regulierung und Sanktionen werden laut. Zur Sicherung der Versorgung werden Wasserverluste reduziert, bestehende Kanäle verbessert und neue Quellen wie das Bohrloch Los Tilos aktiviert, um die Verfügbarkeit in Trockenzeiten zu erhöhen. | |||
=== '''Abfallwirtschaft''' === | |||
Die Abfallwirtschaft auf der Insel La Palma ist geprägt von einem System, bei dem der Müll nicht direkt an den Haushalten abgeholt wird, sondern die Bevölkerung ihren Abfall getrennt in zentralen Containern entsorgt. Es gibt verschiedene Container für Glas (grün), Papier und Pappe (blau), Verpackungen wie PET-Flaschen und Dosen (gelb) sowie Restmüll (schwarz). Organische Abfälle werden in einigen Gemeinden bereits separat gesammelt, und es gibt mehrere Recyclinghöfe („Punto Limpio“) für Sperrmüll, Elektrogeräte und Sonderabfälle. | |||
Im Jahr 2022 produzierte jeder Einwohner im Durchschnitt etwa 351,75 Kilogramm Müll, wobei die Gemeinde Fuencaliente mit 514,09 kg pro Kopf den höchsten Wert aufweist. Im Vergleich zur EU (ca. 480 kg pro Kopf) liegt La Palma damit unter dem Durchschnitt. Die Insel verfügt über eine zentrale Deponie im Umweltkomplex Los Morenos, wo der Restmüll deponiert wird. Dort wird auch eine Sortierung vorgenommen. Eine Müllverbrennungsanlage gibt es nicht. Die Abfallwirtschaft wird derzeit modernisiert und ausgebaut: Das Cabildo investiert 11,42 Millionen Euro in die Infrastruktur, darunter die Wiederherstellung der durch den Vulkan zerstörten Transferstation Callejón de La Gata, die Abdichtung der Deponie und den Ausbau einer Kompostieranlage für organische Abfälle. Auch die Fahrzeugflotte für die Müllentsorgung wird erneuert | |||
Seit April 2025 ist in sechs Gemeinden La Palmas eine verpflichtende Müllgebühr eingeführt, die nach dem Verursacherprinzip erhoben wird. Die Höhe variiert je nach Gemeinde und wird oft anhand von Wasserverbrauch, Haushaltsgröße oder Einkommen berechnet. Durchschnittlich liegt die Gebühr bei etwa 80 Euro pro Jahr. Zusätzlich gibt es auf der Insel Initiativen zur Sensibilisierung der Bevölkerung für Mülltrennung und Recycling, etwa durch öffentliche Aktionen und die Einführung von Biotonnen in einigen Gemeinden. Insgesamt ist die Abfallwirtschaft auf La Palma auf einem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und besserer Mülltrennung, wobei der Fokus auf Recycling, Kompostierung und der Reduzierung von Deponiemüll liegt. | |||
=== '''Handel''' === | |||
Der Export von La Palma beschränkt sich auf Agrarprodukte. Insgesamt hat die Insel eine negative Handelsbilanz, das heißt es wird weit mehr ein- als ausgeführt. Dreiviertel der Lebensmittel müssen importiert werden, so auch Zitrusfrüchte wie Orangen und Zitronen als auch etwa 80 Prozent des Bedarfs an tierischen Produkten. Andere wichtige Importwaren, die zum größten Teil das spanische Mutterland liefert, sind Rohöl, Konsumgüter, ferner mechanische und elektrische Güter sowie Kraftfahrzeuge. | |||
Inselintern gibt es mehrere Einkaufszentren und -gebiete, die eine Vielzahl von Produkten anbieten. Dazu gehören: | |||
* '''Centro Comercial El Tablero''' in Santa Cruz de La Palma: zentral gelegen mit mehr als 120 Geschäften, darunter Mode, Schuhe, Elektronik und mehr. | |||
* '''Centro Comercial Trocadero''' in Los Llanos de Aridane: modern ausgestattet inklusive einer Tiefgarage mit 140 Stellplätzen. | |||
* '''Zona Comercial Abierta del Casco Histórico Santa Cruz de La Palma''' in Santa Cruz de La Palma: in historischer Umgebung gelegen, mit farbenfrohen Fassaden, bietet lokale Waren un Souvenirs. | |||
* '''Mercadillo Municipal de Villa de Mazo''' und '''Mercadillo del Agricultor de Puntagorda''' in Villa de Mazo und Puntagorda: Bauernmärkte mit lokalem Kunsthandwerk und frischen Produkten, bietet authentische lokale Erlebnisse und frische Produkte. | |||
=== Finanzwesen === | |||
Die Finanzwirtschaft auf La Palma ist eng eingebunden in das spanische und kanarische Wirtschaftssystem, mit einigen Besonderheiten aufgrund des Sonderstatus der Kanarischen Inseln. Die offizielle Währung auf La Palma ist der Euro, seit der Einführung 2002. Bargeld und gängige Kreditkarten (Mastercard, Visa) werden breit akzeptiert, während American Express eingeschränkt genutzt werden kann. Banken und Sparkassen sind auf der Insel flächendeckend vertreten, darunter auch Filialen großer internationaler Banken wie Deutsche Bank und Santander. Die Öffnungszeiten sind meist vormittags, samstags nur außerhalb der Sommermonate geöffnet. Geldautomaten sind weit verbreitet und akzeptieren die meisten internationalen Karten. Tageslimits beim Abheben liegen meist bei etwa 200 Euro. | |||
La Palma gehört zur kanarischen Sonderwirtschaftszone (ZEC), die steuerliche Vergünstigungen bietet, etwa eine reduzierte Körperschaftsteuer von bis zu 4 % für Unternehmen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Kanarischen Inseln haben ein eigenes Steuerregime (Regimen Fiscal de Canarias), das sich von Festlandspanien unterscheidet. So gibt es besondere Regeln bei Einkommensteuer, Vermögensteuer und Umsatzsteuer (statt Mehrwertsteuer gilt die AIEM-Steuer). Einkommensteuer ist progressiv, aber für beschränkt Steuerpflichtige auf den Kanaren gilt ein pauschaler Satz von 24 %. Kapitalgesellschaften profitieren in den ersten zwei Gewinnjahren von einem reduzierten Körperschaftsteuersatz von 15 %. Es gibt steuerliche Anreize für Investitionen, darunter Investitionsrücklagen mit bis zu 90 % Steuerbefreiung bei Reinvestitionen auf der Insel innerhalb von drei Jahren. Immobilien unterliegen der Grundsteuer, die von den lokalen Gemeinden erhoben wird, sowie einer Vermögensteuer, die progressiv ab etwa 700.000 Euro Vermögen greift. | |||
Nach dem Vulkanausbruch 2021 wurden umfangreiche Investitionen von über 400 Millionen Euro für den Wiederaufbau und die Wirtschaftsförderung auf La Palma bereitgestellt, darunter auch Mittel für Landwirtschaft und Infrastruktur. Die Kanarischen Inseln profitieren als EU-Randgebiet von speziellen Förderprogrammen und Finanzmitteln, die auch La Palma zugutekommen, um die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen und die Folgen von Naturkatastrophen abzufedern. | |||
== '''Soziales und Gesundheit''' == | |||
Auf La Palma gibt es ein Hauptkrankenhaus und mehrere Gesundheitszentren, die die medizinische Versorgung der Insel sicherstellen. Das '''Hospital General de La Palma''' befindete sich oberhalb von Santa Cruz.Hier finden sich verschiedene Fachabteilungen wie Kardiologie, Urologie, Traumatologie, Chirurgie und Neurologie, stationäre Abteilungen für Innere Medizin, Psychiatrie, Chirurgie und andere Fachbereiche sowie eine Notaufnahme. | |||
Die insgesamt 16 Gesundheitszentren (''Centros de Salud'') verteilen sich auf die Inselgemeinden. Sie bieten Erstversorgung, Vorsorgeuntersuchungen und in einigen Fällen auch fachärztliche Behandlungen. Die größeren Zentren Los Llanos, El Paso und Santa Cruz bieten einen 24-Stunden-Service an sieben Tagen in der Woche. Für Notfälle steht die Notrufnummer 112 zur Verfügung, bei der auch deutsch- und englischsprachige Mitarbeiter erreichbar sind. | |||
=== '''Krankheiten''' === | |||
Es gibt keine auffälligen Krankheitshäufungen auf La Palma. Allzu rasante Höhenwechsel und Windausgesetztheit, kombiniert mit hohen Temperaturen können bei diesbezüglich empfindlichen Besuchern Beschwerden auslösen, ebenso die kurvigen Straßen oder Bootsausflüge bei hohem Seegang. | |||
== '''Bildung''' == | |||
Die Schulen auf La Palma folgen dem spanischen Bildungssystem und bieten die üblichen Stufen der spanischen Bildung an, wie die ''Educación Secundaria Obligatoria'' (ESO), die der Sekundarstufe I entspricht, und die '''Bachillerato''', die der Sekundarstufe II entspricht, | |||
'''Schulen''', Lehrer und Schüler 1992: | |||
Vorschulen 3 64 1 695 | |||
Grundschulen 78 487 8 950 | |||
Höhere Schulen 5 182 2 574 | |||
Hochschulen 5 179 2 206 | |||
insgesamt 91 912 15 425 | |||
=== '''Höhere Bildung und Wissenschaft''' === | |||
Hochschulen im eigentlichen Sinn gibt es auf La Palma nicht. Eine bemerkenswerte Einrichtung ist die '''Escuela de Arte Manolo Blahnik''', die sich auf Kunsthandwerk und Design spezialisiert hat. Diese Schule bietet Ausbildungen in Bereichen wie Grafikdesign, Produktdesign und Fotografie an. | |||
Auf La Palma befindet sich eins der eindrucksvollsten Observatorien weltweit. Das '''Observatorio del Roque de los Muchachos''' (ORM) besteht aus mehreren Sternwarten in einer Seehöhe von 2350 bis 2400 m. Für die Standortwahl im Jahr 1972 entscheidend waren die Höhenlage auf dem Roque de los Muchachos mit 2400 Metern über den Wolken und eine geringe Lichtverschmutzung des Nachthimmels auf La Palma sowie eine verhältnismäßig geringe Entfernung zu Europa gegenüber anderen Standorten wie Südamerika oder Hawaii (mit 4200 Meter Höhe und 50 Prozent Sauerstoffgehalt). | |||
Die Gründungsmitglieder Spanien, England, Dänemark, Deutschland und Schweden beschlossen 1974 als ersten Schritt für die Errichtung des Observatoriums den Ausbau einer Zufahrtsstraße sowie die Wasser- und Stromversorgung auf den Roque de los Muchachos und ein Trainingsprogramm für die spanischen Wissenschaftler. 2979 erfolgte die Unterzeichnung des Abkommens zur Errichtung der Anlage. | |||
1984 nahm das Roque-de-los-Muchachos-Observatorium seinen Betrieb auf. Am 29. Juni 1985 wurde es vom spanischen König und den königlichen Oberhäuptern und Regierungschefs der Mitgliedsländer offiziell eingeweiht . Um die Sichtverhältnisse der Astronomen in der Nacht zu verbessern, wurde 1988 für La Palma und Teneriffa das Gesetz ''Ley de Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC'' („Gesetz zum Schutze des Himmels“) beschlossen, das Leuchtreklame verbietet und festlegt, dass Lampen im Freien nur bestimmtes Licht nur nach unten abstrahlen dürfen. Am 24. Juli 2009 wurde das Gran Telescopio Canarias (GTC oder auch GRANTECAN) durch den spanischen König Juan Carlos und Königin Sophia eingeweiht. Es gilt als größtes Spiegelteleskop weltweit. | |||
Nch der Installierung eines Glasfasernetzes wuchs ab 2012 die internationale Beteiligung stark an. Mit Stand 2025 sind etwa 170 Forschungsinstitute und 31 Staaten an den unter der Aufsicht der auf La Palma und Tenerife tätigen Organisation ''European Northern Observatory'' (ENO) stehenden Instrumenten beteiligt. | |||
== '''Kultur''' == | |||
Zum kulturellen Angebot auf La Palma gehören die archäol ogischen Zentren, ''Parque Arqueologico'' in La Zarza, Gemeinde Garafia und ''Cueva Belmaco'' in Mazo, mehrere Bibliotheken (jeweils in den größeren Orten der Insel), ein Kino und das ''Teatro Chico'' in Santa Cruz und ein Kino Los Llanos sowie diverse Musik- und Kunstveranstaltungen, welche überwiegend in den ''Casas de Cultura'' der Orte stattfinden. | |||
Luis Morera ist einer der bekanntesten auf La Palma lebenden und schaffenden Künstler. Seine Werke auf der Insel sind unter anderem der Plaza de La Glorieta, der Park ''El Jardín de las Delicias'' in Los LLanos, der Brunnen mit der Bronzefigur ''San Miguel de La Palma'' vor dem Rathaus von Tazacorte, die Bronzefigur der Zwerg (''Enana'') in Santa Cruz sowie eine Vielzahl von Bildern von der Natur und Bevölkerung der Insel. | |||
=== '''Museen''' === | |||
Auf der Insel La Palma befinden sich folgende Museen: | |||
* '''Museo Insular de La Palma''' (Inselmuseum) in Santa Cruz de La Palma: Das Inselmuseum in Santa Cruz de La Palma befindet sich in einem historischen Franziskanerkloster und bietet eine vielfältige Sammlung von Kunstwerken, Naturgeschichte und ethnografischen Exponaten. Es ist perfekt für Kunst- und Geschichtsliebhaber sowie Besucher, die eine kulturelle Vielfalt schätzen. | |||
* '''Museo Naval''' (Schifffahrtsmuseum) in Santa Cruz: Es befindet sich in einem Nachbau der Karavelle Santa Maria und zeigt historische Karten und nautische Instrumente. Es bietet umfassende Einblick in die maritime Geschichte der Insel. | |||
* '''Museo Arqueologico''' (Archäologisches Museum)in Los Llanos de Aridane: Dieses Museum in Los Llanos de Aridane bietet einen umfassenden Einblick in das Leben der Ureinwohner La Palmas, den Benahoaritas. Mit multimedialen Ausstellungen, Originalfunden und Nachbildungen ist es besonders geeignet für Geschichtsinteressierte und Familien. Es kombiniert moderne Architektur mit historischen Artefakten und ist barrierefrei zugänglich. | |||
* '''Museo de la Seda Las Hilaneras''' (Seidenmuseum) in El Paso: Es zeigt die traditionelle Seidenherstellung auf La Palma und bietet Workshops sowie einen Museumsshop mit handgefertigten Produkten. Es ist ideal für Besucher, die sich für Handwerkskunst und Textilien interessieren, und bietet eine familienfreundliche Atmosphäre. | |||
* '''Museo del Puro Palmero''' (Palmerisches Zigarrenmuseum) in Breña Alta: Es widmet sich der palmerischen Zigarrenherstellung mit Demonstrationen und Ausstellungen zur lokalen Geschichte. Es ist besonders interessant für Liebhaber von Handwerkskunst und regionaler Kultur. | |||
* '''Museo del Platano''' (Bananenmuseum) in Tazacorte: Es ist mit einer kleinen Bananenplantage verbunden. | |||
* '''Museo del Vino''' (Weinmuseum) an der Plaza de La Glorieta in Las Manchas: Es bietet einen Überblick über den Weinbau auf La Palma inklsuive kleiner Kostproben. | |||
=== '''Architektur''' === | |||
Die traditionelle Architektur von La Palma ist geprägt von einer Mischung aus europäischen und lokalen Einflüssen, die sich über Jahrhunderte entwickelt haben. Sie zeichnet sich durch ihre Anpassung an das Klima und die geografischen Gegebenheiten der Insel aus. Kunstvoll verzierte Holzbalkone sind ein typisches Element der Architektur in Santa Cruz de La Palma. Sie erinnern an maurische Baukunst und wurden ursprünglich als Vorratsräume genutzt, da sie durch filigranes Holzwerk luftige Lagerbedingungen ermöglichten. Die traditionellen kanarischen Fenster bestehen aus kunstvoll gearbeiteten Fensterläden, die frische Luft zulassen, aber neugierige Blicke fernhalten. Die Gebäude wurden aus lokal verfügbaren Materialien wie Basaltstein, Lehm, Tuffstein, Kalk und besonders Tea-Holz gebaut. Die Dächer sind oft Zwei- oder Vierwasserdächer, gedeckt mit Mönch-und-Nonne-Ziegeln. Innenhöfe mit Blumen und Sitzbänken sind ebenfalls typisch. | |||
Die Architektur von La Palma spiegelt die kulturelle Vielfalt der Insel wider, beeinflusst durch galicische, kastilische, andalusische und portugiesische Kolonisatoren seit dem 16. Jahrhundert. Durch die geografische Isolation blieben viele traditionelle Stile erhalten: | |||
* Balcones tipicos in Santa Cruz de la Palma: Besonders entlang der Avenida Marítima sind diese Balkone ein Wahrzeichen der Insel. | |||
* Casa Luján in Puntallana aus dem 17. Jahrhundert: Ein Museum, das die häuslichen Bräuche des traditionellen kanarischen Lebens zeigt. | |||
* Kopfsteinpflasterstraßen und gut erhaltene Gebäude in Städten wie Santa Cruz de La Palma. | |||
Die Architektur von La Palma ist nicht nur funktional, sondern gilt auch ein Ausdruck der kulturellen Identität der Insel. Letztere wird auch durch eine Vielzahl an Kirchen zum Ausdruck gebracht, die verschiedene Baustile wie Gotik, Renaissance und Mudéjar sowie flämische Kunstwerke repräsentieren. Viele dieser Kirchen sind auch kulturelle Zentren und Schauplätze für lokale Feste und Prozessionen. | |||
=== '''Literatur''' === | |||
Eine eigenständige palmerische Literatur hat sich nicht entwickelt. Es gibt aber zahlreiche Werke von Besuchern, die sich mit dem Inselleben auseinandersetzten. So waren es speziell deutschsprachige Reisende des 19. und 20. Jahrhunderts, darunter auch Frauen, die ihre Erfahrungen auf La Palma dokumentierten. Ihre Werke entstanden im Rahmen von „touristischen Reisen“ und unterscheiden sich von wissenschaftlichen Abhandlungen der Zeit. Sie beleuchten Alltag, Kultur und Landschaften, wobei die Texte oft persönliche Eindrücke mit gesellschaftlichen Beobachtungen verbinden. | |||
La Palmas literarische Landschaft umfasst Werke von Inselautoren und Besuchern, die sich mit Geschichte, Natur und Kultur auseinandersetzen. Hierzu sind letzter Zeit mehrere Sammelbände erschienen. Das ''Literarische La-Palma-Lesebuch'' (2022) vereint Texte und Gedichte von Palmeros und Zugewanderten. Es thematisiert Emigration, Naturerlebnisse und die Identität der Insel, ergänzt durch historische Fotos und Gemälde aktueller Künstler. ''Canarias'' ist ein zweisprachiges Werk mit Essays, Lyrik und Kunst, das verborgene Aspekte der Kanaren beleuchtet. | |||
Gorka Garmendia Pérez verarbeitet in ''Benahoare oder Idairas Lächeln'' (2021) die Eroberung La Palmas durch die Kastilier (1492–1493) und den Widerstand der Ureinwohner (Awaras). Das Buch basiert auf dreijähriger Archivrecherche. ''Lavasteinzeit'' von Gudrun Bleyhl bietet persönliche Berichte von der Evakuierungsgrenze zur Zeit des Cumbre Vieja-Ausbruchs 2021. ''Diario de un volcán'' von Lucía Rosa González IST EINE Poetische Verdichtung der Vulkanereignisse aus Sicht einer Bewohnerin des verschütteten Dorfes Todoque: | |||
'''Theater''' | |||
Die Inselhauptstadt Santa Cruz de La Palma ist Heimat zweier bemerkenswerter Theater: | |||
* '''Teatro Chico''': Dieses Theater bietet ein festes Programm, das auch Kinovorführungen umfasst. Es ist bekannt für seine kulturellen Veranstaltungen und das charmante Ambiente | |||
* '''Teatro Circo de Marte''': Dieses Theater ist ein emblematisches Gebäude und seit 1997 als Kulturgut der Kanarischen Inseln anerkannt. Es bietet eine Vielzahl von Veranstaltungen wie Operetten, Komödien, Theaterstücke, Zirkusvorführungen und Konzerte. | |||
Dazu kommen Aufführungen bei diversen Festivitäten. | |||
=== '''Musik''' === | |||
La Palmas Musikszene verbindet traditionelle kanarische Folklore mit modernen Einflüssen aus Europa und Lateinamerika. Traditionelle Vokalmusik wird durch Instrumente wie die viersaitige Timple, Gitarren, Flöten und Kastagnetten geprägt. Stile wie der rhythmische Sirinoque-Tanz, der Weizentanz (Danza del Trigo) und improvisierte Zehnzeilen-Gesänge (Punte Cubano) spiegeln lokale Bräuche wider. Bekannte Folkloregruppen wie ''Los Arrieros'' oder ''Echentive'' präsentieren diese Traditionen bei Festen und in Kulturzentren. | |||
Moderne Musikrichtungen reichen von Folkrock bis Latino-Rhythmen. Die 1974 gegründete Band ''Taburiente'' gilt als Pionier des kanarischen Folkrocks und kombiniert regionale Themen mit rockigen Klängen. Künstler wie die Sängerin Ima Galguén integrieren keltische Elemente, während jüngere Acts wie ''Paraíso Animal'' oder ''Vrandan'' lateinamerikanische Stile aufgreifen. Jazzkonzerte in Los Llanos und Auftritte von Bands wie ''Guitar Juice'' zeigen die stilistische Vielfalt. | |||
Im Jahr 2011 fand auf La Palma und Tenerife das erste '''Starmus-Festivals''' statt, das Wissenschaft und Musik verbindet. Vom 25. bis 29. April 2025 wurde das Festival erneut auf La Palma ausgerichtet. Highlights waren: | |||
* (26. April, Tazacorte): Rocklegenden wie Glenn Hughes und Bands wie ''Efecto Pasillo'' | |||
* (25./27. April, Santa Cruz): Opernstars wie Montserrat Martí Caballé und Simona Todaro Pavarotti | |||
* in Los Llanos und Santa Cruz mit Live-Musik von Bands wie ''Shidow'' oder ''Terco'' | |||
=== '''Kleidung''' === | |||
Die Kleidung der Benahoaritas bestand hauptsächlich aus Tierfellen, insbesondere von Ziegen und Schafen. Diese Felle wurden bearbeitet, teilweise gefärbt, und zu Kleidungsstücken zusammengenäht. Schuhe wurden aus Schweinsleder gefertigt, da dieses Material besonders haltbar war. Die Verarbeitung der Felle erfolgte mit Steinwerkzeugen, und die Kleidungsstücke wurden mit Lederstreifen oder Sehnen zusammengenäht. Um die Nähmaterialien durch das Leder zu ziehen, verwendeten sie Knochenahlen. Die Felle wurden oft zugeschnitten und präzise genäht, auch für die Einwicklung von Toten bei Begräbnissen. Neben der Kleidung trugen die Benahoaritas Schmuck aus Muscheln, Steinen und Knochen. | |||
Die traditionelle Tracht der heutigen Einwohner von La Palma besteht aus drei Varianten, der Arbeitskleidung (faena), der Festkleidung (gala) sowie Manto y Saya. Erstere wird traditionellerweise aus lokal hergestellten Stoffen wie Wolle und Leinen gefertigt. Sie ist funktional und für den Alltag geeignet. Charakteristisch sind seitliche Raffungen des Rocks, grobe Wollstoffe für das Leibchen und eine robuste Barredera am unteren Saum des Rocks, um ihn vor Verschleiß zu schützen. | |||
Die Festkleidung ist aufwendiger gestaltet, mit reich bestickten Blusen, Westen und edlen Stoffen. Frauen tragen zwei Röcke übereinander, wobei der obere Rock über den Kopf geschlagen wird und vom Hut gehalten wird. Männer tragen eine rote Schärpe, lange Westen und Gamaschen aus Wollgarn bekleidet. | |||
Manto y Saya war ein auf der ganzen Insel verbreitetes Kleidungsstück, ist besonders fein gearbeitet und besteht aus mehreren Umhängen und Röcken, oft mit seidenen oder leinenen Stoffen. Eine Falde reichte bis zu den Füßen, die andere wurde über den Rücken gezogen, um den Kopf zu bedecken. Manto y Saya wurde von den Palmeros als alltägliches Kleidungsstück getragen, aber auch für den Kirchgang und bei Trauerfeiern. Die Verwendung dieses Kleidungsstücks reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück und endete im 19. Jahrhundert. Der Stil ist einzigartig auf den Kanarischen Inseln und beinhaltet kunstvolle Accessoires wie Hüte im Mudejar-Stil. Die Trachten werden aus natürlichen Materialien wie Seide, Wolle, Leinen und Leder hergestellt. Kunsthandwerker verwenden traditionelle Techniken wie Webstühle und natürliche Farbstoffe. | |||
=== '''Kulinarik und Gastronomie''' === | |||
Die Palmerische Küche unterscheidet sich nicht sehr von denen der anderen Kanarischen Inseln. Bis in die 1960er Jahre bestand für die meisten palmerischen Familien – insbesondere in den ländlichen Gebieten – das Essen aus den von ihnen gewonnenen Produkten, wie Kartoffeln, Gofio (geröstetes Mais- oder Weizenmehl), Schweine- und Ziegenfleisch, Ziegenkäse, Mojo (pikante Sauce), Milch, Fisch, einige Gemüse- und Obstsorten. Zu festlichen Gelegenheiten wie Karneval und Weihnachten wurden spezielle Gerichte zubereitet, Süßspeisen aus Brot, Honig und Milchreis, geröstete Kastanien, Biskuit. Ziegenkäse mit Mojo zählen heute – auch im touristischem Bereich – zu den besonderen palmerischen Gerichten | |||
=== '''Festkultur''' === | |||
Über das Jahr verteilt gibt es mehrere, teils regional begrenzte Feste. Mit dem Mandelblütenfest im Februar oder März in Puntagorda, wo die meisten Mandelbäume der Insel anzutreffen sind, beginnt der Reigen der Feste auf der Insel. Am 5. Mai wird in der „Fiesta de la Cruz“ die Eroberung der Insel und Gründung der Hauptstadt Santa Cruz gefeiert. Hierzu werden auf der ganzen Insel Kreuze in wertvolle Stofftücher und Papier verhüllt und mit Blumen und Kerzen geschmückt werden. | |||
Die ''Bajada de la Virgen de las Nieves'' („Niederkunft der Jungfrau vom Schnee“) ist eines der herausragenden kanarischen Feste. Es geht auf das Jahr 1676 zurück, in dem auf der Insel große Dürre herrschte. Um eine drohende Missernte abzuwenden, ordnete der kanarische Bischof Jimenz an, die auf der ganzen Insel verehrte Statue der Jungfrau vom Schnee in Las Nieves in einer Prozession in die Hauptstadt zu tragen. Der langersehnte Regen stellt sich danach ein. Die Prozession wird daraufhin alle fünf Jahre wiederholt, das nächste Mal im Jahr 2015. Die Feierlichkeiten ziehen sich jeweils im Sommer über mehr als einen Monat hin. Ein Höhepunkt der Fiesta ist der Maskentanz der Zwerge (''enanas'') in Santa Cruz. | |||
Ein weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten auf La Palma ist der Karneval, dessen Umzüge in den Karneval-Hochburgen von Santa Cruz und Los Llanos den Vergleich mit dem in Rio nicht scheuen brauchen. | |||
'''Fest- und Feeiertage:''' | |||
* 1. Januar - Año Nuevo (Neujahr) | |||
* 6. Januar - Los Reyes (Heilige Drei Könige): größtes Geschenkfest der Kanarischen Inseln | |||
* 17. Janaur - San Antonio Abad (Antoniustag): Patronatsfest in Fuencaliente | |||
* um 30. Januar - Fiesta del Flor del Almandro (Mandelblütenfest) in Puntagorda | |||
* 2. Februar - La Candelaria (Lichtmess) | |||
* 3. Februar - Fiesta de San Blas (Blasiusfest) in Mazo | |||
* Februar bis 24. März - Carnaval (Karneval) in Santa Cruz | |||
* 5. März - San Vicente (Vinzenztag): Patronatsfest von Garafía | |||
* 19. März - Fiesta del Patriarca San José (Josefstag): Vatertagsfest | |||
* April - Semana Santa (Karwoche) und Pascua (Ostern) | |||
* 24./27. April - Nuestra Señora de Mont Serrat (Heilige Jungfrau von Montserrat): Fest in San Andrès y Sauces | |||
* 1. Mai - Día del Trabajo (Tag der Arbeit) | |||
* 3./4. Mai - Día de la Cruz (Tag des Kreuzes): Fest anlässlich des Endes der Conquista in Santa Cruz, Breña Baja und Mazo | |||
* 15. Mai - San Isidro (Isidorstag): Ackerbaufest in Breña Alta | |||
* 1. Maisonntag - Día de la Madre (Muttertag) | |||
* Ende Mai - Corpus Christi (Fronleichnam) | |||
* 30. Mai - Día del Canarios (Tag der Kanaren): Regionalfeiertag | |||
* Anfang Juni - Pentecostés (Pfingsten) | |||
* 12./13. Juni - Vacas Palmeras (Palmerische Rinder): Viehmarkt in San Antonio del Monte, Gemeinde Garafía | |||
* 24. Juni - Fiesta San Juan Bautista (Johannistag): Sonnwendfeiern | |||
* 26. Juni bis 2. Juli - Fiesta de la Nuestra Señora de los Remedios (Fest unserer lieben Frau des Heils) in Los Llanos de Aridane, findet alle „ungeraden“ Jahre statt | |||
* 28. Juni - Ende Juli Bajada de la Virgen de las Nieves (Herabkunft der Heiligen Jungfrau): in Santa Cruz ungefähr alle zwei Jahre stattfindendes Fest | |||
* 29. Juni - Pedro y Paulo (Peter und Paul) | |||
* Ende Juni - Fiesta del Sagrada Corazón Jesú (Fest des Heiligen Herzens Jesu): geschmückter Umzug durch Breña Alta | |||
* 16. Juli - Nuestra Señora del Carmen (Carmenstag): Fischerfest in Tazacorte | |||
* 25. Juli - Santiago (Jakobstag): Fest des Schutzpatrons Spaniens | |||
* 25./26. Juli - Fiesta Santa Ana (Fest der heiligen Anna): Kunstfest in Breña Baja | |||
* 2. Augustsonntag - Nuestra Virgen del Pino (Unsere Jungfrau der Pinien): Festauftakt in El Paso, findet alle drei Jahre statt | |||
* 15. August - Asunción (Mariae Himmelfahrt) | |||
* August - Encarnación (Fleischwerdung Christi): Fest in Breña Alta Piedad (Gnadenfest) in Los Sauces Nuestra Señora de las Angustias (Unsere gequälte liebe Frau): Fest in Los Llanos | |||
* 14. - 30. August - La Vendimia (Weinlesefest) in Fuencaliente | |||
* 3. Augustsonntag - Fiesta San Mauro (Mauro-Fest) in Puntagorda | |||
* 25. August - Nuestra Señora de la Luz (Unsere liebe Frau des Lichts): Fest in Garafía | |||
* 4. Augustsonntag - Fiesta de El Cubo de la Galga (Fest am Galga-Bergkamm) in Puntallana | |||
* 1. Septembersonntag - Nuestra Virgen del Pino (Unsere Jungfrau der Pinien): Fest der Schutzheiligen von El Paso | |||
* 7./8. September - Fiesta de la Virgen de Candelaria (Mariae Reinigungsfest) in Tijarafe | |||
* 13. bis 15. September - Fiesta de la Luz (Lichtfest) in Garafía | |||
* 29. September - Fiesta del San Miguel (Michaelsfest) zur Erinnerung an den des Conquistadors de Lugo in Tazacorte und Santa Cruz | |||
* 7. Oktober - Fiesta de Santa Rosario (Rosariofest) in Barlovento zur Erinnerung an die Schlacht von Lepanto | |||
* 12. Oktober - Día de la Hispanidad (Spanischer Nationalfeiertag) zur Erinnerung an die „Entdeckung Amerikas“ durch Kolumbus | |||
* 1. November - Todos los Santos (Allerheiligen) | |||
* 11. November - Día de San Martín (Martinstag): Weinfest | |||
* 22. November - Fiesta de la Santa Cecilia (Cäcilienfest) in Del Charco, Gemeinde Fuencaliente | |||
* 30. November - Día de San Andrés (Andreastag) in San Andrès | |||
* 6. Dezember - Día de la Constitución (Tag der spanischen Verfassung) | |||
* 8. Dezember - Inmaculada Concepción (Unbefleckte Empfängnis Marias) | |||
* 11. Dezember - Día de San Martín (Sankt Martinstag): Fest mit Umtrunk in Mazo und Fuencaliente | |||
* 13. Dezember - Fiesta Santa Lucia (Luzienfest) in Puntallana | |||
* 25. Dezember - Navidad (Weihnachten): ein simpler Feiertag | |||
* 31. Dezember - Noche del Año Viejo (Altjahrstag) | |||
== '''Medien und Kommunikation''' == | |||
Es gibt keine spezifische Liste von Zeitungen, die ausschließlich auf La Palma erscheinen. Allerdings gibt es mehrere Online-Magazine und Blogs, die Nachrichten und Informationen über die Insel bereitstellen: | |||
* '''La Palma Journal''' - bietet täglich aktuelle Nachrichten und Informationen über La Palma | |||
* '''La Palma Aktuell''' - enthält frische Nachrichten und Tipps für den Urlaub auf La Palma | |||
* '''Lavastein-Blog''' - bietet aktuelle Nachrichten und Infos aus La Palma, von den Kanarischen Inseln und darüber hinaus | |||
* '''Idafe Blog''' - behandelt Themen wie Gleitschirmfliegen und Wettervorhersagen auf La Palma | |||
La Palma gilt die Telefonvorwahl 0(034)44. Die Postleitzahl von Santa Cruz de la Palma lautet 38700, für Tazacorte 38110. | |||
== '''Sport''' == | |||
Hauptsportarten der Insel sind Fußball und Lucha Canaria. Für Gäste der Insel bestehen im sportlichen Bereich folgende Gegebenheiten: | |||
* Baden: 35 Badestrände in 6 Gemeinden - Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, Mazo, San Andrés y Sauces, Santa Cruz und Tazacorte | |||
* Fußball: rund 15 Clubs, Wettkämpfe vor allem April bis August | |||
* Gleitschirm- und Drachenfliegen: organisiert vom Verein „Pegasus“ in Puerto Naos | |||
* Juego de Palos: Fechten mit biegsamen Ruten - bei Fiestas üblich | |||
* Lucha Canaria: (Kanarischer Ringkampf, palmerischer Nationalsport - wird wettkampfmäßig in mehreren Vereinen und eigenen „Stadien“ praktiziert | |||
* Radfahren: 2 Fahrradverleiher - in Los Llanos de Asridane und Santa Cruz | |||
* Segeln: Bunker in Santa Cruz | |||
* Surfen: Zentrum in Playa Nueva bei Puerto Naos | |||
* Tauchen: 2 Zentren - DIWA-Basis El Paso und Diving Centro Cancajos in Fuencaliente | |||
* Tennis: 7 öffentliche bzw. hoteleigene Anlagen - in Barlovento, Breña Alta, Los Llanos de Aridane, nahe Los Llanos, in Puerto Naos, Santa Cruz und Todoque; wichtigster Verein: Club de Tennis Valle de Aridane in Los Llanos de Aridane | |||
'''Fußball''' | |||
Fußball ist auf der Insel zwar populär, wird aber als Vereinssport nur unterklassig betrieben ... oder wurde, bis der österereichische Brausehersteller Red Bull die Insel als Investitionsobjekt entdeckte. "Zum 1. Januar 2021 wurde "Red Bull La Palma C.F." gegründet, eine Fußballmannschaft mit großen Ambitionen. Man trat "in Verhandlungen mit dem Cabildo Insular, um eine sportliche Heimstätte zu erlangen" und bemühte sich, bei den Inselbewohnern mit den hochtrabenden Plänen nicht zu sehr in Misskredit zu geraten. "Die Reaktionen der Fußballanhänger hier auf der Insel fallen recht unterschiedlich aus. Gerade die Fans von Tenisca und Mensajero, unseren beiden Traditionsclubs in La Palma zeigen sich wenig begeistert. Auf der anderen Seite hat sich aber auch schon ein Fanclub gebildet. Die Leute nennen sich „Peña Toro Rojo“ und sind schon mit eigenem Logo und Internetauftritt am Start. Böse Zungen behaupten allerdings, dass es sich bei diesem Fanclub auch nur um ein Marketinginstrument des Brauseherstellers handeln würde." (https://news.la-palma-aktuell.de/2020/12/28/red-bull-la-palma/). | |||
'''Lucha Canaria''' | |||
Lucha Canaria ist ein kanarischer Ringkampf, der bereits vonden Ureinwohnern ausgetragen wurde. 1420 berichtete der Chronist Alvar Garcia de Santa Maria über diese Sportart der Kanaren. Es wird vermutet, dass durch diese Kämpfe Streitigkeiten unter der Urbevölkerung unblutig entschieden wurden. Lucha Canaria ist ein Mannschaftssport, der von zwölf Kämpfern ausgetragen wird. Es ringen immer zwei miteinander. Verloren hat derjenige, dessen Oberkörper zuerst den Boden berührt. Ein Kampf geht über 3 Runden von maximal 2 Minuten Dauer. Hirtensprung (''Salto del pastor'') ist ein auf den Kanarischen Inseln verbreiteter Volkssport, der seine Wurzeln im regionalen Brauchtum hat und wahrscheinlich auf die Ureinwohner zurückgeht. Um in möglichst kurzer Zeit im gebirgigen Gelände Höhenunterschiede schnell und sicher zu überwinden, benutzten die Viehhirten einen mehrere Meter langen Holzstab, den „Regatón“, um auf ein tiefer gelegenes Gelände zu gelangen. | |||
Aufgrund des begrenzten Kontakts zwischen den verschiedenen Inseln entwickelte jede von ihnen unterschiedliche Regeln für die Ausübung des Ringens. Es wird vermutet, dass das Ringen bei wichtigen Anlässen praktiziert wurde, um Konflikte zu lösen. Es wird auch angenommen, dass das Ringen bei wichtigen Anlässen praktiziert wurde, um Konflikte zu lösen. Bis zum Ende des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts entsprach die Organisation von Ringkämpfen einem natürlichen evolutionären Muster, das darin bestand, dass Völker oder Seiten (Nord-Süd) gegeneinander antraten. Oder zwischen Ringern von verschiedenen Inseln. Kurioserweise wurde das erste Reglement für den Ringkampf 1872 in Matanzas (Kuba) erlassen, und erst 1960 wurde mit dem Allgemeinen Organischen Reglement ein gemeinsames Reglement für alle Inseln vereinbart. | |||
Auf La Palma existieren folgende Mannschaften: | |||
La Palma | |||
Primera Categoría | |||
* CL Aurita Tedote | |||
* CL Balta | |||
* CL Candelaría | |||
* CL Aridane | |||
* CL Tazacorte | |||
* CL Tamanca | |||
* CL Tijarafe | |||
* CL Tedote | |||
* CL Candelaria de Mirca | |||
* CL Tamanca Las Manchas | |||
Tercera Categoría | |||
* CL Bediesta | |||
* CL San Antonio de Abad | |||
== '''Persönlichkeiten''' == | |||
Die wichtigsten mit La Palma verbundenen Persönlichkeiten sind: | |||
* Tanausú: Der letzte Inselhäuptling, der sich gegen die spanischen Eroberer wehrte. Er verteidigte seine Stellung im Barranco de las Angustias bis zu seiner Gefangennahme und wird von den Einheimischen al,s eine Art Nationalheld verehrt. | |||
* Alonso Fernández de Lugo: Er war der spanische Eroberer, der La Palma im Jahr 1493 für die Krone von Kastilien einnahm. Obwohl er nicht von der Insel stammte, spielte er eine entscheidende Rolle in ihrer Geschichte. | |||
* Luis Morera: Geboren 1946, ist er ein vielseitiges künstlerisches Talent. Morera ist Musiker, Maler, Architekt und Dichter. Er ist bekannt für seine Neuinterpretationen kanarischer Volksmusik und seine Kunstwerke, die auf der ganzen Insel zu finden sind | |||
* Maria Montez: Obwohl sie in der Dominikanischen Republik geboren wurde, betrachten die Palmeros sie als Tochter ihrer Insel. Sie war ein Hollywood-Star der 1940er Jahre und spielte in Filmen wie "1001 Nacht" und "Ali Baba und die 40 Räuber" | |||
* Manolo Blahnik: Geboren 1940 in Santa Cruz de La Palma, ist er ein weltberühmter Schuhdesigner. Blahnik wurde als "Gott der Stilettos" bezeichnet und hat zahlreiche Preise für seine Arbeit erhalten5. | |||
* Dionisio O'Daly: Dieser irische Kaufmann spielte eine wichtige Rolle in der politischen Geschichte La Palmas. Dank seiner Bemühungen fanden 1773 die ersten demokratischen Wahlen Spaniens durch Zensuswahlrecht auf der Insel statt | |||
* Carmen Ramos Rodríguez: Geboren 1950 in Tijarafe, hat sie eine bedeutende Karriere in den Medien der Insel gemacht. | |||
== '''Fremdenverkehr''' == | |||
1890 gab es auf La Palma erste kleine Hotels. Vor allem die Erholung suchenden Engländer frequentierten Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts gern die westlichste Kanareninsel. Einige Jahrzehnte später ging es mit dem Tourismus auf La Palma bergab, in den 1960er Jahren kam er fast ganz zum Erliegen. In den 1970er Jahren und Anfang der 1980er Jahre profitierte La Palma ein wenig vom Massen- und Chartertourismus auf den beiden Kanarenhauptinseln Teneriffa und Gran Canaria. Das damals einzige große Hotel entstand (''Sol La Palma'', Puerto Naos, 200 Betten). In dieser Zeit gab es unter der einheimischen Bevölkerung noch Vorbehalte gegen den Zustrom von Fremden, die sich in Graffitis an Hauswänden (''Alemanes fuera, Deutsche raus'') äußerten. Dass auf La Palma der Tourismus auch für die Bevölkerung eine wichtige Einnahmequelle ist, hat derartige Anfeindungen verstummen lassen. La Palma ist mittlerweile ein Aussteigerparadies für ''Mittelstandsaussteiger'' geworden, wobei der Anteil der Deutschen am größten ist, gefolgt von Niederländern, Schweizern und Briten. | |||
Erst Ende der 1980er Jahre waren nach der Erweiterung des palmerischen Flughafens für den internationalen Charterverkehr im Tourismusbereich kräftige Zuwachsraten zu verzeichnen. In den 2000er Jahren entstand die Hotelanlage ''La Palma Princess/Teneguia Princess'' mit 400 Betten, abgeschieden an der Südspitze La Palmas, unterhalb von Fuencaliente. Trotz stetig sinkender Fluggastzahlen auf La Palma von einer maximalen Anzahl von 1.207.572 im Jahr 2007 auf 965.779 in 2012 (ein Rückgang von 20 %) wurde 2011 ein neues Flughafengebäude eingeweiht. | |||
Bei einem Angebot von etwa 7500 Betten kann man auf La Palma noch nicht von Massentourismus sprechen. Neben den wenigen größeren Hotels sind die Touristen vorwiegend in Ferienwohnungen und kleineren Häusern (Fincas) untergebracht. Die Ferienzentren mit den meisten Touristen befinden sich auf der Westseite der Insel in der Gegend von Puerto Naos und auf der Ostseite von Los Cancajos. Die Strände von Puerto Naos und Los Cancajos tragen die blaue Flagge der EU und erfüllen somit einen gehobenen Qualitätsstandard. | |||
La Palma ist traditionell eine Wanderinsel, entsprechend groß ist die Anzahl der Anbieter von Wanderausflügen in die verschiedensten Regionen der Insel. | |||
Seit Ende der 1990er Jahre haben sich auch verschiedene Anbieter sportlicher Aktivitäten etabliert. So werden beispielsweise geführte Mountainbiketouren oder Reitexkursionen angeboten, verschiedene Tauchbasen auf der Ost- und Westseite der Insel haben sich etabliert. | |||
Seit 1992 hat sich die ''Asociación insular de Turismo Rural Isla Bonita'' die Förderung des ländlichen Tourismus auf der Insel La Palma zur Aufgabe gemacht. Hierzu zählen insbesondere die Förderung der ländlichen Unterkünfte und anderer touristischer Ressourcen, wie Management-Training, Verwaltung der Museen und Sehenswürdigkeiten. Der Verein ist ein Zusammenschluss von etwa hundert Häuservermietern, kleinen Unternehmen und Berufsverbänden. | |||
Zur Förderung der ländlichen Unterkünfte (mit EU-Geldern) wurden etwa 65 alte Häuser (Fincas) in der typischen Landschaftsarchitektur restauriert (bis zum Jahr 2000). Zu dieser Bauweise gehören beispielsweise Decken in ''Tea-Holz'', Holzbalkone, meterdicke Steinwände und die typisch gemauerten Sitzbänke unter den Fenstern. Die Restaurationsarbeiten fördern gleichzeitig die einheimische Handwerkschaft. Mit dem Erhalt und der Vermietung der Häuser wird der Landflucht entgegengewirkt mit dem Effekt, dass auch die traditionelle Agrarstruktur erhalten bleibt. (''Tea-Holz'' wird aus dem harten Kern der kanarischen Kiefer gewonnen und ist äußerst resistent gegen Feuchtigkeit und lässt sich gut mit dem Stechbeitel bearbeiten.) | |||
Zur Untersuchung der Vorstellungen der Touristen über den Urlaubsort La Palma wurde im Auftrag der ''Asociación de Turismo Rural Isla Bonita'' im Jahr 2007 eine Befragung von 316 Touristen in 181 Unterkünften auf La Palma durchgeführt. Der Altersanteil der Befragten unter 45 Jahre lag bei 68 Prozent. Die Vorstellungen über den Urlaubsort La Palma gaben sie wie folgt an: Bevorzugt wird ein Urlaubsort, der eher abgeschiedenen und nicht überfüllt ist, Erholung und sportliche Aktivitäten in einer natürlichen Umwelt (Wandern und zu einem geringeren Maße Schwimmen) bietet und die Urlaubsausgaben auch der Bevölkerung des Ortes zugutekommen. Besondere Wertschätzungen des Urlaubsortes finden die Landschaft, die Ruhe, die öffentliche Sicherheit wie die einheimische Küche. Ein am wenigstens geschätzter Aspekte ist das Nachtleben. | |||
== '''Literatur''' == | |||
* wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:La_Palma | |||
* wikitravel: https://wikitravel.org/de/La_Palma | |||
* wikivoyage: https://de.wikivoyage.org/wiki/La_Palma | |||
* Fray Juan de '''Abreu Galindo''': Historia de la Conquista de las siete islas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife 1977 | |||
* L. '''Afonso Peréz''' (ed.): Geografía de Canarias, 6 vol., Santa Cruz de Tenerife 1984/85 | |||
* ders. et al. (ed.): Atlas Básico de Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1980 | |||
* Leoncio '''Alfonso''': Esquema de Geografía física de las Islas Canarias, La Laguna de Tenerife 1953 | |||
* E. '''Alonso''': Tierra Canaria, Madrid 1981 | |||
* ders.: Floklore Canario, Las Palmas de Gran Canaria 1985 | |||
* Diego '''Álvarez de Silva''': Historia de Canarias, Santa Cruz de Tenerife (1705) | |||
* José Miguel '''Alzola''': Biografía apresurada del Arquipiélago Canario | |||
== | == '''Reiseangebote''' == | ||
Urlaubsguru - La Palma Erkundung = https://www.urlaubsguru.at/pauschalreisen/la-palma/ | |||
= | La Palma All Inclusive = https://www.ab-ins-blaue.at/urlaub/kanaren/la-palma/all-inclusive-urlaub.html | ||
Tui Pauschalreisen La Palma = https://www.tui.at/pauschalreisen/spanien/la-palma/ | |||
== '''Forum''' == | |||
Hier geht's zum Forum: https://www.insularium.org/forum/viewforum.php?f=6 | |||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2025, 17:24 Uhr
La Palma war für viele europäische Exilanten - Aufsässigen in ihren Heimatländern - eine letzte Zuflucht. In den 1970er Jahren galt die Insel als Aussteigerparadies für Hippies und Öko-Freaks. Als Heimat von insgesamt 120 Vulkanen kann sie aber auch höllische Qualitäten entfalten. Eruptionen haben das Eiland geformt und immer wieder neu gestaltet. An der Schroffheit La Palmas sind einstmals schon die spanischen Eroberer verzweifelt. Die bestens an die schwierigen ökologischen Verhältnisse angepassten Ureinwohner waren nur durch Verrat zu bezwingen. Ihre in einer Vielzahl von Relikten erhalten gebliebene Kultur wurde während der Kolonisierungsphase wiéitgehend zerstört, wird aber in letzter Zeit wieder verstärkt gewürdigt.
| Inselsteckbrief | |
|---|---|
| offizieller Name | Isla de San Miguel de La Palma |
| alternative Bezeichnungen | Iunonia, Junonia (um 50), Al-Ghanam (1124), Aragauia (1349/50), Liparme (1351), Ysla de Palme (1367), Palmaria (15. Jahrhundert), Benahoare (1590), Benahorare (1632), Planaria (1679), Benehoare (1764), Bena Hoave (1803), Benajoare, Banahoare (19. Jahrhundert), La Palma (ab 17. Jahrhundert) |
| Kategorie | Meeresinsel |
| Inseltyp | echte Insel |
| Inselart | vulkanische Insel (Hot Spot) |
| Gewässer | Atlantischer Ozean (Oceano Atlantico) |
| Inselgruppe | Kanarische Inseln (Islas Canarias) |
| politische Zugehörigkeit | Staat: Spanien (Reino de España) Region: Kanarische Inseln (Comunidad Autónoma de Canarias) Provinz: Santa Cruz de Tenerife |
| Gliederung | 14 municipios (Großgemeinden) 136 barríos (Stadtteile), pueblos (Dörfer) und caseríos (Hofgemeinschaften) |
| Status | Inselgemeinschaft (comunidad insular) |
| Koordinaten | 28°37‘ N, 17°52‘ W |
| Entfernung zur nächsten Insel | 50 m (Roque de las Tabaibas), 54 km (Gomera) |
| Entfernung zum Festland | 445 km (Cap Bojador / Marokko) |
| Fläche | 708,16 km² / 273,42 mi² (mit Nebeninseln 708,32 km² / 273,48 mi²) |
| geschütztes Gebiet | 236 km² / 91 mi² (33,3 %) |
| maximale Länge | 45,3 km (N-S) |
| maximale Breite | 27,9 km (W-O) |
| Küstenlänge | 155,6 km |
| tiefste Stelle | 0 m (Atlantischer Ozean) |
| höchste Stelle | 2426 m (Roque de los Muchachos) |
| relative Höhe | 2426 m |
| mittlere Höhe | 560 m |
| maximaler Tidenhub | 2,3 bis 2,5 m (Santa Cruz de La Palma 2,4 m) |
| Zeitzone | HCE (Hora Central Europea / Mitteleuropäische Zeit, UTC+1) |
| Realzeit | UTC minus 12 Stunde 11 bis 12 Minuten |
| Einwohnerzahl | 85.104 (2024) |
| Dichte (Einwohner pro km²) | 120,15 |
| Inselzentrum | Santa Cruz de La Palma |
Name
La Palma, dieser Name erinnert schon vom Klang her an paradiesische Zustände, an Sonne, Strand und elysische Gefielde. Das Wort wird in der Regel als „Palmeninsel“ gedeutet, tatsächlich aber bezeichnet der spanische Ausdruck palma einen „Palmwedel“, wohingegen die „Palme“ in der gleichen Sprache palmera genannt wird. Aber wie auch immer, das Spanische bildet ja doch nur das letzte Glied in einer langen Namensgeschichte.
Begonnen hat die Sache vermutlich mit den Phöniziern, die zu Beginn des -1. Jahrtausends das Meer rund um die Kanaren erkundeten. Wie sie und in ihrem Gefolge ägyptische und römische Geografen die Insel nannten, ist nicht überliefert. Üblicherweise wird die von Plinius im 1. Jahrhundert überlieferte Bezeichnung Iunonia bzw. Junonia - wohl „Land der Juno“, dem vergöttlichten Ideal der römischen Hausmutter - für eine der Insulae Canariae mit La Palma in Zusammenhang gebracht (Biedermann 1983:15-16). Ebenso der aus einer arabischen Quelle des Jahres 1124 stammende Name El-Ghanam. Mit absoluter Sicherheit lässt sich dies aber nicht sagen.
Ebensowenig weiß man, wie die berberstämmigen Ureinwohner ihr heimatliches Eiland nannten. Ein erster interessanter Hinweis auf eine mögliche ursprüngliche Namensgebung findet sich in dem 1349/50 von einem sevillaner Franziskanermönch verfassten Libro del Conoscimiento de todos los reinos e tierras e señorios que son por el mundo (Ulbrich 1989:100). Darin erscheint La Palma als Aragauia, und dieser Name erinnert verblüffend an die Eigenbezeichnung der altkanarischen Eingeborenen der Insel: Auarita bzw. Aguarita, was nach heute üblicher Interpretation „Landsleute“ bedeuten soll (Wölfel 1965:612). Bei alledem bleibt indes unklar, wo er dieses Wort her hatte. Bezog er es maurischen Quellen oder durch italienische Vermittler? Stammte es letztendlich gar von den Inselbewohnern selbst, oder wurde es bloß durch Nachbarstämme vermittelt? Wir wissen es nicht.
Jene frühen Besucher jedenfalls, die ein gewisses forscherisches Interesse an der altkanarischen Kultur hegten, allen voran Leonardo Torriani 1590 und Juan de Abreu Galindo 1632, überlieferten eine andere ursprüngliche Inselbezeichnung, nämlich Benahorare bzw. Benahoare. Spätere Autoren übernahmen diesen Begriff, wandelten seine Schreibung jedoch ab. So heißt die Insel bei George Glas 1764 Benehoare, bei Bory de Saint Vincent 1803 Bena Hoave, bei Thomas Muñoz y Romero Benajoare und bei Rodriguez Lorenzo ebenfalls im 19. Jahrhundert Banahore. Was das nun wieder bedeuten soll, darüber liefern sich die Gelehrten bis heute die allerheftigsten Wortgefechte. Einigermaßen klar ist bloß, dass bena, auch beni, mit „Land bzw. Gegend von“ zu übersetzen ist. Bei ho(r)are scheiden sich dann aber die Geister. Die einen sehen darin ganz simpel die Übertragung eines berberischen Stammesnamens aus dem marokkanischen Teil des Atlas-Gebirges - Hoara, Havar, Houar, heute Beni Hoarin (seit Glas 1767:172) - auf die Kanaren, die anderen schürfen tiefer und stoßen dabei auf Wortwurzeln wie etwa den berberischen Ausdruck tehwiwit, der soviel wie „Breite, Spanne“ bedeutet (Wölfel 1965:611), den Begriff wen-ahûwwâr mit der Bedeutung "Ort der Vorfahren" (Ignacio Reyes) oder das altkanarische quevihiera mit dem Sinngehalt „mein“ (Wölfel 1965:477). Sabin Bertholet ging um 1870 einen ganz anderen Weg, formte aus dem zweiten Namensteil das Wort Haouâràh, deutete selbiges als Eigenbezeichnung der Inselbewohner, in erweiterter Form Haouarytes, vereinfacht Auarites, und schuf damit jenen Begriff, mit dem noch heute die Urpalmesen bedacht werden.
Abseits dessen trug die Insel in europäischen Quellen ganz andere Namen. 1351 erscheint sie in der Mappamundi der Medici als Liparme. Dabei handelt es sich offensichtlich um eine Verballhornung des italienischen Ausdrucks „li palme“, was „die Palme“ bedeutet. Auf der Pizzigani-Karte von 1367 findet sich das kanarische Eiland schließlich als Ysla de Palme wieder, was dem heutigen Namen schon recht nahe kommt. Dass diese Bezeichnung „Palmeninsel“ - also doch! - bedeutet, ist unbestritten. Und klar wird aus alledem auch, dass der letztgültige Inselname italienischen Ursprungs ist. Frühe spanische Autoren wie der Geschichtssschreiber versuchten den Ausdruck ihrem Idiom anzupassen, indem sie ihn als Palmaria hispanisierten. Don Cristobal Perez del Christo berief sich unterdessen in seinem 1679 erschienen Werk „Excelecias de las Canarias“ auf Gaius Plinius und nannte das Eiland in Vermischung verschiedener Begrifflichkeiten Planaria. Doch hatte sich zu seiner Zeit längst La Palma, amtlich offiziell Isla de La Palma, als Inselname durchgesetzt. Zu dessen Deutung merkte der Geschichtsschreiber Viera y Clavijo im 17. Jahrhundert an: „Aus einer gewissen Perspektive von See her ähnelt die Insel der mittens etwas abgeknickten Krone einer gewaltigen Palme, mit dichten, nach den Seiten hin wuchtig ausladenden Wedeln, deren Wölbungen an den Enden wie grüne Hügel aufragen.“ (Fleck 1994:23) Eine andere, an frühe Zeiten des Kolonialismus anklingende Interpretation ist heutigentags von Mallorkinern zu hören. Deren Erzählungen zufolge wäre La Palma schon anno 1311 von Vorfahren der heutigen Balearenser besiedelt worden, die in Erinnerung an ihre Heimat der Insel den Namen ihrer Hauptstadt - La Palma eben - gaben.
Die geschichtlich tatsächlich belegbaren ersten Fremdkolonisatoren, eine von Alonso Fernandez de Lugo befehligte spanische Schlägerertruppe, begann am 29.9., dem Tag des heiligen Michael, im Jahre 1492 von Tazacorte aus mit der Eroberung des Eilands. In Erinnerung an diesen barbarischen Akt der Gewalt wird die Insel seit damals verschiedentlich San Miguel de La Palma genannt. Als weitee Bezeichnungen haben sich in den letzten Jahren - von Touristenkreisen ausgehend - anheimelnde Namen wie Isla Verde, „grüne Insel“, oder Isla Bonita, „liebliche, nette, kleine Insel“, eingebürgert. Bei deutschsprechenden Besuchern, deren manche sich mittlerweile dauerhafter auf La Palma niedergelassen haben, ist verschiedentlich auch von der „Schweiz der Kanaren“ oder von der „drittschönsten Insel der Welt - nach Bora Bora und Hawaii“ (Reifenberger 1991:6) die Rede.
- international: La Palma
- altkanarisch: Benahoare, Benahorare
- amharisch: ላ ፓልማ [La Palma]
- arabisch: لابالما [la Bālmā]
- armenisch: Պալմա [Palma]
- bengalisch: লা পালমা [La Palma]
- birmanisch: လာပါလ်မား [La Palma]
- bulgarisch: Палма [Palma]
- chinesisch: 拉帕爾馬島 [lā pà ěr mǎ dǎo]
- georgisch: პალმა [Palma]
- griechisch: Λα Πάλμα [La Pálma]
- gudscheratisch: લા પાલ્મા [La Palma]
- hebräisch: לה פלמה [La Palma]
- hindi: ला पाल्मा [La Palma]
- japanisch: ラ・パルマ島 [pa ru ma tō]
- kambodschanisch: ឡាផាល់ម៉ា [La Palma]
- koreanisch: 라팔마섬 [ra pal ma seom]
- laotisch: ລາປາມາ [La Palma]
- lateinisch: Iunonia, Junonia
- malayalam: ല പാം [La Palma}
- maldivisch: ލާ ޕާލްމާ [La Paalma]
- orissisch: ଲା ପାଲ୍ମା [La Palma]
- pandschabisch: ਲਾ ਪਾਮਾ [La Palma]
- russisch: Пальма [Pal‘ma]
- serbisch: Ла Палма [La Palma]
- singhalesisch: ලා පාල්මා [La Palma]
- tamilisch: ல பாமா [La Palma]
- thai: ลาปามา [La Palma]
- tibetisch: ལ་པཱམ་ [La Palma]
- ukrainisch: Ла-Палма (La-Palma]
- urdu: لا پالما [La Palma]
- weißrussisch: Пальма [Pal‘ma]
Offizieller Name: Isla de San Miguel de La Palma
- Bezeichnung der Bewohner: Palmeros (Palmerer)
- adjektivisch: palmero (palmerisch)
Kürzel:
- Code: LP / LPA
- Kfz: -
- ISO-Code: ES.CI.LP
Lage
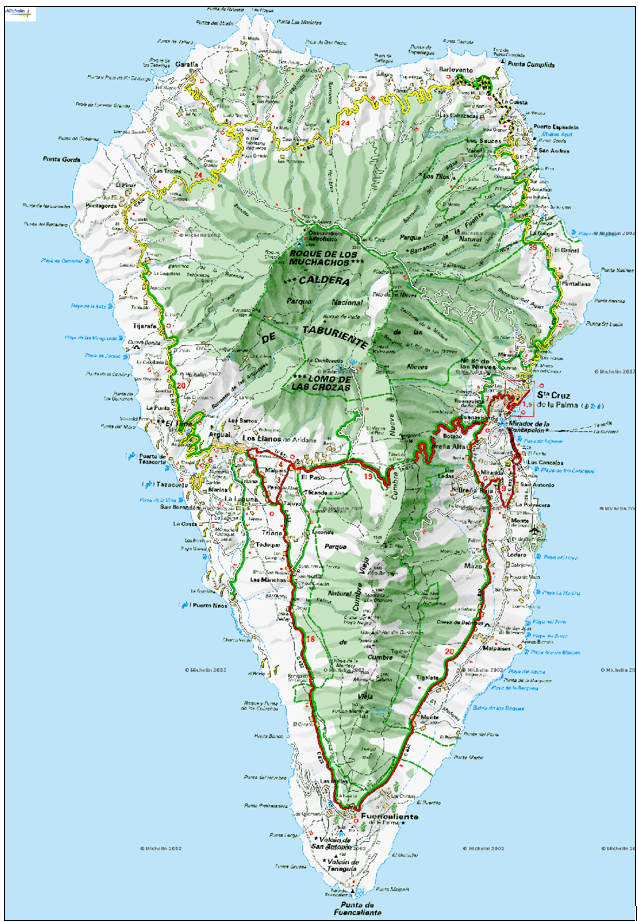
Die nächsten Nachbarn von La Palma sind Gomera im Südosten mit einer Entfernung von 54 km und El Hierro im Süden mit einer Küstendistanz von 69 km. Ebenfalls noch in Schönwettersichtweite, nämlich 85 km weit weg im Osten, befindet sich Teneriffa. Die übrigen Kanarischen Inseln liegen, nicht mehr ganz so greifbar, ebenfalls ostwärts - Gran Canaria 196 km, Fuerteventura 313 km und Lanzarote 385 km entfernt. Nicht viel weiter weg als letztere, genau vermessen 432 km in nördlicher Richtung, ist eine andere Atlantikinsel anzutreffen, nämlich Madeira. Bis zu den Azoren, konkret zur Insel Santa Maria, sind’s schon 1110 km und zur Kapverdischen Insel Santo Antão 1390 km. Die Bermudas schließlich sind durch 4500 km von La Palma getrennt. Das nächste Festland, die von Marokko annektierte sahrauische Küste um das Cap Bojador, ist 445 km entfernt, die portugiesische Algarve mit dem Cabo São Vicente als nächstgelegenem Punkt Europa 1240 km und Spaniens Cap Trafalgar 1380 km.
Die Erdkugelkoordinaten von La Palma sind 17°50’ w.L. und 28°35’ n.B.. Die Insel liegt damit auf in etwa gleicher Höhe wie der Südrand des marokkanischen Atlas-Gebirges, das Plateau du Tademaït in Algerien, die ägyptische Oase Bahariya, Bani Mazar im Niltal, das Sinai-Gebirge, die Südgrenze Kuwaits, die iranische Hafenstadt Bushehr, die zentralpakistanische Region um Sukkur am Indus, Delhi, der Chomolungma bzw. Mount Everest, der Südrand Tibets und der Norden Bhutans, die chinesischen Großstädte Yiyang, Nanchang und Changrao, die nördliche Ryukyu-Insel Oshima, der westliche Hawaii-Vorposten Kure, der zentrale Teil von Baja California, die mexikanische Metropole Chihuahua, Beeville und Port Lavaca im Süden von Texas und Orlando in Florida. Nördlichster Punkt der Insel ist der Punta de Juan Adalid bei El Palmar auf 28°51’15“ n.B., südlichster der Punta Fuencaliente auf 28°25’07“ n.B.. Den östlichsten Vorposten La Palmas bildet der Punta Salinas bei Puntallana auf 17°43’42“ w.L., den westlichsten der von Puntagorda aus erreichbare Punta del Serradero auf 18°00’15“ w.L..
Geografische Lage:
- nördlichster Punkt: 28°51’15“ n.B. (Punta de Juan Adalid)
- südlichster Punkt: 28°25’07“ n.B. (Punta Fuencaliente)
- östlichster Punkt: 17°43’42“ w.L.(Punta Salinas)
- westlichster Punkt: 18°00’15“ w.L. (Punta del Serradero)
Entfernungen:
- Gomera / Kanaren (Punta del Peligro) 54 km
- Hierro / Kanaren (Punta Norte) 69 km
- Teneriffa / Kanaren (Punta del Ancon) 85 km
- Gran Canaria / Kanaren (Punta de la Aldea) 196 km
- Fuerteventura / Kanaren (Punta Cotillo) 313 km
- Lanzarote / Kanaren (Punta Gines) 385 km
- Madeira (Ponta da Cruz) 432 km
- Westsahara / Marokko (Cap Bojador) 445 km
- Santa Maria / Azoren (Punta do Castelo) 1110 km
- Algarve / Portugal (Cabo de São Vicente) 1240 km
- Spanien (CapTrafalgar) 1380 km
- Santo Antão / Kapverden (Ponta do Sol) 1390 km
- Bermuda (Great Head) 4500 km
Zeitzone
Auf La Palma gilt die Hora Central Europea bzw. Central European Time (Mitteleuropäische Zeit), abgekürzt HCE bzw. CET (MEZ), eine Stunde vor der Koordinierten Welötzeit (UTC+1). Die Realzeit liegt um eine Stunde und 11 bis 12 Minuten hinter der Koordinierten Weltzeit (UTC).
Fläche
La Palma ist eine äußerst lebendige Insel, die einerseits durch Verwitterung und ozeanische Abtragungen schrumpft, andererseits durch vulkanische Aktivitäten immer wieder neues Land dazu gewinnt. Es ist also nicht leicht, dauerhaft genaue Angaben über die Gesamtfläche des kanarischen Eilands zu machen. Inoffizielle Darstellungen schwanken üblicherweise zwischen 705 und 708 km², doch wurde die Inselfläche bis in die achtziger Jahre hinein verschiedentlich auch auf 726 bis 730 km² veranschlagt bzw. auf „um 700 km²“ (Marco Polo 1994:5) abgerundet. Amtliche Angaben verlautbarten bis in die 1980er Jahre hinein 704,25 km² als Landfläche La Palmas, neueste Vermessungen ergaben jedoch um etliches mehr, nämlich 708,32 km² bzw. 273,48 mi², wobei sich dieser Wert bei Ebbe auf annähernd 709 km² erhöht. Zur Hauptinsel mit 708,1 km² kommen insgesamt 102 Felseninseln mit zusammen 16,2 ha. Größter der vorgelagerten Felsblöcke ist der Roque de las Taibadas vor Garafía mit einer Größe von 1,4 ha bzw. 260 mal 120 m und einer Höhe von 65 m. Die Küste ist insgesamt 155,6 km lang. Davon sind 128,5 km Fels- und Steilkpste, 8,2 km Kiesstrand, 5,1 km Hafenbereiche und 13,8 km sonstiges. Der Tidenhub beträgt 2,3 bis 2,5 m, in Santa Cruz de La Palma 2,4 m.
Die zwischen dem Punta de Juan Adalid und dem Punta Fuencaliente, großteils durch die Bergkette der Cumbre verlaufende Nord-Süd-Achse La Palmas ist 45,3 km lang. Die das Herz der Insel, die Caldera de Taburiente, querende West-Ost-Breite zwischen dem Punta del Serradero und dem Punta Salinas beträgt 27,9 km. Die mittlere palmerische Seehöhe liegt bei etwa 560 m. Höchster Gipfel ist der Roque de los Muchachos am Nordrand der Caldera de Taburiente mit 2426 m.
Flächenaufteilung 1991:
- Agrarland 360,12 km² (50,8 %)
- Äcker und Gärten 73,26 km²
- Weide- und Brachland 286,86 km²
- Waldland 292,28 km² (41,3 %)
- )Siedlungs- und Ödland 55,86 km² (7,9 %
Landschaft
„Dunkle Wolkenmassen ringsum“, dann „eine blutrote Stelle, die allmählich in ätherisch lichtes Purpur und Grünblau sich auflöst: das märchenhafte La Palma liegt vor uns“ (Lipps 1994:9). Diese Worte der Verzückung kritzelte Hermann Christ auf Papier, als er sich 1885 der „grünsten aller Kanareninseln“ näherte. Bunte Propekte greifen derartige Bilder gerne auf und verkünden wie etwa jener aus dem Jahr 1993: „Üppiges subtropisches Grün, Frieden, Stille, dazu ein herrlich blauer Himmel, grandiose Fernblicke und Sonnenuntergänge plus Baden im Dezember.“ (Fleck 1994:1)
Wer sich dem westlichsten Eiland der Kanaren vom Meer her nähert, wird allerdings nur weniger Badestrände ansichtig werden. Zumeist sind es senkrecht aus dem Meer emporwachsende, steile Klippen, die sich vor den per Schiff Anreisenden auftürmen. Dahinter sind in der Regel schroff aufragende Bergstöcke zu erkennen, die die Relikte einer vulkanischen Tätigkeit bilden, die im Süden noch immer nicht ganz erloschen ist. Das ansonsten üppig wirkende Flair der „grünen Insel des ewigen Frühlings“ verwandelt sich dort unversehens in eine Mondlandschaft. La Palma bildet also eine vielgesichtige kleine Welt für sich, die nicht einfach in irgendwelche Schablonen zu pressen ist - weder von seiner Natur, noch von seiner Kultur her.
La Palma ist ein „Kontinent im Kleinen“, der empfindlich auf alle Eingriffe reagiert, die abseits natürlicher Vorgänge seitens des Menschen vorgenommen werden. Zu den Eingriffen negativer Art gehören unter anderem die Abholzung bzw. das Abbrennen großer Flächen für die Schaffung landwirtschaftlich mehr oder weniger intensiv nutzbarer Flächen. Dazu gehören auch die Vermüllung ganzer Landstriche und die touristische Erschließung der Insel. Dazu gehört vor allem aber der Bananenanbau, der, seit den 1880er Jahren praktiziert, das ökologische Gefüge der Insel bereits schwer in Mitleidenschaft gezogen hat.
Dabei böte dieses ökologische Gefüge die allerbesten Voraussetzungen für so etwas wie paradiesische Zustände. Vulkanische Lava, wie sie sich zuletzt 1971 über den Süden La Palmas ergoss, ist zwar ursprünglich „malpaís“, also „schlechtes Land“, verwandelt sich aber mit der Zeit überall in fruchtbare Böden, die, sorgsam genutzt, eine große Bevölkerungszahl ernähren könnten. „Biologisch“ wirtschaftende Betriebe und geordnete Müllabfuhren gibt es jedoch bloß in Ansätzen, und ein ökologische Bewusstsein beginnt sich bei speziell jungen Palmeros erst seit den frühen 1990er Jahren zu entwickeln. Immerhin stehen heute 222 km² bzw. 31,3 % der Oberfläche La Palmas unter Schutz, wobei unter den 31 Territorien als größte der Parque Natural de la Cumbre Vieja y Teneguía mit 80,2 km² und der Parque Nacional de la Caldera de Taburiente mit 45,1 km² hervorzuheben sind.
Bezüglich der ökologischen Grundvoraussetzungen ist vor allem hervorzuheben, dass La Palma mit Abstand als wasserreichste Insel der Kanaren darstellt. Der Bevölkerung steht doppelt so viel Wasser zur Verfügung wie auf der zweitplazierten Insel Gomera. Dass es dennoch zu Knappheiten kommt, ist vor allem auf den Bananenanbau zurückzuführen. Neben den seit alters her genutzten Quellen, die heute rund 15 % des Wasseraufkommens stellen, wurden ab 1955 Brunnen, spanisch „pozos“, gebohrt und horizontale Wasserstollen, sogenannte „galerías“ - bis 1990 waren es insgesamt 23 mit über 200 km Länge -, angelegt. Dazu kommen Stauseen, deren größter jener von Barlovento mit 25 ha ist. Trotz aller Bemühungen, die Wasserversorgung per Plan zu regeln, hat sich die Qualität des kostbaren Nasses seit den achtziger Jahren enorm verschlechtert. Dazu kommt eine Absenkung des Grundwasserspiegels im Ausmaß von 4 m pro Jahr in unmittelbarer Umgebung der Stollen. Das wasserreiche La Palma läuft also Gefahr, sein kostbarstes Gut zu verschleudern und auszudünsten. Radikale Maßnahmen täten not, um das ökologische Gefüge wieder einigermaßen wiederherzustellen.
Die Isla de La Palma wird von ihren Bewohnern gern als „Herzensinsel“ bezeichnet, weil sie von oben betrachtet die Form eines Herzens hat - und natürlich weil „sie in ihr das kostbare Herzstück der Kanaren sehen.“ Weniger romantisch veranlagte Gemüter beschreiben sie als „gewaltigen, stumpfen Keil, der im Süden spitz zuläuft.“ (Fleck 1994:11) Wozu ein noch unromantischerer Begutachter, Udo Rabsch, anmerkt: Alles in allem sei die Insel „eben nichts anderes als der gigantische Ausguck, den eine Handvoll Vulkane über das Wasser gespuckt hatten und der die Form eines Herzens angenommen hatte, mit schwindelnden grünen Miradores, die voneinander getrennt waren durch die schwarzen Aderschächten von hunderten von Barrancos“ (Rabsch 1988:42). Peter Rothe schließlich macht, wissenschaftlich fundiert, unter Berufung auf C. Gagel klar, dass „man La Palma, ausgehend von dem die Mitte der Insel beherrschenden riesigen Erosionskrater Caldera de Taburiente, sehr treffend mit einer Birne vergleichen kann, aus der man mit einem Zirkelschnitt das Kerngehäuse herausgeholt hat.“ (Rothe 1986).
Was das landschaftliche Gepräge betrifft, so lassen sich mehrere, zum Teil deutlich voneinander abgegrenzte Höhenstufen unterscheiden, die jeweils mit eigenem Klima und eigener Vegetation aufwarten. Als erste wäre da die Küstenzone mit dem unmittelbaren Brandungsbereich bis etwa 50 m und dem weiteren Einzugsgebiet bis 300, maximal 500 m. Die Küste selbst misst in etwa 155 km, davon sind 128 km, also immerhin 82,6 %, steil und felsig, 13,8 km baumbewachsen und ebenfalls nicht grad flach, 8,2 km Sand- und Kiesstrand und 5 km für Häfen verbaut. Die zweite Höhenzone bis etwa 1500 m ist passatverwöhnter Lebensraum, darüber hinaus wird’s alpin. verweis=Datei:La_Palma_-_Caldera.png|rechts Den landschaftlichen Kern La Palmas bildet die Caldera de Taburiente, der Kessel von Taburiente. Sie umfasst annähernd 50 km², reicht von 300 bis 2426 m, ist rund 10 km lang und bis zu 7 km breit. „Hier liegen die reichsten unterirdischen Wasserreservoire der Insel. Aus unzähligen Quellen drückt das Wasser an die Oberfläche, wird für die Landwirtschaft angezapft und abgeleitet. Hier leben auch alle wild vorkommenden Tierarten der Insel, gedeihen alle Arten der reichen palmerischen Flora. Der Ort hat etwas Mystisches. Unter den steilen Wänden, in einer raumfüllenden Stille, die hin und wieder vom Rauschen des Wassers, dem Wind in den Pinien und dem durchdringenden Ruf einer „graja“, der palmerischen Dohle, unterbrochen wird, kommt sich der Mensch recht klein und unbedeutend vor.“ Die Urlandschaft „mit ihren steilen Wänden, Monolithen, Wasserfällen und Bächen, mit alten Pinien und verkrüppelten Zedern und mit Weitblicken über bizarre Felsen hinweg,“ ist mittlerweile geschützt. „1954 wurde das Gebiet zum Nationalpark erklärt, 1981 auf seine jetzige Ausdehnung von 4690 ha erweitert.“ (Marco Polo 1994:79-80)
Im Zentrum der „immergrünen, von Barrancos zerrissenen Urlandschaft“ der Caldera (Wolfsperger 1997:102) befindet sich die Playa de Taburiente. Es ist dies ein „breiter, geröllbedeckter und von einem Netz von Rinnsalen durchzogener Talgrund am Zusammenfluss mehererer Bäche“. Unmittelbar südlich davon erhebt sich „der heilige Fels der Altkanarier“, der Roque de Idafe (Lipps 1994:156-157). Rundum ist die Landschaft geprägt von steilen Felshängen mit zackigen Spitzen und tiefen Schluchten, deren größte und tiefste jene „der Todesängste“, in palmerisch-spanischer Diktion Barranco de las Angustias ist. Dazwischen finden sich zum Teil bereits stark verwitterte und leicht abgeflachte Bergrücken, die um die 1000 m Seehöhe, im Lomo de los Zacamos 1257 m erreichen. An der Grenze zwischen dem sogenannten Basalkomplex und dessen Deckschichten „treten die bedeutendsten Quellen der Caldera zutage.“ (Reifenberger 1991:28) Im Gebirgskamm, der einst den Kraterrand bildete, reicht diese Grenze bis über 2000 m. Die schroffen, im Winter bisweilen schneebedeckten Gipfel erreichen im Norden durchschnittlich 2200 m - am Roque Chico 2372 m, am Pico de los Muchachos 2426 m, am Fuente Nueva 2366 m, am Pico de la Cruz 2351 m, am Piedra Llana 2321 m und am Nievas 2230 m. Der südliche Kraterrandkamm gipfelt in 1857 m. An der Cumbrecita erreicht der Kraterrand des Taburiente mit 1287 m seinen niedrigsten Punkt. Zum Meer hin geht die Caldera respektive der Barranco de las Angustias langsam in das Valle de Aridane über.
Jenseits des Kraters fällt das Land nach Norden hin zunächst steil ab. „Große Höhenunterschiede haben dazu geführt“, dass diese Region, die Cumbres del Norte, „stark zerklüftet und unwegsam ist. Reißende Gebirgsbäche haben in den vergangenen Jahrtausenden unter feuchteren klimatischen Bedingungen als heute auf ihrem kurzen Weg zum Meer tiefe Schluchten in den Vulkankörper geschnitten.“ (Lipps 1994:17&20) Die bemerkenswertesten dieser Schluchten sind im Nordwesten der Insel die Barrancos de Garome, de las Animas, de Izcagua, de Briestas und de Domingo. Das hügelige Caldera-Vorland ist hier zum Teil intensiv bewirtschaftet, aber nur bedingt erschlossen. Alte Vulkankegel wie der Tabladitos (1516 m), Tricias (1209 m), Vaqueros (1154 m), Llanadas (945 m), Fernando Porto (584 m) und Matos (503 m), überragen die von lichten Wäldern bedeckte Landschaft. Die Küste fällt großteils in steilen Klippen zum Meer hin ab, wird von felsigen Inseln begleitet und von unzähligen Landvorsprüngen zergliedert. Größter Inselpflock ist der 270 m durchmessende und bis zu 65 m hohe Roque de las Taibadas. Die Ortschaften der Region - Arecida, Tijarafe, Fuente de Candelaria, Tabladito, Puntagorda, El Pinar, Las Tricias, Llano Negro und Garafia - sind auf einer Höhenstufe von 300 bis 600 m locker in die Hügellandschaft hineingebaut.
Im äußersten Norden wird die Insel von tiefen Schluchten wie den Barrancos de Fagundo, Franceses und Melchor Perez durchfurcht. Die „dichten Lorbeer- und Pinienwälder“, mit denen die Bergrücken bis in Küstennähe bestückt sind, erinnern „an nordische Lande.“ (Marco Polo 1994:35) Oberhalb der zum Meer hin teilweise über 400 m steil abfallenden Hänge finden sich die kleinen Ortschaften El Tablado, Franceses, Gallegos und La Tosca, letztere mit dem größten Drachenbaumhain der Kanarischen Inseln. Die Nordküste zwischen El Mudo und dem mit Leuchtturm bewehrten Punta Cumplida ist schroff, felsig und weist etliche Landvorsprünge auf - als bedeutendste von West nach Ost den Punta del Mudo, Punta del Rabisca, Punta del Juan Adalid, Prois de Don Pedro, Punta Gaviota und Punta del Corcho. Einen etwas leichteren Zugang zum Meer - zugleich den einzigen Strand weit und weg - findet man nur bei La Fajana unterhalb von Franceses bzw. El Tablado. Die Region insgesamt ist infrastrukturell nur schwach erschlossen und seit langem Abwanderungsgebiet. Die wirtschaftliche Nutzung beschränkt sich auf einzelne Gemüsegärten und Obsthaine, lediglich zur Küste hin finden sich einige Bananenplantagen.
Die Gegend um Barlovento, Los Sauces und San Andrés im äußersten Nordosten der Insel wirkt etwas reicher, wenngleich sich das landschaftliche Bild kaum ändert: tiefe Schluchten wie der Barranco Alvaro Diaz und der Barranco del Agua, bewaldete Bergrücken und steile, felsige Küsten mit Kaps wie dem Punta Talavera, Punta Salvajes und Punta Espindola. Hinter letzterem befindet sich ein kleiner Fischerhafen, Puerto Espindola. Etwas mehr als 2 km weiter nördlich befindet sich, direkt unterhalb von Barlovento eine moderne Naturschwimmbeckenanlage mit dem Namen La Fajana. Barlovento selbst liegt mitten in einer Pinien- und Fajal-Brezal-Zone. In einem kaum 500 m durchmessenden Krater oberhalb der Ortschaft wurde ein künstlicher See geschaffen, die Laguna de Barlovento. Zwei Bergrücken weiter südwärts ist ds Biosphärenreservat von Los Tilos anzutreffen mit dem „größten und besterhaltenen Lorbeerwald“ der Insel, mit „Riesenfarnen, Efeuranken, Kräutern und baumhohen Nesselgewächsen“ (Fleck 1994:59), mit kleinen Wasserfällen und den beiden bedeutendsten Quellen der Insel, den Nacientes de Marcos Cordero.
Nach Süden hin schließt La Palma Oriental, die Ostregion La Palmas, an. Hier setzt sich in der Cubo de la Galga die landschaftliche Mischung aus Schluchten und bewaldeten Bergrücken fort, wenngleich mit deutlich abnehmender Schroffheit. Die Barrancos de San Juan, de la Fuente, de Nogales und del Agua führen von den Abhängen der Caldera hinab auf die „schräge Hochfläche“ von Puntallana. Höchste Erhebung hier ist der Zamagallo mit 717 m. Gequert wird die wirtschaftlich relativ intensiv - vor allem als Getreide- und Bananenanbaugebiet - genutzte, hügelige Landschaft von einer Straße, an der sich fast ineinander übergehend mehrere Ortschaften aneinanderreihen - von Norden nach Süden Las Lomades, Las Galguito, La Galga, El Granel, Puntallana, Santa Lucia und Tenagua. Die Küste hier ist zwar weniger steil als weiter nördlich, aber nach wie vor nur schwer zugänglich. Am Punta Salinas erreicht sie den östlichsten Punkt der La Palmas.
Südlich des Barranco Seco beginnt das Land von Santa Cruz de La Palma. Die Inselhauptstadt mit ihren Vororten - Miranda, Mirca, El Morro, La Palmita, Machado, Quintero und El Planto - schmiegt sich an die Hänge der hier vergleichsweise flachen Küste. Dahinter steigen Bergrücken, die vor allem mit Kiefern bestanden sind, steil zur Caldera hin an. Höchster Gipfel der Region ist der Corralejo mit 2044 m. Zwischen den Kämmen stürzt das Land in steilen Klüften in die Barrancos - von Norden nach Süden del Carmen Dorador, de la Madera, de las Nieves und de los Pajaros - ab. Unmittelbar südlich der Stadt befindet sich der in 355 m am Concepción gipfelnde Krater des Monte de Luna, „Mondbergs“.
Die Region südlich von Santa Cruz, im Durchschnitt 300 m, war einstmals ein felsiges, mit Gestrüpp bedecktes Gelände, im spanischen Idiom Breñal. Heute ist es dicht besiedelt mit bebauten Flächen, Bananenplantagen und Getreidefeldern in mittleren Höhenlagen. Die Ortschaften Breña Alta und -Baja, San Antonio, Las Ledas, La Rosa und Mazo gehen beinah ineinander über. Sanfte Hügel - darunter der Breña mit 585 m - prägen das Bild. Die hier etwas flachere, vergleichsweise strandreiche Küste hat man zur Errichtung eines Flughafens und zur Einrichtung der wichtigsten touristischen Zentren La Palmas genutzt. Das Siedlungsgebiet wird im Westen vom Canal de Fuencalientes begrenzt. Hinter diesem steigt das Land langsam an - zu den Cumbres del Sur, der vulkanisch aktivsten Zone der Insel.
Seinen nördlichen Ausgangspunkt nimmt der zunächst von lockeren Kiefernwäldern bestandene Gebirgskamm im Bereich des Corralejo. Die Gipfel der Cumbre Nueva erreichen zwischen 1400 und 1850 m - der Ovejas ist 1854 m hoch, der Reventón 1435 m, der El Gallo 1579 m und der Pico Birigoyo als südlicher Endpunkt 1808 m. Die nach Süden hin anschließende Cumbre Vieja ist fast gänzlich kahl und besteht aus einer Reihe nach wie vor aktiver Vulkane, die heute durch einen speziellen Touristenpfad, die Ruta de los Vulcanos, erschlossen sind: Los Charcos (1848 m), Hoyo Negro (1871 m), Nambroque (1925 m), El Fraile (1782 m), Duraznero (1921 m), Deseada (1949 m), Los Lajiones (1849 m), Cabrito (1860 m), Hoya de la Manteca (1636 m), Volcán Martín (1602 m), Montaña Pelada (1441 m) und La Semilla bzw. Fuego (1249 m). Auf der südlich anschließenden vulkanischen Hochfläche liegt das Dorf Fuencaliente mit den „Vororten“ Las Caletas, Los Quemados und Las Indias, umgeben von den Kratern des Tablas (672 m) und des San Antonio (657 m). Den südlichen Vorposten der palmerischen Cumbre Vieja bildet schließlich der Teneguía (439 m) dessen Vorland bis zur Südspitze der Insel, den leuchtturmbewehrten Punta Fuencaliente, reicht. Das dunkle Gestein ist hier, verursacht durch die vielerorts aus dem Boden dringenden schwefelhaltigen Dämpfe ockergelb zersetzt und erreicht an manchen Tagen eine Oberflächentemperatur von bis zu 200°C.
Das durch die Vulkane geschaffene Neuland rings um die Cumbres del Sur wird von den Einheimischen Malpaís, „schlechtes Land“, genannt. Südlich von Mazo im Südosten La Palmas gibt es viel davon - Abandonado, „aufgegebenes Land“ mit überwucherten Terrassen und frisch angesetzter Vegetation. Die Barrancos - San Simon, de las Cuevas, de la Lava, de los Pinos und Roto - sind nur schwach ausgeprägt, und die Küste ist wohl felsig, großteils aber relativ gut zugänglich. Im Vorland der Vulkane finden sich einige wenige Krater und Kegel wie der Tirimaga (656 m) sowie - hintereinander aufgefädelt - die Ortschaften Malpaises, Tiguerote, Tigalate und Monte de Luna.
Die gegenüberliegende Inselseite, die Südwestregion La Palmas, ist „ein steiler, unzugänglicher Küstenabschnitt“, hinter dem sich „lichte Kiefernwälder“ über „sanfte Hänge“ schmiegen (Lipps 1994:130). Einzige Siedlungen sind hier der Weiler El Charco un d der Hafen El Remo. Etwas mehr menschliches Leben kommt weiter nördlich in die Landschaft. Las Manchas, „Flecken“, heißt dieses hügelige Weinbaugebiet um die Ortschaften Jedey und San Nicolás. Zur Küste hin entwässern die Barrancos de los Hombres und de Támanca, an deren Einmündung sich Puerto de Naos, einer der bedeutendsten Inselhäfen, mit den vorgelagerten Roques del Becerro befindet. Begrenzt wird diese Region durch einen jungen Lavastrom, an dessen Rand sich die heute für Touristen ausgebaute Streusiedlung Todoque befindet.
Das fruchtbarste und wirtschaftlich am intensivsten erschlossene Land La Palmas findet sich zweifellos im Valle de Aridane westlich der Cumbre Nueva und südlich der Caldera de Taburiente. In dessen oberem Bereich, dem westlichen Cumbre-Vorland, liegt im breiten Talkessel des Barranco de Tenisque zwischen 450 und 750 m. El Paso, die drittgrößte Ortschaft der Insel, zugleich Zentrum der Seidenraupenzucht und der Zigarrenherstellung. Die Region südlich von El Paso liegen eingebettet in das agrarisch genutzte flachgewellte Hügelland kleine Siedlungen wie Paraiso. Zur Cumbre hin setzen Pinienwälder an, die von einzelstehenden Kratern und Kegeln überragt werden wie der Montaña de Enrique (1242 m), Montaña Quemada (1376 m) und Montaña Marcos (1098 m).
Das eigentliche Aridane-Tal ist die am dichtesten besiedelte Region La Palmas mit den Hauptorten Los Llanos de Aridane, der heimlichen Inselhauptstadt, Tazacorte, La Laguna und Argual. Riesige Bananenplantagen geben dem sonnenverwöhnten und windgeschützten Land heute das Gepräge. Am deutlichsten sichtbar sind hier allerdings auch die ökologischen Schäden, die die intensive Bewirtschaft auf der nordwestlichen Kanareninsel hervorruft. Ein letzter Blick vom Time (594 m) an der Nordgrenze der Region mag dies am deutlichsten vor Augen führen. Wer allerdings den Blick nach Osten in die urwüchsige Natur der Caldera hinein schweifen lässt, wird sich letztlich zwar der landschaftlichen Widersprüchlichkeiten La Palmas bewusst werden, vielleicht aber auch Chancen für zukünftige Entwicklungen erkennen.

Erhebungen
Caldera de Taburiente:
- Roque de los Muchachos 2426 m
- Cruz del Fraile 2376 m
- Fuente Nueva 2372 m
- Roque Chico 371 m
- Pico de La Cruz 2351 m
- Fuente Nueva 2350 m
- Morro Negro 2322 m
- Roque Palmero 2306 m
- Pico del Ataúd 2144 m
- Roque de la Fortaleza 2090 m
Cumbre Vieja:
- Desedada 1933 m
- Montaña del Fraile 1908 m
- Montaña del Cabrito 1868 m
- Montaña la Barquita 1809 m
- Volcán El Charco 1740 m
- Montaña de la Monteca 1699 m
- Montaña el Caldero 1626 m
- Montaña de Magdalena 1593 m
- Montaña Andrés Martin 1544 m
- Montaña de la Venta 1513 m
- Volcán de San Martin 1487 m
- Montaña Pelada 1445 m
- Volcán Tacande 1365 m
- Volcán Bernardino 1275 m
- Montaña de los Faros 1266 m
- Mantaña de Fuego 1249 m
- Volcán de la Deseada 1238 m
- Volcán Tajuya 1219 m
- Roque de Tamanca 1129 m
- Volcán de Tajogaite 1120 m
- Pico de los Arreboles 1030 m
- Volcán de San Antonio 656 m
- Volcán de Teneguía 428 m
See
- Laguna de Barlovento 0,25 km² (Tiefe 50 m)
Fluss
- Barranco de las Angustias 21 km
Inseln Fläche Ausmaße Seehöhe
La Palma 708,10 km² 40,9 x 24,8 km 2426 m
Roque de las Taibadas 0,014 km² 0,26 x 0,12 km 65 m
Geologie
Den Anfang und die über ganze Erdzeitalter währende Grundlage der Naturgeschichte La Palmas bildete, soviel steht fest, ein druck- und eindrucksvolles Wechselspiel von Feuer und Wasser. Die zur Zeit gängigste Theorie besagt, dass in der Frühzeit der Öffnungs des Atlantiks vor rund 180 bis 150 Millionen Jahren, also am Übergang vom Trias zum Jura, im Bereich der Kanaren ein Meeresbecken bestand, in dem sich vom Kontinent abgetragenes Material ansammelte. Tektonische, also in der Erdkruste wirkende Kräfte am Zusammenstoß der afrikanischen mit der europäischen Platte drückten dieses Becken zunächst in die Tiefe. Vor der nach Osten abdriftenden afrikanischen Küste entwickelten sich mit der Zeit Schollen, die wie einzelne Keile gestaucht, unterschiedlich hoch gehoben und zu Sockeln geformt wurden. Am Ozeanboden entstanden daraufhin vor rund 60 bis 50 Millionen Jahren in rund 4000 m Tiefe Bruchlinien, an denen Magma aus dem flüssigen Erdinneren empordrang. In immer wieder durch das atlantische Wasser abgekühlten Eruptionen wuchsen langsam vulkanische Inseln in die Höhe. Zu den ungezählten, zum Teil explosionsartig verlaufenden Ausbrüchen kamen noch verschiedene andere „dynamische Kräfte“ sowie mehrere durch unterseeische Verwerfungen bedingte Meeresspiegelsenkungen. Im Rahmen dieses Zusammenspiels entstanden der gewaltige Bergstock der Caldera de Taburiente und der Vulkankegel des San Antonio im Gebiet der heutigen Gemeinde Fuencaliente. Diese beiden durch Überdeckung mit jüngeren vulkanischen Gesteinsschichten langsam zusammenwachsenden domförmige „Alt-Inseln“ - von spanischen Geomorphologen Paleo-Palma genannt - erreichten vor rund 3 bis 2 Millionen Jahren die Meeresoberfläche. In der Folgezeit hoben tektonische Kräfte La Palma - sozusagen nachträglich - über Wasser. Heute ragt das jungvulkanische Massiv aus einer Tiefe von über 5000 m unter dem Meeresspiegel fast 8 km hoch auf. Der Taburiente ist damit - relativ gesehen - die höchste Erhebung der Kanaren.
Da das Alter der Inseln von Ost nach West abnimmt, nahmen Fachexperten in Sachen Geologie noch vor wenigen Jahren an, dass unter den Kanarischen Inseln ein sogenannter „hot spot“, also „heißer Fleck“ existiere, der ständig Nachschub an Magma liefere, während der Atlantikboden über ihn hinwegwandere. Diese erstmals 1971 von dem amerikanischen Wissenschaftler Morgan vorgetragene, von hawaiianischen Verhältnissen ausgehende Theorie gilt heute als ebenso überholt wie jene, die von einer einstigen Landverbindung zu Afrika ausgeht, oder jene des finnischen Geologen Hausen. Letzterer hatte „aus den auf allen Inseln vorhandenen Deckbasalten auf ein vormaliges Basalttafelland“ geschlossen, „das später in Horste zerbrochen sei.“ (Reifenberger 1991:23) Trotz ihrer Unhaltbarkeit wird diese Hypothese bis heute von jenen Atlantis-Fans ins Treffen geführt, die in den Kanarischen Inseln Überreste des von Platon im Kritias-Dialog beschriebenen versunkenen Kontinents vermuten. Andere Atlantisisten wie der Biologe Sventenius, der kanarische Bodenforscher Enrique Fernandez Caldas und die Geologin Carmen Roméro verweisen darauf, dass sich La Palma wie „die Spitze eines Eisbergs“ mit nur einem Fünftel ihrer Inselmasse „vom Spiegel des Ozeans abhebt“ und dass die Sockelgröße der atlantischen Inseln nach Norden hin zunimmt. Könnte da nicht auch vorzeiten „eine auf breiten, unterseeischen Sockeln ruhende Landmasse“ (Fleck 1994:309), also ein ganzer Kontinent, emporgehoben worden und wieder versunken sein?
Dass die auf La Palma zu findenden steinigen „Überreste“ allerdings weniger ländlichen, sondern vielmehr ozeanischen Ursprungs sind, wird Wanderern, die etwas genauer hinsehen, auf Schritt und Tritt vor Augen geführt. Bereits frühe Naturforscher wie Friedrich Ehrmann 1799 und Leopold von Buch 1825 stießen hier auf unzählige Meeresfossilien, und Carl von Frisch fand 1867 in rund 1000 m Seehöhe „Korallenversteinerungen im Fels sowie submarine Kristalle“. Bis in die gleiche Zone sind überdies sogenannte Kissenlavablöcke, fachsprachlich „pillows“, spanisch „almohadas“ - grünlich gefärbte, kissenförmige Blöcke mit Durchmessern bis zu einem Meter -, anzutreffen, noch höher hinauf, nämlich bis 1600 m, die „vielen unterseeisch aufgeworfenen basaltischen Laven, Tuffe und Sedimentsgesteinstrümmer“, Grünsteine bzw. „Diabas“, Bimse und Brekzien (Fluch 1994:308). Zu alledem kommen noch grobkristalline, zum Teil kaum zersetzte Tiefenerstarrungsgesteine, deren wichtigstes der Gabbro ist. Letzterer ähnelt dem Granit, stammt vermutlich aus der tieferen Erdkruste und wurde gemeinsam mit der Kissenlava gehoben. Die genannten Gesteine bilden zusammen den sogenannten Basalkomplex, spanisch „conjunto basal“, das unter Wasser entstandene Fundament der Insel.
Das Herzstück La Palmas bildet der gigantische Kraterkessel die Caldera de Taburiente, die immerhin einen Umfang von 28 km aufweist. Vor rund 15 Millionen Jahren - nach geologischer Zeitrechnung im „mittleren Jungtertiär“ - hat auf ihm „ein großartiger domförmiger Vulkanaufbau, eine Riesenkuppel basaltischen Eruptionsgesteins, gesessen“ (ebd.). Einer alten kanarischen Sage zufolge soll der „gewaltige Teide“, der höchste Gipfel der Kanaren auf der Insel Teneriffa, „aus dem Riesenkrater“ herausgeschleudert worden sein, wodurch die heute rund 1500 m tiefe „Hohlform“ entstand (Fleck 1994:305). Frühe Geologen vermuteten demgegenüber eher einen Einsturzkrater. Tatsächlich aber scheint die Caldera, wörtlich übersetzt „Kessel“, über lange Zeiträume hinweg durch Verwitterung, fachsprachlich Erosion, entstanden zu sein, „als Folge des Eindringens von Meereswasser“ und „der Schürfungsarbeit vieler darin zu Tage tretender Wasserläufe und Quellen.“ (Fleck 1994:308)
Über die Sockelformation des Basalkomplexes legten sich nach und nach Deckschichten aus „Tuffbändern und säulig gegliederten Gesteinsbänken. Die Tuffschichten, die von unterschiedlicher Korngröße und Homogenität sind - vom Bims bis zum Agglomerat - entstanden durch explosives Auswerfen von vulkanischen Aschen, Splitterprodukten und mitgerissenen Brocken aus erst verstopften und dann durch Druck freigesprengten Schloten“ (Reifenberger 1991:26). Die Auswirkungen dieser Kräfte sind „heute noch recht deutlich an den alten, stark zergliederten und zerrissenen Gesteinsfolgen und Tachytbänken zu erkennen, die sich oft in auffälliger Farbskala - schwefelgelbe, rostrote, ockerfarbene, grüne und blauschwarze Töne - von den jüngeren Deckschichten“ aus verschiedenen Sedimenten, Ablagerungen, Laven und Aschen, die die Einheimischen Cobertera nennen, unterscheiden. Es ist dies „ein buntes Netz vulkanischer Gänge von überwiegend basaltischer Zusammensetzung“, die sich in ihren jeweiligen Nuancen - dunkler Basalt, hellgrauer Trachyt und Phonolith usw. - an den Rändern der zahlreichen, für La Palma typischen, bis zu 1000 m ins Bergland eingegrabenen „Tieftäler“ bzw. Schluchten, den Barrancos, abzeichnen (Fleck 1994:308). Bekanntestes Beispiel dafür ist der Barranco de las Angustias, an dessen Seitenhängen sich „ein engmaschiges und verwirrendes Netzwerk von Gesteinsgängen unterschiedlicher Zusammensetzung und Streichrichtung“ beobachten lässt (Reifenberger 1991:26). In diese Barrancos haben sich kleine Bachläufe, Riachuelos, eingegraben und dabei „eindrucksvolle, enge Canyons“ geschaffen sowie in Erweiterung ihres Bettes mehr oder weniger breite Bergrücken, sogenannte Tablados (Reifenberger 1991:30).
Als der Taburiente bereits erloschen war, öffneten sich rund um ihn zahlreiche Nebenschlöte. Diese bildeten unter anderem an den Nordhängen der Insel mehrere kleine Aufsitzervulkane, und auch im Valle de Aridane sowie im gegenüberliegenden Bereich um Mazo ist eine Reihe junger Kegel anzutreffen. Der eindrucksvollste Spätvulkan ist aber sicherlich „der vom Meer bereits zu einer Halbmondform zurückgestutzte Kraterring aus Tuffbrekzie südlich des Stadtkerns von Santa Cruz“, der im Concepción auf 355 m gipfelnde Monte de Luna. Er schleuderte einstmals „fragmentierte Lava“ in die Umgebung - ein Vorgang, der durch den Kontakt mit Wasser einige Sprengkraft gewonnen haben dürfte (Reifenberger 1991:30). Die „basaltischen, trachybasaltischen oder seltener phonolithischen Säulenbänke“ kamen demgegenüber „durch ruhiges Austreten relativ flüssigen Magmas aus Förderspalten“ zustande (Reifenberger 1991:28). Diese Lavaströme, spanisch „torrentes de lava“, hinterließen auf dem Weg zur Küste „unfruchtbare Schollenfelder“, die von den Einheimischen Malpaís, „schlechtes Land“, genannt werden (Lipps 1994:20). In besonderer Weise geschah dies im Bereich der Cumbre, wo seit etwa 800 000 Jahren Vulkane - wieder - aktiv sind.
Schlecht aber ist vulkanisches Land auf die Dauer nirgends. Denn „im Gang längerer Zeitläufe, unter dem Einfluss der Atmosphäre, haben sich viele ... Malpaisböden, je nach Grad ihrer Verwitterung, in fruchtbares Land verwandelt.“ (Instituto Geológico y Minero de España, zit. nach Fleck 1994:190) „Der Vulkan, der das Leben nahm“, gibt es auch wieder, in besonderer Weise durch „das Feuchtigkeitsanziehende des bei der Eruption zerblasenen Magma des Picón“. Dieser besteht aus bis zu haselnussgroßen, porösen, oft mit Bimsstein vermengten Lapilli-Steinchen. Er „ist ein gieriger Wasserfreund, der dem über den Ozean streifenden, sich vollsaugenden Passat so viel Wasser entnimmt, dass es für Rebe und Feige, Weizen und Mais reicht. Der schwarze Grus ist trotz seines lebensfeindlichen Aussehens, weit entfernt, den Ackerbau zu verhindern, geradezu seine Ermöglichung.“ (Gerhard Nebel zit. nach ebd.). Und wer sich an Mineralien erfreut, dem oder der wird La Palma wie ein Paradies erscheinen. Wenn etwa die „ersten oder letzten Strahlen der Sonne“ auf „die erzenen Aschen oder auf Kristalle von grünem Olivin, von Quarz, Hornblende oder Jaspin fallen“, dann tut sich ein großartiges Schauspiel, eigentlich Schaubild auf. „Die Kegel schmiegen sich dem Licht an, erscheinen je nach Tagesstunde oder Wetter glasklar hell, braun, silbergrau und golden, in kontrastreichen Tönen, die durch die rötlichen Böden, Hänge und die dunklen Vulkanberge eine Farbsymphonie hervorrufen, die ihresgleichen sucht, purpurn im Dämmer des Abends, grellrot im Schein der Morgensonne, in wundersamer Reinheit des Himmels und der Atmosphäre; aus verwüstetem Gelände taucht scharf Trachytgestein, an dem nadelartige Kristalle blitzen ...“ (Fleck 1994:189)
Die Lavadeltas haben der ursprünglich „steilhangigen Küste“ vielfach einen „flacheren, gebuchteten Rüschensaum“ vorgelagert. Gleichzeitig wirkten seit der Inselwerdung starke Verwitterungskräfte auf das palmerische Profil ein. Wasser durchdrang die jüngeren Deckschichten mit ihren vertikalen Fördergängen und spülte die alten, stark zersetzten Gesteinsformationen des Grundgebirges aus. Solcherart erhielt das Relief La Palmas den gleichsam letzten Schliff. Es besteht heute aus einem im Großen und Ganzen „einheitlichen Gebirgsmassiv von eher ausgeglichener Oberfläche“ (Reifenberger 1991:30).
Zu vulkanischen Ausbrüchen kam es noch „in der jüngeren und jüngsten geologischen Vergangenheit“, und sie konnten vor gar nicht so langer Zeit auch direkt beobachtet werden, konkret im Süden der Insel. Während der letzten fünf Jahrhunderte haben hier neun der 120 Krater des palmerischen Südkammes, der Cumbre Vieja, Lavaströme zum Meer hinuntergeschickt, nämlich (nach https://de.wikipedia.org/wiki/La_Palma):
- 1470/92 Montaña Quemada (Tacande) 1362 m): Aus dem Flankenausbruch des Kraters trat nordöstlich ein Lavastrom aus und bedeckte am Fuß der Cumbre Nueva bis nach El Paso ein Gebiet von 8 km Länge und 1 km Breite.
- 19.5. bis 10.8.1585 Tajuya (oberhalb von Jedey, 1871 m): Vor dem Vulkanausbruch gab es viele Erdstöße. Mehrere Vulkankegel und Ausbruchstellen bildeten eine Eruptionsspalte, aus der Lava bis zum Meer abfloss und im Bereich zwischen Puerto Naos bis Charco Verde eine Landfläche von etwa 1,5 km² neu entstehen ließ. Ein erheblicher Ascheregen ging auf das Land nieder, viele Menschen kamen durch die giftigen Schwefeldämpfe ums Leben. Sechs Wochen später wurde die Insel erneut von heftigen Erdstößen erschüttert.
- 30.9. bis 21.12.1646 San Martin (UTigalate, 1300 m): Dem Vulkanausbruch ging ein starkes Erdbeben zeitlich voraus, Häuser drohten einzustürzen. Die Ausbruchsstelle bildete einen kleinen Kegel südöstlich des 1529 m hohen Hauptkraters, von dem aus der Lavastrom auf der Ostseite der Cumbre eine 7,5 km² große Lavafläche bildete.
- 17.11.1677 bis 21.1.1678 San Antonio (unterhalb von Fuencaliente, 632 m): Dem Vulkanausbruch ging ein leichtes Erdbeben zeitlich voraus. Die Ausbruchstellen traten an den Flanken des Vulkankegels auf, über die sieben Lavaströme zum Meer abflossen und ausgedehnte Lavaplattformen bildeten (der heute sichtbare große Vulkankegel war nicht die Ausbruchsstelle, sondern die Ausbruchstelle einer vor etwa 3200 Jahren stattgefundenen gewaltige Eruption).
- 9.10. bis 3.12.1712 El Charco (El Paso, oberhalb von El Remo, 1700 m): Vom 4. bis 8. Oktober ereigneten sich mehrere Erdbeben, nach einer Ruhephase folgte ein großes Erdbeben. Aus einer Reihe von Eruptivschloten entlang einer etwa 2,5 km langen Spalte floss Lava westlich zum Meer beim heutigen Ort El Remo ab und ließ eine ausgedehnte Plattform entstehen. Rund 6,4 ha Ackerland wurden vernichtet.
- 23.9.1903 Erdbeben in Santa Cruz
- 20.1.1920 Erdbeben in Cumbre Vieja
- 23.7.1936 Serie von Erdbeben am Südrand der Caldera de Taburiente und im Valle de Aridane
- 21.2. bis 2.4.1939 Erdbebenerschütterungen in Los Llanos, in Fuencaliente wurde der Leuchtturm schwer beschädigt.
- 23.1.1947 Erdbebenerschütterungen in El Paso
- 22.2. bis 7.3.1949 Erdbebenschwarm im Süden der Insel: Die Erde bebte fast täglich. Ein heftiges Erdbeben im Süden der Insel, Mauern stürzten ein, der Leuchtturm von Fuencaliente wurde beschädigt und mehrere Erdspalten rissen in Ost-West-Richtung auf.
- 24.6. bis 4.8. 1949 Der Vulkanausbruch trat an drei räumlich getrennten Orten auf, die über ein etwa 3 km langes Spaltensystem verbunden waren. Am 24. Juni öffnete sich unter heftigen Beben der neu entstandene Krater Duraznero und Lava floss nach Osten ab. Am 1. Juli erschütterte ein starkes Beben ganz La Palma, an Mauern und Dächern traten große Schäden auf und in Los Llanos gab es erhebliche Schäden. Am 8. Juli öffnete sich bei Llano del Banco oberhalb von San Nicolás eine Erdspalte, aus der Lava nach Westen bis ins Meer abfloss und neues Land von ungefähr 2 km² Größe entstehen ließ, wo sich heute der Ort La Bombilla sowie der Leuchtturm Faro de Punta Lava befinden (hier entstand der Lavatunnel Tubo Volcánico de Todoque, seit Eröffnung des Besucherzentrums zugänglich als Cueva de Las Palomas). Am 12. Juli brach der Hoyo Negro aus und spie Asche.
- 21.10. bis 18.11.1971 Teneguía (unterhalb von Fuencaliente, 439 m): Am 21. Oktober begann eine Serie von Beben. Einen Tag vor dem Vulkanausbruch wurde die Insel von einem starken Erdbeben erschüttert. Aus Eruptionsspalten des Vulkans (bis zu 300 m Länge) trat Lava aus und floss zum Meer ab, wodurch rund 29 ha neues Land entstand. Durch in Geländesenken angesammeltes Kohlendioxid ersticktten zwei Menschen.
- 17.4.2011 Erdbeben 100 km nördlich La Palmas wurde ein Beben registriert. Kurz darauf strömten aus dem Staubecken Laguna de Barlovento große Wassermassen aus. Mit 2,5 Mio. m³ ist es das größte Speicherbecken der Insel.
- 16.9.2012 Erdbeben im Atlantik vor La Palma, 64 km nördlich von Santa Cruz. Auf El Hierro wurden in der Nacht zuvor 17 Beben mit einer Stärke von bis zu 3,2 aufgezeichnet.
- 22.9.2013 Etwa 20 km vor der Nordostküste bei Barlovento ereignete sich ein Erdbeben mit mehreren Erdstößen.
- 10.2.2014 Erdbeben etwa 3 km vor der Küste von Los Sauces in 40 km Tiefe
- 7. bis 14.10.2017 Erdbebenschwarm mit 127 Ereignissen im Bereich der Cumbre Vieja der Cumbre Vieja auf, in 20 bis 33 km Tiefe an der Grenze zwischen der ozeanischen Kruste und dem oberen Erdmantel, in der der Hotspot vermutet wird.
- 11. bis 14.2.2018 zehn Erdbeben mit Magnituden von 2,3 bis 2,5
- 24. bis 30.7.2020 sieben Erdbeben mit Magnituden von 2,3 bis 2,5
- 12. bis 19.9.2021 452 Erdbeben mit Magnituden 2,1 bis 2,6, 79 mit Magnituden von 2,7 bis 2,9, 38 mit Magnituden von 3,0 bis 3,8 in Tiefen von 12 km und kurz vor dem Ausbruch in 1 km Tiefe.
- 19.9. bis 13.12.2021 Cumbre Vieja (1122 m): Ab dem 11. September 2021 entwickelte sich ein fortlaufend intensivierender Erdbebenschwarm in einer mehrere tausend Beben umfassenden Serie mit einer Stärke von bis zu 3,8 auf der Richterskala. Die Eruption begann am 19. September um 15:12 Uhr Ortszeit im Gebiet von Cabeza de Vaca. Über sechs Schlote wurden Asche, Rauch und Lava durch den neuen Vulkan Tajogaite ausgestoßen.
- 24.3.202 25 Erdbeben mit Magnituden von 2,0 bis 3,0 im Bereich des C umbre Vieja, letztes stärkeres Beben mit Magnitude 3,0 nach stärkeren Nachbeben am 19./21./24. Dezember 2021 kurz nach Ende des Ausbruchs, Erdbeben seitdem nur noch wenige pro Monat und mit Magnitude von 2,2 und darunter
Der letzte große Vulkanausbruch auf La Palma dauerte vom 19. September bis zum 13. Dezember 2021 und gilt als der längste bekannte Ausbruch eines Vulkans auf der kanarischen Insel La Palma. Mit Blick auf die Schäden war es der folgenreichste in der Geschichte der Insel. Der im Juni 2022 so benannte Tajogaite-Vulkan entstand am Westhang des Höhenrückens Cumbre Vieja 1700 m nordwestlich des Llano-del-Banco-Vulkans, einem von drei Vulkanen der San-Juan-Eruption 1949. Die aus mehreren Spalten austretende Lava floss nach Westen über die dicht besiedelte Ebene Aridane und über die Steilküste ins Meer hinab. Dabei wurde eine große Zahl von Häusern in Dörfern und Streusiedlungen der Gemeinden El Paso, Los Llanos de Aridane und Tazacorte zerstört und eine große landwirtschaftlich genutzte Fläche bedeckt. Besonders stark betroffen war Todoque, ein Gemeindeteil von Los Llanos de Aridane (zum genauen Ablauf sh. https://de.wikipedia.org/wiki/Vulkanausbruch_auf_La_Palma_2021).
Der Ausbruch des Vulkans Tajogaite endete am 1. Dezember nach 85 Tagen Aktivität, was ihn zum längsten historischen Ausbruch auf der Insel und zum drittlängsten des Archipels nach Timanfaya auf Lanzarote und Tagoro auf El Hierro machte. Mit Blick auf die Schäden war es der folgenreichste in der Geschichte der Insel. Der im Juni 2022 so benannte Tajogaite-Vulkan entstand am Westhang des Höhenrückens Cumbre Vieja 1700 m nordwestlich des Llano-del-Banco-Vulkans, einem von drei Vulkanen der San-Juan-Eruption 1949. Die aus mehreren Spalten austretende Lava floss nach Westen über die dicht besiedelte Ebene Aridane und über die Steilküste ins Meer hinab. Dabei wurde eine große Zahl von Häusern in Dörfern und Streusiedlungen der Gemeinden El Paso, Los Llanos de Aridane und Tazacorte zerstört und eine große landwirtschaftlich genutzte Fläche bedeckt. Besonders stark betroffen war Todoque, ein Gemeindeteil von Los Llanos de Aridane.
Am 19. Dezember 2023 wurden im BOC wegen des möglichen Vorhandenseins geomorphologischer Werte Vorsichtsmaßnahmen angekündigt, um den Vulkan Tajogaite und seine Umgebung sowie die beiden Fajanas zu schützen. Am 9. Februar 2023 erklärte das Cabildo von La Palma in einer Plenarsitzung offiziell die Bezeichnung Vulkan Tajogaite für diesen Ausbruch. Am 9. Februar 2023 erklärte das Cabildo von La Palma in einer Plenarsitzung offiziell die Bezeichnung Vulkan Tajogaite für diesen Ausbruch. Am 9. Februar 2023 erklärte das Cabildo von La Palma offiziell die Bezeichnung Vulkan Tajogaite für diese Eruption.
Flora und Fauna
La Palma bietet von den Kanarischen Inseln die spektakulärste Tier- und Pflanzenwelt. Die Zahl der Endemiten gehörten zu den größten in Europa.
Flora
La Palma „gilt als die vegetationsreichste und grünste der Kanarischen Inseln“. Sie „zeichnet sich durch eine großartige, wundersame Vielfalt“ an Pflanzen, speziell Bäumen aus. Die Flora von La Palma „bietet vieles, was wir auch auf den anderen kanaren finden. Sie ist eine charakteristisch geprägte, prächtig vitale, fremde“ und doch wiederum an vertraute heimische oder „mittelmeerische Formen erinnernde Pflanzenwelt“ mit oft üppigen Auswüchsen (Fleck 1994:197). „Auf La Palma wachsen in geringer Nachbarschaft subtropische und alpine Pflanzen.“ Und egal, welche Blume man hierher anschleppt, sie gedeiht, sobald sie „in entsprechender Höhe und mit der nötigen Wasserversorgung angepflanzt wird.“ (Marco Polo 1994:16)
Von den 774 wild wachsenden Pflanzenarten La Palmas sind 70 sogenannte „Inselendemiten“, das heißt sie kommen nur hier vor und sonst nirgends auf der Welt. Weitere 104 sind kanarische und 33 makaronesische Endemiten, sind also auch auf den Azoren, Madeira oder den Kapverden anzutreffen. In Europa sonst „krautige Gruppen“ sind hier verholzt und überdies langlebiger. Mit den von spanischen Siedlern mitgebrachten Nutzpflanzen wurde auch „vielerlei Ackerunkraut eingeschleppt, das verwilderte und sich in die natürliche Vegetation einfügte. Nicht selten verdrängte es dabei die heimische Flora.“ Diese wird bestimmt durch Farne, Moose und Pilze, in geringerem Maße auch durch Blütenpflanzen. (Lipps 1994:22) Der alteingessesene Wald freilich bremste den Vormarsch der floristischen Kolonisatoren. Er umfasst auf La Palma 292,28 km² bzw. 41,4 % der Inseloberfläche, weitere 46,6 % sind zumindest von einzelnen Bäumen bestanden, und nur 12 % des Eilandes sind gänzlich baumlos und meist auch sonst ohne jeglichen Pflanzenbewuchs.
Von Botanikern, Biologen, Klimatologen und consorten wird La Palma in drei bis fünf Vegetationszonen unterteilt, die „je nach Wind und Feuchtigkeitslage“ mehr oder weniger „fließend ineinander übergehen.“ (Fleck 1994:196) Die trockene, fachsprachlich „aride“ bzw. „xerophyte“ Zone reicht im Norden und Nordosten bis 300, im Osten bis annähernd 500, ansonsten bis etwa 600 m. Hier leben vor allem „Pflanzen, die in der Lage sind, das wenige Wasser optimal zu nutzen.“ Sie „geben kaum Feuchtigkeit an ihre Umgebung ab, indem sie zum Beispiel nur schmale Blätter bilden oder sich durch harte Schalen und frühe Verholzung schützen.“ (Koch-Börjes 1995:86) Typisch diesbezüglich sind Tabaiba und Säuleneuphorbie, zwei endemische Wolfsmilchgewächse, sowie der Feigenkaktus. Die darüber liegende „feuchte Zone des immergrünen Passatwolkenwaldes“, die Einheimischen nennen sie „Monteverde“ (Fleck 1994:196), ist im „wenig mit feuchtigkeit verwöhnten Süden und Westen“ geprägt durch großflächige Pinienwälder. Typisch sind hier die Kanarische Pinie, die niedrigbuschige Zistrose, der ginsterartige Codeso und die weißblütige Asphodelie. Im Norden und Osten des Eilandes herrschen in der Passatwolkenzone anstelle der Pinien „subtropische Lorbeerurwälder“ vor (Koch-Börjes 1995:88). Oberhalb von rund 1100 Höhenmetern erstreckt sich auf praktisch der gesamten Insel die Fayal-Brezal-Zone mit der strauchigen Baumheide, dem sogenannten Brezo, der Faya, einem niedrigen, dunkel glänzenden Baum, dem Drago oder Drachenbaum und der Hauswurz, fachsprachlich Aeonium, als vorherrschenden Pflanzenarten. Die Hochgebirgszone schließlich, also der Bereich über 1600 m, hat eine subalpine Flora vorzuweisen. Im „Bereich des wolkenfreien, trockenen, balsamischen Antipassat“ gedeihen vor allem Ginsterarten und „hochspezialisierte“ Endemiten wie der Palma-Enzian (Fleck 1994:205). Die Pflanzen der „Höhensteppe“ zeichnen sich „durch einen niedrigen, polsterförmigen Wuchs und kleine, meist behaarte Blätter aus.“ (Lipps 1994:26)
Im Folgenden seien die wichtigsten auf La Palma vorkommenden Pflanzengattungenbzw. Pflanzenarten mit ihren auffälligsten Vertretern kurz vorgestellt. Die Wolfsmilchgewächse bzw. Euphorbien der Tiefenstufe, von den Einheimischen tabaiba genannt, kommen in zwei Arten vor, wozu noch eine Sonderform, der cardón, kommt: Die Honigs-Wolfsmilch (tabaiba silvestra bzw. euphorbia mellifera), palmerisch adelfa, ist eine „salzluftliebende, krummholzige und breite Büsche bildende“ Pflanze (Reifenberger 1994:44). Sie wird bis zu 1,5 m hoch und kommt vor allem in der nördlichen Zone um Barlovento und El Canal“ vor (Fleck 1994:197). Die Süße Wolfsmilch, von den Einheimischen balsamifera bzw. tabaiba dulce, von Biologen euphorbia balsamifera genannt, hat einen glatten, glänzenden Stamm, strebt mehr in die Höhe und besiedelt den Küstenbereich um Garafía sowie die küstenfernen Gebiete der Tiefenstufe. Die kakteenartige Säulen- oder Kandelaber-Wolfsmilch, kanarisch-spanisch „cardón“, ml. „euphorbia canariensis“ bzw. „cardon cardenales“, hat 1 bis 3 m durchmessende, schmale, fünfkantige und säulenartige Äste mit schmalen Blättern, die sie im Sommer abwirft. Sie „wuchert oft in dichten Kulturen an wüstenhaften Hängen, oder in Schluchten zwischen Felsgestein.“ Von „April bis Juni mit kleinen rötlichen Blumen geschmückt“, wird diese Wolfsmilchart wegen ihrer ungewöhnlich „großen, edlen Form als Emblem und Symbol für die Flora der Kanaren dargestellt.“ (ebd.) Der ätzende, milchige „Saft wurde von der Urbevölkerung zum Fischfang genutzt, in flachen Gewässern betäubte man damit Fische.“ (Koch-Börjes 1995:87)
Wolfsmilch scheint eine an die palmerischen Tiefenzonen-Verhältnisse besonders gut angepasste Species zu sein. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass auch andere Pflanzengattungen euphorbisierte Typen hervorbringen. So zum Beispiel die Geiskrautgewächse oder Zinnerarien, von denen auf La Palma vor allem drei Arten zu finden sind: Die Wolfsmilch-Zinnerarie, von Einheimischen verode, von Botanikern senecio kleinia genannt, hat „durch Stammsukkulenz und sommerlichen Blattwurf einen tabaiba-ähnlichen Habitus und eine ebensolche Langlebigkeit“ entwickelt (Reifenberger 1994:44). Sie liebt die trockenen, heißen Böden speziell des Südens La Palmas. Das Weiße Geiskraut (senecio appendiculatus), spanisch mato blanco, bevölkert die Strauchschicht des Lorbeerwaldes. Es ist „weiß mit gelber Mitte“ und erkennbar an seinen „huflattichgroßen Blättern“. Das Violette Geiskraut (senecio papyraceus) ist „auffallend violett“ und harrt über die lorbeerwäldische Strauchschicht hinaus „auch in der offenen Felsenzone“ aus (Reifenberger 1994:40).
Der palmerischen Umwelt in ganz besonderer Weise angepasst haben sich die Äonien bzw. Semperviven, verdeutscht Hauswurzgewächse, die praktisch überall auf der Insel zu finden sind. Die orejas de abad, „Ohren seiner Hochwürden“, wie sie auch genannt werden, haben vier hervorstehende Arten entwickelt. Die Palmerische Hauswurz (aeonium palmense) von den Einheimischen bejeque genannt, ist ein typischer Felsbewohner. Im „späten Frühling“ schiebt sie „aus hellgrünen Rosetten“ bis zu „70 cm hohe, schwefelgelb blühende Schäfte“ in die Höhe. Die Hochstielige Hauswurz (aeonium ciliatum), spanisch melera, entwickelt „im frühen Frühling“ auf Stämmchen, die bis zu einem Meter hoch werden können, „noch einmal halb so hohe, lockere, grünlich bis rosa-weiße Blütenpyramiden“ (Reifenberger 1994:42). Die Noble Hauswurz (aeonium nobile), spanisch bejeque noble, hat fast runde Blätter und auffallend rötliche Blüten. Sie ist vor allem im Barranco de las Angustias, in den Felsgebieten der Caldera und unzugänglichen Klippen zu finden. Die goldleuchtende Busch-Hauswurz (aeonium spathulatum) entwickelt 30 bis 50 cm hohe, kugelige Sträucher „mit grünen Rosetten von nur wenigen Zentimetern Durchmesser“ (Bergmann-Engländer 1993:99). Sie siedelt vor allem in bodenkargen, jungvulkanischen Gebieten“ (Reifenberger 1994:44).
Ihren charakteristischen Eigenschaften nach gehören die Aeonien bzw. Semperviven zu den Crassulaceen oder Dickblattgewächsen, von denen es auf La Palma insgesamt 30 Arten gibt, darunter 11 insuläre und 18 kanarische Endemiten. Hervorstechende Vertreter dieser Gattung sind neben der Hauswurz die Greenovien mit fünf, die Sonchien mit vier Arten und ein Fettblattgewächs. Die Greenovie, insbesondere greenovia aurea und -diplocycla, palmerisch bea bzw. orejones genannt, „entwickeln Riesenformen mit bis zu 32-teiligen Kelchen, rötlich-blauen Blättern und gelblich-grünen Blüten.“ Ihr Lebensraum reicht „von der mittleren semiariden Zone bis in den Lorbeerwald im Nordosten der Insel und in die Cumbrecita hinein“. Ihre „schönen Blüten leuchten an den dunklen Felsen in allen Farben, von weiß, rosa, goldgelb bis braun und purpur.“ (Fleck 1994:197) Der stark behaarte Wollige Stern (aichryson laxum), spanisch estrella lanuda, ist nicht nur auf Felshängen, sondern auch auf bemoosten Baumstämmen zu finden. Die Palma-Gänsedistel (sonchus palmensis), palmerisch cerrajón, ist kein Dickblattgewächs im eigentlichen Sinn. Sie ragt „aus bis zu 2 m hohen Stämmchen aus den Felsen“ (Reifenberger 1994:44) und ist unter anderem in der Gegend von Breña Alta und Baja sowie in den Barrancos Santa Lucia, La Galga, Herradura und Topaciegos zu finden.
Für die palmerische Tiefenzonenflora besonders auffallend sind neben den genannten noch die Echien oder Natternkopfgewächse mit fünf Arten. Der Riesennatternkopf (echium piniana) reckt auf Lorbeerwaldlichtungen „bis zu 4 m hohe Blütenschäfte hoch“ (Reifenberger 1994:40). Seine einheimische Bezeichnung pininana entstammt der palmerishen Ursprache. Der rot blühende Teidenatternkopf und der seltene, blau blühende Palma-Enzian (echium gentianoides), spanisch viola, besiedeln die Höhenregion ab etwa 2000 m. Die Taginaste tritt in zwei Unterarten auf. Deren eine, die Rote Taginaste (echium wildprettii), spanisch taginaste rojo, hat „prächtige, tiefviolette Blüten. Man trifft auf diese äußerst genügsamen und mehrere Meter hochwachsenden Palma-Endemiten in den trockenen, tiefen Barrancos des Nordens“, in der Cumbre Nueva und im Barranco Izcagua, „doch auch in tausend Meter Höhe an den Hängen der Caldera sowie im Nordosten bei La Galga und im Barranco de Los Aguas.“ (Fleck 1994:198)
In der Tiefenzone La Palmas heimisch geworden und von dort nicht mehr wegzudenken sind zwei Spätsiedlergattungen, die Agaven und Opuntien. Die Agave, konkret agave americana, von den Einheimischen la pita genannt, soll vorzeiten als Schwemmgut auf die Insel gelangt sein. Sie hat hier meterhohe, verholzende Blütenstände entwickelt und wird unter anderem als Viehfutter verwendet.
Die Opuntie, Deutschsprechenden besser bekannt als Feigenkaktus (opuntia ficus indica), spanisch chumbera bzw. higuera chumba, stammt eigentlich aus Mexiko. Sie wurde im frühen 19. Jahrhundert zwecks Züchtung von Cochenille-Läusen auf La Palma angesiedelt. Aus den durch schwärzliche Punkte auf der Pflanze erkennbaren Gelegen dieser Läuse wird „ein früher sehr begehrter karminroter Farbstoff gewonnen“. Die Früchte dieser „bis zu 2 m hohen Kaktee, deren große ovale Blätter wie Hasenohren aussehen,“ sind essbar. Sie werden etwa ab September reif, „schmecken ähnlich wie Kiwis, sind aber extrem stachelig ... Die Palmeros pflücken sie mit langen Holzstangen, sprühen sie mit einem scharfen Wasserstrahl ab, um die feinen Stacheln zu entfernen, und öffnen sie zur Sicherheit mit Messer und Gabel, um das Fruchtfleisch herauszuholen.“ (Koch-Börjes 1995:87-88)
Den Agaven verwandt ist die für La Palma wohl typischste Baumart, der zwischen 200 und 1600 m vorkommende Drachenbaum (dracaena draco), sp anisch drago. „Die eigenartig verwachsenen Äste, von denen jeder in einem Büschel schmaler, geschweifter Blätter endet, lassen an ein gefährliches Reptil mit starken Gliedern und scharfen Krallen denken.“ Die Altkanarier betrachteten den Baum seit Urzeiten als heilig. „Er symbolisierte Fruchtbarkeit und Weisheit“ - und symbolisiert dies zum Teil noch bis heute. Wenn er etwa „kräftig blüht, kann man eine gute Ernte erwarten.“ Sein getrocknetes und verbranntes Harz „hält Hexen und böse Zauberer fern. Knochenbrüche werden behandelt, indem man den Verunglückten zu einem Drachenbaum trägt und seine Fußabdrücke in die Rinde schnitzt. Schließen sich die Wunden im Baum, so heilt auch der Bruch.“ Nicht geheilt ist freilich die Ausbeutung des „drago“ durch die europäischen Kolonisten. Schon unmittelbar nach der Eroberung La Palmas begannen diese mit der wirtschaftlichen Nutzung des Baums, dessen an der Luft eine blutrote Farbe annehmende harzige Ausscheidungen als „Drachenblut“ (sanguis draconis) zu einem ersten Exportschlager der Insel wurden. In Europa fand das Harz vor allem „als Farbstoff für Lacke, Glasuren und Textilien“ Verwendung. Die massive Beanspruchung führte dazu, dass die Bäume ausbluteten und vielerorts abstarben. Um 1900 waren sie so selten geworden, dass „sich eine Ausbeutung nicht mehr lohnte. In größerer Zahl haben sie nur im abgeschiedenen Norden La Palmas überlebt.“ Bei La Tosca, Puntagorda, Garafía, Gallegos und Las Tricias „stehen sogar noch richtige Drachenbaumwälder. Bis in die jüngste Vergangenheit gab es auf La Palma viele Seilmacher, die aus den Blattfasern Stricke flochten und verkauften.“ Seit 1991 stehen die Drachenbäume unter Schutz, doch ist an eine Regenerierung des ursprünglichen Bestandes „nicht von heute auf morgen zu denken.“ Denn Drachenbäume wachsen nur langsam. Nach zehn bis fünfzehn Jahren erscheinen an „bis dahin kerzengerade nach oben wachsenden“ Stämmen „die ersten Blüten“, unmittelbar danach beginnt die für ihre Art typische Verzweigung (Lipps 1994:162-163).
Ebenfalls geschützt ist der zweite für das Erscheinungsbild La Palmas charakteristische Baum, die Palma-Kiefer bzw. Kanarische Pinie (pinus canariensis), spanisch pino canario. Sie wird um die 30 m, in Einzelfällen bis zu 50 m hoch, 2 bis 3 m dick und besitzt eine „außerordentlich dicke, tiefgefelderte rötliche Rinde“ (Reifenberger 1994:36). Sie hat des weiteren „eine tief herabreichende Krone“ und „graugrüne, silbern behauchte, drahtfeine, fast einen halben Meter lange Nadeln, die sich zu dichten Bärten büscheln.“ (Gerhard Nebel nach Fleck 1994:204) Mit diesen filtert die Pinie „feinste Tropfen aus den Wolken“, was für den Wasserhaushalt der Insel von enormer Bedeutung ist. „Sehr alte Exemplare der Kanarischen Kiefer besitzen außerdem ein wertvolles Kernholz“ (Lipps 1994:25), das „als ‘Tea’ weit über die Insel hinaus berühmt wurde. In Europa verwendete man es zum Schiffsbau, für die „Fertigung von Balkonen vornehmer Patrizierhäuser und von Kirchendächern.“ Die Kanarische Pinie wächst „an trockenen Südhängen“ ab 500 m und ist in Form „heller, lichtdurchfluteter Sonnenwälder“ bis in Höhen von etwa 2000 m zu finden. Anspruchslos, wie er ist, kann der Baum sogar auf jungen Lavaböden wie etwa im Krater des Vulkans San Antonio Fuß fassen. Hier bildet sie „wahrhaft leuchtende Oasen in den ödesten Landstrichen.“ (Fleck 1994:204) Selbst die alljählichen Waldbrände, von Viehzüchtern veranstaltet, um Platz für „frisches, einjähriges Futter“ zu schaffen, können ihnen auf Dauer nichts anhaben. „Die leicht entzündlichen Kiefern entgehen den Feuern fast nie - überleben es aber meistens“ aufgrund ihrer Fähigkeit, „nach Feuereinwirkung am ganzen Stamnm wieder auszuschlagen.“ (Reifenberger 1994:36)
Charakteristisch für den feuchten Wolken- und Nebelwald zwischen 500 und 1500 m, im Barranco del Agua bis 300 m hinunterreichend, ist der Lorbeer, der auf La Palma mit vier großwüchsigen und einer ganzen Reihe kleinerer Arten in Erscheinung tritt. Der Azoren-Lorbeer (laurus azorica canariensis), von den Palmeros laurel, lorel oder loro genannt, ist mit dem mediterranen Gewürzlorbeer wohl eng verwandt, bildet in der feuchtigkeitsgesättigten Passatwolkenzone aber bis zu 30 m mächtige Baumgebilde aus. Der giftige Madeira-Mahagoni (persea indica), spanisch viñatigo, „ist lang und großblättrig, bläulich bereift und mit 40 bis 50 m der höchste, der Riese aller kanarischen Lorbeerarten.“ Man findet ihn „in der dichten Waldwildnis von Los Tilos, in der Gemeinde Los Sauces, in den Barrancos Gallegos, Garafía, Franceses, Barlovento sowie auf den Höhen der Cumbre Nueva.“ Der Kanarische Lorbeer, sp. „barbusano“, ml. „pollonias barbujana“, ist „ein Baum mit dichter, breiter Krone und glänzenden, myrtenartigen, süßlich duftenden Blättern und schwarz-grünlichen Beeren.“ Auch er ist im Norden La palmas zu finden, „in Los Tilos, den Barrancos de la Herradura, del Carmen und del Río.“ (Fleck 1994:199) Der Stinklorbeer, ml. „ocotea foetens“, wird „wegen seines hellen, leicht rötlichen Holzes“ mit dem spanischen Wort für „Linde“, „til“, bedacht. „In saftigem Grün breitet er sich im Nordosten der Insel aus, auf knorrigen, dicken, doch weniger hohen Stämmen und bildet ein dichtes, überhängendes Schattendach. In den Tiefen des Barrancos del Agua, in einer ‘Los Tilos’ genannten echten Urwaldwildnis, wachsen Stämme, die in geringer Höhe einen Umfang von 10 Metern haben. Die Blätter sind gestielt von eleganten Spitzen, oval und von tiefem Schwarzgrün; die eichelähnliche Frucht ist von einem bläulich-warzigen Becher umgeben.“
Der Stechpalmen-Lorbeer (ilex canariensis), spanisch acebiño, hat kleine, runde, rötliche Früchte „unter bläulichen Blättern von wundersamem Glanz“. Er ist auf der ganzen Insel - auch im Süden - in Höhen zwischen 300 und 1300 m zu finden. Die Wilde Orange (ilex perado), spanisch naranjero alvaje, ist „schatten- und feuchtigkeitsliebend“ und zwischen 500 und 800 m anzutreffen (Fleck 1994:200).
Mit dem Lorbeer oft vergesellschaftet - oder diesen in unzugänglichen Gebieten ersetzend - sind eine Reihe von Hartlaubgewächsen. Das Kanarische Weißholz (picconia excelsa), spanisch palo blanco, ist „die einzige noch laubabwerfende einheimische Art. Standorte sind Los Tilos, Barranco de La Galga, de la Herradura, und im Süden vereinzelt bei Breña Alta.“ (ebd.) Der Wilde Ölbaum (olea europea), spanisch acebuche, ist vereinzelt auf steilen Felsabhängen zu finden. Der Mokan (visnea mocanera), spanisch mocán, hat ein ringloses, schwarzes Holz sowie kleine, gezähnte und zugespitzte Blätter, aus denen die Urpalmeros einen schmackhaften, blutreinigenden Tee bereitet haben. Aus den dunkelroten Beeren wird noch heute eine spezielle Marmelade, die yaga , gemacht. Der Drüsige Faulbaum (rhamnus glandulosa), spanisch sanguinero, hat wie der Mokan gekerbte Blätter und essbare Früchte. Er bildet vielerorts sperrige Hecken. Der Aderno oder Sacatero (heberdenia excelsa) ist „ein spitzwipfeliger Baum mit grünen Blütendolden und kirschenartigen Früchten. Er wächst in schattigen, felsigen Schluchten um das Quellgebiet ‘Marcus y Cordero’, bis in die Höhen von 1500 m sowie in der Caldera de Tajadre und im Barranco de Gallegos.“ (Fleck 1994:200-201) Der Kanarische Erdbeeerbaum (arbutus canariensis), spanisch madroño, trägt „längliche, orangefarbene, essbare Früchte, etwa in Art und Größe unserer Hagebutte“. Man findet ihn in der offenen Nebelwaldzone zwischen etwa 1000 und 1700 m.
Der Wacholder ist auf La Palma mit zwei Arten vertreten. Der Phönizische Wacholder (juniperus phoenicia), spanisch sabina, bildete früher richtige Buchwälder, ist aber heute nur noch „in kleineren Beständen, meist auf steilen Felsabhängen“ zu finden (Lipps 1994:24). Der Zedern-Wacholder (juniperus cedrus) mischt sich nahe der Baumgrenze, vor allem im Bereich der Caldera-Umrandung, unter den Kiefernbestand.
Als letzte Baumarten seien noch eine Schneeballart, ein rötlich blühendes Nesselbäumchen und die Palme, eigentlich Kanarische Dattelpalme (phoenix canariensis), spanisch palmera, erwähnt. Letztere hat bei der Namensgebung der Insel wohl Pate gestanden, ist hier aber nur vereinzelt anzutreffen und anbetrachts ihres schwindenden Auftretens seit 1991 gesetzlich geschützt.
Baum- oder zumindest mannshoch werden können auf La Palma auch die Ginster- und Leguminosensträucher. Der Codeso (adenocarpus foliolosus), spanisch auch retama amarilla, ist dunkelgrün, blüht im Frühjahr und Sommer leuchtend gelb und wird bis zu 2 m hoch. Er bildet den Unterwuchs der Kiefernwälder, wird von den Viehzüchtern immer wieder abgebrannt und ist daher schon ziemlich weit zurückgedrängt worden. Der Geisklee (chamaecytisus proliferus) teilt das Schicksal des Codeso. Der Hochgebirgs-Codeso freilich ist weniger angreifbar. Er hat sich im Bereich der Caldera in Höhen ab 2000 m angesiedelt, ist „klebrig behaart“, bildet „niedrige, kriechende Büsche“ und hat die Landschaft oft „fast allein“ für sich. Der „weiß und duftend blühende Teideginster (retama del pico bzw. retama blanca) bewohnt die gleiche Region (Reifenberger 1994:46), ist darüber hinaus aber auch „zwischen den Pinien von Puntagorda und im Barranco Izcagua“ anzutreffen (Fleck 1994:205). Die Teline (teline stenopetala), spanisch gacia, blüht im Frühling „massenhaft herrlich gelb“ und ist an den Rändern des Lorbeerwaldes zu finden. Der weiß blühende Palmerische Ginsterbusch, von den Einheimischen nach uralter Tradition tagasaste genannt, wird seit jeher „für rationelle und pflegeleichte Viehfuttergewinnung“ verwendet, zum Teil sogar extra angepflanzt (Reifenberger 1994:42).
Die Höhenzone zwischen 1100 und 1500 m wird dominiert von trockenheitsresistenten Fayal-Brezal-Sträuchern, doch kommen diese vereinzelt auch schon ab 500 m vor. Die Baumheide (erica arborea), spanisch brezo, ist ein Erikagewächs, das üblicherweise in 2 bis 3 m Höhe abgeschitten wird, eigentlich aber bis zu 12 m hoch werden kann. Der Gagelbaum (myrica faya), spanisch faya, bildet oft wild wuchernde Büsche. „Weiträumige Standorte finden sich bei Garafía, Barlovento, Puntallana, aber auch um La Breña und Mazo.“ (Fleck 1994:201) Farbig belebt wird der Fayal-Brezal-Wald „durch die leuchtend roten Beeren der Kanarischen Stechpalme (ilex canariensis), spanisch acebiño - die allerdings so gut wie keine Stacheln an ihren dunkel bläulich-grünen Blättern hat.“ (Reifenberger 1994:40)
Um die obig genannten Arten winden sich vielerorts Schlingpflanzen, Flechten „vom hellsten, glasartig-durchsichtigen Grün bis zum ntiefsten Blau-Schwarz“ (Fleck 1994:201). Aus der Vielfalt dieser Gewächse stechen vier Arten hervor. Die Palmerische Schmerwurz (tamus edulis), spanisch norsa, ist eine „zarte,.im Dunkeln rankende“ Verwandte der tropischen Jamswurzel. Sie hält sich „an die niedrigen Kletterhilfen und kriecht auch am Boden entlang.“ (Reifenberger 1994:40) Das Liliengewächs Gibalbera (semele androgyna) schlingt sich auf der Suche nach Licht an Bäumen hoch und trägt ihre Blüten auf Scheinblättern. Der Hörnchenstrauch (periploca laevigata), spanisch cornical, schlängelt sich zumeist an Säulenwolfsmilchstengeln empor. Seine „Blätter gilben und fallen zu Beginn der sommerlichen Trockenzeit.“ (Reifenberger 1994:44) Die Lianen schließlich queren die Schluchten von Los Tilos, La Galga, Franceses und Herradura in bis zu 20 m Höhe, fallen aber immer wieder tief herab, „an ihrem Saum eine Fülle gelber Blüten, die das grüne Erdreich mit einem lichten Mantelvon Goldstaub überdecken.“ (Fleck 1994:201)
Ausgesprochene Blütenpflanzen sind auf La Palma eher in der Minderheit. Nebst einigen schon genannten seien an dieser Stelle genannt: Der gelbblühende Meeressalat bzw. Strandlattich (astydamia latifolia), spanisch lechuga de mar, besiedelt jene Bereiche, wo die „zerstäubte Gischt der Brandung salzluftliebende Pflanzen begüngt“. Das ganze Jahr über fällt „das Leuchten“ seiner „derben, fleischigen, hellgrünen Blätter“ auf (Reifenberger 1994:44). Die Scheidenblättrige Zistrose (cistus symphytifolus), spanisch jara, bildet „trockene, niedrige Büsche, deren rauhe Blätter dem Salbei ähneln.“ Im Mai „verwandeln ihre zartrosa, Buschröschen ähnelnden Blüten den Boden in ein farbiges Meer - besonders eindrucksvoll an den Südhängen der Caldera.“ (Koch-Börjes 1995:88)
Der Palmerische Johannisstrauch (hypericum grandifolium) bildet mannshohe, großblütige Büsche an den Rändern des Nebelwaldes. Im freien Gelände wird er ersetzt durch das Kanarische Johanniskraut (hypericum canariense), das kleinere Blüten hat, aber übermannshoch werden kann. In der gleichen Gegend beheimatet sind der blütenreiche und aromatische Kanarische Jasmin und eine meist von Bienen umschwärmte, nach Zitronen duftende Thymianart. Im Bereich lichter Stellen des Lorbeerwaldes finden sich „silbern schimmernde Vergissmeinnichtarten“ sowie prächtige „Glockenblumen mit Früchten und großen roten Stauden“ (Fleck 1994:201). Die Kiefernwälder werden unter anderem durch Asphodelien, eine aus dem Mittelmeer stammende, ab Januar weiß blühende Lilienart belebt. Der Kanarische Lavendel (lavendula canariensis), und die Eselsmargarite (argyrantheum haouarythemum), spanisch margarita borriquera, zwei Pflanzen der trockenen Zone, haben schmalfiedrige Blättchen und reduzieren sich sommers über auf kleine Rosetten. Der Dornlattich (launaea arborescens), von den Einheimischen aulaga genannt, ist ein Korbblütler, der im Sommer seine Blätter abwirft. Die Nackte Stockpflanze, ml. „ceropegia hians“, verzichtet gleich von vornherein auf Beblätterung. Der Poleo (bystropogon origanifolium), hat „weißfilzige Blätter“, die, „wenn man sie reibt, stark nach Minzöl riechen.“ (Reifenberger 1994:46) Er besiedelt vor allem die trockenen Höhenregionen der Cumbre Vieja. Die Höhensteppe oberhalb von etwa 2000 m wird von einigen wenigen, äußerst widerstandsfähigen und hochspezialisierten Blütenpflanzen bewohnt. Zu diesen gehören neben den bereits oben genannten Arten unter anderem das vom Aussterben bedrohte La Palma-Veilchen (viola palmensis), das stiefmütterhenblaue Teide-Veilchen (viola cheiranthitolia), und der seltene, blau blühende Palma-Enzian (echium gentianoides, spanisch viola).
Bleiben noch Gräser, Moose und Farne, die es fast überall auf La Palma gibt. Der Wurzelnde Grübchenfarn (woodwardia radicans), hat eine „Brutknospe unter der Wedelspitze, die, wenn sie auf feuchten Boden gelangt, wiederum einen neuen Wedel aussenden kann.“ Dieser Wedel ist „zweifach gefiedert“, ist bis zu 3 m lang und bildet einen der „schönsten und mächtigsten Farne“ der Kanarischen Inseln (Reifenberger 1994:40).
Eine besondere Rolle in der palmerische Flora spielen Ziergewächse, die aus aller Welt hierher eingeschlept wurden. Die Palmeros lieben offensichtlich „üppige Blütenpracht: Öffentliche Parkanlagen, Privatgärten oder Fensterkästen sind mit tropischen oder subtropischen Blütenpflanzen reichlich geschmückt. Sogar die Straßen werden vielfach von Blumenrabatten gesäumt.“ Während des ganzen Jahres über „entfalten sich in dem milden Klima La Palmas immer neue Blüten.“ (Lipps 1994:22-23) Der Weihnachtsstern, ml. „euphorbia pulcherrima“, ein giftiges Wolfsmilchgewächs aus Mexiko, kann ab Oktober „zu riesigen Büschen von bis zu 4 m Höhe“ heranwachsen. Im Sommer ist er „unscheinbar grün“ mit „riesigen, knallroten Hochblättern“. Der aus Ägypten stammende Hibiskus, ml. „hibiscus rosasinensis“, wird bis zu 2 m hoch und blüht das ganze Jahr über „in vielen Gelb-, Rot- und Rosatönen“. Der Oleander entwickelt Bäume von bis zu 5 m Höhe. Er blüht im Sommer und Herbst „weiß und rosa“. Die aus Südafrika stammende Strelitzie oder Papageienblume gehört zu den Bananengewächsen. Sie bildet bis zu 80 cm hohe Stauden mit orangefarbenen Blüten auf „starren, dicken Stengeln“. Das Blumenrohr, spanisch „canna“, hat bis zu 1 m lange, rohrartige Stengel, „große, ovale, spitz zulaufende“, dunkelrote bis grüne Blätter und rote bzw. gelbe Blüten. Die Bougainvillea aus Südamerika besitzt viele farbige Hochblätter und ganzjährig zu bewundernde „kräftig lila, rosa und orangene“ Blüten. Die Feuerbigonie leuchtet im Winterhalbjahr auf „dunkelgrünem Laub“ mit „kräftig orangefarbenen, schmal gebündelten Blütenblättern“. Die ursprünglich in Südamerika beheimatete Passionsblume rankt sich mit weißblauen Blüten an Wänden empor und bildet wohlschmeckende Früchte, die Maracujas oder Parchicas, aus. Die Prunk- oder Königswinde bildet „große königsblaue Trichter“ aus und ist vor allem in ländlichen Gegenden an Zäunen zu finden. Der Jacaranda bzw. Falsche Palisanderbaum, ml. „jacaranda mimosifolia“, eine Leguminosenart, entfaltet im Frühjahr ein zartlila bis tiefblaues Blütenkleid. Er kommt aus Brasilien und hat „doppeltgefiederte Blätter“ sowie in jungem Alter „weichgebogene Äste“ Der mit dem Jacaranda verwandte Flamboyant hat eine schirmartige Krone und entwickelt während des Sommerhalbjahrs „feuerrote Blütenrispen“. Der Indische Lorbeer (ficus microcarpa), fehlt auf kaum einer Plaza und in kaum einem Park von La Palma. Seine majestätische, resige Krone spendet dem vor Hitze stöhnenden Gast genauso Schatten wie dem siestierenden Palmero. Der Afrikanische Tulpenbaum (spathodea campanulata), besitzt überdimensionale, feuerrote Blütenkelche, die sich „stolz nach oben recken“. Die aus Südchile stammende Araukarie sieht wie „ein sauber ausgeschnittener, ebenmäßiger Tannenbaum“ aus. Der hierzulande als Bürokümmerling bekannte Gummibaum schließlich wächst sich auf La Palma zu stattlichen Exemplaren aus (nach Koch-Börjes 1995:92-94).
Die wichtigsten Nutzpflanzen sind: Bananen-, Tabak-, Avocado-, Ananasstauden, Weinreben, Zuckerrohr, Mandel-, Kastanien-, Maulbeer-, Mango-, Apfel-, Birn-, Pflaumen-, Kirschen-, Pampelmusen-, Granatapfel-, Pfirsich-, Aprikosen-, Apfelsinen-, Guavenbäume, Zitronen-, Orangen-, Mandarinensträucher, Mispeln, Mais und andere Getreidesorten, Süßkartoffeln, Kartoffeln, alle möglichen Arten von Gemüse, Erd- und andere Beeren. verweis=Datei:La_Palma_Landschaft.png|rand|rechts
Fauna
Die Wildtierfauna La Palmas ist im Grunde recht harmlos. Gefährliche oder gar giftige Lebewesen gibt es hier nicht. Das heißt mit einer Ausnahme, dem bis zu 25 cm langen Hundert- oder auch - je nach Sichtweise - Tausendfüßler (scolopendra morsitans), spanisch ciempies, der unter Steinen in trockenen Zonen ruht und Kindern schon mal ganz schön weh tun kann. Anders der Langbeinige Hundertfüßler (scutigera coleoptrata). Der ist zwar mit ihm verwandt, braucht aber nicht gefürchtet zu werden - auch wenn er sich bisweilen auf der Suche nach Insekten in Häuser verirrt. Dass es die Schwarze Spinne, spanisch viuda negra, eine kleine, schwarze, giftige Spinnenart, auf der Insel gibt, wird zwar immer wieder behauptet. Gesehen und eindeutig erkannt hat sie bislang aber noch niemand.
Die sichtbare Tierwelt ist indes vielfältig genug. Allein um die 1000 Arten von Insekten - Schmetterlingen, Käfern, Fliegen, Mücken, Läusen, Flöhen usw. - gibt es auf der Insel. Einiges, was da so kreucht und fleucht, brummt und summt, kann mitunter auch gehäuft auftreten und in solchen Fällen durchaus lästig werden. Stubenfliegen zum Beispiel, oder eine „wilde“, blutsaugende Verwandte dieses Haustiers mit dem Fachnamen „stomoxys calcitrans“. Letztere ist zumeist abendlicherweise in der Nähe von Bewässerungsbecken anzutreffen, ist aber so nett, „durch ihre zwickenden Beinchen das Opfer rechtzeitig“ zu warnen (Reifenberger 1994:52). Andere Stechmücken bzw. Moskitos sind „an den Wasserläufen in der Caldera de Taburiente“ anzutreffen, wo sie mit besonderem Genuss über zeltelnde Romantiker herfallen (Koch-Börjes 1995:96). Lästig werden können aber auch Flöhe und andere Beißerchen - die allgegenwärtigen Bewohner palmerischer Haustiere. Unter den Wanzen sind zwei besondere Arten zu nennen, die beide nur je 3 mm groß werden, eigene, nur auf La Palma vorkommende Gattungen darstellen und einer „Familie angehören, die erst wieder in Vorderasien und Amerika vorkommt“ (Reifenberger 1994:52).
Unter den Schmetterlingen sticht vor allem der Monarch (danaus plexippus), „ein Wanderfalter aus Amerika mit einer Flügelspannweite von rund 10 cm“ und schwarzer Aderung auf goldfarbenem Grund, hervor (Lipps 1994:29). Wie der mit ihm verwandte Afrikanische Monarch (danaus chrysippus) bevorzugt er Seidenpflanzengewächse als Brutgelege und Raupengehege. Neben dem Admiral „mit seinen tiefrot gebänderten Flügeln“ (Fleck 1994:213) gibt es als der gleichen Art zugehörig den Kanarischen Admiral und den von den Einheimischen pandora oder cardinal genannten Grünen Silberstrich. Auffallend sind daneben noch der Kanarische Zitronenfalter mit „tief goldgelben Vorderflügeln“, der etwas kleinere, bunte Distelfalter, „der braune, goldgepunktete Laubfalter, der Postillon, der Resedenfalter“ sowie „der kleine und große Kohlweißling“. Der Feuerfalter ist zwar violett, gehört aber zu den Bläulingen, ebenso wie der innen blauviolette, außen silbrige zizera lysimon und der braune, ziegelrot gebänderte „plebeius cramera“ (Reifenberger 1994:54).
Im Vergleich zu den Tagfaltern wesentlich artenreicher sind die Nachtfalter mit zahlreichen Endemiten. Am auffallendsten ist hier der Totenkopf- bzw. Wolfsmilchschwärmer mit brtaun-rosa Bänderung, „mächtiger Kopf- und Körperpartie“, weißen Antennen und länglichen Flügeln. „Seine bis 7 cm langen, schön gezeichneten und doch mit ihrer schwarz-gelb-braunen Streifung gut getarnten Raupen“ sind vorwiegend an Euphorbienbüschen anzutreffen. Die einzige tagaktive Schwärmerart, fachsprachlich „macroglossum stellatarum“, „kann, wie ein Kolibri, vor den Blüten schwirrend in der Luft verharren.“ (Reifenberger 1994:55)
Libellen finden sich fast überall auf der Insel um Wasserstellen, Quellen und Bäche. Am hervorstechendsten sind „der leuchtend blaue Anax imperator“, die größte Libelle des Archipels, der „blasser blaue, zierlichere Orthetrum chrysostigma“, die „leuchtend purpurfarbene Crocothemis erythraea“ und der „hellrote Sympetrum fonscolombei“ (Reifenberger 1994:54). Von den Spinnen gibt es ebenfalls etliche Arten, die allesamt Opuntien, Feigenkakteen bevorzugen. Am markantesten ist hier die Gottesanbeterin.
Was die Amphibien betrifft, so verdanken die beiden Froscharten La Palmas ihre Anwesenheit auf der Insel wohl dem Zutun des Menschen, doch haben sie sich hier recht eigenständig entwickelt. Der bis zu 5,5 cm große Kanarische Laubfrosch (hyla meridionalis) hat „einen breiten, rundlichen Kopf“, einen von der Stirn bis zur Schulter reichenden Seitenstreifen, „glatte Haut und normalerweise hellgrüne Färbung, die aber umgebungsbedingt ins Braune mit dunklen Punkten variieren kann.“ Während diese im Frühling und Frühsommer abends quakende Art Waldböden bevorzugt, ist der Kanarische Wasserfrosch (rana perezi) auf nassere Gefielde angewiesen. Dieser scheue Tagquaker „ist bis 15 cm groß, hat drüsig-warzige Haut, eine auffallende Seitenfalte, eine braune, dunkler gefleckte Oberseite und einen hellen Bauch.“ (Reifenberger 1994:51-52)
An Kriechtieren gibt es eine Eidechsen- und eine Geckoart auf der Insel. Die bis zu 15 cm lange Palma-Eidechse (lacerta galloti palmae) hat „hellblaue Seitenflecken“ sowie beim Männchen grau-grünen, beim Weibchen „gelblichen und braunen Längsstreifen“ (Reifenberger 1994:51). Sie „lebt in schütteren Kiefernwäldern, in trockenem, felsigem Terrain“ und ginsterbewachsenen Bimssteinfeldern. Sie frisst vorwiegend Obst, Käfer und Raupen (Fleck 1994:212). Die bis zu 20 cm lange Walzenechse ist eher selten und zudem äußerst scheu. Der nachtjagende, bis zu 30 cm lange Gecko, auf La Palma salamanca oder salamanquesa genannt, „ist eine mit rundlichen Haftzehen ausgestattete Echse“ mit gedrungenem Körperbau (Reifenberger 1994:51). Als Ungeziefer vertilgender „Untermieter“ ist er bei den Palmeros hoch geschätzt.
Die Vögel sind heute fast alle per Gesetz von 1991 geschützt. Und ebenso fast alle haben im Lauf der Jahrtausende eigenständig palmerische oder kanarische Arten entwickelt: „Amsel, Sieglitz, Grauammer, Mönchsgrasmücke, Wiedehopf, Waldohreule, Mäusebussard, Sperber“, Silbermöve, Spatz - hier anthus berthelotii -, Kuckuck, Seeschwalbe, Waldeule und Turmfalke. Zu diesen gesellen sich der Gelbschnabelsturmtaucher, ml. „pardela cenicienta“, die leuchtend gelbbäuchige Palma-Gebirgsstelze, die Brillengrasmücke, die Kanarische Zilpalp, die Samtkopfgrasmücke, das Wintergoldhöhnchen, der Bluthänfling, „die weißbäuchige Palma-Blaumeise oder der Palma-Buchfink mit graublauer Oberseite und rosa Brust“ (Reifenberger 1994:49). Als Zugvögel kurzzeitig Halt auf der Insel machen unter anderem „Seeadler, Kraniche, Reiher, Schnepfenvögel, Regenpfeifer“ und Rotkehlchen.
Unter der bunten Vogelwelt hervorzuheben sind im speziellen drei Taubenarten: die dunkle, hellschwänzige Lorbeertaube, sp. „rabiche“, die Silberhalstaube und die blaugraue Haustaube. Die Vorfahren dieser Vögel dürften am Ebnde des Tertiärs vor mehr als einer Million Jahren Lorbeersamen auf die Insel gebracht und damit für heute für die Kanaren typischste Vegetation gesorgt haben. Leider wurden sie durch Abholzung und die Jagdleidenschaft der Palmeros im Lauf der Zeit stark dezimiert, dürften sich aber durch das Schutzgesetz von 1991 wieder stabilisieren. Ebenso wie der Capirote, ml. „philomela atriapilla“, „el ruiseñor canario“, „die kanarische Nachtigall“, ein eindrucksvoller Sänger und exklusiver Vogel La Palmas. Er ist vor allem im Barranco del Agua in der Gemeinde Los Sauces zu Hause. Im Gegensatz zu ihm verschwunden von der Insel ist seit einigen Jahren der Fischadler, sp. „guincho“.
Im Lorbeer- und Kiefernwald beheimatet ist eine Vogelart, die allgemein als typisch für die Kanaren gilt: der Kanarienvogel, seit dem 16.:17. Jahrhundert nach Deutschland und in alle Welt exportiert, heute DIE Hausvogelart. Auf La Palma ist vor allem der Graue Kanarienvogel zu finden, „ein kleiner, recht unscheinbarer Geselle,“ der fabelhaft zu singen versteht und offensichtlich viel Familiensinn besitzt. Ebenso wie die Stammform der „Kanaris“, der Kanariengirlitz (serinus canaria). Als typischster aller Inselvögel zu nennen ist schließlich Graja (pyrrhocorax pyrrhocorax), spanisch la graja, ein hämisch kreischender Verwandter der Alpenkrähe mit „leuchtend rotem Schnabel und knallroten Füßen“. Als Symbolvogel La Palmas wird er gern als Haustier gehalten, dem man - wie Papageien - „das Sprechen beibringt“. In einem eigenen Graja-Verein tauschen „die Halter dieser domestizierten Rabenkrähe ihre Erfahrungen in der Erziehung“ aus. „Grajas sieht man heut auch als Glücksvögel“ zum Beispiel auf Lottoscheinen. Ein kunstgewerbliches Zentrum heißt ebenso wie ene Wochenzeitschrift „La Graja“. Und natürlich werden verschiedenste Örtlichkeiten nach diesem Vogel benannt (Fleck 1994:209-210).
Das einzige Landsäugetier, das eigenständig auf die Insel gelangte, ist - nicht verwunderlich - eins, das fliegen kann, nämlich die Fledermaus, konkret deren madeirensische Unterart, ml. „pipistrellus maderensis“. Alle anderen Arten kamen nur durch Zutun des Menschen hierher - Mäuse, Ratten, die zu einer wahren Plage gewordenen Kaninchen sowie die 1954 in der Caldera ausgesetzten Mufflons bzw. Mähnenschafe. Dazu natürlich alle Haustierarten: die schon von den Urpalmeros, den Auaritas mitgebrachten Hunde, die ebenso wie die von den spanischen Kolonisatoren mitgebrachten Katzen auch in verwilderter Form anzutreffen sind, Esel, Maultiere, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Hühner und in gerinegrer Zahl Pferde. Ebenfalls von Menschen eingeführt wurden Karpfen und Goldfische, zwei heute in vielen Wasserbecken zu findende Süßwasserfische. Mit dem Menschen zum Teil mitgekommen sind Meeressäuger wie die Delphine.
Von Meeresfischen gibt es rund um La Palma an die 400 Arten. 15 davon gehören zu den Haien - vor allem Blauhai und Hammerhai -, die allerdings bislang noch nie Badende angefallen haben. Sechs zu den Tintenfischen, darunter die kleinen calamares, die großen pulpos, der Kalmar (loligo forbesi) und der Choco (sepia officinalis). 10 weitere sind Rochen, rayas bzw. mantas, zu deutsch „Decken“, mit Namen wie Schmetterlingsrochen, Meeresdrachen, Gitarren- und Engelfisch. Der Thunfisch kommt rund um die Insel in sechs bis neun Arten vor: Eigentlicher Thunfisch (thynnus thynnus), spanisch atún, Gestreifter Bonito (euthynnus pelamis), Atlantischer Bonito (sarda sarda), Peto (anthocymbium solandri) und Albacora (thunnus alalunga). Neben diesen Arten als Speisefische geschätzt werden Schwertfische, Sardinen, Makrelen, spanisch caballas, Goldmakrelen, spanisch dorados, Pfeilhechte bzw. Barracudas, spanisch bicudas, Seehechte, spanisch merluzas, Brassen mit 24 Arten, unter anderem Gold- und Zebrabrassen, Zackenbarsche, spanisch meros, mit sechs Arten, darunter Wolfs- und Forellenbarsche, Salme, spanisch bosigneros, Sprotten, spanisch cabrillas, drei Arten von Knurrfisch, spanisch gallo cochino, Skorpionfische wie Meersau und Meerpfaff, Rascacios und Lachse. Dazu kommen noch unter anderem sechs Muränenarten, spanisch murenas, die karpfenähnlichen, silberglänzenden Meeräschen, sp. „lisas“, die schellfischartigen Burellen, Abdejos und der rotgrün bis blaugelbe Papageienfisch, von den Einheimischen schlicht la vieja, „die Alte“, von den Biologen sparisoma cretense genannt. An der palmerischen Küste leben überdies Langusten, allen voran der Bärenkrebs (scyllarides latus), „sechs Krabben- und drei Garnelenarten.“ Seeigel ziehen sich üblicherweise vor der wildbewegten Meeresoberfläche in tiefere Regionen zurück. Ebenso selten zu finden wie sie sind hier Schildkröten, unter anderem die Karettschildkröte. Als Speisetierchen geschätzt werden hinwiederum Mollusken: die Napfschnecken, das Kanarische Meeresohr (haliotis cocchinea canariensis), die Burgados (osilinus atratus), „kreiselförmige, bräunlich gemusterte Schnecken der Brandungszone“, die Mejillones (perna picta) und die selten gewordene Austernart spondylus gaederopus (Fleck 1994:214 und Reifenberger 1994:55-56).
Tier- und Pflanzenwelt:
Flora:
wild wachsende Pflanzenarten 774
davon palmerische Endemiten 70
kanarische Endemiten 104
makaronesische Endemiten 33
Fauna:
wild lebende Tierarten 1550
davon Insekten 1000
Fische 400
Vögel 37
Säugetiere 11
sonstige Wirbellose 99
Naturschutz
1983 wurde die Gegend von „El Canal und Los Tilos“ von der zum Biosphärenreservat erklärt, das später im Jahre 1997 zum „Biosphärenreservat von Los Tilos“ erweitert wurde. Schließlich wurde 2002 das Reservat auf die gesamte Insel unter dem Namen „Biosphärenreservat von La Palma“ ausgedehnt. 1992 bestanden 31 Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 222 km², was einem Anteil von 30,9 % an der Gesamtfläche der Insel entspricht:

- Cumbre Vieja y Teneguía (80,2 km²)
- Caldera de Taburiente (46,9 km²)
- Los Sauces y Puntallana (31,7 km²)
- Barranco de las Angustias 815,1 km²)
- Barranco Quintero, El Rio, La Madera y Dorador (14,9 km²)
- Barranco de los Hombres y Fagundo y Acantilados de Barlovento (10,6 km²)
- Pinar de Garafía (8,9 km²)
- Coladas del Volcan de San Martín (4,2 km²)
- Costa de Puntagorda (3,3 km²)
- Cuhilletas de San Juan (2,3 km²)
- Tubo Volcanico de Todoque (1,1 km²)
- Conos Volcanicos de Los Llanos (1,1 km²)
- Barranco del Jorado (1,0 km²)
- Cardonal de Martin Luis (0,9 km²)
- sonstige (1,8 km²)
Für das Jahr 2025 wurden 21 Schutzgebiete nach IUCN-Kriterien angegeben:
- ein „strenges Naturreservat“ (Reserva Natural Integral, IUCN-Kategorie I)
- ein Nationalpark (Parque Nacional, IUCN-Kategorie II)
- zwei Naturparks (Parque Natural, IUCN-Kategorie II)
- acht Naturdenkmäler (Monumento Natural, IUCN-Kategorie III)
- ein ASrtenschutzgebiet (Reserva Natural Especial, IUCN-Kategorie IV)
- drei Gebiete von wissenschaftlicher Bedeutung (Sitio de Interés Científico, IUCN-Kategorie IV)
- vier Geschützte Landschaften (Paiseje Protegido, IUCN-Kategorie V)
- ein Meeresreservat (Reserva Marina, IUCN-Kategorie IV)
Konkret sind dies:
- Pinar de Garafía, Strenges Naturreservat (Barlovento, Garafía), Kiefernwald, 984 ha
- Caldera de Taburiente, Nationalpark (El Paso), Erosionskrater, 4690 ha
- Las Nieves, Naturpark (Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz), Lorbeer- und Kieferenwald, 5094 ha
- Cumbre Vieja, Naturpark (Fuencaliente, Villa de Mazo, Breña Alta, Breña Baja), Cumbre Vieja, 7500 ha
- Montaña de Azufre, Naturdenkmal (Villa de Mazo), Vulkan, 75 ha
- Los Volcanes de Aridane, Naturdenkmal (Los Llanos, Tazacorte), Vulkan, 100 ha
- Risco de La Concepción, Naturdenkmal (Breña Alta), Tuiffring, 66 ha
- La Costa de Hiscaguán, Naturdenkmal (Garafía, Puntagorda), Küstengebiet, 253 ha
- Barranco del Jorado, Naturdenkmal (Tijarafe), Schlucht, 99 ha
- Los Volcanes de Teneguía, Naturdenkmal (Fuencaliente), Vulkan, 857 ha
- Tubo Volcánico de Todoque, Naturdenkmal (Los Llanos), Lavaröhre, 0,5 ha
- Idafe, Naturdenkmal (El Paso), Felsformation, 0,4 ha
- Guelguén, Artenschutzgebiet (Barlovento, Garafía), Lorbeerwald, Küsten- und Schluchtgebiet, 1074 ha
- Juan Mayor, Gebiet von wissenschaftlicher Bedeutung (Santa Cruz, Breña Baja), Schlucht, 29 ha
- Barranco del Agua, Gebiet von wissenschaftlicher Bedeutung (Puntallana), Schlucht, 75h ha
- Las Salinas de Fuencaliente, Gebiet von wissenschaftlicher Bedeutung (Fuencaliente), Salinen, 7 ha
- El Tablado, Geschütze Landschaft (Garafía), Schluchtgebit, 222 ha
- Barranco de Las Angustias, Geschütze Landschaft (El Paso, Los Llanos, Tijarafe, Tazacorte), Schlucht, 1696 ha
- Tamanca, Geschütze Landschaft (El Paso, Los Llanos, Fuencaliente), Weinbaugebiet, 2007 ha
- El Remo, Geschütze Landschaft (Los Llanos, Agrarland, 183 ha
- Reserva Marina Isla de La Palma, Meeresreservat (Südwestküste), 3455 ha
Von der UNESCO wurden zwei Schutzgebiete besonders zertifiziert, die jeweils die gesamte Insel umfassen:
- das Biosphärenreservat La Palma (Reserva de la Biosfera)
- das La Palma Starlight Reserve (Reserva Starlight)
Dazu kommen Natura-2000-Schutzgebiete, die sich teils mit den oben angegebenen Schutzgebieten überschneiden sowie besondere Schutzgebiete gemäß FFH-Richtlinie (Zona de Especial Conservación – ZEC)
- Pinar de Garafía
- Guelguén
- Las Nieves
- Cumbre Vieja
- Montaña de Azufre
- Risco de la Concepción
- Costa de Hiscaguán
- Barranco del Jorado
- Malpaís de Las Manchas y Cueva de Las Palomas
- Tablado
- Barranco de las Angustias
- Tamanca
- Juan Mayor
- Barranco del Agua
- Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe
- El Paso y Santa Cruz de La Palma
- Santa Cruz de La Palma
- Breña Alta
- Sabinar de Puntallana
- Sabinar de La Galga
- Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid
- Monteverde de Gallegos-Franceses
- Monteverde de Lomo Grande
- Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua
- Monteverde de Breña Alta
- Los Sables
- Riscos de Bajamar
- Franja marina de Fuencaliente
- Costa de Garafía
- Besondere Schutzgebiete gemäß Vogelschutzrichtlinie (Zona de Especial Protección para las Aves – ZEPA)
- Caldera de Taburiente
- Cumbres y acantilados del norte de La Palma
- Acantilado de Las Traviesas
- Roques de Garafía
- Roque Negro
- Espacio marino del norte de La Palma
Die Schutzgebiete – ausgenommen das Meeresreservat, jedoch einschließlich der küstennahen Gebiete mariner Ökosysteme der Insel und das Starlight Reserve – werden durch einen gemeinsamen Rat der Regierung der Autonomen Gemeinschaft der Kanarischen Inseln, der Inselregierung von La Palma und der Gemeindeverwaltungen von La Palma verwaltet. Sie sind analog der Zonierung des Biosphärenreservates in Kern-, Puffer- und Entwicklungszonen eingeteilt. Das Meeresreservat wird vom Spanischen Umweltministerium, die Lichtschutzgebiete vom Instituto de Astrofísica de Canarias verwaltet. Die Gesamtfläche des geschützten Areals auf der Insel lag 2025 bei 236 km², was einem Anteil von 33,3 % der Inselfläche ausmacht.
Klima
La Palma hat den Ruf, eine „Insel des ewigen Frühlings“ zu sein. „Tatsache ist“, dass hier zumindest bis in eine Höhe von etwa 700 m „stets frühsommerliche Temperaturen herrschen. Ebenso richtig ist aber auch“, dass es „in den Wintermonaten heftig schütten kann“ und dass „kaum ein Sommer ohne zumindest drei brütendheiße Tage mit starken Sahara-Stürmen vergeht.“ (Koch-Börjes 1995:59) „Größere klimatische Unterschiede bestehen“ überdies „zwischen den Küstengebieten und den höheren Lagen“ von 500 bis etwa 1500 m, wo nicht nur „die tages- und jahreszeitlichen Temperaturschwankungen“, sondern auch die Niederschlagsmengen deutlich zunehmen (Lipps 1994:21). Ganz oben freilich ist es dann wieder klarer, aber bedeutend kühler, und da kann’s dem Wandersmensch schon mal ganz schön die Glieder abfrieren.
Konkret liegt La Palma im Einflussbereich von drei Großwettergebieten - dem Passat- und dem Westwindgürtel sowie zeitweiligen Einbrüchen trockenen Saharawetters -, die ihre jeweiligen Machenschaften in recht ungleicher Weise auf die verschiedenen palmerischen Kleinklimazonen verteilen. Der Osten und der Norden sind im Großen und Ganzen mild und feucht, der Süden und Westen trocken und warm bis heiß, und das gebirgige Inselinnere kocht überhaupt seine ganz eigenen Wettersüppchen. Und das bei - wie schon angedeutet - lediglich zwei jahreszeitlichen Grundabstufungen, dem Sommer, der üblicherweise im April beginnt und bis Oktober dauert, und dem sogenannten Winter, eigentlich Frühling, der von Oktober bis März/April angesetzt wird. Letzterer ist kühler, feuchter und geprägt durch etwas tiefer sitzende Wolkenbänke.
Der Passat, in palmerisch-spanischer Diktion „alisio“, bestimmt das Inselwetter während des Sommers fast zur Gänze und während des Winterhalbjahres „immerhin zur Hälfte“. Er „entsteht an der Ostflanke des Azorenhochs und erreicht die Kanaren als gleichmäßiger Nordostwind.“ Beim Kontakt mit dem kalten Kanarenstrom kühlen die „feuchtigkeitsgesättigten Luftmassen“ ab und stauen sich schließlich an der Ostflanke der Caldera sowie der Cumbre Vieja. Zwischen 600 und 950 m kondensieren sie, werden schließlich auf 1200 bis 1800 m hinauf gedrückt und dort durch eine um fünf bis zehn Grad „wärmere, trockene Höhenluftschicht oberseits so scharf begrenzt“, dass sie von den Gebirgskämmen aus betrachtet ein gewaltiges Wolkenmeer bilden. Aus selbigen „kann bei bestimmten Windverhältnissen spontan“ ein „feiner Nieselregen niedergehen“. In Kontakt mit den palmerischen Kiefernwäldern fällt der Niederschlag insbesondere während des Sommers meist horizontal - ein Phänomen, das an nassen Böden bei zugleich trockenen Baumwipfeln bemerkbar ist (Reifenberger 1991/30-32). Zwischen Dezember und Mitte April kann der Passat mitunter recht lebhaft werden. 12 % der Tage dieses Zeitraums sind laut offiziellen Angaben „windig“. Als Rekord-Windbö wurde 1989 in Santa Cruz eine mit 80 kmh gemessen (Fleck 1994:175-176).
Der Westwind, spanisch „viento del oeste“, fällt „zwischen Oktober und März mit großer Unregelmäßigkeit“ mit zum Teil heftigen „atlantischen Regenfronten“ über La Palma her. Speziell wenn er leicht in nordwestliche Richtung dreht, kommt es zu Abkühlung und Niederschlägen, „die in der gebirgsregion über 2000 m häufig als Schnee fallen.“ Tiefausläufer können aber auch weit nach Süden abdriften, sich dabei erwärmen, „umso feuchtigkeitsgeladener wieder nordwärts ziehen und so von Südwesten her auf die Insel treffen.“ Dort kommt es dann zu „unwetterartigen Niederschlägen“, vor allem „im sonst regenärmeren Süden“ La Palmas, manchmal über 300 mm in 24 Stunden (Reifenberger 1994/33). Andererseits kann in ganz seltenen Fällen auch polare Luft auf das Kanareneiland treffen. Die Niederschlagsorgie wird dann wohl etwas gebremst, die Temperatur aber stürzt in sonst ungewohnte Kellergesimse ab.
„Ein starker Gegenspieler der feuchtigkeitsspendenden Luftströmungen des Passats und der Westwinde“ ist das Saharawetter, von den Einheimischen „tiempo sur“ oder „tiempo africano“ genannt. Die mit ihm einhergehenden Hitzeeinbrüche treiben die Quecksilbersäule auf 40 Grad in die Höhe, „wobei die sonst vom Nebel begünstigten mittleren Höhenlagen am stärksten betroffen sind, weil das Meer selbst diese Luftmassen noch ein wenig mit Feuchtigkeit sättigt und abkühlt.“ In Los Llanos de Aridane wurde während einer solchen Wetterlage im August 1953 die seither unerreichte Rekordtemperatur von 46°C im Schatten gemessen. Mit der heißen Luft kommt schließlich „auch der Staub der Sahara herüber, der die sonst atlantisch klare Luft trübt und das Blau der Schatten und des Meeres wie mit einem gelblich-grauen Filter überzieht.“ Im Winter kann das Saharawetter „außer Staub und Trockenheit“ eine arge „kontinentale Kälte mit sich bringen“, oft verbunden „mit heftigen Fallwindböen auf der Westseite, die böse landwirtschaftliche Schäden anrichten.“ (Reifenberger 1994:34)
La Palma wird durch diese drei Großwetterlagen in verschiedene Kleinklimazonen zergliedert. Da ist zunächst einmal das wasserdampfgesättigte Klima der Nebelwälder des Nordens und Nordostens. Es ist kühl bis mild „mit häufigen Aufheiterungen“, vor allem während der Sommermonate, aber mit „gelegentlich heftigen Niederschlägen“ zwischen November und März (Fleck 1994:173). Die Regenmengen betragen im äußersten Norden und Nordosten etwa 550 bis 1500 mm, an der nördlichen Ostküste der Insel unterhalb der Höhenlinie von etwa 500 m 350 bis 450 mm, darüber in der Nebelzone bis zu 1400 mm pro Jahr. Die Temperaturen sind im Küstenbereich vergleichsweise gemäßigt und liegen hier um 14°C im Februar/März bei 20 bis 24°C im September, im Jahresdurchschnitt um 17°C. Weiter im Landesinneren sinken sie um bis zu 5°C ab.
Das gänzjährig feuchte, aber milde Klima der Ostregion ist recht deutlich höhenmäßig gegliedert. Die Niederschläge steigen von 250 im unmittelbaren Küstenbereich auf fast 2000 mm an den meist wolkenverhangenen Hängen der Cumbre. Die Inselhauptstadt Santa Cruz hat im Jahresdurchschnitt 507 mm auf 70 Regentage verteilt aufzuweisen. Die Temperaturen liegen im Februar bei 14 bis 15°C, im August und September bei 23 bis 25°C, im Jahresdurchschnitt bei 18 bis 19°C. 40°C, wie an der gegenüberliegenden Inselseite recht häufig, kann es hier nur vereinzelt mal an einem Sommertag haben.
Weiter nach Süden nehmen die Regenfälle merkbar ab. Selbst in größeren Höhenlagen steigt die Jahresniederschlagsmenge kaum mehr über 600 mm. Dieses Klima der Vulkanregion ist geprägt durch trockene Luftmassen, deren Herrschaft lediglich in der Zeit zwischen November und März bisweilen durch heftige Regengüsse unterbrochen wird. Die Temperaturen liegen hier im Februar bei 15 bis 18°C, im August bei 24 bis 28°C, im Jahresdurchschnitt um die 20°C. Der Süden La Palmas ist also zugleich die heißeste Region der Insel, deren Nebelschwaden meist nicht passatbedingte Ursprünge haben, sondern aus Schwefel sind und vulkanischen Schlöten entstammen.
Das Klima des Westens ist vergleichsweise trocken, sonnig und warm. Der Himmel ist zumeist fast schon kitschig „bilderbuchblau“ und lässt romantisch veranlagte Gemüter bei „großartigen purpurfarbenen Sonnenuntergängen“ wahrhaft dahinschmelzen. Die Temperaturen schwanken zwischen 14 und 19°C im Februar und 24 bis 28°C im August, was ein Jahresmittel von etwa 19 bis 20°C ergibt. Die Niederschlagsmengen liegen in Los Llanos de Aridane bei 397 mm. In der Region insgesamt steigen sie von jahresdurchschnittlich 230 bis 280 mm an der Küste auf annähernd 750 mm an den Cumbre- und Caldera-Hängen, die sich auch hier zeitweilig in eine „Zone in den Wolken“ verwandeln können, freilich nicht so ausgeprägt wie auf der östlichen Inselseite.
Das Klima des Nordwestens zwischen El Time und dem Mirador Las Tricias um die Gemeinden Tijarafe und Puntagorda hat einen relativ eigenen Charakter ausgeprägt. Von Mai bis September herrscht hier fast „völlige Trockenheit mit farblos dürftigem Pflanzenwuchs“. Die reichlichen Regenfälle des Winters verwandeln das Land dann aber in „eine wahrhaft mittelmeerische Zone üppig grünender Wälder“, was Besucher dazu veranlasst hat, der Region den Namen „palmerische Schweiz“ zu verpassen. Immerhin bringt es die Gegend auf 400 bis 1200 mm Jahresniederschlag, und die Temperaturen steigern sich von 14 bis 15°C im Februar auf 24 bis 25°C im August.
Das Klima der Caldera ist meist wild bewegt mit farbenprächtigen Licht- und Schattenspielen. Luftige Nebelbänken lagern sich bisweilen um die mittleren Höhen der Berghänge. „Ihr Saum ist stets von mannigfaltigen Tal- und Bergwinden gekräuselt, und es huschen und flattern die Ränder der großen Wolke über die sonnenbeglänzten Abhängen“ (Fleck 1994:175) - oder sie treiben nachts ein gespenstisches Spiel mit dem Betrachter oder der Betrachterin. Die Niederschlagsmengen freilich halten sich in Grenzen, sie liegen im Jahresdurchschnitt bei 400 bis 750 mm, und die Temperaturen steigen von etwa 10 bis 14°C im Februar auf 21 bis 24°C im August. Das Jahresmittel liegt bei 14 bis 17°C.
Das Bergklima der sogenannten „Zone über den Wolken“, also der Gipfelregion oberhalb von etwa 1500 m am Rand der Caldera, weist einen „zunehmend kontinentalen Charakter“ auf. Typisch für diesen Klimabereich „sind größere Temperaturschwankungen, ausgeprägte Jahreszeiten“, eine „ungefilterte Sonneneinstrahlung“ und deutlich geringere Niederschlagsmengen (J.M. Castro in Castro-Eigen-Göbel 1985:224). 350 bis 550 mm werden im Jahresdurchschnitt gemessen. Die Temperaturen sinken zwischen Ende Dezember und Anfang März gar nicht so selten unter 0°C ab - der Tiefenrekord liegt bei etwa -6°C -, überschreiten im Juli/August aber nur an saharisch erwärmten Tagen die 30°C-Marke. Monatsdurchschnittlich liegen sie im Januar und Februar deutlich unter 10°C, im Juli und August bei annähernd 19°C, woraus sich im jahr ein Schnitt von etwa 11 bis 14°C ergibt. Schnee fällt hier vor allem in strengen Wintern. Oberhalb von etwa 2000 m bleibt er kurzzeitig, an schattigeren Plätzen maximal ein paar Wochen, liegen, doch bildet sich niemals eine weiße Haube wie etwa am Teide auf Teneriffa.
Der für die Wetterküche La Palma mitverantwortliche Kanarenstrom ist ein relativ kühler Ausläufer des Golfstroms. Bedingt durch die massive Sonneneinstrahlung produziert er größere Mengen an Wasserdampf, die die Grundlage für das gesunde kanarische und hier speziell palmerische Klima bilden. Die Wassertemperaturen sind für Badehungrige dennoch nicht übel. Sie schwanken zwischen 18°C im Februar und 23°C im August. Ausgeprägte Hitzeperioden können den Ozean auch mal auf 25°C aufwärmen. Aber wie auch immer, Badesaison ist praktisch das ganze Jahr über, denn La Palmas Klima ist alles in allem „lau und weich“, von sanften Winden umschmeichelt und sommerlich genauso mild wie die meiste Zeit während des Winters.
Klimadaten für Santa Cruz de La Palma (25 m, 1961 bis 1990)
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
| Mitteltemperatur (°C) | 17,7 | 16,9 | 18,3 | 18,6 | 19,4 | 21,0 | 22,4 | 23,5 | 23,4 | 22,6 | 21,1 | 18,9 | 20,3 |
| Niederschlag (mm) | 89 | 15 | 25 | 48 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 26 | 76 | 106 | 409 |
| Niederschlagstage | 16 | 6 | 10 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 12 | 12 | 14 | 100 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 71 | 70 | 72 | 73 | 72 | 74 | 75 | 74 | 74 | 75 | 74 | 74 | 72,5 |
| Tägliche Sonnenstunden | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 10,5 | 9,5 | 8,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 7,5 |
| Wassertemperatur (°C) | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20,5 |
Klimadaten für Tazacorte
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
| Mittelmaximum (°C) | 17,0 | 16,9 | 17,5 | 17,4 | 19,1 | 20,0 | 22,3 | 23,2 | 22,6 | 21,3 | 19,0 | 17,2 | 19,5 |
| Mittelminimum (°C) | 12,2 | 11,6 | 11,9 | 11,9 | 13,2 | 14,5 | 16,4 | 17,4 | 17,2 | 16,6 | 14,9 | 12,8 | 14,2 |
| Niederschlag (mm) | 159 | 112 | 75 | 23 | 12 | 8 | 1 | 3 | 10 | 104 | 224 | 126 | 857 |
| Niederschlagstage | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 45 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 71 | 70 | 68 | 69 | 69 | 71 | 72 | 72 | 73 | 72 | 72 | 70 | 70,8 |
| Tägliche Sonnenstunden | 3,8 | 4,5 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 5,0 | 7,0 | 6,8 | 5,2 | 3,9 | 3,2 | 4,0 | 4,8 |
| Wassertemperatur (°C) | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20,7 |
Mythologie
Die ursprünglichen Bewohner La Palmas waren, wie ein früher Besucher der Insel vermerkte, „Götzendiener, weil sie den Teufel in Gestalt eines Hundes verehrten, den sie Haguanran nannten. Sie sagten von ihm, er wohne im Himmel, der von ihnen Tigotan genannt wird, und auf der Erde am Gipfel der Tedote genannten Berge, wo sie ihre Gebete und Opfer von Milch und Butter verrichteten.“ (Leonardo Torriani nach Castro-Eigen-Goebel 1985:194) Viele der Geschichten, die man sich auf La Palma erzählt, wurzeln in derartigen Vorstellungen aus archaischen Zeiten. Sie handeln von Abora, dem durch missionarische Einflussnahme mit christlichen Attrtibuten versehenen Schöpfergott der alten Kanaren, und von seinem Gegenstück, dem teuflischen Higuanran alias Guayote, dem „Kojoten im Vulkan“. Um den Diabolo Volcánico, den „Vulkanteufel“, wie er heutzutage auch genannt wird, zu besänftigen, pflegt man vielerorts recht zünftige Bräuche. Auf diese und all die anderen Sitten und Festlichkeiten La Palmas wird später noch näher eingegangen werden.
Am Anfang, so wird von Palmeros unter Berufung auf ihre Altvorderen gemunkelt, war Abora. „Vor ihm gab es nur das Nichts und die Leere; das Meer spiegelte noch nicht den Himmel wider, und das Licht hatte noch keine Farben.“ Da schuf er die Luft und das Wasser, den gewaltigen Ozean, und er schuf das Feuer und mit dessen Hilfe das Land. Nach und nach hauchte er dieser Welt Leben ein, formte Pfalnzen und Tiere. Alle „Geschöpfe verdankten ihm ihr Dasein.“ So auch die Menschen, die er als letzte schuf und auf die Inseln brachte, „damit auch sie das Erschaffene bewunderten, es gebrauchten und es erhielten ...“ (Castellano Gil-Macías Martín 1994:152)
Aber am Anfang war auch Higuanran, der sich bisweilen vom Himmel auf die Erde begab und es sich hier gemütlich machte. Er hauste dann auf Berggipfeln und ließ manch einen dieser Kegel Feuer speien. Higuanran nahm zumeist, wie es heißt, die Gestalt eines Hundes an. Als gewalttätige Menschen übers Meer kamen, um die Insel zu unterjochen, empfing er sie mit dumpfem Brausen. Die Neuankömmoinge jedenfalls hassten ihn und setzten ihn als Guayote, dem „Kojoten im Vulkan“, mit dem Teufel gleich. Den allerdings hatten sie selber mitgebracht und ihn auf der Insel so gewaltig wüten lassen, dass nicht mehr viel von der Ursprünglichkeit La Palmas geblieben ist. Aber ganz haben sie das Erbe des Higuanran denn doch nicht auslöschen können.
La Palma ist reich an geheimnisvollen Plätzen, an Naturdenkmälern und historischen Stätten. Wie ein Herz ist die Insel dem Meer entwachsen, und mitten drin in diesem Gebilde liegt eine Stätte, die den Menschen seit jeher als heiliger, anbetungswürdiger Platz erschien: der Idafe. Dieser „Vulkan-Monolith“, offiziell heißt er Roque de Idafe, erhebt sich im Zentrum der Caldera de Taburiente und ragt hier bis auf 603 m empor. Sein Schicksal, so meinen viele Palmeros, und so meinten es auch schon die Ureinwohner, sei untrennbar mit dem der ganzen Insel verquickt. Um die Fruchtbarkeit und damit den weiteren Bestand La Palmas zu sichern, wurden hier einstmals Opfer dargebracht und rauschende Fest, vermutlich speziell zur Zeit der Sommersonnenwende, gefeiert. Jedesmal wenn der Stamm der Aceró, zu deren Bereich der Idafe gehörte, „ein Tier geschlachtet hatte, nahmen zwei Männer den mühseligen Aufstieg zum Fuß des fast unzugänglichen Felsens auf sich, um hier die Innereien darzubringen.“ Dabei sprach der eine: „Y iguida y iguan Idafe!“ Zu deutsch: „Er sagt, dass der Idafe fallen wird!“ Und der andere antwortete: „Que guerte yguan taro!“ Übersetzt in etwa: „Gibt ihm, was du bringst, und er wird nicht fallen!“ (Lipps 1994:156)
Neben dem Idafe gab es vor der spanischen Kolonisierung zumindest noch elf weitere bedeutende Kultstätten auf La Palma - eine für jeden Stamm. Mit einiger Berechtigung als solcher ansprechen lässt sich El Time, die höchste Erhebung der Laderas de Amagar am Nordrand des Barranco de las Angustias. Dazu kommen unter anderem die Krater von Vaqueros und Barlovento im Norden der Insel sowie die Vulkankegel der Cumbre Vieja. Von besonderer Bedeutung waren vermutlich Höhlen, wie zum Beispiel die Cueva de Fraile bzw. „Mönchshöhle“ in der Gemeinde Garafía. Sie war als Felswohnung genauso in Gebrauch wie als Kultstätte. Die Cueva de Balmaco bei Tigalate im Süden der Gemeinde Mazo diente zeitweise wohl als Wohnplatz eines Häuptlings oder Priesters, doch wurden hier mit Sicherheit auch Rituale abgehalten. In den Höhlen darüber haben sich die Auaritas genannten Ureinwohner zur letzten Ruhe hingelegt. Vacaguaré, „ich möchte sterben“ - diesen Ausspruch sollen sie noch getan haben, ehe man sie mit einem Krug Milch versehen in ihrer jeweiligen Höhle einmauerte.
Die christlichen Missionare haben wohl verschiedentlich an alte Pilgertraditionen angeknüpft und etliche ihrer Kapellen und Kirchen auf altüberliefert heiligen Stätten errichtet. Hervorzuheben sind in diesem Zusamenhang die sogenannten Ermitás, „Einsiedeleien“. Eine davon befindet sich unmittelbar nördlich der Hauptstadt Santa Cruz in der kleinen Ortschaft Mirca. Sie trägt den Namen Ermità de Candelaria, „Lichtmess-Einsiedelei“. Im äußersten Südwesten La Palmas, im Bereich der Gemeinde Fuencaliente hat man mitten in pittoreske Lavafelder hinein die Ermità Santa Cecilia errichtet. Etwas weiter nördlich stößt man auf die Ermità del Buen Jesús südlich von Tijarafe. Unmittelbar bei dieser Ermità stehen zwei „von Schlackenkegeln umgebene, großartige Felsentore mit Wänden, die im Frühjahr prächtig von blauen und gelben Blumen und grünen Moosen umgeben sind.“ (Fleck 1994:87). Nicht weit von ihr entfernt, wiederum in Lavafelder eingebettet ist die Ermità San Nicolas, zu finden. Eine letzte bedeutende Kapelle dieser Art, die Ermita Virgen del Pino, wurde am Südrand der Caldera oberhalb des Ortes El Paso errichtet. Es ist dies DER „heilige Wallfahrtsort für alle Einwohner des Aridanetales“. Die uralte Kiefer, die hier bis vor kurzem - mit eingearbeitetem Bildnis der Madonna - verehrt wurde, ist mittlerweile gefällt. Ein nicht unbedingt gutes Omen für das spirituelle Geschick La Palmas. Immerhin aber findet in den letzten Jahren eine langsame Rückbesinnung auf die alten Überlieferungen statt - und das lässt wiederum auf eine bessere Zukunft hoffen.
Geschichte
Vulkane haben die Gestalt der Insel geprägt. In diesem zerklüfteten Stück Land haben die Ureinwohner eine eigenständige Kultur entwickelt. Die Spanier wiederum brauchten länger als anderswo, um das Eiland zu unterjochen.
Altkanarische Zeit
La Palma wurde im Neolithikum vom Volk der Benahoaritas (auch Auaritas genannt) besiedelt, Ihre Herkunft ist nicht eindeutig abschließend geklärt - DNA-Analysen deuten auf nähere Beziehungen zu den Berber-Völkern Nordwestafrikas. Die Frage, wie sie auf die Insel kamen, ist jedoch umstritten, und es gibt zwei Hypothesen. Die erste besagt, dass sie mehr oder weniger zufällig aus eigener Kraft auf die Insel gekommen sind, während die zweite davon ausgeht, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen oder als Ergebnis von Zwangsdeportationen nordafrikanischer Stämme durch die mediterranen Zivilisation Phöniziens bzw. Karthagos absichtlich auf die Insel gebracht wurden. Archäologen haben durch die Untersuchung von Unterschieden in der Gestaltung und Verzierung der Keramik der Ureinwohner festgestellt, dass mindestens zwei Kontingente von Menschen zu verschiedenen Zeiten auf La Palma angekommen sind. So kam eine erste Menschengruppe um die Mitte des -3. Jahrtausends aus dem westlichen Maghreb und dem Nordwesten der Sahara auf die Insel, während eine zweite Gruppe um das -7. Jahrhundert aus der zentralen und nordwestlichen Sahara kam. Andererseits hat die traditionelle Archäologie Parallelen zwischen den Petroglyphen auf der Insel und denen der frühbronzezeitlichen Bevölkerung der europäischen Atlantikküste wie der Bretagne und Irlands festgestellt. Die zweite Hypothese besagt, dass die Ureinwohner La Palmas aus der alten Konföderation der Berberstämme der Hawwara stammten, was auf die sprachliche Ähnlichkeit zwischen diesem Begriff und dem Namen Benahoare zurückzuführen ist, den die ersten Siedler der Insel gaben. Im Fall der Palmeros wurde der Name Benahoare der Insel von den ersten Bewohnern gegeben.
Das früheste Datum für die Besiedlung von La Palma wurde mit Hilfe der Thermolumineszenztechnik in der Höhle von Tendal in der Gemeinde San Andrés y Sauces ermittelt, die auf das -4. Jahrtausend geschätzt werden. Die ältesten eindeutig belegbaren Funde aus der Begräbnisstätte La Palmera in Tijarafe werden auf die Mitte des -3. Jahrtausends datiert.
Näheres zu Gesellschaft, Felszeichnungen und Religion der Benahoaritas erfährt man im Inselmuseum, im Besucherzentrum des Nationalparks Caldera de Taburiente sowie bei La Zarza und La Zarcita (seit 1998 erster Archäologischer Park der Kanaren). Die dortigen Felsbilder faszinieren durch ihre Mäander, Labyrinthe und Figuren. Ein zweiter Archäologiepark bei der Höhle von Belmaco ist mit knapp 4000 Jahren eine weitere Fundstelle der frühen altkanarischen Kultur der Insel.
Diese blieb auch abseits der benahoaritischen Welt nicht unbemerkt. Phönizische Seefahrer dürften ab etwa -1200 auf den Kanaren gelandet sein und letztlich auch La Palma erreicht haben. Der numidische König Juba ließ um -25 die Inselgruppe erkunden und der Geograf Ptolemaios verzeichnete um die Mitte des 1. Jahrhunderts La Palma als Iunonia auf seiner Weltkarte. Im 3. Jahrhundert brachen im Zuge des Niedergangs des Römischen Reichs die Beziehungen zum Mittelmeerraum ab. Es folgte eine Zeit ungestnört isolierter Entwicklung.
Mittelalter
Erst im 10. Jahrhundert gerieten die Kanaren wieder ins Blickfeld einer fremden Macht. Diesmal waren es arabische Autoren, die von Besuchen auf den entlegenen Inseln berichteten. Eine arabische Quelle aus dem Jahr 1124 berichtete von einer Expedition acht verschwägerter Araber aus Lissabon, die nach elf Tagen Fahrt eine Insel erreichten, die als El-Ghanam bezeichnet wurde. Ob dies La Palma oder eine andere Insel war, bleibt unklar.
Im Jahre 1312 erreichte der Genuese Lancelotto Malocello - Namensgeber der Insel Lanzarote - die Kanaren. Ober er auch La Palma besuchte, ist unklar. Seine Berichte über den Aerchipel lockten indes weitere Europäer an. Niccoloso da Recco, ein Berichterstatter einer portugiesischen Expedition unter König Alfons IV., erwähnte 1341 La Palma in seinen Aufzeichnungen. Er beschrieb die Insel als felsig und regenreich, betrat sie jedoch vermutlich nicht. Ebenso Gonzalo Perez Martel, der 1393 eine andalusisch-baskische Sklavenfänger-Truppe anführte, die Gran Canaria und Lanzarote überfiel, La Palma aber nicht tangierte.
Zwischen 1402 und 1405 landeten die Franzosen Jean de Béthencourt und Gadifer de la Salle mehrfach für jeweils nur kurze Zeit auf der Insel. Dabei kam es zwar zu Kontakten mit der Bevölkerung, nicht aber zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die Insulaner waren zu jener Zeit in 12 Stammesgemeinschaften organisiert: Aridane, Tihuya, Tamanca, Ahenguareme, Tigalate, Tedote, Tenagua, Adeyajamen, Tagaragra, Tagalgen, Tijarafe und Aceró. Diese wurden von jeweils bis zu drei Häuptlingen - in spanischer Diktion "Königen" bzw. "Fürsten" - geführt, die den Kontakt mit den Europäern regelten. Die Gesamtbevölkerung zu jener Zeit wird auf 4.000 bis 12.000 geschätzt. Die zahlreichen Reste ihrer "steinzeitlichen" Kultur sind heute noch vorhanden: Wohnhöhlen, Grabstätten, Steinwerkzeuge und die Petroglyphen – komplexe Steinritzungen mit unbekannter Bestimmung. Bemerkenswert sind die steingepflasterten Königswege, die die gesamte Insel überziehen und die verschiedenen ehemaligen Stammesgebiete miteinander verbinden.
Eroberung
Im Jahr 1445 übertrug Guillén de Las Casas seine Rechte an den Kanarischen Inseln an Hernán Peraza (el Viejo) und dessen Kinder Inés und Guillen Peraza de Las Casas. Nachdem der Lehensherr seine Macht auf Lanzarote, Fuerteventura und El Hierro gefestigt hatte, entsandte er eine Flotte aus drei Schiffen mit 500 Mann zu der Insel, die bis dahin als unbezwingbar galt. Guillén Peraza de las Casas landete Ende 1447 mit 500 Männern aus Sevilla, Lanzarote und Fuerteventura in der Nähe des heutigen Tazacorte. Aber auch dieser Feldzug blieb für Eroberer - wie die vorangegangenen - ohne Erfolg. Die Soldaten kamen auf dem bergigen Gelände nicht zurecht. Sie wurden von allen Seiten mit Speeren und Steinen beworfen und verloren bei den erbitterten Kämpfen mit den Insulanern 200 Mann. Nachdem Guillén Peraza durch einen Stein tödlich am Kopf verletzt worden war, wurde der Angriff abgebrochen.
Eine Eroberung La Palmas war damit vorerest vom Tisch. Man beließ es bei einzelnen Piratenüberfällen, die allerdings nicht näher dokumentiert sind. Als kastilische Truppen im Jahr 1478 über Gran Canaria herfielen - sie brauchten fünf Jahre, um die Insel unter ihre Herrschaft zu bringen -, taten sie dies, um Klarheit über die künftigen Machtverhältnisse zu schaffen. Im Vertrag von Alcáçovas von 1479 und der päpstliche Bulle Aeterni regis vom Juni 1481 wurde Kastilien das Recht an den Kanarischen Inseln bestätigt. Zwischen dem Ende des Jahres 1491 und April 1492 bereiteten der Gouverneur von Gran Canaria Francisco Maldonado und Pedro de Valdes die Eroberung der Inseln Teneriffa und La Palma vor. Zu diesem Zweck schickten sie Francisca de Gazmira eine aus La Palma stammende Frau als Vermittlerin zu den Herrschern der Stämme La Palmasl, um sie zu veranlassen, sich taufen zu lassen und der kastilischen Herrschaft zu unterwerfen. Francisca de Gazmira kehrte von ihrer Reise mit vier oder fünf der zwölf Häuptlinge der Insel nach Gran Canaria zurück. Die benahoaritischen "Fürsten" wurden getauft und kehrten nach La Palma zurück mit dem Auftrag, die Bewohner von der Aussichtslosigkeit eines Widerstands gegen die angehenden Kolonialherren zu überzeugen. Die Einverleibung dere Insel ins spanische Imperium sollte nur noch eine Formsache sein.
Am 29. September 1492 – Christoph Kolumbus entdeckte in diesem Jahr Amerika – landete der auf Gran Canaria beheimatete General Alonso Fernández de Lugo mit einer Streitmacht von 900 Mann auf La Palma in der Nähe des Strandes von Tazacorte; er war von dem spanischen Herrscherpaar Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragón zu diesem Feldzug ermächtigt. Er hatte die früher von La Palma verschleppte Gasmirla la Palmens dabei und machte falsche Versprechungen. Die Bezirke Aridane, Tihuya, Tamanca und Ahenguarem unterwarfen sich. Die Herrscher von Tigalate allerdings leisteten starken Widerstand. Schließlich traten alle "Fürsten" der Benahoaritas, der Ureinwohner La Palmas, zum Christentum über, bis auf den Bezirk der Caldera de Taburiente, der damals Aceró (starker Ort) hieß. Diese Gegend unterstand dem berühmten Tanausú, der sich widersetzte und nur durch einen Hinterhalt gefangen genommen werden konnte. De Lugo schickte der kastilischen Krone mehrere Gefangene zum Beweis seiner Eroberung, darunter auch Tanausú, der angesichts dieser Schande in den Hungerstreik trat und noch auf der Überfahrt starb. Am 3. Mai 1493, dem „Tag der Erhebung des Heiligen Kreuzes“, gründete Lugo an dem Ort, an dem sich die altkanarische Siedlung Apunyon (auch Auprón) befand, die Stadt Santa Cruz de La Palma. Dann begab er sich nach Gran Canaria zurück, um Vorbereitungen für die Einnahme von Teneriffa zu treffen, der letzten der sieben großen Kanarischen Inseln, die er schließlich nach einem zweijährigen Feldzug 1496 eroberte.
Die Benahoaritas fochten keine großen Schlachten mit den Spaniern aus, kamen deshalb nicht in Massen um und ließen sich - nicht ohne Widerstand, aber letztlich dann doch - christianisieren. Für Alonso Fernández de Lugo, der den Finanziers seines Eroberungsunternehmens reichlich Sklaven versprochen hatte, waren sie ein schlechtes Geschäft. Der Verkauf von Ureinwohnern, die getauft waren oder kurz vor der Konversion standen, war nämlich durch eine königliche Erklärung vom 20. September 1477 verboten worden. Zudem verbot ein päpstlicher Erlass aus dem Jahr 1434, in dem Eugen IV. die Kanarier zu freien Leuten erklärt hatte, den Menschenhandel auf den Kanarischen Inseln. Letztendlich konnten nur die "heidnisch" gebliebenen Kämpfer von Tanausus Stamm Aceró versklavt werden. De Lugo wollte sich damit jedoch nicht abfinden und behandelte die Ureinwohner so übel, dass sie sich zur Wehr setzten. Dies und die kolonialbeamtliche Einschätzung der Rebellen als "Konversionsunwillig" nutzte de Lugo als Vorwand, um etwa 1.200 Benahoaritas als Sklaven zu verkaufen und 20.000 Stück Vieh zu beschlagnahmen. Francisca de Gazmira erhob mehrfach Beschwerden bei Königin Isabella und König Ferdinand gegen dieses Vorgehen - und hatte damit auch Erfolg..
Kolonialzeit
Die Spanier nutzten die Kanaren als wichtige Zwischenstation für die Überfahrt nach Westindien. La Palma bildete dabei den letzten Außenposten. Ausschlaggebend dafür war die geografische Lage in der nördlichen Passatzone, die schon Kolumbus nutzte. Er startete seine zur Epochenwende gewordene Überfahrt am 3, August 1492 in La Gomera - La Palma hat er nie betreten.
Die Insel war auch sonst für eine koloniale Erschließung eher ungünstig und vor allem unergiebig. Schnellen Reichtum bot sie wegen fehlender Bodenschätze nicht. Gewinn versprachen trootz aller Abkommen lediglich die Einheimischen – als Sklaven. Schätzungen zufolge blieben nur rund 300 Familien (1.200 Menschen) von diesem Schicksal verschont. Diese Palmeros vermischten sich, nachdem sie ab 1514 den Spaniern rechtlich gleichgestellt worden waren, rasch mit den Konquistadoren sowie mit eingewanderten Portugiesen und Franzosen. Schon bevor sich der Sklavenhandel auf der Insel erschöpft hatte, verfolgte Alonso Fernández de Lugo ein weitaus lukrativer erscheinendes Ziel: den Anbau von Zuckerrohr, zur damaligen Zeit das den meisten Gewinn bringende Agrarprodukt. Europäische Kaufleute, Handwerker, Wein- und Ackerbauern wurden auf die Insel gerufen, um Kapital und Arbeitskraft in Zuckerverarbeitungsanlagen zu investieren. Die Landvergabe erolgte dabei wie im Zeitraffer. Im Jahr 1508 zu Beispiel verkaufte Juan Fernández de Lugo seine Zuckerverarbeitungs- und Bewässerungsanlage von Tazacorte und Argual an den Andalusier Dinarte. Dieser veräußerte sie ein Jahr später an die Augsburger Welser; wiederum ein Jahr später (1510) gelangten sie in Besitz des Antwerpener Kaufmannes Jakob Groenenberch (hispanisiert Jacomo Monteverde), von dem sie schließlich das Brüsseler Handelshaus Van de Valle erwarb.
Ab 1553 lohnte der Zuckerrohranbau auf La Palma immer weniger. In Mittel- und Südamerika wurde preisgünstiger produziert. Viele nicht mehr rentable Zuckerrohrplantagen wurden in Weinfelder umgewandelt. Der vor allem im Süden der Insel auf jungvulkanischem Boden gedeihende süße Malvasia wurde das wichtigste Exportprodukt von La Palma. Hauptabnehmer des palmerischen Weins war England. Dieser für die Insel recht einträgliche Handel hielt bis Mitte des 19. Jahrhunderts an, dann führte ein sich ändernder Konsumentengeschmack zum Niedergang des Weinbaus. Erst seit dem späten 20. Jahrhundert wird wieder mit zunehmendem Erfolg Wein prooduziert.
Im 16. Jahrhundert bekam La Palma nach Antwerpen und Sevilla das Privileg, mit Amerika Handel zu treiben. Schnell entwickelte sich Santa Cruz de La Palma zu einem der wichtigsten Häfen des spanischen Reiches. So lockte Santa Cruz de La Palma im Laufe des 16. Jahrhunderts immer wieder Piraten an, die sich der Reichtümer der Stadt bemächtigen wollten. Unter dem Befehl von François Le Clerc plünderten Franzosen 1553 die Hafenstadt. Was sie nicht mitnehmen konnten, brannten sie nieder. Nach dieser Katastrophe wurden Kirchen, Klöster und Häuser größer und prächtiger wieder aufgebaut. Neue Verteidigungsanlagen wurden errichtet. So konnte 1585 der Angriff des Engländers Francis Drake erfolgreich abgewehrt werden. Der Handel mit Amerika begünstigte das Aufkommen weiterer Erwerbszweige (Schiffbau, Herstellung von Segeltuch undsoweiter). Zahlreiche Kaufleute aus aller Welt kamen nach Santa Cruz de La Palma und verliehen dem Ort ein internationales Flair, viele fremdländisch klingende Straßennamen zeugen noch heute von dieser Epoche. Der Niedergang setzte jedoch bereits Mitte des 17. Jahrhunderts ein. Nach einem Erlass aus dem Jahre 1657 mussten alle Schiffe auf dem Weg nach Amerika auf Teneriffa registriert werden und dort ihre Abgaben entrichten. Der Handelsverkehr im Hafen von Santa Cruz de La Palma kam damit nahezu zum Erliegen. Zwar gab König Carlos III. 1778 den Amerikahandel für alle spanischen Häfen frei, doch konnte sich Santa Cruz de La Palma nie völlig von der Wirtschaftskrise erholen.
Abgesehen von Piratenangriffen erlebte La Palma weitestgehend ruhige Zeiten. Von jeder Wirtschaftskrise erholte sich das zwar bodenschatzlose, aber sehr fruchtbare Eiland immer relativ schnell. Nach Zucker und Wein ließ sich auch mit Bienenwachs und -honig, mit Tabak sowie mit Seide gutes Geld verdienen. Bereits seit dem beginnenden 16. Jahrhundert pflanzte man in La Palma Maulbeerbäume an, jetzt war La Palma führend in der Seidenherstellung der Kanaren. Die Seidenverarbeitung der Insel galt als die fortschrittlichste des Kanarischen Archipels. Um 1830 wurde die aus Mexiko stammende Cochenille-Laus eingeführt, eine Schildlaus, die einen begehrten karmesinroten Farbstoff liefert. Mit der Entwicklung von Anilinfarbe um 1880 war diesem Wirtschaftszweig jedoch nur ein kurzer Gewinn beschert. Aus dieser Wirtschaftskrise half der Bananenanbau, den die beiden Gesellschaften Elder Dempster aus England und Fyffes aus Irland ab 1878 in großem Stil auf die Kanaren brachten.
Das einfache Volk auf dem Lande profitierte von dem auf La Palma erwirtschafteten Reichtum kaum. Noch im 19. Jahrhundert lebten die meisten Inselbewohner in strohgedeckten Holzhütten, selbst wohlhabende Landbewohner konnten sich nur niedrige Bruchsteinhäuser leisten. Probleme bereitete oft die Versorgung mit Lebensmitteln. Da man auf der Insel vorwiegend Monokulturen anbaute, reichte die verbleibende Ackerfläche für den Anbau von Getreide und anderen Landwirtschaftserzeugnissen nicht aus. Schon im 16. Jahrhundert musste Getreide – zu hohen Preisen – importiert werden. Als das Domkapitel von La Palma einmal seinen Zehnten in Form von Weizen aus dem Getreidespeicher forderte, weigerte sich die Bevölkerung einmütig und entschlossen, auf diese Art ihre Steuern zu begleichen, woraufhin der Inquisitor über die Insel einen Kirchenbann verhängte und – infolge einer Missernte – einige Jahre lang niemand christlich beerdigt wurde. Die Armut auf dem Lande war so groß, dass in vielen Familien die „schlecht ernährten und schlecht gekleideten“ Männer und Frauen, wie 1758 der Missionar Juan de Medinilla in einem vertraulichen Bericht an seinen Bischof schrieb, sonn- und feiertags aus Mangel an Kleidung jeweils abwechselnd zur Messe gehen mussten.
Weltkriegsära
Der Erste Weltkrieg (1914 bis 1918) hatte erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft der Insel. Der Bananenanbau, der um 1900 einen kurzlebigen Wohlstand gebracht hatte, geriet durch die Kriegsfolgen ins Stocken. Der Außenhandel kam weitgehend zum Erliegen, was die wirtschaftliche Lage der Insel weiter verschlechterte. Während des Krieges nutzte die deutsche Marine die strategische Lage der Kanarischen Inseln, um U-Boote im Atlantik zu positionieren. Diese sollten alliierte Schiffe angreifen, die den Atlantik überquerten. Nebst anderem Kriegsgerät verbrachte die deutsche Viermastbark Pamir den Ersten Weltkrieg im Hafen von Santa Cruz de La Palma.. Die wirtschaftliche Erholung setzte erst nach dem Krieg ein, als der internationale Handel wieder aufgenommen wurde. 1927 teilte man die Kanarischen Inseln in eine West- und Ostprovinz, wobei La Palma Teil der Westprovinz Santa Cruz de Tenerife wurde. Die immer wieder von "Ausgestoßenen" als Exil auserkorene Insel war zu jener Zeit eine Hochburg linker Kräfte – in Tazacorte wählten 1936 72 % den Frente Popular, und auch nach der Franco-Diktatur blieb die Insel sozialistisch geprägt.
Eine besondere Rolle spielte sie zu Beginn des Spanischen Bürgerkriegs im Rahmen der sogenannten Semana Roja ("Rote Woche") vom 18. bis 25. Juli 1936. Damals gelang es den Republikanern, den Putsch der Nationalisten unter Francisco Franco vorübergehend zu verzögern. Als Nachrichten vom Putsch Francos erreichten La Palma erreichten, organisierte die Frente Popular (Volksfront) Widerstand, rief den Generalstreik aus und bildete Volksmilizen. Putschkommandant Baltasar Gómez Navarro verfügte auf der Insel nur über 25 Soldaten, während die Republikaner unter Führung des Regieerungsdelegierten Tomás Yanes Rodríguez und des kubanischen Kommunisten José Miguel Pérez in Tazacorte starken Rückhalt hatten. Als das Kanonenboot Canalejas der Falangisten die Isel ansteuerte, beschloss die Regierungsdelegation in der Hoffnung auf Verstärkung aus Madrid, keinen bewaffneten Widerstand zu leisten. Die nachfolgende Machtübernahme der Frankisten brachte harte Repressionen mit sich. Mindestens 400 Menschen wurden auf den Kanaren getötet, darunter der sozialistische Bürgermeister von Los Llanos, Francisco Rodriguez Betancort. Oppositionelle wurden in Lager wie Mauthausen deportiert - erst 2011 wurden die Überreste der 1937 hingerichteten "13 von Fuencaliente" beigesetzt. Der kanarische Autor Alexis Ravelo verarbeitete die Ereignisse 2017 im Roman Los milagros prohibido.
Moderne Zeit
Nach dem Zweiten Weltkrieg war La Palma zeitweise starken Repressionen seitens des Franco-Regimes ausgesetzt. Die Guardie Civil spielte dabei eine zentrale Rolle. Zur politisch prekären Lage kam der wirtschaftliche Niedergang. Der Bananenanbau, seit dem späten 19. Jahrhundert wichtigster Wirtschaftszweig, war nur noch durch Subventionen wettbewerbsfähig. Dazu kamen noch Vulkanausbrüche wie der des San Juan im Jahr 1949. Alles zusammen führt zu schweren Handelseinbußen und einer neuen Auswanderungswelle nach Südamerika. Erst mit dem Entstehen eines zaghaften Tourismus ab den 1950er Jahren konnte diese Entwicklung abgebremst werden.
In den 1960er und 1970 Jahren wurde die Insel zu einem Aussteiger-Domizil zivilisationsmüder "Hippies" und Öko-Freaks - vor allem aus Deutschland. Zahl,reiche Bio- und sonstige "Läden" zeugen noch heute von deren Präsenz. Nach Francos Tod 1975 wurde La Palma 1982 Teil der Autonomen Gemeinschaft der Kanarischen Inseln. Ab den 1980er Jahren entwickelte sich der - zahlenmäßig freilich begrenzt bleibende - Tourismus zu einem stabilen Wirtschaftsfaktor, während die Landwirtschaft weiterhin von EU-Subventionen abhängig blieb.
Zur Corona-Zeit war ab März 2020 La Palma von den in Madrid veranlassten Maßnahmen betroffen, blieb vom "pandemischen" Geschehen ansonsten aber weitgehend verschont. eine Geringe Fallzahlen und relativ lockere Handhabung vorgeschriebener Regularien sorgten für eine weitgehend ruhige Lage. Protestaktionen gab es nur vereinzelt.
Mitten in diese Krisenzeit fiel der Vulkanausbruch vom 19. September 2021, der bis zum 13. Dazember andauerte und mit 85 Tagen und 18 Stunden den längsten dokumentierten Ausbruch auf der Insel darstellte. Über 7.000 Menschen wurden evakuiert, und etwa 3.000 konnten nicht mehr in ihre zerstörten Häuser zurückkehren. Die Lava zerstörte 1.345 Gebäude, darunter Schulen und Kirchen, und bedeckte fast 1.200 Hektar Land, zum Teil agrarische Nutzflächen. Die Schäden wurden auf über 900 Millionen Euro geschätzt..
Trotz des offiziellen Endes des Ausbruchs bleibt der Vulkan unberechenbar und Gasemissionen stellen weiterhin eine Gefahr dar. Forscher entdeckten eine riesige Magmablase unter La Palma, die mit großer Wahrscheinlichkeit zukünftige Eruptionen speisen wird. Zudem könnte die Vulkanflanke langsam in den Atlantik abrutschen, was weitere Risiken weit übere die Insel hinaus birgt. La Palma bleibt also ein Unruheherd.
Chronologie
-2 mio. Hebung der Insel über die Meeresoberfläche
-500.000 Der Taburiente ragt 3500 m über die Meeresoberfläche
-2000 Möglicherweise Entdeckung der Insel durch mediterrane Megalithiker
-4. Jh. Vermutlich Wiederentdeckung durch karthagische Seefahrer
um -240 Besiedlung durch Altkanarier von Tenerife aus
ab -200 Etablierung der urpalmerischen Kultur der „Benahoaritas“
um 1300 Die Insel ist in 12 benahoaritische Stammesdistrikte aufgeteilt
1342/45 Schiffe des aragonischen Königs Pedro IV. ankern vor La Palma
1402 Die spanische Krone erhebt Anspruch auf die gesamten Kanarischen Inseln
1405 Ein erster Versuch Jean de Béthencourts, La Palma zu erobern, scheitert
1407 Auch Béthencourts Neffe Maciot wird von den Benahoaritas zurückgeschlagen
1443 Der Portugiese Conde Mandellacastillo wird bereits vor der Landung verjagt
1447 Hernán Peraza muss sich nach schweren Verlusten zurückziehen
1477 La Palma wird als „Isla Real“ formell direkt der spanischen Krone unterstellt
um 1480 Lava entströmt der Montaña Quemada über Tacande
1491 Alonso Fernández de Lugo erhält die Ermächtigung zur Eroberung La Palmas
29.9.1492 Beginn der Conquista, in deren Folge Tausende Auaritas versklavt werden
April 1493 Der letzte benahoaritische Häuptling Tanausu wird durch List überrumpelt
3.5.1493 Offizielles Ende der Conquista
Mai 1493 Gründung von Santa Cruz an Stelle der benahoaritischen Siedlung Apunyon
1496 A.F. de Lugo macht seinen Neffen Juan zum Statthalter von La Palma
ab 1496 La Palma untersteht formell dem Gouverneur von Teneriffa
1508 Die Handelsbeschränkungen betreffs Amerika fallen
ab 1508 Santa Cruz de la Palma entwickelt sich zu einer blühenden Handelsmetropole
1509 Beginn der Landesveräußerung an flämische und deutsche Handelshäuser
um 1510 Beginn des Zuckerrohranbaus durch den Kölner Jacob Grunenberg
1514 Rechtliche Gleichstellung der Altkanarier mit den Spaniern
um 1520 Die benahoaritische Kultur geht in der spanisch-christlichen auf
ab 1520 Politisch und religiös Verfolgte Mitteleuropäer lassen sich La Palma nieder
ab 1545 Die Kammwälder werden durch Beweidung nach und nach zerstört
1553 Verheerender Überfall der französischen Piraten Le Clerq und Pie de Palo
ab 1554 Der Zuckerrohranbau geht zurück, wird durch Weinbau ersetzt
1556 In Santa Cruz wird die erste öffentliche Grammatikschule eröffnet
1560 Luis Van de Walle stiftet ein „Getreidedepot der Armen“
1566 La Palma wird Sitz eines königlichen Verzollungs- bzw. Registergerichts
1585 Eine Attacke des englischen Korsaren Francis Drake wird abgewehrt; Eruption des Tahuya
1590 Der Flame Aventrot wird wegen seines Freiheitsstrebens ausgewiesen
1599 Letzter großer Piratenüberfall durch den holländischen Admiral van der Does
1610 Limitierung des Amerikahandels auf den gesamten Kanarischen Inseln
ab 1610 Die palmerische Wirtschaft stagniert
ab 1620 24 adelige Vogtsfamilien verprassen die Einkünfte aus der Pacht für die Insel
1618 Ein algerischer Pirat wird noch auf See zurückgeschlagen
1655 - 1667 Eine englische Gesellschaft monopolisiert den kanarischen Weinexport
1657 Schließung des Registergerichts von Santa Cruz
1659/60 Heuschrecken fressen die Insel kahl
1677/78 Aus dem Explosionskrater des San Antonio bei Fuencaliente fließt Lava
1712 Die Eruption des El Charco hinterlässt 12 Schlünde
ab 1715 Der Weinexport geht zurück, die palmerische Wirtschaft liegt darnieder
1752 Bei Mazo werden altkanarische Felsbilder und Inschriften entdeckt
1760 Von Spanien ausgehend beginnt eine Phase politischer Liberalisierung
1771 O’Daly erreicht durch eine Klage die Absetzung der absolutistischen Vögte
1773 In Santa Cruz tagt der erste demokratisch gewählte Lokalrat Spaniens
1778 König Carlos III. gibt den Amerikahandel wieder frei
ab 1778 Die palmerische Wirtschaft erholt sich langsam
ab 1808 Kurzzeitige Eigenverwaltung durch eine gewählte Inselversammlung
1.9.1808 Absetzung des tenerifensischen Gouverneurs
1811/12 Eine große Heuschreckenplage sucht die Insel heim
1820 Legendäre Predigt des Manuel Diaz Hernández für mehr Demokratie
1821 Hernándet errichtet eine erste kostenlose Volksschule
1823 Die „liberalen Umtriebe“ werden durch Gouverneur Van de Walle gestoppt
1829 Der tenerifensische Bischof kämpft per Hirtenbrief gegen die „Unmoral“
um 1830 Die Cochenille-Zucht löst den Weinexport als Haupteinnahmequelle ab
1836 In Santa Cruz wird die erste Musikschule der Insel eingerichtet
ab 1836 Die politische Liberalisierung in Spanien wird auch auf La Palma spürbar
1841 Gründung der ersten Druckerei auf La Palma
1844/45 Eine Heuschreckenplage verursacht Not und Hunger auf der Insel
1852 Faulschimmel legt die Weinproduktion lahm; die Kanarischen Inseln werden Freihandelszone
1863 Gründung der ersten palmensischen Wochenzeitung „El Time“
1878 Mehltau vernichtet die Weinproduktion endgültig
um 1880 Der Cochenille-Handel kommt zum Erliegen
1881 Eröffnung der „Cosmologica“, eines Museums mit Bibliothek
1893 Mit dem Wasserkraftwerk von Barranco del Rio wird La Palma elektrifiziert
1896 Einführung des Bananenanbaus durch englische Handelsfirmen
1908 Streik der Tabakarbeiter gegen soziale Missstände
1912 La Palma erhält spezielle Selbstverwaltungsrechte
1927 Neuordnung der kanarischen Provinzen - La Palma kommt zu Tenerife
1931 Bei den Gemeinderatswahlen erhalten die Monarchisten 51 von 65 Ratssitzen
1932 Die kommunistische Federación de Trabajadores de La Palma tagt erstmals
1936 Nach einwöchigen Kämpfen übernehmen Frankisten die Herrschaft
25.6.1949 San Juan-Eruption am nördlichen Ende des Cumbre Vieja
ab 1950 Auf La Palma wird wieder verstärkt in wirtschaftliche Projekte investiert
1954 Gründung des Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
1966 Inbetriebnahme eines erdölbetriebenen Kraftwerkes bei Santa Cruz
1970 Eröffnung eines internationalen Flughafens in Mazo
24.10.1971 An der Südspitze La Palmas entsteht ein neuer Vulkan, der Teneguía
ab 1975 Langsame Demokratisierung nach Francos Tod
25.3.1981 Der 4690 ha große Nationalpark der Caldera wird gesetzlich verankert
1982 Kanarisches Autonomiestatut mit neuer Sonderrechtsregelung für La Palma; die konservative Wahlmehrheit wird erstmals gebrochen
1983 Einrichtung des 511 ha großen Biosphärenreservats Canal y Los Tilos
1986 Beim Beitritt Spanien zur EG bleiben die Kanaren ausgeklammert
ab 1986 Bürgerinitiativen finden verstärkt Zulauf
1987 Große Protestaktionen anlässlich des ersten Charterfluges aus Deutschland
1987 Auf den Kanarischen Inseln wird die Ehescheidung gesetzlich verankert
1987 Errichtung des ersten Teleskops („NOT“) auf dem Roque de los Muchachos
1987 Gründung der Naturschutzgruppe „Irichen“ („Weizen“)
1987/89 Auf La Palma werden insgesamt 31 Naturschutzgebiete eingerichtet
24.1.1991 Das Gesetz über den Artenschutz wird erlassen
1991 Gründung der ersten palmerischen Frauengruppe in Santa Cruz
1992 Entdeckung eines riesigen unterirdischen Wasserreservoirs in der Caldera; erstmalige Einführung einer geordneten Müllabfuhr
1992/93 Die Ruta del Norte wird als letztes Teilstück der Inselrundfahrt asphaltiert
1993 Integration der Kanaren und damit La Palmas in die Europäische Union; Gründung des ökologisch orientierten „Verbands Junger Unternehmer“ (AJE)
Verwaltung
La Palma ist seit 1927 eine selbstverwaltete Insel der Provincia Santa Cruz de Tenerife (Provinz Santa Cruz), die seit 1983 Teil der Region Autonoma de los Canares (Autonome Region der Kanarischen Inseln) des Königreichs Spanien (Reino de España) ist.
Herrschaftsgeschichte
- um -200 bis April 1493 eigenständige benahoaritische Häuptlingstümer ("Königreiche")
- 1402 und 1477 Anspruch des Königreichs Kastilien (Reino de Castilla) auf La Palma
- April 1493 bis 27. Juli 1496 Kolonie La Palma (Colonia de San Miguel de La Palma) des Königreichs Spanien (Reino de España)
- 27. Juli 1496 bis 27. Januar 1822 La Palma als Teil der Kronolonie Kanarische Inseln (Islas Canarias de Realengo) des Königreichs Spanien (Reino de España)
- 27. Januar 1822 bis 17. März 1852 Provinz Kanarische Inseln (Provincia de Canarias) des Königreichs Spanien (Reino de España)
- 17. März 1852 bis 3. März 1854 Provinz Westliche Kanaren (Provincia des Canarias Occidentales) des Königreichs Spanien (Reino de España)
- 3. März 1854 bis 23. September 1927 gesamtkanarische Provinz Santa Cruz de Tenerife (Provincia de Santa Cruz de Tenerife) des Königreichs Spanien (Reino de España)
- 23. September 1927 bis 16. August 1982 westkanarische Provinz Santa Cruz de Tenerife (Provincia de Santa Cruz de Tenerife) des Königreichs Spanien (Reino de España)
- seit 16. August 1982 Inselgemeinschaft La Palma (Comunidad Insular de La Palma) innerhalb der Provinz Santa Cruz de Tenerife (Provincia de Santa Cruz de Tenerife) der Autonomen Gemeinschaft Kanarische Inseln (Comunidad Autónoma de Canarias) des Königreichs Spanien (Reino de España)
Legislative und Exekutive
Der Cabildo Insular de La Palma (Inselrat von La Palma) besteht aus 21 Abgeordneten, die direkt von der Bevölkerung in einer Listenwahl gewählt werden. Die Hauptfunktionen und Organe des Cabildo Insular von La Palma sind:
- El Pleno: Die Versammlung besteht aus allen 21 gewählten Abgeordneten und fungiert als gesetzgebende Versammlung der Insel.
- Las Comisiones del Pleno: Ausschüsse, die aus Vertretern der verschiedenen im Plenum vertretenen Parteien bestehen und Beschlüsse vorbereiten.
- El Consejo del Gobierno: Der Regierungsrat ist das Exekutivorgan des Cabildos und besteht aus Mitgliedern der Mehrheitspartei bzw. der Koalitionsparteien.
Der Cabildo Insular de La Palma ist zuständig für alle Bereiche, die die Insel in ihrer Gesamtheit betreffen, darunter Wirtschaft, Verkehr, Tourismus, Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Umweltschutz, Raumplanung, Soziales, Kultur und Sport1. Zudem fördert er die aktive Bürgerbeteiligung in Entscheidungsprozessen und bei der Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten auf der Insel.
Inseloberhaupt
Höchster Repräsentant der Insel ist seit 1983 der Präsident der Inselregierung (Presidente del Cabildo Insular de La Palma). Er repräsentiert das Cabildo in der Öffentlichkeit, bestimmt die Richtlinien der Politik und leitet die Verwaltung.
Presidentes del Cabildo Insular de La Palma
- 1979 - 1982 Gregorio Guadalupe Rodríguez, Coalición Canaria
- 1982 - 1991 José Ernesto Luis González Afonso, Partido Popular
- 1991 - 1993 Gregorio Guadalupe Rodríguez, Coalición Canaria
- 1993 - 1996 Felipe Hernández Rodríguez, Partido Socialista Obrero Español
- 1996 - 2009 José Luis Perestelo Rodríguez, Coalición Canaria
- 2009 - 2013 Guadalupe González Taño, Coalición Canaria
- 2013 - 2019 Anselmo Pestana Padrón, Partido Socialista Obrero Español
- 2019 Nieves Lady Barreto Hernández, Coalición Canaria
- seit 2019 Mariano Hernández Zapata, Partido Popular
Politische Gruppierungen und Wahlen
Auf La Palma sind folgende Parteien aktiv:
- Coalición Canaria (CC): stärkste Kraft auf La Palma, die bei der letzten Wahl die absolute Mehrheit mit 11 Abgeordneten erreichte.
- Partido Socialista Obrero Español (PSOE): eine der etablierten Parteien auf La Palma, die 5 Abgeordnete im Inselparlament stellt.
- Partido Popular (PP): ebenfalls eine bedeutende Partei auf der Insel mit 5 Abgeordneten im Inselparlament.
Justizwesen und Kriminalität
Der Oberste Gerichtshof der Kanarischen Inseln hat seinen Sitz in den beiden Hauptstädten des Archipels und auch die wichtigsten Kammern sind in Las Palmas de Gran Canaria und Santa Cruz de Tenerife angesiedelt. Für La Palma bedeutet das, dass komplexere oder schwerwiegende Fälle oft an die Gerichte in den größeren Städten oder auf andere Inseln verwiesen werden. Vor Ort gibt es lokale Polizeistationen, etwa in Los Llanos, wo aktuell die Arrestzellen ausgebaut werden, um die Kapazitäten zu erhöhen. Dies soll die Sicherheit verbessern und die Arbeitsbedingungen der Beamten optimieren. Auch spezielle Räume, etwa für Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt, werden modernisiert5. Die Polizei auf La Palma besteht aus der lokalen Polizei, der Guardia Civil und seit 2024 verstärkt auch aus Beamten der Policía Canaria, die gemeinsam zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt werden.
Die Kriminalität auf La Palma ist zuletzt deutlich gestiegen. Im Jahr 2023 wurden 2.229 Straftaten registriert – ein Anstieg um 33,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt La Palma kanarenweit an der Spitze des Kriminalitätsanstiegs, während der Durchschnitt auf dem Archipel bei einem Plus von 6 Prozent lag. Besonders auffällig war der Anstieg bei Internetdelikten (Cyberkriminalität), insbesondere Computerbetrug. Die häufigsten Delikte auf La Palma sind Diebstahl, Drogenhandel und Drogenbesitz. Die Polizei reagiert mit verstärkten Patrouillen, insbesondere in Randgebieten und in Häfen. Auch eine Hundestaffel wird im Hafen von Tazacorte eingesetzt. Im Vergleich zu anderen Kanarischen Inseln ist die Kriminalitätsrate in der Provinz Teneriffa, zu der La Palma gehört, überproportional gestiegen (+28 % im Jahr 2022). Auf den Kanaren insgesamt sind Diebstähle, Einbrüche und Sexualdelikte die häufigsten Straftaten.
Die Kanarischen Inseln weisen laut einer aktuellen Studie die höchste Verbreitung politischer Korruption in Spanien auf. 69,3 Prozent der Gemeinden waren in Korruptionsfälle verwickelt, wobei 85,2 Prozent dieser Fälle auf kommunaler Ebene stattfanden. Besonders betroffen ist der Bereich Stadtplanung, gefolgt von Diebstahl öffentlicher Gelder und unerlaubten Absprachen bei öffentlichen Ausschreibungen. Von den abgeschlossenen Verfahren endeten 62 mit einer Verurteilung, wobei fast 63 Prozent dieser Urteile Haftstrafen zur Folge hatten. Die Justiz auf La Palma steht angesichts des Anstiegs der Kriminalität und der besonderen Herausforderungen – etwa durch die steigende Zahl von Migranten und die Überlastung der Aufnahmezentren – unter Druck. Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, NGOs und Justiz wird als herausragend beschrieben, insbesondere bei der Bewältigung der Migrationskrise und dem Schutz Minderjähriger.
Flagge und Wappen
Die Flagge (Bandera de La Palma) ist in zwei gleichbreite Streifen senkrecht geteilt, blau am Mast und weiß am Flugende mit dem Inselwappen in ihrer Mitte. Sie hat ein blaues Quadrat in der oberen linken Ecke, das zwölf goldene Sterne enthält, die für die zwölf Gemeinden der Insel stehen. In der Mitte befindet sich ein goldener Kreis, der das Wappen der Insel La Palma darstellt. Die Flagge wurde am 11. März 1983 offiziell angenommen und ist eine Variante der Flagge der Kanarischen Inseln. Sie ist ein Symbol der Autonomie des Bundeslandes und seiner Einheit mit dem spanischen Staat.
Das Wappen von La Palma (Escudo de La Palma) ist eine goldene Sonne, die von einem goldenen Halbmond umgeben ist. Der Halbmond ist von acht goldenen Sternen umringt. In einem blauen Feld über silbernen und blauen Wellen steht ein goldener Turm, gemauert und bezinnt, auf der Zinne eine silberne Büste des Heiligen Michael, silbern gekleidet mit rotem Rock, golden nimbiert, in der rechten Hand eine goldene Waage haltend, links vom Ganzen eine goldene Palme. Das Wappen hat einen goldenen Schildrand mit fünf purpurnen Veilchen. Über dem Schild ist eine geschlossene, königliche Bügelkrone.
Der Wappenschild der Insel La Palma beruht auf dem Wappen, das von den katholischen Königen, das heißt von Kastilien und Leon, oder durch deren Tochter Donna Juana dem Inselrat der Insel La Palma verliehen wurde, und das auf der sogenannten “Pendón de la Conquista” („Standarte der Eroberung“), zwischen 1536 und 1556 datiert, erscheint. Zur Unterscheidung vom Wappen der Hauptstadt wurden dem Schildrand die Veilchen, eine einheimische Art, hinzugefügt. Die endgültige Einführung erfolgte durch Dekret des Ministerio de la Gobernación vom 10. Oktober 1975.
Hauptstadt
Hauptstadt der Insel ist seit ihrer Gründung am 3 Mai 1493 Santa Cruz de La Palma. Die Stadt entstand im Zuge der spanischen Kolonialisierung der Kanaren nach der Eroberung der Insel durch Alonso Fernández de Lugo zwischen 1492 und 1493. Sie wurde als zentraler Hafen- und Handelsort geplant und hat ihren Status als Hauptstadt nie verloren. Historisch war sie im 16. und 17. Jahrhundert einer der wichtigsten Seehäfen des Spanischen Reiches, was ihren Status festigte.
Verwaltungsgliederung
La Palma besteht aus 14 Gemeinden:
| Municipio | Fläche (km²) | Einwohner 2017 | Dichte (E/km²) |
| Barlovento | 43,55 | 1.859 | 42,69 |
| Breña Alta | 30,82 | 7.061 | 229,10 |
| Breña Baja | 14,2 | 5.434 | 382,68 |
| El Paso | 135,92 | 7.464 | 54,91 |
| Fuencaliente | 56,42 | 1.695 | 30,04 |
| Garafía | 103,0 | 1.584 | 15,38 |
| Los Llanos de Aridane | 35,79 | 20.107 | 561,83 |
| Puntagorda | 31,1 | 2.009 | 64,60 |
| Puntallana | 35,1 | 2.429 | 69,20 |
| San Andrés y Sauces | 42,75 | 4.135 | 96,73 |
| Santa Cruz de La Palma | 43,38 | 15.581 | 359,22 |
| Tazacorte | 11,37 | 4.620 | 406,33 |
| Tijarafe | 53,76 | 2.590 | 48,18 |
| Villa de Mazo | 71,17 | 4.782 | 67,18 |
| La Palma | 708,32 | 81.350 | 114,85 |
Verwaltungseinheiten:
14 municipios (Großgemeinden)
136 barríos (Stadtteile), pueblos (Dörfer) und caseríos (Hofgemeinschaften)
Bevölkerung
Die Einwohnerzahl von La Palma verzeichnet in den zwölf zurückliegenden Jahren einen moderaten Anstieg. Die Einwohnerentwicklung in den Gemeinden von 1990 bis 2012 stellt sich recht unterschiedlich dar. Wenn in Santa Cruz in den letzten zwölf Jahren die Einwohnerzahl stetig abnahm, hatte Los Llanos einen entsprechenden Zuwachs zu verzeichnen, wie auch die an Santa Cruz grenzenden Gemeinden Breña Alta und Breña Baja. Bevölkerungsrückgänge sind auch in den Landgemeinden im Norden der Insel, Garafía, Barlovento und San Andrés y Sauces sowie Tazacorte im Westen festzustellen. Die übrigen Gemeinden weisen dagegen nur geringe Veränderungen in den Einwohnerzahlen aus. Im Folgenden die Entwicklung der Bevölkerungszahl samt Dichte, bezogen auf die offizielle Fläche von 708,32 km².
Bevölkerungsentwicklung:
Jahr Einwohner Dichte (E/km²)
1455 6 000 8,47
1492 3 800 5,37
1513 1 200 1,69
1650 9 000 12,71
1676 13 315 18,55
1745 17 580 24,82
1768 19 195 27,10
1802 28 824 40,70
1830 33 000 46,59
1843 28 608 40,39
1853 34 320 48,46
1860 31 168 44,01
1891 39 605 55,92
1901 41 996 59,29
1905 45 752 64,60
1910 49 464 69,83
1915 46 582 65,77
1920 52 225 73,73
1925 51 784 73,11
1930 53 034 74,87
1940 60 533 85,47
1945 63 809 90,09
1950 67 225 95,18
1955 67 141 94,80
1960 72 010 101,66
1965 66 329 93,65
1967 68 006 96,02
1970 73 749 104,12
1975 72 665 102,60
1980 75 577 106,71
1981 76 426 107,91
1982 78 036 110,18
1983 79 545 112,31
1984 80 710 113,96
1985 79 419 112,13
1986 79 815 112,69
1987 79 884 112,79
1988 80 809 114,10
1989 81 505 115,08
1990 82 303 116,20
1991 78 867 111,35
1992 79 513 112,27
1993 80 913 114,24
1994 81 724 115,39
1995 82 183 116,04
1996 81 507 115,08
1997 80 100 113,09
1998 78 198 110,41
1999 82 419 116,36
2000 82 483 116,46
2001 84 319 119,05
2002 85 547 120,77
2003 85 631 120,89
2004 84 282 118,99
2005 85 252 120,36
2006 86 062 121,50
2007 85 933 121,32
2008 86 528 122,16
2009 86 996 122,82
2010 87 324 123,28
2011 87 163 123,06
2012 85 468 120,66
2013 85 115 120,16
2014 83 456 117,82
2015 82 346 116,26
2016 81 486 115,04
2017 81 350 114,85
2018 81 863 115,57
2019 82 671 116,71
2020 83 458 117,83
2021 83 439 117,80
2022 83 875 118,41
2023 84 338 119,07
2024 85 104 120,15
Die Bevölkerung wuchs von 1981 bis 2001 um durchschnittlich 0,516 % pro Jahr.
Bevölkerungsaufteilung:
Bevölkerungszahl 1991 insgesamt 78 867
davon weiblich 39 941 50,64 %
männlich 38 926 49,36 %
davon unter 15jährig 15 711 19,92 %
15 bis 64 Jahre alt 51 886 65,79 %
über 64jährig 11 270 14,29 %
davon ländlich 53 919 68,37 %
städtisch 24 948 31,63 %
davon Palmeros 66 385 84,17 %
Kanaren 6 393 8,11 %
Ausländer 6 089 7,72 %
Lebenserwartung 1996:
- insgesamt 76,15 Jahre
- Frauen 80,84
- Männer 71,54
- mittleres Alter 2002: 35 Jahre
Haushalte 1990:
- Gesamtzahl der Gebäude 24 262
- davon Einfamilienhäuser 22 662
- Personen pro Gebäude 3,251
- Wohnunghen 30 412
- Personen pro Wohnung 2,706
- Gesamtzahl der Familien 18 807
- Personen pro Familie 4,019
Volksgruppen
Die Bewohner La Palmas, zumindest jene, die hier „eingeboren“ sind, also in einer der 14 Inselgemeinden zur Welt, werden üblicherweise als Palmeros bezeichnet. Seit den 1960er Jahren hat sich die Insel zu einer Art „Aussteigerparadies“ entwickelt. Vor allem Deutsche haben sich hier angesiedelt und sichtbare Spuren hinterlassen. Die Zahl der Ausländere betrug im Jahr 2023 insgesamt 10.053, was einem Bevölkerungsanteil von 11,92 % entspricht.
Ausländer 2011:
- Venezuela 4.736
- Deutschland 4.392
- Kuba 1523
- Kolumbien 746
- Großbritannien 534
- Italien 340
- Schweiz 292
- Marokko 220
- Niederlande 210
- Frankreich 184
- Belgien 138
- Argentinien 133
- Portugal 122
Die Ureinwohner der Insel werden in der Fachliteratur Benahoaritas genannt - frühere Bezeichnungen wie Auaritas, Avaritas oder Awaras sind nicht mehr gebräuchlich. Sie waren veremutlich mit den Berbern verwandt und siedelten sich ab dem -4. Jahrhundert auf der Insel an. Hier entwickelten sie äußerst komplexe soziale Strukturen und organisierten sich in Stammesgemeinschaften und Clans. Was das Aussehen der Benahoaritas betrifft, so heißt es in den frühen Kolonialberichten, dass sie die am größten gewachsene Ureinwohnergruppe der Kanarischen Inseln waren (Rodriguez 1992:13). Wissenschaftliche Studien an menschlichen Knochen aus der Zeit vor der Wiederentdeckung der Inseln durch die Europäer ermittelten eine mittlere Größe von 1,70 m für Männer und 1,65 für Frauen.
Die Benahoaritas waren hauptsächlich Viehzüchter, im Speziellen Ziegenhirten. Sie lebten in natürlichen Höhlen und nutzten diese auch als Lagerstätten und Grabstätten. Ihre Nahrung bestand hauptsächlich aus Milch, Butter, Ziegen- und Schweinefleisch. Sie stellten Keramik her und trugen Ledertuniken oder Binsenkleidung. Die Benahoaritas praktizierten die Mumifizierung, insbesondere bei hochgestellten Persönlichkeiten.
Auf La Palma gibt es noch heute archäologische Spuren der Benahoaritas, wie steingepflasterte Wege, die als Königswege bezeichnet werden, sowie Grabstätten und Steinritzungen. Diese Spuren zeugen von einer reichen Kultur, die jedoch nach der spanischen Eroberung weitgehend verloren ging. Trotz des Verlusts ihrer Kultur wird der letzte König der Benahoritas, Tanausú, noch heute verehrt. Die Geschichte und das Erbe der Benahoaritas sind ein wichtiger Teil der Identität La Palmas und werden durch Museen und archäologische Stätten bewahrt
Sprachen
Offizielle Amtssprache ist Spanisch. Im Alltag gesprochen wird die palmerische Unterart des kanarischen Dialekts. Der Akzent klingt hier vergleichsweise melodischer, fast wie ein Singen. Obwohl die ursprüngliche Sprache der altkanarischen Ureinwohner ausgestorben ist, haben sich einige Wörter im heutigen kanarischen Dialekt erhalten. Zudem finden sich im kanarischen Dialekt, einschließlich des auf La Palma gesprochenen, Elemente aus dem lateinamerikanischen Spanisch.
- Phonetische Besonderheiten:
- Aspiration des /s/-Lautes am Silbenende und vor Konsonanten
- Stimmhaftwerden stimmloser Plosive (/p,t,k/ werden zu /b,d,g/)
- Verlust des intervokalischen /d/
- Grammatikalische Merkmale:
- Häufige Verwendung von Diminutiven mit den Endungen -ito oder -illo
- Ersetzung von Possessivpronomen durch Dativformen
- Bevorzugung bestimmter Zeitformen wie Presente, Indefinido und Imperfecto
- Lexikalische Besonderheiten:
- Verwendung des Verbs "aquellar", das nur noch auf La Palma zu finden ist
- Einflüsse aus dem Portugiesischen, wobei La Palma neben Teneriffa die meisten "Lusismen" aufweist
Die Sprache der Benahoariten, Ahuwwâra genannt, gehörte zur berberischen Sprachfamilie. In der Isolation entwickelte sie sich zu einem eigenständigen Idiom, das auf den anderen Inseln nur bedingt verständlich war. Im 17. Jahrhundert starb die Sprache aus. Nur wenige Begriffe - wie etwa roque für "Klippe" - überlebten.
Religion
Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist römisch-katholisch. Die Insel gehört zur Diözese San Cristóbal de La Laguna mit Sitz auf Tenerife. Kirchen gibt es in allen Gemeinden, in Santa Cruz sogar sechs mit der Iglesia Matrz de El Salvador als Hauptkirche. Das Festleben der Palmeros ist stark nach dem christlichen Kalender ausgerichtet. In regelmäßigen Abständen werden die Heiligen aus bestimmten Kirchen mit Prozessionen geehrt. Diese Veranstaltungen verlaufen über mehrere Tage und werden durch ein Rahmenprogramm und ausgelassene Feiern begleitet.
Neben der katholischen Kirche gibt es auf La Palma auch andere christliche Konfessionen und Religionsgemeinschaften:
- diverse evangelische Kirchen
- Russisch- und Rumänisch-Orthodoxe Kirche
- Zeugen Jehovas mit einigen wenigen Mitgliedern
- Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) mit ebenfalls nur wenigen Mitgliedern
Darüber hinaus gibt es auf La Palma kleinere Gemeinschaften anderer Religionen wie Islam, Hinduismus und Buddhismus, wobei deren genaue Zahlen nicht bekannt sind.
Siedlungen
Die Einwohnerzahlen der Gemeinden entwickelte sich wie folgt:
| Gemeinde | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2020 |
| Barlovento | 1.986 | 2.111 | 2.414 | 2.663 | 3.069 | 3.193 | 2.764 | 2.736 | 2.540 | 2.598 | 2.694 | 2.398 | 2.507 | 2.296 | 2.085 | 1.926 |
| Breña Alta | 2.589 | 2.863 | 3.078 | 3.437 | 3.843 | 4.049 | 4.762 | 4.290 | 4.792 | 5.467 | 5.567 | 5.898 | 7.039 | 7.347 | 7.298 | 7.247 |
| Breña Baja | 1.816 | 2.001 | 1.839 | 2.042 | 2.364 | 2.405 | 2.505 | 2.632 | 3.363 | 3.418 | 3.537 | 4.051 | 4.355 | 5.259 | 5.492 | 5.821 |
| Fuencaliente | 1.650 | 1.833 | 1.841 | 1.966 | 2.212 | 2.270 | 1.943 | 1.749 | 1.664 | 1.822 | 1.804 | 1.800 | 1.913 | 1.898 | 1.840 | 7.623 |
| Garafía | 2.718 | 3.024 | 3.240 | 3.800 | 4.419 | 4.884 | 4.405 | 3.222 | 2.082 | 2.043 | 2.032 | 2.007 | 1.924 | 1.714 | 1.654 | 1.751 |
| Los Llanos de Aridane | 6.638 | 7.214 | 6.912 | 5.786 | 6.614 | 7.696 | 9.886 | 12.118 | 14.677 | 17.062 | 17.737 | 18.190 | 19.878 | 20.948 | 20.895 | 1.730 |
| El Paso | 4.038 | 4.399 | 4.665 | 4.885 | 5.087 | 5.407i | 5.591 | 5.534 | 5.862 | 7.154 | 7.293 | 7.289 | 7.404 | 7.837 | 7.874 | 20.760 |
| Puntagorda | 1.341 | 1.359 | 1.508 | 1.633 | 1.531 | 1.706 | 1.593 | 1.287 | 1.187 | 1.692 | 1.825 | 1.785 | 1.795 | 2.177 | 1.940 | 2.203 |
| Puntallana | 2.152 | 2.225 | 2.230 | 2.318 | 2.494 | 2.632 | 2.321 | 2.078 | 2.266 | 2.305 | 2.296 | 2.204 | 2.424 | 2.425 | 2.428 | 2.553 |
| San Andrés y Sauces | 3.409 | 3.977 | 4.160 | 4.616 | 5.568 | 5.990 | 6.208 | 5.399 | 5.345 | 5.399 | 5.492 | 5.229 | 5.086 | 4.874 | 4.637 | 4.182 |
| Santa Cruz de la Palma | 7.024 | 7.542 | 7.258 | 7.951 | 11.605 | 11.524 | 12.967 | 13.163 | 16.629 | 18.183 | 17.460 | 18.204 | 17.788 | 17.128 | 16.705 | 15.695 |
| Tazacorte | 3.104 | 3.728 | 4.067 | 4.587 | 4.644 | 6.002 | 7.049 | 6.617 | 6.147 | 5.835 | 5.697 | 4.957 | 4.601 | |||
| Tijarafe | 2.552 | 2.694 | 2.766 | 2.733 | 2.937 | 3.041 | 2.873 | 2.662 | 2.692 | 2.734 | 2.662 | 2.672 | 2.713 | 2.769 | 2.765 | 2.507 |
| Villa de Mazo | 4.081 | 4.510 | 4.651 | 4.850 | 5.062 | 4.947 | 4.726 | 3.564 | 3.564 | 5.112 | 5.260 | 4.609 | 4.591 | 4.955 | 4.898 | 4.859 |

In der Hauptstadt Santa Cruz de La Palma an der zentralen Ostküste lebt rund ein Fünftel der plamerischen Bevölkerung. Der Ort liegt unterhalb der bewaldeten Berghänge der Cumbres auf der östlichen Seite der Insel. Die Bebauung reicht vom schmalen Uferstreifen bis ins bergige Gebiet. Der Altstadtkern ist ein kunsthistorisches Baudenkmal. Die Hauptdurchgangsstraße ist die Avenida Marítima, die nur auf der Landseite bebaute Uferstraße. Hier befinden sich neben neuen Gebäuden einige alte Häuser im kanarischen und kolonialen Stil mit kunstvoll verzierten Holzbalkonen. Auf der parallel verlaufenden Calle O’Daly, auch als Calle Real bezeichnet, befinden sich das Rathaus (im 16. Jahrhundert unter der Herrschaft von Philipp II. errichtet), die Plaza de España mit der Hauptkirche El Salvador, kleine Geschäfte, Cafeterias und Restaurants. Gegründet wurde die Stadt am 3. Mai 1493 von Alonso Fernández de Lugo. Sie entwickelte sich zunächst zu einem Handels- und Schmuggelzentrum, ehe sie ab Mitte des 17. Jahrhunderts einen wirtschaftlichen Niedergang erlebte. Erst durch den 1778 einsetzenden Amerikahandel konnte sich die Stadt wieder erholen. Heute ist sie mit ihrem nahegelenen Flughafen das „Eingangstor“ zur Insel.
Los Llanos de Aridane, die größte Ortschaft auf La Palma, liegt im Tal von Aridane auf der windabgewandten und sonnigen Seite der Insel, was eine sehr günstige Lage ist, abgesehen von der Tatsache, dass der westliche Teil der Insel recht gut bewässert ist und niedrigere Hänge hat als die anderen Gebiete, daher der Name der Stadt. Sie entstand 1522, als Jacomo de Monteverde die Kirche Nuestra Señora de Los Remedios erbauen ließ. Im späten 18. Jahrhundert wanderte ein großer Teil der Einwohner nach Amerika aus. 1868 erhielt Los Llanos per königlichem Dekret den Titel Villa, damit galt sie nach der Inselhauptstadt Santa Cruz de La Palma als die wichtigste Stadt der Insel. Die Gemeinde hat sich im Laufe der Zeit zur einwohnerstärksten der Insel entwickelt und damit in den 1990er Jahren Santa Cruz de La Palma übertroffen. Der zur Gemeinde Los Llanos gehörende Ort Puerto Naos ist, neben Los Cancajos in der Gemeinde Breña Baja, eines der beiden touristischen Zentren La Palmas. Heute ist Los Llanos de Aridane das wichtigste Wirtschaftszentrum im Westen der Insel.
Tazacorte, offiziell La Villa y Puerto de Tazacorte, liegt am mittleren Teil der Westküste dieser Insel. Hier begann 1492 die spanische Eroberung La Palmas. Aufgrund der guten klimatischen Lage und Wasserversorgung haben die Eroberer frühzeitig Zuckerrohr anbauen lassen, was über mehr als drei Jahrhunderte lang in der Gemeinde erfolgreich möglich war. Die heute noch existierenden Herrenhäuser zeugen von dieser Entwicklung. Die wesentlichen Erwerbsgrundlagen der Gemeinde sind heute ausgedehnte Bananenplantagen und der sanfte Tourismus. Besonderheiten der Gemeinde sind das historische Treppenviertel in Villa de Tazacorte und der Fischerei- und Yachthafen.
El Paso im Zentrum von La Palma gilt als das „Herz der Insel“. Im Gebiet der flächenmäßig größten Inselgemeinde befinden sich vorwiegend Ackerflächen und Kiefernwälder. Ein großer Teil der Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft. Die hauptsächlichen Erzeugnisse sind Wein, Mandeln und einige Fruchtarten.
Fuencaliente befindeet sich im äußersten Süden der Insel. Der Name leitet sich von Fuente Caliente „heiße Quelle“ ab und bezieht sich auf die Heilquelle Fuente Santa, die im 16. und 17. Jahrhundert genutzt und 2005 wiederentdeckt wurde. Nachdem sie beim Ausbruch des Vulkans San Antonio im Jahr 1677 unter Lavamassen begraben worden und 300 Jahre unentdeckt geblieben war, wurde der Ort in Los Canarios umbenannt. Heute sind beide Namensnennungen gebräuchlich.
Verkehr
Die Insel verfügt über ein gut ausgebautes Verkehrsnetz.
Straßenverkehr
Mittlerweile ist das Straßennetz auf La Palma gut 1.200 Kilometer lang. Alle Hauptstraßen sind asphaltiert, landschaftsbedingt kurvenreich und in gutem Zustand.
Um den abgelegenen Norden der Insel wirtschaftlich besser einzubinden, wurde Anfang 1992 eine asphaltierte Verbindungsstraße zwischen Garafia und Barlovento geschaffen. Lediglich einige abgelegene Ortschaften im Inselnorden sind nur über Erd- oder Betonpisten zu erreichen.
Ein etwa 180 Kilometer langer Straßenring (Kartenbezeichnung LP-1 und LP-2) umläuft die gesamte Insel (Santa Cruz–Los Cancajos–Mazo–Fuencaliente–Los Llanos–Tijarafe–Puntagorda–Barlovento–San Andrés–Puntallana–Santa Cruz), weiterhin verbindet eine rund 35 Kilometer lange Straße (Kartenbezeichnung LP-3) über zwei Tunnel den Osten mit dem Westen der Insel (Los Llanos–Los Cancajos). Eine dritte Straße verbindet den Osten mit dem Nordwesten der Insel (Kartenbezeichnung LP-4) und führt über den höchsten Berg von La Palma, den Roque de los Muchachos.
Der Öffentliche Personennahverkehr auf der Kanarischen Insel La Palma stützt sich auf die von Transportes Insular La Palma S. Coop. betriebenen Omnibuslinien. Die Linienbusse werden auch hier, wie auf den anderen zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln, als Guagua bezeichnet.
Derzeit gibt es 16 Linien. Nachdem der Busverkehr über mehrere Jahre deutlich ausgebaut worden war, wurde im Zuge der Wirtschaftskrise mit einer Fahrplanänderung Ende 2012 die Bedienung auf einigen Linien wieder erheblich zusammengekürzt. Gleichzeitig wurde die Nummerierung der einzelnen Linien geändert. Die neue Nummerierung orientiert sich nun grob an der Bezeichnung der Hauptverkehrsstraßen, die den einzelnen Linien folgen. So folgt beispielsweise die 300 der LP-3 von Santa Cruz de La Palma nach Los Llanos de Aridane. Die wichtigsten Linien sind hierbei Santa Cruz mit Los Llanos: direkt (300), über den Inselnorden (100) oder den Inselsüden (200). Häufig befahren wird auch die Strecke von Santa Cruz zum Flughafen Santa Cruz de La Palma über den Touristenort Los Cancajos. In der Regel liegt ein Stundentakt vor, dieser ist an Sonntagen und Abends ausgedünnt. Einzelne Linien bieten vormittags einen Halbstundentakt.
Jede Fahrt ist einzeln zu bezahlen, es gibt einen Orts- und einen Überlandpreis. Die Preise betragen 1,30 € und 2,00 € (Stand 2013). Rabatte sind durch eine Bonobus genannte Chipkarte möglich. Die übertragbare Bonobuskarte kann für 1€ beim Busfahrer erworben und dort mit einem beliebigen Betrag immer wieder aufgeladen werden. Der Fahrpreis wird mit einem Rabatt von rund 20 Prozent von dieser Karte abgebucht. Bonobuskarten können auch in einigen Kiosken in der Nähe der zentralen Bushaltestelle in Santa Cruz sowie am Busbahnhof in Los Llanos gekauft werden.
Straßen 1992:
- insgesamt 1.173 km
- davon asfaltiert 355 km (0,503 km/km²)
- Tankstellen 15
- Fahrzeugbestand insgesamt 30 449 (0,386 pro Person)
- Pkw 20.473
- Motorräder / Mopeds 8.257
- Lkw 1.332
- Agrarfahrzeuge 80
- Autobusse 55
- sonstige 252
Schiffsverkehr
Die Bucht der Hauptstadt wird seit der Eroberung der Insel durch die Spanier als Hafen genutzt. Von Santa Cruz de La Palma werden diverse Fährverbindungen zu den Nachbarinseln und (wöchentlich) zum spanischen Festland, mit Zwischenstopps auf Lanzarote, Gran Canaria und Teneriffa, angeboten. Seit Januar 2008 verkehrt die Fähre El Fortuny der Gesellschaft Trasmediterránea auf der früher von der Juan J. Sister bedienten Route nach Cádiz auf dem spanischen Festland.
Seit 2008 verkehrt auch eine Fähre der Naviera Armas, die Volcán de Tijarafe, zwischen Portimão, Portugal via Funchal, Madeira nach Santa Cruz de Tenerife von wo aus man La Palma im Anschluss erreichen kann. Der großzügig ausgebaute Hafen an der Westküste in Puerto de Tazacorte war 2005/2006 kurzzeitig mit einer (wöchentlichen, nicht immer zuverlässig verkehrenden) Verbindung zur Insel Teneriffa über Santa Cruz de La Palma dem Fährverkehr angeschlossen.
Leuchttürme:
Areans Blancas
- Standort: Arenas Blancas, 28°34‘ N, 17°46‘ W
- Inbetriebnahme:
- Turmhöhe: 31,5 m
- Feuerhöhe: 41,5 m
- Befeuerung:
- Tragweite: 37 km
Faro de Fuencaliente
- Standort: Playa de Fuencaliente, 28°28‘ N, 17°51‘W
- Inbetriebnahme: 1984
- Turmhöhe: 24 m
- Feuerhöhe: 38 m
- Befeuerung:
- Tragweite: 26 km
Faro de la Punta Cumplida
- Standort: Barlovento, Punta Cumplida, 28°50‘ N, 17°47‘ W
- Inbetriebnahme: 1867
- Turmhöhe: 34 m
- Feuerhöhe: 83 m
- Befeuerung:
- Tragweite: 42 km
Faro de la Punta Lava
- Standort: Punta Lava, 28°35‘ N, 17°55‘ W
- Inbetriebnahme:
- Turmhöhe: 48 m
- Feuerhöhe: 51 m
- Befeuerung:
- Tragweite: 37 km
Flugverkehr
Der erste Flughafen von La Palma wurde bei Breña Alta in 350 Metern Höhe über dem Meeresspiegel mit einer Länge von tausend Metern errichtet und 1955 in Betrieb genommen. Er erhielt den Namen Buenavista. Wegen der Nähe der Berge bestand das Problem der wechselnden Winde aus unterschiedlichen Richtungen, wiederholt auftretender Nebelbänke und Regenfälle, die in den folgenden Jahren über 15 Prozent Flugausfälle verursachten. Diese Umstände zwangen zu einer Neuplanung des Flughafenstandortes. Der Flughafen Buenavista wurde 1970 mit der Inbetriebnahme des neuen Flughafens stillgelegt, dessen Piste noch existiert und von der Hauptverbindungsstraße von der Ostseite der Insel zur Westseite überquert wird.
Der neue Flughafen La Palma wurde in der Gemeinde Mazo entlang des Küstenstreifens errichtet. Aufgrund des zunehmenden Verkehrsaufkommens wurde 1980 die Landebahn durch Aufschüttung eines Damms im angrenzenden Meer verlängert. Seit 1987 ist er der sechste internationale Flughafen der Kanarischen Inseln, der mehrmals wöchentlich von mehreren europäischen Chartergesellschaften angeflogen wird. Vom Flughafen bestehen Linienverbindungen zu den Nachbarinseln und zur spanischen Hauptstadt Madrid, die durch die spanischen Fluggesellschaften Iberia sowie die lokale Gesellschaft Binter Canarias bedient werden. Das neue Flughafenterminal ist seit 2011 in Betrieb.
Am 19. Februar 1921 erhielt die damalige Gesellschaft Marítimo Canaria vom Verkehrsministerium die Genehmigung, an der Küste von Tazacorte einen Luftverkehrsdienst einzurichten. Anfang der 1950er Jahre plante man einen neuen Flugplatz. Die Auswahl des Ortes war allerdings schwierig, da die Insel La Palma sehr gebirgig ist und kaum ebene Fläche in der Nähe der Hauptstadt bietet. So entschied man sich, den Flugplatz namens Buenavista de Arriba etwa drei Kilometer westlich der Inselhauptstadt Santa Cruz auf 400 Meter Höhe anzulegen. Dieser Flugplatz, mit einer etwa 1.000 Meter langen Piste, wurde am 22. September 1955 für die zivile Luftfahrt und die ersten Touristenflüge eröffnet. 1958 erhielt die Start- und Landebahn eine Asphaltdecke in Richtung 03-21. Es verkehrten Flugzeuge des Typs Junkers Ju 52/3m und Douglas DC-3. Vom alten Flughafen existieren noch die Landebahn sowie der Tower nebst Flughafengebäude, das mittlerweile zu einem Privathaus umgebaut wurde. Da aber auch dieser Flugplatz aufgrund der schwierigen Wind- und Wetterverhältnisse nicht mehr tragbar war, wurde in der Nähe von Mazo, etwa acht Kilometer südlich von Santa Cruz, am 15. April 1970 der neue Flughafen eröffnet. Aufgrund des großen Verkehrsaufkommens wurde die Landebahn 01-19 um etwa 500 Meter in Richtung Norden verlängert. Sie war am 1. April 1980 vollendet und blieb bis heute unverändert.
Aber auch dieser Flughafen ist an einem windanfälligen Standort positioniert – bei seltenen Westwindwetterlagen entstehen an einigen Tagen im Jahr Fallwinde von den Berghängen, bei denen der Flugverkehr teilweise oder sogar ganz eingestellt werden muss. Bei einem der längsten Vorkommnisse dieser Art in der Zeit vom 6. bis 10. April 2008 fielen etwa drei Viertel aller Flugbewegungen aus, teilweise war der Airport komplett geschlossen. Viele Charterflüge wurden zum Flughafen Teneriffa Süd umgeleitet. Über 1.500 Fluggäste mussten Fährverbindungen nutzen oder auf Teneriffa bzw. den anderen Inseln ausharren.
Im März 2005 wurde mit dem Ausbau des Flughafens begonnen. Das Investitionsvolumen beträgt 103,9 Millionen Euro und soll im Jahr im 2012 endgültig abgeschlossen sein. Geplant sind eine Vorfelderweiterung, der das alte Terminal weichen muss, ein neuer Tower sowie eine größere Abfertigungshalle (Terminal) mit Fluggastbrücken und einer Kapazität von bis zu drei Millionen Passagieren im Jahr. Es besteht aus insgesamt acht Ebenen mit einer Gesamtfläche etwa 95.000 m². Im obersten Stockwerk befinden sich diverse Restaurants und der Abflugbereich. In der mittleren Ebene befindet sich die Ankunft dessen Gepäckausgabe über fünf Gepäckbänder verfügt, ebenfalls auf dieser Ebene 24 Check-in Schalter, diverse Geschäfte und Informationsschalter. In den unteren Ebenen befindet sich ein zweistöckiges Parkhaus. Die Sicherheitseinrichtungen, wie beispielsweise die Feuerwehr, die gegenüber dem Terminal auf der anderen Seite des Rollfeldes in ein neues Gebäude verlagert wird, wurden umfangreich modernisiert. Außerdem plant der Flughafen den Bau eines Hangars. Am 6. Juli 2011 wurde das neue Terminal eröffnet und der Rückbau des alten Gebäudes eingeleitet.
| Airlines | Ziele |
| Air Europa Express | Tenerife-Nord |
| Binter Canarias | Gran Canaria, Tenerife–Nord |
| Condor | Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, saisonal: Düsseldorf |
| CanaryFly | Tenerife–Nord |
| easyJet | saisonal: Berlin-Schönefeld, London-Gatwick |
| Enter Air | Paris-Charles de Gaulle (Charter) |
| Eurowings | Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart |
| Germania | saisonal: Berlin-Tegel (ab 6. November 2018), Düsseldorf, Hamburg |
| Germania Flug | saisonal: Zürich |
| Iberia Express | Madrid |
| Primera Air | saisonal: Billund, Kopenhagen, Göteborg, Helsinki, Joensuu, Kokkola-Pietarsaari, Kuopio, Laappeenranta, Malmö, Oslo-Gardermoen, Oulu, Pori, Reykjavik-Keflavik, Stockholm-Arlanda |
| Small Planet Airlines | saisonal: Warschau-Chopin |
| Travel Service | Lyon, Nantes (beide Charter) |
| Transavia | Amsterdam |
| TUI Airways | London-Gatwick, Manchester |
| TUI fly Belgium | Brüssel |
| TUI fly Netherlands | Amsterdam |
| Vueling | Barcelona |
La Palma Airport
- spanischer Name: Aeropuerto de La Palma
- Code: SPC / GCLA
- Lage: 28°37‘35“ N, 17°45‘20“ W
- Seehöhe: 33 m (108 ft)
- Entfernung: Mazo, 8 km südlich von Santa Cruz de La Palma
- Inbetriebnahme: 15. April 1970
- Betreiber: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
- Terminal: 1
- Rollbahn: 1
- Länge der Rollbahn: 2200 m (Asfalt)
- Fluggesellschaften: 18
- Flugzeug-Standplätze: ca. 30
- jährliche Passagierkapazität: ca. 1 mio.
- jährliche Frachtkapazität: ca. 2000 t
- Flughafen-Statistik: Jahr Flugbewegungen Passagiere Fracht in t
1990 . 486 186 439
1995 11 966 716 295 1 650
1996 12 115 703 578 1 586
1997 11 751 719 278 1 537
1998 12 870 775 184 1 456
1999 13 777 853 959 1 604
2000 14 955 893 726 1 756
2001 14 673 943 688 1 647
2009 19 741 1 042 969 1 084
2011 19 455 1 067 431 851
2015 15 800 971 676 565
2016 17 296 1 116 146 577
2017 17 757 1 302 485 617
Wirtschaft
Hauptwirtschaftszweige der Insel sind Landwirtschaft und Tourismus.
Landwirtschaft
2006 wurde auf insgesamt 8.305 Hektar Landwirtschaft betrieben. Bananen und Wein nehmen dabei mit über 5.000 Hektar eine zentrale Rolle ein. Zunehmend wird die Landwirtschaft jedoch mit dem Anbau von Avocado, Zitrusfrüchten und Gemüse diversifiziert.
Die Landwirtschaft wird durch ein einzigartiges Bewässerungssystem aus Wasserleitungen und Tunneln ermöglicht, die das Wasser aus den Bergen in die agrarisch genutzten Gebiete führen. Diese Tunnel sind zum Teil Hunderte von Metern durch Felsen getrieben und bringen das Wasser über mehrere Kilometer in die bewohnten Gebiete an der Küste. Allerdings führt der enorme Wasserverbrauch der Landwirtschaft, vor allem der Bananenanbau, zu einer beständigen Verknappung des Wassers auf der regenreichsten Kanareninsel.
Landwirtschaft 1989:
- Nutzfläche 22 138 ha
- Agrarbetriebe 13 596
- Parzellen 69 625 (5,121 pro Betrieb)
Viehbestand: 1972 1982 1991
Geflügel 60 000 56 000 180 000
Kaninchen 0 200 52 000
Ziegen 18 656 17 130 20 730
Schweine 4 375 4 493 7 427
Rinder 5 425 2 274 1 309
Schafe 1 001 600 667
Esel und Maultiere 1 253 329 320
Pferde 223 111 100
Fischerei
Fischfang und hier speziell die Hochseefischerei, hat auf La Palma eine lange Tradition, wobei sowohl die kommerzielle als auch die Freizeitfischerei eine wichtige Rolle spielen. Die Insel gehört zu den westlichen Kanaren und ist bekannt für ihre vielfältigen Fischarten wie Thunfisch, Marlin, Schwertfisch, Wahoo, Amberjack, Großaugenbarsch, Degenfisch, Papageienfisch, Morena, Sama und viele mehr. La Palma ist ein Geheimtipp für Hochseefischen (Big Game Fishing) mit Möglichkeiten, große Fische wie Blue Marlin (bis 200 bis 300 kg), Thunfisch, Marlin, Wahoo und Rochen zu fangen. Die Fischereizonen liegen meist nahe der Küste, da der Meeresboden schnell bis zu 1.000 Meter oder mehr abfällt, was exzellente Fangmöglichkeiten bietet.
Die traditionelle Fischerei wird von zwei Hauptfischereigenossenschaften betrieben: Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de Las Nieves in Santa Cruz de La Palma und Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Carmen in Tazacorte. Diese betreiben eine Flotte von etwa 40 Schiffen und fangen unter anderem Thunfisch, Sardinen, Garnelen und Papageienfische. Der Hafen von Tazacorte ist ein zentraler Ausgangspunkt für Hochseeangeltouren. Es gibt Anbieter, die moderne Boote und Ausrüstung bereitstellen, zum Beispiel die „Gatufas“, ein 8 Meter Sportfischerboot, das für Gruppen bis 5 Personen geeignet ist. Die Preise für Hochseefischen sind vergleichsweise günstig, und man muss meist nur wenige Minuten vom Hafen fahren, um in tiefes Wasser mit großem Fischreichtum zu gelangen. Brandungsangeln vom Ufer oder Hafenmolen ist ebenfalls möglich und wird von Einheimischen und Touristen mit Genehmigung praktiziert. Gute Plätze sind jedoch oft schwer zugänglich.
Fischereidaten 1992:
- Fischer 132
- Fischereibetriebe 104
- Fischerboote 106
- Anlandungen (1990) 2 017,5 t
Industrie
Im Vergleich zur Landwirtschaft spielen Handwerk und Industrie auf La Palma nur eine untergeordnete Rolle. Die Insel besitzt lediglich einige kleine Betriebe, die Landwirtschaftsprodukte weiterverarbeiten bzw. Baustoffe oder Kunsthandwerk herstellen, sowie einige Baufirmen, die dank des Tourismus in den letzten Jahren einen Aufschwung zu verzeichnen hatten. Nur die Zigarettenfabrik in El Paso, in der etwa 300 Insulaner arbeiteten, produzierte bis Ende 2000 in größerem Umfang. Die Produktion wurde nach Deutschland verlagert.
Betriebe 1986 (mit Beschäftigtenzahl und Beschäftigten pro Firma):
Industrie und Handwerk 233 1 204 3,6
Baugewerbe 36 2 376 66,0
Energiewirtschaft
Die Energieversorgung auf La Palma basiert derzeit zu über 90 % auf Dieselgeneratoren des Kraftwerks Los Guinchos in Breña Alta, das von Endesa betrieben wird. Ergänzt wird die Stromerzeugung durch Windkraftanlagen (ca. 6,6 %) und Photovoltaikanlagen (ca. 2,3 %) sowie kleinere Eigenverbrauchsanlagen mit Solarstrom. Der jährliche Strombedarf lag 2022 bei etwa 262 GWh, wovon der Großteil durch Dieselgeneratoren gedeckt wurde, was jedoch mit hohen CO2-Emissionen verbunden ist (rund 160 Millionen kg CO2 jährlich).
Auf La Palma gibt es eine aktive Bürgerinitiative („Plataforma por un Nuevo Modelo Energético“), die sich für eine Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und den Ausbau erneuerbarer Energien einsetzt. Diese Initiative hat das „Manifiesto del Electrón“ initiiert, das von allen Gemeinden und der Inselregierung unterzeichnet wurde und eine 100 % erneuerbare Energieversorgung anstrebt. Ziel ist eine deutliche Steigerung der Leistung bis 2028 und eine Reduktion der Abhängigkeit von Diesel. Zusammenfassend ist La Palma derzeit noch stark von Dieselenergie abhängig, befindet sich aber in einem aktiven Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigeren, erneuerbaren Energieversorgung mit Wind, Solar und künftig auch Geothermie als zentralen Säulen.
Das Projekt „La Palma Renovable“ koordiniert die Umsetzung der Energiewende mit Fokus auf dezentrale, effiziente Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen und fördert lokale Akteure, Bildung und technische Unterstützung. Die kanarische Regierung plant den Ausbau der Stromversorgung und Investitionen in erneuerbare Energien, darunter auch die Erschließung geothermischer Energie auf La Palma, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen und den Anteil erneuerbarer Energien zu steigern. La Palma wurde von der EU-Kommission als Pilotprojekt für saubere Energien ausgewählt, um beispielhaft die Energiewende und Autarkie auf Inseln zu demonstrieren.
Kraftwerke 1992:
Wasserkraftwerk 1
Erdölkraftwerk 1
Transformatoren 6
installierte Leistung 44,47 mwh
Energieproduktion 131 788 mwh
Elektrische Anschlüsse:
insgesamt 1983 25 615
1992 32 334
Energieverbrauch 1992 117 271 mwh
pro Kopf 1,475 mwh
Wasserwirtschaft
Die Wasserwirtschaft auf La Palma ist geprägt durch eine einzigartige natürliche Wasserversorgung, die sich deutlich von den anderen Kanarischen Inseln unterscheidet. Die Insel profitiert von ausreichendem Wasser aus Passatwolken, das in den Bergen durch Nebelkondensation auf den Kiefern gefiltert und in das poröse Lavagestein versickert. Dieses Wasser wird über ein weit verzweigtes System von Stollen, sogenannten Galerien, sowie Brunnen und Quellen gesammelt und über ein ausgedehntes Netz von Kanälen und Rohrleitungen zu den Verbrauchern geleite.
Hauptsächlich stammen die Wassermengen aus etwa 187 Galerien, von enen 94 aktiv genutzt, und rund 84 Brunnen, von denen etwa 23 aktiv sind. Die Galerien sind gewölbte Tunnel mit leichter Gefälle, die das Wasser mittels Schwerkraft ableiten. Der Lavastrom 2021 zerstörte wichtige Wasserleitungen in den Gebieten Puerto Naos, El Remo und La Bombilla, wodurch etwa 600 Hektar Bananenplantagen ohne Bewässerung blieben. Die Versorgung wird derzeit durch mobile Entsalzungsanlagen und Wassertransporte per Tankschiff sichergestellt.
Das Wasser wird von den wasserreichen Nordregionen über mehrere große Rohrleitungsstränge (Canal General La Palma I, II, III und Conducción Aduares-Hermosilla) auch in die trockeneren Südregionen transportiert. Dabei müssen Höhenunterschiede von bis zu 635 Metern überwunden werden, was Pumpstationen erfordert. Etwa 85 % des Wassers werden für die Landwirtschaft verwendet, insbesondere für die intensive Bewässerung der Bananenplantagen, die eine zentrale Rolle in der Inselwirtschaft spielen. Die Bevölkerung verbraucht rund 11 %, der Tourismussektor etwa 3,4 %.
Das Wasser gilt als besonders rein, da es durch das Lavagestein natürlich gefiltert wird. Die Wasserversorgung ist die einzige der Kanaren, die über ausreichend eigenes Wasser aus natürlichen Quellen verfügt. Kritisiert wird mangelnde Kontrolle und Regulierung der Wassernutzung durch Wassergemeinschaften. Es gibt Probleme mit Wasserverlusten, Spekulation und fehlender Verbrauchskontrolle, was die nachhaltige . Wasserversorgung gefährdet. Forderungen nach besserer Regulierung und Sanktionen werden laut. Zur Sicherung der Versorgung werden Wasserverluste reduziert, bestehende Kanäle verbessert und neue Quellen wie das Bohrloch Los Tilos aktiviert, um die Verfügbarkeit in Trockenzeiten zu erhöhen.
Abfallwirtschaft
Die Abfallwirtschaft auf der Insel La Palma ist geprägt von einem System, bei dem der Müll nicht direkt an den Haushalten abgeholt wird, sondern die Bevölkerung ihren Abfall getrennt in zentralen Containern entsorgt. Es gibt verschiedene Container für Glas (grün), Papier und Pappe (blau), Verpackungen wie PET-Flaschen und Dosen (gelb) sowie Restmüll (schwarz). Organische Abfälle werden in einigen Gemeinden bereits separat gesammelt, und es gibt mehrere Recyclinghöfe („Punto Limpio“) für Sperrmüll, Elektrogeräte und Sonderabfälle.
Im Jahr 2022 produzierte jeder Einwohner im Durchschnitt etwa 351,75 Kilogramm Müll, wobei die Gemeinde Fuencaliente mit 514,09 kg pro Kopf den höchsten Wert aufweist. Im Vergleich zur EU (ca. 480 kg pro Kopf) liegt La Palma damit unter dem Durchschnitt. Die Insel verfügt über eine zentrale Deponie im Umweltkomplex Los Morenos, wo der Restmüll deponiert wird. Dort wird auch eine Sortierung vorgenommen. Eine Müllverbrennungsanlage gibt es nicht. Die Abfallwirtschaft wird derzeit modernisiert und ausgebaut: Das Cabildo investiert 11,42 Millionen Euro in die Infrastruktur, darunter die Wiederherstellung der durch den Vulkan zerstörten Transferstation Callejón de La Gata, die Abdichtung der Deponie und den Ausbau einer Kompostieranlage für organische Abfälle. Auch die Fahrzeugflotte für die Müllentsorgung wird erneuert
Seit April 2025 ist in sechs Gemeinden La Palmas eine verpflichtende Müllgebühr eingeführt, die nach dem Verursacherprinzip erhoben wird. Die Höhe variiert je nach Gemeinde und wird oft anhand von Wasserverbrauch, Haushaltsgröße oder Einkommen berechnet. Durchschnittlich liegt die Gebühr bei etwa 80 Euro pro Jahr. Zusätzlich gibt es auf der Insel Initiativen zur Sensibilisierung der Bevölkerung für Mülltrennung und Recycling, etwa durch öffentliche Aktionen und die Einführung von Biotonnen in einigen Gemeinden. Insgesamt ist die Abfallwirtschaft auf La Palma auf einem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und besserer Mülltrennung, wobei der Fokus auf Recycling, Kompostierung und der Reduzierung von Deponiemüll liegt.
Handel
Der Export von La Palma beschränkt sich auf Agrarprodukte. Insgesamt hat die Insel eine negative Handelsbilanz, das heißt es wird weit mehr ein- als ausgeführt. Dreiviertel der Lebensmittel müssen importiert werden, so auch Zitrusfrüchte wie Orangen und Zitronen als auch etwa 80 Prozent des Bedarfs an tierischen Produkten. Andere wichtige Importwaren, die zum größten Teil das spanische Mutterland liefert, sind Rohöl, Konsumgüter, ferner mechanische und elektrische Güter sowie Kraftfahrzeuge.
Inselintern gibt es mehrere Einkaufszentren und -gebiete, die eine Vielzahl von Produkten anbieten. Dazu gehören:
- Centro Comercial El Tablero in Santa Cruz de La Palma: zentral gelegen mit mehr als 120 Geschäften, darunter Mode, Schuhe, Elektronik und mehr.
- Centro Comercial Trocadero in Los Llanos de Aridane: modern ausgestattet inklusive einer Tiefgarage mit 140 Stellplätzen.
- Zona Comercial Abierta del Casco Histórico Santa Cruz de La Palma in Santa Cruz de La Palma: in historischer Umgebung gelegen, mit farbenfrohen Fassaden, bietet lokale Waren un Souvenirs.
- Mercadillo Municipal de Villa de Mazo und Mercadillo del Agricultor de Puntagorda in Villa de Mazo und Puntagorda: Bauernmärkte mit lokalem Kunsthandwerk und frischen Produkten, bietet authentische lokale Erlebnisse und frische Produkte.
Finanzwesen
Die Finanzwirtschaft auf La Palma ist eng eingebunden in das spanische und kanarische Wirtschaftssystem, mit einigen Besonderheiten aufgrund des Sonderstatus der Kanarischen Inseln. Die offizielle Währung auf La Palma ist der Euro, seit der Einführung 2002. Bargeld und gängige Kreditkarten (Mastercard, Visa) werden breit akzeptiert, während American Express eingeschränkt genutzt werden kann. Banken und Sparkassen sind auf der Insel flächendeckend vertreten, darunter auch Filialen großer internationaler Banken wie Deutsche Bank und Santander. Die Öffnungszeiten sind meist vormittags, samstags nur außerhalb der Sommermonate geöffnet. Geldautomaten sind weit verbreitet und akzeptieren die meisten internationalen Karten. Tageslimits beim Abheben liegen meist bei etwa 200 Euro.
La Palma gehört zur kanarischen Sonderwirtschaftszone (ZEC), die steuerliche Vergünstigungen bietet, etwa eine reduzierte Körperschaftsteuer von bis zu 4 % für Unternehmen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Kanarischen Inseln haben ein eigenes Steuerregime (Regimen Fiscal de Canarias), das sich von Festlandspanien unterscheidet. So gibt es besondere Regeln bei Einkommensteuer, Vermögensteuer und Umsatzsteuer (statt Mehrwertsteuer gilt die AIEM-Steuer). Einkommensteuer ist progressiv, aber für beschränkt Steuerpflichtige auf den Kanaren gilt ein pauschaler Satz von 24 %. Kapitalgesellschaften profitieren in den ersten zwei Gewinnjahren von einem reduzierten Körperschaftsteuersatz von 15 %. Es gibt steuerliche Anreize für Investitionen, darunter Investitionsrücklagen mit bis zu 90 % Steuerbefreiung bei Reinvestitionen auf der Insel innerhalb von drei Jahren. Immobilien unterliegen der Grundsteuer, die von den lokalen Gemeinden erhoben wird, sowie einer Vermögensteuer, die progressiv ab etwa 700.000 Euro Vermögen greift.
Nach dem Vulkanausbruch 2021 wurden umfangreiche Investitionen von über 400 Millionen Euro für den Wiederaufbau und die Wirtschaftsförderung auf La Palma bereitgestellt, darunter auch Mittel für Landwirtschaft und Infrastruktur. Die Kanarischen Inseln profitieren als EU-Randgebiet von speziellen Förderprogrammen und Finanzmitteln, die auch La Palma zugutekommen, um die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen und die Folgen von Naturkatastrophen abzufedern.
Soziales und Gesundheit
Auf La Palma gibt es ein Hauptkrankenhaus und mehrere Gesundheitszentren, die die medizinische Versorgung der Insel sicherstellen. Das Hospital General de La Palma befindete sich oberhalb von Santa Cruz.Hier finden sich verschiedene Fachabteilungen wie Kardiologie, Urologie, Traumatologie, Chirurgie und Neurologie, stationäre Abteilungen für Innere Medizin, Psychiatrie, Chirurgie und andere Fachbereiche sowie eine Notaufnahme.
Die insgesamt 16 Gesundheitszentren (Centros de Salud) verteilen sich auf die Inselgemeinden. Sie bieten Erstversorgung, Vorsorgeuntersuchungen und in einigen Fällen auch fachärztliche Behandlungen. Die größeren Zentren Los Llanos, El Paso und Santa Cruz bieten einen 24-Stunden-Service an sieben Tagen in der Woche. Für Notfälle steht die Notrufnummer 112 zur Verfügung, bei der auch deutsch- und englischsprachige Mitarbeiter erreichbar sind.
Krankheiten
Es gibt keine auffälligen Krankheitshäufungen auf La Palma. Allzu rasante Höhenwechsel und Windausgesetztheit, kombiniert mit hohen Temperaturen können bei diesbezüglich empfindlichen Besuchern Beschwerden auslösen, ebenso die kurvigen Straßen oder Bootsausflüge bei hohem Seegang.
Bildung
Die Schulen auf La Palma folgen dem spanischen Bildungssystem und bieten die üblichen Stufen der spanischen Bildung an, wie die Educación Secundaria Obligatoria (ESO), die der Sekundarstufe I entspricht, und die Bachillerato, die der Sekundarstufe II entspricht,
Schulen, Lehrer und Schüler 1992:
Vorschulen 3 64 1 695
Grundschulen 78 487 8 950
Höhere Schulen 5 182 2 574
Hochschulen 5 179 2 206
insgesamt 91 912 15 425
Höhere Bildung und Wissenschaft
Hochschulen im eigentlichen Sinn gibt es auf La Palma nicht. Eine bemerkenswerte Einrichtung ist die Escuela de Arte Manolo Blahnik, die sich auf Kunsthandwerk und Design spezialisiert hat. Diese Schule bietet Ausbildungen in Bereichen wie Grafikdesign, Produktdesign und Fotografie an.
Auf La Palma befindet sich eins der eindrucksvollsten Observatorien weltweit. Das Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM) besteht aus mehreren Sternwarten in einer Seehöhe von 2350 bis 2400 m. Für die Standortwahl im Jahr 1972 entscheidend waren die Höhenlage auf dem Roque de los Muchachos mit 2400 Metern über den Wolken und eine geringe Lichtverschmutzung des Nachthimmels auf La Palma sowie eine verhältnismäßig geringe Entfernung zu Europa gegenüber anderen Standorten wie Südamerika oder Hawaii (mit 4200 Meter Höhe und 50 Prozent Sauerstoffgehalt).
Die Gründungsmitglieder Spanien, England, Dänemark, Deutschland und Schweden beschlossen 1974 als ersten Schritt für die Errichtung des Observatoriums den Ausbau einer Zufahrtsstraße sowie die Wasser- und Stromversorgung auf den Roque de los Muchachos und ein Trainingsprogramm für die spanischen Wissenschaftler. 2979 erfolgte die Unterzeichnung des Abkommens zur Errichtung der Anlage.
1984 nahm das Roque-de-los-Muchachos-Observatorium seinen Betrieb auf. Am 29. Juni 1985 wurde es vom spanischen König und den königlichen Oberhäuptern und Regierungschefs der Mitgliedsländer offiziell eingeweiht . Um die Sichtverhältnisse der Astronomen in der Nacht zu verbessern, wurde 1988 für La Palma und Teneriffa das Gesetz Ley de Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC („Gesetz zum Schutze des Himmels“) beschlossen, das Leuchtreklame verbietet und festlegt, dass Lampen im Freien nur bestimmtes Licht nur nach unten abstrahlen dürfen. Am 24. Juli 2009 wurde das Gran Telescopio Canarias (GTC oder auch GRANTECAN) durch den spanischen König Juan Carlos und Königin Sophia eingeweiht. Es gilt als größtes Spiegelteleskop weltweit.
Nch der Installierung eines Glasfasernetzes wuchs ab 2012 die internationale Beteiligung stark an. Mit Stand 2025 sind etwa 170 Forschungsinstitute und 31 Staaten an den unter der Aufsicht der auf La Palma und Tenerife tätigen Organisation European Northern Observatory (ENO) stehenden Instrumenten beteiligt.
Kultur
Zum kulturellen Angebot auf La Palma gehören die archäol ogischen Zentren, Parque Arqueologico in La Zarza, Gemeinde Garafia und Cueva Belmaco in Mazo, mehrere Bibliotheken (jeweils in den größeren Orten der Insel), ein Kino und das Teatro Chico in Santa Cruz und ein Kino Los Llanos sowie diverse Musik- und Kunstveranstaltungen, welche überwiegend in den Casas de Cultura der Orte stattfinden.
Luis Morera ist einer der bekanntesten auf La Palma lebenden und schaffenden Künstler. Seine Werke auf der Insel sind unter anderem der Plaza de La Glorieta, der Park El Jardín de las Delicias in Los LLanos, der Brunnen mit der Bronzefigur San Miguel de La Palma vor dem Rathaus von Tazacorte, die Bronzefigur der Zwerg (Enana) in Santa Cruz sowie eine Vielzahl von Bildern von der Natur und Bevölkerung der Insel.
Museen
Auf der Insel La Palma befinden sich folgende Museen:
- Museo Insular de La Palma (Inselmuseum) in Santa Cruz de La Palma: Das Inselmuseum in Santa Cruz de La Palma befindet sich in einem historischen Franziskanerkloster und bietet eine vielfältige Sammlung von Kunstwerken, Naturgeschichte und ethnografischen Exponaten. Es ist perfekt für Kunst- und Geschichtsliebhaber sowie Besucher, die eine kulturelle Vielfalt schätzen.
- Museo Naval (Schifffahrtsmuseum) in Santa Cruz: Es befindet sich in einem Nachbau der Karavelle Santa Maria und zeigt historische Karten und nautische Instrumente. Es bietet umfassende Einblick in die maritime Geschichte der Insel.
- Museo Arqueologico (Archäologisches Museum)in Los Llanos de Aridane: Dieses Museum in Los Llanos de Aridane bietet einen umfassenden Einblick in das Leben der Ureinwohner La Palmas, den Benahoaritas. Mit multimedialen Ausstellungen, Originalfunden und Nachbildungen ist es besonders geeignet für Geschichtsinteressierte und Familien. Es kombiniert moderne Architektur mit historischen Artefakten und ist barrierefrei zugänglich.
- Museo de la Seda Las Hilaneras (Seidenmuseum) in El Paso: Es zeigt die traditionelle Seidenherstellung auf La Palma und bietet Workshops sowie einen Museumsshop mit handgefertigten Produkten. Es ist ideal für Besucher, die sich für Handwerkskunst und Textilien interessieren, und bietet eine familienfreundliche Atmosphäre.
- Museo del Puro Palmero (Palmerisches Zigarrenmuseum) in Breña Alta: Es widmet sich der palmerischen Zigarrenherstellung mit Demonstrationen und Ausstellungen zur lokalen Geschichte. Es ist besonders interessant für Liebhaber von Handwerkskunst und regionaler Kultur.
- Museo del Platano (Bananenmuseum) in Tazacorte: Es ist mit einer kleinen Bananenplantage verbunden.
- Museo del Vino (Weinmuseum) an der Plaza de La Glorieta in Las Manchas: Es bietet einen Überblick über den Weinbau auf La Palma inklsuive kleiner Kostproben.
Architektur
Die traditionelle Architektur von La Palma ist geprägt von einer Mischung aus europäischen und lokalen Einflüssen, die sich über Jahrhunderte entwickelt haben. Sie zeichnet sich durch ihre Anpassung an das Klima und die geografischen Gegebenheiten der Insel aus. Kunstvoll verzierte Holzbalkone sind ein typisches Element der Architektur in Santa Cruz de La Palma. Sie erinnern an maurische Baukunst und wurden ursprünglich als Vorratsräume genutzt, da sie durch filigranes Holzwerk luftige Lagerbedingungen ermöglichten. Die traditionellen kanarischen Fenster bestehen aus kunstvoll gearbeiteten Fensterläden, die frische Luft zulassen, aber neugierige Blicke fernhalten. Die Gebäude wurden aus lokal verfügbaren Materialien wie Basaltstein, Lehm, Tuffstein, Kalk und besonders Tea-Holz gebaut. Die Dächer sind oft Zwei- oder Vierwasserdächer, gedeckt mit Mönch-und-Nonne-Ziegeln. Innenhöfe mit Blumen und Sitzbänken sind ebenfalls typisch.
Die Architektur von La Palma spiegelt die kulturelle Vielfalt der Insel wider, beeinflusst durch galicische, kastilische, andalusische und portugiesische Kolonisatoren seit dem 16. Jahrhundert. Durch die geografische Isolation blieben viele traditionelle Stile erhalten:
- Balcones tipicos in Santa Cruz de la Palma: Besonders entlang der Avenida Marítima sind diese Balkone ein Wahrzeichen der Insel.
- Casa Luján in Puntallana aus dem 17. Jahrhundert: Ein Museum, das die häuslichen Bräuche des traditionellen kanarischen Lebens zeigt.
- Kopfsteinpflasterstraßen und gut erhaltene Gebäude in Städten wie Santa Cruz de La Palma.
Die Architektur von La Palma ist nicht nur funktional, sondern gilt auch ein Ausdruck der kulturellen Identität der Insel. Letztere wird auch durch eine Vielzahl an Kirchen zum Ausdruck gebracht, die verschiedene Baustile wie Gotik, Renaissance und Mudéjar sowie flämische Kunstwerke repräsentieren. Viele dieser Kirchen sind auch kulturelle Zentren und Schauplätze für lokale Feste und Prozessionen.
Literatur
Eine eigenständige palmerische Literatur hat sich nicht entwickelt. Es gibt aber zahlreiche Werke von Besuchern, die sich mit dem Inselleben auseinandersetzten. So waren es speziell deutschsprachige Reisende des 19. und 20. Jahrhunderts, darunter auch Frauen, die ihre Erfahrungen auf La Palma dokumentierten. Ihre Werke entstanden im Rahmen von „touristischen Reisen“ und unterscheiden sich von wissenschaftlichen Abhandlungen der Zeit. Sie beleuchten Alltag, Kultur und Landschaften, wobei die Texte oft persönliche Eindrücke mit gesellschaftlichen Beobachtungen verbinden.
La Palmas literarische Landschaft umfasst Werke von Inselautoren und Besuchern, die sich mit Geschichte, Natur und Kultur auseinandersetzen. Hierzu sind letzter Zeit mehrere Sammelbände erschienen. Das Literarische La-Palma-Lesebuch (2022) vereint Texte und Gedichte von Palmeros und Zugewanderten. Es thematisiert Emigration, Naturerlebnisse und die Identität der Insel, ergänzt durch historische Fotos und Gemälde aktueller Künstler. Canarias ist ein zweisprachiges Werk mit Essays, Lyrik und Kunst, das verborgene Aspekte der Kanaren beleuchtet.
Gorka Garmendia Pérez verarbeitet in Benahoare oder Idairas Lächeln (2021) die Eroberung La Palmas durch die Kastilier (1492–1493) und den Widerstand der Ureinwohner (Awaras). Das Buch basiert auf dreijähriger Archivrecherche. Lavasteinzeit von Gudrun Bleyhl bietet persönliche Berichte von der Evakuierungsgrenze zur Zeit des Cumbre Vieja-Ausbruchs 2021. Diario de un volcán von Lucía Rosa González IST EINE Poetische Verdichtung der Vulkanereignisse aus Sicht einer Bewohnerin des verschütteten Dorfes Todoque:
Theater
Die Inselhauptstadt Santa Cruz de La Palma ist Heimat zweier bemerkenswerter Theater:
- Teatro Chico: Dieses Theater bietet ein festes Programm, das auch Kinovorführungen umfasst. Es ist bekannt für seine kulturellen Veranstaltungen und das charmante Ambiente
- Teatro Circo de Marte: Dieses Theater ist ein emblematisches Gebäude und seit 1997 als Kulturgut der Kanarischen Inseln anerkannt. Es bietet eine Vielzahl von Veranstaltungen wie Operetten, Komödien, Theaterstücke, Zirkusvorführungen und Konzerte.
Dazu kommen Aufführungen bei diversen Festivitäten.
Musik
La Palmas Musikszene verbindet traditionelle kanarische Folklore mit modernen Einflüssen aus Europa und Lateinamerika. Traditionelle Vokalmusik wird durch Instrumente wie die viersaitige Timple, Gitarren, Flöten und Kastagnetten geprägt. Stile wie der rhythmische Sirinoque-Tanz, der Weizentanz (Danza del Trigo) und improvisierte Zehnzeilen-Gesänge (Punte Cubano) spiegeln lokale Bräuche wider. Bekannte Folkloregruppen wie Los Arrieros oder Echentive präsentieren diese Traditionen bei Festen und in Kulturzentren. Moderne Musikrichtungen reichen von Folkrock bis Latino-Rhythmen. Die 1974 gegründete Band Taburiente gilt als Pionier des kanarischen Folkrocks und kombiniert regionale Themen mit rockigen Klängen. Künstler wie die Sängerin Ima Galguén integrieren keltische Elemente, während jüngere Acts wie Paraíso Animal oder Vrandan lateinamerikanische Stile aufgreifen. Jazzkonzerte in Los Llanos und Auftritte von Bands wie Guitar Juice zeigen die stilistische Vielfalt.
Im Jahr 2011 fand auf La Palma und Tenerife das erste Starmus-Festivals statt, das Wissenschaft und Musik verbindet. Vom 25. bis 29. April 2025 wurde das Festival erneut auf La Palma ausgerichtet. Highlights waren:
- (26. April, Tazacorte): Rocklegenden wie Glenn Hughes und Bands wie Efecto Pasillo
- (25./27. April, Santa Cruz): Opernstars wie Montserrat Martí Caballé und Simona Todaro Pavarotti
- in Los Llanos und Santa Cruz mit Live-Musik von Bands wie Shidow oder Terco
Kleidung
Die Kleidung der Benahoaritas bestand hauptsächlich aus Tierfellen, insbesondere von Ziegen und Schafen. Diese Felle wurden bearbeitet, teilweise gefärbt, und zu Kleidungsstücken zusammengenäht. Schuhe wurden aus Schweinsleder gefertigt, da dieses Material besonders haltbar war. Die Verarbeitung der Felle erfolgte mit Steinwerkzeugen, und die Kleidungsstücke wurden mit Lederstreifen oder Sehnen zusammengenäht. Um die Nähmaterialien durch das Leder zu ziehen, verwendeten sie Knochenahlen. Die Felle wurden oft zugeschnitten und präzise genäht, auch für die Einwicklung von Toten bei Begräbnissen. Neben der Kleidung trugen die Benahoaritas Schmuck aus Muscheln, Steinen und Knochen.
Die traditionelle Tracht der heutigen Einwohner von La Palma besteht aus drei Varianten, der Arbeitskleidung (faena), der Festkleidung (gala) sowie Manto y Saya. Erstere wird traditionellerweise aus lokal hergestellten Stoffen wie Wolle und Leinen gefertigt. Sie ist funktional und für den Alltag geeignet. Charakteristisch sind seitliche Raffungen des Rocks, grobe Wollstoffe für das Leibchen und eine robuste Barredera am unteren Saum des Rocks, um ihn vor Verschleiß zu schützen.
Die Festkleidung ist aufwendiger gestaltet, mit reich bestickten Blusen, Westen und edlen Stoffen. Frauen tragen zwei Röcke übereinander, wobei der obere Rock über den Kopf geschlagen wird und vom Hut gehalten wird. Männer tragen eine rote Schärpe, lange Westen und Gamaschen aus Wollgarn bekleidet.
Manto y Saya war ein auf der ganzen Insel verbreitetes Kleidungsstück, ist besonders fein gearbeitet und besteht aus mehreren Umhängen und Röcken, oft mit seidenen oder leinenen Stoffen. Eine Falde reichte bis zu den Füßen, die andere wurde über den Rücken gezogen, um den Kopf zu bedecken. Manto y Saya wurde von den Palmeros als alltägliches Kleidungsstück getragen, aber auch für den Kirchgang und bei Trauerfeiern. Die Verwendung dieses Kleidungsstücks reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück und endete im 19. Jahrhundert. Der Stil ist einzigartig auf den Kanarischen Inseln und beinhaltet kunstvolle Accessoires wie Hüte im Mudejar-Stil. Die Trachten werden aus natürlichen Materialien wie Seide, Wolle, Leinen und Leder hergestellt. Kunsthandwerker verwenden traditionelle Techniken wie Webstühle und natürliche Farbstoffe.
Kulinarik und Gastronomie
Die Palmerische Küche unterscheidet sich nicht sehr von denen der anderen Kanarischen Inseln. Bis in die 1960er Jahre bestand für die meisten palmerischen Familien – insbesondere in den ländlichen Gebieten – das Essen aus den von ihnen gewonnenen Produkten, wie Kartoffeln, Gofio (geröstetes Mais- oder Weizenmehl), Schweine- und Ziegenfleisch, Ziegenkäse, Mojo (pikante Sauce), Milch, Fisch, einige Gemüse- und Obstsorten. Zu festlichen Gelegenheiten wie Karneval und Weihnachten wurden spezielle Gerichte zubereitet, Süßspeisen aus Brot, Honig und Milchreis, geröstete Kastanien, Biskuit. Ziegenkäse mit Mojo zählen heute – auch im touristischem Bereich – zu den besonderen palmerischen Gerichten
Festkultur
Über das Jahr verteilt gibt es mehrere, teils regional begrenzte Feste. Mit dem Mandelblütenfest im Februar oder März in Puntagorda, wo die meisten Mandelbäume der Insel anzutreffen sind, beginnt der Reigen der Feste auf der Insel. Am 5. Mai wird in der „Fiesta de la Cruz“ die Eroberung der Insel und Gründung der Hauptstadt Santa Cruz gefeiert. Hierzu werden auf der ganzen Insel Kreuze in wertvolle Stofftücher und Papier verhüllt und mit Blumen und Kerzen geschmückt werden.
Die Bajada de la Virgen de las Nieves („Niederkunft der Jungfrau vom Schnee“) ist eines der herausragenden kanarischen Feste. Es geht auf das Jahr 1676 zurück, in dem auf der Insel große Dürre herrschte. Um eine drohende Missernte abzuwenden, ordnete der kanarische Bischof Jimenz an, die auf der ganzen Insel verehrte Statue der Jungfrau vom Schnee in Las Nieves in einer Prozession in die Hauptstadt zu tragen. Der langersehnte Regen stellt sich danach ein. Die Prozession wird daraufhin alle fünf Jahre wiederholt, das nächste Mal im Jahr 2015. Die Feierlichkeiten ziehen sich jeweils im Sommer über mehr als einen Monat hin. Ein Höhepunkt der Fiesta ist der Maskentanz der Zwerge (enanas) in Santa Cruz.
Ein weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten auf La Palma ist der Karneval, dessen Umzüge in den Karneval-Hochburgen von Santa Cruz und Los Llanos den Vergleich mit dem in Rio nicht scheuen brauchen.
Fest- und Feeiertage:
- 1. Januar - Año Nuevo (Neujahr)
- 6. Januar - Los Reyes (Heilige Drei Könige): größtes Geschenkfest der Kanarischen Inseln
- 17. Janaur - San Antonio Abad (Antoniustag): Patronatsfest in Fuencaliente
- um 30. Januar - Fiesta del Flor del Almandro (Mandelblütenfest) in Puntagorda
- 2. Februar - La Candelaria (Lichtmess)
- 3. Februar - Fiesta de San Blas (Blasiusfest) in Mazo
- Februar bis 24. März - Carnaval (Karneval) in Santa Cruz
- 5. März - San Vicente (Vinzenztag): Patronatsfest von Garafía
- 19. März - Fiesta del Patriarca San José (Josefstag): Vatertagsfest
- April - Semana Santa (Karwoche) und Pascua (Ostern)
- 24./27. April - Nuestra Señora de Mont Serrat (Heilige Jungfrau von Montserrat): Fest in San Andrès y Sauces
- 1. Mai - Día del Trabajo (Tag der Arbeit)
- 3./4. Mai - Día de la Cruz (Tag des Kreuzes): Fest anlässlich des Endes der Conquista in Santa Cruz, Breña Baja und Mazo
- 15. Mai - San Isidro (Isidorstag): Ackerbaufest in Breña Alta
- 1. Maisonntag - Día de la Madre (Muttertag)
- Ende Mai - Corpus Christi (Fronleichnam)
- 30. Mai - Día del Canarios (Tag der Kanaren): Regionalfeiertag
- Anfang Juni - Pentecostés (Pfingsten)
- 12./13. Juni - Vacas Palmeras (Palmerische Rinder): Viehmarkt in San Antonio del Monte, Gemeinde Garafía
- 24. Juni - Fiesta San Juan Bautista (Johannistag): Sonnwendfeiern
- 26. Juni bis 2. Juli - Fiesta de la Nuestra Señora de los Remedios (Fest unserer lieben Frau des Heils) in Los Llanos de Aridane, findet alle „ungeraden“ Jahre statt
- 28. Juni - Ende Juli Bajada de la Virgen de las Nieves (Herabkunft der Heiligen Jungfrau): in Santa Cruz ungefähr alle zwei Jahre stattfindendes Fest
- 29. Juni - Pedro y Paulo (Peter und Paul)
- Ende Juni - Fiesta del Sagrada Corazón Jesú (Fest des Heiligen Herzens Jesu): geschmückter Umzug durch Breña Alta
- 16. Juli - Nuestra Señora del Carmen (Carmenstag): Fischerfest in Tazacorte
- 25. Juli - Santiago (Jakobstag): Fest des Schutzpatrons Spaniens
- 25./26. Juli - Fiesta Santa Ana (Fest der heiligen Anna): Kunstfest in Breña Baja
- 2. Augustsonntag - Nuestra Virgen del Pino (Unsere Jungfrau der Pinien): Festauftakt in El Paso, findet alle drei Jahre statt
- 15. August - Asunción (Mariae Himmelfahrt)
- August - Encarnación (Fleischwerdung Christi): Fest in Breña Alta Piedad (Gnadenfest) in Los Sauces Nuestra Señora de las Angustias (Unsere gequälte liebe Frau): Fest in Los Llanos
- 14. - 30. August - La Vendimia (Weinlesefest) in Fuencaliente
- 3. Augustsonntag - Fiesta San Mauro (Mauro-Fest) in Puntagorda
- 25. August - Nuestra Señora de la Luz (Unsere liebe Frau des Lichts): Fest in Garafía
- 4. Augustsonntag - Fiesta de El Cubo de la Galga (Fest am Galga-Bergkamm) in Puntallana
- 1. Septembersonntag - Nuestra Virgen del Pino (Unsere Jungfrau der Pinien): Fest der Schutzheiligen von El Paso
- 7./8. September - Fiesta de la Virgen de Candelaria (Mariae Reinigungsfest) in Tijarafe
- 13. bis 15. September - Fiesta de la Luz (Lichtfest) in Garafía
- 29. September - Fiesta del San Miguel (Michaelsfest) zur Erinnerung an den des Conquistadors de Lugo in Tazacorte und Santa Cruz
- 7. Oktober - Fiesta de Santa Rosario (Rosariofest) in Barlovento zur Erinnerung an die Schlacht von Lepanto
- 12. Oktober - Día de la Hispanidad (Spanischer Nationalfeiertag) zur Erinnerung an die „Entdeckung Amerikas“ durch Kolumbus
- 1. November - Todos los Santos (Allerheiligen)
- 11. November - Día de San Martín (Martinstag): Weinfest
- 22. November - Fiesta de la Santa Cecilia (Cäcilienfest) in Del Charco, Gemeinde Fuencaliente
- 30. November - Día de San Andrés (Andreastag) in San Andrès
- 6. Dezember - Día de la Constitución (Tag der spanischen Verfassung)
- 8. Dezember - Inmaculada Concepción (Unbefleckte Empfängnis Marias)
- 11. Dezember - Día de San Martín (Sankt Martinstag): Fest mit Umtrunk in Mazo und Fuencaliente
- 13. Dezember - Fiesta Santa Lucia (Luzienfest) in Puntallana
- 25. Dezember - Navidad (Weihnachten): ein simpler Feiertag
- 31. Dezember - Noche del Año Viejo (Altjahrstag)
Medien und Kommunikation
Es gibt keine spezifische Liste von Zeitungen, die ausschließlich auf La Palma erscheinen. Allerdings gibt es mehrere Online-Magazine und Blogs, die Nachrichten und Informationen über die Insel bereitstellen:
- La Palma Journal - bietet täglich aktuelle Nachrichten und Informationen über La Palma
- La Palma Aktuell - enthält frische Nachrichten und Tipps für den Urlaub auf La Palma
- Lavastein-Blog - bietet aktuelle Nachrichten und Infos aus La Palma, von den Kanarischen Inseln und darüber hinaus
- Idafe Blog - behandelt Themen wie Gleitschirmfliegen und Wettervorhersagen auf La Palma
La Palma gilt die Telefonvorwahl 0(034)44. Die Postleitzahl von Santa Cruz de la Palma lautet 38700, für Tazacorte 38110.
Sport
Hauptsportarten der Insel sind Fußball und Lucha Canaria. Für Gäste der Insel bestehen im sportlichen Bereich folgende Gegebenheiten:
- Baden: 35 Badestrände in 6 Gemeinden - Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, Mazo, San Andrés y Sauces, Santa Cruz und Tazacorte
- Fußball: rund 15 Clubs, Wettkämpfe vor allem April bis August
- Gleitschirm- und Drachenfliegen: organisiert vom Verein „Pegasus“ in Puerto Naos
- Juego de Palos: Fechten mit biegsamen Ruten - bei Fiestas üblich
- Lucha Canaria: (Kanarischer Ringkampf, palmerischer Nationalsport - wird wettkampfmäßig in mehreren Vereinen und eigenen „Stadien“ praktiziert
- Radfahren: 2 Fahrradverleiher - in Los Llanos de Asridane und Santa Cruz
- Segeln: Bunker in Santa Cruz
- Surfen: Zentrum in Playa Nueva bei Puerto Naos
- Tauchen: 2 Zentren - DIWA-Basis El Paso und Diving Centro Cancajos in Fuencaliente
- Tennis: 7 öffentliche bzw. hoteleigene Anlagen - in Barlovento, Breña Alta, Los Llanos de Aridane, nahe Los Llanos, in Puerto Naos, Santa Cruz und Todoque; wichtigster Verein: Club de Tennis Valle de Aridane in Los Llanos de Aridane
Fußball
Fußball ist auf der Insel zwar populär, wird aber als Vereinssport nur unterklassig betrieben ... oder wurde, bis der österereichische Brausehersteller Red Bull die Insel als Investitionsobjekt entdeckte. "Zum 1. Januar 2021 wurde "Red Bull La Palma C.F." gegründet, eine Fußballmannschaft mit großen Ambitionen. Man trat "in Verhandlungen mit dem Cabildo Insular, um eine sportliche Heimstätte zu erlangen" und bemühte sich, bei den Inselbewohnern mit den hochtrabenden Plänen nicht zu sehr in Misskredit zu geraten. "Die Reaktionen der Fußballanhänger hier auf der Insel fallen recht unterschiedlich aus. Gerade die Fans von Tenisca und Mensajero, unseren beiden Traditionsclubs in La Palma zeigen sich wenig begeistert. Auf der anderen Seite hat sich aber auch schon ein Fanclub gebildet. Die Leute nennen sich „Peña Toro Rojo“ und sind schon mit eigenem Logo und Internetauftritt am Start. Böse Zungen behaupten allerdings, dass es sich bei diesem Fanclub auch nur um ein Marketinginstrument des Brauseherstellers handeln würde." (https://news.la-palma-aktuell.de/2020/12/28/red-bull-la-palma/).
Lucha Canaria
Lucha Canaria ist ein kanarischer Ringkampf, der bereits vonden Ureinwohnern ausgetragen wurde. 1420 berichtete der Chronist Alvar Garcia de Santa Maria über diese Sportart der Kanaren. Es wird vermutet, dass durch diese Kämpfe Streitigkeiten unter der Urbevölkerung unblutig entschieden wurden. Lucha Canaria ist ein Mannschaftssport, der von zwölf Kämpfern ausgetragen wird. Es ringen immer zwei miteinander. Verloren hat derjenige, dessen Oberkörper zuerst den Boden berührt. Ein Kampf geht über 3 Runden von maximal 2 Minuten Dauer. Hirtensprung (Salto del pastor) ist ein auf den Kanarischen Inseln verbreiteter Volkssport, der seine Wurzeln im regionalen Brauchtum hat und wahrscheinlich auf die Ureinwohner zurückgeht. Um in möglichst kurzer Zeit im gebirgigen Gelände Höhenunterschiede schnell und sicher zu überwinden, benutzten die Viehhirten einen mehrere Meter langen Holzstab, den „Regatón“, um auf ein tiefer gelegenes Gelände zu gelangen.
Aufgrund des begrenzten Kontakts zwischen den verschiedenen Inseln entwickelte jede von ihnen unterschiedliche Regeln für die Ausübung des Ringens. Es wird vermutet, dass das Ringen bei wichtigen Anlässen praktiziert wurde, um Konflikte zu lösen. Es wird auch angenommen, dass das Ringen bei wichtigen Anlässen praktiziert wurde, um Konflikte zu lösen. Bis zum Ende des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts entsprach die Organisation von Ringkämpfen einem natürlichen evolutionären Muster, das darin bestand, dass Völker oder Seiten (Nord-Süd) gegeneinander antraten. Oder zwischen Ringern von verschiedenen Inseln. Kurioserweise wurde das erste Reglement für den Ringkampf 1872 in Matanzas (Kuba) erlassen, und erst 1960 wurde mit dem Allgemeinen Organischen Reglement ein gemeinsames Reglement für alle Inseln vereinbart.
Auf La Palma existieren folgende Mannschaften:
Primera Categoría
- CL Aurita Tedote
- CL Balta
- CL Candelaría
- CL Aridane
- CL Tazacorte
- CL Tamanca
- CL Tijarafe
- CL Tedote
- CL Candelaria de Mirca
- CL Tamanca Las Manchas
Tercera Categoría
- CL Bediesta
- CL San Antonio de Abad
Persönlichkeiten
Die wichtigsten mit La Palma verbundenen Persönlichkeiten sind:
- Tanausú: Der letzte Inselhäuptling, der sich gegen die spanischen Eroberer wehrte. Er verteidigte seine Stellung im Barranco de las Angustias bis zu seiner Gefangennahme und wird von den Einheimischen al,s eine Art Nationalheld verehrt.
- Alonso Fernández de Lugo: Er war der spanische Eroberer, der La Palma im Jahr 1493 für die Krone von Kastilien einnahm. Obwohl er nicht von der Insel stammte, spielte er eine entscheidende Rolle in ihrer Geschichte.
- Luis Morera: Geboren 1946, ist er ein vielseitiges künstlerisches Talent. Morera ist Musiker, Maler, Architekt und Dichter. Er ist bekannt für seine Neuinterpretationen kanarischer Volksmusik und seine Kunstwerke, die auf der ganzen Insel zu finden sind
- Maria Montez: Obwohl sie in der Dominikanischen Republik geboren wurde, betrachten die Palmeros sie als Tochter ihrer Insel. Sie war ein Hollywood-Star der 1940er Jahre und spielte in Filmen wie "1001 Nacht" und "Ali Baba und die 40 Räuber"
- Manolo Blahnik: Geboren 1940 in Santa Cruz de La Palma, ist er ein weltberühmter Schuhdesigner. Blahnik wurde als "Gott der Stilettos" bezeichnet und hat zahlreiche Preise für seine Arbeit erhalten5.
- Dionisio O'Daly: Dieser irische Kaufmann spielte eine wichtige Rolle in der politischen Geschichte La Palmas. Dank seiner Bemühungen fanden 1773 die ersten demokratischen Wahlen Spaniens durch Zensuswahlrecht auf der Insel statt
- Carmen Ramos Rodríguez: Geboren 1950 in Tijarafe, hat sie eine bedeutende Karriere in den Medien der Insel gemacht.
Fremdenverkehr
1890 gab es auf La Palma erste kleine Hotels. Vor allem die Erholung suchenden Engländer frequentierten Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts gern die westlichste Kanareninsel. Einige Jahrzehnte später ging es mit dem Tourismus auf La Palma bergab, in den 1960er Jahren kam er fast ganz zum Erliegen. In den 1970er Jahren und Anfang der 1980er Jahre profitierte La Palma ein wenig vom Massen- und Chartertourismus auf den beiden Kanarenhauptinseln Teneriffa und Gran Canaria. Das damals einzige große Hotel entstand (Sol La Palma, Puerto Naos, 200 Betten). In dieser Zeit gab es unter der einheimischen Bevölkerung noch Vorbehalte gegen den Zustrom von Fremden, die sich in Graffitis an Hauswänden (Alemanes fuera, Deutsche raus) äußerten. Dass auf La Palma der Tourismus auch für die Bevölkerung eine wichtige Einnahmequelle ist, hat derartige Anfeindungen verstummen lassen. La Palma ist mittlerweile ein Aussteigerparadies für Mittelstandsaussteiger geworden, wobei der Anteil der Deutschen am größten ist, gefolgt von Niederländern, Schweizern und Briten.
Erst Ende der 1980er Jahre waren nach der Erweiterung des palmerischen Flughafens für den internationalen Charterverkehr im Tourismusbereich kräftige Zuwachsraten zu verzeichnen. In den 2000er Jahren entstand die Hotelanlage La Palma Princess/Teneguia Princess mit 400 Betten, abgeschieden an der Südspitze La Palmas, unterhalb von Fuencaliente. Trotz stetig sinkender Fluggastzahlen auf La Palma von einer maximalen Anzahl von 1.207.572 im Jahr 2007 auf 965.779 in 2012 (ein Rückgang von 20 %) wurde 2011 ein neues Flughafengebäude eingeweiht.
Bei einem Angebot von etwa 7500 Betten kann man auf La Palma noch nicht von Massentourismus sprechen. Neben den wenigen größeren Hotels sind die Touristen vorwiegend in Ferienwohnungen und kleineren Häusern (Fincas) untergebracht. Die Ferienzentren mit den meisten Touristen befinden sich auf der Westseite der Insel in der Gegend von Puerto Naos und auf der Ostseite von Los Cancajos. Die Strände von Puerto Naos und Los Cancajos tragen die blaue Flagge der EU und erfüllen somit einen gehobenen Qualitätsstandard.
La Palma ist traditionell eine Wanderinsel, entsprechend groß ist die Anzahl der Anbieter von Wanderausflügen in die verschiedensten Regionen der Insel.
Seit Ende der 1990er Jahre haben sich auch verschiedene Anbieter sportlicher Aktivitäten etabliert. So werden beispielsweise geführte Mountainbiketouren oder Reitexkursionen angeboten, verschiedene Tauchbasen auf der Ost- und Westseite der Insel haben sich etabliert.
Seit 1992 hat sich die Asociación insular de Turismo Rural Isla Bonita die Förderung des ländlichen Tourismus auf der Insel La Palma zur Aufgabe gemacht. Hierzu zählen insbesondere die Förderung der ländlichen Unterkünfte und anderer touristischer Ressourcen, wie Management-Training, Verwaltung der Museen und Sehenswürdigkeiten. Der Verein ist ein Zusammenschluss von etwa hundert Häuservermietern, kleinen Unternehmen und Berufsverbänden.
Zur Förderung der ländlichen Unterkünfte (mit EU-Geldern) wurden etwa 65 alte Häuser (Fincas) in der typischen Landschaftsarchitektur restauriert (bis zum Jahr 2000). Zu dieser Bauweise gehören beispielsweise Decken in Tea-Holz, Holzbalkone, meterdicke Steinwände und die typisch gemauerten Sitzbänke unter den Fenstern. Die Restaurationsarbeiten fördern gleichzeitig die einheimische Handwerkschaft. Mit dem Erhalt und der Vermietung der Häuser wird der Landflucht entgegengewirkt mit dem Effekt, dass auch die traditionelle Agrarstruktur erhalten bleibt. (Tea-Holz wird aus dem harten Kern der kanarischen Kiefer gewonnen und ist äußerst resistent gegen Feuchtigkeit und lässt sich gut mit dem Stechbeitel bearbeiten.)
Zur Untersuchung der Vorstellungen der Touristen über den Urlaubsort La Palma wurde im Auftrag der Asociación de Turismo Rural Isla Bonita im Jahr 2007 eine Befragung von 316 Touristen in 181 Unterkünften auf La Palma durchgeführt. Der Altersanteil der Befragten unter 45 Jahre lag bei 68 Prozent. Die Vorstellungen über den Urlaubsort La Palma gaben sie wie folgt an: Bevorzugt wird ein Urlaubsort, der eher abgeschiedenen und nicht überfüllt ist, Erholung und sportliche Aktivitäten in einer natürlichen Umwelt (Wandern und zu einem geringeren Maße Schwimmen) bietet und die Urlaubsausgaben auch der Bevölkerung des Ortes zugutekommen. Besondere Wertschätzungen des Urlaubsortes finden die Landschaft, die Ruhe, die öffentliche Sicherheit wie die einheimische Küche. Ein am wenigstens geschätzter Aspekte ist das Nachtleben.
Literatur
- wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:La_Palma
- wikitravel: https://wikitravel.org/de/La_Palma
- wikivoyage: https://de.wikivoyage.org/wiki/La_Palma
- Fray Juan de Abreu Galindo: Historia de la Conquista de las siete islas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife 1977
- L. Afonso Peréz (ed.): Geografía de Canarias, 6 vol., Santa Cruz de Tenerife 1984/85
- ders. et al. (ed.): Atlas Básico de Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1980
- Leoncio Alfonso: Esquema de Geografía física de las Islas Canarias, La Laguna de Tenerife 1953
- E. Alonso: Tierra Canaria, Madrid 1981
- ders.: Floklore Canario, Las Palmas de Gran Canaria 1985
- Diego Álvarez de Silva: Historia de Canarias, Santa Cruz de Tenerife (1705)
- José Miguel Alzola: Biografía apresurada del Arquipiélago Canario, Las Palmas de Gran Canaria ²1978
- V. Arana / V. Fuster: La erupción del volcán Teneguía La Palma, Madrid 1974
- Antonio Arozarena Villar: Parque Nacional de la Caldera de Taburiente - Isla de La Palma, Madrid 1976
- J.J. Bacallado Aránega: Fauna del Archipiélago Canario, Las Palmas de Gran Canaria 1984
- Eduardo Barrenechea: Obejtivo - Canarias (= Testimonio de actualidad. Edición de bolsillo 36), Barcelona 1978
- Othmar Baumli: Die Kanarischen Inseln. Trauminseln im Atlantik, Luzern 1981
- E. Becerril: Informe Hidrogeológico sobre los manantiales de la Caldera de Taburiente y Marco y Corderos, Los Llanos de Aridane 1955
- Anselmo J. Benítez: Historia de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife o.J.
- Pierre Bergeron: Traicté de la Navigation et des Voyages de Descouverte et Conquestes modernes, et principalement des François. Avec une exacte particulière description de toutes les Isles Canaries, les preuves du temps de la conqueste d’icelles, et la Généalogie des Béthencourts et Bracquemons. Le tout recueilly de divers Autheurs, observations, titres et enseignements, Paris 1629
- Hans-Heiner Bergmann / Wiltraud Engländer: Reiseführer Natur. Kanarische Inseln, München 1993, vor allem S. 55 - 67
- Hans Biedermann: Die Spur der Altkanarier. Eine Einführung in die Altvölkerkunde der Kanarischen Inseln, Hallein 1983
- J.G.B.M. Bory de Saint Vincent: Geschichte und Beschreibung der Kanarien-Inseln, Graz 1970
- Friedrich L. Boschke: Die Welt aus Feuer und Wasser, Stuttgart 1981
- Irene Börjes / Hans-Peter Koch: Kanarische Inseln. Teneriffa - La Palma - La Gomera - El Hierro, Hamburg 1992, S. 133 - 155
- Harald Braem: Der Kojote im Vulkan. Märchen und Mythen von den Kanarischen Inseln, Berlin 1990
- ders.: Tanausú, der letzte König der Kanaren, München 1991 und 1993
- ders.: Das magische Dreieck. Neue Geheimnisse aus dem Reich der Pyramiden, Stuttgart 1992
- ders.: Der Vulkanteufel. Schaurige Ereignisse aus grauer Vorzeit bedrohen die kanarische Urlaubsinsel La Palma, Stuttgart/Wien 1994 und Frankfurt 1996
- ders. / Marianne Braem: Kanarische Inseln. Auf den Spuren atlantischer Völker, München 1988, vor allem S. 97 - 118
- Zoe & David Bramwell: Wild Flowers of the Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife 1974
- dies.: Kanarische Flora. Illustrierter Führer, Madrid 1983
- dies.: Historia Natural de las Islas Canarias, Madrid 1987
- T. Bravo: Geografía General de las Islas Canarias, 2 vol., Santa Cruz de Tenerife 1958/64
- O. Brito: Historia del Movimiento Obrero Canario, Madrid 1980
- Christian Freiherr von Buch: Physikalische Beschreibung der Canarischen Inseln, Berlin 1825
- M.A. Camacho González: Potencialidades de Desarrollo Socioeconomico en la Isla de La Palma, Santa Cruz de Tenerife 1987
- Antonio Carpenter Vizcaya: Topografía Canaria, ed. Instituto Estudios Canarios, Santa Cruz de Tenerife 1964
- José M. Castellano Gil / Francisco J. Macías Martín: Die Geschichte der Kanarischen Inseln, Santa Cruz de Tenerife ²1994
- Pedro Agustín Castillo Ruíz de Vergara: Descripción histórica y geográfica de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1848 und Madrid 1948/60
- Castro Cordobes: Kanarische Weine, Santa Cruz de Tenerife 1988
- Juan Manuel Castro / Simone Eigen / Wulf Göbel: La Palma. Die Canarische Insel, Tübingen 1991
- D. Catalán: Romancero General de las Islas Canarias, Valencia 1969
- L. Ceballos / F. Ortuño: Vegetación y Flora forestal de las Canarias Occidentales, Santa Cruz de Tenerife 1976
- CEDOC: Padrón Municipal. Habitantes des Canarias 1986, Madrid 1988
- Gregorio Chil y Naranjo: Estudios Históricos, Climatológicos y Patológicos de las Islas Canarias, tomo 1 - 3, Las Palmas de Gran Canaria 1876, 1880 und 1891
- Hermann Christ: Frühlingsfahrt nach den Kanarischen Inseln, Basel/Genf/Lyon 1886
- José Luis Concepción: Die Guanchen. Ihr Überleben und ihre Nachkommen, La Laguna 11. Aufl. 1992
- Pete Damaso: Heroes Atlanticos, Santa Cruz de Tenerife 1984
- Rose Marie Dähncke: Mein Inselkochbuch, Stuttgart 1983
- Diaz Alayón: Materiales toponímicos de La Palma, Santa Cruz de Tenerife 1988
- Luis Diego Cuscoy: Los Guanches, Santa Cruz de Tenerife 1968
- Félix Duarte: En Una Isla Canaria, Santa Cruz de La Palma 1979
- Andrew Eames (hg.): Teneriffa, La Gomera, La Palma, El Hierro, München 1995, S. 178 - 197
- Friedrich Theophil Ehrmann: Geschichte der merkwürdigsten Reisen, welche seit dem zwölften Jahrhunderte zu Wasser und zu Land unternommen worden sind, 22. Band / 11. Abschnitt: Reisen nach den westafrikanischen Inseln, III. die Kanarieninseln, Frankfurt am Main 1799
- Don Francisco Escolar y Serrano: Estatistica de las Islas Canarias 1806 - 1810, Santa Cruz de Tenerife 1820
- ETAGSA-ETAPSA: Estudios de los suelos regablesde las Islas de La Palma y La Gomera, Madrid 1981
- E. Caldas Fernández: Características Químicas de las Aguas Subterráneas de las Islas Canarias Occidentales, Santa Cruz de Tenerife 1974
- ders.: El Transporte Regional en Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1983
- ders.: El Turismo en Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1985
- ders.: La Industria en Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1986
- ders. (ed.): La Pesca en Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1982
- José M. Fernandez: Los Lepidopteros diurnos de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1976
- Felipe Fernández Armesto: The Canary Islands after the conquest. The making of a colonial society in the early sixteenth century, Oxford 1982
- A.J. Fernández García: Real Santuario Insular de la Nuestra Señora de las Nieves, Madrid 1980
- Antonia L. Ferreira Cubillo: Nueva analisis de algunas palabres Guanches, Las Palmas de Gran Canaria 1980
- Michael Fleck: La Palma. Kratergigantik im Sonnenwald, Bruchköbel 1994
- Fraga González: La Arquitectura Mudéjar en Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1977
- ders.: Aspectos de la Arquitectura Mudéjar en Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1980
- ders.: Arte Barroco en Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1980
- H.J. Fründt / S. Muxfeldt: Kanarische Inseln auf eigene Faust, Kiel 1988
- F. Galante: Elementos del gótico en la arquitectura canaria, Las Palmas de Gran Canaria 1983
- J.L. García: La Población del Valle de Aridane en La Palma, Santa Cruz de Tenerife 1983
- George Glas: The History of the Discovery and Conquest of the Canary Islands. Translated from a Spanish Manuscript found in the Island of Palma. With an enquiry into the origin of the ancient inhabitants. To which is added, A Description of the Canary Islands, including the Modern History of the Inhabitants, and an Account of their Manners, Customs, Trade etc., London ²1767
- Wulf Goebel / Alex Aabe: La Palma. Praktisches Reisehandbuch, Augsburg 1991
- Rolf Goetz: La Palma. Aktivurlaub auf der grünsten der kanarischen Inseln, Frankfurt am Main 4. Aufl. 1997
- Diogo Gomez: De insulis primo inventis in m ari oceano accidentis, et primo de Insulis Fortunatis, quae nunc de Canaria vocantur, München 1847
- Maria Nieves Gonzáles Henríquez: Flora del Arquipiélago Canario, Las Palmas de Gran Canaria 1986
- Richard Greeff: Reise nach den canarischen Inseln, Bonn 1868
- Peter Grimm: La Palma Wanderführer, München 1993
- Eduard Gugenberger: Oasen in der globalisierten Welt. Orte, Inseln und Regionen, die andere Wege gehen, Wien 2007, S. 170ff.
- J. Hernández Bravo de Laguna: Los elecciones políticas en Canarias 1976 - 1986, Madrid 1987
- P. Hernandez Hernandez (ed.): Natura y Cultura de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1978
- M. Hernández Pérez: La Palma prehispánica, Las Palmas de Gran Canaria 1977
- G. Hernández Rodriguez: Estadística de las Islas Canarias 1793 - 1806 de Francisco Escolar Serrano, Las Palmas de Gran Canaria 1983
- Ernest A. Hooton: The Ancient Inhabitants of the Canary Islands, Cambridge Mass. 1925
- Heinz Junker: La Palma Tagebuch. „Die Pinie zur Heiligen Jungfrau“, Düsseldorf (1986)
- Ulrike Klugmann (red.): Bildatlas - Teneriffa, Gran Canaria, La Palma, Gomera, Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, Hamburg ²1990, S. 74 - 81
- Hans-Peter Koch / Irene Börjes: La Palma, Erlangen 1995
- Harald Körke: Noch ein verdammter Tag im Paradies, Tübingen 1988
- ders.: Lust und Liebe auf Papaya. Neue Aussteigergeschichten, Tübingen 1989
- ders.: Die Kräuter des langen Lebens. Geheimnisse und Rezepte der Uralten auf der Insel La Palma, Tübingen 1993
- Günther Kunkel: Die Kanarischen Inseln und ihre Pflanzenwelt, Stuttgart 1987
- ders. (ed.): Biogeography and Ecology in the Canary Islands, The Hague 1976
- S. La Nuez: Unamuno en Canarias, La Laguna 1964
- Suárez Manrique de Lara Isabel: Mujer canaria y entorno social (= Cuadernos Canarios 3), Madrid 1978
- Francisco Maria de Leon: Historia de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1966
- Susanne Lipps: La Palma, Köln 1994
- J.S. López García: La arquitectura del renacimiento en el Arquipiélago Canario, La Laguna de Tenerife 1983
- Salvador López Herrera: Die Kanarischen Inseln. Ein geschichtlicher Überblick, Madrid 1978
- Felipe Lorenzo: Crónicas de mi Pueblo (Tazacorte), Santa Cruz de Tenerife 1978
- J.B. Lorenzo Rodríguez: Noticias para la Historia de la Palma, tomo 1, La Laguna de Tenerife 1987
- Franz von Löher: Kanarierbuch, München 1895
- Klaus und Marianne Lüdtke: Essen auf La Palma. Restaurantführer, Berlin 1992
- F.C. MacGregor: Die Canarischen Inseln nach ihrem gegenwärtigen Zustand, hg. C.N. Röding, Hannover 1831
- Francisco Javier Machado Fiesco: Mapa general de las Islas de Canaria, con uns relación compendiosa de todas ellas, en diez columnas, su situación, descubrimientos, conquistas, antiguos, habitantes, montes etc., o.O. 1762
- Luis Maffiotte: Los periódicos de las Islas Canarias, 3 tomos, Madrid 1905/06
- Juan Maluquer y Viladot: Recuerdos de un viaje a Canarias, Barcelona 1906
- Marco Polo Redaktion (hg.): La Palma. Reiseführer mit Insider-Tips, Ostfildern 1994
- Jésus E. Marquez Moreno: El Atlántico, Canarias y Venezuela, Santa Cruz de Tenerife 1980
- Manuel Martel Sangil: Las Islas Canarias y su origen, Bilbao 1950
- ders.: El volcán de San Juan, Madrid 1960
- F. Martín Rodríguez: Arquitectura doméstica canaria, Santa Cruz de Tenerife 1978
- ders.: El arte flamenco en La Palma, Las palmas de Gran Canaria 1985
- V. Marzol Jaen: La Lluvia. Un recurso natural para Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1988
- Josef Matznetter: Die Kanarischen Inseln. Wirtschaftsgeschichte und Agrargeographie, Gotha 1958
- METRA SEIS: Plan de ordenación de la oferta turística de las islas menores de la Provincia de Tenerife - La Palma, La Gomera, El Hierro, Madrid 1984
- Klaus Metzler: Kompass-Wanderführer Kanarische Inseln, Stuttgart 1980
- Augustín Millares Torres: Historia general de las islas Canarias, tomos I - X, Las Palmas 1893/95
- Ministerio de Agricultura / Instituto Nacional para la Conservacion de la Naturaleza: Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, Madrid 1976
- Ministerio de Industria y Energía, Delegación de Santa Cruz de Tenerife (ed.). El Agua en Canarias, Factor Polémico. Aspectos Históricos, Tecnicos, Económicos, Tributários, Santa Cruz de Tenerife 1981
- Julius Freiherr von Minutoli: Die Canarischen Inseln, ihre Vergangenheit und Zukunft, Berlin 1954
- Hubert Moeller. Kanarische Pflanzenwelt, 2 Bände, Puerto de la Cruz 1980
- Manuel Mora Morales: Die Guanchenküche. Das Gofio-Handbuch. Hintergrundinformationen über die Küche der Kanarischen Ureinwohner. Köstliche Rezepte, Santa Cruz de Tenerife 1986
- José Luis Moreno: Educación y Fuerza de Trabajo en Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1981
- José Manuel Moreno: Guía de las Aves de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife o.J.
- Gerhard Nebel: Phäakische Inseln, Stuttgart 1965
- Thomas Nichols: Beschreibung der Canarischen Eylande und von Madeira und Georg Roberts Reise nach den Canarischen Inseln (= Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande, II. Band, 4. Buch), Leipzig 1747
- Talia Noda Gomez: Medizina popular en la Isla de la Palma, Santa Cruz de La Palma 1984
- Juan Nuñez de la Peña: Conquista y Antiguedades de las Islas de la Gran Canaria, y su descripcion, con muchas adertencias de sus privilegios, conquistadores, pobladores, y otras particularidades, en la muy poderosa Isla de Tenerife dirigido a la milagrosa imagen de nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife 1847
- Pedro de Olive: Diccionario Estatistico Administrativo de la Islas Canarias, Barcelona 1865
- Luis Ortega Abraham: Teide, Timafaya, Taburiente, Poéma del volcán, Santa Cruz de Tenerife 1981
- L. Eugenio Burriel de Orueta: Canarias, Población y Agricultura en una Sociedad dependiente (= Taller de Geografía 2), Villassar de Mar 1981
- Carlos O’Shanahan Juan: Antropología canaria. Fundamentos psicoanalíticos aplicados a la interpretación de los símbolos canarios prehispanicos, Las Palmas de Gran Canaria 1979
- Felipe Jorge Pais Pais: Los benahoaritas. Arte y cultura material de loa aborígenes de La Palma, Santa Cruz de la Palma 2006
- Mauro S. Hernández Pérez: La Palma Prehispanica, Las palmas de Gran Canaria 1977
- Régulo Juan Pérez: Los Periodicos de la Isla de La Palma, Santa Cruz de Tenerife 1948
- L. Pérez Aguado: La arquitectura gótica en Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1983
- Elena Pérez González: La dieta de los Benahoritas, in: Revista de Estudios Generales de la Isla de La Palma. Nr. 3/2007
- J. Pérez Ortega: Die Kanarischen Inseln. Ihre Ureinwohner und die Eroberer, Santa Cruz de Tenerife 1987
- F. Pérez Padron: Las Aves de Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1983
- Sergio T. Pérez Parrilla: La Arquitectura racionalista en Canarias (1927 - 1939), Las Palmas de Gran Canaria 1977/78
- Casas J. Pestana: La Isla de San Miguel de La Palma. Bosquejo historico, Santa Cruz de La Palma 1898
- Pedro J. de Pestana: La Isla de San Miguel de La Palma. Su pasado, su presente y su porvenir, Santa Cruz de Tenerife 1898
- The Poor Pilgrim: A pleasant description of the Fortunate Ilandes, called the Ilands of Canaria, with their straunge fruits and commodities, verie delectable to read, to the praise of God, London ²1588
- Antonia Pino Perez: Dandole vueltas al viento, Santa Cruz de Tenerife 1982
- Damaso de Quezada y Chaves: Las Canarias Ilustradas y Puente Isleña Americana fixa en el primer y Gral. Meridiano Descubrimientos, conquistas de las siete Yslas Afortunadas en el Obispado que antes dicho de Rubicon se nombra hoy de las Canarias. En tres tomos o Partes dividos. Compuestos en Roma 1770, Roma 1784
- F. Quirantes: El regadío en Canarias, 2 tomos, Santa Cruz de Tenerife 1983
- Kollektiv Raaíz: La Palma Schritt für Schritt, Santa Cruz de Tenerife 1992
- Udo Oskar Rabsch: Tazacorte. Roman, Tübingen 1989
- Adam Reifenberger: La Palma Handbuch, Kiel ²1991
- Ursula Reifenberger: Kanarisches Wanderbuch. Auf den Spuren der Guanchen durch La Gomera, El Hierro und La Palma, Göttingen (1984)
- W. Reiß: Die Diabas und Lavaformation der Insel La Palma, Wiesbaden 1961
- M. Rios Navarro: La Energía en Canaria, Santa Cruz de Tenerife 1982
- Gerda Rob: Kanarische Inseln. Bertelsmann Reiseführer, Gütersloh 1973
- Anelio Rodrigues Concepcion: Poemas de la guagua, Santa Cruz de Tenerife 1984
- Ernesto Martin Rodríguez: Actividades arqueológicas en la Isla de La Palma, Tabona 1984
- ders.: La Palma y los Auariotas, in: Antonio Tejera Gaspar (ed.): La prehistoria de Canarias, vol. 3, ed. Centro de la Cultura Popular Canaria, La Laguna 1992
- ders.: La Palma y los Auaritas, Santa Cruz de Tenerife 1992
- G. Rodríguez: La iglesia de El Salvadorde Santa Cruz de La Palma, Madrid 1985
- Wladimir Rodríguez Brito: La agricultura en la Isla de La Palma, Santa Cruz de Tenerife 1982
- ders.: La agricultura de exportación en Canarias (1940 - 1980), Santa Cruz 1986
- J.B. Rodríguez Lorenzo: Noticias para la historia de La Palma, tomo I, La Laguna 1975
- H. Rodríguez Méndez: El impuesto sobre el azúcar en Canarias, Santa Cruz de La Palma 1913
- Juan-Alberto Rodríguez Pérez: Die exotische Pflanzenwelt auf den Kanarischen Inseln, Madrid o.J.
- F. Rodríguez y Rodríguez de Acuña: Formación de la Economía Canaria (1800 - 1936), Madrid 1981
- L. de Rosa Olivera et al.: El agua en Canarias - factor polémico, Santa Cruz de Tenerife 1981
- Peter Rothe: Kanarische Inseln. Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Gomera, La Palma, Hierro (= Sammlung geologischer Führer, Band 81), Berlin/Stuttgart ²1996, vor allem S. 192 - 206
- Almut und Frank Rother: Die Kanarischen Inseln, Köln 1979
- Arnoldo Santos: Arboles de Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1979
- ders.: Vegetación y Flora de La Palma, Santa Cruz de Tenerife 1983
- J. Santos Cabrera: Caldera de Taburiente, Barcelona 1989
- ders.: Isla La Palma. Patronato de Turismo del Excmo Cabildo Insular de La Palma, Santa Cruz de La Palma 1992
- A Santos Guerra: Vegetación y Flora de La Palma, Santa Cruz de Tenerife 1983
- Karl Sapper: Die Kanarischen Inseln. Ei ne geographische Studie, Leipzig 1906
- Ilse Schwidetzky: Die vorspanische Bevölkerung der kanarischen Inseln, Göttingen 1963
- Soler: Informe Hidrogeológico del acuífero del Barranco de las Angustias, ed. SGOPU, Madrid 1984
- M. Olivia Stone: Tenerife and its six satellites, London 1889
- Klaus Stromer: La Palma selbst entdecken, Zürich 1993
- Mitchell R.C. Thomé: Geology of the Middle Atlantic Islands, Berlin/Stuttgart 1976
- Rafael Torres Campos: Carácter de la Conquista y Colonización de las Islas Canarias, Madrid 1901
- Leonardo Torriani: Die Kanarischen Inseln und ihre Urbewohner. Eine unbekannte Bilderhandschrift vom Jahre 1590, hg. D.J. Wölfel, Leipzig 1940
- Trujillo Rodríguez: El retablo barroco en Canarias, Las Palmas de Gran Canaria 1977
- Horst Uden: Kanarische Legenden. Berge, Inseln, Giganten, Puerto de la Cruz 1978
- Miguel de Unamuno: Gesammelte Werke, München 1928
- Haraldus Vallerius: Dissertatio de Insulis Canariis, Upsalae 1708
- R. Verneau: Cinq annéesde séjour aux Isles Canaries, Paris 1890 und Santa Cruz de Tenerife 1982
- José Viera y Clavijo: Historia General de las Islas Canarias, Las Palmas 1931/33
- ders.: Noticias de la historia general de las Islas Canarias, 4 tomos, Santa Cruz de Tenerife 1941 und Madrid 1978
- V. Voggenreiter: Geobotanische Untersuchungen an der natürlichen Vegetation der Kanareninsel Tenerife, Lehre 1974
- Benigno Carballo Wangüemert: Las Afortunadas. Viaje descriptivo a las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1990, S. 53 - 150
- Barker Webb / Sabin Berthelot: Histoire naturelle des Iles Canaries, Paris 1842/50
- Leo Woerl: Reisebilder - Die Kanarischen Inseln, Leipzig 1906
- Klaus Wolfsperger / Annette Miehle-Wolfsperger: Wanderungen auf La Palma, München 4. Aufl. 1997
- Dominik Josef Wölfel: Monumenta Linguae Canariae. Die kanarischen Sprachdenkmäler. Eine Studie zur Vor- und Frühgeschichte Weißafrikas, Graz 1965
- José María Zuazvanar y Francia: Compendio de la historia de las Canarias, formado en su principio con la comisión correspondiente para las Escuelas de primeras letras de aquellas islas, y hoy ilustrado y aumentado notablemente en obsequio de la verdad etc., Madrid 1816
Zeitungen und Zeitschriften
- Almogaren, Hallein seit 1970
- Diario de Avisos - La Palma, Santa Cruz de Tenerife seit 1890
- El Día - La Palma, Santa Cruz de Tenerife
- El Time, Santa Cruz de La Palma seit 1992
- La Graja - Revista Cultural Palmera, Santa Cruz de la Palma
- La Palma - Revista de Informacion Insular, Santa Cruz de la Palma
- La Palma Info, Los Llanos de Aridane seit 1985
- Museo Canario, Las Palmas seit 1893
- Wochenspiegel, Santa Cruz de la Palma
Reiseberichte
- La Palmas Highlights erwandert = https://www.asi-reisen.de/blog/la-palma-reisebericht/
- La Palma - die Isla Bonita = https://www.reiseoasen.de/spanien/reisebericht-la-palma/
- La Palma - Wandern auf der Kanareninsel = https://www.tourentipp.com/de/bergjournal/alpinmagazin/meldungen/La-Palma-Wandern-Vulkanroute.php
- La Palma - die Reisegalerie = https://www.reisegalerie.com/reiseberichte_neu/reise-nach-la-palma/
- La Palma Erfahrungsbericht = https://www.gettivity.com/allgemein/la-palma-erfahrungsbericht/
- La Palma - Erleben Sie die Insel auf eigene Faust = https://www.welt.de/reise/nah/article252431124/La-Palma-Erleben-Sie-die-Insel-auf-eigene-Faust-Das-kann-herausfordernd-sein-lohnt-sich-aber.html
- Reisebericht La Palma = https://www.voegele-reisen.ch/reiseblog/reisebericht/lapalma/
Videos
- Bananeninsel (Kanal) = https://www.youtube.com/@bananeninsel
- La Palma, der schlummernde Feuerdrache = https://www.youtube.com/watch?v=XOazODwo470
- La Palma, vom Ursprung der Insel = https://www.youtube.com/watch?v=b0noWHPUzTk
- La Palma, die schöne Insel (2006) = https://www.youtube.com/watch?v=HTkP1F0Cj_s
- La Palma per Drohne = https://www.youtube.com/watch?v=m0H9191RlXY&list=RDm0H9191RlXY&start_radio=1
- La Palma Reisetipps = https://www.youtube.com/watch?v=8yaS1epvF9g
- Grenzenlos die Welt entdecken - La Palma = https://www.youtube.com/watch?v=UmL3O7mTj_0
- Vulkanausbruch auf La Palma und die Folgen = https://www.youtube.com/watch?v=XccDNXGciAE
- ZDF Info: La Palma unter Lava = https://www.youtube.com/watch?v=3Z4Z3nUajZY
- Das ist La Palma, die schönste der Kanarischen Inseln = https://www.youtube.com/watch?v=b3BHt16P-mI
- Geheimnisse der Insel La Palma = https://www.youtube.com/watch?v=cLGgnj7F1L4
- Donkey on Tour - La Palma = https://www.youtube.com/watch?v=PlV-mv355VY
Atlas
- La Palma Übersicht = https://www.visitarcanarias.com/Images/mapa_la_palma_grande.gif
- La Palma Topographie = https://www.3d-relief.com/Europa/Reliefkarte-Spanien/3D-Reliefkarte--LaPalma-physisch.html
- La Palma Straßenkarte = https://viagallica.com/canaries/lang_de/carte_ile_palma.htm#google_vignette
- La Palma interaktiv = https://clubcanary.com/de/la-palma-map/
- La Palma Übersicht = https://www.portal-de-canarias.com/html/karte_la_palma.html
- La Palma Geologie = https://www.researchgate.net/figure/Geological-map-of-the-island-of-La-Palma-based-on-the-IGME-GEODE-map-Bellido-Mulas-et_fig1_371959878
- La Palma Vulkanismus = https://www.researchgate.net/figure/Map-of-La-Palma-showing-the-different-stratigraphic-units-and-the-lava-flows-from-Cumbre_fig1_372558191
- La Palma Satellitenaufnahme = https://www.science-photo.de/bilder/13755061-La-Palma-Santa-Cruz-de-Tenerife-satellite-image
- La Palma Gemeinden = https://www.facebook.com/groups/2610471662416174/posts/3403655909764408/?_rdr
- La Palma Stammesgebiete = https://es.wikipedia.org/wiki/Benahoarita#/media/Archivo:Lapalma_cantones_prehispanica2.jpg
Reiseangebote
Urlaubsguru - La Palma Erkundung = https://www.urlaubsguru.at/pauschalreisen/la-palma/
La Palma All Inclusive = https://www.ab-ins-blaue.at/urlaub/kanaren/la-palma/all-inclusive-urlaub.html
Tui Pauschalreisen La Palma = https://www.tui.at/pauschalreisen/spanien/la-palma/
Forum
Hier geht's zum Forum: https://www.insularium.org/forum/viewforum.php?f=6