Tasmanien (Lutruwita / Tasmania): Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 310: | Zeile 310: | ||
* Mount Hugel 1397 m | * Mount Hugel 1397 m | ||
* Mount Cuvier 1380 m | * Mount Cuvier 1380 m | ||
'''Seen''' | '''Seen''' | ||
| Zeile 396: | Zeile 395: | ||
Der feuchte Wind sorgt im Westen für jährliche Niederschläge von über 1500 mm mit Spitzenwerten bis zu 3800 mm. Im Osten sind Werte um 1500 mm jährlich die Ausnahme, zum Teil werden hier nur Werte um 400 mm erreicht. Vereinfacht dargestellt kann man sagen, dass die jährlichen Niederschläge Tasmaniens in West-Ost-Richtung kontinuierlich abnehmen. Verglichen mit dem aridesten Kontinent der Erde – Australien – sind selbst diese Werte im Osten der Insel noch hoch. | Der feuchte Wind sorgt im Westen für jährliche Niederschläge von über 1500 mm mit Spitzenwerten bis zu 3800 mm. Im Osten sind Werte um 1500 mm jährlich die Ausnahme, zum Teil werden hier nur Werte um 400 mm erreicht. Vereinfacht dargestellt kann man sagen, dass die jährlichen Niederschläge Tasmaniens in West-Ost-Richtung kontinuierlich abnehmen. Verglichen mit dem aridesten Kontinent der Erde – Australien – sind selbst diese Werte im Osten der Insel noch hoch. | ||
[[Datei:Tasmanien - Coles Bay.png|rechts]] | |||
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2025, 06:43 Uhr
Tasmanien ist das südliche Anhängsel Australiens - eine eigene Welt in einer eigenen Welt. Von der fast schon ausgerotteten, aber mittlerweile wiedererwsachten tasmanischen Menschenrasse über den Tasmanischen Teufel und unzählige andere Tiere ebenso wie Pflanzen, die ganzm anders sind als anderswo.
| Inselsteckbrief | |
|---|---|
| offizieller Name | Tasmania (englisch), Lutruwita (palawa) |
| alternative Bezeichnungen | Van Diemens Land, Van Diemen’s Land (1642), Anthilland (17. Jahrhundert), Tassie (lokal), Tasmanie (französisch), Tasmanien (deutsch) |
| Kategorie | Meeresinsel |
| Inseltyp | echte Insel |
| Inselart | Kontinentalinsel |
| Gewässer | Tasmansee (Tasman Sea) |
| Inselgruppe | Tasmanien (Tasmania) |
| politische Zugehörigkeit | Staat: Australien (Commonwealth of Australia) Bundesstaat: Tasmanien (State of Tasmania) |
| Gliederung | 27 local government areas (Selbstverwaltungsgebiete), Bundesstaat 29 480 parishes (Gemeinden) |
| Status | Inselstaat (island state) |
| Koordinaten | 42°10‘ S, 146°30‘ O |
| Entfernung zur nächsten Insel | 140 m (Perkins Island), 1,1 km (Robbins Island), 199 km (Australien) |
| Entfernung zum Festland | 6.212 km (Pulau Besar / Malaysia) |
| Fläche | 64.519 km² / 24.911 mi² (Bundesstaat 68.401 km² / 26.410 mi²) |
| geschütztes Gebiet | 35.770 km² / 13.811 mi² (55,4 %), Bundesstaat 36.222 km² / 13.985 mi² (52,9 %) |
| maximale Länge | 372 km (NNW-SSO) |
| maximale Breite | 286 km (ONO-WSW) |
| Küstenlänge | 2.850 km |
| tiefste Stelle | 0 m (Tasmansee) |
| höchste Stelle | 1617 m (Mount Ossa) |
| relative Höhe | 1617 m |
| mittlere Höhe | 280 m |
| maximaler Tidenhub | 1,2 bis 4,5 m (Launceston 4,3 m, Hobart 1,5 m) |
| Zeitzone | EST (Eastern Standard Time / Östliche Standard-Zeit, UTC+11). |
| Realzeit | UTC plus 9 Stunden 35 bis 53 Minuten |
| Einwohnerzahl | 569.279, Bundesstaat 573.479 (2023) |
| Dichte (Einwohner pro km²) | 8,82, Bundesstaat 8,38 |
| Inselzentrum | Hobart |
Name
Die indigenen Palawa, die Tasmanien vor etwa 40.000 Jahren besiedelten, nannten die Insel Lutruwita, ein Begriff aus ihrer rekonstruierten Sprache Palawa kani, der ihre tiefe kulturelle Verbindung zur Heimat betont. Während der letzten Eiszeit war die Insel bis vor etwa 13.000 bis 10.000 Jahren mit dem australischen Festland verbunden, was eine isolierte Entwicklung ihrer Flora, Fauna und Kulturen ermöglichte.
1642 sichtete der niederländische Entdecker Abel Janszoon Tasman (1603 bis 1659) die Insel als erster Europäer und benannte sie Van Diemens Land - auch Van Diemen's Land geschrieben - zu Ehren von Anthony van Diemen (1593 bis 1645), dem Generalgouverneur der Niederländischen Ostindien-Kompanie. Dieser Name, manchmal auch als Anthilland verzeichnet, wurde in europäischen Karten übernommen, obwohl Tasman die Insel nie betrat. Mit der britischen Kolonisation ab 1803, als Sträflingskolonien wie Hobarttown gegründet wurden, blieb Van Diemens Land der offizielle Name. 1825 wurde die Insel als eigenständige Kolonie von New South Wales getrennt.
Am 1. Januar 1856 erfolgte die Umbenennung in Tasmania, um Abel Tasman zu ehren und die Assoziation mit der Sträflingszeit hinter sich zu lassen, die mit Van Diemens Land verbunden war. Der neue Name sollte einen ehrenvolleren Charakter vermitteln und leitete sich direkt von Tasman ab. Seit der Eingliederung in das Commonwealth of Australia 1901 trägt die Insel offiziell diesen Namen. Umgangssprachlich wird sie heute als Tassie genannt. Im Deutschen heißt sie Tasmanien. Heute gewinnt der ursprüngliche Name Lutruwita wieder an Bedeutung, insbesondere durch die Bemühungen der Palawa-Gemeinschaft und der Tasmanian Aboriginal Corporation, die kulturelle Identität nach dem Genozid des 19. Jahrhunderts, der die indigene Bevölkerung nahezu auslöschte, zu revitalisieren.
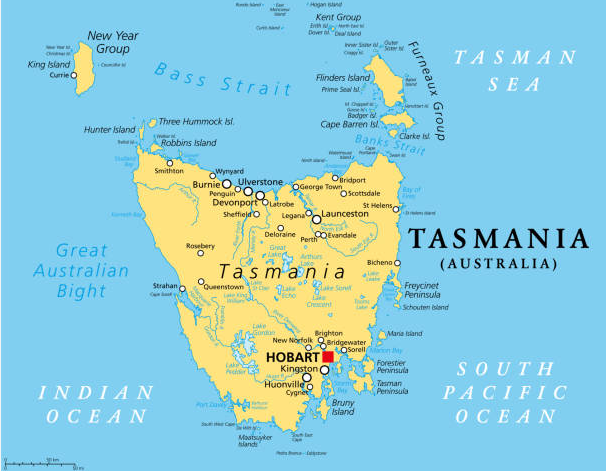
- abchasisch: Тасмания [Tasmanija]
- acehnesisch: Tasmania
- adygisch: Тасманиe [Tasmanie]
- afrikaans: Tasmanië
- akan: Tasmania
- albanisch: Tasmania
- alemannisch: Tasmanie
- altaisch: Тасмания [Tasmanija]
- altkirchenslawisch: Тасманї [Tasmanî]
- amharisch: ታዝማኒያ [Tāzmaniyā]
- angelsächsisch: Tasmania
- arabisch: تاسمانيا [Tasmāniyā]
- aragonesisch: Tasmania
- armenisch: Տասմանիա [Tasmaniya]
- aromunisch: Tasmania
- assamesisch: তাসমানিয়া [Tāsamāniẏā]
- aserbaidschanisch: Tasmaniya
- asturisch: Tasmania
- awarisch: Тасмания [Tasmanija]
- aymara: Tasmaniya
- bambara: Tasmani
- bandscharisch: Tasmania
- baschkirisch: Тасмания [Tasmanija]
- baskisch: Tasmania
- bengalisch: তাসমানিয়া [Tāsamāniẏā]
- bhutanisch: ཏས་མེ་ནི་ཡ [Ta-me-ni-ya]
- biharisch: तस्मानिया [Tasmāniyā]
- bikol: Tasmania
- birmanisch: တက်စမေးနီးယား [Tat-sa-may-ni-ya]
- bislama: Tasmania
- bosnisch: Tasmanija
- bretonisch: Tasmania
- bulgarisch: Тасмания [Tasmanija]
- burjatisch: Тасмания [Tasmanija]
- cebuano: Tasmania
- chakassisch: Тасмания [Tasmanija]
- chavakano: Tasmania
- cherokee: ᏔᏍᎹᏂᏯ [Tas-ma-ni-ya]
- chinesisch: 塔斯马尼亚 [Tăsīmăníya]
- dari: تاسمانیا [Tâsmâniyâ]
- dänisch: Tasmanien
- deutsch: Tasmanien
- englisch: Tasmania
- esperanto: Tasmanio
- estnisch: Tasmaania
- ewe: Tasmania nutome
- färingisch: Tasmania
- fidschianisch: Tasmaniya
- finnisch: Tasmania
- französisch: Tasmanie
- friesisch: Tasmaanje
- friulanisch: Tasmania
- ful: Tasmani
- gagausisch: Тасмания [Tasmaniya]
- galizisch: Tasmania
- gälisch: An Tasmáin
- georgisch: ტასმანია [Tasmania]
- griechisch: Τασμανία [Tasmania]
- grönländisch: Tasmaniut
- guarani: Tasmania
- gudscheratisch: ટસમાનિયા [Tasmāniyā]
- haitianisch: Tazmani
- hakka: 塔斯曼尼亚 [Tǎ sī màn ní yà]
- hausa: Tasmaniya
- hawaiianisch: Kāmoana
- hebräisch: טסמניה [Tasmanyah]
- hindi: तस्मानिया [Tasmāniyā]
- igbo: Tasmania
- ilokano: Tasmania
- indonesisch: Tasmania
- interlingua: Tasmania
- inuktitut: Tasmaania
- irisch: Yn Tasmaan
- isländisch: Tasmanía
- italienisch: Tasmania
- jakutisch: Тасмания [Tasmanija]
- jamaikanisch: Tasmania
- japanisch: タスマニア州 [Tasmania-shū]
- javanisch: Tasmania
- jerseyanisch: Tasmanie
- jiddisch: טאַסמאַניע [Tasmanie)]
- kabardisch: Тасманиэ [Tasmaniă]
- kabiye: Tasmaanii
- kabylisch: Tasmanya
- kalmükisch: Тасмани [Tasmani]
- kambodschanisch: តាស្មានី [Tasmanī]
- kanaresisch: ಟಾಸ್ಮೇನಿಯಾ [Tāsmeniyā]
- karakalpakisch: Тасмания [Tasmanija]
- karatschai-balkarisch: Тасмания [Tasmanija]
- karelisch: Тасманиa [Tasmania]
- kasachisch: Тасмания [Tasmanija]
- kaschubisch: Tasmanija
- katalanisch: Tasmania
- kirgisisch: Тасмания [Tasmaniya]
- komi: Тасмания [Tasmanija]
- koreanisch: 태즈메이니아주 [T’asŭmeini‘aju]
- kornisch: Tasmani
- korsisch: Tasmania
- krimtatarisch: Тасмания [Tasmaniya]
- kroatisch: Tasmanija
- kumükisch: Тасмания [Tasmanija]
- kurdisch: Tasmania
- ladinisch: Tasmania
- ladino: Tasmania
- lakisch: Тасманиja [Tasmanija]
- laotisch: ທາສເມເນຍ [Thāsmenia]
- lasisch: ტასმანია [Tasmania]
- lateinisch: Tasmania
- lesgisch: Тасманиja [Tasmanija]
- lettisch: Tasmanija
- letzeburgisch: Tasmanien
- limburgisch: Tasmanië
- litauisch: Tasmanija
- livisch: Tasmania
- madegassisch: Tasmania
- makedonisch: Тасманиja [Tasmanija]
- malaisch: Tasmania
- malayalam: ടാസ്മാനിയ [Ṭāsmānija]
- maldivisch: ޓަސްމޭނިޔާ [Tasmeniyā)]
- maltesisch: Tażmanja
- manx: yn Tasmany
- maori: Tahumeneia
- marathisch: तस्मानिया [Tasmāniyā]
- mari: Тасманий [Tasmanij]
- mingrelisch: ტასმანია [Tasmania]
- minnan: 塔斯馬尼亞 [Thap-su-má-nî-a]
- mirandesisch: Tasmania
- moldawisch: Tasmania
- mongolisch: Тасмани [Tasmani]
- mordwinisch: Тасманий [Tasmanij]
- nahuatl: Tasmania
- nauruanisch: Tasmania
- nepalesisch: टैज़मेनिया [Tasmāniyā]
- niederländisch: Tasmanië
- normannisch: Tasmanie
- norwegisch: Tasmania
- novial: Tasmania
- okzitanisch: Tasmania
- olonetzisch: Тасмания [Tasmanija]
- orissisch [Odia]: ଟାସ୍ମାନିଆ [Tāsmaniā]
- oromo: Tasmeeniyaa
- ossetisch: Тасмани [Tasmani]
- pampangan: Tasmania
- pandschabisch: ਟਸਮਾਨੀਆ [Tasmānīā]
- panganisan: Tasmania
- papiamentu: Tasmania
- paschtunisch: تسمانیا [Tasmāniyā]
- persisch: تاسمانیا [Tâsmâniyâ]
- piemontesisch: Tasmania
- pitkernisch: Tasmainya
- polnisch: Tasmania
- portugiesisch: Tasmânia
- provenzalisch: Tasmania
- quetschua: Tasmaniku
- rätoromanisch: Tasmania
- romani: Tasmania
- rumänisch: Tasmania
- rundi-Rwandesisch: Tasmaniya
- russisch: Тасмания [Tasmanija]
- ruthenisch: Тасмания [Tasmanija]
- samisch: Tasmania
- samoanisch: Tasmaniai
- samogitisch: Tasmanėjė
- sango: Tasmanïi
- sardisch: Tasmània
- saterfriesisch: Tasmanien
- schlesisch: Tasmańijo
- schottisch: Tasmanie
- schwedisch: Tasmanien
- schweizerdeutsch: Tasmanie
- serbisch: Тасманија [Tasmanija]
- sindhi: ٽسمانيا [Tasmaniya]
- singhalesisch: ටස්මේනියා [Tasmēniyā]
- sizilianisch: Tasmania
- slovio: Tasmnija
- slowakisch: Tasmánia
- slowenisch: Tasmanija
- somalisch: Tasmaaniya
- sorbisch: Tasmanija
- spanisch: Tasmania
- sudovisch: Tasmania
- surinamesisch: Tasmania
- swahili: Tasmania
- syrisch [Aramäisch]: ܬܣܡܢܝܐ [Tasmaniya]
- tabassaranisch: Тасмания [Tasmanija]
- tadschikisch: Тасмания [Tasmaniya]
- tagalog: Tasmanya
- tahitianisch: Tātimana
- tamilisch: தாஸ்மானியா [Tāsmāṉiyā]
- tatarisch: Тасмания [Tasmaniya]
- telugu: టాస్మానియా [Ṭāsmāniya]
- thai: รัฐแทสเมเนีย [Thasmāniya]
- tibetisch: ཏས་མེ་ནི་ཡ [Ta-me-ni-ya]
- tigrinisch: ታዝሜኒያ [Tasmanya]
- timoresisch: Tasmánia
- tok Pisin: Tasmania
- tonganisch: Tasimania
- tschechisch: Tasmánie
- tschetschenisch: Тасмани [Tasmani]
- tschuwaschisch: Тасмани [Tasmani]
- turkmenisch: Tasmaniýa
- tuwinisch: Тасмания [Tasmaniya]
- türkisch: Tazmanya
- twi: Tasmania
- udmurtisch: Тасмания [Tasmanija]
- ugurisch: تاسمانىيە [Tasmaniye]
- ukrainisch: Тасманiя [Tasmanija]
- ungarisch: tasmania
- urdu: تسمانیہ [Tasmaniya]
- usbekisch: Тасмания [Tasmanija]
- venezianisch: Tasmania
- vietnamesisch: Tasmania
- visayan: Tasmania
- volapük: Tasmania
- valisisch: Tasmania
- wallonisch: Tasmanie
- weißrussisch: Тасманиja [Tasmanija]
- wepsisch: Tasmanii
- winaray: Tasmania
- wolof: Tasmaani
- yoruba: Tasmania
- zazakisch: Tasmania
- zulu: iTasmania
Offizieller Name: Tasmania
- Bezeichnung der Bewohner: Tasmanians (Tasmanier)
- adjektivisch: tasmanian (tasmanisch)
Kürzel:
- Landescode: TS / TAS
- Kfz: -
- FIPS-Code: AS06
- ISO-Code: AU-TS
Lage
Tasmanien liegt im Südosten Australiens zwischen 40° und 44° südlicher Breite sowie zwischen 144° und 149° östlicher Länge. Der Insel-Bundesstaat befindet sich auf der gleichen geografischen Breite wie der Norden der Süd- und der Süden der Nordinsel Neuseelands, die Insel Chiloë samt Hinterland im Süden Chiles, Nord-Patagonien in Argentinien und die Gough-Insel. Die Insel ist rund 200 km vom australischen „Festland“ entfernt.
Geografische Lage:
- nördlichster Punkt: 40°38‘30“ s.B. (Cape Grim) bzw. 39°11‘55“ s.B. (Seal Rock / Hogan Group)
- südlichster Punkt: 43°38‘21“ s.B. (South East Cape) bzw. 43°39‘50“ s.B. (Needle Rocks / Maatsuyker Islands)
- östlichster Punkt: 148°21‘15“ ö.L. (Cape Forestier) bzw. 148°10‘50“ ö.L. (Cape Barren / Cape Barren Island)
- westlichster Punkt: 144°36‘32“ ö.L. (Bluff Hill Point) bzw. 143°49‘05“ ö.L. (New Year Island / King Island)

Entfernungen:
- Perkins Island 140 m
- Robbins Island 1,1 km
- Flinders Island 54 km
- King Island 88 km
- Wilsons Promontory / Australien 199 km
- Melbourne 319 km
- Canberra 591 km
- Sydney 816 km
- Adelaide 836 km
- Pulau Besar / Malaysia 6.212 km
Zeitzone
In Tasmanien gilt die Eastern Standard Time (Östliche Standard-Zeit), kurz EST (OSZ), 10 Stunden vor der MEZ (UTC+11). Vom letzten Sonntag im März bis zum letzten Sonntag im Oktober gilt die Eastern Standard Summer Time (Östliche Standard-Sommerzeit). Die Realzeit liegt um 9 Stunden und 35 bis 53 Minuten vor der Koordinierten Weltzeit (UTC).
Fläche
Tasmanien als größte Insel des Australischen Bundes umfasst 68.401 km² bzw. 26.410 mi² - ohne vorgelagerte Inseln 64.519 km² bzw. 24.911 mi² -, das sind 0,89 % der Gesamtfläche Australiens. Inklusive Wasserfläche (22.357 km²) ist Tasmanien 90.758 km² groß. Der Durchmesser der Hauptinsel beträgt von Nordnordwest nach Südsüdost 372 km und von Ostnordost nach Westsüdwest 286 km. Die Küstenlänge beträgt 2.850 km, inklusive Nebeninseln 4.882 km. Die Bass-Straße, die die Insel vom australischen Festland trennt, wird im Nordwesten durch King Island, an der Nordostspitze von Flinders Island flankiert. Landschaftlich dominieren Gebirge und Hochebenen bis zirka 1600 m Höhe die Insel. Die höchste Erhebung ist der Mount Ossa (1617 m). Die mittlere Höhe liegt bei 280 m. Auch die 1300 km südlich gelegene Macquarieinsel gehört zum Bundesstaat Tasmanien, und zwar zur Gemeinde Huon Valley, die an der Südspitze von Tasmanien liegt. Der maximale Tidenhub beträgt 1,2 bis 4,5 m, bei Launceston 4,3 m, bei Hobart 1,5 m.
Geologie
Die tasmanische Pflanzen- und Tierwelt ist eng mit der geologischen Vergangenheit Australiens verknüpft. Erdgeschichtlich betrachtet nimmt der australische Kontinent aufgrund seiner rund 50 Millionen Jahre dauernden Isolation eine Sonderstellung ein, die sich nachhaltig auf seine Biozönose ausgewirkt hat. Diese Abtrennung ist verantwortlich für die Vielzahl der endemischen Arten, die häufig ein hohes stammesgeschichtliches Alter aufweisen. In Tasmanien wird dieser Aspekt durch die Trennung vom australischen Festland vor rund 12.000 Jahren insofern noch verstärkt, als außeraustralische Einflüsse hier noch weniger zum Tragen kamen.
Tasmanien geht in seinen Grundzügen auf den Superkontinent Gondwana zurück. Gondwana erreichte zu Beginn des Perm seine größte Ausdehnung und begann im Jura in die gegenwärtigen Kontinente der Südhalbkugel zu zerbrechen. Die Reihenfolge dieser Teilung hat die Stellung der Biosphäre Australiens im ökologischen Weltgefüge maßgeblich geprägt. Nacheinander wurde die australische Landmasse vom späteren Afrika, Indien, Neuseeland, aber erst im Eozän von Antarktika getrennt. Darin liegt der Umstand begründet, dass die australische Biosphäre am ehesten Ähnlichkeit mit Teilen der neuseeländischen und südamerikanischen aufweist. Denn während des Eozäns waren Südamerika und Australien noch durch die Landmasse Antarktika verbunden. Diese Theorie wird sowohl durch Untersuchungen an der rezenten Pflanzen- und Tierwelt als auch durch fossile Befunde gestützt. Seit der Trennung von Antarktika war Australien mehr als 50 Millionen Jahre von den anderen Kontinenten isoliert. Selbstverständlich hat sich auch die australische Biosphäre seither den ökologischen Bedingungen und Veränderungen im Laufe der Jahrmillionen angepasst und dennoch ähnelt sie noch deutlich der ehemaligen Flora und Fauna Gondwanas.
Auch geologisch unterscheiden sich der Westen und der Osten der Insel. B
+3esteht der Westteil der Insel aus extrem nährstoffarmen präkambrischen Sedimenten, ist der Ostteil aus trophisch etwas günstigerem Jura-Dolerit aufgebaut. Die extrem ungünstige Nährstoffversorgung der Böden überlagert besonders im Westen der Insel, auch in Zusammenhang mit den extremen Niederschlagswerten, oft die klimatische Baumgrenze: es können sich hier auch im Tiefland keine Wälder ausbilden, es kommt zur Ausbildung ausgedehnter Moorgebiete, die von der Cyperaceae Gymnoschoenus sphaerocephalus dominiert werden und als Buttongrass-Moorland bezeichnet werden.
Landschaft
Die Insel liegt auf der Südspitze des australischen Kontinentalschelfs und ist annähernd so groß wie Irland. Sie ist die weitaus größte der über hundert Inseln des Bass-Archipels. Tasmanien ist eine, inklusive etwa 30 kleinerer Inseln, zirka 63.300 km² große Insel im Süden des australischen Kontinents, die Form entspricht etwa einem auf der Spitze stehenden, gleichseitigen Dreiecks.
Tasmaniens Küsten sind sehr vielfältig, wobei die Westküste mit nur zwei für natürliche Häfen geeigneten Plätzen, nämlich Macquarie Harbour und Port Davey, noch am gleichförmigsten ist. Berühmt ist der Mündungsbereich des Derwent River im Süden der Insel: Hier hat sich die Hauptstadt Hobart unter für einen Hafen äußerst günstigen natürlichen Bedingungen entwickelt.
Obwohl der höchste Gipfel Tasmaniens nur 1617 m hoch ist (Mount Ossa in den Cradle Mountains) und heute keine Vergletscherung existiert, kann die Insel als sehr gebirgig bezeichnet werden, im Zentrum der Insel und weniger im Süden und Westen gibt es auch Gebiete mit natürlicher alpiner Vegetation. Obwohl Tasmanien nur etwa 0,9 % der Gesamtfläche Australiens umfasst, kommen hier 50 % der Fläche mit high mountains vor. Der größte Teil der Insel ist vom mächtigen Zentralmassiv, das mit seinen Ausläufern fast die ganze Insel von Norden nach Süden durchzieht, dominiert.

Erhebungen
- Mount Ossa 1617 m
- Cradle Mountain 1545 m
- Mount Jerusalem 1458 m
- Ironstone Mountain 1443 m
- Mount Gell 1442 m
- Mount Field West 1434 m
- Mount Rufus 1416 m
- Fisher Bluff 1408 m
- Mount Hugel 1397 m
- Mount Cuvier 1380 m
Seen
- Lake Pedder 242 km² (Tiefe 43 m)
- Great Lake 114 km² (Tiefe 1030 m)
Flüsse
- Derwent River 180 km
- Huon River 174 km
- Cockle Creek 148 km
- Arthur River 85 km
- Tamar River 70 km
- Weld River 50 km
Inseln Fläche Ausmaße Seehöhe
Tasmanien 64 519 km² 355 x 310 km 1617 m
Flinders Island 1 330 km² 61 x 31 km 756 m
King Island 1 098 km² 62 x 26 km 161 m
Cape Barren Island 464 km² 37 x 14 km 687 m
Bruny Island 362 km² 40 x 36 km 571 m
Flora und Fauna
Tasmanien beherbergt eine einzigartige Flora mit endemischen Arten wie dem Huon-Kiefer und uralten Regenwäldern, die im Tasmanian Wilderness World Heritage Area geschützt sind. Die Fauna umfasst ikonische Tiere wie den Tasmanischen Teufel, Wombats und zahlreiche Vogelarten, wobei der ausgestorbene Thylacin (Beutelwolf) ein kulturelles Symbol bleibt.
Flora
Die Vegetation wird im Nordwesten von gemäßigten regenwaldähnlichen Wäldern bestimmt. Im Südwesten und Norden finden sich aber auch Buttongras- und Moorlandschaften. Auf den weitläufigen Hochebenen begegnen uns alpine Moose und Blumen. Durch die isolierte Lage vom Festland sind etwa 20 Prozent der gut 1500 vorkommenden höheren Pflanzenarten endemisch. Aufgrund der unterschiedlichen klimatischen und geografischen Verhältnisse differiert auch in Bezug auf die Flora die Westhälfte der Insel stark vom Osten. Im Westteil finden sich vorwiegend regenwaldähnliche Wälder und Vegetationsformen, die in Teilen jenen von Südamerika und Neuseeland ähneln. Im Osten Tasmaniens herrschen trockene und lichte Wälder australischer Prägung vor. Letztere sind gekennzeichnet durch hunderte verschiedener Akazien- und Eukalyptusarten, die wie in Teilen Australiens die gesamte Restflora dominieren. Wie die gesamte australische Flora weisen auch sie eine Vielzahl unterschiedlicher evolutionärer Anpassungen auf. Der Wald australischer Prägung lichtet in den Höhenlagen zunehmend aus. Oberhalb 900 m im Norden und 600 Meter im Süden gehen die Wälder häufig in ausgedehnte Moorlandschaften über.
Im kühl temperierten feuchten Fast-Regenwald Westtasmaniens bestimmen endemische Südbuchen-Arten (Nothofagus sp.), die bis zu 40 Meter Höhe erreichen können, das Bild. Wie annähernd alle Baumarten Tasmaniens sind auch sie immergrün. In diesen Wäldern wachsen die höchsten Laubbäume der Welt wie die Riesen-Eukalypten (bis 100 m hoch) oder der Stringy-Bark (bis 90 m hoch). Diese Giganten ragen weit über das Walddach hinaus. Auch darunter wachsen urtümliche Baumarten, die ihresgleichen suchen wie die Celery-top-Pine, ein Nadelbaum ohne Nadeln mit blattartig verbreiterten Stielen, die Huon-Pine, die über 2.000 Jahre alt werden kann oder die Dicksonia-Baumfarne mit ihren weit ausladenden Wedeln. Aufgrund der vorkommenden Eukalyptenarten sind diese Wälder strenggenommen keine echten Regenwälder, obwohl alle anderen Kriterien zutreffen. Der ausgeprägte Stockwerkbau dieses Waldes und sein dichtes Unterholz machen ihn häufig undurchdringlich. In den ausgedehnten Dünenlandschaften der Sandstrände herrschen hitze- und trockenheitsresistente Büsche, Sträucher und Gräser vor.
Bereits vor der Ankunft der Europäer waren weite Landstriche Tasmaniens durch die Einwirkung der einheimischen Inselbevölkerung geprägt. Auf diese Weise entstanden beispielsweise die feuchten Riedlandschaften mit ihrem Schilf-, Gras- und Heckenbewuchs, die den Regenwald durchsetzen und der zum Teil parkähnliche Charakter mancher Eukalyptus- und Akazienwälder.
Fauna
Die Tierwelt Tasmaniens ist in starkem Ausmaß mit der australischen verwandt. Letztere ist, ebenso wie die Vegetation, geprägt von Endemismen. Beuteltiere sind die dominanten Landlebewesen, von denen der ausgestorbene Beutelwolf (oder Beuteltiger, Tasmanischer Tiger, Tylacine) ein bekanntes Beispiel ist. Der Wombat (ein Beutelbär), ist ebenso vertreten wie zahlreiche Känguru-Arten.
Da viele der nach Australien eingeschleppten europäischen Tierarten (hauptsächlich der Fuchs) und auch der selbst eingewanderte Dingo es nie bis nach Tasmanien geschafft haben, sind hier viele Tierarten erhalten geblieben, die auf dem Festland ausgestorben sind: Beuteldachse oder kleine Wallaby-Arten. Ein ebenfalls sehr bekanntes Beispiel einer für Tasmanien endemischen Tierart ist der Tasmanische Teufel, welcher auf dem australischen Festland bereits ausgestorben ist.
Wie auf dem Australischen Festland sind auch hier verschiedene Arten von Kletter-, Ring- und Gleitbeutlern zu finden. Diese sind wie Koalas oder Kängurus Beuteltiere und gehören seit eh und je zur Ur-Fauna Australiens. Die vorherrschenden Beuteltiere gehen ebenfalls auf Gondwana zurück. Auch der australische flugunfähige Straußenvogel, der Große Emu, stammt aus dieser Epoche. Die Hauptvertreter der Tierwelt Australiens, die Beuteltiere, haben, mit Ausnahme des Ökosystems Wasser, alle ökologischen Nischen besetzt. So unterscheidet sich die Meeresfauna Tasmaniens nur unwesentlich von der anderer Regionen dieses Breitengrades.
Auf dem Land blieben die Beuteltiere (Marsupiala) jedoch von außeraustralischen Einflüssen weitestgehend verschont. Selbst die extrem artenreiche Vogelfauna – obwohl weniger an Grenzen gebunden – setzt sich aus Gattungen zusammen, die zu 90 Prozent endemisch sind. Betrachtet man nur die Vogelarten, sind dies sogar 95 Prozent. Die Auswahl an höheren Säugetieren (Plazentatieren) beschränkte sich in voreuropäischer Zeit in Australien auf Nage- und Fledertiere (Fledermäuse und fliegende Hunde). Sie kamen vermutlich während des Miozäns aus dem Norden.
Die Fauna Tasmaniens ist noch um einiges artenärmer als die australische. So kommen dort nur etwa ein Fünftel der Beuteltier-, ein Zehntel der Nager- und ein Siebtel der Fledermausarten Australiens vor. Flughunde und Gleitbeutler sind ebenfalls nicht bis nach Tasmanien vorgedrungen. Diese Artenarmut darf jedoch nicht über die hohe Populationsdichte der Landtiere in Tasmanien hinwegtäuschen, die durch die vielseitige Küsten- und Meeresfauna noch ergänzt wird.
Im Gegensatz zum tasmanischen Beutelwolf konnte der tasmanische Teufel – vermutlich bedingt durch das Fehlen des Dingos in Tasmanien – bis heute überleben. Der tasmanische Beutelwolf (Thylacinus cynocephalus) wurde häufig auf Grund seines dunkelbraun-gelblich gestreiften Felles tasmanischer Tiger genannt. Sein lateinischer Name bedeutet ‘Beutelhund mit Wolfskopf’, was seinem Aussehen schon ziemlich nahe kam. Mit einer Rückenlänge von zirka 1,2 m hatte er in etwa die gleiche Größe wie unser europäischer Wolf und war in der Lage, auch größere Beutetiere zu reißen. Er jagte meist im Dunkeln oder zumindest in der Dämmerung und galt als langsam und etwas unbeholfen. Wahrscheinlich wurden ihm die ausgewilderten Hunde der frühen Kolonialzeit zum Verhängnis. Aber auch die Schafhirten stellten ihm nach, so dass er schon in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhundert sehr selten war. Im ausgehenden 19. Jahrhundert war er bereits eine außerordentlich begehrte Jagdtrophäe. Wann genau er ausgestorben ist, ist unsicher und in regelmäßigen Abständen tauchen immer wieder Augenzeugen auf, die einzelne Exemplare gesehen haben wollen. Obwohl gegenwärtig Tasmaniens Wildhüter mit der Suche nach Spuren betraut sind, blieben diese Gerüchte bislang unbestätigt.
Das Schnabeltier (Platypus) und der Ameisenigel (Echidna) aus der Unterklasse der Prototheria, deren phylogenetische Stellung noch bis heute unklar ist, zählen zu den skurrilsten Vertretern der australischen beziehungsweise tasmanischen Fauna. Beide, wenngleich Säugetiere, zählen aufgrund fehlender spezifischer Geschlechtsorgane, genau wie etwa die Vögel oder Reptilien, zu den Kloakentieren.
Das wichtigste Jagdwild der voreuropäischen Bevölkerung waren das Känguru, der Wombat und der Fuchskusu. Von den im Vergleich zu Australien wenigen Känguruarten war das graubraune Forester’s Känguru (Macropus major) die beliebteste Jagdbeute. Es wird bis zu eineinhalb Meter groß und trat in großen Herden auf. Bei den kleineren Känguruarten war vor allem das ‘Wallaby’ als Beute von Bedeutung. Der Nacktnasenwombat (Vombatus ursinus) lebt in unterirdischen Höhlensystemen und wurde als ergiebiger Fleischlieferant genutzt. Die Jagd nach dem Fuchskusu (Trichosurus vulpecula) war weit verbreitet aber sehr beschwerlich, da er sich meist in hohen Baumwipfeln aufhält.
Neben dem Emu wurde ein weiterer flugunfähiger Laufvogel gejagt. Der Tribonyx mostierii entspricht in seiner Gestalt unserem Rebhuhn. Ansonsten war die äußerst vielfältige Vogelfauna des tasmanischen Inlandes als Beute nicht von Bedeutung. Von den Reptilien, die in Australien neben den Beuteltieren die erfolgreichste Tiergruppe stellen, wurden in Tasmanien nur die größeren Arten verzehrt.
Nur drei der 140 australischen Schlangenarten sind auf der Insel heimisch. Alle drei gehören zur Gruppe der Elapidae und sind ausnahmslos giftig. In Tasmanien spielen Schnecken und Egel eine größere Rolle als auf dem trockenen Kontinent.
Von entscheidender Bedeutung war in Tasmanien die Küsten- und Meeresfauna. Wie bereits angedeutet, unterscheidet sie sich nicht wesentlich von der Fauna anderer Erdteile. In dem fischreichen Meer gab es auch eine Vielzahl Meeressäuger: Delphine, Wale, See-Elefanten, Robben und Seehunde. Die große Anzahl von Muscheln, Krebsen, Krabben und Hummer waren ein begehrtes Nahrungsmittel. An den Küsten nisteten Seevögel in großer Zahl, die jedoch teilweise als Zugvögel nur saisonal anzutreffen waren: Kormorane, Enten, Gänse, Schwarze Schwäne, verschiedene Wasserhuhnarten, Albatrosse, Reiher, Tölpel und der ‘mutton bird’ (Puffinus tenuirostris), ein Sturmvogel, der eine zentrale Rolle in der Nahrungsversorgung der Küstenbevölkerung spielte.
In diesem Zusammenhang noch von Interesse ist die am Ende der Eiszeit vor rund 25.000 bis 15.000 Jahren (Flood 1995:192 und Scarre 1990:68) ausgestorbene Megafauna. Diese beinhaltete auch größere Formen der rezenten Tierarten. Andere Gattungen sind mit ihrem Aussterben für immer verschwunden; so etwa das Diprotodon, das die Größe eines Nashorns erreichte. Die damaligen Formen des Tasmanischen Teufels und des Emus waren beträchtlich größer. Manche Känguruarten erreichten eine Höhe von drei Metern und auch Wombats von der Größe eines Esels sind belegt.
Die Gründe des Aussterbens sind noch nicht eindeutig geklärt; dennoch deutet einiges darauf hin, dass die voreuropäische Bevölkerung daran nicht unbeteiligt war (Flood 1995:136f und 281, Lourandos 1997:98-111, Wilpert 1987:21). Entgegen anders lautenden Behauptungen haben auch die Aborigines in ihrem Lebensraum Spuren hinterlassen. Ein Phänomen, das – lange verleugnet – auch bei Wildbeuterpopulationen anderer Erdteile zunehmend Bestätigung findet. Geringe Naturbeherrschung darf in diesem Zusammenhang nicht gleichgesetzt werden mit nicht vorhandener nachhaltiger Beeinflussung.
Natürlich war ihnen bewusst, dass der Raubbau an der Natur sie ihrer Lebensgrundlage entzieht. Diese Zusammenhänge hatten sie täglich vor Augen. Deshalb waren sie bemüht, ihre Ressourcen nicht über die Maßen zu strapazieren, was ihnen jedoch nicht immer gelang. Ein anderes Beispiel hierfür könnte die Ausrottung einer See-Elefantenart (Mirounga leonina) auf Tasmanien sein, für die Rhys Jones die prähistorische Bevölkerung verantwortlich macht (Jones 1966:67 nach Mulvaney/Golson 1987:90).
Naturschutz
Es gibt auf Tasmnien noch relativ viele naturbelassene Landschaftstypen. Etwa ein Viertel der Insel sind als UNESCO-Weltnaturerbe ausgewiesen, zu 37 % besteht die Insel aus Nationalparks. Während der meisten Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts herrschte in Tasmanien eine Politik der Ressourcenausbeutung. Holzeinschlag, Bergbau und die Eindämmung von Flüssen zur Nutzung der Wasserkraft waren wichtige Wirtschaftsfaktoren. Proteste von Umweltschützern gegen die geplante Überflutung des Lake Pedder für ein Wasserkraftwerk führten 1972 zur Gründung der United Tasmania Group (UTG), der ersten Grünen Partei der Welt. 2004 kündigte der australische Forstkonzern Gunns den Bau der weltweit größten Zellstofffabrik auf Tasmanien an. Dieses Vorhaben hat einen heftigen Kampf um den Schutz der tasmanischen Urwälder ausgelöst, die aufgrund der vielen endemischen Arten weltweit einzigartig sind. Immerhin sind in Tasmanien beeindruckende 36.522 km² geschützt, vor allem im Westteil der Insel. Dort liegt auch das UNESCO-Welterbe-Schutzgebiet Tasmanische Wildnis. Doch die potentiell wirtschaftlich interessanten Wälder sind nicht geschützt.
Tasmanien hat 19 Nationalparks, die von üppigen Regenwäldern im Westen bis zu weißen Sandstränden im Osten reichen. Sie schützen endemische Arten wie den Tasmanischen Teufel, den Beutelmarder und seltene Pflanzen wie die Huon Pine, die über 3.000 Jahre alt werden kann. Die Parks sind gut erschlossen, mit Besucherzentren, Wegen und Campingmöglichkeiten, wobei die meisten Eintrittsgebühren verlangen (zum Beispiel 40 AUD für einen Tagespass oder 96 AUD für einen Jahrespass für alle Parks, Stand 2025). Die TWWHA umfasst sieben Nationalparks, darunter Cradle Mountain-Lake St Clair, Franklin-Gordon Wild Rivers und Southwest, die für ihre Wildnis und geologische Bedeutung bekannt sind. Besonders eindrucksvoll sind die Landschaft am Cradle Mountain sowie die unberührte und teilweise schwer zugängliche Wildnis des Südwestens.
Einer der bekanntesten Nationalparks ist der Mount Field National Park. Seine Popularität verdankt er allem voran den Russel Falls. Hinter dem Namen verbirgt sich, wie sich wohl vermuten lässt, ein Wasserfall. Doch es ist keine gewöhnliche senkrecht in die Tiefe abfallende Wassersäule. Die Russel Falls lassen ihre Wassermassen in drei aufeinander folgenden Stufen in das Wasserfallbecken scheinbar hinab springen. Dieses schon malerisch anmutige Bild wird begleitet von einem grünen Einzug aus Bäumen, Büschen und anderen tropischen Gewächsen. Nicht ohne Grund sind die Russel Falls eines der beliebtesten Fotomotive bei Touristen aus aller Welt.
Klima
Das tasmanische Klima ist ozeanisch. Die Winter fallen dadurch relativ milde aus. Andererseits ist die Insel eine der wenigen Landmassen im Bereich der sogenannten „Donnernden Vierziger“ (Roaring Forties). Daher ist das Klima meist windig bis stürmisch, regnerisch und unbeständig. Alle Jahreszeiten lassen sich, besonders auf den Hochebenen, an einem Tag durchleben. Obwohl Tasmanien auf dem gleichen Breitengrad liegt wie Istanbul, Rom und Barcelona auf der Nordhalbkugel, ist das Klima kühler als auf dem Festland.
Das zentrale Gebirge teilt Tasmanien in zwei grundsätzliche Klimatypen: den humiden bis extrem humiden Westen (Niederschlagsmengen bis 3600 mm) und den gemäßigten bis trockenen Osten (Niederschlagsmengen bis unter 500 mm). Diese relative Trockenheit der östlich des Gebirges liegenden Gebiete kommt dadurch zustande, daß Westwinde vorherrschen. Zwischen der Ostküste Patagoniens und der Westküste Tasmaniens liegen 15.000 km kalter Südatlantik bzw. Südindischer Ozean, die von keiner Festlandsmasse unterbrochen sind, sodass die kaltfeuchten Luftmassen der „Roaring Forties“ zum ersten Mal auf die Westabdachung der tasmanischen Zentralgebirge prallen und sich dort abregnen.
Als Insel steht Tasmanien unter maritimem Einfluss, daher ist das Kleinklima regional stärker ausdifferenziert. Die zu Westeuropa um sechs Monate verschobenen Jahreszeiten sind weit weniger ausgeprägt. Die Winter sind mit Durchschnittstemperaturen von 0,5 bis 10,5°C mild und die Sommer mit 9 bis 19°C eher kühl. Dennoch kann es fast überall auf der Insel im Winter zu Nachtfrösten kommen und zu jeder Jahreszeit in den Höhenlagen Schnee fallen. Selbst im Sommer können die Bergkuppen oberhalb 1200 m, im Winter oberhalb 600 Meter schneebedeckt sein. In solchen Hochlagen kann die Temperatur im Januar bis -1°C und auf Extremwerte bis -10°C absinken. Das relativ milde Klima wird jedoch geprägt durch abrupte Wetterwechsel, den häufig starken Wind und die hohe Luftfeuchtigkeit.
Auch die Niederschlagsverteilung Tasmaniens ist weniger von jahreszeitlichen Schwankungen als durch die vorherrschende Windrichtung geprägt. Im Gegensatz zum australischen Festland, wo der Südostpassat seinen Einfluss geltend macht, ist die Insel ganzjährig zum Teil heftigen Westwinden ausgesetzt. Diese Donnernden Vierziger herrschen auf diesem Breitengrad auf der gesamten südlichen Erdhalbkugel und treffen hier ungebremst von Landmassen (die nächste ist Patagonien) auf Tasmanien. So ist der Westteil der Insel sowohl feuchter als auch kühler und hat darüber hinaus weniger Sonnenstunden pro Jahr als der Osten. Diese Temperaturunterschiede werden verstärkt durch den Einfluss einer warmen Meeresströmung im Osten und einer kalten, von der Antarktis kommenden, im Westen Tasmaniens.
Der feuchte Wind sorgt im Westen für jährliche Niederschläge von über 1500 mm mit Spitzenwerten bis zu 3800 mm. Im Osten sind Werte um 1500 mm jährlich die Ausnahme, zum Teil werden hier nur Werte um 400 mm erreicht. Vereinfacht dargestellt kann man sagen, dass die jährlichen Niederschläge Tasmaniens in West-Ost-Richtung kontinuierlich abnehmen. Verglichen mit dem aridesten Kontinent der Erde – Australien – sind selbst diese Werte im Osten der Insel noch hoch.

Klimadaten für Hobart (54 m, 1961 bis 1990)
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
| Mitteltemperatur (°C) | 16,3 | 16,1 | 15,1 | 12,4 | 10,5 | 8,3 | 7,8 | 8,8 | 10,6 | 11,8 | 13,6 | 15,1 | 12,2 |
| Niederschlag (mm) | 44 | 45 | 53 | 61 | 47 | 62 | 51 | 50 | 51 | 68 | 58 | 64 | 652 |
| Niederschlagstage >0,25 mm | 8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 14 | 180 |
| Potenzielle Verdunstung (mm) | 90 | 75 | 72 | 44 | 36 | 23 | 26 | 31 | 43 | 56 | 70 | 86 | 650 |
| L;uftfeuchtigkeit (%) | 58 | 61 | 64 | 66 | 70 | 73 | 72 | 68 | 63 | 61 | 60 | 60 | 64 |
| Sonnenstunden pro Tag | 7,7 | 7,0 | 6,4 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 4,4 | 5,1 | 5,9 | 6,1 | 7,2 | 7,3 | 5,9 |
| Wassertemperatur (°C) | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Klimadaten für Launceston (81 m, 1961 bis 1990)
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
| Mitteltemperatur (°C) | 17,7 | 18,2 | 16,1 | 12,9 | 10,2 | 8,1 | 7,4 | 8,5 | 10,4 | 12,3 | 14,5 | 16,5 | 12,7 |
| Niederschlag (mm) | 41 | 50 | 40 | 62 | 73 | 71 | 86 | 80 | 65 | 68 | 56 | 50 | 740 |
| Niederschlagstage >0,25 mm | 8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 | 11 | 10 | 149 |
| Potenzielle Verdunstung (mm) | 105 | 90 | 73 | 50 | 33 | 23 | 21 | 27 | 40 | 55 | 74 | 99 | 690 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 75 | 77 | 77 | 75 | 72 | 65 | 63 | 69 |
Klimadaten für Hobart (1881 bis 2013)
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
| Höchstrekord (°C) | 41,8 | 40,1 | 37,3 | 30,6 | 25,7 | 20,6 | 22,1 | 24,5 | 31,0 | 34,6 | 36,8 | 40,6 | 41,8 |
| Mittelmaximum (°C) | 21,7 | 21,7 | 20,1 | 17,3 | 14,4 | 12,0 | 11,7 | 13,1 | 15,1 | 17,0 | 18,7 | 20,3 | 16,9 |
| Mittelminimum (°C) | 11,9 | 12,0 | 10,9 | 9,0 | 7,0 | 5,2 | 4,6 | 5,2 | 6,4 | 7,8 | 9,3 | 10,8 | 8,3 |
| Tiefstrekord (°C) | 3,3 | 3,4 | 1,8 | 0,7 | −1,6 | −2,8 | −2,8 | −1,8 | −0,8 | 0,0 | 0,3 | 3,3 | −2,8 |
| Niederschlag (mm) | 47,3 | 40,1 | 45,0 | 51,4 | 46,5 | 54,1 | 51,8 | 53,6 | 53,5 | 61,4 | 54,1 | 56,4 | 615,2 |
| Wassertemperatur (°C) | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 13,8 |
| Niederschlagstage | 10,9 | 9,4 | 11,3 | 12,3 | 13,6 | 14,5 | 15,4 | 15,5 | 15,3 | 16,3 | 14,1 | 12,8 | 161,4 |
| Sonnenstunden | 248 | 206,2 | 198,4 | 159 | 130,2 | 117 | 136,4 | 155 | 177 | 201,5 | 207 | 229,4 | 2165,1 |
Klimadaten für Ellerslie Road (Battery Point, 1981 bis 2910)
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
| Höchstrekord (°C) | 41,8 | 40,1 | 39,1 | 31,0 | 25,7 | 20,6 | 22,1 | 24,5 | 31,0 | 34,6 | 36,8 | 40,6 | 41,8 |
| Mittelmaximum (°C) | 22,7 | 22,2 | 20,7 | 17,9 | 15,3 | 12,7 | 12,6 | 13,7 | 15,7 | 17,6 | 19,1 | 21,0 | 17,6 |
| Mittelminimum (°C) | 13,0 | 12,8 | 11,6 | 9,4 | 7,6 | 5,5 | 5,2 | 5,6 | 6,9 | 8,3 | 10,0 | 11,6 | 9,0 |
| Tiefstrekord (°C) | 3,3 | 3,4 | 1,8 | 0,7 | −1,6 | −2,8 | −2,8 | −1,8 | −0,8 | 0,0 | 0,3 | 3,3 | −2,8 |
| Niederschlag (mm) | 43,7 | 37,8 | 37,0 | 42,6 | 39,2 | 46,0 | 44,5 | 63,0 | 55,6 | 52,8 | 50,7 | 53,0 | 565,9 |
| Niederschlagstage (≥ 0,2 mm) | 9,5 | 9,1 | 11,3 | 11,1 | 12,0 | 12,4 | 14,1 | 15,3 | 15,7 | 15,0 | 13,5 | 11,7 | 150,7 |
| Luftfeuchtigkeit nachmittags (%) | 51 | 52 | 52 | 56 | 58 | 64 | 61 | 56 | 53 | 51 | 53 | 49 | 55 |
| Sonnenstunden | 257,3 | 226,0 | 210,8 | 177,0 | 148,8 | 132,0 | 151,9 | 179,8 | 195,0 | 232,5 | 234,0 | 248,0 | 2393,1 |
| Sonnenstundenanteil in % | 59 | 62 | 57 | 59 | 53 | 49 | 53 | 58 | 59 | 58 | 56 | 53 | 56 |
| Meerestemperatur (°C) | 16,9 | 16,4 | 16,4 | 15,4 | 14,6 | 13,6 | 12,9 | 12,7 | 12,7 | 13,1 | 14,4 | 15,9 | 14,6 |
| Ultraviolettindex | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5,3 |
Mythologie
Die Mythologie Tasmaniens, oder Lutruwita, wie die Insel in der Sprache der palawa (die indigenen Tasmanier) genannt wird, ist tief in der Kultur der palawa verwurzelt, die die Insel seit etwa 40.000 Jahren bewohnen. Diese Mythen sind eng mit dem Land, der Natur und der spirituellen Verbindung zur Umwelt verknüpft, ähnlich dem „Dreaming“ oder „Traumzeit“-Konzept anderer aboriginaler Kulturen Australiens. Allerdings ist die tasmanische Mythologie aufgrund der kolonialen Zerstörung – einschließlich Genozid, Krankheiten und Zwangsumsiedlungen im 19. Jahrhundert – nur fragmentarisch überliefert. Die Überlieferung erfolgte mündlich, und vieles ging mit dem fast vollständigen Aussterben der Vollblut-Population bis 1876 verloren. Dennoch werden heute durch die palawa-Community, wie die Tasmanian Aboriginal Corporation, Teile der Traditionen revitalisiert, basierend auf Aufzeichnungen von Missionaren, Siedlern und frühen Forschern.
Ein zentraler Schöpfungsmythos der palawa bezieht sich auf die beiden Schöpfergottheiten Moinee und Droemerdene, die als Kinder von Parnuen (der Sonne) und Vena (dem Mond) gelten. Moinee wird als guter Schöpfer beschrieben, der die Welt formt, Tiere und Menschen erschafft und für Harmonie sorgt. Droemerdene hingegen ist sein böser Zwilling, der Chaos und Zerstörung bringt – eine Dualität von Gut und Böse, die in vielen aboriginalen Mythen vorkommt. Diese Figuren symbolisieren die Entstehung der Landschaft Lutruwitas: Flüsse, Berge und Wälder entstanden durch ihre Handlungen.
Ein weiterer Mythos erzählt von der Migration der ersten Menschen aus einem fernen Land, die zu Fuß kamen und dann durch eine große Flut getrennt wurden. Dies spiegelt die reale prähistorische Verbindung Tasmaniens mit dem australischen Festland wider, die vor etwa 10.000–13.000 Jahren durch das Ansteigen des Meeresspiegels (Bass-Straße) unterbrochen wurde. Die Flut wird als göttliche Handlung interpretiert, die die palawa isolierte und ihre einzigartige Kultur formte.
Tiere spielen eine prominente Rolle in den Mythen, da sie oft als Ahnen oder Schöpfungsgeister gelten. Der Känguru-Mythos ist besonders bedeutsam: Der Känguru, bekannt als Tarner, ist ein Schöpfungsgeist und Vorfahr von Parlevar, dem „ersten Menschen“. Durch Verwandtschaftspflichten band Tarner die palawa an das Land – er symbolisiert Identität, Jagd und spirituelle Bindung. Wenn ein Känguru getötet wurde, errichteten die palawa Hütten aus Grünzeug über den Knochen, um himmlische Turbulenzen zu vermeiden, was die tiefe Respekt vor dem Tier unterstreicht.
Ähnlich mythisch aufgeladen ist der Thylacin (Tasmanischer Tiger), der in Tänzen und Geschichten als Schutzgeist oder bedrohliches Wesen vorkommt. In einem Tanz, den der Missionar James Backhouse 1833 auf Flinders Island beobachtete, wird der Tiger dargestellt, wie er Kinder bedroht und verwundet wird – ein Symbol für Gefahr und Überleben. Trotz seiner Ausrottung in den 1930er Jahren lebt der Thylacin in modernen Legenden fort, mit angeblichen Sichtungen, die den Mythos von der „ewigen Abwesenheit“ nähren.
Orte wie Toogee Low (Port Davey) im Südwesten gelten als Wohnstätten von „Teufeln“ oder bösen Geistern, die in der Mythologie als Wächter der Wildnis erscheinen. Diese Mythen dienten auch als Erklärungen für Naturphänomene wie Stürme oder Überschwemmungen.
Die palawa-Mythen sind nicht nur Erzählungen, sondern Gesetze und Anleitungen für das Leben: Sie regeln Jagd, Landnutzung und soziale Beziehungen. Die Traumzeit-Idee – eine ewige Gegenwart, in der Ahnen die Welt prägten – verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Heute werden diese Mythen in Initiativen wie dem palawa kani (der rekonstruierten Sprache) und kulturellen Spaziergängen (zum Beispiel Wukalina Walk) wiederbelebt, um die Verbindung zur Lutruwita zu stärken.
Neben den indigenen Mythen entstanden koloniale „Mythen“ über die palawa, die bis heute widerlegt werden müssen. Der berühmte Aussterbe-Mythos – dass die Tasmanier mit dem Tod von Truganini 1876 ausgestorben seien – diente der Rechtfertigung der Kolonisation. Tatsächlich überlebten Nachkommen (etwa aus Beziehungen mit Robbenjägern auf den Bass-Strait-Inseln), und die palawa-Community zählt heute Tausende. Ein weiterer Mythos war die „Primitivität“ der Palawa, dass sie kein Feuer entzünden konnten - eine Fehldeutung, die ihre komplexe Kultur ignorierte.
Geschichte
Das heutige Tasmanien wurde bereits vor 40.000 bis 35.000 Jahren von Norden aus über die damalige Festlandverbindung zu Australien besiedelt. Die Überflutung der Bass-Straße vor etwa 12.000 Jahren isolierte die Tasmanier von den Aborigines des Kontinents, so dass kulturelle und technische Innovationen nicht mehr ausgetauscht werden konnten. Zum Zeitpunkt der europäischen Entdeckung lebten vermutlich zwischen 4.000 und 6.000 Tasmanier auf der Insel.
Zeit der Palawa
Die Tasmanier, auch als Palawa oder Pakana bekannt, sind Nachfahren der ersten Menschen, die vor etwa 40.000 bis 35.000 Jahren nach Australien migrierten, als der Kontinent noch über Landbrücken mit Neuguinea verbunden war. Vor etwa 10.000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit, stieg der Meeresspiegel, und Tasmanien wurde durch die Bass-Straße vom australischen Festland getrennt. Dies führte zur Isolation der tasmanischen Bevölkerung, die sich kulturell und genetisch eigenständig entwickelte.
Die Tasmanier lebten als Jäger und Sammler in kleinen, nomadischen Gruppen von etwa 20 bis 50 Personen, die in Clans organisiert waren. Archäologische Funde, wie Werkzeuge aus Stein und Knochen, Muschelhaufen (Middens) und Felsmalereien, deuten auf eine gut angepasste Lebensweise hin. Sie nutzten die reichen Ressourcen der Insel, darunter Meerestiere (wie Robben und Schalentiere), Kängurus, Wallabys und Pflanzen. Feuer war ein zentrales Element ihrer Kultur, sowohl für die Jagd als auch für die Landschaftspflege, um offene Flächen für die Tierjagd zu schaffen.
Die tasmanische Gesellschaft war stark mit dem Land verbunden. Ihre Spiritualität drehte sich um die Natur, und es gab komplexe Rituale, Tänze und Geschichten, die mündlich überliefert wurden. Sprachlich waren die Tasmanier vielfältig: Es gab schätzungsweise fünf bis neun verschiedene Sprachen oder Dialekte, obwohl die genaue Zahl schwer zu bestimmen ist, da viele durch die Kolonisierung verloren gingen.
Die Tasmanier waren geschickte Handwerker. Sie stellten einfache, aber effektive Werkzeuge her, wie Speere, Wurfhölzer und Netze, und bauten schwimmfähige Boote aus Rinde oder Schilf, um Flüsse zu überqueren oder Küstengewässer zu nutzen. Ihre Kleidung bestand häufig aus Tierfellen, und sie schmückten sich mit Muscheln oder Ocker.
Ein oft diskutiertes Thema ist der technologische Wandel: Archäologische Beweise deuten darauf hin, dass die Tasmanier nach ihrer Isolation bestimmte Technologien, wie Bumerangs oder bestimmte Angelmethoden, nicht weiterentwickelten oder verloren, was möglicherweise auf die begrenzten Ressourcen der Insel oder die kulturelle Anpassung zurückzuführen ist. Dennoch zeigt ihre Fähigkeit, in einer rauen Umgebung zu überleben, ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit.
Bis zum 18. Jahrhundert lebten die Tasmanier weitgehend isoliert von der Außenwelt. Es gibt keine Hinweise auf Kontakte mit anderen Kulturen, wie den Polynesiern oder anderen indigenen Gruppen Australiens, nach der Trennung durch die Bass-Straße. Die Bevölkerungszahl wird auf etwa 3.000 bis 15.000 Menschen geschätzt, aufgeteilt in mehrere Stämme, die über die Insel verteilt waren.
Die tasmanische Kultur war stabil, aber die Isolation machte die Bevölkerung anfällig für die dramatischen Veränderungen, die mit der Ankunft der Europäer bevorstanden. Die ersten dokumentierten Kontakte mit Europäern fanden im späten 18. Jahrhundert statt, beginnend mit den Entdeckungsreisen europäischer Seefahrer.
Entdeckungszeit
Europäische Historiker geben meist als offiziellen Entdecker Australiens den Holländer Willem Jansz an. Im Zuge der Kolonialisierung von Indonesien passierten zu dieser Zeit viele holländische Frachtschiffe den indischen Ozean. Jansz machte 1606 den Versuch, an der Westküste der australischen Yorkhalbinsel bei Mapoom zu landen, wurde jedoch von den Aborigines in die Flucht geschlagen. 200 Meilen weiter südlich erlaubten ihm die Mitglieder der Aurukum an Land zu gehen. Umgehend begannen sie eine Siedlung zu errichten. Anfangs war das Verhältnis zu den Einheimischen entspannt; als aber die Siedler eine Aboriginal entführten, kam es zu blutigen Auseinandersetzungen. Die Hälfte der Holländer kam dabei ums Leben und die Siedlung wurde aufgegeben.
Bis zu diesem Zeitpunkt war Australien - beziehungsweise ‘Neuholland’, wie es im 17. und 18. Jahrhundert genannt wurde - auf keiner Weltkarte erfasst; dennoch kursierte bereits viel früher das Gerücht über die Existenz eines Südkontinents (terra australis). In Europa war man überzeugt, dass im Süden der Erdhalbkugel noch eine weitere größere Landmasse existieren müsse, da es sonst unmöglich sei, dass die Erde in ihrer Achse die Balance halten könne.
Bereits Anfang des 16. Jahrhunderts bereisten portugiesische Schiffe den Westpazifik. Neuguinea wurde 1525 von den Spaniern und Portugiesen entdeckt. Vermutlich ist es den Portugiesen zu verdanken, dass bereits im ausgehenden 16. Jahrhundert, circa zehn Jahre vor der Landung von Jansz, in England eine, wenn auch sehr grobe Karte von Australien existierte (Przemyslaw 1990:89f).
Selten findet dieser Umstand in der Entdeckungsgeschichte Australiens Erwähnung. Dabei war der Gelehrte Richard Henry Major bereits Mitte des letzten Jahrhunderts aufgrund einer (anderen) Karte von der Entdeckung des australischen Kontinents durch die Portugiesen überzeugt: „Die Tatsachen, die ich zusammenbringen konnte, haben mich zum Schluss geführt, dass das von mir erwähnte Land, das auf französischen Karten als Java - la - Grande bezeichnet wird, nichts anderes als Australien sein kann, und dass es vor 1542 entdeckt wurde, kann fast als erwiesen gelten. [...] Wir müssen deshalb zum Schluss gelangen, [...] dass die Entdeckung des Kontinents Neu-Holland den Portugiesen zuzuschreiben ist. The facts which I have been able to bring together lead me to the conclusion that the land described as Java - la - Grande on the French maps to which I have reffered can be no other than Australia, and that it was discovered before 1542 may be almost accepted as demonstrable certainity. [...] We must therefore come to the conclusion [...] that the discovery of the continent New Holland belongs to the Portuguese“ (Mc Intyre 1977:200).
Kenneth Mc Intyre hat diese Theorie 1977 wieder aufgegriffen und kommt zu dem Ergebnis, dass die Portugiesen bereits in den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts Australien betreten hatten. Im selben Jahr führte Mc Kiggan seine Recherche zum gleichen Resultat. Er datiert die Entdeckung von Australien durch Europäer (Portugiesen) auf das Jahr 1522 (Mc Intyre 1977:200; Mc Kiggan 1977). Es gibt sogar Hinweise, dass die Portugiesen bereits in Tasmanien landeten (Robson 1983:3). Wie dem auch sei; Logbücher oder andere schriftliche Quellen aus dieser Zeit liegen nicht vor, weshalb diese Epoche in diesem Zusammenhang nur von sekundärer Bedeutung ist.
Ebenfalls selten Erwähnung in der Geschichtsliteratur finden nichteuropäische Meeresexpeditionen in der australischen Entdeckungsgeschichte. Die Nordküste Australiens war den Seefahrern des malaiischen Archipels bereits lange vor Ankunft der Europäer bekannt (Wopfner 1997:1). Spätestens seit dem 15. Jahrhundert waren Handelsreisende aus Neuguinea in den Inseln der Torresstraße und der Kap-York-Halbinsel präsent (Przemyslaw 1990 : 91f). Auch zwischen den Bugis aus Sulawesi und den Aborigines Nord- und Westaustraliens herrschten langjährige Handelsbeziehungen (Przemyslaw 1990 : 91ff). Ihr Hauptinteresse galt der Seegurke (Holoturia nobilis), die damals wie heute in Asien und dort vor allem in China als Delikatesse gehandelt wurde. Der Seegurke, bekannter unter dem Namen Trepang, wurden große Heilwirkung und magische Eigenschaften (Aphrodisiakum) zugeschrieben. In Australien wurde sie gefischt und konserviert. Eine Saison dauerte vier bis fünf Monate. Zwischen dem 15. Jahrhundert bis ins ausgehende 18. Jahrhundert, beeinflussten diese Handelsbeziehungen die Kultur der Küstenbevölkerung in Nord- und Nordwestaustralien sowie an der Torresstraße nachhaltig (Przemyslaw 1990:92; Wilpert 1987:128ff). Im Tauschhandel erwarben sie metallene Äxte, Messer und Speerspitzen. Sie erlernten den Bau von Booten mit Auslegern, übernahmen Melodien, Musikinstrumente und sogar ein chinesisches Kartenspiel. In Sprachen und Bräuchen machten sich diese Einflüsse ebenfalls geltend. Es kam zu einer ausgeprägteren Sesshaftigkeit und einer strafferen, politischen Organisation.
Dessen ungeachtet waren es die Holländer, die neue Kunde über den Südkontinent nach Europa brachten und damit eine neue Ära einläuteten. Nach Willem Jansz, dem ‘Entdecker’ Australiens, kamen noch Jan Carstensz, Frederick de Houtman, Dirk Hartog, Willem de Vlamingh, François Pelsaert, Pieter Nuysz und viele andere Holländer, die meist in Handelsschiffen unterwegs waren, um Gewürze, Gold und andere Güter aufzunehmen.
Der ruhmreichste unter ihnen war Abel Janszoon Tasman, der als Entdecker Tasmaniens gilt. Tasman erreichte Tasmanien am 24. November 1642 und nannte es zu Ehren des damaligen Generalgouverneurs von Niederländisch-Ostindien, Antony van Diemen, ‘Van Diemensland’. Er war von Batavia aus aufgebrochen und erreichte mit der ‘Heemskerck’ und der ‘Zeahaen’ nach 72 Tagen die Insel. Er war ein erfahrener Navigator und hatte den Auftrag, den Südkontinent aufzusuchen und dort die Gegend zu erkunden. Außerdem sollte er eine Seeroute durch den Pazifik nach Südamerika suchen, um neue Märkte und Ressourcen zu erschließen, was ihm auch beides gelang.
Überhaupt müsste Abel Tasman aufgrund seiner geografischen Entdeckungen in einem Zuge mit den ganz großen Entdeckern und frühen Seefahrern genannt werden: Er entdeckte Tasmanien, Neuseeland und die Route südlich an Tasmanien vorbei durch den Pazifik nach Südamerika. Er war auch der Erste, der das ganze Ausmaß Neuhollands (Australiens) erkannte. Tasman erforschte die Nordküste Australiens (1644) vom heutigen Staat Western Australia, den er ‘Eendrachtland’ nannte, über den Golf von Carpentaria bis nach Queensland (‘Carpentaria’). Bei dieser Gelegenheit stellte er fest, dass Neuguinea durch eine Meerenge (Torresstraße) von Australien getrennt war. Eine beeindruckende Leistung, die ihm jedoch nie wirklich zu Ruhm und Ansehen verhalf.
Das hatte einen einfachen Grund: Tasman war zwar der Entdecker Tasmaniens, entdeckte aber nicht die Einwohner der Insel, wie manchmal behauptet wird. Er erkannte zwar, dass die Insel bewohnt war, bekam aber deren Bewohner nie zu Gesicht. Auf all seinen Reisen ließ er, obwohl kühner Seefahrer, beim Kontakt mit ‘Wilden’ äußerste Vorsicht walten, und wenn es sich vermeiden ließ, verzichtete er ganz darauf. Diese Behutsamkeit wurde ihm bereits zu Lebzeiten von offizieller Seite vorgeworfen, verhinderte seinen Ruhm, begünstigte aber gleichzeitig sein Privileg, als Entdecker eines natürlichen Todes zu sterben.
Er ging 1642 an der Ostküste Tasmaniens vor Anker und war genötigt, seine Wasservorräte aufzufrischen. Ihm klangen noch die damals gängigen Gerüchte in den Ohren die besagten, diese entlegene Weltgegend sei die Heimat von Monstern und Riesen. Deshalb beschränkte er die Landgänge auf das Allernötigste. Einer seiner Leute entdeckte zwei 18 bis 20 Meter hohe Bäume mit einem Umfang von zirka vier Metern, in die Kerben eingeschlagen waren. Sie deuteten diese Kerben richtig als Kletterhilfe der einheimischen Bevölkerung, dachten aber damals, diese dienten dem Ausnehmen von Vogelnestern. Tatsächlich waren sie für die Possumjagd geschlagen worden. Der Abstand der in gerader Linie nach oben verlaufenden Kerben schien Tasmans Befürchtungen zu bestätigen. Die Distanz zwischen den Kerben betrug circa eineinhalb Meter, woraus er schloss, „dass diese Menschen entweder von ungeheurer Größe sind oder eine gewisse Art haben, auf Bäume zu klettern, an die wir nicht gewöhnt sind“. Obwohl letzteres zutraf, ging Tasman von einer riesenhaften Bevölkerung aus und gab somit den in Europa bestehenden Gerüchten neue Nahrung. Nach dieser Beobachtung näherte er sich nur noch einmal vorsichtig dem Ufer, ließ einen seiner Leute an Land schwimmen, der dort die holländische Flagge hisste, und verließ die Insel mit dem Hinweis, dass eine plötzliche Wetteränderung eine weitere Landung unmöglich mache. Für die folgenden 130 Jahre sind keine weiteren Landungen auf der Insel belegt. Über 200 Jahre trug sie den Namen ‘Van Diemensland’ und wurde erst 1853 in Tasmanien umbenannt.
Demnach war der französische Kapitän Marc-Joseph Marion du Fresne, der Leiter der zweiten europäischen Expedition der Erste, der Kontakt zu den tasmanischen Aborigines hatte. Er legte unweit Tasmans Landeplatz an der Ostküste der Insel an, um ebenfalls frische Holz- und Wasservorräte aufzunehmen. Er hatte den Auftrag, mit seinen Schiffen ‘Le Mascarin’ und ‘Le Marquis de Castries’ neue Handelsrouten ausfindig zu machen und eine kürzere Route nach China zu suchen. Du Fresne und seine Begleiter Jules Crozet und Saint-Allouarn entdeckten auf ihren Reisen im Indischen Ozean die Crozetinseln. Sie waren in erster Linie Seefahrer und verfügten über keinerlei wissenschaftliche Kenntnisse. Ihr Weltbild war geprägt von der bahnbrechenden Arbeit Rousseaus, weshalb Fresne im Gegensatz zu Tasman keine Monster, sondern „edle Wilde„ (nobles sauvages) anzutreffen erwartete: Nackte, glückliche Menschen in ihrem Urzustand, eingebettet in einen Garten Eden (Robson 1983:6; Bonwick 1870:2).
Konsequenterweise waren die Europäer beim Erstkontakt ebenfalls unbekleidet (Ryan 1981:50), um Barrieren abzubauen und eventuelles Misstrauen bereits im Keim zu ersticken. Am Morgen des 7. März 1772 näherten sie sich mit zwei Booten der Küste von North Bay. Eine dreißigköpfige Gruppe Aborigines lief ihnen am Strand entgegen. Deren Frauen und Kinder suchten jedoch Zuflucht in den angrenzenden Wäldern.
Einer der Männer löste sich von der Gruppe und kam auf sie zu, blieb dann im Wasser stehen und machte den Franzosen Zeichen näherzukommen. Zwei Besatzungsmitglieder schwammen auf Du Fresnes Zeichen nackt zum Strand. Dort angekommen wurde ihnen von einem älteren Aboriginal eine Fackel überreicht. Diese Geste werteten die zwei Franzosen als Zeichen des Friedens und quittierten sie, indem sie dem Mann einen Spiegel aushändigten. Dieser wurde reihum gereicht und löste, ebenso wie die Hautfarbe der Neuankömmlinge, großes Erstaunen aus. Nach einer eingehenden Untersuchung der beiden Seeleute legten die Einheimischen die Speere beiseite und begannen vor ihnen zu tanzen.
Zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Kontaktes legten die Europäer mit zwei Booten an und bekamen ebenfalls Fackeln überreicht. Im Gegenzug übergaben sie einige Stoffreste und Messer. Die harmonische Stimmung schlug um in helle Aufregung, als sich ein drittes Boot der Franzosen dem Ufer näherte. Aufs Äußerste erregt versuchten die Einheimischen, diese Landung mit Gesten und Rufen zu verhindern. Du Fresne gab der Mannschaft des Bootes Signal zum Umkehren. Das Boot wurde jedoch von der Brandung ans Ufer getragen. Daraufhin ging ein Hagel von Speeren und Steinen auf die Franzosen nieder. Du Fresne und einige seiner Männer wurden von den Steinen verletzt und eröffneten das Feuer. Ein Aborigine kam dabei ums Leben und mehrere wurden verletzt. Der Rest ergriff panisch schreiend die Flucht.
Die Franzosen verließen die Insel und segelten weiter nach Neuseeland. Der Kontakt mit den Māori auf Neuseeland kostete Marion du Fresne das Leben. Er und einige Mitglieder der Mannschaft wurden von den Māori in einen Hinterhalt gelockt, getötet und angeblich verspeist (Robson 1983:6). Als der bedeutendste Chronist dieser Expedition, Crozet, nach seiner Heimkehr Rousseau diese Ereignisse schilderte, entgegnete dieser zutiefst bestürzt: „Ist es möglich, dass die guten Kinder der Natur wirklich so böse sein können?“ (nach Ryan 1981:50).
Ein Jahr darauf war Captain James Cook auf der Endeavour in den Gewässern südlich von Tasmanien unterwegs. Nachdem er dort auf der Suche nach Land gekreuzt war, wollte er Tasmanien anlaufen. Dieser Plan wurde durch die Wetterverhältnisse vereitelt und er segelte weiter nach Neuseeland. Den Kontakt zu seinem Begleitschiff ‘Adventure’ unter dem Kommando von Tobias Furneaux hatte er jedoch aufgrund dichten Nebels verloren. Furneaux warf am verabredeten Treffpunkt vor Tasmanien Anker und unternahm mehrere Landexpeditionen. Bei seinem fünftägigen Aufenthalt in der nach seinem Schiff benannten Adventure Bay östlich von Bruni Island kam es zu keinem Kontakt mit der tasmanischen Bevölkerung. Anhand seiner Beobachtungen schloss er, dass sie weder feste Siedlungen noch Boote kannten und bezeichnete sie als elende, ignorante Rasse, die völlig außerstande sei, die Privilegien des guten Klimas und der üppigen, fruchtbaren Landschaft zu nutzen (Völger 1971:24; Robson 1983:27).
Nach dem Ausbleiben von Cook machte sich Furneaux auf den Weg nach Neuseeland, wo dieser dann ebenfalls eintraf. Cook sollte erst auf seiner dritten Reise Tasmanien zu Gesicht bekommen. Auf der Resolution landete er am 26. Januar 1777 ebenfalls in der Adventure Bay und blieb vier Tage. Cook, der bereits seit langem von Tasmanien fasziniert war, äußerte als Erster den Verdacht, Tasmanien könnte eine Insel sein. Bisher war man der Auffassung, dass Tasmanien den südlichsten Ausläufer Australiens bilde. Dieser Gedanke beschäftigte ihn bereits 1773 auf seiner zweiten Reise. Aus Zeitgründen war er gezwungen, diese Frage auf sich beruhen zu lassen. Denn sein eigentlicher Auftrag lautete, eine geeignete Seeroute zwischen Pazifik und Atlantik zu suchen.
Cooks Entdeckerdrang erschöpfte sich glücklicherweise nicht in geografischen Fragestellungen. Er war ebenfalls von Rousseaus Thesen fasziniert und auf der Suche nach „Wilden“ in ihrem vermeintlichen Urzustand. So war er beeindruckt von der Kultur der australischen Aborigines: „Nach dem, was ich über die Eingeborenen von Neuholland gesagt habe, könnten sie Einigen als das armseligste Volk auf der Welt erscheinen, doch in Wirklichkeit sind sie viel glücklicher als wir Europäer; ohne jede Kenntnis nicht nur der überflüssigen, sondern auch der notwendigen Bequemlichkeiten, die man in Europa so sehr sucht, sind sie eben darin glücklich, nicht zu wissen, wozu diese dienen. Sie leben in einer Ruhe, die nicht durch soziale Ungleichheit der Lebensbedingungen gestört wird“ (Heintze 1987:70).
Diese ihm eigene Mischung aus Neugier und Toleranz führte dazu, dass sein Aufenthalt des Öfteren als der erste von ethnologischem Wert bezeichnet wird (Ryan 1981:51). Cook kam von dieser dritten Reise nicht nach Europa zurück. Er wurde 1779 auf Hawaii getötet. Um so einflussreicher waren die Aussagen von Cooks Offizier William Anderson, der das Bild der tasmanischen Aborigines in Großbritannien entscheidend beeinflusste.
Während Cooks Aufzeichnungen viele wertvolle Details über Aussehen, Schmuck, Frisur und Verhaltensweisen lieferten, war Anderson voller Abscheu gegenüber der angetroffenen Bevölkerung: Es war ihre Schamlosigkeit, die ihn überforderte. Bereits die Franzosen amüsierten sich über die Angewohnheit der Aborigines, in aller Öffentlichkeit mit dem Penis zu spielen. Ebenso kam es vor, dass sie im Stehen, ohne im geringsten ihre Stellung zu verändern - teilweise sogar während einer Unterhaltung - Wasser abschlugen, so dass der Urin ihre Beine hinunter lief. Dazu kam, dass beiderlei Geschlechter in der Regel völlig nackt waren (Robson 1983:27). Anderson und die meisten seiner Landsleute waren darüber derart entsetzt, dass sich in Großbritannien Unmut und Abscheu gegenüber den Aborigines breitzumachen begann.
In dieser intoleranten Haltung unterschieden sich die britischen Entdecker generell von den französischen. Das ist einer der Gründe, warum die wertvollsten ethnografischen Daten dieser Epoche auf die Franzosen zurückgehen. Ihre Motivation war auch weitaus weniger von Besitzansprüchen, strategischen Überlegungen, Handels- und Wirtschaftsinteressen geprägt als die der Briten. Die Franzosen standen unter dem Einfluss Rousseaus, Lafiteaus und anderen und waren geprägt von den Idealen der aufkommenden Französischen Revolution. Cooks Beschreibungen seiner Kontakte zu den Einheimischen müssen, obwohl reich an Details, wegen der Kürze seines Aufenthaltes viele Fragen offen lassen.
1775 bis 1783 kämpfte Großbritannien im Nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Am 4. Juli 1776 erklärten die dreizehn Kolonien ihre Unabhängigkeit von Großbritannien, und 1783 musste Großbritannien diese Unabhängigkeit im Frieden von Paris anerkennen. Dies war die bedeutendste Niederlage der Kolonialmacht Großbritannien. Aufgrund dieser Niederlage verstärkte Großbritannien seine imperialistischen Bestrebungen noch weiter.
Im Mai 1787 brach Gouverneur Arthur Phillip mit elf bewaffneten Schiffen von Großbritannien aus in Richtung Australien auf. Sein Ziel war die Botany Bay an der Ostküste Australiens, die von dem deutschen Geografen und Naturforscher Johann Reinhold Forster und seinem Sohn Georg Forster als Land Eden beschrieben wurde. Nach siebenmonatiger Überfahrt ging die Flotte vor Botany Bay vor Anker. Bei näherer Erkundung stellte sich die Bucht als völlig ungeeignet zur Besiedlung heraus. Sie segelten weiter, entdeckten den Naturhafen des heutigen Sydney und gründeten 1788 die erste australische Siedlung Port Jackson. Bis Ende des 18. Jahrhunderts blieb dies die einzige größere Ansiedlung in Australien. Erst 1803 folgte eine zweite auf Tasmanien. Port Jacksons Bevölkerung bestand aus den insgesamt 1.500 Passagieren, die Gouverneur Arthur Phillip begleiteten. Dies waren Staatsbeamte, Soldaten und 757 deportierte Strafgefangene, darunter 192 Frauen und 18 Kinder (Przemyslaw 1990:95).
Den europäischen Geschichtsschreibern zufolge gaben die ersten Siedler Geschenke im Tausch gegen das Land. Dennoch musste die Siedlung, die bis 1816 ausschließlich aus Holzhäusern bestand, mit starken Palisaden umgeben und bis 1840 ständig militärisch bewacht werden. Immer wieder kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit australischen Aborigines.
Die Gründung der Siedlung Port Jackson in Ostaustralien ist für die Entdeckungsgeschichte Tasmaniens von zentraler Bedeutung. Da man immer noch überzeugt war, dass Tasmanien eine Halbinsel des australischen Kontinents sei, nahmen alle von Europa kommenden Schiffe auf dem Weg nach Port Jackson zunächst Kurs auf die Südspitze Tasmaniens und gingen häufig an der tasmanischen Ostküste kurz vor Anker. Ab diesem Zeitpunkt war der Anblick von Europäern für die Ostküstenbevölkerung Tasmaniens keine Seltenheit mehr.
Der nächste nachgewiesene Kontakt fand im August 1788 statt. Der Engländer William Bligh ging mit der „Bounty“ in der Adventure Bay vor Anker. Er war auf dem Weg von Tahiti zu den Westindischen Inseln und hatte Setzlinge des Brotfruchtbaumes geladen. Bligh wusste, was ihn erwartete, denn er war bereits elf Jahre zuvor als Navigator auf Cooks dritter Reise hier gewesen. Tasmanien lag für die Briten strategisch so günstig, dass Blighs Besatzung in der Adventure Bay nahe einer Quelle eine Reihe von Obstbäumen pflanzte, um nachfolgenden Reisenden die Proviantaufnahme zu erleichtern. Die Kontakte mit der Bevölkerung von Bruni Island verliefen friedlich: Als sie die Landungsboote entdeckten, reckten sie die Arme über den Kopf und verfielen Bligh zufolge in ein aufgeregtes ‘Geschnatter’, das ihn an Gänse erinnerte. Alle dargereichten Geschenke legten sie sich nach kurzer Prüfung auf den Kopf (Gould 1980 : 9; Turnbull 1963 : 35).
Die Bandbreite des Umgangs mit Geschenken der europäischen Entdecker reichte von völliger Ablehnung bis zur totalen Verzückung, wobei die Briten eine Ablehnung meist als persönliche Beleidigung empfanden. Die Franzosen wiederum sahen diese ablehnende Haltung mit Wohlwollen (Robson 1983:26f), da sie ihr Bild der Vollkommenheit des paradiesischen Urzustandes bestätigt sahen. Möglicherweise handelt es sich bei Blighs Kontakt um dieselben Familien, die bereits Cook elf Jahre zuvor aufsuchte (Völger 1971:26). Sein kurzer Bericht enthält jedenfalls keine wichtigen Neuerungen. Erst kurze Zeit später wurde entdeckt, dass die Adventure Bay nicht an der Küste Tasmaniens, sondern an einer ihr vorgelagerten bewohnten Insel lag.
Blighs eigentliche Mission, der Transport der Brotfruchtbäume zu den Westindischen Inseln, schlug wegen der berühmt gewordenen Meuterei auf der Bounty fehl. Dennoch wurde er vier Jahre später noch einmal mit dem gleichen Auftrag betraut und ankerte auch dieses Mal am 8. Februar 1792 in der Adventure Bay vor Bruni Island. Nur eine einzige seiner Pflanzen, ein Apfelbaum, hatte überlebt. Bei diesem zweiwöchigen Aufenthalt (seinem dritten und letzten) machte er eine Vielzahl interessanter Beobachtungen und spekulierte bereits über ethnologische Problemstellungen, die bis heute nicht zufriedenstellend geklärt werden konnten (Völger 1971:26).
Zwischen Blighs Besuchen machte sich Captain John Henry Cox auf den Weg nach Tasmanien (Robson 1983:8). Er lief am 28. Februar 1789 in Großbritannien aus und traf bereits am 3. Juli an der Südwestspitze Tasmaniens ein. Cox läutete die in ethnologischer Hinsicht so bedeutende Epoche der Robben- und Walfänger ein, indem er Großbritannien Kunde brachte von der reichhaltigen Meeressäugerfauna in diesem Teil der Erde. Dass er damit zu einem der Vorboten des Niedergangs der tasmanischen Kultur wurde, war ihm vermutlich nicht bewusst, denn er pflegte freundschaftlichen Umgang zur Inselbevölkerung. Während seines Aufenthalts auf Maria Island, wo eine kurze Begegnung mit den tasmanischen Aborigines stattfand, gab er der Oyster Bay ihren Namen.
Er beschrieb sie als glücklich, harmlos und völlig unkultiviert. Obwohl eher befangen, fanden sie großen Spaß daran, die Bewegung und Mimik der Europäer nachzuahmen. Ethnografisch bedeutsamer als das Treffen selbst, bei dem wieder ausgetauschte Geschenke abgelehnt wurden, waren seine Beobachtungen in den Tagen vor dem kurzen Kontakt. Wie schon so oft in dieser Ära der Entdecker fand er mehrere Lagerplätze, die kurz zuvor fluchtartig verlassen worden waren. Deren Inventar unterzog er genaueren Untersuchungen.
Bligh hatte gerade seinen dritten Aufenthalt auf Van Diemens Land beziehungsweise Bruni Island beendet, als wieder Schiffe vor der Küste Tasmaniens auftauchten. Es waren Franzosen, die mit dieser Expedition einen Meilenstein in der Entdeckungsgeschichte Tasmaniens setzten. Erstmals wurde die Insel von hochkarätigen Wissenschaftlern betreten und erforscht. Sie waren von Frankreich ausgesandt, um nach Lebenszeichen einer früheren französischen Expedition zu suchen: 1785 war Jean Francois Galoup de la Pérouse mit zwei Forschungsschiffen entsandt worden und nie zurückgekehrt.
Joseph Bruny d’Entrecasteaux hatte den Auftrag, den Verbleib dieser beiden verschollenen Schiffe zu klären und die Südsee nebst ihren Ressourcen zu erkunden. Er ging am 21. April 1792 vor der Küste Tasmaniens vor Anker (Robson 1983:8; Ryan 1981:53). An Bord befanden sich Wissenschaftler aller Couleur: Naturforscher, Botaniker, Zeichner, Kartografen, Ärzte und Astronomen, darunter einige der meisttalentiertesten Forscher, die Frankreich damals zu bieten hatte (Ryan 1981:53).
Der Leiter der Expedition d’Entrecasteaux kehrte nicht mehr nach Frankreich zurück. Er starb auf dieser Reise an Skorbut. Neben Kapitän Jean-Michel Huon de Kermadec machten vor allem zwei Besatzungsmitglieder von sich reden: E.P.E Rossel, der erste Offizier der ‘Recherche’, der 1808 in Paris über diese Expedition publizierte. Seinem Bericht liegt unter anderem das Tagebuch von d’Entrecasteaux zugrunde. Der ergiebigste Reisebericht stammt aus der Feder des 34-jährigen Naturforschers Jacques Julien Houtou de Labillardière, der auch detaillierte Beschreibungen der Lebensweise der Insulaner beinhaltet.
D’Entrecasteaux ließ auf dieser Reise zweimal die Südostküste Tasmaniens anlaufen. Die erste Untersuchung dauerte vom 21. April bis Ende Mai 1792. Im Januar 1793 kehrten sie zurück und blieben bis Februar. Insgesamt dauerte ihr Aufenthalt in Tasmanien circa zehn Wochen (Plomley 1966:3). In dieser Zeit kam es zu zahlreichen, harmonisch verlaufenden Begegnungen mit der einheimischen Bevölkerung.
Die Franzosen näherten sich der tasmanischen Bevölkerung sehr gefühlvoll. Sie ließen sich geduldig von Kopf bis Fuß mustern und sich von den Frauen die Gesichter schwärzen. Sie aßen, sangen und lachten zusammen, spielten mit den Kindern und es kam zu vielen, wechselseitigen Einladungen. Es fanden freundschaftliche Ringkämpfe am Strand statt; abends wurden die Franzosen zu ihren Booten geleitet und am Morgen wieder enthusiastisch begrüßt (Broome 1982:23, Ryan 1981:54, Robson 1983:26).
Darüber hinaus machten sie noch eine Reihe geografischer Entdeckungen. D’Entrecasteaux erkanne als Erster, dass Bruni Island, der bevorzugte Landeplatz der Briten , eine Insel ist. Die trennende Wasserstraße wurde nach ihm benannt. Er entdeckte die Mündungen der Flüsse Huon und Derwent. Er segelte den Derwent hinauf und kartierte die Norfolk Bay.
Zwischen den beiden Besuchen von d’Entrecasteaux sind keine weiteren Landungen durch Europäer belegt. Zwei Monate nach Beendigung seiner zweiten Landerkundung traf der junge, ehrgeizige Engländer John Hayes auf der Insel ein. Sein Aufenthalt im d’Entrecasteaux-Channel dauerte vom 26. April bis zum 9. Juni 1794 (Plomley 1993:18). Hayes erkundete in dieser Zeit die Gegend gründlich; unwissend, dass ihm die Franzosen bereits zuvor gekommen waren. Es ist völlig unklar, warum sich Hayes so lange in Tasmanien aufhielt, denn er war eigentlich auf dem Weg nach Neuguinea. Nur durch Zufall nahm er witterungsbedingt den Umweg um den Sahulschelf. Sein Tagebuch, das über die genaueren Umstände seines Aufenthaltes Aufschluss geben könnte, ging leider verloren. Das Schiff, mit dem er es Richtung Großbritannien sandte, wurde von den Franzosen gekapert (Völger 1972:29).
Zu diesem Zeitpunkt war man immer noch der Meinung, Van Diemens Land (Tasmanien) sei der Südausläufer Neuhollands (Australiens). Obwohl sich seit Cooks Verdacht die Hinweise und Gerüchte häuften, wurde erst im Oktober 1798 eine Expedition ausgerüstet, um diese Frage endgültig zu klären. George Bass und Matthew Flinders wurden beauftragt, Tasmanien wenn möglich zu umsegeln, um somit den Beweis zu erbringen, dass es eine Insel sei.
Es war möglich und somit wurde die für die Entdeckungsgeschichte Tasmaniens so bedeutsame Route um die tasmanische Südküste als Umweg erkannt. Bass und Flinders benötigten für die Umsegelung (7. Oktober 1798 bis 12. Juni 1799) fast ein dreiviertel Jahr (Robson 1983:9). Dabei entdeckten und kartierten sie nicht nur die bis dahin unbekannte Nordküste, sondern auch Teile der wenig bekannten Westküste (Abb. 9). Sie kartierten die Furneaux Inseln und andere Inseln der Bass-Straße. Aus deren Unberührtheit schlossen sie zurecht, dass die Bewohner von Van Diemens Land der Seefahrt im offenen Meer unkundig waren. Mit der Bevölkerung entstanden lediglich kurze und oberflächliche Kontakte, die nur dürftig beschrieben wurden.
Diese Kontakte fanden ebenfalls an der Südostküste Tasmaniens statt, die Flinders bereits als Besatzungsmitglied auf Blighs zweiter Reise kennengelernt hatte (Völger 1971 : 30). Flinders war von ihrem offenen, freundlichen Wesen beeindruckt und stellte die Ähnlichkeit zur Bevölkerung von New South Wales fest (Ryan 1981:57f).
Flinders war auch der Erste, der später Neuholland umsegelte und den Namen ‘Australia’ vorschlug (Przemyslaw 1990:7, 98). King Island, das Flinders übersehen hatte, wurde noch im gleichen Jahr von Reed kartiert. Macquarie Harbour und Port Davey an der Westküste wurden erst 1815 von Kelly und Birch entdeckt, die ebenfalls die Insel umschifften (Bryden 1965:38).
Zehn Jahre nach dem Besuch von Labillardière - kurz bevor Tasmanien von Großbritannien beziehungsweise Australien aus kolonialisiert wurde - traf eine zweite französische wissenschaftliche Expedition unter der Leitung von Nicolas Baudin auf der Insel ein. Deren 22-köpfige wissenschaftliche Crew mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren setzte sich zusammen aus drei Botanikern, fünf Zoologen und jeweils zwei Gärtnern, Mineralogen, Astronomen, Kartografen und Künstlern (Plomley 1966:3). Letztere, Petit und Lesuer, fertigten eine Vielzahl von Portraits sowie einige Zeichnungen, die Alltagsszenen, Grabstätten, Gegenstände des täglichen Gebrauchs und Waffen darstellten. Vor allem die Arbeiten von Petit werden meist gelobt. Seine Portraits waren zwar noch stark von Zeitgeist und Ästhetikempfinden der damaligen Epoche geprägt, stellten aber dennoch alle bisherigen Darstellungen in den Schatten.
Die Ergebnisse dieser Reise wurden verfasst und editiert von einem Mitglied der Crew, dem Naturforscher, Anthropologen und Mediziner (Triebel 1947:64) François Péron. Nach Pérons Tod wurde die Arbeit von Louis de Freycinet fertiggestellt. Diese Arbeit stellt die beste ethnografische Quelle dar, die wir aus ‘voreuropäischer’ Zeit von den Einwohnern Tasmaniens besitzen. Am 14. Januar 1802 erreichte Kommandant Baudin tasmanische Gewässer. Auch diese Expedition hielt sich im Osten Tasmaniens auf. Sie erkundete unter anderem den Huon River, die Oyster Bay und die östlich vorgelagerte Insel Maria Island. Sie blieben insgesamt 43 Tage. Ähnlich wir vorher bei d’Entrecasteaux kam es zu zahlreichen herzlichen Begegnungen in denen sich vor allem Péron als wichtiger Beobachter hervortat. James Bonwick beschreibt ihn als „angenehmen Sentimentalisten, der die romantische Schule von Rousseau in tiefen Zügen eingenommen hatte“ (Bonwick 1870:92).
An der Mündung des Huon Rivers trafen sie einen etwa 23-jährigen Aboriginal. Wie bereits bei früheren Begegnungen war auch dieser am meisten erstaunt über die Hautfarbe der Besucher. Furchtlos ging er zu ihnen und öffnete die Jacken und Hemden der Franzosen; zweifellos um sich zu vergewissern, ob die Farbe am Körper die gleiche wie im Gesicht sei. Nachdem er diese Leibesvisitation beendet hatte, begann er in heller Aufregung zu schreien und schnell mit den Füßen zu stampfen.
Einer jungen Frau überreichten sie ein Beil, ein Taschentuch und eine rote Feder. „Sie schrie, sie lachte, sie schien berauscht vor Glück und als wir uns vom Ufer abstießen, war ihr Schmerz ergreifend“ (Péron nach Turnbull 1963:38f). Am 22. Februar trafen sie auf eine Gruppe von vierzehn Männern und wurden sofort freundlich eingeladen (Ryan 1981:63). Sie aßen zusammen und die Franzosen sangen ihnen die Marseillaise vor, was große Heiterkeit auslöste (Péron 1809:173ff). Péron überprüfte ihre Körperkraft anhand eines Trainingsgerätes (Regnier Dynameter) und stellte entgegen seinen Erwartungen fest, dass sie weitaus weniger Kraft hatten als er oder einer seiner Offiziere, worüber die Aborigines zum Teil sehr verärgert waren (Péron 1809:222, 313f).
Nicht alle Treffen verliefen so harmonisch und friedlich. Bei einem Ausflug nach Bruni Island schlug nach einer freundlichen Begegnung die Stimmung aus ungeklärter Ursache um und beim Besteigen der Boote wurde ein Matrose durch einen Speer an der Schulter verletzt (Péron 1808:192 und Völger 1971:32). Auch bei einer anderen Gelegenheit wurden sie mit Steinen beworfen und traten den Rückzug an (Péron 1808:197 und Völger 1971:32).
Aggressionen weckte bei der vierten Begegnung der Maler Petit. Er hatte bereits einige Zeichnungen angefertigt, was jedoch mit einem Mal nicht weiter geduldet wurde. Nur mit Mühe konnte er einem Keulenschlag entgehen. Zunächst konnten die Franzosen die Situation entschärfen, aber als sie in die Boote stiegen, ging wieder ein Steinhagel auf sie nieder. Auf Maria Island kam es ebenfalls nach anfänglicher Harmonie zu Auseinandersetzungen, die die Franzosen zum Rückzug veranlassten. Es ist den Leitern dieser Expedition hoch anzurechnen, dass sie bei diesen Vorfällen auf den Gebrauch von Schusswaffen verzichteten.
Péron war derartig beeindruckt von den tasmanischen Aborigines, dass er keiner Mühe oder Gefahr aus dem Wege ging und unermüdlich neue Begegnungen herbeiführte. Aufgrund seines Interesses wurden uns viele Details der Kultur überliefert. Nebst Angaben über Aussehen, Schmuck, Essgewohnheiten, soziale Organisation und Beschreibung der Siedlungen einschließlich des Inventars war seine Entdeckung der Grabstätten der Aborigines von besonderer Bedeutung. Seine Beobachtungsgabe war bemerkenswert und seine Angaben zeichnen sich aus durch Genauigkeit, Einfühlungsvermögen und Glaubwürdigkeit. Jedoch war seine Behauptung, die Bewohner Tasmaniens seien die unzivilisiertesten der ganzen Welt, Wasser auf die Mühlen des gerade aufkeimenden Sozialdarwinismus, deren Vertreter sich bald auf die Suche nach dem Bindeglied zwischen Mensch und Affe begaben (Ryan 1981:63).
Nach dieser Expedition erholte sich die Crew fünf Monate lang in Sydney. Während dieses Aufenthaltes kam dem damaligen Gouverneur King ein folgenschweres Gerücht zu Ohren: Demnach hätte einer der französischen Offiziere verlauten lassen, es sei die Absicht Frankreichs, in Tasmanien eine Kolonie zu gründen. Die Tatsache, dass Tasmanien kein Teil Neuhollands war, verlieh der Insel damals den Status eines Niemandslandes.
King war entschlossen, den Franzosen zuvorzukommen. In einer überstürzten Aktion schickte er einen Abgesandten, Leutnant Robbins, der die Insel offiziell in den Besitz der britischen Krone bringen sollte. Sein Auftrag lautete, die Franzosen, die sich bereits auf der Heimreise befanden einzuholen und ihnen unmissverständlich klar zu machen, dass Tasmanien bereits annektiert sei. „Zum großen Vergnügen der Franzosen entledigte sich Robbins seiner Aufgabe auf eine etwas lächerliche Weise: kaum war der kleine Schoner vor der King Insel vor Anker gegangen, landete er mit einer kleinen Gruppe seiner Leute, die sich eilenden Schrittes zu den Zelten der Franzosen begaben. Dort hissten sie die englische Flagge, feuerten einige Salven ab, schrien dreimal Hurra und erklärten die Insel zum Besitz ihres Königs“ (Völger 1971:34).
Baudin, der Leiter der französischen Expedition verurteilte diese Maßnahme des Gouverneurs. In Sydney hatte er die Folgen der Kolonisation für die Aborigines hautnah miterlebt. In einem Brief an King schrieb er: „Es wäre unendlich ruhmreicher, die Bewohner der verschiedenen Länder, die unserem Recht unterstehen, für die Gesellschaft zu formen, als den Wunsch zu äußern, diejenigen, die so weit abgelegen sind, durch sofortige Besitznahme des Bodens, den sie besitzen und der sie geboren hat, zu berauben“ (Ryan 1981:64).
King zeigte sich wenig beeindruckt von der liberalen Haltung des Franzosen und um jegliches Risiko zu vermeiden, gründete er kurz darauf, ausgehend von Sydney, die erste Siedlung auf tasmanischem Boden. Zu diesem Zeitpunkt war von Van Diemensland nicht viel mehr als seine groben Umrisse bekannt. Die Erkundungsexpeditionen wurde auch von französischer Seite fortgesetzt (Plomley 1966c : 4; Marchant 1969:3). Selbst noch in den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts waren weite Landstriche Tasmaniens nur unzulänglich kartiert (Bryden 1960:39).
Die Aufzeichnungen der Forschungsreisenden dieser Epoche sind von besonderer Bedeutung, da sie die tasmanische Kultur in ihrer unverfälschten Form beschreiben. Dennoch gilt es zu berücksichtigen, dass zur damaligen Zeit Völkerkunde als Wissenschaft noch nicht etabliert war. Die Auswirkungen dieser Forschungsreisen erscheinen im Vergleich zur Kolonialgeschichte nahezu bedeutungslos. Und dennoch hatte bereits die Epoche der Entdeckungsreisen in der tasmanischen Kultur ihre Spuren hinterlassen. Der ethnologischen Forschung bleibt das Ausmaß und die Art dieser Spuren - in Tasmanien ebenso wie in anderen Regionen der Welt - größtenteils verschlossen. Es ist leicht vorstellbar, dass diese Epoche vor allem im Osten der Insel (Mulvaney & White 1987:314) nicht ohne Folgen blieb. Über die Art der Folgen können wir indes nur spekulieren.
Spätere diesbezüglichen Entwicklungen der Kolonialzeit lassen vermuten, dass bereits von den Reisenden Krankheiten mit epidemischer Wirkung eingeschleppt wurden, die einerseits zu Todesfällen, andererseits auch zur partiellen Immunität der Bewohner gegenüber späteren Ansteckungen hätten führen können, wie man sie zum Beispiel bei den Trepangfischern Nordaustraliens beobachten konnte (Przemyslaw 1990:98).
Ein anderer Aspekt, dessen Auswirkung man nur erahnen kann, sind die unzähligen Geschenke, die die Seefahrer unter der ‘voreuropäischen’ Bevölkerung verteilten. Ebenso unklar bleiben die Motive der Reaktionen über solche Gastgeschenke, die von totaler Verzückung über (gespielte?) Gleichgültigkeit bis hin zu offener Aggression reichten. Der Hochmut der Besitzenden und der Neid der Leerausgegangenen haben möglicherweise zu sozialen Spannungen geführt. Speziell bei den Geschenken in Form von Kleidungsstücken kann ein Zusammenhang zu auftretenden Krankheiten nicht ausgeschlossen werden.
Sowohl die Matrosen als auch die seit Cox auftretenden Robbenfänger hatten bereits sexuelle Kontakte zu den Aborigines, die häufig nicht ohne Konsequenzen blieben. Mit Sicherheit führte diese bereits in vorkolonialer Zeit eingetretene Hybridisation der tasmanischen Bevölkerung zu gesellschaftlichen Konflikten.
Für derartige Besuche war jedoch im Weltbild der „Tasmanier„ kein Platz, so dass sie es entsprechend modifizieren mussten. Aufgrund der Sozialstruktur der Aborigines in Verbindung mit der begrenzten Ausdehnung ihres Lebensraumes ist spätestens seit d’Entrecasteaux’ Besuch abwegig, von einer ‘voreuropäischen’ Bevölkerung zu sprechen.
Offensichtlich wurde jede Landung von den Einheimischen ebenso registriert wie die vorbeiziehenden Schiffe, die sich zum Teil auch inoffiziell und von der Geschichtsschreibung übergangen in diesen Gewässern aufhielten. Auch muss man annehmen, dass sie sich wechselseitig, möglicherweise über große Entfernungen hinweg, über derartig exotische Begegnungen informierten und den Versuch unternahmen, diese zu interpretieren. Selbst ein harmonisch verlaufendes Treffen musste bei ihnen starke Verunsicherung auslösen. Darüber hinaus ist zu vermuten, dass die Aborigines von der Technologie der Europäer - entgegen den Behauptungen der Anhänger Rousseaus - ebenso beeindruckt wie eingeschüchtert waren.
Britische Kolonialzeit
Um jeglichen anderweitigen Besitzansprüchen zuvorzukommen, gründeten die Briten im September 1803 mit Risdon Cove ihre erste Siedlung auf Tasmanien, der im Laufe eines Jahres noch zwei weitere folgen sollten. Die erste Besiedlung (Risdon Cove) wurde ausgehend von Sydney unter der Leitung von Lieutnant John Bowen durchgeführt. Bowen, der zuvor noch nie einem tasmanischen Aborigine begegnet war, hatte sich bereits vor der Landung seine Meinung gebildet: Er bezeichnet die Ureinwohner als ohne jeglichen Wert für Großbritannien und hoffte, nie einen von ihnen zu Gesicht zu bekommen. Er traf im September 1803 ein und gründete - in einem von George Bass vorgeschlagenen Gebiet im Südosten der Insel - an einem Seitenarm des Derwent die erste Siedlung. In seiner Begleitung befanden sich vierundneunzig Strafgefangene und Soldaten aus Sydney. Im darauffolgenden Februar kamen nochmals über zweihundert Gefangene und Militärs unter der Leitung von Colonel David Collins. Diesmal direkt von England ausgesandt, errichteten sie nach einer Besichtigung von Port Phillip und Risdon Cove am gegenüberliegenden Ufer des Derwent die Siedlung Sullivan’s Cove, das spätere Hobart.
Im November kam es zur zweiten, von Sydney ausgehenden Okkupationswelle. Gouverneur Philip G. King teilte die Insel in zwei Regierungsbezirke: Südlich des 42. Breitengrades in den Bezirk ‘Buckingham’ mit den beiden bereits bestehenden Siedlungen. Im nördlichen Bezirk ‘Cornwall’ ließ er eine dritte Siedlung gründen. Unter dem Kommando von Vizegouverneur William Paterson wurde bei Port Dalrymple (heute Launceston) an der Mündung des Flusses Tamar River George Town gegründet.
Keine der drei Siedlungen war anfangs autark. Sie hatten auch nicht, wie zum Teil behauptet wird, den Zweck, sich der aus Großbritannien deportierten Strafgefangenen zu entledigen. Dazu wäre auf dem australischen Festland Raum genug vorhanden gewesen. Die Motivation der britischen Regierung bestand darin, sich mit Hilfe der Sträflinge den Besitz Tasmaniens zu sichern, in der Gewissheit, dass sich die Kolonie in absehbarer Zeit selbst tragen und darüber hinaus noch Rendite abwerfen würde. Doch wie jede Investition in die Zukunft waren auch die neuen Siedlungen zunächst ein Zuschussbetrieb, der auf die Unterstützung von Sydney und Großbritannien angewiesen war. Nachdem die Besitzansprüche Großbritanniens an Tasmanien geklärt waren, hielten sich die beiden Regierungen mit Subventionen bedeckt, so dass die Kolonialisierung Tasmaniens nur sehr langsam voranschritt.
Zwanzig Jahre nach der Erstbesiedlung erreichte die europäische Bevölkerung Tasmaniens eine Einwohnerzahl von 10.000 und noch im Jahre 1923 waren weite Teile der Insel unerforscht. Neben den ersten drei Siedlungszentren entwickelten sich in deren Umgebung einige weitere entlang der Flussläufe - dem Tamar im Norden und dem Derwent im Süden - oder der Küstenlinie. Nach dreißigjähriger Besiedlungdauer Tasmanienes war die Straße zwischen der Inselhauptstadt Hobart und der Hauptstadt des Nordbezirkes Launceston unzulänglich ausgebaut.
Chronologisch überlappend fand neben der Kolonialisierung eine weitere Entwicklung statt, deren Anfänge in die neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts zurückreichen. Diese Entwicklung - die Etablierung des Robbenfangs und die Jagd nach anderen Meeressäugern in der Bass-Straße und der Westküste Tasmaniens - hatte bereits in vorkolonialer Zeit eine abweisende Einstellung der Insulaner gegenüber den Europäern hervorgebracht.
Anfänglich wurden die Robbenfänger nur saisonal auf den Inseln abgesetzt und am Ende der Fangzeit wieder abgeholt. Nachdem die Nachfrage nach Tran, Fleisch, Haut und Haaren der Meeressäuger angestiegen war, etablierten sich zunehmend feste, ganzjährig bewirtschaftete Fangstationen. Der Handel blühte, und die Jagd nach Meeressäugern aller Art wurde zum expandierenden Wirtschaftsfaktor an dem die Aborigine nicht partipizierten, sondern deren Fanggebiete beeinträchtigte.
Im Zuge dieser Entwicklung steigerte sich das Interesse der Robbenfänger an tasmanischen Frauen. Anfänglich brachten sie die Frauen am Ende der Saison wieder aufs Festland zurück und begnügten sich mit jeweils einer Aborigine. Nachdem man jedoch die Effizienz ihrer Arbeitskraft sowohl bei der Robbenjagd, als auch bei der täglichen Nahrungsbeschaffung - inklusive der traditionell deren Männern vorbehalteten Kängurujagd - erkannt hatte, nahmen die Entführungen ein verheerendes Ausmaß an. Zunehmend wurden die Frauen unter Zuhilfenahme von Gewalt verschleppt und auf die für die Aborigines unerreichbaren Inseln deportiert. Die Tragödien, die sich dort abspielten, sind uns aus der Anfangszeit gar nicht und mit beginnender Kolonialzeit nur rudimentär überliefert. Zu Beginn der Robbenfängerepoche wurden Aboriginefrauen von den Europäern im Tauschhandel erworben. In der Regel waren diese nicht, wie teilweise behauptet wird, Frauen der eigenen Lokalgruppe, sondern solche, die sie ihrerseits von den Nachbargruppen geraubt hatten. Nach den ersten gewaltsamen Entführungen war der Weg des friedlichen Tauschhandels versperrt. Die Robbenfänger überfielen die Bewohner der Nord- und Ostküsten, töteten die Männer und verschleppten deren Frauen, wie bei dem von George Augustus Robinson untersuchten Cape-Grim-Massaker aufgedeckt. An der Ostküste, die zum betreffenden Zeitpunkt von der Kolonisation noch weitgehend unberührt war, wurde eine Gruppe von achtzig bis neunzig Aborigines angetroffen, darunter waren nur zwei Frauen.
Anfangs war die Kolonie für freie Siedler wenig reizvoll. Das Brachland der wenigen Ebenen musste unter Strapazen erst urbar gemacht werden. In Großbritannien kursierte darüber hinaus die Auffassung, die Ureinwohner seien gefährliche Wilde. Auch der hohe Anteil an Strafgefangenen unter der europäischen Bevölkerung wurde mit Misstrauen beobachtet. 1804 kamen auf einen freien Siedler mehr als vier Häftlinge, wobei es zu bedenken gilt, dass diese 'freien' Siedler meist keinesfalls freiwillig dort ansässig wurden. Streng genommen waren es keine Siedler, sondern Soldaten, Beamte und Handwerker, die nach Van-Diemens-Land abkommandiert waren.
In keine andere australische Kolonie wurden so viele Strafgefangene deportiert wie nach Tasmanien. Insgesamt wurden 74.000 auf die Insel verbannt, darunter 12 bis 13.000 Frauen. Erst 1825 war das Verhältnis zwischen freien und deportierten Europäern ausgeglichen: Von den zirka dreizehntausend Einwohnern waren erstmals nur noch die Hälfte Strafgefangene. In den darauf folgenden Jahren verbesserte sich das Verhältnis noch etwas zugunsten der freien Siedler. Aber Mitte der dreißiger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts wurde die Abschiebung von Häftlingen noch verstärkt und erreichte in den vierziger Jahren ihren Höhepunkt, als die Deportation nach New South Wales eingestellt wurde. Die Bevölkerungsentwicklung der freien Siedler muss ähnlich verlaufen sein, denn 1844 kamen auf insgesamt 60.000 Europäer immer noch 30.000 Strafgefangene.
Ein anderes Ungleichgewicht begünstigte ebenfalls die langsame Entwicklung der Kolonie. In den Anfangsjahren gab es auf Tasmanien kaum Frauen - zumindest keine europäischen. 1828 kamen auf vier Männer nur eine Frau. Noch 1840 gab es nicht einmal halb so viele Frauen wie Männer. Die Diskrepanz des Geschlechterverhältnisses nahm über die Jahre nur sehr langsam ab, so dass Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts noch immer kein Gleichgewicht hergestellt war. Wohl gab es zahlreiche Gesuche, alleinstehende Frauen in die Kolonie zu entsenden; eine dahingehende Maßnahme wurde jedoch von der bürgerlichen Gesellschaft der jungen Städte blockiert, da sie befürchteten, dass die ohnehin schon stark grassierende Prostitution dadurch noch verschärft werden könnte. Diese durchaus streitbare Argumentation nährte sich aus der damalig vorherrschenden Einstellung; eine ehrbare Frau würde eine solche Reise niemals alleine antreten.
Ein weiteres Hemmnis war die Tatsache, dass viele Sträflinge bereits zu Beginn der Kolonisation entflohen waren. Diese schlossen sich zum Teil den Robbenfängern der umgebenden Inseln an oder durchstreiften in Banden raubend, plündernd und mordend das Land. Um einer drohenden Hungersnot in der jungen Kolonie zu entgehen, erlaubte man ihnen 1805, sich ihre Nahrung durch Jagd selbst anzueignen. Viele kehrten aus den Wäldern nicht wieder zurück. Diese Banden (‘bushrangers’) wurden von den frühen Siedlern als noch größere Bedrohung empfunden als die Urbevölkerung selbst. Erst 1817 unter Gouverneur Sorell wurde dieses Problem endgültig gelöst. Trotz all dieser Widrigkeiten nahm die europäische Bevölkerung langsam, aber kontinuierlich zu. Mit dem Bevölkerungszuwachs verstärkte sich zunehmend der Druck auf die Aborigine.
Im Mai 1804 töteten die Royal Marines in der Nähe von Risdon um die vierzig tasmanische Aboigines. Ab diesem Zeitpunkt stieg die Gewaltbereitschaft sowie das Konfliktpotential ständig an. Die Militärs gingen immer entschlossener vor, wurden aber von den zivilen Siedlern noch übertroffen, die eine Unzahl von Verbrechen an der vorkolonialen Bevölkerung verübten. Meist werden in diesem Zusammenhang die zivilen Siedler nach Berufsgruppen unterteilt, da alle diese Gruppen bei der beginnenden Eskalation verschiedene Rollen einnahmen. Neben Soldaten, Polizisten und Beamten, die meist im Auftrag der Regierung handelten, werden fünf Hauptgruppen unterschieden:
Von den bereits erwähnten Robbenfängern, die den Aborigines zwar kein Land, aber deren Frauen raubten, wurden wohl die meisten und grausamsten Verbrechen verübt, die häufig an Perversion kaum zu überbieten sind. Sie störten empfindlich das Geschlechterverhältnis und provozierten Fehden unter den Stämmen, die sich ihrerseits der Frauen wegen bekriegten.
Bei den Bauern, die ihr in der Nähe der Siedlungen gelegenes, günstig erworbenes Land bestellten, gab es individuelle Unterschiede und meist wird in den Quellen ein neutrales Bild der Bauern gezeichnet. Aber auch einige von ihnen machten sich einen Spaß daraus, Schwarzen (‘black crows’) aufzulauern und sie zu töten. Ihr größter Negativeinfluss lag vermutlich in der forcierten Landnahme, die im Laufe der Jahre zunehmend abwanderungsbedingten Bevölkerungsdruck bei den Aborigines auslöste. Allein im Zeitraum von 1811 bis 1814 stieg die Anbaufläche von rund 3.000 auf rund 12.000 Hektar an.
Die bekanntgewordenen, von den Strafgefangenen an den Aborigines verübten Verbrechen bildeten nur die Spitze eines Eisberges. Sie bekriegten sich sogar untereinander und machten auch den weißen Siedlern das Leben schwer. Allerdings waren sie, ebenso wie die Robbenjäger, nicht an der Landnahme beteiligt.
Die Viehzüchter und Schafhirten, deren Stationen meist am Rande der besiedelten Gebiete und somit außer Reichweite des Gesetzes lagen, standen den Robbenfängern und Strafgefangenen in nichts nach. Diesen drei Gruppen ist gemeinsam, dass, obwohl deren Handeln weitgehend der Öffentlichkeit entzogen war, trotzdem unzählige ihrer Grausamkeiten überliefert wurden. Zwischen 1811 und 1814 stieg die Anzahl der Schafe in Tasmanien von 3.500 auf 38.000, so dass auch der Anteil der Viehzüchter am Landraub gewaltig war, zumal sie ihre Tiere häufig auch illegal zum Weiden in die Wildnis trieben.
Diese sehr schematische Einteilung kann weder der Realität und keineswegs Individuen gerecht werden. Dennoch scheinen hier tatsächlich derartige Tendenzen bestanden zu haben, denn in nahezu allen Quellen werden die Gruppen in dieser Art unterschieden, wobei die Auswirkungen genannter Gruppen auf die Aborigines von Quelle zu Quelle leicht unterschiedlich gewertet werden.
Die tasmanischen Aborigines wurden vergewaltigt und auf andere Weise gefoltert, kastriert, versklavt, verstümmelt, bei lebendigem Leibe verbrannt, vergiftet oder anderweitig getötet und danach zum Teil an die Hunde verfüttert. Ihre Frauen traf es am härtesten und selbst Kinder waren von solchen Verbrechen nicht ausgenommen. Nach nur dreißigjähriger Besiedlungsdauer war die ehemals mehrere Tausend zählende Aboriginalbevölkerung bis auf einen kümmerlichen Rest von zweihundert Individuen ausgerottet. Die Regierung hat diese Entwicklung zwar bis 1926 nicht gebilligt, aber durch ihr unentschlossenes Vorgehen toleriert.
Nur ein einziges Mal wurden Europäer für derartige Ausschreitungen zur Rechenschaft gezogen: Zwei Männer wurden wegen Misshandlungen von Aborigines öffentlich ausgepeitscht. Einer hatte einem Jungen ein Ohr abgeschnitten, der andere einem Mann den Finger, um ihn als Pfeifenstopfer zu benutzen.
Um so verwunderlicher ist es, dass sich die Europäer zu Beginn der Kolonialzeit unbehelligt durch größere Gruppen Aborigines bewegen konnten. Noch im Jahre 1824 schrieb die Hobart Town Gazette: „Im Ganzen genommen sind die schwarzen Eingeborenen der Kolonie die friedlichsten Geschöpfe der Welt“.
Abgesehen von Frauenraub und Mord dezimierte sich die Urbevölkerung Tasmaniens durch grassierende Epidemien und den rapiden Rückgang des Wildbestandes. Anfangs haben die Europäer das Wild nur zur Ergänzung der knappen Nahrungsmittel gejagt; später entstand ein schwungvoller Handel mit den Fellen. Dazu kamen die unzähligen Hunde, die sich ungehindert auf der Insel vermehrten. Ein früher Siedler, Reverend Knopwood, vermerkte voller Stolz in seinem Tagebuch, dass seine Hunde in nur zwei Monaten fast siebzig Kängurus erlegten.
Obwohl die tasmanischen Aborigines den weißen Siedlern und Strafgefangenen, die zahlenmäßig überlegen waren und effektivere Waffen besaßen, wenig entgegenzusetzen hatten, leisteten sie doch teils erbitterten Widerstand gegen ihre Enteignung und Ausrottung. So existieren Überlieferungen von einer Aborigine, Namens Walyer, die die Eindringlinge heftigst bekämpfte. Sie organisierte und leitete gezielte Attacken auf weiße Soldaten und Siedler. Im Gegensatz zu vielen anderen Aborigines konnte sie auch mit Feuerwaffen umgehen und war bei den Weißen sehr gefürchtet. Den Quellen zufolge wurde sie evtl. 1831 von den Briten gefangen genommen. Aber auch während ihrer Gefangenschaft, versuchte sie die Aborigines zur Rebellion gegen die weißen Okkupatoren anzuzetteln. Kurz nach ihrer Gefangennahme verstarb sie allerdings.
In der Folge sah sich die Regierung, die bisher nur unentschlossen an die Vernunft der Siedler appelliert hatte, gezwungen, vehement durchzugreifen. Am 1. November 1828 verhängte sie das Standrecht über die Aborigines, die somit letztlich dem legalen Abschuss freigegeben wurden.
Im Februar 1830 wurde zusätzlich für jeden lebendig gefangenen Aborigine ein Kopfgeld ausgesetzt. In diesem Zeitraum gründete man sogenannte ‘roving parties’. Kopfgeldjägertruppen, die von der Regierung offiziell beauftragt waren, die Aborigines in Reservaten festzusetzen. Zwei Führer dieser Suchtrupps sind für die Forschung als Informanten von Interesse: Jorgen Jorgenson, ein dänischer Abenteurer, und John Batman, ein Einwanderer aus Australien. Letzterer wird in den Quellen meist als den Aborigines wohlgesinnt dargestellt. Beide hielten sich häufig außerhalb des Siedlungsgebietes auf und hatten zahlreiche Kontakte zur indigenen Bevölkerung. Generell war auch diese Maßnahme kontraproduktiv. Die Regierung zahlte zwar nur für jeden lebend gefangenen Aboriginal ein Kopfgeld in Höhe von fünf Pfund, aber die meist aus Strafgefangenen rekrutierten Truppen - die zum Teil sogar von Häftlingen geleitet wurden - erschossen häufig neun, in der Hoffnung, den zehnten lebendig zu fangen. Neben der Verhängung des Standrechtes sind aus dieser Zeit noch vier weitere Erlässe und Proklamationen von geschichtswissenschaftlichem Interesse:
Unter diesen stellt die Proklamation von Gouverneur Sorell eine positive Ausnahme dar. Es wird in den Quellen oft als das gerechteste, weitblickendste und aufrichtigste Dokument der Kolonialregierung beschrieben. Dieser vielversprechende Aufruf fand aber bei den gewaltbereiten Siedlern kein Gehör.
Am 29. November 1826, bereits zwei Jahre bevor Gouverneur George Arthur das Standrecht verhängte, veröffentlichte er folgende Forderung: „Sollte man bemerken, dass ein oder mehrere Stämme entschlossen sind anzugreifen, zu rauben oder die weißen Bewohner zu ermorden, so darf sich jede Person bewaffnen und dem Militär anschließen, um sie mit Gewalt zu vertreiben. Die Stämme können in diesem Fall als offene Feinde betrachtet werden“. Da sich die genauen Umstände der gewalttätigen Ausschreitungen in der Regel der Öffentlichkeit entzogen, hatten die Gewalttäter freie Hand.
Am 15. April 1828 beschloss Arthur, die besiedelten Gebiete durch eine bewaffnete Postenkette abriegeln zu lassen und nur Aborigines, deren Führer einen vom ihm ausgestellten Pass besaßen, passieren zu lassen. Außerdem erteilte er „hiermit allen Urbewohnern den strengen Befehl, sich sofort zurückzuziehen und [...] unter keinem Vorwand [...] wieder die besiedelten Gebiete [...] zu betreten“. Sicherlich hat niemals ein Aborigine von diesem Erlass erfahren, denn dahingehende Maßnahmen sind nicht belegt, und eine Verständigung war aufgrund der Sprachbarriere unmöglich.
Vermutlich war es ebenfalls Arthur, der die Problematik, dass die Aborigines unmöglich etwas befolgen konnten, wovon sie keine Kenntnis hatten, in ihrer vollen Tragweite erfasste. Er ließ bunte Plakate erstellen, die in Form einer Bildergeschichte darstellen sollten, dass Schwarze und Weiße vor dem europäischen Gericht gleichgestellt seien. Sie wurden in den Wäldern an den Bäumen angebracht. Dieser Gipfel der Hilflosigkeit wurde in der englischen Literatur meist mit Häme überzogen. Aber auch in der in Braunschweig erschienenen völkerkundlichen Zeitschrift ‘Globus’ ließ man sich bereits 1869 voller Ironie über diese „ganz im Stil der Morithatenbilder auf den Jahrmärkten“ gehaltenen Tafeln aus : „Das Auskunftsmittel galt für sinnreich. Man beschloss, den Inhalt der Decrete den beschränkten Unterthanenverstande der Wilden durch Illustrationen klar zu machen. Diese sollten, zur Nachachtung für die Schwarzen, und wahrscheinlich auch zu Nutz und Frommen des Kakadus und Opossums an Bäume in den Wäldern angenagelt werden“.
Neben diesen Erlässen wurden in Arthurs Regierungszeit auch vielversprechende Versuche unternommen, die kriegerischen Auseinandersetzungen beizulegen. Am 7. März 1829 erschien in der ‘Hobart Town Gazette’ ein Inserat der Regierung. Gesucht wurde „a steady person of good character, who can be well recommended, who will take an interest in affecting an intercourse with this important race, and reside on Brune [Bruni] Island taking charge of the provisions supplied for the use of the natives of that place“.
Man hatte sechs Monate lang für die Einheimischen in den Wäldern Nahrungsmittel hinterlegt und daraufhin drei Aborigines gefangen. Für diese und nachfolgende Gefangene wurde ein Betreuer gesucht, dessen Aufgabe es war, auf Bruni Island eine Reservation zu leiten. Aus insgesamt neun Bewerbern wurde ein achtunddreißigjähriger Maurer ausgewählt: George Augustus Robinson schien aufgrund seines Engagements in mehreren karitativen Einrichtungen prädestiniert für diesen Auftrag. Um die Aborigines vor dem sicheren Untergang zu bewahren, fasste er den Entschluss, möglichst viele in einer Reservation, fernab der Siedler, unterzubringen.
Für die Europäer begann der Krieg mit der Verhängung des Standrechts 1828. Aus der Sicht der voreuropäischen Bevölkerung ist eine derartige zeitliche Fixierung des sogenannten Black War nicht nachvollziehbar: Sie hatten keinerlei Zugang zu den Regierungserlässen, und eine Steigerung der ihnen angetanenen Gewalt war ab 1828 kaum mehr möglich. Nimmt man ihre Guerilla als Maßstab, so erscheint dieses Datum jedoch gerechtfertigt. Ihre Angriffe auf Europäer nahmen nach 1828 deutlich zu, aber ab 1831 erlahmte ihre Gegenwehr. Der erste Europäer kam bereits 1807 durch die Aborigines ums Leben. Im Laufe des Jahres 1808, zwanzig Jahre vor dem offiziellen Kriegsbeginn, hatten ihre Krieger zwanzig Europäer getötet. Insgesamt starben bereits in den ersten zwanzig Jahren der Besiedlung 176 Europäer bei Kampfhandlungen.
Unter den Siedlern machte sich zunehmend Panikstimmung breit. Die Regierung unter Arthur ersuchte 1830 London um militärische Hilfe, die jedoch verweigert wurde. In Anbetracht der demografischen Entwicklung der beiden Kontrahenten ist ein solches Gesuch zu diesem Zeitpunkt nicht nachvollziehbar. Von den ehemals zirka fünftausend Aborigines waren nur noch weniger als dreihundert am Leben. Davon war die Hälfte weiblichen Geschlechts, so dass abzüglich der Alten, Kinder, der Gefangenen und bereits ‘Befriedeten’ weniger als einhundert kampfbereite Aborigines einer Übermacht von damals vierundzwanzigtausend Europäern gegenüberstanden. Dennoch sah sich Arthur genötigt, parallel zu den ‘roving parties’ und den Bemühungen Robinsons Schritte in die Wege zu leiten, die dem Widerstand ein für alle Mal Einhalt gebieten sollten. Er organisierte eine militärische Operation ungeheuren finanziellen und organisatorischen Ausmaßes, um die Überlebenden einzufangen und aus Tasmanien zu verbannen. Ihm gelang es, eine aus Militär, Polizei, Strafgefangenen und freien Siedlern bestehende Truppe zu mobilisieren, die mindestens dreitausend Mann stark war.
Deren Einsatz begann Anfang Oktober 1830 und dauerte sieben Wochen. Ihre Aufgabe war es, in einer undurchdringlichen Kettenformation die Aborigines vor sich her zu treiben. An der Südspitze der Insel sollten sie dann aufgegriffen und auf die bereitstehenden Schiffe verladen werden. Der Plan der Regierung ging nicht auf: Das Ergebnis dieser mehrere Tausend Pfund teuren Operation war beschämend. Als die Siedler die Südspitze der Insel erreichten und sich bereit machten, die Einheimischen zu umzingeln, wurde nicht ein Aboriginal angetroffen. Nur im Zuge ihres Vormarsches gelang es, zwei Aborigines zu töten und zwei weitere gefangenzunehmen. Diese als Black Line (‘Black String’) bekannt gewordene Maßnahme Arthurs war ein kompletter Fehlschlag. Dennoch (oder gerade deshalb ?) genießt sie in der wissenschaftlichen Literatur Anerkennung. Die Beschreibungen sind ebenso zahlreich wie widersprüchlich.
George Augustus Robinson war von den Briten beauftragt worden, die verbliebenen Aborigines auf friedlichem Wege in die Reservation zubringen. Er hatte im Laufe seiner Mission zu allen dreihundert Überlebenden Kontakt. Weniger als vier Jahre nach der ‘Black Line’ war es ihm gelungen, alle Aborigines aus Tasmanien zu deportieren. Sein Plan war, auf einer Insel der Bass-Straße eine Siedlung zu errichten. Nach mehreren Anläufen fiel seine endgültige Wahl auf Flinders Island. Insgesamt wurden 220 Aborigines nach Flinders Island deportiert, wobei niemals mehr als 130 gleichzeitig dort lebten. Auf der siebzig Kilometer langen und dreißig Kilometer breiten Insel waren die Überlebenden geschützt vor den mordenden Siedlern, aber das Sterben nahm kein Ende. Achtzig der dreihundert Aborigines starben, noch bevor sie Flinders erreichten. Aufgrund epidemischer Infektionskrankheiten war die Todesrate auch dort von Beginn an sehr hoch. Im Dezember 1833 waren bereits dreiunddreißig Mitglieder der Westküstengruppen gestorben. Einschließlich der von Robinson eingebrachten zweiundvierzig Neuankömmlinge lebten damals 111 Einwohner in der Siedlung. Diese Gruppe mit ausgeglichenem Geschlechterverhältnis wurde anfangs von 43 Europäern betreut.
Anfang 1836 übernahm Robinson die Leitung der „Wybalenna“ genannten Reservation. Er unternahm den Versuch, die damalig einhundertdreiundzwanzig Aborigines zu zivilisieren und zu christianisieren. Sie wurden im Lesen und Schreiben unterrichtet und mussten regelmäßig den von Pfarrer Robert Clark abgehaltenen Gottesdienst besuchen. Aufgrund der anhaltenden Misserfolge wurde später der Gottesdienst auf das Singen von Hymnen beschränkt und der Unterricht ganz aufgegeben. Dennoch versuchten Robinson und Clark, die ihre Arbeit regelmäßig vor der Regierung verantworten mussten, den Schein des kontinuierlichen Fortschritts zu wahren. Eines dieser Blendwerke war die Herausgabe einer eigenen Zeitung, die angeblich von den Aborigines geschrieben wurde. Diese Zeitung wurde jedoch von drei schwarzen Jugendlichen verfasst, die vermutlich schon schreiben und lesen konnten, bevor sie in die Reservation kamen.
Um die Europäisierung voranzutreiben, führte Robinson den Geldverkehr ein. Von nun an entlohnte man die Aborigines für ihre Arbeit. Die Männer wurden als Jäger (Pelzhandel), Gärtner, Schäfer, Polizisten und im Straßenbau beschäftigt. Die Frauen verrichteten Haus- und Handarbeiten und verarbeiteten die von ihnen gefangenen ‘mutton birds’. Aber auch diese Aktivitäten verliefen, nachdem sie nur zögerlich begonnen hatten, nach und nach im Sande.
Aufgrund der hohen Todesrate breitete sich eine allgemeine Mutlosigkeit unter den Bewohnern aus. 1834 starben dreißig weitere Aborigines, und die Hinterbliebenen verfielen zunehmend in Resignation. Auch die Errichtung einer kleinen Krankenstation, die von einer Krankenschwester betreut wurde, konnte diese Entwicklung nicht verhindern. Das Engagement Robinsons ließ ebenfalls im Laufe der Zeit nach. Er war nur noch bemüht, seinen Ruf als Leiter von ‘Wybalenna’ zu wahren. Von den vierzig Monaten, die er die Reservation leitete, war er nur siebenundzwanzig Monate auf Flinders Island anwesend.
Bereits wenige Monate nach dem Beginn seiner Amtszeit in der Reservation hatte er sich um das Protektorat der Aborigines im Port-Phillipp-Distrikt in Südostaustralien beworben. Die Verhandlungen zogen sich in die Länge, so dass erst am 10. August 1838 positiv über seinen Antrag entschieden wurde. Er übernahm das Protektorat in Südostaustralien, konnte aber nicht, wie ursprünglich geplant, alle tasmanischen Aborigines mitnehmen.
Zum Zeitpunkt von Robinsons Aufbruch nach Australien am 25. Februar 1839 wütete in der Reservation eine Grippeepidemie. Von den verbliebenen 96 Insassen waren nur acht transportfähig. Als Robinsons Familie später nach Port Phillipp nachkam, brachte sie weitere sieben Aborigines mit. Robinsons Sohn George blieb als Leiter des Reservats mit den Restlichen zurück, von denen bereits eine Woche nach Robinsons Abreise acht weitere starben. Von den dreizehn nach Australien deportierten tasmanischen Aborigines sahen nur fünf Tasmanien wieder. Zwei wurden in Australien öffentlich wegen Mordes gehängt, acht weitere wurden von Krankheiten dahingerafft.
1847 wurde Wybalenna auf Flinders Island aufgelöst und die inzwischen nur noch 47 Aborigines nach Oyster Cove am D´Entrecasteaux Channel in Südosttasmanien verlegt. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete Robinson noch als Protektor in Australien. Er besuchte die Verbliebenen nur noch einmal im April 1851 in Oyster Cove, bevor er im Mai 1852 für immer nach Europa zurückkehrte. Im Vergleich zu Flinders Island hatten sich ihre Lebensbedingungen noch verschlechtert. Das Gelände war eine Feuchtwiese und die Gebäude aus Holz waren dem kalten Südwind ausgesetzt. Dadurch wurden die meisten krank und dem Alkohol verfallen und wurden abseits der Gesellschaft ohne nennenswerte Unterstützung dem Vergessen bzw. dem Exitus preisgegeben. Am fünfzigsten Jahrestag der Gründung Hobarts (Sullivan’s Cove) waren noch sechzehn tasmanische Aborigines in Oyster Cove am Leben.
Am 8. Mai 1876 starb Truganini, die als die letzte Reinrassige ihres Volkes galt. Truganini nimmt unter den bekanntgewordenen tasmanischen Aborigines zumindest für die Forschung eine herausragende Stellung ein; nicht etwa wegen ihrer vielgepriesenen Schönheit, sondern auf Grund ihrer schillernden, charismatischen Persönlichkeit, die durch zahlreiche Berichte belegt ist. Sie ist die Aborigine, über die die meiste Detailinformation bekannt ist, und ihre Biografie ist eine Rekapitulation des Unterganges ihres Volkes. Als langjährige Begleiterin Robinsons in Tasmanien und Australien kann sie außerdem als dessen Hauptinformantin gelten.
Es ist bedenklich, wenn die indigene Bevölkerung Tasmaniens meist als mit Truganini ausgestorben bezeichnet wird, obwohl heute in Tasmanien und auf den Inseln der Bass-Straße mehrere Tausend Nachkommen weiblicher Aborigines und europäischer Robbenfänger leben. Diese dunkelhäutige Bevölkerung, die noch vor wenigen Jahren von der Regierung als Europäer eingestuft wurde, bezeichnete sich selbst, obwohl jeglicher Landrechte aberkannt, als Aborigines. Die Kultur der tasmanischen Aborigines dürfte aufgrund der überlebenden ‘Islanders’ nicht unwiederbringlich verloren sein.
Die Okkupation Tasmaniens durch die Briten verlief zeitgleich mit einer gesellschaftlichen Revolution, die die Diskriminierung ganzer Rassen verfolgte und nachträglich die Ausrottung der tasmanischen Urbevölkerung als „minderwertige Rasse“ legitimierte. Bis zu diesem Zeitpunkt galt nach biblischem Verständnis die Überzeugung, dass alle Menschen als gleich anzusehen seien. Auch wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse diesen Grundsatz zu keinem Zeitpunkt widerspiegelten - waren ja gesellschaftliche Unterdrückung aufgrund der Klassenzugehörigkeit, der Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht und Sklaverei allgegenwärtig -, war er doch weitgehend unbestritten. 1850 veröffentlichte jedoch ein schottischer Chirurg Namens Robert Knox Schriften unter dem Titel „The Races of Men, a Fragment„. Diese Schrift kann als Vorläufer zu Hitlers Machwerk „Mein Kampf„ verstanden werden, das in rassischen Konflikten die Ursache für alle geschichtlichen Ereignisse ausmacht. Damit setzte Knox einen Kontrapunkt zu dem kommunistischen Manifest von Marx und Engels, das zwei Jahre früher veröffentlicht worden war.
Knox war einer der ersten Autoren, die behaupteten, dass es sich nicht um unterschiedliche Rassen von Menschen, sondern vielmehr um unterschiedliche Spezies handele. Dabei verherrlichte er die angelsächsische Spezies, der er den größten Entwicklungsvorsprung bescheinigte. Knox's Buch brachte es sofort zum Bestseller. Zum ersten Mal wurde es gemeinhin akzeptiert, ja geradezu als schick angesehen, die Welt und die Menschen nach rassistischen Maßstäben zu betrachten und zu beurteilen.
Bis hinein ins späte 19. Jahrhundert galten die tasmanischen Aborigines als die Niederste aller menschlichen Spezies, die Urbevölkerung wurde als Zwischenstufe zwischen Primat und Mensch angesehen. Umso bemerkenswerter ist die Feststellung eines Lehrers in Lancashire, John Bradley, dass sein Schüler, genannt George Vandiemen - ein tasmanischer Aborigine - über herausragende Fähigkeiten auf dem Gebiet der Arithmetik verfüge. George Vandiemen wurde von dem weißen Siedler William Kermode aufgegriffen, als er einsam in der Nähe von New Norfolk umherstreifte. Der Siedler schickte den Jungen nach Lancashire, wo ihm Erziehung und Bildung angedeihen sollten. Im Gegensatz zur allgemeinen Meinung über die geistige Unzulänglichkeit der Aborigines waren die Schulleistungen des jungen George sehr gut. Nach seiner Rückkehr nach Tasmanien 1828 erkrankte George Vandiemen aber und starb bald darauf. Seine kurze Geschichte war bald vergessen. Von seinem Lehrer, John Bradley, stammt auch der Ausspruch: „May the revolutions of mind establish the empire of reason and benevolence over the ruins of ignorance and prejudice“. Übersetzt bedeutet das: „Möge die Revolution des Geistes eine Herrschaft des Verstandes und der Güte auf den Ruinen von Ignoranz und Vorurteilen errichten“.
Australische Pionierzeit
Bis in die frühen 1850er Jahre war Tasmanien, damals noch als Van Diemen's Land bekannt, vor allem eine Strafkolonie, in die über 75.000 Sträflinge deportiert wurden. Die Abschaffung der Sträflingstransporte 1853 läutete eine neue Ära ein. 1855 wurde der Name offiziell in "Tasmania" geändert, ein symbolischer Akt, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen und ein Image als freie Siedlerkolonie zu schaffen. Im November 1856 trat die erste selbstverwaltete Regierung unter Premier William Champ an, unterstützt von einem bikameralen Parlament mit House of Assembly und Legislative Council. Tasmanien führte 1856 als eines der ersten Territorien weltweit die geheime Wahl ein, was die demokratische Entwicklung stärkte. In den folgenden Jahrzehnten wuchs die Bevölkerung von etwa 90.000 (1861) auf 191.000 (1911), angetrieben durch Einwanderung und den Ausbau der Landwirtschaft, insbesondere Schafzucht und Hopfenanbau.
Wirtschaftlich erlebte Tasmanien einen Aufschwung. In den 1870er Jahren begann der Zinnbergbau, gefolgt von Kupfer in den 1890er Jahren, was die Insel zu einem wichtigen Rohstofflieferanten machte. Die Schließung der berüchtigten Strafkolonie Port Arthur 1877 symbolisierte das Ende der Sträflingszeit, während Infrastrukturprojekte wie Pferdebahnen in Hobart (1856) und die Gründung der University of Tasmania (1890) den gesellschaftlichen Fortschritt unterstrichen. Der Goldrausch in Victoria führte zwar zeitweise zur Abwanderung, doch Tasmanien erholte sich durch Exporte und einen aufkommenden Tourismus.
In den 1890er Jahren gewann die Idee einer australischen Föderation an Fahrt, um Handel, Verteidigung und Infrastruktur zu vereinheitlichen. Tasmanien beteiligte sich aktiv an den Verhandlungen, und 1898 stimmten rund 94 % der Tasmanier in einem Referendum für den Beitritt. Die Verfassung des Commonwealth, mitgestaltet von Tasmaniern wie Andrew Inglis Clark, trat am 1. Januar 1901 in Kraft, und Tasmanien wurde einer der sechs Gründungsstaaten. Die Föderation wurde mit Festen in Hobart und Launceston gefeiert, wobei Tasmanien seine eigene Verfassung und ein autonomes Parlament behielt, das nun mit der föderalen Regierung kooperierte.
Als Bundesstaat passte sich Tasmanien nach 1901 an die neue Ordnung an. Die Wirtschaft stützte sich weiter auf Bergbau und Forstwirtschaft, während die Einführung des Frauenwahlrechts 1903 und die erste Labor-Regierung unter John Earle 1914 soziale Reformen vorantrieben. Die Gründung des Hydro-Electric Department 1913 legte den Grundstein für die Nutzung der Wasserkraft, ein Schlüsselfaktor für die spätere Industrialisierung. Die föderale "Harvester-Entscheidung" von 1907 führte einen Mindestlohn ein, der auch Tasmanien zugutekam. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 stand die Insel vor neuen Herausforderungen, da viele junge Tasmanier rekrutiert wurden.
Weltkriegsära
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs im August 1914 trat Australien, einschließlich Tasmanien, sofort auf Seiten des britischen Empires in den Konflikt ein. Tasmanische Freiwillige schlossen sich den Australian Imperial Forces (AIF) an, darunter berühmte Einheiten wie die 40th Battalion, die aus tasmanischen Rekruten bestand. Die berüchtigte Landung bei Gallipoli am 25. April 1915, bei der australisch-neuseeländische Truppen (ANZAC) massive Verluste erlitten, markierte einen Wendepunkt: Tasmanien verlor Hunderte Soldaten in diesem Feldzug. Insgesamt fielen rund 2.000 Tasmanier, bei einer Beteiligung von über 12.000 Mann – ein hoher Blutzoll für die kleine Bevölkerung. Die Kriegsjahre brachten wirtschaftliche Belastungen durch Ressourcenknappheit, aber auch soziale Veränderungen: Frauen übernahmen zunehmend Arbeiten in der Industrie, und die Insel profitierte von der Nachfrage nach Wolle, Holz und Metallen für den Kriegseinsatz. Der ANZAC-Day wurde zu einem nationalen Gedenktag, der in Tasmanien bis heute begangen wird. Der Krieg verstärkte das australische Nationalgefühl, während er die Abhängigkeit vom Empire unterstrich.
Die Nachkriegsjahre brachten Tasmanien wirtschaftliche Erholung, aber auch Krisen. Die Landwirtschaft – mit Schwerpunkt auf Schafzucht, Hopfenanbau und Apfelproduktion – blieb der Wirtschaftsmotor, ergänzt durch Bergbau in Regionen wie Mount Lyell, wo Kupfer und Zinn abgebaut wurden. Die Große Depression ab 1929 traf die Insel hart: Arbeitslosigkeit stieg auf über 30 Prozent, und soziale Unruhen führten zu Streiks in der Forst- und Hüttenindustrie. Politisch dominierte die Australian Labor Party (ALP) in Tasmanien, mit Premierministern wie Joseph Lyons, der 1932 Bundespremierminister wurde und die Insel als „Modellstaat“ darstellte.
Ein Meilenstein der nationalen Identität war die Stiftung des Staatswappens: 1917 gewährte der britische König Georg V. Tasmanien ein offizielles Wappen, das im Mai desselben Jahres proklamiert wurde. Der Schild symbolisiert die tasmanischen Industrien mit einem Weizenbündel, Hopfen, einem Widder und Äpfeln; oben thront ein roter Löwe, und als Schildhalter dienen zwei Beutelwölfe (Thylacines), die das einzigartige tasmanische Erbe verkörpern. Das Motto „Ubertas et Fidelitas“ (Fruchtbarkeit und Treue) unterstreicht die Bindung an britische Traditionen. Dieses Wappen, das 1919 offiziell angenommen wurde, spiegelt den Stolz auf die Insel wider und wurde zu einem Symbol der Stabilität inmitten der Nachkriegsunruhen.
In den 1930er Jahren rückte die Umwelt in den Fokus: Die Ausrottung des Thylacines durch Jagd und Habitatverlust, die seit dem 19. Jahrhundert andauerte, kulminierte 1936 im Tod des letzten bekannten Exemplars. Am 7. September 1936 starb das Tier – oft fälschlich als „Benjamin“ benannt – im Beaumaris Zoo in Hobart, nur 59 Tage nach der verspäteten Schutzausweisung durch die Regierung. Dieses Ereignis markierte den endgültigen Verlust eines Symbols Tasmaniens und wurde später zum National Threatened Species Day am 7. September. Der Thylacine, der im Wappen von 1917 noch als lebendiges Wahrzeichen prangte, wurde posthum zum Sinnbild für menschliche Hybris und den Verlust der Biodiversität.
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 mobilisierte Tasmanien erneut Truppen für die Alliierten. Etwa 8.000 Tasmanier dienten in der Australian Army, Navy und Air Force, oft in Pazifik- und Nahost-Theatern. Die Insel selbst wurde zur strategischen Bastion: Die Regierung befürchtete japanische Angriffe nach Pearl Harbor 1941, weshalb Küstenfestungen errichtet und Luftschutzmaßnahmen ergriffen wurden. Hobart und Launceston beherbergten Trainingslager, und die Hydro-Elektrizitätswerke, die in den 1930er Jahren ausgebaut wurden, lieferten Energie für die Kriegsindustrie. Wirtschaftlich profitierte Tasmanien von der Nachfrage nach Aluminium und Schiffbau, doch Rationierungen und Luftschutzalarme belasteten die Zivilbevölkerung. Im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg gab es keine direkten Schlachten auf tasmanischem Boden, doch die Isolation der Insel verstärkte das Gefühl der Abgelegenheit. Der Krieg endete 1945 mit der Kapitulation Japans, und Tasmanien kehrte zu Friedenszeiten zurück, geprägt von den Verlusten von rund 600 Gefallenen.
Moderne Zeit
Nach 1945 profitierte Tasmanien vom australischen Nachkriegsboom, der durch Immigration aus Europa und Asien angetrieben wurde. Die Regierung förderte die Industrialisierung, insbesondere die Hydro-Elektrizitätsindustrie, die ab den 1950er Jahren massive Dammprojekte einleitete. Die Gründung der Hydro-Electric Commission (heute Hydro Tasmania) 1930 erreichte ihren Höhepunkt in den 1950er und 1960er Jahren mit dem Bau von Kraftwerken wie dem Gordon Dam, die die Insel zu einem Energieexporteur machten. Dies schuf Tausende Jobs in der Bau- und Bergbauindustrie, doch es führte auch zu frühen Umweltkonflikten, etwa der Überschwemmung von Tälern. Die Landwirtschaft blieb zentral: Apfelanbau, Schafzucht und Fischerei dominierten, ergänzt durch aufstrebende Sektoren wie Textilien und Schiffbau in Hobart und Launceston. Die Bevölkerung wuchs durch Zuzug, und Städte wie Hobart modernisierten sich mit neuen Infrastrukturen, darunter die Eröffnung der Tasman Bridge 1964, die den Verkehr über den Derwent River revolutionierte.
Die 1970er Jahre markierten einen Wendepunkt durch Umweltproteste, die Tasmanien zu einer Wiege des globalen Grünpolitischen machten. Der Kampf gegen die Überschwemmung des Lake Pedder 1972 führte 1972 zur Gründung der United Tasmania Group, der weltweit ersten Green Party. Dies mündete in den massiven Protesten gegen den Franklin Dam in den frühen 1980er Jahren, bei denen Blockaden und internationale Aufmerksamkeit die Regierung zum Einlenken zwangen. 1983 stoppte die bundesstaatliche Intervention das Projekt, und 1982 wurde der Tasmanian Wilderness World Heritage Area ausgerufen, der heute 30 Prozent der Insel umfasst. Politisch schwankte Tasmanien zwischen Labor und Liberal Parties; Premier Doug Lowe (1977 bis 1981) symbolisierte den progressiven Wandel. Ein tragisches Highlight war die Katastrophe der Tasman Bridge am 5. Januar 1975: Der Frachtschiff Lake Illawarra rammte die Brücke über den Derwent River, sodass mehrere Segmente einstürzten und die östlichen und westlichen Teile von Hobart voneinander getrennt wurden. Zwölf Menschen starben – sieben Crewmitglieder und fünf Autofahrer –, und die Stadt war monatelang auf Fähren angewiesen. Die Reparatur kostete Millionen und dauerte bis 1977; sie förderte den Ausbau des Fährverkehrs und langfristig die Entwicklung des Eastern Shore zu einer eigenständigeren Region mit mehr Jobs und Dienstleistungen.
In den 1990er Jahren fokussierte sich Tasmanien auf Tourismus und Nachhaltigkeit, unterstützt durch die Anerkennung indigener Rechte. Die palawa-Community, Nachkommen der Ureinwohner, gewann an Einfluss: 1995 wurde der Aboriginal Land Council of Tasmania gegründet, und Landrückgaben wie Cape Barren Island 2005 stärken die kulturelle Revitalisierung. Wirtschaftlich boomte der Weinbau (besonders Pinot Noir), der Ökotourismus und die Filmindustrie – Filme wie „The Last Wave“ (1977) hatten bereits Aufmerksamkeit erregt. Die Bevölkerung alterte, doch Immigration und Bildungsinvestitionen hielten das Wachstum aufrecht. Umweltkatastrophen wie die Buschbrände von 1967 und 2019 unterstrichen die Vulnerabilität der Insel, führten aber zu besseren Schutzmaßnahmen. Politisch stabilisierte sich Tasmanien unter Premiers wie Paul Lennon (Labor) und Will Hodgman (Liberals), mit Fokus auf grüne Energie – heute deckt Hydro Tasmania 100 Prozent des Bedarfs aus erneuerbaren Quellen.
Die Maßnahmen der Corona-Zeit (ab 2020) trafen Tasmanien hart, obwohl die Insel an sich schon isoliert war. Als Teil Australiens schloss Tasmanien früh die Grenzen und erreichte hohe Impfraten. Bis Ende 2021 waren über 95 Prozent der Bevölkerung ein- und 90 Prozent zweimal geimpft. Dennoch gab es Wellen: Bis 2025 wurden über 287.000 Fälle registriert, mit 18 Todesfällen bis Januar 2022, hauptsächlich Ältere mit Vorerkrankungen. Lockdowns, Maskenpflicht und Grenzschließungen isolierten die Insel weiter – der „Trans-Tasman Bubble“ mit Neuseeland brach mehrmals zusammen. Wirtschaftlich litt der Tourismus (bis zu 80 Prozent Einbußen), doch die Regierung pumpte Milliarden in Unterstützung, was den Arbeitsmarkt stabilisierte. Die Cortona-Zeit beschleunigte den Digitalisierungsboom und Umweltinitiativen, da weniger Besucher die Wildnis entlasteten.
Verwaltung
1856 erlangte Tasmanien eine eigene Verfassung und Regierung. Seit 1901 gehört die Insel zum Australischen Bund.
Herrschaftsgeschichte
- -40.000 bis 26. Januar 1788 Stammesgemeinschaften der Palawa
- 26. Januar 1788 bis 3. Dezember 1803 Kolonie Neusüdwales (New South Wales) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland)
- 13. September 1803 bis 3. Dezember 1825 Kolonie Van Diemans Land (Coony of Van Diemen’s Land) als Teil der Kolonie Neusüdwales (New South Wales) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland)
- 3. Dezember 1825 bis 1. November 1856 Kolonie Van Diemans Land (Colony of Van Diemen’s Land) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland)
- 1. November 1856 bis 31. Dezember 1900 Kolonie Tasmania (Colony of Tasmania) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland)
- seit 1. Januar 1901 Bundesstaat Tasmanien (State of Tasmania) des Australischen Bundes (Commonwealth of Australia)
Verfassung
Im Jahr 1856 wurde Tasmanien ein eigener Staat mit eigenständiger Regierung. Die damals erlassene Verfassung bildet bis heute die Grundlage des politischen Lebens auf der Insel.
Legislative und Exekutive
Tasmanien besitzt ein Zweikammerparlament. Das Oberhaus, der Legislative Council bzw. Upper House hat 15 Mitglieder. Das Tasmanian House of Assembly bzw. Lower House hat 25 direkt vom Volk gewählte Mitglieder. Die Exekutive wird vom Premierminister von Tasmanien und dessen Kabinett gebildet.
Auf der Ebene des Bundesstaates ist der Gouverneur von Tasmanien der Vertreter des britischen Monarchen, derzeit König Charles III. Er hat hauptsächlich zeremonielle Aufgaben und wird auf Vorschlag des Premierministers vom Monarchen ernannt. Die Regierung von Tasmanien ist für Bereiche wie Bildung, Gesundheit, Justiz, Polizei und Verkehrswesen zuständig.
Inseloberhaupt
Staatsoberhaupt ist offiziell die britische Königin Elisabeth II, deren tatsächliche Macht sich jedoch in Grenzen hält. Das Oberhaupt der britischen Krone wird durch einen Gouverneur vertreten.
Commandant (Kommandant)
- 11 Sep 1803 - 1804 John Bowen (1780 - 1827)
Lieutenant governor (Vizegouverneur)
- 16 Feb 1804 - 24 Mar 1810 David Collins (1756 - 1810)
Commandants (Kommandanten)
- 24 Mar - 8 Jul 1810 Edward Lord (1781 - 1859)
- 8 Jul 1810 - 20 Feb 1812 John Murray (1768 - 1827)
- im Norden -
- Okt 1804 - Nov 1808 William Paterson (1755 - 1810)
- Nov 1808 - Jan 1810 John Brabyn (1758 - 1835)
- Jan 1810 - Jun 1812 George Alexander Gordon
- Jun - 1 Jul 1812 John Ritchie (1781 - nach 1820)
- auf der ganzen Insel -
- 20 Feb 1812 - 4 Feb 1813 Andrew E. Geils (1773 - 1843)
Lieutenant governors (Vizegouverneure)
- 4 Feb 1813 - 9 Apr 1817 Thomas Davey (1758 - 1823)
- 9 Apr 1817 - 14 Mai 1824 William Sorell (1775 - 1848)
- 14 Mai 1824 - 31 Okt 1836 George Arthur (1784 - 1854)
- 31 Okt 1836 - 6 Jan 1837 Kenneth Snodgrass [amtierend] (1784 - 1853)
- 6 Jan 1837 - 21 Aug 1843 Sir John Franklin (1786 - 1847)
- 21 Aug 1843 - 13 Okt 1846 Sir John Eardley-Wilmot (1783 - 1847)
- 13 Okt 1846 - 26 Jan 1847 Charles Joseph La Trobe [amtierend] (1801 - 1875)
- 26 Jan 1847 - 8 Jan 1855 Sir William Thomas Denison (1804 - 1871)
Governors (Gouverneure)
- 8 Jan 1855 - 11 Dez 1861 Sir Henry Edward Fox Young (1803 - 1870)
- 11 Dez 1861 - 30 Dez 1868 Thomas Gore Browne (1807 - 1887)
- 30 Dez 1868 - 15 Jan 1869 William Cosmo Trevor [amtierend] (1826 - 1894)
- 15 Jan 1869 - 30 Nov 1874 Charles Du Cane (1825 - 1889)
- 30 Nov 1874 - 13 Jan 1875 Sir Francis Smith [amtierend] (1819 - 1909)
- 13 Jan 1875 - 6 Apr 1880 Frederick Aloysius Weld (1823 - 1891)
- 6 Apr - 21 Okt 1880 Sir Francis Smit [2, amtierend]
- 21 Okt 1880 - 7 Dez 1881 Sir Henry Lefroy [amtierend] (1817 - 1890)
- 7 Dez 1881 - 29 Okt 1886 Sir George Cumine Strahan (1838 - 1887)
- 29 Okt - 18 Nov 1886 William Robert Giblin [amtierend] (1840 - 1887)
- 18 Nov 1886 - 11 Mar 1887 Sir William Lambert Dobson [amtierend] (1833 - 1898)
- 11 Mar 1887 - 30 Nov 1892 Sir Robert George Crookshank Hamilton (1836 - 1895)
- 30 Nov 1892 - 8 Aug 1893 Sir William Lambert Dobson [2, amtierend]
- 8 Aug 1893 - 19 Aug 1900 Jenico William Joseph Preston, Viscount Gormanston (1837 - 1907)
- 19 Aug 1900 - 8 Nov 1901 Sir John Stockell Dodds [amtierend] (1848 - 1914)
- 8 Nov 1901 - 16 Apr 1904 Sir Arthur Elibank Havelock (1844 - 1908)
- 16 Apr - 29 Sep 1904 Sir John Stockell Dodds [2, amtierend]
- 28 Okt 1904 - 20 Mai 1909 Sir Gerald Strickland (1861 - 1940)
- 20 Mai - 29 Sep 1909 Sir John Stockell Dodds [3, amtierend]
- 29 Sep 1909 - 10 Mar 1913 Sir Henry Barron (1847 - 1921)
- 10 Mar - 4 Jun 1913 Sir John Stockell Dodds [4, amtierend]
- 4 Jun 1913 - 31 Mar 1917 Sir William Grey Ellison Macartney (1852 - 1924)
- 31 Mar - 6 Jul 1917 Sir Herbert Nicholls [amtierend] (1868 - 1940)
- 6 Jul 1917 - 9 Feb 1920 Sir Francis Alexander Newdigate (1862 - 1936)
- 9 Feb - 16 Apr 1920 Sir Herbert Nicholls [2, amtierend]
- 16 Apr 1920 - 28 Jan 1922 Sir William Lamond Allardyce (1861 - 1930)
- 28 Jan 1922 - 26 Nov 1923 Norman Kirkwood Ewing [amtierend] (1870 - 1928)
- 26 Nov 1923 - 23 Dez 1924 Sir Herbert Nicholls [3, amtierend]
- 23 Dez 1924 - 23 Dez 1930 Sir James O'Grady (1866 - 1934)
- 23 Dez 1930 - 4 Aug 1933 Sir Herbert Nicholls [4, amtierend]
- 4 Aug 1933 - 20 Jul 1945 Sir Ernest Clark (1864 - 1951)
- 20 Jul - 24 Dez 1945 Sir John Demetrius Morris [amtierend] (1902 - 1956)
- 24 Dez 1945 - 9 Mai 1951 Sir Thomas Hugh Binney (1883 - 1953)
- 9 Mai - 22 Aug 1951 Sir John Demetrius Morris [2, amtierend]
- 23 Aug 1951 - 4 Jun 1958 Sir Ronald Hibbert Cross (1896 - 1968)
- 4 Jun 1958 - 21 Okt 1959 Sir Stanley Charles Burbury [amtierend] (1909 - 1995)
- 21 Okt 1959 - 26 Mar 1963 Thomas Godfrey Polson Corbett, Baron Rowallan (1895 - 1977)
- 26 Mar - 24 Sep 1963 Sir Stanley Charles Burbury [2, amtierend]
- 24 Sep 1963 - 12 Jul 1968 Sir Charles Henry Gairdner (1898 - 1983)
- 12 Jul - 1 Dez 1968 Sir Stanley Charles Burbury [3, amtierend]
- 2 Dez 1968 - 30 Nov 1973 Sir Edric Montague Bastyan (1903 - 1980)
- 30 Nov - 4 Dez 1973 Guy Green [amtierend] (1937 - 2025)
- 5 Dez 1973 - 16 Mar 1982 Sir Stanley Charles Burbury [4]
- 16 Mar - 1 Okt 1982 Sir Guy Green [2, amtierend]
- 1 Okt 1982 - 8 Mai 1987 Sir James Plimsoll (1917 - 1987)
- 8 Mai - 19 Okt 1987 Sir Guy Green [3, amtierend]
- 19 Okt 1987 - 2 Okt 1995 Sir Phillip Bennett (1928 - 2023)
- 2 Okt 1995 - 3 Okt 2003 Sir Guy Green [4]
- 3 Okt 2003 - 9 Aug 2004 Richard Butler (* 1942)
- 9 Aug - 3 Dez 2004 William Cox [amtierend] (* 1936)
- 3 - 15 Dez 2004 Peter Underwood [amtierend] (1937 - 2014)
- 15 Dez 2004 - 2 Apr 2008 William Cox [2]
- 2 Apr 2008 - 7 Jul 2014 Peter Underwood [2]
- 7 - 9 Jul 2014 David Porter [amtierend]
- 9 Jul - 10 Dez 2014 Alan Blow [amtierend]
- 10 Dez 2014 - 9 Jun 2021 Catherine Ann „Kate“ Warner [w] (*1948)
- 9 - 16 Jun 2021 Alan Blow [2, amtierend]
- seit 16 Jun 2021 Barbara Avalon Baker [w] (* 1958)
Premiers (Premieminister)
- 1 Nov 1856 - 26 Feb 1857 William Thomas Napier Champ (1808 - 1892)
- 26 Feb - 25 Apr 1857 Thomas George Gregson (1798 - 1874)
- 25 Apr - 12 Mai 1857 William Pritchett Weston (1804 - 1888)
- 12 Mai 1857 - 1 Nov 1860 Francis Smith
- 1 Nov 1860 - 2 Aug 1861 William Pritchett Weston [2]
- 2 Aug 1861 - 20 Jan 1863 Thomas Daniel Chapman (1815 - 1884)
- 20 Jan 1863 - 24 Nov 1866 James Whyte (1820 - 1882)
- 24 Nov 1866 - 1 Aug 1869 Sir Richard Dry (1815 - 1869)
- 4 Aug 1869 - 4 Nov 1872 James Milne Wilson (1812 - 1880)
- 4 Nov 1872 - 4 Aug 1873 Frederick Maitland Innes (1816 - 1882)
- 4 Aug 1873 - 20 Jul 1876 Alfred Kennerley (1810 - 1897)
- 20 Jul 1876 - 9 Aug 1877 Thomas Reibey (1821 - 1912)
- 9 Aug 1877 - 3 Mar 1878 Philip Oakley Fysh (1835 - 1919)
- 3 Mar - 20 Dez 1878 William Robert Giblin [amtierend]
- 20 Dez 1878 - 30 Okt 1879 William Lodewyk Crowther (1817 - 1885)
- 30 Okt 1879 - 15 Aug 1884 William Robert Giblin [2]
- 15 Aug 1884 - 8 Mar 1886 Adye Douglas (1813 - 1906)
- 8 Mar 1886 - 29 Mar 1887 James Wilson Agnew (1818 - 1901)
- 30 Mar 1887 - 17 Aug 1892 Philip Oakley Fysh [2] LP
- 17 Aug 1892 - 14 Apr 1894 Henry Dobson (1841 - 1918) CP
- 14 Apr 1894 - 12 Okt 1899 Sir Edward Nicholas Coventry Braddon (1829 - 1904) FT
- 12 Okt 1899 - 9 Apr 1903 Neil Elliott Lewis (1st time) (1850 - 1935) CP
- 9 Apr 1903 - 11 Jul 1904 William Bispham Propsting (1861 - 1937) L-D
- 11 Jul 1904 - 19 Jun 1909 John William Evans (1855 - 1943) LP
- 19 Jun - 20 Okt 1909 Sir Neil Elliott Lewis [2] LP
- 20 - 27 Okt 1909 John Earle (1865 - 1932) ALP
- 27 Okt 1909 - 14 Jun 1912 Sir Neil Elliott Lewis [3] LP
- 14 Jun 1912 - 6 Apr 1914 Albert Edgar Solomon (1876 - 1914) LP
- 6 Apr 1914 - 15 Apr 1916 John Earle [2] ALP
- 15 Apr 1916 - 12 Aug 1922 Sir Walter Henry Lee (1874 - 1963) LP
- 12 Aug 1922 - 14 Aug 1923 John Blyth Hayes (1868 - 1956) LP
- 14 Aug - 25 Okt 1923 Sir Walter Henry Lee [2] NP
- 25 Okt 1923 - 15 Jun 1928 Joseph Aloysius Lyons (1879 - 1939) ALP
- 15 Jun 1928 - 15 Mar 1934 John Cameron McPhee (1878 - 1952) NP
- 15 Mar - 22 Jun 1934 Sir Walter Henry Lee [3] NP
- 22 Jun 1934 - 10 Jun 1939 Albert George Ogilvie (1891 - 1939) ALP
- 11 Jun - 18 Dez 1939 Edmund Dwyer-Gray (1870 - 1945) ALP
- 18 Dez 1939 - 18 Dez 1947 Robert Cosgrove (1884 - 1969) ALP
- 18 Dez 1947 - 24 Feb 1948 William Edward Brooker (1891 - 1948) ALP
- 25 Feb 1948 - 25 Aug 1958 Sir Robert Cosgrove [2] ALP
- 26 Aug 1958 - 26 Mai 1969 Eric Elliot Reece (1909 - 1999) ALP
- 26 Mai 1969 - 3 Mai 1972 Walter Angus Bethune (1908 - 2004) LP
- 3 Mai 1972 - 31 Mar 1975 Eric Elliot Reece [2] ALP
- 31 Mar 1975 - 1 Dez 1977 William Arthur Neilson (1925 - 1989) ALP
- 1 Dez 1977 - 11 Nov 1981 Douglas Ackley Lowe (* 1942) ALP
- 11 Nov 1981 - 26 Mai 1982 Harry Norman Holgate (1933 - 1997) ALP
- 27 Mai 1982 - 29 Jun 1989 Robin Trevor Gray (* 1940) LP
- 29 Jun 1989 - 17 Feb 1992 Michael Walter Field (* 1948) ALP
- 17 Feb 1992 - 18 Mar 1996 Raymond „Ray“ John Groom (* 1944) LP
- 18 Mar 1996 - 14 Sep 1998 Anthony „Tony“ Maxwell Rundle (1939 - 2025) LP
- 14 Sep 1998 - 21 Mar 2004 James „Jim“ Alexander Bacon (1950 - 2004) ALP
- 23 Feb 2004 - 26 Mai 2008 Paul Lennon [amtierend für Bacon bis 21 Mar 2004] (* 1955) ALP
- 26 Mai 2008 - 24 Jan 2011 David Bartlett (* 1968) ALP
- 24 Jan 2011 - 31 Mar 2014 Lara Giddings [w] (* 1972) ALP
- 31 Mar 2014 - 20 Jan 2020 William „Will” Hodgman (* 1969) LP
- 20 Jan 2020 - 8 Apr 2022 Peter Carl Gutwein (* 1964) LP
- seit 8 Apr 2022 Jeremy Page Rockluiff (* 1970) LP
Politische Gruppierungen
Die Tasmanian Greens sind eine politische Partei in Tasmanien, Australien. Sie sind Teil der Australian Greens, die nach föderalistischen Gesichtspunkten organisiert sind. Diese Partei verfolgt ökologische, sozialpolitisch gerechte, friedenspolitische und basisdemokratische Ziele. Sie begreift sich als Teil der globalen ökologischen Bewegung. In Tasmanien entstanden erste umweltpolitische Gruppierungen, die sich gegen den Bau der Staudämme am Lake Pedder wendeten, in den 1960er Jahren. Während dieser Auseinandersetzungen bildete sich die Partei United Tasmania Group, die erste Grüne Partei der Welt, die 1972 gegründet wurde und ihre Arbeit Ende des Jahres 1979 einstellte. Die Tasmania Greens, 1990 für die Wahlen in Tasmanien formiert, verstehen sich als ihre Nachfolgepartei.
Der unabhängige Norm Sanders wurde 1980 als erster grüner Parlamentarier Australiens gewählt. Als er seinen Sitz 1982 abgab, wurde Bob Brown, ein Arzt aus Launceston, in Tasmanien gewählt. 1989 kamen Christine Milne, Lance Armstrong und Di Hollister ins Parlament. Brown trat aus dem Parlament 1993 aus, um in die Bundespolitik Australiens zu gehen. Diesen Sitz nahm Peg Putt ein, und die parlamentarische Führung der Partei übernahm Christine Milne. Gerry Bates trat im Mai 1995 zurück. Seinen Sitz übernahm Mike Foley. Das politische Programm der Tasmanian Greens umfasst Ökologie, Demokratie, Frieden, soziale Gerechtigkeit, nachhaltige Ökonomie, sinnvolle Arbeit, Kultur, umfassende Informationspolitik, globale Verantwortung, sichere Zukunft und Gerechtigkeit für die Aborigines. Des Weiteren sind Frauenpolitik, Kunstförderung und verbesserte Kontrolle über Waffen genannt.
Als im Jahre 1998 die Labour Party und die Liberal Conservative Party (Liberal-Konservative Partei) in Tasmanien die Anzahl der Sitze im Tasmanischen Parlament von 35 auf 25 reduzierten, verloren drei grüne Parlamentarier ihren Sitz, obwohl sie insgesamt lediglich 0,5 % weniger Stimmen als in der vorausgegangenen Wahl hatten. 1999 gewann die Partei in den kommunalen Wahlen Stimmen hinzu und 2002 wurden vier Sitze im Tasmanischen Parlament gewonnen.
Justizwesen und Kriminalität
Das Justizsystem Tasmaniens ist ein zentraler Bestandteil der staatlichen Ordnung und eng mit dem australischen Bundesrecht verknüpft, basiert jedoch primär auf tasmanischen Gesetzen. Es wird vom Department of Justice verwaltet, das für die Durchsetzung von Rechten, Streitbeilegung und eine sichere Gesellschaft verantwortlich ist. Zu den Kerninstitutionen gehören der Supreme Court of Tasmania, der schwere Straf- und Zivilfälle sowie Berufungen bearbeitet, und der Magistrates Court, der für kleinere Strafsachen, Jugendkriminalität und Zivilstreitigkeiten zuständig ist. Das Tasmanian Civil and Administrative Tribunal (TASCAT), seit 2021 aktiv, behandelt administrative und zivilrechtliche Angelegenheiten.
Der Strafvollzug wird von der Tasmania Prison Service organisiert, mit Einrichtungen wie dem Risdon Prison in Hobart und dem Northern Correctional Facility in Launceston. Der Fokus liegt auf Rehabilitation, etwa durch den Strategic Plan for Corrections 2023 ("Changing lives creating futures"). Jugendstrafrecht wird reformiert, mit dem Youth Justice Blueprint 2024–2034, der therapeutische Ansätze und eine neue Einrichtung in Pontville (geplant für 2026) vorsieht. Die Digitalisierung des Justizsystems schreitet durch das Astria-Projekt voran, das digitale End-to-End-Lösungen einführt. Neue Gesetze stärken den Opferschutz, etwa durch das Witness Intermediary Scheme für Menschen mit Kommunikationsschwierigkeiten, und verhindern Missbrauch, wie das Verbot der Fahrer-Impersonation bei Sexualstraftätern. Historisch wurzelt das System in der Kolonialzeit als Strafkolonie (speziell Port Arthur), ist heute jedoch modern, transparent und inklusiv.
In puncto Kriminalität gilt Tasmanien als einer der sichersten australischen Bundesstaaten, mit niedrigeren Raten bei Eigentumsdelikten und Körperverletzungen als im Bundesschnitt. Dennoch zeigen Statistiken der Tasmania Police und des Australian Bureau of Statistics (ABS) für 2023/24 einen Anstieg der Gesamtdelikte um 10 % (35.998 Delikte, +3.377 gegenüber 2023). Körperverletzungen stiegen um 8 % (4.412 Opfer), wobei 41 % familienbezogen sind. Autodiebstähle sanken um 11 % (1.493 Fälle), während andere Diebstähle (11.279 Fälle, +11 %) den höchsten Stand seit 2003 erreichten, insbesondere in Geschäften (62%). Morde bleiben mit 10 Fällen stabil und niedrig. Besorgniserregend ist die Jugendkriminalität: Jugendliche (10–17 Jahre) verübten 5.782 Delikte (+52% seit 2022), vor allem Diebstähle und Einbrüche, wobei 42% Mehrfachtäter sind. Nord-Tasmanien verzeichnete 11.128 Delikte (+11%). Die Aufklärungsrate liegt bei 50–60%, doch die "Dark Figure" (nicht gemeldete Delikte) bleibt hoch. Ursachen für den Anstieg sind bessere Meldepraktiken und sozioökonomische Faktoren wie steigende Lebenshaltungskosten. Die Polizei setzt auf Prävention, etwa durch verstärkte Patrouillen (Taskforce Raven) und Maßnahmen gegen Jugendrezidive. Öffentliche Sicherheitswahrnehmung liegt laut Numbeo-Index bei 40–50/100 (mäßig sicher).
Flagge und Wappen
Tasmanien führte im Jahr 1875 die erste Flagge ein, verwearf sie jedoch nur einen Monat später zugunsten der heute gültigen, da sie nicht den von der britischen Admiralität festgelegten Vorgaben entsprach. Im Flugteil war das Kreuz des Südens mit fünfstrahligen Sternen abgebildet.
Die heutige Flagge von Tasmanien wurde am 25. September 1876 zunächst inoffiziell eingeführt. Sie ist eine Variante der britischen Blue Ensign, mit dem Staatsabzeichen im Flugteil. Das Abzeichen ist eine weiße Scheibe mit einem schreitenden roten Löwen in der Mitte. Die genaue Bedeutung dieses Designs ist nicht bekannt, doch es wird angenommen, dass der Löwe einen Bezug zu England herstellt. Die Flagge ist fast unverändert geblieben, mit Ausnahme einer kleinen Detailänderung beim Löwen im Jahr 1975, als die Regierung die Flagge auch offiziell einführte.
Das Wappen von Tasmanien, einem Bundesstaat Australiens auf der Insel Tasmanien, ist in Rot und Blau geviert mit einem übergelegten weißen Balken mit einem goldenen Schaf. Im ersten Feld eine goldene Garbe und im vierten goldener Hopfen; Im zweiten und im dritten Feld mit Silber beginnend liegen zwei blaue Balken über denen erst eine goldene Figur und dann vier goldene Äpfel liegen. Über den Schild schwebt ein rot-weißer Crest mit einem roten laufenden Löwen, der sich mit der rechten Vorderpfote auf einer Schaufel und einer Spitzhacke stützt. Schildhalter ist rechts und links je ein goldener Beutelwolf auf einem goldenem Arabeskengitter stehend. Unter dem Schild ein weißes Band und den Worten in schwarzen Majuskeln Ubertas et Fidelitas („Fruchtbarkeit und Treue“). Das Wappen wurde am 29. Mai 1917 offiziell durch König George V. des Vereinigten Königreichs gewährt und im Jahr 1919 angenommen.
Nationale Symbole:
- Farbe: rot
- Pflanze: Blauer Eukalyptus (Tasmanian Blue Gum, eucalypts globulus)
- Tier: Tasmanischer Teufel (Tasmanian Devil, sarcophilus harrisii)
- Motto: Ubertas et Fidelitas (Fertility and Faithfulness - Fruchtbarkeit und Treue)
- Held: Abel Janszoon Tasman (1603 bis 1659)
Hymne
Tasmanien hat keine offizielle Staatshymne im Sinne einer verbindlichen Nationalhymne. Die australische Nationalhymne „Advance Australia Fair“ gilt auch für Tasmanien und wird bei offiziellen Anlässen gespielt. Dennoch gibt es historische und kulturelle Lieder, die als inoffizielle Hymnen oder patriotische Songs gelten und die Identität der Insel betonen. Diese wurzeln oft in der Kolonialzeit und feiern die natürliche Schönheit, die Geschichte und den Stolz der Tasmanier.
Eine der bekanntesten historischen Hymnen ist The Tasmanian National Anthem, komponiert von Frederick Augustus Gow Packer (1839 bis 1902), einem Organisten aus Hobart. Das Stück wurde um 1879 veröffentlicht und erstmals 1879 bei einem Konzert in Hobart aufgeführt. Es diente als patriotisches Lied für die Kolonie Tasmanien und wird heute noch bei Gedenkveranstaltungen wie dem Boer-War-Commemoration-Day in Hobart und Launceston gespielt. Die Noten und der Text sind in Archiven wie der State Library of Tasmania erhalten.
1. All hail the land we love so well,
Bright jewel of the sea,
Fair home of England's stalwart sons,
The brave, the bold and free!
Where bright-eyed maidens gaily sing,
And peace and plenty reign,
And beauty smiles of ev'ry side,
O'er mountain, vale and plain.
Chorus:
Tasmania! Land of joy and peace,
whose sons are true and brave,
No scomful foe shall lay thee low,
While England rules the wave!
2. May love and joy around thee watch,
And God thy ways defend,
Thy children walk in honour's paths,
Until their journey's end,
May right prevail and might assist,
When foes assail thy cause,
And rulers true with wisdom frame,
Thy people's ways and laws.
Chorus:
Tasmania! Land of joy and peace,
whose sons are true and brave,
No scomful foe shall lay thee low,
While England rules the wave!
Hauptstadt
Hobart, ursprünbglich Hobarttown, ist seit der Einrichtung der Kolonie im Jahr 1804 dessen Hauptstadt. Hobart wurde von Lieutenant-Governor David Collins in Sullivan’s Cove am Derwent River gegründet, nachdem ein erster Siedlungsversuch 1803 in Risdon Cove gescheitert war. Vor 1804 gab es keine europäische Verwaltung oder Hauptstadt, da Tasmanien (damals Van Diemen’s Land) nur von den indigenen Palawa bewohnt wurde, die keine zentralisierte Verwaltungsstruktur hatten. Hobart blieb seitdem ununterbrochen die Hauptstadt, auch nach der Umbenennung in Tasmanien (1856) und dem Beitritt zum Commonwealth of Australia (1901).
Verwaltungsgliederung
Die ersten Verwaltungseinheiten Tasmaniens waren Distrikte (districts). 1846 bestanden die folgenden Distrikte:
- Georgetown
- Launceston
- South Esk
- North Esk
- Norfolk Plains
- Western River
- Lake River
- Bathurst
- Lennox
- Richmond
- Methven
- Amherst
- Staffa
- Bath
- Murray
- Sorell
- Green Ponds
- Ormaig
- Harrington
- Gloucester
- Caledon
- Ulva
- Jarvis
- Strangford
- Macquarie
- New Norfolk
- Melville
- Drummond
- Queenboro
- Sussex
- Clarence Plains
- Cambridge
- Forbes
- Glenorchy
- Argyle
- Kingboro
1850 wurde die Verwaltungsstruktur neu geordnet. Tasmanien bestand von nun aus 18 Grafschaften (counties). Es waren dies:
- Arthur County
- Buckingham County
- Cornwall County
- Cumberland County
- Devon County
- Dorset County
- Franklin County
- Glamorgan County
- Kent County
- Lincoln County
- Monmouth County
- Montagu County
- Montgomery County
- Pembroke County
- Russell County
- Somerset County
- Wellington County
- Westmoreland County
Der seit 1901 als solcher bestehende australische Bundesstaat Tasmanien ist heute in 29 lokale Selbstverwaltungsgebiete, so genannte Local Government Areas (LGA), eingeteilt (Stand August 2006). Sie tragen jeweils zusätzlich die formelle Bezeichnung City oder Municipality. Diese Unterscheidung ist historisch bedingt, hat aber heute keine Bedeutung mehr.
| Local
Government Area |
Hauptort | Fläche
(km²) |
Bevölkerung 2006 | Dichte (E/km²) | Gebiet |
| Break O'Day | Saint Helens | 3809,8 | 6218 | 1,6 | North-east area |
| Brighton | Brighton | 168 | 14329 | 85,3 | Hobart area |
| Central Coast | Ulverstone | 931,1 | 21259 | 22,8 | North-west and west coast |
| Central Highlands | Hamilton | 7976,4 | 2316 | 0,3 | Central |
| Circular Head | Smithton | 4917 | 8188 | 1,7 | North-west and west coast |
| City of Burnie | Burnie | 618 | 19701 | 31,9 | North-west and west coast |
| City of Clarence | Rosny Park | 386 | 50808 | 131,6 | Hobart area |
| City of Devonport | Devonport | 116 | 24880 | 214,5 | North-west and west coast |
| City of Glenorchy | Glenorchy | 120 | 44179 | 368,2 | Hobart area |
| City of Hobart | Hobart | 76,2 | 49556 | 650,3 | Hobart area |
| City of Launceston | Launceston | 1405 | 64620 | 46 | Launceston area |
| Derwent Valley | New Norfolk | 4111 | 9692 | 2,4 | South-east area |
| Dorset | Scottsdale | 3196 | 7253 | 2,3 | North-east area |
| Flinders | Whitemark | 1333 | 881 | 0,7 | North-east area |
| George Town | George Town | 652,6 | 6744 | 10,3 | Launceston area |
| Glamorgan Spring Bay | Triabunna | 2522 | 4329 | 1,7 | South-east area |
| Huon Valley | Huonville | 5497 | 14442 | 2,6 | South-east area |
| Kentish | Sheffield | 1187 | 5965 | 5 | North-west and west coast |
| King Island | Currie | 1100 | 1703 | 1,5 | North-west and west coast |
| Kingborough | Kingston | 717 | 31706 | 44,2 | Hobart area |
| Latrobe | Latrobe | 550 | 8888 | 16,2 | North-west and west coast |
| Meander Valley | Westbury | 3821 | 18938 | 5 | Launceston area |
| Northern Midlands | Longford | 5130 | 12505 | 2,4 | Central |
| Sorell | Sorell | 582,6 | 12131 | 20,8 | Hobart area |
| Southern Midlands | Oatlands | 2561 | 5845 | 2,3 | Central |
| Tasman | Nubeena | 660 | 2317 | 3,5 | South-east area |
| Waratah-Wynyard | Wynyard | 1187 | 13815 | 11,6 | North-west and west coast |
| West Coast | Zeehan | 9574,5 | 5171 | 0,5 | North-west and west coast |
| West Tamar | Beaconsfield | 689 | 21543 | 31,3 | Launceston area |
| Tasmanien | Hobart | 65594,2 | 489922 | 7,5 |
Verwaltungseinheiten:
29 local government areas (Selbstverwaltungsgebiete), davon 2 auf Nebeninseln
480 parishes (Gemeinden)
Bevölkerung
Im Jahr 2001 lebten auf Tasmanien laut amtlicher Statistik 472.931 Einwohner. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von 6,9 Einwohnern pro km². 2025 waren es 573.479. Davon lebten 4.200 auf Nebeninseln. Im Folgenden die Entwicklung der Bevölkerungszahl samt Dichte, bezogen auf die offizielle Fläche von 68.401 km².
Bevölkerungsentwicklung:
Jahr Einwohner Dichte (E/km²)
1873 104 200 1,53
1875 103 700 1,52
1881 115 700 1,69
1886 137 200 2,01
1891 146 700 2,14
1896 160 800 2,35
1901 172 475 2,52
1906 181 100 2,66
1911 191 211 2,80
1916 197 500 2,89
1921 213 780 3,13
1926 209 400 3,06
1929 214 000 3,13
1931 224 000 3,27
1933 227 599 3,33
1938 235 500 3,44
1941 239 700 3,50
1947 257 078 3,76
1949 269 400 3,94
1950 280 000 4,12
1951 286 200 4,18
1952 294 000 4,33
1953 302 000 4,42
1954 308 752 4,51
1955 314 000 4,59
1956 320 000 4,68
1957 326 000 4,77
1958 332 000 4,85
1959 338 000 4,94
1960 344 000 5,03
1961 350 340 5,12
1962 354 000 5,18
1963 358 000 5,23
1964 362 000 5,29
1965 366 000 5,35
1966 371 436 5,43
1967 375 000 5,48
1968 380 000 5,56
1969 387 000 5,66
1970 395 000 5,77
1971 398 100 5,82
1972 401 000 5,86
1973 404 000 5,91
1974 407 000 5,95
1975 410 000 5,99
1976 412 300 6,03
1977 415 000 6,06
1978 418 000 6,10
1979 421 500 6,16
1980 425 000 6,21
1981 427 200 6,25
1982 429 000 6,28
1983 430 500 6,30
1984 432 000 6,32
1985 433 500 6,34
1986 436 353 6,38
1987 439 000 6,42
1988 442 500 6,48
1989 446 000 6,52
1990 450 000 6,58
1991 452 837 6,62
1992 453 500 6,63
1993 455 000 6,66
1994 456 500 6,68
1995 458 000 6,70
1996 459 659 6,72
1997 458 800 6,71
1998 458 000 6,70
1999 457 500 6,69
2000 457 000 6,68
2001 456 652 6,68
2002 465 500 6,81
2003 473 365 6,92
2004 474 400 6,94
2005 475 000 6,95
2006 476 534 6,97
2007 490 534 7,16
2008 492 069 7,19
2009 502 600 7,36
2010 507 626 7,42
2011 511 439 7,48
2012 512 400 7,49
2013 513 100 7,50
2014 514 762 7,53
2015 517 400 7,56
2016 519 050 7,59
2017 519 166 7,59
2018 522 327 7,64
2019 534 457 7,80
2020 539 590 7,89
2021 557 571 8,15
2022 571 517 8,36
2023 573 479 8,38
Die Bevölkerung wuchs von 1981 bis 2001 um durchschnittlich 0,322 % pro Jahr.
Regionale Verteilung
Die Bevölkerung Tasmaniens konzentriert sich auf die Nordküste und die Osthälfte der Hauptinsel. Die Einwohnerzahlen der Verwaltungseinheiten entwickelten sich wie folgt:
| Name | Status | S 2001 | S 2006 | S 2011 | S 2016 | S 2019 |
| Break O‘Day | Gemeinde | 5.839 | 6.274 | 6.469 | 6.198 | 6.288 |
| Brighton | Gemeinde | 12.857 | 14.236 | 15.685 | 16.669 | 17.675 |
| Burnie | Stadt | 19.077 | 19.748 | 20.164 | 19.228 | 19.550 |
| Central Coast | Gemeinde | 21.242 | 21.428 | 22.332 | 21.736 | 21.938 |
| Central Highlands | Gemeinde | 2.339 | 2.327 | 2.357 | 2.169 | 2.130 |
| Circular Head | Gemeinde | 8.128 | 8.243 | 8.361 | 8.104 | 8.078 |
| Clarence | Stadt | 49.370 | 50.344 | 52.825 | 55.465 | 57.807 |
| Derwent Valley | Gemeinde | 9.372 | 9.636 | 9.946 | 10.087 | 10.424 |
| Devonport | Stadt | 24.502 | 24.901 | 25.752 | 25.128 | 25.633 |
| Dorset | Gemeinde | 7.413 | 7.244 | 7.158 | 6.724 | 6.634 |
| Flinders | Gemeinde | 896 | 896 | 809 | 939 | 1.010 |
| George Town | Gemeinde | 6.557 | 6.755 | 6.857 | 6.873 | 6.968 |
| Glamorgan/Spring Bay | Gemeinde | 4.029 | 4.371 | 4.419 | 4.451 | 4.602 |
| Glenorchy | Stadt | 43.805 | 43.844 | 45.402 | 46.722 | 47.969 |
| Hobart | Stadt | 47.232 | 48.989 | 50.482 | 52.018 | 54.649 |
| Huon Valley | Gemeinde | 13.987 | 14.530 | 15.905 | 16.563 | 17.561 |
| Kentish | Gemeinde | 5.555 | 5.965 | 6.369 | 6.263 | 6.315 |
| Kingborough | Gemeinde | 29.285 | 31.404 | 34.693 | 36.544 | 38.310 |
| King Island | Gemeinde | 1.741 | 1.716 | 1.637 | 1.594 | 1.610 |
| Latrobe | Gemeinde | 8.324 | 8.973 | 10.275 | 10.927 | 11.638 |
| Launceston | Stadt | 62.966 | 64.802 | 67.154 | 66.518 | 68.007 |
| Meander Valley | Gemeinde | 18.248 | 19.052 | 19.622 | 19.553 | 19.844 |
| Northern Midlands | Gemeinde | 12.047 | 12.561 | 12.729 | 12.972 | 13.437 |
| Sorell | Gemeinde | 10.955 | 12.049 | 13.346 | 14.482 | 15.603 |
| Southern Midlands | Gemeinde | 5.788 | 5.864 | 6.265 | 6.083 | 6.290 |
| Tasman | Gemeinde | 2.282 | 2.326 | 2.443 | 2.389 | 2.414 |
| Waratah/Wynyard | Gemeinde | 13.765 | 13.895 | 14.304 | 13.813 | 13.828 |
| West Coast | Gemeinde | 5.572 | 5.229 | 4.890 | 4.210 | 4.175 |
| West Tamar | Gemeinde | 20.495 | 21.700 | 22.833 | 23.092 | 24.070 |
| Tasmanien | Bundesstaat | 473.668 | 489.302 | 511.483 | 517.514 | 534.457 |
Volksgruppen
Die Tasmanier verfügten nicht über die Technik der Ozean-Schifffahrt und entwickelten sich daher unabhängig von den Aborigines auf dem australischen Festland. Man schätzt, dass bei Ankunft der Briten 1803 etwa 3.000 bis 5.000 Ureinwohner auf Tasmanien lebten. Sie wurden bis 1865 von den Briten völlig ausgerottet, allerdings leben immer noch mehrere Tausend Nachkommen von Ureinwohnern und Europäern. Die Sprachen der Ureinwohner sind mit ihnen ausgestorben, siehe Tasmanische Sprachen.
Die Aborigines von Tasmanien, die Tasmanier genannt werden, nennen sich selbst Palawa. Sie gründeten das Tasmanian Aboriginal Centre (TAC), das von Michael Mansell geführt wird. Seit Mitte der 1970er Jahre werden die Interessen der Tasmanier von diesem Zentrum vertreten, das auch die seit 1999 eingerichteten Schutzgebiete verwaltet.
Die heutigen Tasmanier sind allesamt Nachkommen von Tasmaniern und Europäern und zu großen Teilen von Fanny Cochrane Smith, die mit einem Mann europäischer Herkunft verheiratet war. Diese Menschengruppe lebt auf Tasmanien und einigen vorgelagerten Inseln in der Bass Strait. Sie verstehen sich als legitime Nachfahren der Tasmanier, ihr Status ist jedoch umstritten.
Das TAC erkennt nur die Tasmanier von den Bass Strait-Islands, die von Mannalargenna, dem Stammesältesten der Plangermairiener (Ben Lomond), und seinen Nachkommen Dolly Dalrymple sowie Fanny Cochrane Smith abstammen, als legitime Tasmanier an. Mit dieser Definition durch die Palawa sind lediglich die well known family names, wie Maynard, Brown, Burgess, Mansell, Smith, Thomas, Everett, Gower und einige andere Tasmanier Nachfahren des Urvolks auf Tasmanien.
Jedes Jahr im Januar veranstaltet die Palawa Gemeinschaft ein Fest am Oyster Cove, in dem sie an ihr Landrecht erinnert, das ihnen die Briten nahmen, als sie das Land okkupierten. Erst im Jahre 1995 wurden Teile des Landes an die Urbevölkerung zurückgegeben.
Eine andere Gruppe, die Lia Pootah, lehnen diese Festlegung ab und kritisieren, dass die Aborigines-Gemeinschaft der Palawa in der Minderheit ist und sie in der Mehrheit seien und dies habe zur Folge, dass große Konfusion unter den Tasmaniern herrsche. Die Lia Pootah unterstellen den Palawa, dass sie ein Diktat über die Mehrheit der Tasmanier unter der Ägidie von zwei tasmanischen Regierungen erhalten haben; dies sei undemokratisch und unaustralisch.
Die Palawa argumentieren gegen die Kritik der Lia Pootah, dass lediglich die Nachfolger von Manalaganna und Fanny Cochran Smith Landrechte besitzen und dieses Recht durch den Staat bereits anerkannt wurde. Dies wird auch dadurch belegt, dass die Regierung Fanny Cochrane Smith 121 Hektar Land zu Beginn des 19. Jahrhundert gab und dass die Palawa weiteres Land im Jahre 1995 erhielten. Die Palawa merken auch an, dass die Regierung von Tasmanien davon ausgeht, dass die Palawa die ursprünglichen Tasmanier sind und nur diese anerkennt. Die Lia Pootah kritisieren darüber hinaus, dass die Palawa Plätze nach ihren Namensvorstellungen benennen und dass sie historische Ereignisse festlegen und Land kontrollieren, auf das sie keine blood rights (Blutrechte) haben. Das von der Lia Pootah vorgetragenen Argument, dass die Palawa in der Minderheit seien, wird durch Zahlenmaterial von Mansell widerlegt, denn es gab 6000 Tasmanier auf dem Festland und auf den Inseln der Lia Pootah in der Bass Strait lediglich von 200 vor der britischen Kolonisation.
Neuerdings wird die Frage diskutiert, inwieweit DNA-Analysen zur Klärung einer Abstammung herangezogen werden können. Aber auch dies ist strittig, da dies als Störung der Totenruhe interpriert werden könnte.
Sprachen
Das australische Englisch, wie es in Tasmanien gesprochen wird, ist ein regionaler Dialekt, der sich nur geringfügig von anderen Varianten des australischen Englisch unterscheidet. Tasmanien, als isolierte Insel südlich des australischen Festlands, hat einige sprachliche Eigenheiten entwickelt, die durch seine Geschichte, Geografie und kulturelle Identität geprägt sind. Dennoch bleibt das tasmanische Englisch weitgehend dem Standard des australischen Englisch treu, das sich durch drei Hauptvarianten auszeichnet: General, Broad und Cultivated. Der tasmanische Dialekt fällt meist in die Kategorie „General Australian“, mit Nuancen, die ihn subtil von anderen Regionen abheben.
Der tasmanische Dialekt hat einen weniger ausgeprägten „Broad“-Akzent als etwa in Queensland oder im Outback. Vokale sind oft etwas weicher, ähnlich dem südaustralischen Akzent, was möglicherweise auf die kühlere, isolierte Umgebung zurückzuführen ist. Typisch für australisches Englisch ist die Nicht-Rhotizität (kein starkes „r“ am Wortende, zum Beispiel „car“ klingt wie „cah“). Dies gilt auch in Tasmanien. Es gibt eine leichte Tendenz zu einer klareren Artikulation im Vergleich zu „Broad Australian“, was dem „Cultivated“-Stil näherkommt, möglicherweise durch den Einfluss britischer Siedler (vor allem aus Südengland) in der Kolonialzeit.
Einige Wörter oder Redewendungen sind spezifisch für Tasmanien. Zum Beispiel wird die Insel oft als „Tassie“ bezeichnet, ein umgangssprachlicher Begriff, der stolz von Einheimischen genutzt wird. Lokale Begriffe spiegeln die Umwelt wider, zum Beispiel wird der tasmanische Teufel (das Tier) oft in Redewendungen erwähnt, und Begriffe aus der Forstwirtschaft oder dem Fischfang sind verbreitet. Einflüsse der indigenen Sprache palawa kani zeigen sich in Ortsnamen wie Lutruwita (Tasmanien) oder kunanyi (Mount Wellington), die zunehmend in den alltäglichen Sprachgebrauch einfließen.
Der tasmanische Dialekt hat einen etwas ruhigeren, weniger nasalen Tonfall als etwa der viktorianische oder neuseeländische Akzent. Dies wird oft als „entspannt“ beschrieben, was zur entspannten Lebensweise der Inselbewohner passt. Es gibt eine Tendenz zu einer gleichmäßigeren Intonation, weniger „singend“ als im Festland-Englisch.
Tasmanien wurde 1803 als britische Strafkolonie (Van Diemen’s Land) gegründet, mit Siedlern vor allem aus Südengland, Irland und Schottland. Dies führte zu einer stärkeren Beibehaltung britischer Sprachmuster im Vergleich zu anderen australischen Regionen, wo später mehr Einwanderung aus anderen Ländern stattfand. Die geografische Trennung durch die Bass-Straße hat dazu beigetragen, dass sich sprachliche Eigenheiten langsamer verändert haben. Der Dialekt ist daher konservativer und weniger von modernen urbanen Einflüssen (zum Beispiel aus Sydney oder Melbourne) geprägt.
Durch die Wiederbelebung von palawa kani werden zunehmend Wörter und Ortsnamen der tasmanischen Aborigines in den Sprachgebrauch integriert, besonders in offiziellen Kontexten, Schulen und Medien. Tasmanier betonen oft ihren insularen Stolz, was sich in einer liebevollen Nutzung von „Tassie“ oder Redewendungen wie „mainlander“ (für Festland-Australier) widerspiegelt. Der Dialekt ist ein Symbol dieser Identität.
Vor der britischen Kolonisation ab 1803 sprachen die indigenen Palawa (tasmanische Aborigines) vermutlich sechs bis zwölf verschiedene Sprachen oder Dialekte, die durch die Trennung vom australischen Festland vor etwa 10.000 Jahren einzigartig waren. Diese Sprachen, verteilt auf regionale Gruppen wie die Nordwest-, Nordost-, Südost- und Westsprachen, hatten keine nachweisbare Verwandtschaft mit anderen Sprachen und sind nur durch wenige historische Wortlisten, etwa von George Augustus Robinson, überliefert. Die Kolonialzeit, gezeichnet durch die „Schwarzen Kriege“ (1820er und 1830er Jahre), Zwangsumsiedlungen und Krankheiten, führte zum Aussterben dieser Sprachen. Die letzte Sprecherin, Fanny Cochrane Smith, starb 1905, hinterließ jedoch Tonaufnahmen von 1903 – die einzige erhaltene Audioquelle.
Seit den 1990er Jahren wird die Sprache Palawa kani vom Tasmanian Aboriginal Centre als Rekonstruktion aus überlieferten Wörtern entwickelt. Diese Kompositsprache, die Begriffe wie Lutruwita (Tasmanien) oder waramaldinna (Hallo) umfasst, wird heute in Schulen, Medien und Filmen genutzt, hat jedoch keine Muttersprachler. Sie dient als Symbol kultureller Wiederbelebung und wird von der Aborigines-Gemeinschaft (ca. 6 % der Bevölkerung) als Zweitsprache gepflegt. Englisch dominiert heute als Amtssprache, gesprochen von etwa 95 % der rund 570.000 Einwohner, mit einem tasmanischen Dialekt. Durch Einwanderung gibt es zudem Minderheitensprachen wie Mandarin oder Punjabi. Die Wiederbelebung von palawa kani zeigt die Resilienz der Palawa und ihren Wunsch, ihre kulturelle Identität zu bewahren. Weitere Informationen bietet die Website des Tasmanian Aboriginal Centre.
Die tasmanischen Sprachen waren die Sprachen der Ureinwohner Tasmaniens. Diese wurden im 19. Jahrhundert von den englischen Kolonisatoren innerhalb von 80 Jahren systematisch ausgerottet, damit waren auch die tasmanischen Sprachen ausgestorben. Man geht davon aus, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts etwa 5.000 Tasmanier rund zehn verschiedene Sprachen gesprochen haben. Die Aufzeichnungen über diese Sprachen sind äußerst dürftig und fehlerhaft. Gesammelt liegen sie vor bei Plomley 1976, die Hälfte des Materials stammt von George August Robinson und wurde 1829 bis 1834 aufgezeichnet, aber erst in den 1950er Jahren wiederentdeckt. Fast die gesamten Aufzeichnungen (Seefahrer, Siedler, Material aus den Konzentrationslagern) bestehen aus einfachen kurzen Wortlisten, die ohne jegliche linguistische Kompetenz nach dem Gehör aufgezeichnet wurden. Wegen der Dürftigkeit des Materials ist nicht einmal klar, ob die tasmanischen Sprachen genetisch miteinander verwandt waren und eine einzige oder mehrere Sprachfamilien bildeten.
Auch die externen Beziehungen der tasmanischen Sprachen sind nicht geklärt (und werden wohl auch nicht geklärt werden können). Tasmanien wurde bereits vor mindestens 35.000 Jahren von Norden aus über die damals existierende Festlandverbindung zu Australien besiedelt. Die Überflutung der Bassstraße durch Erhöhung des Meeresspiegels am Ende der letzten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren isolierte die Tasmanier von den Bewohnern des australischen Kontinents, so dass kulturelle und technische Innovationen nicht mehr ausgetauscht werden konnten. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass die tasmanischen Sprachen mit den australischen Sprachen entfernt verwandt sind, wenn auch kaum gemeinsame Wortwurzeln identifiziert werden konnten. Crowley-Dixon drückten es 1981 so aus: All we can say, is that there is no evidence that Tasmanian languages were not related to languages spoken on the mainland.
Nach Joseph Greenberg sind die tasmanischen Sprachen zwar nicht mit den australischen, aber mit den geografisch weit entfernten Papua-Sprachen und den andamanischen Sprachen verwandt. Diese sog. indopazifische Hypothese Greenbergs wird allgemein abgelehnt (siehe den Artikel Indopazifisch).
Bei der Dürftigkeit des Materials ist eine Identifizierung einzelner Sprachen natürlich sehr problematisch. Crowley-Dixon 1981 kommen zu mindestens sechs, maximal acht Einzelsprachen, die durch ihre geografische Lage definiert sind. Originalnamen sind in keinem Fall erhalten geblieben.
- Zentral-Tasmanisch † Dialekte: Oyster Bay, Big River, Little Swanport
- Südost-Tasmanisch †
- Nordost-Tasmanisch † Dialekte: Piper River, Cape Portland, Ben Lomond; Nord
- North Midlands-Tasmanisch †
- Port Sorell-Tasmanisch †
- Nordwest-Tasmanisch † Dialekte: Nordwestküste, Robbins Island, Circular Head
- Südwest-Tasmanisch † (unsicher)
- Macqarie Harbour-Tasmanisch † (unsicher)
Bei der schon mehrfach angesprochenen Dürftigkeit des vorliegenden Materials ist es äußerst schwierig, substantielle Aussagen über die Eigenschaften der tasmanischen Sprachen zu machen. Die folgenden Bemerkungen basieren auf Crowley-Dixon 1981.
Das phonologische System scheint dem der australischen Sprachen geglichen zu haben: es gab mindestens vier Verschlusslaut-Serien (bilabial, apico-alveolar, laminal und dorso-velar), einen Lateral, zwei r-Laute und zwei Halbvokale. Alle Verschlusslaute können nasaliert werden. Wörter bestehen in der Regel aus zwei Silben, Konsonantenhäufung ist im Wortinnern häufig, am Wortanfang selten.
Die Morphologie war suffigierend, allerdings ist es kaum möglich, die Funktionen isolierbarer Suffixe zu verstehen. Über syntaktische Funktionen und ihre Markierung (Kennzeichnung) sowie über die grundlegende Wortfolge im Satz lassen sich kaum Aussagen machen. (Die wenigen Sätze, die aufgezeichnet wurden, scheinen SVO nahezulegen.) Das Adjektiv folgt seinem Nomen.
Zwei Pronomina sind identifizierbar. Südost-Tasmanisch lauten sie mina „ich“ und nina „du“, in den anderen Sprachen sind die entsprechenden Formen oft sehr abweichend, die /m/-/n/-Opposition bleibt aber erhalten.
Trotz der äußerst geringen erhaltenen Quellen versuchen einige Tasmanier heute, ihre verloren gegangenen Sprachen zu rekonstruieren. Das Ergebnis ist eine Kompositsprache namens Palawa Kani, die auf Basis der erhaltenen Wortlisten, die linguistisch äußerst fragwürdig sind und zu sechs bis acht verschiedenen Sprachen gehören (von denen man nicht einmal weiß, ob sie genetisch verwandt sind), eine neue Kunstsprache rekonstruieren. Bisher liegt keine Publikation der wissenschaftlichen Richtlinien dieses Projekts vor. Generell ist zu bemerken, dass eine seriöse Rekonstruktion einer ausgestorbenen Sprache auf einer solch extrem dürftigen Basis – wie sie in allen wissenschaftlichen Artikeln über tasmanische Sprachen beschrieben wird – unmöglich ist. Wenn gar von einer Verwendung der rekonstruierten Kunstsprache in Schulen oder bei Reden gesprochen wird, handelt es sich eher um folkloristische Aktionen zur Stärkung einer tasmanischen Identität, als um eine linguistisch begründete Sprachrekonstruktion.
Religion
Vor der britischen Kolonisation im Jahr 1803 praktizierten die tasmanischen Aborigines, die Palawa, eine Spiritualität, die eng mit der Natur und dem Land verbunden war. Ihre Glaubenssysteme basierten auf mündlichen Überlieferungen, die Traumzeit-ähnliche Konzepte umfassten, obwohl sie sich aufgrund der geografischen Isolation Tasmaniens von den Mythen des australischen Festlands unterschieden. Heilige Stätten, wie Felskunst oder spirituelle Landschaften, spielten eine zentrale Rolle. Durch die Kolonialzeit, insbesondere die „Schwarzen Kriege“ (1820er und 1830er Jahre) und Zwangsumsiedlungen, wurde diese Spiritualität fast vollständig unterdrückt. Seit den 1990er Jahren fördert das Tasmanian Aboriginal Centre (TAC) die Wiederbelebung dieser Traditionen, einschließlich der Sprache palawa kani, die oft in spirituellen Kontexten verwendet wird. Heute praktizieren einige Palawa (rund 6 % der Bevölkerung) eine Mischung aus traditioneller Spiritualität und modernen kulturellen Praktiken, oft ohne formelle religiöse Strukturen.
Die britische Kolonisation brachte das Christentum nach Tasmanien, zunächst vor allem den Anglikanismus, da die Insel als Strafkolonie (Van Diemen’s Land) gegründet wurde. Kirchen wie die Anglikanische Kirche und später die Katholische Kirche spielten eine zentrale Rolle im sozialen und politischen Leben. Laut der Volkszählung von 2021 bezeichnen sich etwa 38 % der Tasmanier als Christen, wobei die größten Denominationen Anglikaner (rund 15 %), Katholiken (zirka 14 %) und andere protestantische Gruppen wie Uniting Church oder Baptisten sind. Historisch gesehen waren Kirchen wie die St. David’s Cathedral in Hobart zentrale Orte des Glaubens. Der Einfluss des Christentums nimmt jedoch ab, was mit einem allgemeinen Trend in Australien hin zu Säkularisierung übereinstimmt. Viele Kirchen in Tasmanien, insbesondere in ländlichen Gebieten, kämpfen mit schrumpfenden Gemeinden.
Tasmanien ist heute eine weitgehend säkulare Gesellschaft. Bei der Volkszählung 2021 gaben rund 50 % der Bevölkerung an, keiner Religion anzugehören, was Tasmanien zu einer der säkularsten Regionen Australiens macht. Dieser Trend spiegelt die Abkehr von traditionellen religiösen Institutionen wider, insbesondere bei jüngeren Generationen. Gleichzeitig gibt es durch Einwanderung eine wachsende religiöse Vielfalt. Kleinere Gemeinschaften praktizieren den Islam (rund 1 %), den Buddhismus (zirka 1 %), den Hinduismus (rund 0,5 %) und das Judentum (unter 0,5 %). Diese Religionen sind vor allem in Städten wie Hobart und Launceston präsent, wo Einwanderer aus Asien, dem Nahen Osten und anderen Regionen kulturelle Zentren aufgebaut haben, etwa die Hobart Mosque oder buddhistische Meditationsgruppen.
Die Wiederbelebung der indigenen Spiritualität durch die Palawa hat auch einen Einfluss auf die breitere tasmanische Gesellschaft. Ortsnamen wie kunanyi (Mount Wellington) oder Lutruwita (Tasmanien) werden zunehmend verwendet und spiegeln eine Anerkennung indigener Werte wider. Gleichzeitig gibt es alternative spirituelle Bewegungen, wie New Age oder heidnische Praktiken, die von der naturnahen Lebensweise Tasmaniens angezogen werden. Die Insel ist bekannt für ihre Umweltbewegung, die oft mit spirituellen oder pantheistischen Überzeugungen verknüpft ist, insbesondere in Gemeinschaften, die sich für den Schutz des tasmanischen Regenwalds einsetzen. Festivals wie das Dark Mofo in Hobart integrieren spirituelle und künstlerische Elemente, die sowohl indigene als auch moderne Einflüsse aufgreifen.
Siedlungen
Die größten Städte Tasmaniens sind Hobart, Launceston, Devonport und Westbury. Nach dem Zensus von 2001 lebten in der Hauptstadt Hobart 27,4 % der Bevölkerung Tasmaniens, 2010 waren es 25,35 %. Die größten Einwohnerzahlen der Ortschaften entwickelten sich wie folgt:
| Locality | Status | Z 2001 | Z 2006 | Z 2011 | Z 2016 | Z 2021 |
| Bagdad | Locality | 677 | 739 | 408 | 466 | 501 |
| Beaconsfield | Urban Center | 995 | 1,056 | 1,010 | 1,054 | 1,093 |
| Beauty Point | Urban Center | 1,153 | 1,116 | 1,203 | 1,170 | 1,231 |
| Bicheno | Locality | 687 | 640 | 646 | 744 | 797 |
| Binalong Bay | Locality | ... | 204 | 209 | 209 | 247 |
| Bothwell | Locality | 337 | 376 | 390 | 354 | 379 |
| Bracknell | Locality | 358 | 371 | 376 | 368 | 392 |
| Bridport | Urban Center | 1,352 | 1,327 | 1,246 | 1,269 | 1,371 |
| Burnie - Somerset | Urban Center | 18,064 | 19,160 | 19,818 | 19,388 | 20,267 |
| Campania | Locality | 231 | 239 | 283 | 399 | 608 |
| Campbell Town | Locality | 756 | 772 | 782 | 837 | 823 |
| Carrick | Locality | 317 | 439 | 449 | 431 | 503 |
| Clifton Beach | Locality | ... | ... | 556 | 586 | 618 |
| Collinsvale | Locality | 283 | 295 | 249 | 265 | 186 |
| Cremorne | Locality | 402 | 404 | 460 | 502 | 577 |
| Cressy | Locality | 643 | 670 | 674 | 669 | 668 |
| Currie | Locality | 791 | 746 | 687 | 667 | 659 |
| Cygnet | Urban Center | 802 | 839 | 843 | 929 | 1,057 |
| Deloraine | Urban Center | 2,031 | 2,243 | 2,332 | 2,431 | 2,631 |
| Devonport | Urban Center | 21,528 | 22,315 | 22,770 | 23,044 | 24,591 |
| Dilston | Locality | 294 | 335 | 308 | 292 | 316 |
| Dodges Ferry - Lewisham | Urban Center | 3,174 | 3,748 | 4,446 | 4,623 | 5,219 |
| Dover | Locality | 487 | 465 | 443 | 487 | 521 |
| Dunalley | Locality | 269 | 313 | 272 | 274 | 304 |
| Eaglehawk Neck | Locality | 236 | 269 | 338 | 354 | 391 |
| Electrona | Locality | ... | ... | 476 | 539 | 601 |
| Evandale | Urban Center | 1,062 | 1,059 | 1,085 | 1,118 | 1,058 |
| Exeter (incl. Lanena, Blackwall) | Urban Center | 827 | 954 | 1,009 | 970 | 1,092 |
| Fern Tree | Locality | 594 | 598 | 666 | 723 | 763 |
| Fingal | Locality | 325 | 338 | 366 | 336 | 350 |
| Forth | Locality | 349 | 368 | 379 | 370 | 398 |
| Franklin | Locality | 424 | 453 | 326 | 336 | 444 |
| Gawler | Locality | 250 | 280 | 250 | 256 | 277 |
| Geeveston | Locality | 821 | 761 | 634 | 617 | 658 |
| George Town | Urban Center | 4,125 | 4,266 | 4,303 | 4,261 | 4,408 |
| Gravelly Beach | Locality | 580 | 537 | 560 | 568 | 641 |
| Grindelwald | Locality | 586 | 739 | 829 | 965 | 1,037 |
| Hadspen | Urban Center | 1,841 | 1,926 | 2,061 | 2,215 | 2,337 |
| Heybridge | Locality | 322 | 295 | 307 | 316 | 339 |
| Hillwood | Locality | ... | 339 | 439 | 434 | 454 |
| Hobart | Major Urban Area | 154,278 | 161,968 | 170,977 | 178,005 | 197,451 |
| Howden | Locality | 299 | 464 | 661 | 675 | 717 |
| Huonville | Urban Center | ... | ... | 1,742 | 1,842 | 2,071 |
| Kempton | Locality | 310 | 358 | 355 | 345 | 371 |
| Kettering | Locality | 303 | 392 | 307 | 355 | 408 |
| Latrobe | Urban Center | 2,686 | 2,843 | 3,354 | 3,471 | 4,456 |
| Launceston | Urban Center | 68,088 | 71,395 | 74,085 | 75,328 | 80,943 |
| Legana | Urban Center | 2,139 | 2,500 | 2,916 | 3,242 | 4,252 |
| Lilydale | Locality | 331 | 288 | 273 | 274 | 307 |
| Longford | Urban Center | 2,826 | 3,027 | 3,053 | 3,342 | 3,711 |
| Low Head | Locality | 429 | 474 | 442 | 473 | 507 |
| Margate | Urban Center | 957 | 1,368 | 2,104 | 2,301 | 2,572 |
| Midway Point | Urban Center | ... | ... | 2,599 | 2,861 | 3,384 |
| Mole Creek | Locality | 211 | 223 | 229 | 192 | 216 |
| New Norfolk | Urban Center | 5,009 | 5,230 | 5,541 | 5,834 | 6,153 |
| Nubeena | Locality | 255 | 278 | 274 | 293 | 362 |
| Oatlands | Locality | 591 | 540 | 552 | 541 | 562 |
| Opossum Bay | Locality | 272 | 302 | 330 | 332 | 383 |
| Orford | Locality | 477 | 553 | 518 | 536 | 623 |
| Penguin | Urban Center | 2,907 | 2,943 | 3,158 | 3,137 | 3,330 |
| Perth | Urban Center | 1,972 | 2,239 | 2,410 | 2,625 | 3,233 |
| Port Sorell | Urban Center | 1,929 | 2,211 | 2,853 | 3,354 | 3,869 |
| Primrose Sands | Urban Center | 668 | 894 | 935 | 1,051 | 1,209 |
| Queenstown | Urban Center | 2,343 | 2,117 | 1,973 | 1,757 | 1,772 |
| Railton | Locality | 867 | 900 | 882 | 835 | 887 |
| Ranelagh | Locality | ... | ... | 684 | 876 | 1,058 |
| Richmond | Locality | 818 | 880 | 888 | 859 | 934 |
| Ridgley | Locality | 432 | 449 | 381 | 394 | 401 |
| Rosebery | Locality | 1,103 | 1,032 | 924 | 707 | 749 |
| Ross | Locality | 272 | 272 | 271 | 273 | 291 |
| Scamander | Locality | 466 | 506 | 544 | 511 | 639 |
| Scottsdale | Urban Center | 1,900 | 1,966 | 1,901 | 1,901 | 1,979 |
| Sheffield | Urban Center | 990 | 1,034 | 1,109 | 1,128 | 1,195 |
| Sisters Beach | Locality | 290 | 380 | 438 | 393 | 481 |
| Smithton | Urban Center | 3,142 | 3,361 | 3,239 | 3,274 | 3,282 |
| Snug (mit Lower Snug, Coningham) | Urban Center | ... | ... | 1,335 | 1,560 | 1,843 |
| Sorell | Urban Center | ... | ... | 2,109 | 2,541 | 3,180 |
| South Arm | Locality | 538 | 586 | 577 | 615 | 691 |
| Stanley | Locality | 455 | 458 | 483 | 472 | 504 |
| St Helens | Urban Center | ... | ... | 1,498 | 1,444 | 1,573 |
| Stieglitz | Locality | ... | ... | 642 | 692 | 724 |
| St Marys | Locality | 533 | 522 | 509 | 466 | 494 |
| Strahan | Locality | 735 | 637 | 661 | 655 | 634 |
| Sulphur Creek | Locality | 345 | 424 | 504 | 559 | 631 |
| Swan Point | Locality | ... | ... | 277 | 281 | 300 |
| Swansea | Locality | 519 | 557 | 599 | 645 | 711 |
| Triabunna | Locality | 701 | 796 | 768 | 751 | 722 |
| Tullah | Locality | 249 | 195 | 192 | 161 | 196 |
| Ulverstone | Urban Center | 10,757 | 11,237 | 12,112 | 12,032 | 12,723 |
| Waratah | Locality | 249 | 227 | 250 | 222 | 235 |
| Westbury | Urban Center | 1,238 | 1,357 | 1,475 | 1,475 | 1,666 |
| White Beach | Locality | 253 | 275 | 284 | 267 | 305 |
| Wynyard | Urban Center | 4,621 | 4,812 | 5,061 | 5,167 | 5,387 |
| Zeehan | Locality | 897 | 845 | 726 | 698 | 702 |
Hobart, die Hauptstadt und größte Stadt Tasmaniens, liegt am Ufer des Derwent River im Südosten der Insel. Als historisches Zentrum der Kolonialzeit beherbergt sie ikonische Wahrzeichen wie das Battery Point mit seinen viktorianischen Häusern, das Tasmanian Museum und Art Gallery sowie den majestätischen Mount Wellington, der die Stadt von oben überragt. Hobart ist ein kulturelles und wirtschaftliches Herz, bekannt für das jährliche MONA FOMA-Festival, frische Meeresfrüchte und als Ausgangspunkt für Ausflüge in die umliegenden Nationalparks. Die Stadt verbindet urbane Lebendigkeit mit natürlicher Schönheit und dient als Tor zur wilden Südinsel.
Südlich von Hobart erstreckt sich Kingston, ein Vorort von Hobar, der als eigenständige Stadt gilt, aber zum Greater Hobart Area gehört. Diese wachsende Wohnsiedlung an der Küste des Bruny Island Channels ist geprägt von moderner Infrastruktur, Stränden und Golfplätzen. Kingston bietet eine entspannte Atmosphäre mit Fokus auf Familienleben und Freizeit, darunter das nahegelegene Adventure Bay auf Bruny Island, das für Whale Watching und Wanderungen beliebt ist. Als Erweiterung der Hauptstadt profitiert es von Pendlerverbindungen, bleibt aber ein ruhiger Rückzugsort mit Blick auf die D'Entrecasteaux Channel.
Weiter westlich entlang der Südküste liegt Huonville, die größte Stadt der Huon Valley. Diese ländliche Idylle am Huon River ist das Zentrum einer Region, die für ihre Apfelplantagen und die weltberühmte Cidre-Produktion bekannt ist. Huonville verkörpert das tasmanische Landleben mit Märkten, lokalen Weingütern und Wanderwegen durch subtropische Regenwälder. Die Stadt dient als Drehscheibe für den Tourismus in der Nähe des Hastings Caves und des Hartz Mountains Nationalparks, wo Besucher beeindruckende Kalksteinhöhlen und alte Wälder erkunden können.
Im Südwesten, fernab der großen Routen, thront Strahan als Tor zur Wildnis. Diese Hafenstadt am Macquarie Harbour ist historisch mit dem Holzhandel und dem berüchtigten Sarah Island Penal Settlement verbunden, das als eine der härtesten Strafkolonien diente. Heute zieht Strahan Abenteurer an mit Bootstouren durch den Regenwald, dem Weltkulturerbe Tasmanian Wilderness und dem spektakulären Gordon River. Die kleine, aber lebendige Community lebt vom Tourismus und Fischerei, umgeben von unberührter Natur, die Tasmaniens raue Schönheit verkörpert.
Auf der Ostküste, nordöstlich von Hobart, liegt die malerische Stadt Swansea. Diese historische Siedlung am Blackwater Lagoon, gegründet 1818 als erste Kolonie der Ostküste, atmet die Atmosphäre des 19. Jahrhunderts mit ihren steinernen Gebäuden und dem Great Oyster Bay-Blick. Swansea ist ein Juwel für Naturliebhaber, mit Stränden, Spaziergängen und der Nähe zu Weinbergen. Die Stadt dient als Einstieg in die Freycinet-Halbinsel, wo der berühmte Wineglass Bay zu den schönsten der Welt zählt, und fördert nachhaltigen Tourismus in einer Region reicher Biodiversität.
Etwas nördlicher an der Ostküste erhebt sich Bicheno, eine Küstenstadt, die für ihre gläsernen Blowholes und die nächtlichen Fairy Penguins berühmt ist. Ursprünglich ein Fischerdorf, hat Bicheno sich zu einem Hotspot für Tauchen und Schnorcheln entwickelt, umgeben vom Diamond Beach und dem Douglas-Apsley Nationalpark. Die Community lebt von Austernzucht und Tourismus, mit charmanten Cafés und Galerien, die die künstlerische Seele Tasmaniens widerspiegeln. Bicheno verkörpert die entspannte Ostküstenkultur, wo das Meer das Leben diktiert.
Im Nordosten, am Fuße der Ben Lomond Mountains, befindet sich Scottsdale. Diese kleine Stadt im Nordost-Tal ist das Herz der Landwirtschaft, insbesondere der Kartoffel- und Gemüseproduktion, und dient als Ausgangspunkt für Skifahren im Winter. Umgeben von Eukalyptuswäldern und dem Derby Mountain Bike Park, zieht Scottsdale Outdoor-Enthusiasten an. Die historische Main Street mit ihren Pubs und Märkten lädt zu einem gemütlichen Aufenthalt ein, während die Nähe zu Launceston sie zu einem praktischen Zwischenstopp macht.
Im Norden Tasmaniens dominiert Launceston, die zweitgrößte Stadt der Insel, am Zusammenfluss der North und South Esk Rivers. Als kulturelles Zentrum des Nordens beherbergt sie das Queen Victoria Museum, den Cataract Gorge mit seinen Hängeseilbahnen und das jährliche Fest der kleinen Städte. Launceston ist industriell geprägt durch Weinproduktion und Bildungseinrichtungen wie die University of Tasmania Campus, doch es atmet auch Geschichte mit viktorianischer Architektur. Die Stadt verbindet urbanes Flair mit natürlicher Nähe, etwa zu den Tamar Valley-Weinbergen.
Westlich von Launceston an der Mersey River-Mündung liegt Devonport, die drittgrößte Stadt. Als Fährhafen für die Spirit of Tasmania verbindet sie die Insel mit dem Festland und ist ein Knotenpunkt für Handel und Tourismus. Devonport beeindruckt mit dem Bass Strait-Blick, dem Tiagarra Aboriginal Culture Centre und lebendigen Märkten. Die Community ist multikulturell, geprägt von Immigration, und die Stadt bietet Strände sowie den nahegelegenen Cradle Mountain als Highlight für Wanderer.
Im Nordwesten der Insel liegt Burnie, ein industrielles Zentrum an der Emu Bay. Bekannt für seinen Milchverarbeitungsbetrieb und den Export von Käse, hat Burnie eine starke wirtschaftliche Basis, ergänzt durch den Maker's Workshop, ein Zentrum für Kunsthandwerk. Die Küstenpromenade, der Little Penguin Observation Centre und der nahe Cradle Mountain Nationalpark machen Burnie zu einem attraktiven Ziel. Trotz ihrer industriellen Wurzeln pflegt die Stadt eine lebendige Kulturszene und bietet atemberaubende Sonnenuntergänge über dem Bass Strait.
Verkehr
Der Verkehr in Tasmanien ist geprägt von gut ausgebauten Straßen, einem begrenzten öffentlichen Nahverkehr und verschiedenen Fährverbindungen. Die wichtigsten Verkehrswege sind drei Hauptstraßen: der Southern Outlet (nach Süden), der Tasman Highway (nach Osten) und die Brooker Avenue (nach Norden), die das Stadtzentrum von Hobart mit Vororten und dem Rest der Insel verbinden. Die meisten Einwohner nutzen Autos, Mietwagen oder Campervans zur Fortbewegung, da der Busverkehr, organisiert von Metro Tasmania, relativ eingeschränkt ist, vor allem außerhalb der Geschäftszeiten und am Wochenende.
Öffentliche Verkehrsmittel umfassen hauptsächlich Busse, Taxis und einige touristische Fähren, beispielsweise zur Bruny Island oder zum Museum of Old and New Art (MONA). Bahnlinien werden derzeit kaum für den Personenverkehr genutzt, sondern vor allem touristisch oder für Güter. Radfahren wird als umweltfreundliche Alternative gefördert, mit ausgewiesenen Radwegen wie dem Intercity Cycleway entlang des Derwent Rivers. Internationale Anbindung erfolgt über Flughäfen in Hobart und Launceston sowie Fährverbindungen von Devonport nach Melbourne, die auch Fahrzeugmitnahme ermöglichen.
Straßenverkehr
In bebauten Gebieten liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit, sofern nicht anders angegeben, bei 50 km/h. Auf Landstraßen ist in der Regel eine Geschwindigkeit von 100 km/h erlaubt, auf einigen gut ausgebauten Straßen sogar 110 km/h. Auf allen Landstraßen sind jedoch häufig niedrigere Geschwindigkeiten vorgeschrieben, an die man sich auch halten sollte.
Der Tasman Highway und der Midland Highway verbinden die Städte Hobart und Launceston miteinander. Der Tasman Highway ist mit einer Länge von 410 km einer der längsten unter den 53 Highways auf Tasmanien.
Der Straßenverkehr in Tasmanien ist durch ein gut ausgebautes, aber anspruchsvolles Straßennetz geprägt, das durch bergige Topografie, schmale Straßen und wechselhaftes Wetter beeinflusst wird. Er basiert auf den Australian Road Rules, umgesetzt durch die Road Safety (Road Rules) Regulations 2019, mit tasmanischen Besonderheiten wie strengeren Vorgaben für Tierunfälle oder Abstände zu Radfahrern (mindestens 1,5 m). Linksverkehr gilt, und das Department of State Growth sowie die Tasmania Police überwachen Sicherheit und Durchsetzung. Wichtige Regeln umfassen Geschwindigkeitslimits (50 km/h in Städten, 100 km/h auf Landstraßen, 80 km/h auf Schotterstraßen), eine Alkoholgrenze von 0,05 Promille (0,00 für Lernfahrer und unter 25-Jährige), Sicherheitsgurtpflicht und ein Handyverbot während der Fahrt (Bußgelder 150 bis 500 AUD). Unfälle mit Schäden über 1.000 AUD oder Verletzungen müssen der Polizei gemeldet werden. Jährlich sterben über 30 Menschen auf tasmanischen Straßen, weshalb Kampagnen des Road Safety Advisory Council (RSAC) auf Prävention setzen. Internationale Führerscheine sind 3 Monate gültig; Mietwagen (zum Beispiel Camper) sind beliebt, aber Tankstellen sind auf dem Land rar. Schotterstraßen und Winterwetter erfordern Vorsicht, besonders wegen Wildtieren nachts. Die Polizei nutzt Drohnen und Apps wie PINS für Bußgelder. Für aktuelle Infos siehe die Roadworks Map oder Transport Tasmania.
Tasmanien hat ein gut ausgebautes Busnetz, das vor allem für den öffentlichen Nahverkehr in den größeren Städten und für Fernverbindungen zwischen den Regionen genutzt wird. Da es keine Personenzüge auf der Insel gibt, sind Busse die primäre Option für Reisen ohne Auto. Die Dienste sind zuverlässig, aber saisonal variierend – es lohnt sich, Fahrpläne im Voraus zu prüfen. Im Folgenden eine Zusammenfassung der wichtigsten Anbieter, Routen und Tipps.
Die wichtigsten Buslinien sind:
- Metro Tasmania: Der größte Anbieter für den städtischen Nahverkehr. Bedient Hobart (Süd), Launceston (Norden) und Burnie (Nordwesten) mit umfangreichen Liniennetzen. In Hobart gibt es Verbindungen in alle Stadtteile über Hauptstraßen wie den Southern Outlet, Tasman Highway und Brooker Avenue. Tickets: Papiertickets beim Fahrer oder Greencard (aufladbar, online oder in Shops erhältlich).
- Tassielink Transit: Spezialisiert auf Fernbusse und regionale Routen, zum Beispiel von Hobart nach Süden (Huon Valley) oder Osten (Swansea). Bietet auch Shuttle-Dienste zu Touristenattraktionen.
- Tasmanian Redline Coaches: Fokussiert auf Express-Services, zum Beispiel zum Fährhafen Devonport (für die Spirit of Tasmania-Fähre vom Festland) und Schülerverkehr. Charter-Optionen für Gruppen verfügbar.
Bahnverkehr
Die Eisenbahn in Tasmanien besteht aus einem Schmalspurnetz in Kapspur (1067 mm), das alle wichtigen Siedlungszentren Tasmaniens verbindet. Heute verkehren nur noch Güterzüge, in der Regel als Ganzzüge. Der Personenverkehr wurde 1978 eingestellt. In einigen Abschnitten fahren jedoch Museumszüge.
Die erste in Tasmanien eröffnete Strecke führte von Deloraine nach Launceston. Sie war als Breitspurstrecke (1600 mm) erbaut und durch Garantien anliegender Grundbesitzer, die sich von einer Bahn Vorteile erwarteten, finanziert worden und wurde am 10. Februar 1871 eröffnet. Bereits 1872 ging das Unternehmen in Konkurs und wurde zum 31. Oktober 1873 von der Regierung Tasmaniens übernommen. Der Versuch der Regierung, die Garantien der anliegenden Grundbesitzer einzulösen, führte zu erheblichem Widerstand.
Am 1. März 1876 wurde die Hauptstrecke Hobart–Evandale (in der Nähe von Launceston) eröffnet. Sie wurde in Kapspur durch die tasmanische Regierung errichtet, von der Tasmanian Main Line Company betrieben und am 1. November des gleichen Jahres mit einer Verlängerung an die bestehende Strecke nach Deloraine in dem Bahnhof Western Junction angeschlossen. Zwischen Western Junction und Launceston bestand nun ein Dreischienengleis, das bis zum 17. März 1885 nach Deloraine verlängert wurde und den durchgehenden Verkehr in Kapspur auch nach dort erlaubte. Bis zum 18. August 1888 wurde das Breitspurgleis demontiert und die Umspurung der Strecke so abgeschlossen. Am 30. Mai 1885 erreichte das Netz Devonport. 1890 erwarb die tasmanische Regierung die Tasmanian Main Line Company und schuf die Tasmanian Government Railways. Am 15. April 1901 wurde das Netz nach Burnie verlängert und konnte dort an die Emu Bay Railway anschließen, die von Zeehan kommend durch die Betreiber der dortigen Bergwerke errichtet worden und am 21. Dezember 1900 in Betrieb genommen worden war. 1913 erfolgte eine Erweiterung des staatlichen Netzes nach Wynyard, die 1922 nach Wiltshire Junction verlängert wurde, wo sie an die Strecke von Stanley nach Smithton anschloss.
Die Hauptstrecken wurden bis 1975 von Tasmanian Government Railways betrieben. In diesem Jahr wurde der Betrieb durch die Australian National Railways Commission übernommen und in TasRail umbenannt. Die Australian National Railways Commission fasste die Commonwealth Railways, den Eisenbahnfernverkehr Südaustraliens und die tasmanische Staatseisenbahn zusammen. TasRail wurde im November 1997 an Australian Transport Network Limited verkauft, eine Kooperation der neuseeländischen Eisenbahngesellschaft Trans Rail und der US-amerikanischen Eisenbahngesellschaft Wisconsin Central. Als 2003 die Canadian National die Wisconsin Central und Toll Holdings die Trans Rail übernahm, wurden alle Überseeengagements verkauft. Der Eisenbahnbetrieb der TasRail ging an Pacific National über.
1998 wurde die Emu Bay Railway entlang der Westküste der Insel vom Australian Transport Network gekauft und rechtlich mit dem übrigen Netz vereinigt. Die Nebenstrecken sind:
- Parattah–Oatlands, 1885 (geschlossen 1949)
- Conara Junction (an der Hauptstrecke Hobart–Launceston)–St Marys, 1886
- Derwent Valley Line: Bridgewater (heute ein Vorort von Hobart)–New Norfolk, 1887, erweitert 1888 nach Glenora und 1936 nach Kallista
- Launceston–Scottsdale, 1889, erweitert 1911 nach Branxholm und 1919 nach Herrick
- Deloraine (Lemana Junction)–Mole Creek, 1890 (geschlossen 1985)
- Don Junction–Paloona, 1916, erweitert nach Barrington 1923 (insgesamt geschlossen 1963). 1976 wurde der Abschnitt Don Junction–Don Township wiedereröffnet.
- Launceston–Bell Bay, 1974 (Industrieanschluss). Für diesen Abschnitt bestanden Überlegungen, ihn in Normalspur auszubauen, um Trajektverkehr zwischen dem Festland und Launceston zu ermöglichen. Die Pläne wurden nicht weiter verfolgt.
Über das geschlossene Netz hinaus bestanden einzelne Inselbetriebe:
- Bellerive–Sorell, 1892 (geschlossen 1926)
- Zeehan–Strahan (damals Regatta Point), 1892. Die Linie erhielt 1901, nach Eröffnung der Emu Bay Railway, Anschluss an das gesamttasmanische Netz und verlor ihren Status als Inselbetrieb.
- North Mount Lyell Railway
Der bekannteste Zug Tasmaniens war der Tasman Limited, der seit 1954 verkehrte und 1978 eingestellt wurde. Der Verfall des Bahnsystems wurde zum Teil verursacht, weil Investitionen in die Technik ausblieben und die Bahn weiter so betrieben wurde, wie in den Hochzeiten des Eisenbahnverkehrs. Es wurden über hundert Bahnhöfe unterhalten und ein breites Angebot aufrechterhalten. Die Bahn galt als die mit dem besten Service in Australien. Der damit einhergehende hohe Personalbestand war bei zurückgehendem Verkehr nicht mehr ökonomisch. Reformen setzten zu spät ein, so dass schließlich selbst das Kerngeschäft zusammengestrichen werden musste. Auch die Umstellung auf Dieseltriebwagen konnte auf die Dauer keine Abhilfe mehr schaffen.
Noch 1970 wurden im Bahnhof von Hobart täglich etwa 70 Züge abgefertigt. Aber schon 1975 wurde der schienengebundene ÖPNV der Tasmanian Government Railways in Hobart und Umgebung aufgegeben, mit dem Übergang der Tasmanian Government Railways zur TasRail 1978 der Personenverkehr insgesamt eingestellt. Der Bahnhof von Hobart wurde abgerissen und in einen Parkplatz umgewandelt.
Die Eisenbahninfrastruktur gehört dem tasmanischen Staat, wobei die Unterhaltungsarbeiten an Fremdfirmen vergeben werden. Im September 2009 wurden auch der Eisenbahnverkehr, der bis dahin von der Pacific National geführt wurde, wieder auf die staatseigene TasRail übertragen. Die Leistung des Systems ist heute gering: Die Blockabstände zwischen den Zügen betragen 10 bis 15 Kilometer. Der Bahngüterverkehr wird allerdings geschätzt, da er den Straßenverkehr in Tasmanien um jährlich viele tausend Lkw-Fahrten entlastet. Im Güterverkehr - der letzten verbliebene Verkehrsart neben einigen Museumsverkehren - ist Hauptfrachtgut Zement, der von Railton nach Devonport befördert wird. Weitere auf der Schiene beförderte Güter sind Kohle, Holz, Container und Papier.
Schiffsverkehr
Dreh- und Angelpunkt des Passagier- und Fahrzeugverkehrs Tasmaniens ist die berühmte Fähre Spirit of Tasmania, die von der TT-Line Company betrieben wird. Diese Zwillingsschiffe – Spirit of Tasmania I und II – verbinden täglich den Hafen Melbourne am australischen Festland mit Devonport im Norden Tasmaniens. Die Überfahrt dauert etwa 9 bis 11 Stunden und legt dabei rund 429 Kilometer zurück. Seit Oktober 2022 startet die Fähre nicht mehr vom alten Terminal in Port Melbourne, sondern vom modernen, neu gebauten Hafen in Geelong, der mehr Parkplätze, effizientere Sicherheitskontrollen und eine gemütliche Passagierlounge bietet. Die Schiffe sind wahre schwimmende Hotels: Mit einer Länge von 194 Metern können sie bis zu 1.400 Passagiere und 500 Fahrzeuge aufnehmen. An Bord finden Reisende eine breite Palette an Annehmlichkeiten, darunter Kabinen für Paare, Familien oder Alleinreisende, Liegesitze in Lounges, Restaurants, Bars und sogar Spielbereiche für Kinder. Besonders in der Hauptsaison von Dezember bis April gibt es zusätzliche Tagesabfahrten, während das ganze Jahr über nächtliche Routen angeboten werden. Für Autofahrer und Camper ist die Fähre essenziell, da sie nicht nur PKWs, sondern auch Wohnmobile und Caravans transportiert – allerdings müssen Mieter von Leihwagen prüfen, ob ihr Modell genehmigt ist.
Neben dem Passagierverkehr spielt der Gütertransport eine entscheidende Rolle im tasmanischen Schiffsverkehr. Der Hafen von Devonport ist der größte Containerhafen der Insel und dient als Tor für Importe und Exporte, insbesondere für landwirtschaftliche Produkte wie Milch, Wein und Holz. In der Hauptstadt Hobart, gelegen am Derwent River, ist der Schiffsverkehr historisch geprägt: Der Hafen war einst ein zentraler Knotenpunkt für die britische Strafkolonie, in der von 1803 bis 1853 Tausende Gefangene ankamen. Heute empfängt er Kreuzfahrtschiffe, die Tausende Touristen in die Nähe des ikonischen Mount Wellington oder des Tasmanian Museum bringen, das Einblicke in die Aborigines-Kultur und die Inselgeschichte gewährt. Rund 40 Prozent der Fährverbindungen in Tasmanien laufen über Devonport, was die Insel zu einem nahtlosen Reiseziel macht – sei es für Naturliebhaber, die die Nationalparks mit Koalas und Tasmanischen Teufeln erkunden wollen, oder für Geschmackssucher, die in Hobbarts kulinarischer Szene eintauchen.
Ein spannender Ausblick bietet die Zukunft des Schiffsverkehrs in Tasmanien: Die Werft Incat in Hobart hat kürzlich die weltweit größte Elektrofähre zu Wasser gelassen – ein 122 Meter langes Schiff mit einer 275 Tonnen schweren Batterie, das vollständig emissionsfrei betrieben wird. Dieses Projekt, das Probefahrten auf dem Derwent River plant, markiert einen Meilenstein für die australische Schifffahrt und unterstreicht Tasmaniens Engagement für grüne Technologien. Der tasmanische Premierminister Jeremy Rockliff feierte es als Symbol für Innovation und Nachhaltigkeit. Insgesamt trägt der Schiffsverkehr nicht nur zur Vernetzung bei, sondern formt auch das Bild einer Insel, die Tradition und Moderne auf den Wellen vereint. Ob als Tor zur Wildnis oder als Brücke zur Welt – Tasmaniens Meere bleiben ein pulsierender Lebensnerv.
Flugverkehr
In Tasmanien gibt es insgesamt 5 Flughäfen:
- Burnie Burnie Wynyard Airport (BWT)
- Devonport Devonport Airport (DPO)
- Hobart International Airport (HBA)
- Queenstown Queenstown Airport (UEE)
- Smithton Smithton Airport (SIO)
Der Hobart International Airport liegt in Cambridge, etwa 17 km östlich des Stadtzentrums von Hobart, Tasmanien. Er ist der größte Flughafen der Insel und ein wichtiger Knotenpunkt im australischen Inlandsverkehr. Über den Tasman Highway ist er mit der Stadt verbunden.
Der Flughafen entstand, weil der ältere Cambridge Aerodrome in den 1940er-Jahren den wachsenden Anforderungen nicht mehr genügte. Nach einem Flugzeugunglück 1946 wurde der Bau eines neuen Flughafens beschlossen. Der unter dem Namen Llanherne Airport geplante Neubau begann in den späten 1940ern und wurde nach Verzögerungen am 23. Juni 1956 eröffnet. Kurz darauf erhielt er den Namen Hobart Airport. Bereits im ersten Jahr nutzten ihn rund 120.000 Passagiere.
In den 1970er und 1980er Jahren erfolgten mehrere Erweiterungen: 1976 wurde ein neues Terminal eröffnet, 1983 bis 1986 kam ein internationales Terminal hinzu. Die Route Hobart–Christchurch war die einzige internationale Linienverbindung und wurde 1998 eingestellt. Seitdem dient der Flughafen nur noch saisonalen Charterflügen ins Ausland.
1988 ging der Flughafen an die Federal Airports Corporation, 1998 wurde er für 35 Mio. AUD privatisiert. 2008 verkaufte die Regierung Tasmaniens den Flughafen für 352 Mio. AUD an das Tasmanian Gateway Consortium. Seither wurden Terminal, Gepäcksystem und Parkanlagen modernisiert.
Die Start- und Landebahn 12/30 ist 2251 m lang, 45 m breit und mit ILS ausgerüstet. Eine Verlängerung um 280 m ist geplant. Drei Terminals stehen zur Verfügung: das kombinierte Hauptterminal für Inlands- und Charterflüge, ein kleines Regionalterminal der Airline Tasair und zwei Frachtanlagen.
Der Flughafen wird derzeit unter anderem von Qantas, Jetstar, Virgin Australia und Tiger Airways angeflogen, hauptsächlich mit Verbindungen nach Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane und Gold Coast. Zudem starten Flüge der Skytraders regelmäßig zur Casey-Station in der Antarktis. Auf dem Gelände befinden sich Parkflächen, Autovermietungen, Geschäfte, Gastronomie, ein Duty-Free-Shop und das Quality Hotel Hobart Airport. Bus- und Taxiverbindungen führen regelmäßig ins Stadtzentrum.
Hobart International Airport
Code: HBA / YMHB
Lage: 42°50‘10“ S, 147°30‘37“ O
Seehöhe: 4 m (13 ft)
Entfernung: 17 km öslich von Hobart
Inbetriebnahme: 1956
Betreiber: Hobart International Airport Pty Ltd.
Fläche: 498 ha
Terminal: 1
Rollbahn: 1
Länge der Rollbahn: 2751 m (Asfalt)
Fluggesellschaften: 6
Flugzeug-Standplätze: ca. 50
jährliche Passagierkapazität:
jährliche Frachtkapazität:
Beschäftigte: 450 bis 500 (2015/16)
Flughafen-Statistik: Jahr Flugbewegungen Passagiere
1985/86 12 200 506 159
1986/87 11 728 494 483
1987/88 11 556 539 067
1988/89 10 095 544 051
1989/90 8 445 455 024
1990/91 10 140 590 268
1991/92 10 681 683 500
1992/93 10 929 705 658
1993/94 11 325 743 003
1994/95 12 381 815 463
1995/96 11 230 850 295
1996/97 9 468 841 222
1997/98 8 965 853 962
1998/99 9 697 860 240
1999/2000 10 776 908 647
2000/01 15 205 973 922
2001/02 12 266 957 611
2002/03 11 444 1 009 605
2003/04 12 729 1 225 645
2004/05 15 889 1 522 838
2005/06 13 764 1 605 978
2006/07 12 762 1 629 417
2007/08 13 778 1 758 241
2008/09 14 285 1 869 262
2009/10 14 380 1 855 849
2010/11 16 064 1 903 165
2016/17 27 120 2 440 792
Wirtschaft
Wirtschaftlich von Bedeutung sind in Tasmanien die Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft, die Bodenschätze und der Tourismus. Landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Hafer, Gerste und Wolle haben einen großen wirtschaftlichen Einfluss. Die Tasmanier keltern mittlerweile auch einen sehr guten, fruchtigen Wein. In dem Bereich der Fischerei hat die Zucht von Austern Priorität und auch die Menge an gefangenen Meereskrebsen ist bedeutend Tasmanien ist noch zu ungefähr 50% bewaldet und demnach haben die Forstwirtschaft und die holzverarbeitenden Industrien einen hohen Stellenwert. Die Insel ist sehr reich an Bodenschätzen wie Gold, Kupfer, Blei, Nickel, Wismuth, Chrom, Silber, Zink, Zinn und anderen abbaubaren Bodenschätzen. Der Schwerpunkt der tasmanischen Wirtschaft liegt in der Industrie der Papiererzeugung und Nahrungsmittelverarbeitung.
Landwirtschaft
Schon seit den Zeiten der Besiedlung Tasmaniens durch die Briten hat die Landwirtschaft große Bedeutung. Die Zentren der landwirtschaftlichen Nutzung sind das Derwent Valley, das Huon Valley, das Cool River Valley und der Norden der Insel. Noch im 19. Jahrhundert war Tasmanien ein bedeutender Weizenexporteur, heute haben Gerste und Hafer größere Bedeutung, auch der Gemüseanbau spielt eine gewisse Rolle. Der Name Apple Isle weist auf die bedeutende Apfelproduktion, die zum teil nach Großbritannien, aber auch bis in den Ostasiatischen Raum (Japan) exportiert wird. Auch Hopfen gedeiht in gewissen Bereichen Tasmaniens gut und ist für die Biererzeugung sehr gefragt.
Die Landwirtschaft ist ein Eckpfeiler der tasmanischen Wirtschaft und trägt etwa 12-15 % zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Staates bei. Wichtige Produkte umfassen Milchprodukte, Rindfleisch, Lamm, Obst, Gemüse und Wein. Die Milchwirtschaft ist besonders dominant: Tasmanien produziert rund 10 % der australischen Milch, wobei die Regionen im Norden und Nordwesten wie die King Island für ihre hochwertigen Käsesorten bekannt sind. Die Viehzucht konzentriert sich auf Grasfed-Rinder und -Schafe, die auf natürlichen Weiden gehalten werden, was die Produkte als umweltfreundlich und nachhaltig vermarktet. Obst- und Gemüseanbau, einschließlich Äpfel, Kirschen, Beeren und Kartoffeln, blüht in den Tälern des Derwent und Huon Rivers auf. Tasmanien ist Australiens größter Produzent von Kirschen und Beeren, mit Exporten in Märkte wie Asien und Europa.
Tasmanien hat eines der strengsten Quarantänegesetze der Welt. Es ist der einzige australische Staat, der frei von Fruchtfliegen, Kartoffelnematoden und Tabak-Blauschimmel ist. Wie der Rest Australiens ist auch Tasmanien von vielen gefährlichen Tierseuchen wie der Maul- und Klauenseuche, BSE, Tollwut und Rinderpest verschont geblieben. Da wir möchten, dass das so bleibt, haben wir sehr strenge Quarantänevorschriften.
Weinbau
Die Insel verfügt über lange, kühle Sommer und milde Winter, wodurch die Trauben langsamer reifen können. Das Ergebnis sind Weine mit intensiven Aromen, klarer Fruchtstruktur und ausgewogener Säure. Besonders erfolgreich werden hier Pinot Noir und Chardonnay angebaut, wobei Pinot Noir für elegante, fruchtbetonte Rotweine und Chardonnay häufig für frische Weißweine und hochwertige Schaumweine verwendet wird. Weitere verbreitete Rebsorten sind Sauvignon Blanc, Riesling und Pinot Gris, während die Produktion von Schaumweinen nach der traditionellen Methode Tasmanien international bekannt gemacht hat.
Die Weinregionen der Insel sind in verschiedene Geographical Indications unterteilt, darunter das Nordwesten, die Nordostregion um Launceston und Pipers River, der Süden mit dem Coal River Valley sowie die Ostküste und das Tamar Valley. Jede Region bietet aufgrund unterschiedlicher Böden und Mikroklimata spezielle Voraussetzungen für den Weinbau. Tasmanische Weingüter setzen dabei oft auf Qualität statt Masse, viele Betriebe sind klein, familiengeführt und zunehmend auf nachhaltige oder biodynamische Anbaumethoden ausgerichtet.
Regionen wie Coal River Valley produzieren preisgekrönte Pinot Noir- und Chardonnay-Weine, unterstützt durch kühle Klimabedingungen, die an europäische Weinregionen erinnern. Herausforderungen umfassen Klimawandel-Effekte wie Trockenperioden und Schädlinge, aber Initiativen zur nachhaltigen Bewässerung und Biodiversitätsschutz helfen, diese zu mildern. Die Regierung fördert die Branche durch Subventionen und Forschungsprogramme, wie das Tasmanian Institute of Agriculture, das Innovationen in Präzisionslandwirtschaft und biologischem Anbau vorantreibt.
Die weltweite Nachfrage nach fruchtigen Weißweinen hat auch in Tasmanien zur Gründung von neuen wineries geführt, die oft unter Anwendung neuester Technik hervorragende Weine keltern, die gute Frucht mit vollem Körper vereinigen, als Rebsorten sind hier Chardonnay, aber auch Riesling (Rheinriesling), Müller Thurgau und Traminer hervorzuheben (http://www.tasmanian-wine.com.au/wine-lovers-guide.htm).
Forstwirtschaft
Tasmanien ist heute noch zu zirka 50 % bewaldet, die Forstwirtschaft und auch die holzverarbeitende Industrie haben einen dementsprechend hohen Stellenwert. Die in den letzten Jahrzehten sehr stark gewachsene woodchip-export-industry, welche hauptsächlich nach Japan exportiert, ist zuletzt immer stärker ins Visier von Umweltschutz- und Naturschutzgruppen gekommen.
Die Forstwirtschaft Tasmaniens ist geprägt von einer Balance zwischen wirtschaftlicher Nutzung und Umweltschutz, da die Insel über ausgedehnte Wälder verfügt, die etwa 50 % der Landfläche bedecken. Tasmanien beherbergt einige der ältesten und höchsten Bäume der Welt, wie die Eukalyptus-Regnans-Bäume in den Tasmanian Wilderness World Heritage Areas. Die Branche umfasst sowohl Plantagenholz (hauptsächlich Eukalyptus und Kiefern) als auch natürliche Wälder. Plantagen machen rund 20 % der forstwirtschaftlichen Fläche aus und liefern Holz für Papier, Zellstoff und Bauholz.
Wichtige Unternehmen wie Forico und Sustainable Timber Tasmania managen diese Ressourcen. Die Holzindustrie exportiert vor allem in den asiatischen Markt, wobei Produkte wie Furnierholz und Holzschnitzel im Vordergrund stehen. In den letzten Jahren hat es Kontroversen gegeben, insbesondere um die Abholzung alter Wälder, was zu strengen Regulierungen geführt hat: Seit 2013 gibt es ein Moratorium für die Rodung bestimmter Hochwaldgebiete, und der Fokus liegt auf nachhaltiger Forstwirtschaft nach FSC-Standards (Forest Stewardship Council). Der Sektor beschäftigt Tausende und trägt etwa 5 bis 7 % zum BIP bei, mit einem Jahresumsatz von über 1 Milliarde AUD. Klimawandel und Buschfeuer stellen Risiken dar, weshalb Investitionen in Feuerprävention und Wiederaufforstung priorisiert werden. Zudem gewinnt die Forstwirtschaft an Bedeutung im Kontext des Kohlenstoffhandels, da Wälder als CO2-Senken dienen und Tasmanien Programme zur Aufforstung fördert, um Klimaziele zu erreichen.
Fischerei
Tasmaniens Fischerei profitiert von den umliegenden kalten, nährstoffreichen Gewässern des Südlichen Ozeans, die eine reiche Meeresfauna beherbergen. Die Branche ist in kommerzielle Fischerei, Aquakultur und Freizeitfischerei unterteilt und generiert jährlich über 1 Milliarde AUD, was sie zu einem der wichtigsten Exportsektoren macht. Die Aquakultur, insbesondere die Lachszucht, dominiert: Tasmanien ist Australiens größter Produzent von atlantischem Lachs, mit Farmen in der Macquarie Harbour und Huon Estuary. Unternehmen wie Tassal und Huon Aquaculture züchten jährlich Millionen von Fischen, die hauptsächlich nach Asien und in die USA exportiert werden.
Wildfischerei umfasst Arten wie Abalone (Seeohren), Langusten, Thunfisch und Sardinen, wobei strenge Quoten und Schutzzonen die Nachhaltigkeit gewährleisten. Die Abalone-Fischerei ist besonders wertvoll, mit Exporten in den asiatischen Luxusmarkt.
Geplagt wird die Fischerei durch Umweltprobleme wie Algenblüten in Aquakulturbuchten und den Einfluss des Klimawandels auf Meeresströmungen, die Fischbestände beeinflussen. Die tasmanische Regierung reguliert die Branche durch das Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment (DPIPWE), das Fanglimits und Marine Protected Areas durchsetzt. Zudem gibt es Forschungsinitiativen, wie Partnerschaften mit der University of Tasmania, um nachhaltige Praktiken zu entwickeln, einschließlich der Reduzierung von Antibiotika in der Lachszucht. Die Fischerei trägt nicht nur wirtschaftlich bei, sondern unterstützt auch den Tourismus durch Angeltouren
Bergbau
Tasmanien ist sehr reich an Bodenschätzen, vor allem Antimon, Arsen, Wismuth, Cadmium, Chrom, Kobalt, Kupfer, Gold, Eisen, Blei, Mangan, Molybdän, Nickel, Osmium, Scheelit (CaWo4), Silber, Schwefel, Zinn, Titan, Uran, Zink, Zirkonium und Kaolin kommen in abbauwürdigen Mengen vor. 1996/97 wurden aus dem Abbau in Tasmanien 1.243 Millionen Australische $, daneben aus dem Verkauf von reingeschmolzenem Zink, Aluminium und Eisenlegierungen sowie Zement 706 Millionen Australische $ erlöst. Eine in Tasmanien ansässige Firma ist der größte australische Zink-Produzent und zählt zu den sechs größten der Welt. Letztere Produktionszweige profitieren weniger von reichen tasmanischen Vorkommen, als von der relativ billigen elektrischen Energie, die aus großen Wasserkraftwerken gewonnen wird. Der starke Ausbau der Nutzung der Wasserkraft hat schon Ende der 1960er Jahre in Tasmanien zur Etablierung von Grünbewegungen geführt, eine Grünpartei ist auch heute als kleine Oppositionspartei im House of Assembly vertreten.
Die Geschichte des Bergbaus in Tasmanien reicht zurück ins Jahr 1881, als alluviales Gold am Mount Lyell entdeckt wurde. Dies führte zur Gründung der Mount Lyell Gold Mining Company, die ab 1892 auch Kupfer förderte. Die Gesellschaft wurde später in die Mount Lyell Mining and Railway Company umgewandelt und entwickelte sich zum Zentrum des Bergbaus in der West Coast Range, einer bergigen Region nördlich des Franklin-Gordon Wild Rivers Nationalparks. Queenstown, eine kleine Stadt mit rund 1.755 Einwohnern (Stand 2016), entstand als typisches Bergbaustädtchen in einem Tal westlich des Mount Owen. In ihren Blütezeiten im frühen 20. Jahrhundert war Queenstown ein pulsierendes Zentrum mit Schmelzöfen, Ziegeleien, Sägemühlen und einer üppigen, bewaldeten Umgebung. Die Mount Lyell Mine, eines der ältesten Kupferbergwerke der Welt, ist seit über 100 Jahren in Betrieb und hat Millionen Tonnen Erz geliefert. Bis 1923 wurden allein 350.000 Tonnen Kupfer gefördert, was die Region zu einem Hotspot für Einwanderer und Arbeiter machte.
Heute betreibt die Copper Mines of Tasmania Pty Ltd, seit 1999 Teil der indischen Sterlite Industries, den Abbau am Mount Lyell. Die Konzentrate werden nach Indien verschifft, wo sie weiterverarbeitet werden. Neben Kupfer spielen Goldminen wie die Henty Goldmine in Queenstown eine Rolle, die mit modernen Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) betrieben wird. KI hilft bei der Analyse geologischer Karten und Bodenproben, um neue Vorkommen effizienter zu lokalisieren und Kosten zu senken. In Spreyton und anderen Orten gibt es zudem Steinbrüche und kleinere Minen, die den lokalen Bergbau ergänzen. Der Sektor exportiert vor allem nach China, Taiwan und Japan, was den wirtschaftlichen Rückhalt stärkt.
Doch der Bergbau hat auch Schattenseiten: Die intensive Abholzung und der Erzabbau haben in Queenstown eine Mondlandschaft hinterlassen, mit kahlen, erosionsgeprägten Hängen, die als Symbol für Umweltschäden gelten. Historisch führte der Kupferabbau zu massiver Entwaldung, und Debatten über Nachhaltigkeit prägen die Diskussionen bis heute. Trotz strengerer Regulierungen und Fokus auf Tourismus als wachsenden Wirtschaftszweig bleibt der Bergbau essenziell. Er verbindet Tasmaniens Vergangenheit mit einer zukunftsorientierten Industrie, die durch Innovationen wie KI ihre Rolle in einer ressourcenhungrigen Welt sichert. Insgesamt ist Tasmanien ein Paradebeispiel dafür, wie Rohstoffe eine Inselregion zu wirtschaftlichem Wohlstand führen können, ohne ihre natürliche Schönheit vollständig zu opfern.
Handwerk
as Handwerk in Tasmanien ist tief in der Kultur der Insel verwurzelt und reicht von traditionellen Praktiken bis hin zu modernen, künstlerischen Ausdrucksformen. Die Insel ist bekannt für ihre hochwertigen handwerklichen Produkte, die oft lokale Materialien nutzen. Holzarbeiten sind ein zentraler Bestandteil, da Tasmanien über einzigartige Holzarten wie Huon-Pine verfügt, die von Möbelbauern und Kunsthandwerkern geschätzt werden. In Orten wie Deloraine gedeiht die Handwerkskunst, mit kleinen Werkstätten, die alles von handgeschnitzten Möbeln bis hin zu kunstvollen Holzskulpturen produzieren.
Auch die Textil- und Keramikherstellung sind weit verbreitet. Tasmanische Wolle, insbesondere von Merinoschafen, wird zu hochwertigen Textilien verarbeitet, die auf Märkten und in Boutiquen der Insel verkauft werden. Keramiker nutzen lokale Tone und Mineralien, um einzigartige Stücke zu schaffen, die oft von der rauen Schönheit der tasmanischen Landschaft inspiriert sind. In Städten wie Launceston und Hobart gibt es lebendige Handwerksmärkte, wie den Salamanca Market, wo Künstler und Handwerker ihre Waren präsentieren.
Ein weiteres Highlight ist die Lebensmittelhandwerkskunst. Tasmanien ist bekannt für seine kulinarischen Spezialitäten, wie handwerklich hergestellten Käse, Whisky und Bier. Destillerien wie die Lark Distillery in Hobart nutzen lokale Zutaten und traditionelle Brenntechniken, um preisgekrönte Spirituosen zu produzieren. Diese handwerklichen Betriebe profitieren von der reinen Natur der Insel, die sauberes Wasser und hochwertige Rohstoffe liefert.
Industrie und Handwerk in Tasmanien ergänzen sich auf vielfältige Weise. Der Bergbau liefert Rohstoffe wie Metalle, die von Kunsthandwerkern für Schmuck oder Skulpturen genutzt werden. Gleichzeitig inspiriert die industrielle Geschichte – etwa die Bergbaustädtchen wie Queenstown – handwerkliche Kreationen, die diese Vergangenheit in Kunstwerken oder Souvenirs widerspiegeln. Moderne Technologien, wie der Einsatz von KI im Bergbau, finden auch im Handwerk Anwendung, etwa bei der Präzisionsbearbeitung von Materialien oder der Gestaltung digitaler Muster für Textilien.
Industrie
Neben dem Bergbau gibt es kleinere industrielle Aktivitäten, wie Steinbrüche in Spreyton und die Verarbeitung von Holz und Agrarprodukten. Die Holzindustrie, obwohl durch Umweltdebatten eingeschränkt, bleibt relevant, da Tasmanien über ausgedehnte Wälder verfügt. Historisch führte der Bergbau zu Umweltschäden, etwa in Queenstown, wo Abholzung und Erzabbau eine Mondlandschaft hinterließen. Heute stehen Nachhaltigkeit und strengere Regulierungen im Fokus, um Industrie und Naturschutz in Einklang zu bringen.
Das Baugewerbe umfasst in Tasmanien sowohl Wohnungsbau, kommerziellen Bau als auch öffentliche Infrastrukturprojekte wie Straßen, Brücken und Hafenanlagen. Ein zunehmender Fokus liegt auf nachhaltigem Bauen und energieeffizienten Gebäuden, da Umweltbewusstsein und Klimaschutz in der Region eine wachsende Rolle spielen. Der Arbeitsmarkt im Bausektor Tasmaniens ist stark von Fachkräften wie Bauingenieuren, Handwerkern, Architekten und Projektmanagern geprägt. Gleichzeitig gibt es Herausforderungen durch Fachkräftemangel und steigende Baukosten, insbesondere bei Materialien, die importiert werden müssen.
Wasserwirtschaft
Die Wasserwirtschaft in Tasmanien ist geprägt von einem reichen Wasserschätze, der durch jährliche Niederschläge von bis zu 3.000 Millimetern an der Westküste entsteht. Dieses Wasser wird nicht nur für die Trinkwasserversorgung und Landwirtschaft genutzt, sondern dient vor allem als Schlüsselressource für die Energieerzeugung. Hydro Tasmania, das staatliche Energieunternehmen, betreibt ein Netz aus über 50 Wasserkraftwerken, die rund 90 Prozent des Stroms der Insel liefern. Diese Anlagen speichern Wasser in großen Stauseen wie dem Lake Pedder oder dem Gordon-Staudamm und gewinnen daraus saubere, erneuerbare Energie. Gleichzeitig wird die Wasserqualität streng überwacht, um Ökosysteme wie die unberührten Regenwälder zu schützen.
In der Abfallwirtschaft spielt Wasser eine Rolle bei der Behandlung von Abwässern aus Industrie und Haushalten, die in modernen Kläranlagen recycelt und in die Flüsse zurückgeführt werden. So entsteht ein geschlossener Kreislauf, in dem Wasser als Träger von Energie und Nährstoffen fungiert.
Energiewirtschaft
Die tasmanische Energieversorgung erfolgt mit Hilfe von Wasser- und Windkraftwerken. Das öffentliche Stromnetz läuft mit 230/240 Volt / 50 Hertz, aber viele Hotels und Motels verfügen über 110 Volt-Steckdosen (20 Watt) für Rasierapparate. Die 1929 gegründete und 1998 neu strukturierte Energiegesellschaft Hydro Tasmania betreibt insgesamt 27 Wasserkraftwerke.
Hydro Tasmania, ehemals die Hydro-Electric Commission, produziert jährlich über 9.000 Gigawattstunden Strom – genug, um die gesamte Insel autark zu versorgen und Überschüsse zu exportieren. Die dramatische Topografie mit steilen Flüssen und Bergen macht Wasserkraft effizient und kostengünstig. Ergänzt wird dies durch Offshore-Windparks an der Küste, die den Übergang zu einer 100-prozentigen erneuerbaren Energieversorgung vorantreiben. Ein zukunftsweisendes Projekt ist die Produktion von grünem Wasserstoff: Mit überschüssigem Strom aus Wind und Wasser wird Wasser durch Elektrolyse in Wasserstoff gespalten. Tasmanien positioniert sich damit als potenzieller Großexporteur, etwa nach Europa. Eine Studie der Port of Rotterdam Authority und der tasmanischen Regierung zeigt, dass der grüne Wasserstoff aus Tasmanien – dank niedriger Produktionskosten von unter 2 Euro pro Kilogramm – die Dekarbonisierung der nordeuropäischen Industrie fördern könnte. Der Transport per Schiff von Bell Bay nach Rotterdam ist machbar und kostengünstig. Diese Energiewirtschaft schließt nahtlos an die Wasserressourcen an und minimiert Abfall durch effiziente Nutzung von Nebenprodukten wie Wärme aus Kraftwerken.
Abfallwirtschaft
Die Abfallwirtschaft in Tasmanien zielt auf Null-Abfall ab und integriert sich in die breiteren Systeme von Wasser und Energie. Der Fokus liegt auf Recycling, Kompostierung und Energiegewinnung aus Abfall. Haushaltsabfälle werden in modernen Anlagen sortiert, wobei organische Reste zu Biogas verarbeitet werden, das wiederum Strom erzeugt – ein direkter Link zur Energiewirtschaft. Tasmanien hat ambitionierte Ziele: Bis 2030 soll der Recyclinganteil auf 65 Prozent steigen, unterstützt durch ein flächendeckendes Sammelsystem. Industrieabfälle, etwa aus der holzverarbeitenden Branche (Tasmanien ist ein Hotspot für nachhaltige Forstwirtschaft), werden zu Pellets gepresst und als Bioenergiequelle genutzt. Wasser spielt hier eine entscheidende Rolle, da Abwässer aus Recyclingprozessen gereinigt und wiederverwendet werden, um Ressourcen zu schonen. Projekte wie die Kooperation mit internationalen Partnern fördern Technologien zur CO2-Speicherung aus Abfallverbrennung, was die Energiewirtschaft entlastet und den Klimawandel bekämpft. Verbände wie der australische BDEW-Äquivalent betonen, dass solche Ansätze Planungssicherheit und Umweltschutz gewährleisten müssen.
Handel
Tasmanien, der kleinste Bundesstaat Australiens mit rund 570.000 Einwohnern, hat sich in den letzten Jahren zu einem robusten und innovativen Wirtschaftsstandort entwickelt. Mit einem Bruttoinlandsprodukt (GSP) von aktuell 40,6 Milliarden australischen Dollar – ein Rekordwert, der seit dem Amtsantritt der Liberal-Regierung 2014 um beeindruckende 26,3 Prozent oder 8,5 Milliarden Dollar gestiegen ist – profitiert die Insel von ihrer einzigartigen natürlichen Lage, nachhaltigen Ressourcen und einer starken Exportorientierung. Der Fokus liegt auf einer diversifizierten Wirtschaft, in der traditionelle Branchen wie Landwirtschaft und Bergbau mit modernen Sektoren wie Tourismus, grüner Energie und Fertigung verschmelzen. Die Regierung unter Premier Jeremy Rockliff treibt dies durch den "2030 Strong Plan for Tasmania’s Future" voran, der Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Innovation priorisiert, um Jobs zu schaffen und das Wachstum zu sichern. Im Jahr 2025 zeigt die tasmanische Wirtschaft besondere Stärke: Trotz globaler Unsicherheiten führt sie das Land in Business Confidence und liegt auf Platz zwei bei Business Conditions, untermauert durch eine Rekord-Arbeitslosenquote von unter 4 Prozent.
Die tasmanische Wirtschaft basiert auf einer Mischung aus primären und dienstleistungsorientierten Sektoren. Die Landwirtschaft und Aquakultur sind Rückgrat: Die Insel exportiert hochwertige Produkte wie Lachs, Rindfleisch, Milchprodukte, Äpfel, Birnen, Beeren und Gemüse – insgesamt einen Wert von über 5 Milliarden Dollar an Güterexporten im Jahr 2022/23, was etwa 15 Prozent des GSP ausmacht. Bergbau spielt eine zentrale Rolle mit Rohstoffen wie Kupfer, Zink, Zinn, Eisen und Gold, die in verarbeiteter Form exportiert werden und die verarbeitende Industrie ankurbeln, etwa in der Schifffahrt und Textilbranche. Forstwirtschaft und Fischerei ergänzen dies, wobei nachhaltige Praktiken – Tasmanien ist zu 45 Prozent Nationalpark – den Ruf als "grüne Insel" festigen.
Tourismus boomt als Wachstumsmotor: 2023 verzeichneten die Insel 1,19 Millionen Besucher, die 2,07 Milliarden Dollar ausgaben und 10,58 Millionen Übernachtungen buchten – ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die einzigartige Natur, von der Wineglass Bay bis zu den Regenwäldern des Westens, zieht Abenteurer und Ökotouristen an. Ergänzt wird dies durch die Energiewirtschaft: Hydro Tasmania produziert erneuerbare Energie, die nicht nur die Insel versorgt, sondern auch grünen Wasserstoff für den Export ermöglicht – ein Projekt, das Tasmanien zum potenziellen Großlieferanten für Märkte wie Europa positioniert. Der Retail-Handel unterstreicht die Vitalität: Im März 2025 erreichte er mit 743,6 Millionen Dollar monatlich einen Allzeithoch, kumuliert auf 8,75 Milliarden Dollar im Jahr – ein 66-prozentiges Wachstum seit 2014. Lokale Geschäfte in Städten wie Hobart und Launceston profitieren von steigender Konsumkraft und Touristenströmen.
Tasmaniens Handel ist exportgetrieben und widerstandsfähig: Im Januar 2025 beliefen sich die Güterexporte auf 504 Millionen Dollar, mit einem Jahresumsatz von 4,64 Milliarden Dollar – ein Plus von 2,5 Prozent trotz nationaler Rückgänge. Wichtige Abnehmer sind China (für Agrarprodukte), Japan, die USA und Europa; Freihandelsabkommen wie CPTPP, RCEP und das UK-Australia-FTA decken 90 Prozent der Exporte ab und erleichtern den Marktzugang. Die Regierung investiert 5,6 Millionen Dollar in Trade-Boosting-Initiativen, darunter Missionen für Wein und Obstexporteure. Dienstleistungs-Exporte, vor allem Tourismus, wuchsen 2022/23 um 56 Prozent auf 792 Millionen Dollar.
Die Tasmanian Trade Strategy 2019–2025 hat Erfolge gefeiert, indem sie Märkte öffnete, Unternehmen erweiterte und Jobs schuf. Nun läuft die Konsultation für die Nachfolgerin "Trade Strategy 2030", die bis September 2025 Input von Branchen und Bürgern einholt – mit Fokus auf Diversifikation, Resilienz und Chancen in Tech und Nachhaltigkeit. Events wie die Tasmanian Export Awards 2025 ehren Top-Exporteure und fördern Netzwerke.
Tasmaniens Geschäftsumfeld ist unternehmerfreundlich. Die NAB Business Survey hebt die Insel als Spitzenreiter hervor, mit hoher Investitionsbereitschaft trotz Inflation und globaler Herausforderungen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) dominieren, unterstützt durch Programme des Department of State Growth wie Grants für Exporte und Trade Missions. Die "Tasmania Economic Review 2025" von RDA Tasmania analysiert Wachstumstreiber wie Bevölkerungswachstum und Branchentrends, betont aber auch Herausforderungen wie Arbeitskräftemangel und Umweltanpassung. Investitionen in Bildung und Digitalisierung sollen den Übergang zu einer "Wellbeing Economy" erleichtern, die Wohlstand mit Nachhaltigkeit verbindet.
Das Handelszentrum Tasmaniens ist die Hauptstadt Hobart. In Tasmanien gibt es für den Einzelhandel hinsichtlich der Öffnungszeiten keine gesetzlichen Beschränkungen. Große Supermärkte sind in der Regel täglich von 07:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Viele kleinere Lebensmittelgeschäfte haben auch längere Öffnungszeiten.
Finanzwesen
Die bedeutendsten Finanzinstitute des Bundesstaates sind die MyState Bank und die Bank of us, letztere die einzige vollständig tasmanische, kundeneigene Bank mit Sitz in Launceston. Beide bieten klassische Bankdienstleistungen wie Kontoführung, Kredite, Baufinanzierungen und Versicherungsprodukte an und konzentrieren sich stark auf die Bedürfnisse regionaler Kunden. Daneben sind auch große nationale Banken wie die Commonwealth Bank, ANZ, NAB und Westpac vertreten, allerdings meist mit reduzierter physischer Präsenz.
In den letzten Jahren hat sich das Bankwesen auf der Insel stark gewandelt. Die Zahl der Filialen und Geldautomaten ist deutlich zurückgegangen, da immer mehr Menschen digitale Angebote nutzen. Heute existieren in ganz Tasmanien nur noch rund 46 Bankfilialen, wodurch vor allem ländliche Gebiete unter eingeschränktem Zugang zu persönlichen Bankdienstleistungen leiden. Gleichzeitig wächst die Bedeutung von Onlinebanking und mobilen Finanzlösungen, was zu einem verstärkten Wettbewerb zwischen traditionellen Banken und digitalen Anbietern führt.
Die tasmanische Wirtschaft, stark geprägt von Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tourismus, beeinflusst auch das Finanzwesen. Banken wie die Rabobank und regionale Institute bieten speziell auf die Bedürfnisse dieser Branchen zugeschnittene Finanzprodukte an – etwa Betriebskredite, Investitionsdarlehen oder saisonale Finanzierungslösungen. Der Agrarsektor wird in vielen Berichten als einer der stabilsten und wachstumsstärksten Wirtschaftszweige der Insel beschrieben, was Tasmanien zu einer „Erfolgsgeschichte der australischen Landwirtschaft“ macht.
Soziales und Gesundheit
Der Tasmanian Department of Health (Tasmanisches Gesundheitsministerium) ist die zentrale Behörde, die für Krankenhäuser, Ambulanzdienste, Community-Health-Programme und Primärversorgung verantwortlich ist. Das System zielt auf eine nachhaltige, patientenzentrierte Versorgung ab, mit Fokus auf Prävention, Integration von Akut- und Primärpflege sowie Unterstützung vulnerabler Gruppen wie Älteren, Aborigines und Menschen in ländlichen Gebieten.
Die Spitäler Tasmaniens sind:
- Royal Hobart Hospital (RHH) - öffentliches Spital in Hobart.
- Calvary Hospital - privates Spital in Hobart, betrieben von katholischen Nonnen.
- St Johns Calvary Hospital - Campus des Calvary Hospital.
- Hobart Private Hospital - privates Spital in Hobart in der Nähe des Royal Hobart Hospital.
- St Helens Private Hospital - privates Spital in Hobart.
- Launceston General Hospital (LGH) - öffentliches Spital in Launceston.
- St Vincent's Private Hospital - privates Spital in Launceston.
- St Lukes Private Hospital - privates Spital in Launceston.
- Mersey Community Hospital - Gemeindespital in Latrobe.
- North West Regional Hospital (NWRH) - öffentliches Spital in Burnie.
- North West Private Hospital - privates Spital in Burnie.
Das Tasmanian Health Service ist der operative Arm des Ministeriums, der öffentliche Krankenhäuser (zum Beispiel Royal Hobart Hospital, Launceston General Hospital), ambulante Dienste (Ambulance Tasmania) und Community-Services wie Zahnmedizin, Alters- und Mentale-Gesundheitsversorgung bereitstellt.
Über 70 Standorte bieten kostenlose oder subventionierte Dienste wie Kindergesundheitschecks (zum Beispiel "Kids Love to Learn"-Programm für 18-Monatige) und Unterstützung für chronische Erkrankungen. In ländlichen und abgelegenen Regionen (die den Großteil Tasmaniens ausmachen) gibt es spezialisierte Dienste zur Bekämpfung von sozialer Benachteiligung, niedrigen Löhnen und höherer Arbeitslosigkeit.
Stark ausgebaut durch Reformen seit 2019, inklusive 24/7-Hotlines (Access Mental Health: 1800 332 388), Headspace-Zentren für Jugendliche und Partnerschaften mit Organisationen wie Lifeline Tasmania. Investitionen von über 410 Millionen AUD in den letzten Jahren zielen auf Suizidprävention und Community-Recovery-Programme ab.
Spezielle Programme adressieren höhere Raten von Gewalt, Substanzmissbrauch und chronischen Erkrankungen in indigenen Communities, zum Beispiel durch Primary Health Tasmania. "Our Healthcare Future" (seit 2020) integriert Dienste, um auf demografische Herausforderungen wie eine alternde Bevölkerung (Medianalter: 41 Jahre) zu reagieren. Der Fokus liegt auf Digitalisierung, Qualitätsstandards und Partnerschaften mit dem Bund (zum Beispiel neue Krebstherapien und MS-Forschung).
Krankheiten
Laut dem Australian Bureau of Statistics (ABS, National Health Survey 2022) leiden 58,4 % der erwachsenen Tasmanier an mindestens einer chronischen Erkrankung – der höchste Wert in Australien. Dies wird durch hohe Raten an Risikofaktoren wie Rauchen (16,4 % tägliche Raucher) und Übergewicht (70,9 % der Erwachsenen) verstärkt. Besonders betroffen sind ältere Menschen, indigene Gemeinschaften und Bewohner abgelegener Regionen, wo der Zugang zu Gesundheitsdiensten eingeschränkt ist.
Chronische Erkrankungen dominieren das Krankheitsbild. Arthritis (24,2 %) ist weit verbreitet, insbesondere bei älteren Menschen, und führt in ländlichen Gebieten häufig zu eingeschränkter Mobilität. Blutdruckhoch (Hypertonie) betrifft 24,8 % der Bevölkerung und ist ein Hauptrisikofaktor für Herz-, Schlaganfall- und Gefäßerkrankungen (9,7 %), die bei älteren und behinderten Menschen bis zu 17,3 % erreichen. Asthma (12,7 %) wird durch das feuchte Klima verschärft, mit höheren Raten bei Kindern. Diabetes (6,3 %) ist eng mit Adipositas verbunden und überproportional in indigenen Gemeinschaften vertreten. Krebs (5,5 %), insbesondere Prostata- und Brustkrebs, ist ebenfalls bedeutend, wobei Tasmanien die höchste Prävalenz von Multipler Sklerose (MS) in Australien aufweist, was durch Forschungsarbeiten des Menzies Institute unterstützt wird. Osteoporose (5,2 %) betrifft vor allem Frauen über 50, während chronische Nierenerkrankungen (2,0 %) teils genetisch bedingt sind (8,5 % der Fälle durch zystische Nieren).
Infektionskrankheiten spielen eine saisonale Rolle. Akute Atemwegsinfektionen wie Influenza, RSV und COVID-19 sind laut RespTas-Report 2025 moderat aktiv, begünstigt durch das Klima. Historisch hatten eingeschleppte Krankheiten wie Masern oder Grippe im 19. Jahrhundert verheerende Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung, was bis heute soziale und gesundheitliche Ungleichheiten nachwirkt. Seltene Erkrankungen (Rare Diseases) belasten das Gesundheitssystem ebenfalls, mit Prävalenzen von bis zu 1/2000 für bestimmte genetische Krankheiten.
Bildung
Das Bildungssystem Tasmaniens ist ein integraler Bestandteil des australischen Bildungswesens, wird jedoch durch ein einzigartiges dreigliedriges Schulsystem geprägt, das vom Department for Education, Children and Young People verwaltet wird. Es umfasst frühkindliche Bildung, Primar- und Sekundarstufen sowie tertiäre Ausbildung und orientiert sich am Australian Curriculum, der acht Kernbereiche wie Englisch, Mathematik, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften abdeckt. Mit etwa 55.000 Schülern im Jahr 2023 steht Tasmanien vor Herausforderungen wie niedrigen Literacy- und Numeracy-Raten, die unter dem nationalen Durchschnitt liegen, aber auch vor ambitionierten Reformen, um die Bildungsqualität zu steigern.
Die frühkindliche Bildung beginnt mit Programmen wie Launching into Learning, das Kindern von der Geburt bis vier Jahre kostenlos in Primarschulen oder Familienzentren angeboten wird. Der Kindergarten ist ab vier Jahren freiwillig, aber stark empfohlen. Die Primarstufe (Prep bis Jahr 6, Alter 5–12) legt den Fokus auf Grundlagen wie Lesen, Schreiben und Rechnen und wird in 123 öffentlichen Primarschulen angeboten. In ländlichen Gebieten übernehmen sogenannte Distriktsschulen oft die gesamte Schulbildung von Kindergarten bis Jahr 12, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten.
Die Sekundarstufe ist in zwei Phasen unterteilt: Die High School (Jahr 7–10, Alter 12–15) vermittelt fortgeschrittene Fächer in 54 Schulen, während die Senior Secondary Colleges (Jahr 11–12, optional Jahr 13, Alter 15–18) auf das Tasmanian Certificate of Education (TCE) oder berufliche Ausbildungen (VET) vorbereiten. Acht Colleges in Städten wie Hobart und Launceston bieten spezialisierte Kurse, und einige High Schools decken ebenfalls Jahr 11–12 ab. Die Schulpflicht gilt bis 17 Jahre, wobei Schüler nach Jahr 10 in Arbeit, Ausbildung oder Kombinationen wechseln können. Besonders in ländlichen Regionen unterstützt die Tasmanian eSchool Fernunterricht für alle Stufen.
Etwa 70 % der Schüler besuchen öffentliche Schulen, die kostenlos sind, während der Rest unabhängige (oft religiöse) Schulen wählt. Tasmanien hat die höchste Homeschooling-Quote Australiens (6,4 pro 1.000 Kinder). Internationale Schüler können sowohl öffentliche als auch private Schulen besuchen. Das System ist inklusiv gestaltet, mit besonderem Augenmerk auf indigene Schüler und Programme zur Förderung kultureller Sicherheit. Dennoch wird das dreigliedrige System kritisiert, da nur etwa 50 % der Jahr-10-Schüler ein College besuchen.
Tasmanien war ein Bildungspionier: 1868 führte es als erste australische Kolonie die Schulpflicht ein, 1885 wurde ein Bildungsministerium gegründet, und 1908 wurden Schulgebühren abgeschafft. Aktuelle Reformen basieren auf der Independent Education Review 2024 und umfassen die Einführung von Multi-School Organisations (MSO) ab 2026, um Ressourcen besser zu nutzen, sowie die vollständige Finanzierung aller öffentlichen Schulen ab 2025 (zusätzliche 300 Mio. AUD bis 2030). Die Lifting Literacy-Strategie zielt darauf ab, den funktionalen Analphabetismus (ca. 50 % der Bevölkerung) durch phonetischen Unterricht zu bekämpfen, während die Kampagne Every School Day Matters die Schulbesuchsraten steigern soll.
Fortbildende Schulen auf Tasmanien sind:
High schools
- Bridgewater High School
- Brooks High School
- Burnie High School
- Claremont High School
- Clarence High School
- Cosgrove High School
- Deloraine High School
- Devonport High School
- Exeter High School
- Geilston Bay High School
- Huonville High School
- Kings Meadows High School
- Kingston High School
- Latrobe High School
- Montrose Bay High School
- New Norfolk High School
- New Town High School (boys only)
- Ogilvie High School (girls only)
- Parklands High School
- Penguin High School
- Port Dalrymple School
- Prospect High School
- Queechy High School
- Reece High School
- Riverside High School
- Rokeby High School
- Rose Bay High School
- Scottsdale High School
- Smithton High School
- Taroona High School
- Ulverstone High School
- Wynyard High School
Colleges
- Claremont College
- Elizabeth College
- Hellyer College
- Hobart College
- Launceston College
- Newstead College
- Rosny College
- The Don College
- Australian Technical College - Northern Tasmania
Höhere Bildung
Die University of Tasmania (UTAS) ist eine australische Universität in Hobart und Launceston auf der Insel Tasmanien. Sie wurde 1890 gegründet und ist damit die viertälteste Universität in Australien. Die Universität wurde 1890 als Hochschule in Hobart gegründet. 1991 fusionierte sie mit dem Tasmanian Institute of Technology in Launceston. Die UTAS bietet über 200 verschiedene Studienkurse in grundständigen Studienfächern sowie postgraduale Möglichkeiten an. Bekannt ist die Universität für Ihre Ausbildungs- und Forschungsqualitäten in Arktis- und Meereswissenschaften; es ist sogar eine eigene Forschungsstation in der Antarktis vorhanden. Zudem verfügt sie über eigene Radioteleskope, das Mount Pleasant Radio Observatory.
Bibliotheken und Archive
In Tasmanien sorgt Libraries Tasmania für alle öffentlichen Bibliotheken, Archive und historische Sammlungen im Bundesstaat. Es handelt sich um einen staatlich finanzierten Dienst, der neben den 46 öffentlichen Bibliotheken unter anderem die State Library and Archives of Tasmania, das Allport Library and Museum of Fine Arts und das Büro des State Archivist umfasst.
Die State Library and Archives of Tasmania sammeln, bewahren und zugänglich machen das dokumentarische Erbe Tasmaniens – von Regierungsakten über Gemeindeunterlagen bis hin zu Manuskripten, Karten, Fotos und Kunst. Zur Aufgabe gehört auch, ein Exemplar jeder in Tasmanien publizierten Veröffentlichung aufzubewahren (Legal Deposit).
Die öffentlichen Bibliotheken verteilen sich über ganz Tasmanien – von den „Hauptstädten“ Hobart und Launceston bis in entlegene Regionen und sogar auf Inseln wie Flinders und Bruny. Die Mitglieder dürfen Bücher, Zeitschriften, Filme, Musik etc. kostenlos ausleihen und haben Zugriff auf eine breite Auswahl digitaler Medien sowie auf Online-Ressourcen. Außerdem werden Kurse und Programme angeboten, zum Beispiel zur Förderung von Lese-, Schreib- und digitalen Kompetenzen, Familienforschung, Erwachsenenbildung etc.
Die tasmanischen Archive bestehen aus zwei Hauptbereichen:
- Government Archives: Behörden sind gesetzlich verpflichtet, dauerhaft relevante staatliche Unterlagen in das Archivinventar zu überführen.
- Community Archives: Sammlungen privater und organisatorischer Herkunft – Fotos, Tagebücher, Korrespondenzen etc., die das gesellschaftliche und kulturelle Gedächtnis ergänzen.
Seit Anfang 2025 besteht in Launceston eine neue Einrichtung: ein spezieller Raum der State Library and Archives, der lokalen historischen Aufzeichnungen und Gemeinschaftsarchiven gewidmet ist. Die digitalen Angebote sind stark ausgebaut: Mehr als 1,2 Millionen Archiv- und Kulturdokumente Tasmaniens sind mittlerweile online durchsuchbar. Presse, Zeitungen, historisches Bildmaterial und andere Medien werden zunehmend digital zugänglich gemacht.
Kultur
Die Leute und Ereignisse, die der Insel ihren Stempel aufgedrückt haben, sind bis heute nicht vergessen. Wo immer Sie hingehen, können Sie den Abdruck sehen, die sie hinterlassen haben. Die Kunst- und Kulturlandschaft Tasmaniens ist stark und lebendig. Der mehr zwanglose Lebensstil, eine allgemein anspruchslose Art sowie eine dynamische Kunstszene zieht Schriftsteller, Künstler und Schauspieler an. Zwar stellen wir nur drei Prozent der australischen Bevölkerung, jedoch sind hier aber neun Prozent seiner Künstler zu Hause.
Tasmanien war Pate einer Rennsportserie in den 1960er Jahren für Formelwagen, der Tasman-Serie. In Arno Schmidts Roman „Abend mit Goldrand“ (1975) ist Tasmanien das utopische Ziel einer chiliastischen Rotte. Tasmania Berlin war ein Berliner Fußballverein, der in der Saison 1965/66 in der 1. Bundesliga spielte.
Kultur der Tasmanier
Die Tasmanier machten einige technische Neuerungen Australiens wie den Bumerang aufgrund ihrer Isolation nach der Trennung der beiden Landmassen nicht mit. Da beide Kulturen keine ozeangängigen Boote kannten, unterblieb auch ein nachfolgender kultureller Austausch.
Da Tasmanien erheblich kleiner ist als das restliche Australien, im Innern zudem dicht bewaldet, konnte es nur eine geringe Bevölkerung einer Jäger- und Sammlerkultur tragen. Die Gesamtbevölkerungszahl wird von unterschiedlichen Quellen auf zwischen 5.000 und 20.000 Menschen geschätzt.
Diese kleine Population implizierte nicht nur ein geringes Innovationspotential, sondern auch den allmählichen Verlust bereits vorhandener kultureller Errungenschaften wie zum Beispiel Fischfang, Speerjagd oder Kleidung. Dieser kulturelle „Verfall“ ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass die Tasmanier nur in sehr kleinen Gruppen lebten und eine dauerhafte und lückenlose Tradierung des Wissens nicht gewährleistet werden konnte. So verschwand der zur Zeit der Abtrennung noch bekannte Fischfang und die Herstellung von Knochenwerkzeugen in den folgenden Jahrtausenden; der Verlust der Werkzeugkenntnisse führte dann zum Verlust der Kleidungsherstellung. Dass die Tasmanier tatsächlich, wie Indizien anzeigen, das Feuer noch nicht entwickelt hatten, erscheint unwahrscheinlich.
Diskutiert wird auch, dass sich die tasmanische Kultur nach diesem kulturellen Abschwung in einem erneuten, langsamen Aufschwung befunden habe, was die traditionelle Beurteilung der Tasmanier als isolierte und im Niedergang begriffene Kultur in Frage stellt. So wurden auf Tasmanien Kanus entwickelt und es entstand eine halbsesshafte Dorfkultur.
Museen
Tasmanien, die Insel im Süden Australiens, beherbergt eine beeindruckende Vielfalt an Museen, die von moderner Kunst über koloniale Geschichte bis hin zu maritimer Heritage und natürlicher Wissenschaft reichen. Mit über 50 Einrichtungen, darunter große staatliche Museen und kleine regionale Sammlungen, spiegeln sie die reiche Kultur, die indigene Vergangenheit und die einzigartige Umwelt der Insel wider. Viele Museen sind in historischen Gebäuden untergebracht und bieten interaktive Ausstellungen, die Besucher aus aller Welt anziehen. Der Fokus liegt oft auf der tasmanischen Identität, einschließlich der Aborigines-Kultur, der Sträflingsgeschichte und zeitgenössischer Kunst. Im Jahr 2025 sind Eintritte teilweise kostenlos oder erschwinglich, und viele Orte haben sich an nachhaltige Praktiken angepasst, um die fragile Natur zu schützen.
Das prominenteste Museum ist zweifellos das Museum of Old and New Art (MONA) in Hobart, das als eines der kontroversesten und innovativsten Kunstmuseen der Welt gilt. Gegründet vom Millionär David Walsh, öffnete es 2011 und präsentiert eine eklektische Sammlung alter und neuer Kunst, oft mit provokativen, erotischen oder dunklen Themen. Das unterirdische Gebäude, in einen Felsen gehauen, umfasst Werke von Künstlern wie Sidney Nolan oder Wim Delvoye. MONA ist nicht nur ein Museum, sondern ein Erlebnisort mit Weingut, Brauerei, Restaurants und Events wie dem Dark Mofo Festival. Es ist von Donnerstag bis Montag geöffnet (ab Oktober 2025), und der Eintritt kostet für Nicht-Tasmanier etwa 38 AUD; der Fährtransfer vom Hafen Hobart ist ein Highlight.
In Hobart liegt auch das Tasmanian Museum and Art Gallery (TMAG), das älteste Museum der Insel (gegründet 1843). Es kombiniert Kunst, Geschichte und Naturwissenschaften in einem kostenlosen Angebot für Familien. Highlights sind Aborigines-Artefakte, koloniale Relikte und eine interaktive Ausstellung zur tasmanischen Tierwelt, inklusive des ausgestorbenen Beuteltigers. Das TMAG ist ein idealer Einstieg in die tasmanische Kultur und bietet Programme für Kinder sowie temporäre Ausstellungen. Ebenfalls in der Hauptstadt: Das Maritime Museum Tasmania widmet sich der Seefahrtsgeschichte mit Modellen, Artefakten von Schiffswracks und Geschichten zur Walfang-Ära. Es betont Tasmanias Inselcharakter und ist in einem historischen Gebäude am Hafen untergebracht.
Außerhalb Hobarts lohnt der Queen Victoria Museum & Art Gallery (QVMAG) in Launceston, das größte regionale Museum Australiens. Es umfasst eine Kunstgalerie, ein Naturkundemuseum mit Dinosaurier-Fossilien und ein Planetarium. Themen reichen von indigener Geschichte bis zur Industriellen Revolution in Tasmanien. Ein weiteres Juwel ist der Port Arthur Historic Site südlich von Hobart, ein UNESCO-Weltkulturerbe und Freilichtmuseum zur Sträflingsvergangenheit. Mit Ruinen, Führungen und Geistertouren erzählt es von der harten Kolonialzeit (1830–1877) und zieht jährlich Hunderttausende Besucher an.
In ländlichen Regionen finden sich spezialisierte Museen wie das West Coast Pioneers' Museum in Zeehan, das die Bergbaugeschichte der Westküste beleuchtet, oder das Mawson's Huts Replica Museum in Hobart, eine Nachbildung der Antarktis-Hütten des Entdeckers Douglas Mawson. Kleine lokale Museen, wie das Markree House Museum oder das Military Museum of Tasmania, ergänzen das Angebot mit Fokus auf Alltagsgeschichte und Militaria. Viele dieser Einrichtungen sind ehrenamtlich geführt und bieten Einblicke in regionale Besonderheiten, zum Beispiel die Eisenbahn-Geschichte im Don River Railway Museum oder Wildlife im Bonorong Wildlife Sanctuary, das eher ein interaktives Museum als Zoo ist.
Architektur
In der frühen Kolonialzeit des 19. Jahrhunderts prägten georgianische Einflüsse die Architektur, die sich durch Schlichtheit und Funktionalität auszeichnete. Gebäude wie das Woolmers Estate (bei Longford, um 1817), ein elegantes Herrenhaus im Besitz des National Trust, verkörpern diese Ära mit ihren klaren Linien und robusten Materialien. Mit dem Bergbaureichtum des späten 19. Jahrhunderts kamen viktorianische und edwardianische Bauten hinzu, die Pracht und Ornamentik betonten. Beispiele wie die Old Bank in Launceston (1884/85) im Queen-Anne-Stil oder die imposante Town Hall (1864) zeigen den Wohlstand dieser Zeit. Auch die neogotische St. David’s Cathedral in Hobart (1865 bis 1867) und die historischen Überreste der Strafkolonie Port Arthur, ein UNESCO-Weltkulturerbe, zeugen von dieser Ära.
Im 20. Jahrhundert öffneten sich Tasmanien internationale Einflüsse, etwa aus Japan und Skandinavien, und die Architektur entwickelte sich weiter. Art-Deco-Elemente finden sich in Bauten wie Tarraleah (1930er), einem Wohnkomplex für Hydroelektrik-Arbeiter, während die Mid-Century-Moderne neue Impulse setzte. Seit den 2000er Jahren steht Nachhaltigkeit im Fokus, wobei moderne Designs die spektakuläre Landschaft Tasmaniens integrieren. Das Museum of Old and New Art (MONA) in Hobart, 2011 von Fender Katsalidis entworfen, ist ein ikonisches Beispiel: unterirdisch angelegt, wirkt es wie eine Skulptur und hat Tasmanien international Aufmerksamkeit verschafft. Ebenso beeindruckt The Hedberg (Hobart, 2017) von Liminal Architecture, das historische Elemente mit modernen Glas- und Metallstrukturen kombiniert. Projekte wie das River’s Edge Building der University of Tasmania in Launceston (2024) von John Wardle Architects oder die Devil’s Corner Winery (2016) mit ihrem markanten Aussichtsturm zeigen, wie Architektur industrielle Vergangenheit und Natur verbindet. Auch kleinere Projekte wie das Bruny Shore House auf Bruny Island setzen auf nachhaltige Materialien und eine harmonische Einbindung in die Küstenlandschaft.
Die Tasmanian Architecture Awards 2024 würdigten solche Entwicklungen, etwa das James Street-Projekt von Taylor and Hinds Architects, das für seine nuancierte Raumgestaltung gefeiert wurde. Architekturbüros wie JAWS Architects oder 1+2 Architecture stehen für diesen modernen Ansatz, der Klima, lokale Materialien und Nachhaltigkeit priorisiert. Tasmaniens Architektur bleibt so ein dynamisches Feld, das Geschichte bewahrt und gleichzeitig mutig in die Zukunft blickt.
Commonwealth Heritage listet alle schützenswerten Objekte Tasmaniens auf. Grundlage der Liste ist der Environment Protection and Biodiversity Conservation Act aus dem Jahr 1999. Bis November 2004 wurden in dem Bundesstaat 15 Stätten in die Liste aufgenommen.
- Anglesea Barracks
- Australian Maritime College, Newnham Campus
- Cape Sorell Lighthouse
- Cape Wickham Lighthouse
- Eddystone Lighthouse (Tasmanien)
- General Post Office, Hobart
- General Post Office, Launceston
- Goose Island Lighthouse
- Mersey Bluff Lighthouse
- Paterson Barracks Commissariat Store
- Pontville Small Arms Range Grassland Site
- Queenstown Post Office
- Swan Island Lighthouse
- Table Cape Lighthouse
- Tasman Island Lighthouse
Bildende Kunst
Die Kunstszene Tasmaniens ist so vielfältig wie die Landschaft: von indigenen Wurzeln über koloniale Geschichten bis hin zu avantgardistischen Werken, die Tabus sprengen. Museen wie das ikonische Museum of Old and New Art (MONA) und das historische Tasmanian Museum and Art Gallery (TMAG) in Hobart bilden das Herz dieser Szene, während Festivals, Künstlerkollektive und unkonventionelle Projekte wie das Pooseum oder die Earth's Black Box die Insel zu einem kreativen Hotspot machen.
Das MONA, 2011 von David Walsh gegründet, ist mehr als ein Museum – es ist ein Erlebnis. In einer ehemaligen Weinkellerei am Derwent-Fluss gelegen, zeigt es eine eklektische Sammlung von antiken Artefakten bis hin zu zeitgenössischen Werken, die Themen wie Sterblichkeit und Sexualität provokativ angehen. Berühmt wurde es durch kontroverse Ausstellungen, etwa gefälschte Picassos als Statement gegen Frauenfeindlichkeit. Mit Events wie dem Dark Mofo-Festival, das Nacktprozessionen und Feuerperformances bietet, zieht das MONA jährlich Hunderttausende an. Ebenso bedeutend ist das TMAG, Australiens ältestes Museum, das seit 1846 Naturgeschichte und Kunst vereint. Es zeigt Aborigines-Artefakte, koloniale Gemälde und Werke moderner Künstler wie Ricky Maynard, die den Konflikt zwischen Siedlern und indigenen Tasmaniern reflektieren. Mit 400.000 Besuchern jährlich ist es ein kultureller Ankerpunkt am Hafen von Hobart.
Jenseits der Museen sprüht Tasmanien vor kreativer Energie. Das Pooseum in Hobart, ein preisgekröntes Projekt der Österreicherin Karin Koch, verwandelt Tierkot in Kunst – von Skulpturen aus Kuhdung bis zu Gemälden mit Wombat-Kot. Der jährliche „Poo-tastic Tasmanian Paint Off“ bricht spielerisch Tabus und sensibilisiert für Biodiversität. Ebenso faszinierend ist die Earth's Black Box im Westen der Insel, ein Stahlturm, der als Kunst-Technik-Hybrid die Menschheitsgeschichte und Klimakrise für zukünftige Generationen dokumentiert. Indigene Kunst, etwa Korroboree-Darstellungen oder Fotografien von Ricky Maynard, erzählt von Landrechten und kulturellem Überleben, während das Tasmanian College of the Arts und Festivals wie Ten Days on the Island Nachwuchskünstler fördern. Street-Art in Hobart, besonders in North Hobart, verbindet Naturmotive mit kolonialer Geschichte in farbenfrohen Murals.
Literatur
Die tasmanische Literatur ist tief verwurzelt in der Geschichte der Insel als ehemalige Sträflingskolonie und ihrer komplexen Beziehung zur Natur und den indigenen Völkern. Das Tasmanian Gothic, ein Begriff, der in den 1980er Jahren populär wurde, beschreibt Werke, die die düstere Atmosphäre der Insel einfangen – von der Brutalität der Konviktzeit bis hin zur Isolation in der Wildnis. Ein frühes Beispiel ist Marcus Clarkes Roman For the Term of His Natural Life (1874), der das Leiden der Sträflinge in Port Arthur schildert und als Vorläufer des Genres gilt. Zeitgenössische Autoren wie Richard Flanagan, der mit The Narrow Road to the Deep North (2013) den Booker-Preis gewann, verweben tasmanische Motive in ihre Werke. Sein Roman Death of a River Guide (1995) verbindet die raue Natur mit spirituellen und indigenen Elementen, während er das Gothic-Stereotyp kritisch hinterfragt. Amanda Lohrey (The Conversion, 2020) und Heather Rose (The Museum of Modern Love, 2016) setzen diese Tradition fort, indem sie Isolation, Trauma und Identität erkunden. Lokale Verlage und das Tasmanian Writers' Centre fördern Nachwuchstalente, während Festivals wie das Hobart Writers Festival die literarische Szene beleben. Die tasmanische Literatur ist somit ein Spiegel der Insel: schön, rau und von Geistern der Vergangenheit durchzogen.
Die bedeutendsten Autoren Tasmaniens sind:
- Nan Chauncy
- Marcus Clarke
- „Tasma“ (Jessie Couvreur)
- Stephen Edgar (Poet)
- Richard Flanagan
- Martin Flanagan
- Christopher Koch
- Amanda Lohrey
- Louisa Ann Meredith
- Katherine Scholes
- Margaret Scott
- Rachael Treasure
- Reverend John West
- Danielle Wood
Die wichtigsten Werke sind:
- History of Tasmania, 1852 von Reverend John West
- Notes and Sketches of New South Wales, 1844 von Louisa Ann Meredith
- My Residence in Tasmania, 1852 von Louisa Anne Meredith
- Bush Friends in Tasmania, 1860 und 1891 von Louisa Anne Meredith
- For the Term of His Natural Life von Marcus Clarke
- Uncle Piper of Piper's Hill, 1889 von „Tasma“
- Out of Ireland von Christopher Koch
- The sound of one hand clapping von Richard Flanagan
Theater
Das Theater in Tasmanien ist ein lebendiger Ausdruck lokaler Geschichten, der die Vergangenheit mit zeitgenössischen Fragen verbindet. Das Theatre Royal in Hobart, Australiens ältestes noch aktives Theater (gegründet 1834), ist ein zentraler Ort für Aufführungen, die oft die tasmanische Geschichte reflektieren. Die Reihe „Made in Tasmania“ bringt Stücke von lokalen Dramatikern auf die Bühne, die Themen wie die Sträflingszeit oder indigene Rechte behandeln. Speziell das Dark Mofo-Festival, organisiert vom Museum of Old and New Art (MONA), hat das tasmanische Theater revolutioniert. Hier verschmelzen experimentelle Performances mit Gothic-Elementen, etwa in Inszenierungen, die die Schrecken der Kolonialzeit oder die Mythen um den ausgestorbenen Tasmanischen Tiger aufgreifen.
Regionale Festivals wie The Unconformity in Queenstown nutzen die Landschaft selbst als Bühne, um immersive Theatererlebnisse zu schaffen. Diese Produktionen verbinden die Community und geben marginalisierten Stimmen, insbesondere der Aboriginal-Bevölkerung, Raum. Das tasmanische Theater ist damit ein Medium, das Geschichte und Gegenwart in einem intimen, oft unheimlichen Rahmen vereint.
Film
Die tasmanische Filmindustrie hat sich dank der dramatischen Landschaften und staatlicher Förderung durch Screen Tasmania (gegründet 1999) zu einem bedeutenden Standort entwickelt. Filme wie The Tale of Ruby Rose (1988), ein Gothic-Drama über das Überleben in den Highlands, oder Van Diemen’s Land (2009), das die wahre Geschichte des kannibalistischen Sträflings Alexander Pearce erzählt, verkörpern das Tasmanian Gothic auf der Leinwand. Moderne Produktionen wie The Hunter (2011) mit Willem Dafoe, der einen Söldner auf der Suche nach dem Tasmanischen Tiger zeigt, oder die Horrorserie The Kettering Incident (2016) nutzen die unheimliche Atmosphäre der Insel, um Geschichten von Verlust und Geheimnis zu erzählen. Komödien wie Rosehaven (2016/21) bieten eine leichtere Perspektive, während Filme wie The Nightingale (2018) die Brutalität der Black War thematisieren. Festivals wie Stranger With My Face, das sich auf Horrorfilme von Frauen konzentriert, fördern lokale Talente. Über 50 Filme wurden in Tasmanien gedreht, unterstützt durch die einzigartige Kulisse und eine wachsende Infrastruktur. Die Insel ist somit nicht nur Schauplatz, sondern ein aktiver Charakter in diesen Erzählungen.
Zu den auf Tasmanien entstandenen Filmen gehören:
| Film | Jahr | Orte |
| Almost Alien | 1997 | Tasmanien; Adelaide, Flinders Ranges, Hawker, South Australia - Australia |
| Andrew, Sauveteur de baleines en Tasmanie | 2007 | Tasmanien - Australia |
| Aya | 1990 | Hobart, Tasmanien; Melbourne, Point Lonsdale, Victoria - Australia |
| Beyond Gravity | 2000 | Tasmanien - Australia; Bishop, California - USA; Vancouver Island, Squamish, British Columbia - Canada; Tasermuit Fjord - Greenland |
| Boys | 2003 | Tasmanien - Australia; Chennai, Tamil Nadu; Cochin, Kerala - India |
| Boys in the Island | 1989 | Tasmanien; Melbourne, Victoria; Sydney, New South Wales - Australia |
| Dying Breed | 2008 | Dandenong Ranges National Park, Victoria; Tasmanien - Australia |
| Exile | 1994 | Tasmanien - Australia |
| For the Term of His Natural Life | 1927 | Port Arthur, Tasmanien; Berrima, Bondi Junction, Sydney Harbour, Sydney, Wombeyan Caves, New South Wales - Australia |
| The Last Confession of Alexander Pearce | 2008 | Central Highlands, Derwent Bridge, Lake St Clair, Mount Wellington, Nelson's Falls, Tahune Forest Reserve, Tasmanien; Somersby, Rozelle, Sydney, New South Wales - Australia |
| Love the Beast | 2009 | Tasmanien; Victoria - Australia; London - England; Los Angeles, California; New York City, New York - USA |
| Manganinnie | 1980 | Central Tasmanien, West Coast, Tasmanien - Australia |
| Napoleon | 1995 | Tasmanien; Adelaide Hills, Adelaide, Flinders Ranges, Hendon, Kangaroo Island, South Australia; Sydney, New South Wales; Northern Territory - Australia |
| Oscar and Lucinda | 1997 | Hobart, Tasmanien; Glebe, Sydney, New South Wales - Australia; Boscastle, Bossiney, Crackington Haven, Morwenstow, Port Isaac, Trebarwith Strand, Cornwall - England |
| Rosebery 7470 | 2006 | Tasmanien - Australia |
| Save the Lady | 1982 | Hobart, Tasmanien - Australia |
| Testing Taklo | 2004 | Hobart, Tasmanien; Melbourne, Victoria - Australia |
| The Sound of One Hand Clapping | 1998 | Hobart, Tasmanien - Australia |
| The Tale of Ruby Rose | 1987 | Central Highlands, Tasmanien - Australia |
| They Found a Cave | 1962 | New Town, Hobart, Richmond, Glenorchy, Tasmanien - Australia |
| Van Diemen's Land | 2009 | Great Otway National Park, Victoria; Lake Binney, Bronte Park, Wild Rivers National Park, Tasmanien - Australia |
Musik und Tanz
Die Musik- und Tanzkultur Tasmaniens ist ein faszinierendes Geflecht aus uralten indigenen Traditionen, kolonialen Einflüssen und zeitgenössischen Ausdrucksformen, das die Isolation und Vielfalt der Insel widerspiegelt. Die palawa, die traditionellen Tasmanischen Aborigines, haben seit Tausenden von Jahren Musik und Tanz als zentrale Elemente ihrer spirituellen und sozialen Welt genutzt. Lieder, bekannt als "LUN.NER.RY", und Tänze, genannt "TRUE.DE.CUM", dienten der Erzählung von Geschichten, der Weitergabe von Wissen über Landschaften und Ahnen sowie der Stärkung von Gemeinschaften in Zeremonien. Diese Praktiken waren eng mit der Natur verbunden, wobei Bewegungen und Rhythmen spezifische Narrative ausdrückten – von Jagdritualen bis hin zu kosmologischen Mythen. Die Ankunft der Europäer im 19. Jahrhundert brachte jedoch eine brutale Unterbrechung: Durch Zwangsumsiedlungen, Assimilationspolitik und den vermeintlichen "Aussterben" der palawa wurde die orale Überlieferung von Liedern und Tänzen fast vollständig unterbunden. Dennoch überlebten Fragmente, wie die 1903 von Fanny Cochrane Smith aufgenommene Gesänge, die als letzte authentische Zeugnisse gelten.
In den letzten Jahrzehnten erlebt die indigene Musik- und Tanztradition eine beeindruckende Wiederbelebung, die als Akt des kulturellen Widerstands und der Heilung verstanden wird. Gruppen wie die pakana kanaplila, eine Tanztruppe der Tasmanischen Aborigines, arbeiten seit über 20 Jahren daran, verlorene Praktiken durch zeitgenössische Interpretationen neu zu beleben. Ihre Aufführung "tuylupa", uraufgeführt 2022 im Theatre Royal in Hobart, verbindet alte Ahnen-Geschichten mit moderner Technologie wie interaktiven Projektionen und der Sprache palawa kani. Unter der Leitung von Sinsa Mansell und in Zusammenarbeit mit Komponist Dewayne Everettsmith entsteht hier eine Brücke zwischen 10.000 Jahren Geschichte und der Gegenwart, die Zuschauer in zeremonielle Bewegungen eintauchen lässt. Ähnlich initiierte die Weilangta Dancers in den 1980er Jahren neue Tänze als politische Statement, um die Lebendigkeit der palawa-Kultur zu betonen. Instrumente wie Klatschstöcke, mit Ocker bemalt, und gelegentlich der Didgeridoo (obwohl nicht traditionell tasmanisch) untermalen diese Revivals. Veranstaltungen wie das Putalina-Festival oder die "Ten Days on the Island" integrieren solche Performances, fördern den intergenerationellen Austausch und ehren die Traditionellen Hüter des Landes.
Die koloniale Periode markierte den Übergang zu einer europäisch geprägten Musik- und Tanzszene, die dennoch von lokalen Bedingungen geformt wurde. Mit der Gründung der Siedlung 1803 brachten Konviktierte, Wachen und Siedler Instrumente wie Geigen, Flöten und Klaviere mit, die in improvisierten Konzerten und Bällen erklingten. Pionierfiguren wie der Geiger und Organist John Deane installierten 1825 das erste Kirchenorgel in Hobart und organisierte mit dem Bandmaster Joseph Reichenberg Aufführungen von Haydn und eigenen Quadrillen – den ersten gedruckten Tänzen Australiens. Reichenbergs "Hobart Town Quadrilles" spiegeln den Einfluss britischer und irischer Volkstraditionen wider, die in ländlichen Häusern und Theatern zu Hause wurden. Komponisten wie Vincent Wallace, der in New Norfolk inspirierte, schufen Opernarien wie "Scenes That Are Brightest" aus "Maritana", beeinflusst von den sanften Hügeln Tasmaniens. Konviktierte trugen mit Lagerfeuerliedern bei, darunter die Verse des Dichters "Frank the Poet" oder Balladen über Fluchten wie die der "Cyprus Brig". In den 1840er Jahren etablierte Anne Clarke das Theaterleben, mit der australischen Uraufführung von Mozarts "Figaro"-Hochzeit 1845, und importierte Stars wie die Sopranistin Amy Sherwin, die in den 1870er Jahren Temperanzlieder popularisierte.
Tanztraditionen in der Kolonialzeit waren geprägt von formellen Bällen und volkstümlichen Set-Tänzen, die Einwanderer aus Britannien und Irland mitbrachten. Quadrillen, Walzer und Reels beherrschten die Säle, während in ländlichen Gebieten "Old Time Dances" wie Hornpipes und Jigs überlebten – ein Erbe, das in Sammlungen wie "Old Time and Set Dances of Tasmania" (2009) dokumentiert ist. Überraschend hat Tasmanien Verbindungen zum Tango: Frühe Einflüsse aus argentinischen Einwanderern und maritimen Routen machten es zu einem "tasmanischen" Element, das in Folk-Kreisen weiterlebt. Im 19. Jahrhundert entstanden Messingbands in Industrie und Gemeinden, die Marsche von Alex Lithgow, dem "Sousa der Antipoden", spielten und europäische Konzerte bereisten. Diese Phase kulminierte in der Etablierung von Opern- und Chor-Traditionen, unterstützt von Nonnenorden, die Klavier und Gesang als Bildung für Frauen förderten.
Die Folk-Musikszene Tasmaniens entwickelte sich in drei Phasen zu einem lebendigen Gegenpol zur klassischen Tradition. In den 1960er Jahren, beeinflusst von globalen Jugendbewegungen, entstanden Coffee-Lounge-Clubs wie das Wild Goose in Hobart, wo amerikanische Protestlieder und britische Balladen gesungen wurden. Festivals des Tasmanian University Folk Clubs ab 1968 markierten den Start. Die 1970er bis 1980er Jahre brachten den "Anglo-Celtic"-Schub: Pubs wie das Bothy Folk Club übernahmen irische und australische Repertoires, gekrönt vom Longford Folk Festival (1977–1986). Seit den 1980er Jahren dominiert eine eklektische, multikulturelle Akustikszene mit Festivals in Cygnet und George Town, die Tanz und Musik verschmelzen – von Apfelscheune-Melodien bis zu Weltmusik. Berühmte Tasmanier wie die Pianistin Eileen Joyce, die in Zeehan geboren wurde und international glänzte, oder der Komponist Peter Sculthorpe, der Launceston-Stimmen in zeitgenössische Werke einfloss, bereicherten diese Entwicklung. Das Tasmanian Symphony Orchestra, seit 1948 aktiv, und Jazz-Pioniere wie Tom Pickering unterstreichen die Breite.
Heute pulsiert Tasmaniens Musik- und Tanzszene in einem Mix aus Festivals und urbanen Venues, die indigene Wurzeln mit globalen Strömungen verweben. Das Dark Mofo 2025 in Hobart, mit Acts wie The Horrors und Tierra Whack, verbindet Gothic-Rock mit rituellen Performances; die "Ten Days on the Island" feiert mit Vika & Linda und choralen Events kulturelle Vielfalt. Der Unconformity-Festival in Queenstown (Oktober 2025) widmet sich Tanz als Ausdruck von Resilienz, während die Southern Tasmanian Dancing Eisteddfod Genres wie Hip-Hop und Ballett präsentiert. Das Festival of Voices (Juni/Juli 2025) ehrt 20 Jahre Gesang mit Karaoke-Dance-Fusions, und der Pacific Rhythm bei Ulverstone integriert pazifische Tänze. Venues wie das Mona oder regionale Pubs bieten Live-Shows von Bands wie Baby Come Tack, die Yacht-Rock zum Tanzen einladen. Diese Szene, geprägt von Nachhaltigkeit und Inklusion, bewahrt Erbe, während sie Innovationen wie interaktive Tech in indigenen Tänzen fördert – ein lebendiges Zeugnis der tasmanischen Identität, die in jedem Rhythmus und jeder Bewegung widerhallt.
Kleidung
In der frühen Kolonialzeit des 19. Jahrhunderts trugen die europäischen Siedler auf Tasmanien die für Großbritannien typische Kleidung der Zeit: Männer in Wollhosen, Westen und Mänteln, Frauen in langen Kleidern mit Korsett, Schürze und Kopfbedeckung. Diese Kleidung war oft unpraktisch für das kühle, feuchte Klima der Insel, wurde aber später an lokale Bedingungen angepasst.
Die indigene Bevölkerung Tasmaniens, die Palawa, besaß vor der Kolonisation ihre eigene Bekleidungstradition. Sie trugen in den kälteren Monaten Umhänge aus Känguru- oder Wallabiefellen, die sorgfältig zusammengenäht und mit Ornamenten versehen waren. Diese Felle boten Schutz gegen Wind und Kälte, die in Tasmanien häufig sind.
Kulinarik und Gastronomie
Zartes Wild, köstlicher Lachs, delikater Hummer und frische Austern sind nur einige der kulinarischen Genüsse, mit denen die tasmanische Küche aufwartet. Fette Soßen und salzige Würzen liebt man gar nicht, dafür aber eine leichte und frische Kost, „modern Australian“ genannt, bei der sich mediterrane und asiatische Einflüsse auf harmonische Weise verbinden. Die englische Küche hat ausgedient und so nimmt es nicht Wunder, dass man auf Tasmanien manchmal etwas sehr enthuasiastisch über die noch neuen kulinarischen Höhenflüge ins Schwärmen gerät.
Angesichts der frischen Zutaten, die alle von der Insel stammen, sind der innovativen Kochkunst keine Grenzen gesetzt. Roher Lachs auf sauren Mango-Streifen zum Beispiel oder zartrosa gebratenes Wallaby, garniert mit Safran-Chutney, erfreuen Auge wir Gaumen gleichermaßen. Auch Vegetarier kommen auf ihre Kosten, gibt es doch in den meisten Restaurants schmackhafte vegetarische Gerichte. Beim Dessert hat man oftmals die Wahl der Qual. Crème brûlé mit Zitronengras und Palmzucker an kandiertem Chili, dazu ein Gläschen Eiswein - oder lieber ein Schokoladen- Mandarinen-Parfait mit einer zarten Anmutung von Zimt, begleitet von einem Gläschen Tokayer?
Tassies bevorzugen eine gepflegte, aber zwanglose Atmosphäre wie oben links die Home Hill Winery in Ranelagh. Mit Blick in die Weinberge - und in die offene Küche - speist man gut und trinkt dazu Wein aus eigenem Anbau. Angesichts der frischen Zutaten ist auch ein Tassie-Frühstück ein wahrer Genuss! So wie oben rechts wird es in den Pomona B&B and Spa Cottages mit Blick auf den Fluss Tamar serviert.
Das heimische Bier ist im Geschmack frisch und süffig, vergleichbar mit Lager oder Export. Auf Tasmanien gibt es zwei große traditionsreiche Brauereien, die auch besichtigt werden können: die Cascade Brewery bei Hobart und die J Boag & Son Brewery in Launceston. Weißweine liefern im kühlen tasmanischen Klima mit seinem langen, sonnigen Herbst hervorragende Ergebnisse. Sie zeichnen sich durch stabilen Körper, fruchtigen Geschmack und elegante Säure aus. Bei den Rotweinen liegt der Pinot Noir an der Spitze, während die Beeren des Cabernet Sauvignon nur in einem langen, sonnigen Sommer voll ausreifen.
Sollte man einmal mit den einheimischen Speisen nicht so gut zurechtkommen, also Magenbeschwerden bekommen, empfiehlt es sich, die Leistungen einer Reisekrankenversicherung in Anspruch nehmen zu können. Meist ist es nur eine kleine Magenverstimmung, aber nicht immer reicht dazu die Apotheke aus. Hier bekommt man zwar oft günstige Medikamente, aber nicht immer optimale medizinische Beratung. Da aber Arztbesuche meist direkt bezahlt werden müssen, hilft die Vorlage der Bestätigung der Reisekrankenversicherung.
Festkultur
Tasmanien hat eine eigene Festkultur entwickelt.
Feiertage:
1. Januar - New Year’s Day (Neujahrstag)
26. Januar - Australia Day (Tag der Landung erster weißer Zuzüglinge in Australien)
Ende März / Anfang April - Easter (Ostern)
25. April - Anzac Day (Tag der ersten Militäraktionen Australiens im Ersten Weltkrieg)
2. Montag im Juni - Queen's Birthday (Geburtstag der Königin)
14. September - National Aboriginal Day (Nationaler Tag der Aborigines)
25. Dezember - Christmas Day (Weihnachtstag)
26. Dezember - Boxing Day (Stefanitag)
Vor der europäischen Kolonisation war die Festkultur der Palawa tief in spirituellen und saisonalen Zyklen verwurzelt. Zeremonielle Versammlungen, oft mit Tänzen, Gesängen und Feuerritualen, dienten der Feier von Ernten, Ahnen und der Verbindung zur Natur – wie die corroborees, bei denen Geschichten der Schöpfung und des Überlebens durch performative Künste weitergegeben wurden. Diese Praktiken waren nicht isoliert, sondern integrierten sich in das tägliche Leben, markiert durch den Wechsel der Jahreszeiten in den gemäßigten Wäldern und Küsten. Die brutale Kolonisation ab 1803 führte jedoch zu einer fast vollständigen Unterdrückung: Durch Zwangsumsiedlungen und kulturelle Assimilation wurden viele Traditionen verloren, doch Fragmente überlebten in oralen Überlieferungen und wurden in den letzten Jahrzehnten revitalisiert. Heutige indigene Feste wie das NAIDOC Week (National Aboriginal and Islander Day Observance Committee, jährlich im Juli) feiern die Resilienz der palawa-Kultur mit Events in Hobart und Launceston, die Kunsthandwerk, Musik und Geschichtenerzählungen umfassen. Initiativen wie das Putalina Festival oder palawa-geführte Performances im Rahmen größerer Events wie Ten Days on the Island betonen Heilung und kulturelle Souveränität, oft in Kooperation mit Organisationen wie Reconciliation Tasmania.
Die koloniale Periode formte eine neue Schicht der Festkultur, geprägt von britischen und irischen Einflüssen, die sich mit lokalen Bedingungen vermischten. Ab den 1820er Jahren entstanden formelle Bälle und Märkte in Siedlungen wie Hobart und Launceston, wo Konviktierte und Siedler Erntedankfeste und Jahrmärkte abhielten – Vorläufer moderner Events wie Agfest. Die Hobart Regatta, seit 1823 das älteste jährliche Sportfest Australiens, kombinierte Bootsrennen, Picknicks und Feuerwerke am Derwent River und wurde zu einem Symbol tasmanischer Gemeinschaft. Im 19. Jahrhundert blühten landwirtschaftliche Feste auf, inspiriert von der fruchtbaren Landschaft: Die Royal Hobart Show (seit 1821) präsentierte Vieh, Ernten und Handwerke, während irische Einwanderer Volkstraditionen wie Morris-Tänze und Ceilidhs einführten. Diese Events dienten nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der sozialen Kohäsion in einer harten Pioniergesellschaft. Mit dem Aufstieg des Tourismus im frühen 20. Jahrhundert etablierten sich Festivals wie das Tasmanian Gourmet Festival (später Taste of Tasmania), das 1988 begann und die kulinarische Vielfalt der Insel feierte, beginnend mit dem Abschluss der Sydney-Hobart Yacht Race. Solche kolonialen Wurzeln mischen sich heute nahtlos mit modernen Ausdrücken, die Tasmaniens Gothic-Ästhetik und Abenteuergeist betonen.
Seit den 1970er Jahren hat sich die Festkultur Tasmaniens zu einem international anerkannten Phänomen entwickelt, das Kunst, Natur und Innovation verbindet. Der Boom begann mit Folk- und Musikfestivals wie dem Longford Folk Festival (1977 bis 1986), das anglo-keltische Traditionen mit lokalen Klängen feierte, und wuchs durch die Gründung von Events wie Festivale in Launceston (seit 1983), einem dreitägigen Rausch aus Streetfood, Wein und Live-Musik. Die Biennale Ten Days on the Island (seit 2001) reist durch die Insel und integriert zeitgenössische Kunst, Theater und indigene Performances, um Lutruwitas kreativen Geist zu beleben – die nächste Ausgabe ist für März 2027 geplant. Ikonisch ist Dark Mofo, das 2013 vom Museum of Old and New Art (MONA) ins Leben gerufene Midwinter-Festival in Hobart (Juni), das mit paganen Ritualen, Feuerperformances, der Nude Solstice Swim und Konzerten von Acts wie Tierra Whack die dunklen Seiten der tasmanischen Seele erforscht. Es zieht Tausende an und kontrastiert mit sonnigeren Sommerfesten wie der Taste of Summer (um den Jahreswechsel), einem kulinarischen Highlight mit lokalen Produkten, Weinen und Feuerwerk zum Neujahr.
Tasmaniens Festkalender ist saisonal strukturiert und nutzt die abwechslungsreiche Landschaft für thematische Vielfalt. Im Frühling (September / November) blühen Events wie das Table Cape Tulip Festival (Oktober) mit farbenfrohen Tulpenfeldern und dem Junction Arts Festival in Launceston, das unkonventionelle Kunst in Alltagsorten platziert. Der Herbst (März–Mai) feiert die Ernte mit dem ECHO Festival (März) am East Coast, das Wein, Kunst und ländliches Leben ehrt, oder dem monatelangen Tasmanian Autumn Festival (April) im Derwent Valley, das bunte Laubfärbung, Trüffel und Feste wie TrailGraze mit saisonalen Speisen umfasst. Sportliche Highlights wie die Hobart Airport Marathon (April) oder das Agfest (Mai), das landwirtschaftliche Innovationen präsentiert, runden diese Periode ab. Im Sommer (Dezember–Februar) dominieren maritime und musikalische Feste: Die Rolex Sydney Hobart Yacht Race kulminiert in Hobart, gefolgt von Festivale (Januar / Februar) mit Street-Art und dem Cygnet Folk Festival (Januar). Der Tasmanian Wine Festival (Februar) und das Australian Wooden Boat Festival (biennial, nächstes 2027) feiern die Meeres- und Weintraditionen.
Der Winter (Juni / August) verwandelt Tasmanien in ein Festival der Düsternis und Wärme, kontrastierend mit dem kalten Klima. Dark Mofo bleibt der Star, ergänzt durch das Festival of Voices (Juni / Juli), ein Chor- und Singalong-Spektakel, und das Permission to Trespass (Juli), das Kunst in abgelegenen Nordwest-Gebieten erkundet. Weitere Highlights sind der Devonport Jazz Festival (Juli), die Tassie Scallop Fiesta (August) mit frischen Meeresfrüchten und der Beaker Street Festival (August), das Wissenschaft und Kunst verschmilzt. Spezialisierte Events wie die Tasmanian Whisky Week (August) oder das Chocolate Winterfest (August) im Nordwesten bieten gemütliche Genüsse, während das Australian Antarctic Festival (biennial, nächstes 2026) Hobarts Rolle als Antarktis-Tor betont. Indigene Einflüsse sickern durch, etwa in Dark Mofo's Ritualen oder NAIDOC Week (Juli 2025), das palawa-Kunst und -Geschichten integriert. Regionale Feste wie das Stanley & Tarkine Forage Festival (Mai) oder das Mural Fest in Sheffield (November) fördern lokale Identitäten und Nachhaltigkeit.
Medien
Die Medienlandschaft in Tasmanien ist vielfältig und spiegelt die regionale Identität der Insel wider. Tasmanien verfügt über eine Mischung aus Printmedien, Rundfunk und digitalen Plattformen, die Nachrichten, Unterhaltung und lokale Informationen bereitstellen. Die bekanntesten Tageszeitungen sind The Mercury mit Sitz in Hobart und The Examiner in Launceston, die über regionale, nationale und internationale Ereignisse berichten. Ergänzt werden diese durch lokale Wochenzeitungen, Community-Publikationen und spezialisierte Magazine, die sich Themen wie Kultur, Landwirtschaft und Tourismus widmen.
Im Rundfunkbereich spielt der öffentlich-rechtliche Sender ABC Tasmania eine zentrale Rolle, unterstützt von kommerziellen Radiosendern wie 7HO, Triple M und Hit Network, die Nachrichten, Musik und Unterhaltung kombinieren. Auch digitale Medien gewinnen zunehmend an Bedeutung: Nachrichtenportale, Social-Media-Kanäle lokaler Anbieter und Online-Magazine ergänzen das Informationsangebot und ermöglichen eine schnelle Verbreitung von Inhalten.
Zeitungen:
- The Advocate (Australia)
- The Courier (Hobart)
- The Examiner (Tasmania)
- Flinders Island Chronicle
- The Mercury (Hobart)
- The West Coast Miner
- Zeehan and Dundas Herald
Radiosender:
Hobart und Umgebung
- ABC Radio Hobart (936 AM) – regionaler öffentlich-rechtlicher Sender des ABC-Netzwerks
- ABC Radio National (585 AM) – nationales Kultur- und Informationsprogramm
- ABC News Radio (747 AM) – Nachrichten, Politik und Live-Berichterstattung
- 7RPH / Print Radio Tasmania (864 AM) – barrierefreier Sender für seh- und lesebehinderte Menschen
- Hobart FM (96.1 / 92.1 FM) – Community-Radio mit breitem Musik- und Informationsangebot
- Edge Radio (99.3 FM) – Jugend- und Communitysender, Schwerpunkt auf lokaler Musik
- hit100.9 Hobart – kommerzieller Pop- und Unterhaltungssender
- 7HOFM (101.7 FM) – populäre Musik, lokale Nachrichten und Shows
- Ultra106five (106.5 FM) – christlich orientiertes Radioprogramm
- Triple M Hobart (107.3 FM) – Rock-, Classic- und Sportradio
Launceston und Nordtasmanien
- 89.3 LAFM (89.3 FM) – kommerzieller Sender mit Adult-Contemporary-Format
- Chilli FM (90.1 FM) – Pop- und Chartmusik, lokale Unterhaltung
- ABC Northern Tasmania (100.5 FM) – öffentlich-rechtlicher Regionalsender für den Norden
Nordwestküste und Küstenregionen
- Coast FM Tasmania (106.1 / 104.7 / 88.9 FM) – Community-Radio mit regionalen Programmen für Wynyard, Devonport und Smithton
- 7AD (98.9 FM) – kommerzieller Sender in Devonport, Musik und lokale Inhalte
- 7BU (100.9 FM) – klassischer Radiosender für Burnie und Umgebung
- Sea FM Burnie / Devonport (101.7 / 107.7 FM) – moderne Popmusik und Jugendradio
Zentral- und Südtasmanien
- The Voice of the Midlands (97.1 FM) – Community-Radio für die Midlands-Region, mit lokalen Nachrichten und Musik
- Tasman FM (97.7 FM) – Regionalsender für die Tasman- und Forestier-Halbinseln
- Vision Christian Radio (88.0 FM, mehrere Standorte) – überregionaler christlicher Narrowcast-Sender
Sonder- und Communityangebote
- Print Radio Tasmania (7RPH) – sendet über mehrere Frequenzen für sehbehinderte Hörer in Hobart, Launceston und Devonport
- Edge Radio (7EDG) – Ausbildungssender für Studierende und junge Kreative
- ABC Classic – landesweites Klassikradio, auch in Tasmanien empfangbar
- Triple J – landesweites Jugendradio des ABC, mit tasmanischer Regionalabdeckung
Fernsehstationen:
- ABC Tasmania. Produziert lokale Abendnachrichten 7 pm. (digital & analog, callsign: ABT)
- SBS One (digital & analog, callsign: SBS)
- Southern Cross Television Tasmania (digital & analog). Tochtergesellschaft von Seven Network. (callsign: TNT).
- WIN Television Tasmania. (digital & analog). Tochtergesellschaft von Nine Network (callsign: TVT)
- Tasmanian Digital Television. Bringt Ten News At Five von ATV-10 in Melbourne. (digital). Tochtergesellschaft von Ten Network (callsign: TDT)
Multivisionelle Kanäle:
- ABC2 (betrieben von ABT)
- ABC3 (betrieben von ABT)
- ABC News 24 (betrieben von ABT)
- SBS Two (betrieben von SBS)
- SBS HD (betrieben von SBS)
- One HD (betrieben von TDT)
- GO! (betrieben von TVT)
- WIN HD (betrieben von TVT)
- 7mate (betrieben von TNT)
- 7TWO (betrieben von TNT)
Kommunikation
Alle 29 Verwaltungseinheiten verfügen über eine eigene Postverwaltung. Tasmanien gehört zur australischen Vorwahlzone „03“, die auch den südöstlichen Teil des australischen Festlands umfasst (Victoria und Teile von New South Wales). Die Landesvorwahl von Australien ist +61. Wenn man also von außerhalb Australiens nach Tasmanien telefonierst, wählt man 00613.
Sport
Laut der AusPlay-Umfrage von Sports Australia 2023 nehmen 78 % der Erwachsenen und 33 % der Kinder wöchentlich an sportlichen Aktivitäten teil. Besonders populär sind Schwimmen, Leichtathletik, Radfahren/Mountainbiking, Golf und Australian Rules Football (AFL). Netball dominiert bei Frauen, Cricket bei Männern, während Fußball (Soccer) mit 36.773 Teilnehmern (6,8 % der Bevölkerung) der meistgespielte Teamsport ist. Sport hat in Tasmanien eine lange Tradition, die bis in die Kolonialzeit zurückreicht. Die tasmanische Regierung unterstützt dies mit Investitionen, etwa 2 Millionen AUD im Fiskaljahr 2020/21 für organisierte Sportarten wie AFL, Basketball, Cricket, Rugby und Soccer sowie 1 Million AUD für Kinderprogramme. Große Veranstaltungen wie die Royal Hobart Regatta, das Hobart International (Tennis), der Hobart Cup (Pferderennen), der Tasmanian Derby, die Targa Tasmania (Rallye) und das Ziel der Sydney-to-Hobart Yacht Race ziehen jährlich Tausende an. Die geografische Isolation fördert den Sport: Kurze Distanzen zu Sportstätten und die hohe Lebensqualität motivieren zur Teilnahme.
Australian Rules Football (AFL) ist Tasmaniens beliebtester Sport, sowohl für Zuschauer (79 % Interesse laut einer Internet-Traffic-Studie 2018) als auch für Teilnehmer. Bereits 1864 wurde das Spiel eingeführt – Tasmanien war die erste Region außerhalb Victorias. Mit 13.927 aktiven Spielern (2,5 % der Bevölkerung), davon ein Viertel Frauen, ist AFL tief verwurzelt. Die Geschichte begann mit informellen Matches in den 1860ern. Die Tasmanian Football League (TFL), gegründet 1879, ist die älteste Liga. Nach Umstrukturierungen, wie der Zusammenlegung von Northern und Southern Leagues, prägt heute die Tasmanian State League den Sport. Die tasmanische Staatsmannschaft feierte bis 1993 Erfolge gegen alle australischen Staaten, darunter historische Siege gegen Victoria (1960, 1990). Das neue AFL-Team, die Tasmania Devils, tritt 2028 in die AFL (Männer) und 2027 in die AFLW (Frauen) ein. Heimspiele finden in Hobart und Launceston statt. Bekannte Spieler wie Darrell Baldock, Peter Hudson, Ian Stewart und Royce Hart sind AFL Hall-of-Fame-Legenden, und über 300 Tasmanier spielten in der AFL. Aktuelle Diskussionen (Oktober 2025) drehen sich um Rekrutierungen wie Caleb Serong für die Devils. Wichtige Spielstätten sind das North Hobart Oval, Blundstone Arena (Hobart) und das University of Tasmania Stadium (Launceston).
Cricket ist seit 1814 ein Symbol tasmanischer Kultur. Seit dem Beitritt zur Sheffield Shield 1977/78 hat Tasmanien bedeutende Erfolge erzielt. Die Tasmanian Tigers (Männer) und Roar (Frauen) sind etabliert, mit Sheffield Shield-Siegen (2006/07, 2010/11, 2012/13) und One-Day-Cup-Titeln (1978/79, 2004/05, 2007/08, 2009/10). Stars wie David Boon, Ricky Ponting und Tim Paine prägten den Sport. Die Hobart Hurricanes spielen in der Big Bash League (T20) im Blundstone Arena (Hobart, 20.000 Plätze) und York Park (Launceston). 2025 erzielte Marnus Labuschagne ein Century gegen Tasmanien im Sheffield Shield.
Fußball (Soccer) ist der meistgespielte Teamsport, besonders bei Kindern (17,5 % der 5–14-Jährigen). Football Tasmania, seit 1898 aktiv, regelt den Sport. Nach einem Boom durch Migration in den 1950ern wächst die National Premier League (NPL) Tasmania, die 2026 auf 10 Teams mit Abstieg erweitert wird. Erfolgreiche Clubs wie Devonport Strikers und South Hobart dominierten 2025. Spielstätten wie North Hobart Oval und Wellington Park (Hobart) sind zentral. Historische Highlights sind internationale Tourneen, etwa von Nagoya Grampus 1993 mit Gary Lineker.
Basketball erlebt seit dem Eintritt der Tasmania JackJumpers in die NBL (2021/22) einen Boom und zählt nun zu den Top-Zuschauersportarten. Die JackJumpers gewannen 2021/22 und 2023/24 die NBL-Titel, und 2025 feierten sie ihren dritten Sieg in Folge. Die Frauenmannschaft, Tasmania Devils, startet 2025 in der WNBL. Heimspiele finden in der MyState Bank Arena (Hobart) statt.
Rugby Union und League sind vor allem im Norden populär. Die Tasmanian Rugby Union, seit den 1930ern aktiv, fördert Clubs wie den University of Tasmania Rugby Club. Schulwettbewerbe (SATIS) und die Tasmanian Jackjumpers (Rugby League) prägen die Szene. Rugby Park (Hobart) ist die Hauptstätte.
Weitere Sportarten sind
- Netball: Der beliebteste Frauensport, organisiert durch die Tasmanian Netball League.
- Baseball: Seit 2007 durch Baseball Tasmania gefördert, mit Wurzeln bis 1910.
- Leichtathletik: Athletics Tasmania organisiert Events wie die NHSSA.
- Radfahren/Mountainbiking: Weltklasse-Trails in Blue Derby und Maydena Bike Park.
- Wassersport: Schwimmen im Hobart Aquatic Centre, Surfen an der Ostküste, Yachting (Sydney-Hobart Race).
- Golf: Über 50 Plätze, darunter Barnbougle Dunes.
- Motorsport: Targa Tasmania (Rallye).
- Pferdesport: Hobart Cup und Tasmanian Derby.
- Wintersport: Skifahren in Ben Lomond (Juni–August).
Tasmaniens Natur macht es zum Mekka für Abenteuersport. Der Overland Track (65 km, 6 Tage) lockt Wanderer, die Totem Pole im Tasman National Park Kletterer. Mountainbiking in Blue Derby, Kajakfahren, Tauchen und Surfen an der Ostküste sowie Skifahren in Ben Lomond sind Highlights. Tipps: Ausrüstung in Hobart/Launceston mieten, Events wie die East Coast Trail Runs besuchen.
Das Tasmanian Institute of Sport (TIS, seit 1985) fördert Elite-Athleten und arbeitet mit Paralympics Australia zusammen. Active Tasmania unterstützt Inklusion und Infrastruktur, während die Tasmanian Sports Federation als Dachverband agiert. Die Regierung finanziert Sportstätten und Programme. Aktuelle Debatten (X, Oktober 2025) drehen sich um das neue AFL-Stadion (1 Mrd. AUD) und VFL-Rekrutierungen.
Persönlichkeiten
Die wichtigsten Persönlichkeiten Tasmaniens sind:
- Truganini (1812 bis 1876), Mitglied der südöstlichen Aborigines, oft genannt als eine der letzten vollblütigen Tasmanischen Ureinwohnerinnen
- Fanny Cochrane Smith (1834 bis 1905), Aborigines-Sprecherin; letzte vollkommene Sprecherin einer der Tasmanischen Sprachen, bekannt für ihre Tonaufnahmen indigener Lieder
- Llewellyn Atkinson (1867 bis 1945), Politiker, Abgeordneter im australischen Parlament, in Launceston geboren
- John Watt Beattie (1859 bis 1930), Fotograf; viele Landschafts- und Historienaufnahmen von Tasmanien
- Joseph Aloysius Lyons (1879 bis 1939), Politiker; wurde Premier von Tasmanien und später Premierminister Australiens
- Amy Rowntree (1885 bis 1962), Pädagogin; führte Kindergarten-Techniken in Tasmanien ein und engagierte sich in Bildung und kulturellem Erbe
- Errol Flynn (1909 bis 1959), international bekannter Schauspieler, in Hobart geboren, berühmt für Abenteuer- und Historienfilme
- Emerson Rodwell (1921 bis 2011), Soldat, Cricketspieler und Sportkommentator aus Tasmanien.
- Elizabeth Helen Blackburn (* 1948), Molekularbiologin, Nobelpreisträgerin (Physiologie / Medizin), in Hobart geboren
Fremdenverkehr
Tasmaniens Tourismus profitiert in letzter Zeit immer stärker von seiner großteils intakten Naturlandschaft, fast 20 % der Fläche liegen in Nationalparks oder anderen Schutzzonen. Vorbildhaft sind die Anlagen, die es dem interessierten Touristen ermöglichen, die in den verschiedenen Landesteilen lokalisierten Parks zu besuchen. Häufig sind auch landschaftlich besonders eindrucksvolle Gebiete mit befestigten Steigen und Informationstafeln versehen, die den Besucherstrom vorsichtig lenken. Auch die Forestry Commission beteiligt sich aktiv an der Naturschutzaufklärung in den Waldgebieten durch Herausgabe von Informationsmaterial.
Touristen können bei der Abreise eine Rückerstattung der GST für die in Australien gekauften Waren beantragen. Die Erstattung erfolgt für Waren mit einem Gesamtwert von mindestens $A 300 (inkl. GST), die aus Australien ausgeführt werden. Die Waren dürfen höchstens 30 Tage vor der Abreise aus Australien gekauft worden sein. Alle Artikel mit niedrigerem Preis, die innerhalb dieser 30-Tage-Frist, gleichzeitig oder bei verschiedenen Gelegenheiten, in ein und demselben Geschäft gekauft werden, werden auf einer Steuerrechnung zusammengefasst. Sie können aber auch Waren in verschiedenen Geschäften kaufen, sofern die Steuerrechnungen der einzelnen Geschäfte mindestens $A 300 (inklusive GST) betragen. Tourist Refund Scheme (TRS)-Stände befinden sich an den internationalen Flug- und Kreuzfahrthäfen. Für die Rückerstattung müssen die Reisenden ihren Reisepass, eine Bordkarte für einen internationalen Flug, die Steuerrechnung des Einzelhändlers und die Waren vorlegen. Unter Umständen gelten noch andere Bedingungen.
Literatur
- wikipedia = https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Tasmania
- wikitravel = https://wikitravel.org/en/Category:Tasmania
- wikivoyage = https://en.wikivoyage.org/wiki/Tasmania
Reiseberichte
- Reiseblog Tasmanien =https://kommwirmachendaseinfach.de/land/tasmanien/
- Germans Travel: Roadtrip Tasmanien - in 14 Tagen über die Insel = https://germans.travel/de/blog/reisen-in-tasmanien/roadtrip-tasmanien-14-tage
- Travel Essence: Tasmanien - einsame Strandschönheit = https://www.travelessence.at/reiseblog/tasmanien-reisebericht
- Cool Man: Travel the World - Tasmanien = https://cool-man.ch/de/tasmanien-australien/
Videos
- Tasmanien 4k = https://www.youtube.com/watch?v=mAsMuPM3Oeo
- Tasmania (Into the WVorld Films) = https://www.youtube.com/watch?v=J3dYjV1wqV0
- David Attenborough: Tasmania = https://www.youtube.com/watch?v=RwYusppCSFc
- Tasmania, the island at the edge of the world = https://www.youtube.com/watch?v=Ss55E5Q1-do
- Tasmania, best places to visit = https://www.youtube.com/watch?v=K3a0fzJ9fLA
Atlas
- Tasmanien, openstreetmap =´https://www.openstreetmap.org/#map=7/-41.698/146.239
- Tasmanien, ADAC = https://maps.adac.de/ort/hobart-tasmanien
- Tasmanien, Satellit = https://satellites.pro/Tasmania_map
Reiseangebote
Discover Tasmania = https://www.discovertasmania.com.au/
Tourism Tasmania Corporate = https://www.tourismtasmania.com.au/
Forum
Hier geht’s zum Forum: