Aaland (Fasta Åland): Unterschied zwischen den Versionen
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 372: | Zeile 372: | ||
'''Erhebungen''' | '''Erhebungen''' | ||
Orrdalsklint | * Orrdalsklint 129,1 m (Saltvik) | ||
* Kasberg 119,0 m (Saltvik) | |||
* Soltuna 107,0 m (Geta) | |||
* Getabergen 99,0 m (Gerta) | |||
* Notbergen 81,0 m (Högskär) | |||
* Bistorpsberg 77,2 m (Lumparland) | |||
* Jomala 71,0 m (Jomala) | |||
'''Fluss''' | |||
* Strömen 10 km | |||
'''Seen''' Fläche Seehöhe Uferlinie | |||
'''Seen''' Fläche Seehöhe | |||
Långsjön-Markusbölefjärden 305,11 ha 6,0 m 23,46 km | Långsjön-Markusbölefjärden 305,11 ha 6,0 m 23,46 km | ||
| Zeile 2.686: | Zeile 2.680: | ||
|460 | |460 | ||
|463 | |463 | ||
|} | |} | ||
=== '''Volksgruppen''' === | |||
Die Bewohner Ålands sind zu mehr als 96 % Staatsangehörige Finnlands. Aufgrund des Selbstverwaltungsgesetzes gibt es aber parallel dazu ein sogenanntes '''''Hembygdsrätt''''' (Heimatrecht), das funktionell einer åländischen Staatsangehörigkeit ähnelt. An den Wahlen zum Landtag und an den Kommunalwahlen dürfen aktiv wie passiv nur Personen mit åländischem Heimatrecht teilnehmen. Auch der Erwerb von Grundeigentum auf den Inseln sowie die Aufnahme einer unternehmerischen Tätigkeit setzen in der Regel das Heimatrecht voraus. Das åländische Heimatrecht kann nur von finnischen Staatsangehörigen erworben werden, die mindestens fünf Jahre ohne Unterbrechungen in Åland gewohnt haben und der schwedischen Sprache mächtig sind. | Die Bewohner Ålands sind zu mehr als 96 % Staatsangehörige Finnlands. Aufgrund des Selbstverwaltungsgesetzes gibt es aber parallel dazu ein sogenanntes '''''Hembygdsrätt''''' (Heimatrecht), das funktionell einer åländischen Staatsangehörigkeit ähnelt. An den Wahlen zum Landtag und an den Kommunalwahlen dürfen aktiv wie passiv nur Personen mit åländischem Heimatrecht teilnehmen. Auch der Erwerb von Grundeigentum auf den Inseln sowie die Aufnahme einer unternehmerischen Tätigkeit setzen in der Regel das Heimatrecht voraus. Das åländische Heimatrecht kann nur von finnischen Staatsangehörigen erworben werden, die mindestens fünf Jahre ohne Unterbrechungen in Åland gewohnt haben und der schwedischen Sprache mächtig sind. | ||
| Zeile 3.238: | Zeile 3.231: | ||
* Die Jomala Kyrka ist eine der ältesten Steinkirchen Finnlands. Analysen deuten auf die Periode zwischen 1250 und 1280 als Entstehungszeit hin. | * Die Jomala Kyrka ist eine der ältesten Steinkirchen Finnlands. Analysen deuten auf die Periode zwischen 1250 und 1280 als Entstehungszeit hin. | ||
== '''Siedlungen''' == | |||
'''Siedlungen''' | |||
Åland ist in 16 Gemeinden mit insgesamt 273 Ortschaften unterteilt. „Zum sogenannten ’festen Aland’ gehören neben Mariehamn mit der gleichnamigen Hauptstadt noch Eckerö, Hammarland, Jomala, Finström, Saltvik, Geta, Sund, Lemland und Lumparland. Sie alle sind zumindest durch Brücken miteinander verbunden und werden von insgesamt rund 22.500 Personen bewohnt. Die weiter östlich gelegenen, in Tausende von Inseln zersplitterten Gemeinden des Schärengebiets heißen Vardö, Föglö, Sottunga, Kumlinge, Brändö und Kökar.“ Hier leben rund 2000 Menschen. | Åland ist in 16 Gemeinden mit insgesamt 273 Ortschaften unterteilt. „Zum sogenannten ’festen Aland’ gehören neben Mariehamn mit der gleichnamigen Hauptstadt noch Eckerö, Hammarland, Jomala, Finström, Saltvik, Geta, Sund, Lemland und Lumparland. Sie alle sind zumindest durch Brücken miteinander verbunden und werden von insgesamt rund 22.500 Personen bewohnt. Die weiter östlich gelegenen, in Tausende von Inseln zersplitterten Gemeinden des Schärengebiets heißen Vardö, Föglö, Sottunga, Kumlinge, Brändö und Kökar.“ Hier leben rund 2000 Menschen. | ||
| Zeile 4.527: | Zeile 4.518: | ||
Hafer 3 312 | Hafer 3 312 | ||
Gerste | Gerste 2 285 | ||
Chinakohl 1 902 | Chinakohl 1 902 | ||
| Zeile 5.690: | Zeile 5.681: | ||
2015 2 108 945 | 2015 2 108 945 | ||
Als Unterkunftsmöglichkeiten standen 2000 insgesamt 18 Campingplätze (2006 waren es nur noch 15), 21 Hotels mit 2229 Betten, 33 Nächtigungshütten, 33 Gasthäuser und Pensionen sowie 39 Feriendörfer mit 399 Ferienhäusern zur Verfügung. | Als Unterkunftsmöglichkeiten standen 2000 insgesamt 18 Campingplätze (2006 waren es nur noch 15), 21 Hotels mit 2229 Betten, 33 Nächtigungshütten, 33 Gasthäuser und Pensionen sowie 39 Feriendörfer mit 399 Ferienhäusern zur Verfügung. | ||
| Zeile 5.734: | Zeile 5.726: | ||
'''Ein- und Ausreise:''' | '''Ein- und Ausreise:''' | ||
Reisedokumente: Staatsbürger der skandinavischen Länder | * Reisedokumente: Staatsbürger der skandinavischen Länder sowie von Ländern, die dem Schengener Abkommen beigetreten sind, benötigen keinen Reisepass, müssen aber über einen Personalausweis verfügen. Gäste, die die Staatsangehörigkeit von Ländern außerhalb der EU/EWS besitzen, sollten etwaige Visumanforderungen vor der Einreise nach Finnland oder Åland überprüfen. | ||
* Zollbestimmungen: In Zoll- und Steuerangelegenheiten liegt Åland außerhalb der EU-Grenzen. Somit passiert man bei der Einreise nach Åland von Schweden, Finnland und Estland kommend die Zollgrenze, wo auch stichprobenartig kontrolliert wird. Bei der Einreise von Åland gelten die üblichen Tax-Free Grenzen, wie sie bei der Einreise aus Nicht-EU-Ländern auch gelten, Reisende, die von See aus in die Europäische Union einreisen, dürfen steuerfrei maximal Waren in Wert von 430 € einführen. | |||
Zollbestimmungen: In Zoll- und Steuerangelegenheiten liegt Åland außerhalb der EU-Grenzen. Somit passiert man bei der Einreise nach Åland von Schweden, Finnland und Estland kommend die Zollgrenze, wo auch stichprobenartig kontrolliert wird. Bei der Einreise von Åland gelten die üblichen Tax-Free Grenzen, wie sie bei der Einreise aus Nicht-EU-Ländern auch gelten, Reisende, die von See aus in die Europäische Union einreisen, dürfen steuerfrei maximal Waren in Wert von 430 € einführen. | * Reisen mit Kfz: Führerscheine aus EU-Staaten sind in Åland gültig. Eine Grüne Karte wird empfohlen. | ||
* Umgangsformen: Das Duzen ist in Åland weitaus verbreiteter als in Mitteleuropa und gilt als freundschaftliche und unkomplizierte Anredeform. Besucher sollten deshalb nicht erstaunt oder gar beleidigt sein, wenn sie gleich mit Du angesprochen werden. | |||
Reisen mit Kfz: Führerscheine aus EU-Staaten sind in Åland gültig. Eine Grüne Karte wird empfohlen. | * Trinkgeld: In Skandinavien ist es nicht üblich, Trinkgeld zu geben. Es ist üblicherweise in der Rechnung inkludiert. | ||
* Reisezeit: Die ideale Reisezeit für die Åland-Inseln ist im Sommer Juni bis August, für Wintersportfreunde sind die Monate Januar bis März zu empfehlen. | |||
Umgangsformen: Das Duzen ist in Åland weitaus verbreiteter als in Mitteleuropa und gilt als freundschaftliche und unkomplizierte Anredeform. Besucher sollten deshalb nicht erstaunt oder gar beleidigt sein, wenn sie gleich mit Du angesprochen werden. | |||
Trinkgeld: In Skandinavien ist es nicht üblich, Trinkgeld zu geben. Es ist üblicherweise in der Rechnung inkludiert. | |||
Reisezeit: Die ideale Reisezeit für die Åland-Inseln ist im Sommer Juni bis August, für Wintersportfreunde sind die Monate Januar bis März zu empfehlen. | |||
== '''Literatur''' == | == '''Literatur''' == | ||
Aktuelle Version vom 23. August 2025, 22:24 Uhr
Aaland, in schwedischer Schreibung Åland, ist eine Schärenlandschaft im Südwesten Finnlands. Über 6700 Inseln und Inselchen sind hier zu finden. Genau lässt sich das nicht sagen, denn das Land hebt sich und die Landfläche wächst. Zwischen Finnland und Schweden gelegen, bildet Åland eine Welt für sich. 1922 haben sich die Bewohner weitgehende Selbstbestimmungsrechte erkämpft. Heute gilt Åland als Musterbeispiel einer gelungenen regionalen Autonomie.
| Inselsteckbrief | |
|---|---|
| offizieller Name | Åland bzw. Fasta Åland |
| alternative Bezeichnungen | Alandia (lateinisch), Aaland (deutsch), Ahvenanmaa (finnisch), Alánda (samisch) |
| Kategorie | Meeresinsel |
| Inseltyp | echte Insel |
| Inselart | Schäreninsel |
| Gewässer | Ostsee (Östersjöen) |
| Inselgruppe | Aalandinseln (Ålandsöerna) |
| politische Zugehörigkeit | Staat: Republik Finnland (Suomen tasavalta) Teilstaat: Åland (Landskapet Åland / Ahvenanmaan maakunta) |
| Gliederung | 16 kommunerna (Gemeinden), davon 10 auf Fasta Åland 1 stad (Stadt) mit 24 stadsdelar (Stadtteilen) auf Fasta Åland 15 landkommunerna / kuntia (Landgemeinden) mit 272 byar (Dörfer), davon 9 Gemeinden mit 216 Dörfern auf Fasta Åland |
| Status | Teilstaat (landskap) |
| Koordinaten | 60°04’ N, 20°23‘ O |
| Entfernung zur nächsten Insel | 20 m (Hulta Holmen) |
| Entfernung zum Festland | 38,2 km (Byholma / Schweden) |
| Fläche | 685 km² / 264 mi² (Fasta Åland inklusive verbundener Nebenlinseln 1.010 km² / 390 mi², Archipel 1.582,93 km² / 611,17 mi², inklusive Wasserfläche 13.324,36 km² / 5.144,54 mi²) |
| geschütztes Gebiet | 19,09 km² / 7,37 mi² (1,3 %) |
| maximale Länge | 41,1 km (N-S) |
| maximale Breite | 35,3 km (W-O) |
| Küstenlänge | 490 km |
| tiefste Stelle | 0 m (Ostsee) |
| höchste Stelle | 126 m (Oralsklint) |
| relative Höhe | 126 m |
| mittlere Höhe | 14 m |
| maximaler Tidenhub | 0,01 bis 0,02 m (Mariehamn (0,015 m) |
| Zeitzone | MET (Medeleuropeisk Tid / Mitteleuropäische Zeit, UTC+1) |
| Realzeit | UTC plus 1 Stunde 59 Minuten bis 2 Stunden 1 Minute |
| Einwohnerzahl | 28.663, Landskap 30.654 (2024) |
| Dichte (Einwohner pro km²) | 28,38, Landskap 19,37 |
| Inselzentrum | Mariehamn |
Name
Aaland ist eine Inselgruppe am Nordrand der Ostsee zwischen Finnland und Schweden. Zur Absicherung der schwedisch geprägten Kultur der Bevölkerungsmehrheit wurde 1951 ein Autonomiestatut erlassen, das bis heute eine Vorbildwirkung in ganz Europa besitzt. Der offizielle schwedische Name der Inselgruppe ist Ålands Län bzw. Landskapet Åland, „Provinz Aaland“. Die Inselbezeichnung Aaland bzw. Åland, im schwedischen Original gesprochen [o:land], latinisiert Alandia, leitet sich her aus altnordisch *aa / schwedisch å „Gewässer“, und altnordisch / schwedisch land „Land“, bedeutet also „Land im Wasser“ oder „Wasserland“. Der finnische Name Ahvenanmaa wird üblicherweise als „Barschland“ übersetzt - zu finnisch ahven „Barsch“ und maa „Land“. Die Hauptinsel der Inselgruppe heißt offiziell-amtlich Fasta Åland, übersetzt in etwa „festes bzw. festländisches Aaland“. Meist wird sie aber namentlich mit dem Archipel gleichgesetzt.
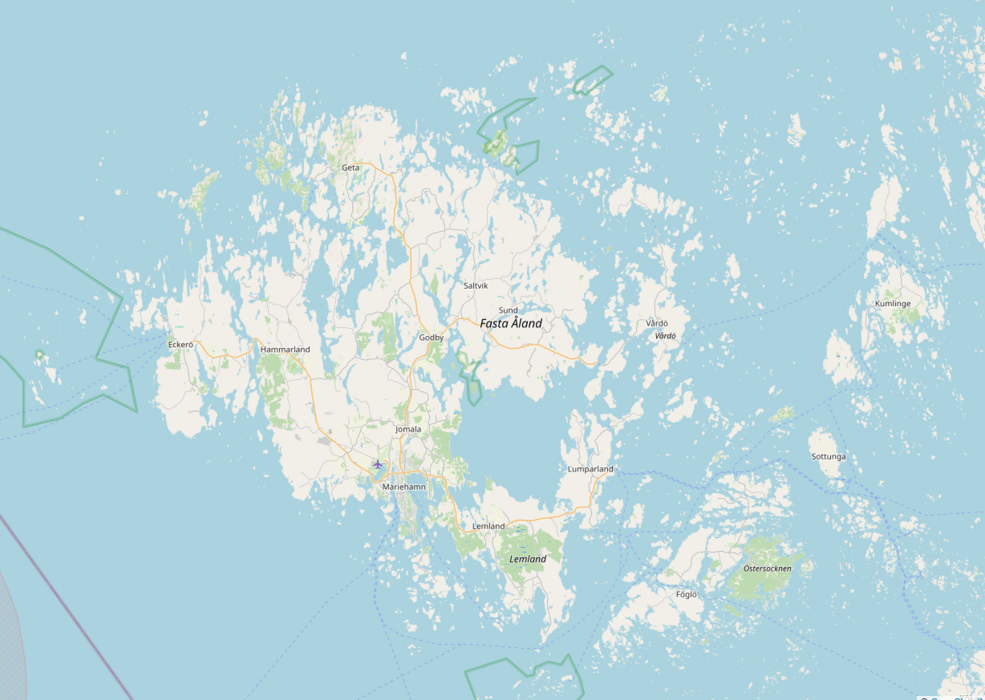
- abchasisch: Аляндия [Aljandija]
- acehnesisch: Pulo-pulo Aland
- adygisch: Аляндиe [Aljandie]
- afrikaans: Aland-eilande
- akan: Aland
- albanisch: Ishujt Aland
- alemannisch: Aland
- altaisch: Аляндия [Aljandija]
- althochdeutsch: Aland
- altkirchenslawisch: Ала́ндьск О́строва [Aland’sk Óstrova]
- altnordisch: Áland
- amharisch: ኦላንድ [Oland]
- angelsächsisch: Aland
- arabisch: جزر آلاند [Ğuzur Ālānd]
- aragonesisch: Islas Aland
- armenisch: Ալանդիա [Alandia], Ալանդյան կղզիներ [Alandyan k‘ghziner]
- aromunisch: Insule Aland
- aserbaidschanisch: Aland adaları
- assamesisch: অলান্ড দ্বীপপুঞ্জ [Ôland dîp-punjo]
- asturisch: Islles Aland
- awarisch: Аляндия [Aljandija]
- aymara: Alandya, Asuyu
- bambara: Alaŋ
- baschkirisch: Аланд утрауҙары [Aland utrauźarı]
- baskisch: Aland uharteak
- bengalisch: অলান্দ দ্বীপপুঞ্জ [Alæņḍ dbīp-puñjô]
- betawi: Olan
- bhutanisch: ཨོ་ལནཌ་ [O-land]
- bikol: Aland
- birmanisch: အာလန် ကျွန်းစု [Alan kyun zu]
- bislama: Aelan
- bosnisch: Aland, Alandska Ostrva
- bretonisch: Inizi Aland
- bulgarisch: Оландски острови [Olandski ostrovi]
- burjatisch: Ааландын арлууд [Aalandyn arluud]
- cebuano: Pulo sa Aland
- chakassisch Алянд [Aljand]
- chavakano: Alandia
- cherokee: ᎣᎴᏅᏓᏚ ᎦᏚᏛᎢ [Olenvdadu Gadudvi]
- chinesisch: - 奥兰 [Àolán], 奥兰群岛 [Àolán Qúndǎo]
- dari: جزایر آلاند [Jazāyer-e Âlând]
- dänisch: Ålandsøerne
- deutsch: Aaland, Aland, Aland-Inseln
- dine: Ō’łání
- emilianisch: Alàndia
- englisch: Aland, Aland Islands
- esperanto: Alando
- estnisch: Ahvenamaa
- estremadurisch: Alandia
- färingisch: Áland, Álandoyar
- fidschianisch: Alan
- finnisch: Ahvenanmaa
- französisch: Îles d’Aland
- franko-provenzalisch: Iles d’Aland
- friesisch: Ålâneilannen
- friulanisch: Isulis Aland
- gagausisch: Ааланд адалары [Aland adaları]
- galizisch: Ille d’Aland
- gälisch: Eileanan Àland
- georgisch: ალანდის კუნძულები [Alandis kundzulebi]
- gotisch: Aland
- griechisch: Nήσοι Ώλαντ [Nisoi Olant]
- grönländisch: Åland
- guarani: Áland
- gudscheratisch: આલાન્ડ ટાપુઓ [Ālānḍ ṭāpuo]
- guyanisch: Aland
- haitianisch: Zile Åland, Zile Aland
- hakka: 奧蘭群島 [O-làn kùn-tó]
- hausa: Aland
- hawaiianisch: ʻĀlani, ʻĀlani Mokupuni
- hebräisch: איי אולנד [Iyey Oland], אולנד [Oland]
- hindi: आलैंड [Ālaiṇḍ]
- ido: Alando
- igbo: Aland
- ilokano: Alandia
- indonesisch: Kepulauan Aland
- interlingua: Alandia
- inuktitut: ᐊᐅᓚᓐᑎ ᕿᑭᖅᑕᑦ [Aulanti Qikiqtat]
- irisch: Oileain Ailand
- isländisch: Álandseyjar
- italienisch: Isole Aland
- jakutisch: Аланд арыылара [Aland aryylara]
- jamaikanisch: Aland
- japanisch: オーランド諸島 [Ōrando-shotō]
- jerseyanisch: Iles d’Alaunde
- jiddisch: אולנד [Oland]
- kabardisch: Аланды [Alandy]
- kabylisch: ⴰⵍⴰⵏⴷ [Aland]
- kalmükisch: Аландин Арлс [Alandin Arls]
- kambodschanisch: โอลานด์ [O-lan]
- kanaresisch: ಆಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು [Ālyāṇḍ dvīpagalu]
- kantonesisch: 奧蘭群島 [Ou3 laan4 kwan4 dou2]
- kapverdisch: Ilhas Aland
- karakalpakisch: Алянд [Aljand]
- karatschai-balkarisch: Аляндия [Aljandija]
- karelisch: Axbeнaнмaa [Ahvenanmaa]
- kasachisch: Аланд аралдары [Aland araldary]
- kaschubisch: Alandskô
- katalanisch: Illes Aland
- kirgisisch: Аланд аралдары [Aland araldary]
- komi: Аланд діяс [Aland dijas]
- koreanisch: 올란드 제도 [Ollandeu jedo]
- kornisch: Ynysow Aland
- korsisch: Isule Aland
- krimtatarisch: Aландия [Alandija]
- kroatisch: Otoci Aland
- kumükisch: Аланд [Aland]
- kurdisch: ئالاند [Aland]
- kurmandschisch: ألاند / ئالاند [Aland]
- kvenisch: Aaland
- ladino: אולאנד [Āland]
- ladinisch: Ijule Aland
- lakisch: Аляндия [Aljandija]
- laotisch: หมู่เกาะโอลันด์ [Mùu kɔ̀ʔ oo-lan]
- lasisch: ალანდ [Aland]
- lateinisch: Alandia, Aboenses Insulae
- lesgisch: Аaлaнд [Aaland]
- lettgallisch: Ālandu salas
- lettisch: Alandu salas, Olande
- letzeburgisch: Aland
- ligurisch: Isoe Aland
- limburgisch: Aland
- lingala: Aland, Bisanga ya Aland
- litauisch: Alandai, Alandų salos
- livisch: Aaland, Aaland sǟrandõd
- lombardisch: Isol Aland
- luganda: Bizinga Åland, Bizinga Aland
- madegassisch: Nosy Åland, Nosy Aland
- makedonisch: Oланд [Oland]
- malaisch: Kepulauan Aland
- malayalam: ആലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ [Ālāṇḍ dvīpukaḷ]
- maldivisch: އޯލަން [Aalan / Olan]
- maltesisch: Gżejjer Aland, Alandja
- manx: Ellanyn Aland
- maori: Ngā Moutere Ōrana
- marathisch: आलान्द बेटे [Ālānd bēṭe]
- mari: Алaнд [Aland], Аланд талаш [Aland talaš]
- maurizisch: Zil Åland, Zil Aland
- mingrelisch: ალანდი [Alandi], ალანდიშ კოკეფი [Alandiš kokefi]
- minnan: O-lân tò͘-tó
- mirandesisch: Illas Aland
- moldawisch: Инcyлeлe Аланд [Insulele Aland]
- mongolisch: Аландын арлууд [Alandyn arluud]
- mordwinisch, erzya: Аландонь остравонть [Alandon‘ ostravont‘]
- mordwinisch, mokscha: Аланды тустарат [Alandy tustarat]
- nahuatl: Atlālpan, Aland tlāltikpak tepēmeh
- nauruanisch: Aland
- nepalesisch: आलान्ड टापुहरू [Aaland tapuharu]
- niederländisch: Aland-eilanden
- niedersächsisch: Alandeilaanden, Aland
- normannisch: Alaunde
- norwegisch: Åland
- novial: Aland
- okzitanisch: Iles d’Aland
- olonetzisch: Aland
- orissisch: ଆଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱୀପପୁଞ্জ [Ālāṇḍ dwīpapunja]
- oromo: Aaland gandoota galaanaa
- ossetisch: Аланды сакъадæхтæ [Alandy sak‘adächtä]
- pampangan: Aland
- pandschabisch: Alǽđ
- panganisan: Aland
- papiamentu: Aland
- paschtunisch: أولان [Âland]
- persisch: جزایر آلاند [Jazāyer-e Âlând]
- piemontesisch: Isole Aland
- pikardisch: Alinde
- pitkernisch: Aland
- plattdeutsch: Aaland
- polnisch: Wypsy Alandzkie
- portugiesisch: Aland, Ilhas de Aland
- provenzalisch: Iscles d’Aland
- quetschua: Áland
- rätoromanisch: Insule Aland
- ripuarisch: Alandt
- romani: Aland
- rumänisch: Insulele Aland
- rundi-rwandesisch: Ibirwa by‘Alande
- russisch: Аландcкиe островa [Alandskije ostrova], Принцевы острова [Prinzevy ostrova]
- ruthenisch: Аланды [Alandy], Oланды [Olandy]
- samisch: Alánda, Ålándda eanangoddi
- samoanisch: ʻĀlani, Alandi
- samogitisch: Alėjė
- sango: Âland
- sardisch: Ìsulas Aland
- saterfriesisch. Alaund
- schlesisch: Alandja
- schottisch: Aland
- schwedisch: Åland, Ålands län, Ålandsöarna
- schweizerdeutsch: Aland
- serbisch: Оландска Острва [Olandska Ostrva]
- seschellisch: Zil Åland, Zil Aland
- sindhi: اولاند ٻيٽون [Oland beeṭūⁿ]
- singalesisch: ඔලන්ද් දූපත් [Oland dupath]
- sizilianisch: Ìsuli Ålan
- slovio: Aland-ostrovy
- slowakisch: Alandy, Alandské ostrovy
- slowenisch: Alandski otoki
- somalisch: Jasiiradaha Aaland
- sorbisch: Awland, Awlandowe kupy
- spanisch: Aland, Islas de Aland
- sudovisch: Alandas
- sundanesisch: Aland, Kapuloan Aland
- surinamesisch: Aland
- swahili: Visiwa vya Aland
- swasi: Aland
- syrisch: ܐܘܠܐܢܕ [Awland]
- tadschikisch: Аляндия [Aljandija]
- tagalog: Åland, Mga Pulo ng Åland
- tahitianisch: Mā’ohi Åland, Motu Åland
- tatarisch: Аланд [Aland], Аланд утраулары [Aland utraulary]
- telugu: ఆలాండ్ దీవులు [Ālāṇḍ dīvulu]
- thai: หมู่เกาะโอลันด์ [Mū Ko O-lan]
- tibetisch: ཨོ་ལནཌ། [O-lan-d]
- tigrinisch: ኦላንድ [Oland]
- timoresisch: Alandia
- tok pisin: Alan
- tonganisch: ʻĀlānisi motu
- tschechisch: Alandy
- tschetschenisch: Аландан гӀайренаш [Alandan gyajrenaš]
- tschuwaschisch: Алan [Alan]
- turkmenisch: Aland adalary
- tuwinisch: Аланд [Aland]
- türkisch: Aland adaları
- udmurtisch: Алaн [Alan]
- uigurisch: ئولاند [Oland]
- ukrainisch: Аланди [Alandi], Аландськi острови [Alands’ki ostrovi]
- ungarisch: Alandszigetek
- urdu: اولانڈ جزائر [Oland jazā’ir]
- usbekisch: Aland orollari
- venezianisch: Alandia
- vietnamesisch: Quần đảo Åland
- visayan: Aland
- volapük: Alän
- voronisch: Ahunamaa
- walisisch: Ynysoedd Aland
- wallonisch: Alande
- weißrussisch: Аляндзкія выспы [Aljanskija vyspy]
- wepsisch: Ahvenanma, Ahvenanman Sared
- winaray: Kapuropud-an Aland
- wolof: Dunu Aland
- yoruba: Àlàndì, Àwọn Erékùṣù Àlàndì
- yukatekisch: Aland
- zazakisch: Aalanda, EBland
- zhuang: 阿兰 [A̱laen]
- zulu: iAlan
Offizieller Name:
- schwedisch: Landskapet Åland
- finnisch: Ahvenanmaan Maakunta
- Bezeichnung der Bewohner: Ålänningar (Aaländer)
- adjektivisch: ålänning (aaländisch)
Kürzel:
- Landescode: AX / ALA
- Alternativ: ALD
- Sport: ALA
- Post: FI200
- Kfz: ÅL
- FIPS-Code: FI01
- ISO-Code: AX, ALA, 248
- Internet: .ax
Lage
Die Åland-Inseln befinden sich im Zentrum der Ostseeregion zwischen den schwedischen Provinzen Uppsala und Stockholm auf der einen, und der finnischen Provinz Varsinais-Suomi mit der Hauptstadt Turku bzw. Åbo auf der anderen Seite. Sie liegen auf durchschnittlich 20°23’ ö.L. und 60°04’ n.B.. Der Archipel befindet sich damit auf gleicher geografischer Breite wie die Shetland-Inseln, die norwegische Stadt Bergen, Finnlands Hauptstadt Helsinki, der Ladoga-See, das Zentrum Sibiriens, der Nordrand der Kamtschatka, das Cook Inlet vor Anchorage in Alaska, die Nordgrenze der kanadischen Staaten British Columbia, Alberta, Saskatchewan und Manitoba, die Nordspitze Labradors und die Südspitze Grönlands.
Åland ist 21 km von der schwedischen Küste und 18 km von der finnischen Küste entfernt. Die Hauptinsel mit etwa 90 % der Einwohner liegt im Westen des Archipels, 40 km von der schwedischen und 100 km von der finnischen Küste entfernt. Die Länge der Küsten Ålands wird offiziell mit 501,3 km angegeben.
Geografische Lage:
- nördlichster Punkt: 60°25‘38“ n.B. (Geta) bzw. 60°39’19“ n.B. (Storklyndan / Brändö)
- südlichster Punkt: 60°03‘37“ n.B. (Mariehamn) bzw. 59°30’10“ n.B. (Bogskär / Föglö)
- östlichster Punkt: 20°16‘32“ ö.L. (Hulta) bzw. 21°19’36“ ö.L. (Skataskär / Kökar)
- westlichster Punkt: 19°38‘07“ ö.L. (Svartnö) bzw. 19°07’54“ ö.L. (Märket / Hammarland)
Entfernungen:
- Byholma / Schweden 38,2 km
- Hiiumaa / Estland 102 km
- Turku / Finnland 116 km
- Gotska Sandön / Gotland 168 km
- Helsinki / Finnland 260 km
- Lettland 270 km
- Rozewie / Polen 560 km
- Arkona / Rügen 693 km
Zeitzone
Die Inselgruppe gehört wie Finnland zum Bereich der Östeuropäisk Tid bzw. Eastern European Time (Osteuropäische Zeit), kurz ÖET bzw. EET (OEZ). Diese ist der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) um eine Stunde voraus (UTC+2). Vom letzten Sonntag im März bis zum letzten Sonntag im Oktober gilt die Östeuropäisk Sommartid (Ostereuropäische Sommerzeit), kurz ÖEST bzw. EEST (OESZ), eine Stunde vor der Standardzeit. Die Realzeit liegt eine Stunde und 16 bis 25 Minuten vor der Koordinierten Weltzeit (UTC). Die Sonne geht in Åland im Mittel um 11 bis 20 Minuten früher auf als in Wien.
Fläche
Das Gesamtareal des Åland-Archipels umfasste mit Stand 2015 insgesamt 6.784,2 km² bzw. 2.620 mi² (0,49 % der Fläche Finnlands). Davon entfielen 5.202,8 km² auf äußere Gewässer, 1.581,4 km² auf Land und 27,41 km² auf Binnengewässer. Die reine Landfläche betrug 1552,57 km² im Jahr 2015. Für 2021 werden 1.582,93 km² angegeben. Unter Einrechnung der Wasserflächen der Ostsee, insgesamt 11.743,39 km² (1991 waren es 11.744,36 km²), erreicht der Archipel eine Größe von 13.352,2 km² bzw. 5.157,3 mi² - 1991 und wiederum 2021 waren es 13.324,36 km². Für das Jahr 2016 gab das finnische Landmäkeriverket eine Gesamtfläche von 13.324,29 km² mit einem Landanteil von 1.553,3 km² an. Die Gesamtzahl der Inseln mit einer Mindestgröße von 0,25 ha beträgt 6.757. Größer als 1 ha sind 6.554 Inseln, bewohnt 60.
Die Hauptinsel Fasta Åland nimmt mit rund 685 km² bzw. 264 mi², inklusive der mit Dammn verbundenen Inseln 1.010 km² bzw. 390 mi², also rund zwei Drittel der Gesamtfläche, ein. Mit unmittelbaren Nebeninseln ergibt sich eine Fläche von 1.017,29 km². Fasta Åland durchmisst von von Norden nach Süden 41,1 km, von Westen nach Osten 35,3 km bei einer Küstenlänge von fast 500 km. Der Durchmesser der gesamten Inselgruppe beträgt in Ostnordost-Westsüdwest-Richtung von Storklyndan bis Märket 97 km und in Nordnordwest-Südsüdost-Richtung von Norrskär bis Västra Märskär) 82 km. Die mittlere Seehöhe Ålands beträgt 14 m. Höchste Erhebungen sind der Orrdalsklint mit 126 m und der Kasberg mit 119 m, jeweils auf der Hauptinsel Fasta Åland. Die tiefste Stelle liegt auf Meeresniveau, das einem maximalen Tidenhub von 0,01 bis 0,02 m (Mariehamn 0,015 m) ausgesetzt ist. Der Landbildungsprozess ist noch immer nicht abgeschlossen und so wächst die Landfläche des Schärenarchipels.
Fläche inklusive Binnengewässer:
1931 1 423,10 km²
1951 1 452,00 km²
1971 1 481,00 km²
1981 1 512,00 km²
1991 1 551,60 km²
2010 1 579.80 km²
2015 1 581,40 km²
2016 1 582,62 km²
2017 1.582,71 km²
2019 1 582,82 km²
2021 1 582,93 km²
Rund 9 % des Landareals werden als Acker-, 4 % als Weideland genutzt. 58 % entfallen auf Buschland und Wälder, 18 % sind felsiges Ödland, 10 % ungenutzte Wiesen. Nicht einmal ein halbes Prozent des Landes ist verbaut.
Flächenaufteilung 1997:
Waldland 725,0 km² 47,6 %
Ödland 270,0 km² 17,7 %
Buschland 204,0 km² 13,4 %
Wiesen 187,0 km² 12,3 %
Agrarland 134,5 km² 8,8 %
verbautes Land 3,0 km² 0,2 %
Geologie
Die Inseln Aalands bestehen zum größten Teil aus metamorphen und magmatischen Gesteinen, die oft als Fels zum Vorschein treten. Sie sind präkambrischen Alters (etwa 1,6 Milliarden Jahre) und gehören zum Baltischen Schild. Vor allem im östlichen Teil der Inselgruppe steht Gneis an. Auf der Hauptinsel und in ihrer Umgebung findet man meist Granite. Bekannt bei Geologen ist die auf den Inseln vorkommende rötliche Granitvarietät Rapakiwi, die man auch sehr häufig in Norddeutschland als eiszeitliches Geschiebe findet.
Zum sogenannten Rapakiwipluton gehören die meisten Gesteine der Region. Sie zeigen eine große Bandbreite verschiedener Gefüge, sind aber wegen ihrer typischen Merkmale - insbesondere die braunrote Farbe und die grafischen Verwachsungen - gut zu identifizieren. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass die kleinkörnigeren Gesteine (Granitporphyre und Aplitgranite) eher im Süden der Hauptinsel anzutreffen sind und dass die mehr groben Gefüge in Richtung auf die Mitte des gesamten Massivs hin auftreten. Das ist aber nur eine allgemeine Tendenz. Die verschiedenen Gesteine sind im einzelnen sehr ungleichmäßig angeordnet.
Konkret gibt es drei Gefügetypen: den gewöhnlichen Åland-Granit (mittelkörnig, keine Ovoide), den Granitporphyr und den Åland-Rapakiwi. Darüber hinaus finden sich in nennenswerter Menge die feinkörnigen Aplitgranite. Echte Quarzporphyre mit dichter Grundmasse sind nur sehr spärlich vorhanden und auf Åland seltener als im Geschiebe. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es weitere Vorkommen von Quarzporphyren außerhalb Aalands gibt, die nicht bekannt sind und fälschlicherweise dieser Inselgruppe zugeschlagen werden. Weitere Gesteinstypen sind porphyrischer Granit, gleichkörnige Granite und Mischformen zwischen allen genannten Gruppen. Auch Prick-Granit soll an einigen wenigen Stellen vorkommen. Alle diese Varianten gehören zum Ålandpluton und damit zu den Rapakiwis. An einer einzigen, sehr kleinen Stelle gibt es ein Rapakiwigestein vulkanischen Ursprungs - einen Ignimbrit. Dabei handelt es sich um den einzigen Vulkanit in einem skandinavischen Rapakiwivorkommen, wenn man von der Insel Hogland absieht, die in Russland liegt (http://www.kristallin.de/rapakiwis/alandkarte.htm).
In der letzten Eiszeit wurde das Land von den Eismassen vollständig unter den Wasserspiegel gedrückt. Vor etwa 13.000 Jahren hob sich das erste Land aus dem Meer, beginnend mit dem höchsten Punkt Ålands, dem Orrdalsklint. Damals hatten sich die eiszeitlichen Gletscher nach Norden zurückgezogen und Skandinavien von ihrer gewaltigen Last befreit, was zur Folge hatte, dass sich die ganze Region allmählich hob. Ungefähr um -4000 bestand Aland erst aus jenen Gebieten, die heute mehr als 60 m über dem Meeresspiegel liegen. Im Laufe der Zeit stieg das Land weiter an und immer mehr Inseln bildeten sich. Dieser Prozess setzt sich bis heute fort: Åland steigt mit einer Geschwindigkeit von einem halben Zentimeter pro Jahr aus dem Meer empor.
„Einen guten Eindruck von Åland erhält, wer mit einer der lokalen Fähren von einer Ecke des Archipels in eine andere fährt. Ungezählte kleine und kleinste Eilande säumen die Route. Hinter jeder Felsnase öffnet sich der Blick auf neue Inseln, ragen andere sturmpolierte Felsen wie Buckel von Walen aus dem Wasser. Seevögel kurven um die Klippen. Von Zeit zu Zeit taucht aus dem Grün der bewaldeten Inseln ein einzelnes Holzhaus auf. Hier und dort erkennt man an der Küste weissgetünchte Steintürme, Orientierungspunkte der Fischer in dieser verworrenen Inselwelt.“ (Kappeler 1992)
Landschaft
Die Inselgruppe besteht aus über 6700 Inseln und Schären - das sind die für die skandinavischen Küsten so typischen, von urzeitlichen Gletschern buckelartig abgeschliffenen Felsinseln - gehören zu diesem Archipel am südlichen Eingang des Bottnischen Meerbusens in der nördlichen Ostsee. Sie ist relativ flach mit einer durchschnittlichen Seehöhe von 14 m. Höchste Erhebung ist der Orrdalsklint im Norden der Hauptinsel Fasta Åland mit 129 m. Wie sie sind auch die nächst höchsten Hügel - Kasberg mit 116 m und Geta mit 107 m - auf Fasta Åland, der Hauptinsel, zu finden.
Die sechs größten Inseln sind heute durch befestigte Straßen und Brücken miteinander verbunden, zwischen den anderen Inseln verkehren Fähren. Der südliche Teil Ålands ist grün und fruchtbar, der nördliche dagegen karg und felsenreich. Die Kulturlandschaft Ålands besteht aus vier unterschiedlichen Erscheinungsformen:
- Löväng: Das sind mit Laubbäumen und Büschen bestandene Wiesen oder lockere Laubwälder mit zahlreichen Lichtungen, wie sie vor allem rund um intensiv bewirtschatete Nutzflächen zu finden sind.
- Torräng: Diese mit Büschen und vereinmzelten Laubbäumen durchsetzten Trockenwiesen sind Brachflächen, wie sie höher gelegene Regionen kennzeichnen. Sie sind nährstoffarm, aber auch reich an Pflanzen- und Insektenarten.
- Slåtteräng: Es sind dies Schnittwiesen, die ein- bis zweimal pro Jahr gemäht werden. Sie sind vorwiegend im Umfeld von Ortschaften und Gehöften zu finden.
- Strandäng: Die Strandwiesen in den Küstengebieten sind feucht, mitunter sumpfig. Hier gedeihen Pflanzenarten, die viel Wasser brauchen und von denen viele heute in ihrem Weiterbestand gefährdet sind.

Erhebungen
- Orrdalsklint 129,1 m (Saltvik)
- Kasberg 119,0 m (Saltvik)
- Soltuna 107,0 m (Geta)
- Getabergen 99,0 m (Gerta)
- Notbergen 81,0 m (Högskär)
- Bistorpsberg 77,2 m (Lumparland)
- Jomala 71,0 m (Jomala)
Fluss
- Strömen 10 km
Seen Fläche Seehöhe Uferlinie
Långsjön-Markusbölefjärden 305,11 ha 6,0 m 23,46 km
Vargsundet 105,38 ha 10,0 m 15,45 km
Inre Fjärden 91,84 ha 1,9 m 9,34 km
Tjudö Träsk 82,38 ha 3,0 m 8,81 km
Storträsk 80,38 ha 3,4 m 6,25 km
Södra Långsjön 66,00 ha 22,7 m 6,29 km
Toböle Träsk 51,75 ha 8,1 m 5,66 km
Inre Verkviken 49,20 ha 64,0 m 6,59 km
Långsjön 45,78 ha 22,8 m 5,30 km
Sonröda Träsk 43,06 ha 41,0 m 3,64 km
Moraträsk 40,44 ha 13,0 m 4,57 km
Olofsnäs Träsk 38,46 ha 5,0 m 4,50 km
Långträsk (Hammarland) 37,93 ha 20,0 m 5,81 km
Åsgårda Träsk 35,08 ha 30,0 m 5,21 km
Gröndals Träsk 31,21 ha 15,0 m 3,69 km
Bostaholmsträ#sket 29,89 ha 4,0 m 3,60 km
Byträsk (Geta) 29,54 ha 4,0 m 4,10 km
Lavsböle Träsk 29,53 ha 25,0 m 3,98 km
Norrträsk 27,19 ha 31,0 m 2,01 km
Bjärströms Träsk 26,49 ha 1,9 m 3,81 km
Leviksfjärden 25,95 ha 8,0 m 2,71 km
Dalsträsk 25,66 ha 19,5 m 2,47 km
Mösjö 25,41 ha 15,0 m 3,62 km
Norsträsk 24,97 ha 9,0 m 4,03 km
Kråkskärsfjärden 23,63 ha 1,0 m 4,29 km
Syllöda Träsk 22,08 ha 11,0 m 2,43 km
Oppsjön 21,19 ha 7,0 m 2,38 km
Storträsket 20,46 ha 50,0 m 2,30 km
Kvarnträsk 18,48 ha 13,0 m 1,92 km
Borgsjö 17,99 ha 6,0 m 2,38 km
Möträsk 17,44 ha 11,0 m 3,58 km
Västra Kyrksundet 17,00 ha 5,0 m 2,00 km
Prästträsket 16,15 ha 13,0 m 2,12 km
Kvärsjö 15,33 ha 26,0 m 2,26 km
Björby Träsk 15,19 ha 2,1 m 2,03 km
Medalen 14,74 ha 5,0 m 2,21 km
Trutvik Träsk 14,69 ha 9,0 m 2,43 km
Långträsk (Geta) 13,70 ha 48,0 m 2,92 km
Mönträsk 13,49 ha 19,0 m 1,92 km
Kvarnbo Träsk 13,18 ha 29,0 m 1,77 km
Strömma Träsk 13,05 ha 46,0 m 2,27 km
Kvarnsjön 12,84 ha 33,0 m 1,96 km
Byträsk (Lemland) 11,88 ha 16,0 m 1,63 km
Askarträsk 11,52 ha 3,2 m 1,70 km
Tjudnas Träsk 11,26 ha 11,0 m 1,41 km
Västmyra Träsk 10,63 ha 5,0 m 1,74 km
Västerträsk 10,57 ha 4,0 m 1,94 km
Västersjö 10,55 ha 16,0 m 2,13 km
Svartträsk (Finström) 10,23 ha 32,0 m 1,44 km
Fägernäs Träsk 10,13 ha 10,0 m 2,25 km
Borgboda Träsk 9,91 ha 19,0 m 1,72 km
Inseln Fläche Ausmaße Höhe
Fasta Åland 685 km² 57,3 x 44,5 km 129 m
Lemland 108 km² 17,0 x 10,0 km 52 m
Eckerö 101 km² 18,7 x 9,1 km 35 m
Lumparland 35 km² 11,6 x 4,9 km 8 m
Vårdö 34 km² 10,3 x 6,0 km 17 m
Föglö 32 km² 9,5 x 5,0 km 10 m
Kökar 29 km² 8,6 x 6,0 km 59 m
Kumlinge 26 km² 7,0 x 5,4 km 4 m
Enklinge 20 km² 6,4 x 3,0 km 5 m
Storsottunga 19 km² 5,1 x 2,4 km 10 m
Flora und Fauna
Die aaländische Inselwelt zeichnet sich durch ein mildes Klima, zahlreiche Inseln und eine vielfältige Natur aus. Während etwa 89 % der Inselgruppe aus Wasser bestehen, ist sowohl die Pflanzen- als auch die Tierwelt außergewöhnlich artenreich und einzigartig.
Flora
Pflanzengeografisch gesehen liegt Åland im Norden in der sogenannten Eichenzone mit einem relativ großen Anteil von edlen Laubbäumen, wie Eichen, Eschen, Ulmen, Ahorn und Linden und anderen eher südlichen Arten von Laubbäumen. Das milde Meerklima und die mineralreichen Böden mit kalkreicher Humusschicht tragen noch mehr zu der reichen Flora bei.
Auf den Inseln wachsen zahlreiche Orchideenarten, von denen die meisten zu den etwa fünfzig unter Naturschutz stehenden Pflanzen gehören. Insgesamt sind mehr als 1.100 höhere pflanzliche Organismen, darunter 650 Blütenpflanzenarten, in Åland beheimatet und machen Ålands Fauna damit zu der vielfältigsten in ganz Finnland.
Es dominiert der Nadelwald mit Fichten und Kiefern, aber auch Birken, Erlen, Espen und andere Laubbäume sind verbreitet. Besonders prächtig sind im übrigen die bizarren „Felsgärten“, die in den Rissen, Spalten und Mulden des vielerorts zutagetretenden Granits wachsen und sich aus Wacholderbüschen und Farnwedeln, Moospolstern und Heidekraut, Pilzen und Gräsern, Buschwindröschen und dürren Ästen zusammensetzen.
Fauna
Durch seine Lage in der Ostsee besitzt Åland ein milderes Klima als sein Nachbar Schweden oder als das finnische Festland. Das bedeutet, dass die Temperaturen im Sommer selten über 20°C steigen und im Winter kaum unter -10°C fallen. Dieses Klima bedingt eine reichhaltige Fauna mit insgesamt 22.700 verschiedenen Tierarten – allerdings sind über 75 % hiervon Insekten. Zu diesen zählen natürlich auch die allseits gefürchteten und verhassten Mücken. Durch die Nähe zum Meer ist die Anzahl der Plagegeister hier aber geringer als in anderen Regionen Schwedens und Finnlands.
Neben so vielen Insekten gibt es rund 130 verschiedene Vogelarten, die jedes Jahr auf den Inseln brüten. Dazu gehört unter anderem die Bergente, die zu den bedrohten Wasservögeln gehört. Auch der Seeadler, der in Finnland Mitte der 1970er Jahre nahezu vollständig ausgerottet war, konnte durch große Bemühungen geschützt und und wieder angesiedelt werden. Er steht, wie nahezu alle Tiere Ålands, unter Naturschutz.
Neben allerlei - zum Teil in ihrem Bestand bedrohten - Seevögeln wie der Bergente „nisten auf dem Archipel einige auffällige Landvogelarten wie Habicht, Uhu und Birkhuhn. Ferner drängen sich ganze Spatzenvölker auf Telefondrähten, Elsternpaare fliegen um graue Granitkirchen, Krähenschwärme fallen auf abgeerntete Kartoffeläcker ein. Im übrigen ist die Inselgruppe ein wichtiger Rastplatz für hochnordische Zugvögel.“ (Kappeler 1992) Der Seeadler, der Mitte der 1970er Jahre in ganz Finnland praktisch ausgerottet war, kann nach erfolgreichen Schutz- und Wiederansiedlungsbemühungen in Åland in großer Zahl angetroffen werden. Von dem Jagdwild abgesehen stehen fast alle Tiere Ålands unter Naturschutz.
Ein anderes Tier wichtiges Tier der Inselwelt ist der Elch. Auch diese eleganten Tiere mit den langen Beinen sind auf den Åland-Inseln zahlreich vertreten. Wer allerdings einen Elch zu Gesicht bekommen möchte, muss sich in Geduld üben: Sie sind äußerst scheu und meiden normalerweise die Nähe der Menschen.
Insgesamt sind es 25 verschiedene Arten von Säugetieren, die in der westlichsten Region Finnlands beheimatet sind. Ein Wildtier aber, das auf dem finnischen Festland lebt, sucht man in Åland vergeblich: den Braunbären. Dieses Tier kann mit ein wenig Geschick und Geduld in allen Regionen Finnlands angetroffen werden – mit Ausnahme von Åland.
Pflanzen-und Tierarten:
Flora
gesamt 1 100
Blütenpflanzen 650
Fauna
gesamt 22 700
Vögel 135
Fische 50
Säugetiere 25
Reptilien und Amfibien 5
Naturschutz
Der Naturschutz ist heute in der åländischen Gesellschaft relativ gut entwickelt. Åland verfügt über ein eigenes Naturschutzgesetz mit besonderen Bestimmungen über schützenswerte Pflanzen und Tiere. Etwa 50 Pflanzen, darunter die meisten Orchideenarten, stehen auf Åland unter Naturschutz, wie auch die meisten wildlebenden Säugetiere und Vögel mit Ausnahme der Wildtiere, die während der Jagdzeit geschossen werden dürfen. Gemäss einem Regierungsbeschluss sind auch alle, auf Åland vorkommenden Amphibien und Reptilien, mit Ausnahme der Kreuzottern, und bestimmte von der Ausrottung bedrohte Schmetterlinge geschützt. Das åländische Recht zum Gemeinbrauch ist in gewissen Bereichen etwas strenger als in den Nachbarregionen.
Auf Åland gab es mit Stand 2020 44 zu insgesamt zehn Einheiten zusammengefasste Naturschutzgebiete, die insgesamt 1,3 % der gesamten Landfläche einnehmen. Damit sollen die unterschiedlichen Naturtypen, die es auf Åland gibt, auch für die kommenden Generationen bewahrt werden. In der Nähe von Mariehamn liegen beispielsweise die für ihre Laubbäume bekannten Naturschutzgebiete Ramsholmen und Nåtö. Dazu kommen noch neue Vogelschutzgebiete. Die Zahl und der Umfang der naturgeschützten Areale betrug:
Naturschutzgebiete: Land Wasser
1980 616 ha 0,4 % 6 292 ha 1,2 %
1990 1 058 ha 0,7 % 7 438 ha 1,4 %
2004 1 682 ha 1,1 % 10 025 ha 1,9 %
2007 1 909 ha 1,3 % 10 657 ha 2,0 %
Klima
Das Klima auf Åland ist aufgrund der Insellage in der Ostsee im Vergleich zum schwedischen und finnischen Festland gemäßigt, laut Köppen Dfb (humides Kontinentalklima mit warmen Sommern und kalten Wintern). Die Ostsee erwärmt im Winter die kalten Nordostwinde und kühlt im Sommer die heißen Südostwinde. Der jährliche Niederschlag liegt bei durchschnittlich 550 bis 570 mm pro Jahr und ist damit geringer als auf dem schwedischen und dem finnischen Festland. Der meiste Niederschlag fällt in der Zeit von Ende August bis Anfang Januar bei einer Tageshöchstmenge von 62 mm. An durchschnittlich 102 Tagen im Jahr ist der Boden schneebedeckt. In der restlichen Zeit verdunsten rund 506 mm wieder in die Atmosphäre. Die mittlere Luftfeuchtigkeit beträgt 81 % mit deutlich höheren Werten im Winterhalbjahr. Nebeltage gibt es rund 200, Tage mit Gewitter im Durchschnitt 12. Die Sonne scheint im Mittel 5,6 Stunden pro Tag, und der Wind hat auf Åland eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 9,4 km/h, wobei Stürme mit über 100 km/h absolute Ausnahmefälle bilden.
Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 5,5°C. Die höchste jemals auf Åland gemessene Temperatur beträgt 31,3°C, die niedrigste -32,4°C. Die Meerestemperatur schwankt zwischen 0°C von Mitte Januar bis Mitte März und 17°C im August. Die nachfolgenden Durchschnittswerte für die einzelnen Monate stammen aus den Jahren 1971 bis 2000 (* zum Vergleich 1961 bis 1990).
Klimastationsdaten für Mariehamn - 69°07’ N, 19°54’ O, 4 m
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
Mittlere Temperatur in °C:
-2,5 -3,7 -1,2 2,7 8,7 13,0 15,9 15,0 10,5 6,4 2,4 -0,6 5,5
Niederschlagsmenge in mm:
40 24 30 27 24 42 55 73 65 61 62 48 565
Tage mit mehr als 0,1 mm Niederschlag:
20 16 13 12 10 11 12 13 16 18 19 20 180
Potenzielle Verdunstung in mm:
0 0 0 20 59 92 118 104 66 36 11 0 506
Relative Luftfeuchtigkeit in %:
88 85 83 79 71 72 75 79 83 84 88 89 81
Mythologie
Die Entstehung der Åland-Inseln war deren Bewohnern bis in die Neuzeit herauf ein Rätsel, ein Akt, der sich im Dunkel der mythischen Frühzeit verlor. Zur Erklärung zogen sie den Mythos der beiden riesenhaften Sklaven Fenja und Menja heran, die dazu gezwungen wurden, Gold für König Frodi zu zerstoßen. Eines Nachts attackierte ein fremdes Kriegsschiff den König. Dessen Kapitän beorderte Fenja und Menja auf sein Schiff und befahl ihnen, Salz zu zerstoßen. Das Schiff sank, aber die beiden Sklaven hörten auch auf dem Boden des Meeres nicht auf, Salz zu zerstoßen. Auf diese Weise, so heißt es, kam das Salz ins Meer. Und dies war auch die Ursache, weshalb die Åland-Inseln ganz langsam aus dem Meer emporwuchsen.
Auf den Inseln selbst machten sich bald eine Fülle übernatürlicher Gestalten breit wie zum Beispiel die Letesgubbar. Das waren mythische Wesen, die die Menschen vor kommenden Stürmen warnten. Sie schlugen durch Geräusche, Wandklopfen oder Werfen von Gegenständen Alarm, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen. Die Greise waren oft klein und wohnten in der Nähe von Fischerdörfern im Schärengebiet. Häufig wurden sie nach dem Ort, wo sie gesehen wurden, genannt, zum Beispiel „Örgubben“ oder „Skarvskärsgubben“. „Lete“ ist im Schwedischen eine Art Kork, der an Strömlingsnetzen befestigt wird. Das Wort ist auf Åland allgemein bekannt, und es kommt auch in den Schärengebieten östlich und westlich von Åland vor.
Eine andere in åländischen Sagen anzutreffende Gestalt ist Gylfe. Er war alten Überlieferungen entsprechend der letzte König der ältesten schwedischen Reichsbildung, die das Reich des Hägakünigs genannt wird. Dieses Reich existierte schon um das Jahr -1000, also während der mittleren Bronzezeit. Es umfasste die Landschaften in der Umgebung von Mälaren und dessen Hinterland im Westen, dazu die entlegenen Felder im Norden Schwedens. Auch Gotland, die Aland-Inseln und der südwestliche Teil Finnlands gehörten zum Reich des Hägakünigs. In der Bronzezeit, wo die Temperatur im Norden im Durchschnitt höher als in der Zeit nach Christi Geburt war, entstand im Mälargebiet wahrscheinlich ein Sonnenkult, der in den religiösen Vorstellungen der Eisenzeit immer noch bemerkbar war.
Geschichte
Åland blickt auf eine reichhaltige und abwechslungsvolle Geschichte zurück. Mehr als 13.000 Gegenstände aus früheren Epochen wurden bislang ausgegraben. Begonnen hat diese Geschichte vor rund 10.000 Jahren, als sich das Land nach Abzug der Gletschermassen zu heben begann. Die Menschen allerdings verschonten die kargen Schären vorerst noch.
Frühzeit
Während der Weichseleiszeit um -18.000 erstreckte sich eine dicke Eisdecke über Skandinavien. Die gewaltigen Eismassen formten die bestehende Landoberfläche und schliffen sie weitgehend glatt. Ihr Gewicht übte einen großen Druck aus. Um -9000 zog sich das Eis allmählich von den Inseln zurück. Um -8000 ragten nur die Hügel Nord-Ålands aus dem Wasser.
Nachdem das Eis sich zurückgezogen hatte, erhoben sich die Inseln infolge der Druckentlastung langsam aus dem Meer. Aufgrund des Vormoor-Effekts nach dem Abschmelzen der Eiskappen hebt sich das Gebiet um Åland noch immer um mehrere Millimeter pro Jahr, wodurch sich die Oberfläche der Schären geringfügig vergrößert. Seit dem -7. Jahrtausend hat sich das Land um rund 60 Meter gehoben. Die Meeresspiegel in der Ostsee wechselten sich ab, aber eine Landbrücke nach Åland bildete sich nie, was darauf hindeutet, dass die ersten Menschen mit dem Schiff oder über das Eis kamen.
Neolithikum
In der späten Steinzeit, gegen Ende des -6. Jahrtausends, ließen sich die ersten nomadisierenden Fischer und Seehundjäger auf der Inselgruppe an. Sie kamen von Osten her und gehörten zur sogenannten Kammkeramischen Kultur.
Nach -3300 drangen neue Stammesgruppen auf das mittlerweile bereits über 800 km² umfassende Land vor. Diesmal kamen sie aus dem Westen, betrieben Jagd, Fischfang und primtiven Ackerbau und gründeten erste feste Niederlassungen. Wie ihre Vorgänger siedelten sie in Küstennähe, doch liegen ihre Wohnplätze heute 30 bis 35 m über dem Meeresspiegel. Eine der bekanntesten archäologischen Fundstellen aus dieser Epoche befindet sich beim heutigen Jettböle in der Gemeinde Jomala. Als Vertreter der Muldenkeramischen Kultur pflegten die spätsteinzeitlichen Inselbewohner Kontakte zum mittelschwedischen Raum, streckten ihre Fühler aber auch weiter nach Osten aus.
Bronze- und Eisenzeit
Um -1800 kam es zur nächsten Zeitenwende, als neue Zuwanderer - wiederum aus Schweden - eine neue Kultur, die Kiukainen-Kultur, begründeten. Sie betrieben Schiffbau, befuhren als Händler die Ostsee und errichteten in ihrer åländischen Wahlheimat Hügelgräber. Damals erreichten erste Bronzegegenstände, zunächst Schmuck, bald auch Waffen, Åland, was üblicherweise als den Beginn der Bronzezeit angesehen wird.
Diese Periode - sie verlief im Wesentlichen friedlich - dauerte bis ins beginnende -4. Jahrhundert. Zu jener Zeit führte eine massive Klimaverschlechterung zur Massenauswanderung. Der Großteil der mehrere Tausend Bewohner Ålands verließ die Inselgruppe in Richtung Südwesten und Südosten, was zu einer nachhaltigen Schwächung der åländischen Gesellschaft führte.
Es folgte ein Zeitraum von etwa 200 Jahren, in dem die Inseln möglicherweise unbewohnt waren. Jedenfalls konnten keine Spuren menschlichen Lebens aus dieser Zeit nachgewiesen werden. Allem Anschein nach aber war die Inselgruppe im 4. und 5. Jahrhundert praktisch unbewohnt.
Frühmittelalter
Erst im 7. Jahrhundert erreichte eine neue Welle von Siedlern die Inseln aus dem Westen. Es waren germanische Skandinavier, in ethnischer Hinsicht die Vorfahren der heutigen Bevölkerung Ålands. Sie zogen in so großer Zahl nach Åland, dass der Archipel binnen weniger Jahrzehnte zur dichtestbesiedelten Region Nordeuropas wurde. Die heutige Bevölkerung geht überwiegend auf eine neue Siedlungswelle im 7. Jahrhundert aus dem Westen zurück, die die direkten Vorfahren der heutigen Åländer stellte.
Im 10. Jahrhundert war die Hauptinsel bereits dicht besiedelt; zahlreiche Familiengräber sowie Gebäudefundamente bezeugen dies. Weitreichende Handelsverbindungen verbanden Åland mit Ländern vom Norden Skandinaviens bis zum deutschen Ostseeraum. Handelsgüter Aus fernen Ländern, zahlreiche Gräberfelder und sechs Wallburgen, insbesondere die Wallburg Borge, zeigen Bedeutung und Wohlstand der Region in der Wikingerzeit.
Hochmittelalter
Im 11. Jahrhundert kam das Christentum nach Åland, und der Heilige Olaf wurde Schutzheiliger der Inseln. In dieser Phase entstanden erste Anzeichen christlichen Glaubens und erste Kontakte zur Kirche. Die Inseln wurden im Zeitraum des Hochmittelalters schließlich Teil des schwedischen Einflussbereichs. In Finström wurde eine erste Kirche errichtet. Sie wurde um 1200 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Wenige Jahrzehnte später Lemland, Hammarland, Kökar, Eckerö, Saltvik, Kumline und Vårdö. Die Kirche von Jomala ist eine der ältesten Steinkirchen in ganz Finnland. Unterdessen wurde Åland auf einem Dokument über Schifffahrtslinien als wichtiger Dreh- und Angelpunkt erwähnt.
Zum Zeitpunkt der schwedischen Reichsgründung im Hochmittelalter im 12./13. Jahrhundert stand Åland unter der Herrschaft der Diözese Linköping. Die Inselgruppe wurde als Teil der Diözese im Jahr 1249 dem neu entstandenen schwedischen Reich eingegliedert, lange bevor sich der Einflussbereich der Reiches auf andere Regionen des heutigen Finnlands ausdehnte. Die Geschichte Ålands war in der Folgezeit eng mit der Geschichte Schwedens verknüpft. Aufgrund seiner Lage nahm Åland dabei große strategische Bedeutung ein. Um seine Brückenfunktion in der Erschließung Finnlands zu betonen, unterstellte man den Archipel 1309 der Diözese Åbo (Turku). Gleichzeitig begann man mit der militärischen Erschließung des Schärenlandes. In diesem Zusammenhang entstand die Burg Kastelholm, deren Bau von Bo Jonsson Grip geleitet wurde. Die Burg ist erstmals im Jahr 1388 urkundlich erwähnt.
Schwedische Ära
In den Wirren der Kalmarer Union wechselte die Burg mehrmals den Besitzer. 1440 wurde sie von Karl Knutsson erobert, der sich vorübergehend die schwedische Königskrone sichern konnte. Als Folge davon verlor Åland 1442 seine Handelsfreihit. 1480 übernahm Svante Nilsson Kastelholm für den dänischen König. Nachdem Svante allerdings die Seiten gewechselt hatte, übergab er die Burg 1497 an Sten Sture den Älteren, der die Burg wiederum an Gustaf Wasa weiterreichte. Nach heftigen Angriffen der Dänen wurde die Inhaberschaft im Jahr 1502 durch ein Duell zwischen dem dänischen Feldherr Lyder Frisman und Wasas Vertreter Henning von Brockenhus zugunsten der Dänen entschieden, die die Burg jedoch nach zwei weiteren Jahren wieder aufgaben. Schon 1507 kehrten sie zurück und zerstörten unter der Führung Sören Norrbys Schloss Kastelholm. 1521/23 kam es noch einmal zu heftigen Kämpfen zwischen Dänen und Schweden auf åländischem Boden.
In den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten rückte Åland aus dem Brennpunkt des Geschehens heraus. Der Konfessionswechsel der Bewohner im Zuge Reformation um 1540 verlief ohne besonderes Aufsehen. Ebensowenig hatten Wechsel in der Feudalherrschaft nachhaltige Folgen. 1556 erhielt Herzog Johan von Schweden die Inselgruppe samt Åboland als Lehen, während der Burgbezirk zunehmend an Bedeutung verlor. Er wurde lediglich als Internierungslager für prominente Häftlinge - wie 1571 des Königs Erik XIV und der Karin Månsdotter - genutzt. Die Bewohner Ålands spürten dennoch die Auswirkungen der vielen Kriegsunternehmungen des expandierenden Reiches. Sie hatten hohe Steuern zu leisten und auch Soldaten hauptsächlich für die schwedische Flotte abzustellen. Als Åland am 13. November 1621 schwedische Kronbesitzung wurde, erhöhte sich der Druck noch weiter.
Eine leichte Entspannung brachte erst die Vereinigung Ålands mit den Provinzen Åbo und Björneborg im Jahr 1634. In der Folgezeit, konkret ab 1638, übernahm die Inselgruppe eine Mittlerfunktion im Postverkehr zwischen Schweden und Finnland. 1639 entstand in Saltvik die erste åländische Unterrichtsanstalt, Ålands Pedagogi, und 1652 wurde in Föglö das erste Krankenhaus Ålands errichtet. Die relativ ruhige Zeit dauert bis ins frühe 18. Jahrhundert. Dann aber änderten sich die machtpolitischen Konstellationen.
Als neue starken Männer erschienen die Russen auf dem skandinavischen Parkett. Im Gefolge des Großen Nordischen Krieges geriet der größte Teil des heutigen Finnlands, insbesondere Åland, im Jahr 1714 unter russische Herrschaft. Die Besatzer wüteten grausam. Die verjagten schwedischen Machthaber versuchten vergeblich, die Inselgruppe zurückzuerobern, und auch die 1718 in Lövö (Vårdö) durchgeführten Friedensverhandlungen zwischen den beiden Streitparteien wurden schließlich ergebnislos abgebrochen. Die bis zum Friedensschluss von Nystad im Jahr 1721 andauernde gewalttätige Herrschaft der russischen Marine führte dazu, dass in diesen Jahren ein Großteil der åländischen Bevölkerung in das schwedische Hauptland floh. Ein weiterer Krieg führte zur erneuten Besetzung Ålands von 1741 bis 1743. Erneut flohen viele Einwohner, doch war diese zweite russische Besatzungszeit von deutlich weniger Übergriffen geprägt.
1765 wurde im Zuge der Lockerung des herrschaftlichen Gefüges den åländischen Bauern das Recht auf freien Verkauf ihrer Produkte zugestanden. Als 1795 F.W. Radloff einen viel beachteten Reisebericht über Åland veröffentlichte, hatte ein zaghafter Modernisierungsschub begonnen. Im Jahr darauf wurde in Grisslehamn und Signildskär ein optischen Telegrafensystem eingerichtet.
Russische Ära
Mitten in dem wirtschaftlichen Aufschwung traten erneutg die Russen auf den Plan. 1808 setzten sich russische Truppen in Kumlinge fest, wurden jedoch von aufständischen Bauern vertrieben. Sie kamen jedoch schon im folgenden Jahr wieder, diesmal verstärkt.
Der russische Angriff während des Finnischen Krieges 1808/09 gegen das wehrlose Åland begann am 27. März 1808, als ein Jagdbataillon den Skiftet auf dem Eis überquerte, um nach der Eroberung Turkus über Brändö auf das åländische Festland zu gelangen. Der Plan war, die schwedischen Beziehungen zur Front im Südwesten Finnlands zu unterbrechen. Nach der Übernahme durch die Russen wuchs die Unzufriedenheit unter den Åländern, unter anderem wegen der unmöglichen russischen Forderungen, Boote in segelfähigem Zustand zu liefern. Dies führte zu einem Bauernaufstand gegen die russischen Eroberer, der am 19. März 1808 im Gemeindehaus von Jomala begann und als åländischer Aufstand bekannt wurde. Das Heer der Bauern und Fischer wurde von dem Landrat Eric Arén und dem Hilfspfarrer Johan Henrik Gummerus angeführt. Am 6. Mai traf eine 73 Mann starke schwedische Truppe auf Föglö ein, und am folgenden Tag begannen die Schweden eine Blockade der russischen Truppen auf Kumlinge. Der Aufstand gipfelte am 10. Mai in der Schlacht von Kumlinge, in der die schwedische Armee und das åländische Bauernheer landeten und die Russen im Kloster Kumlinge gefangen nahmen. Am nächsten Tag geschah das Gleiche auf Brändö.
Schweden besetzte daraufhin Åland nach und nach mit einer Gesamtstärke von etwa 3.000 Mann, und König Gustav IV. Adolf traf im Juli auf Åland ein. Ende Oktober segelte die Schärenflotte wieder nach Stockholm und ließ nur eine kleine Flottille für die Verteidigung von Åland zurück, die später in Degerby eingefroren wurde. Anfang November verließ der König Åland, nachdem er angeordnet hatte, dass die östlichen Schären mit Kumlinge und Brändö geräumt und alle Gebäude außer Kirchen und Mühlen wegen der Gefahr russischer Angriffe im Winter abgerissen werden sollten. Die Evakuierung war erst Ende Januar 1809 abgeschlossen, als die Bewohner und das Vieh das Eis überqueren mussten und die restlichen Gebäude niedergebrannt wurden. Georg Carl von Döbeln traf im Februar in Jomala ein und übernahm die Verteidigung von Åland. von Döbeln bereitete die Verteidigung für den erwarteten russischen Angriff vor, einschließlich einer optischen Telegrafenlinie nach Stockholm. Lebensmittel und Platz waren Mangelware. Vor dem russischen Angriff im März bestand die Truppe aus 7.200 Mann, und die versprochene Verstärkung für die Åland-Verteidigung kam nicht zustande. Der kritisierte Befehl Gustav IV. Adolfs lautete, dass Åland um jeden Preis zu verteidigen sei. Von Döbeln erhielt am 11. März Informationen über den bevorstehenden russischen Angriff. Am 13. März wurde Gustav IV. Adolf in einem unblutigen Staatsstreich abgesetzt und von Herzog Karl als Reichsstatthalter abgelöst, der von Döbeln anwies, sich auf das schwedische Festland zurückzuziehen, falls Åland nicht verteidigt werden könne.
Am 14. März begann der russische Hauptangriff auf Åland mit einem russischen Marsch über den Skiftet. Die åländischen Verteidigungsanlagen wurden zu ständigen Rückzügen gezwungen, und zwei Tage später hatten die Schweden das åländische Festland fast geräumt. Am nächsten Tag marschierten die schwedischen Truppen über das Eis nach Grisslehamn. von Döbeln schrieb an den russischen Oberbefehlshaber, dass Schweden Frieden unter der Bedingung anbiete, dass russische Truppen nicht schwedischen Boden betreten, was nicht stimmte. von Döbeln tat dies, um Schweden vor einer Invasion zu schützen. Wahrscheinlich waren es vor allem die Risiken, die eine russische Invasion über das Eis verhinderten. Im Juni 1809 verfügte Russland auf den Åland-Inseln über insgesamt mehr als 10.000 Soldaten. Mit dem Frieden von Fredrikshamn (Hamina) am 17. Oktober 1809 kam Åland usammen mit Festland-Finnland an das russische Zarenreich und wurde Teil des autonomen Großherzogtums Finnland.
Die neuen Landesherren machten sich daran, Åland zu einem Posten am Rande ihres Reiches auszubauen. 1828 wurde in Eckerö ein Post- und Zollgebäude eingerichtet, 1829 begannen die Bauarbeiten an der Festung von Bomarsund. 1835 entstand in Godby eine Hochschule für Seefahrt, und auch sonst wurde die Infrastruktur des Landes gestärkt. In dieser Situation wurde die Inselgruppe 1854 jedoch erneut in einen Krieg hineingezogen. Im Zuge des Krimkrieges eroberte und zerstörte eine englisch-französische Flotte Bomarsund. Bei den Pariser Friedensverhandlungen 1856 verlangte Schweden die Rückgabe Ålands. Das erreichten sie zwar nicht, doch verpflichtete sich Russland, die Inselgruppe nicht zu befestigen. Es war dies der Beginn einer nachhaltigen Demilitarisierung, die lediglich im Ersten Weltkrieg kurz unterbrochen wurde.
Unterdessen befuhr 1856 das erste åländische Schiff den Atlantik, und Åland entwickelte sich allmählich zu einem wichtigen wirtschaftlichen Faktor im Ostseeraum. 1861 entstand nach russischen Plänen die Stadt Mariehamn - bis heute die einzige Stadt des Landes. Die Ruhe der Schärenwelt zog immer wieder Gäste an. 1886 entstand die Künstlerkolonie Önningeby um Victor Westerholm, und 1889 kamen mit der Eröffnung einer Badeanstalt in Mariehamn die ersten Touristen nach Åland.
1891 wurde das junge Mariehamn zur Hauptstadt Ålands. Im gleichen Jahr erschien die erste åländische Zeitung, und 1895 eröffneten die Åländer ihre erste Volkshochschule. Die russischen Landesherren ließen den Bewohnern der Inselgruppe einige Freiheiten und wollten es im sich abzeichnenden Unabhängigkeitskampf Finnlands nicht so einfach aus der Hand geben. 1915 landeten russische Truppen auf den demilitarisierten Inseln und begannen sich hier einzurichten.
Finnische Ära
Nach der Unabhängigkeitserklärung Finnlands im Jahre 1917 gehörte Åland als Teil des bisherigen Großherzogtums zur neugegründeten finnischen Republik. Allerdings wurde der Archipel sogleich in die Wirren des finnischen Bürgerkrieges hineingezogen. Die russische Rote Armee trat in Åland mit sichtbar zur Schau getragener Macht auf. Dies hatte zur Folge, dass in Åland offen über einen Anschluss an Schweden nachgedacht wurde. In einem geheimen Treffen verlangten åländische Gemeindevertreter am 20. August 1917 eine Wiedervereinigung mit dem benachbarten Königreich. Zu diesem Zweck wurde unter anderem eine von 7135 Einwohnern unterzeichnete Adresse an Schweden überreicht. Während des Bürgerkrieges im Jahr 1918 entsandte Schweden eine durch deutsche Einheiten verstärkte Militärtruppe nach Åland - mit der offiziellen Mission, die Zivilisten auf Åland zu schützen, aber allem Anschein nach auch zur Vorbereitung eines Anschlusses der Inseln an das Reich. Die Truppen wurden aber von deutschen Truppen von den Inseln verdrängt, als diese entscheidend in den Bürgerkrieg eingriffen.
1919 verhandelten drei åländische Gesandte bei der Friedenskonferenz von Paris über die Zukunft der Inselgruppe mit. Deren Bewohner jedenfalls entwickelten eine optimistische Aufbruchsstimmung. Noch im selben Jahr wurde die Ålandsbank gegründet. Anfang 1920 akzeptierte das Parlament Finnlands die Autonomie der Inselgruppe, doch nahmen finnische Behörden Kämpfer für ein unabhängiges Åland vorsorglich in Haft. Die Åland-Frage wurde schließlich im Frühjahr 1920 auf Initiative des Vereinigten Königreiches dem Rat des Völkerbundes zur Entscheidung vorgelegt. Nach dessen am 24. Juni 1921 ergangener Entscheidung sollten die Inseln entgegen dem Wunsch der Mehrheit der Ålander im Staatsverbund Finnlands verbleiben. Jedoch seien zur Sicherung der Nationalität, der Sprache und der Kultur der schwedischsprachigen Bevölkerung der Inseln verschiedene Garantien zu geben. Finnland akzeptierte die Bedingungen und setzte diese als Ergänzungen zu der bereits 1920 gewährten weitgehenden Selbstverwaltung in Kraft. Im Oktober 1921 wurde in Genf ein Vertrag über die Demilitarisierung und Neutralität Ålands geschlossen. Die Befestigungen auf der Insel waren schon 1919 abgebaut worden.
Selbstverwaltungsära
Am 8. Mai 1922 fanden in Åland die ersten Wahlen statt, und am 9. Juni 1922 trat das åländische Parlament, was damals noch Landsting - heute Lagting - hieß, zu seiner ersten Plenarsitzung zusammen. Der 9. Juni ist seither åländischer Nationalfeiertag. Das am 10. Juli verabschiedete Selbstverwaltungsgesetz sicherte der Inselgruppe weitgehende Autonomie zu. Und die wurde mit allem Nachdruck verteidigt, wann immer sich eine der in die politischen Entscheidungsfindungen einbezogenen Mächte - Finnland oder Schweden - daran machte, die Eigenrechte zu beschneiden. So kam es 1938 zu heftigen Protesten gegen schwedisch-finnische Pläne einer neuerlichen Militarisierung Ålands. Und sie hatten Erfolg. 1939 beschlossen die Schweden und Finnland, den demilitarisierten Archipel gemeinsam zu verteidigen. Gegen die geballte Übermacht Nazi-Deutschlands kamen sie jedoch nicht an. 1941 ließen sich deutschen Truppen in Åland nieder und errichteten hier, ohne viel zu fragen, Befestigungsanlagen. Die Nazi-Besatzung dauerte bis 1944, als sowjetische Truppen die Inselgruppe eroberten. Mitte 1945 übergaben sie Åland wieder der Republik Finnland.
Am 28. Dezember 1951 wurde das Selbstverwaltungsrecht erweitert, in dessen Rahmen eine Art åländischer Staatsbürgerschaft eingeführt wird. Am 3. April 1954 erhielt Åland seine eigene Flagge, welche die historischen Beziehungen zu Schweden darstellt: ein rotes Kreuz auf gelbem Kreuz mit blauem Hintergrund. Der blaue Hintergrund mit gelbem Kreuz stellt die schwedische Flagge dar, das rote Kreuz auf dem gelben Kreuz stellt die alten schwedischen Farben für Finnland dar (Farben des finnischen Wappenlöwen). Åland hat seit 1984 eigene Briefmarken und seit 1993 seine eigene Postverwaltung.
Unterdessen wurde 1959 die erste tägliche Fährverbindung nach Schweden eröffnet. 1970 erhielt Åland einen eigenen Sitz im Nordischen Rat, und 1980 wurde das Gebäude der åländischen Selbstverwaltung eingeweiht. 1984 nahm der åländische Rundfunk seine Sendearbeit auf. 1988 regelte ein Zusatz zum Landskapsstyrelse die weitere eigenständige parlamentarische Arbeit, und am 16. August 1991 wurde das Autonomieabkommen erweitert. Das dritte Autonomiestatut trat 1993 in Kraft, und 1995 wurde die Inselgruppe gemeinsam mit Finnland Mitglied der Europäischen Union. Ebenfalls gemeinsam mit Finnland führten die Åländer 2002 den Euro als neue Währung ein und erneuerten 2004 noch einmal ihr Autonomiestatut. Die große Mehrzahl der Einwohner Ålands verhält sich gegenüber dem finnischen Hauptland weiterhin deutlich distanziert, doch ist man mit dem geltenden Autonomiestatus in der Regel zufrieden.
Intern kamen unterdessen immer mehr ökologische Themen aufs Tapet. 1993 wurde die Gemeinde Sund zum ersten Nationalpark Ålands, und Pläne zur Entwicklung eines umweltverträglichen Tourismus fanden breiten Anklang. 1997 erhielt Eckerö den Titel einer finnischen Jahresfremdenverkehrsgemeinde. Im Jahr zuvor entstand die Rundfunkgesellschaft Ålands Radio och TV.
Zu Beginn der Coronazeit forderten die Behörden in Åland dringend dazu auf, nicht notwendige Reisen zwischen dem finnischen Festland und den Inseln zu unterlassen. Wer trotzdem aus Finnland anreiste, musste eine vierzehntägige Quarantäne absolvieren. Diese Einschränkungen führten zu einem dramatischen Einbruch im Tourismus – einer Hauptsäule der lokalen Wirtschaft –, da der Großteil der Besucher aus Finnland kommt.
Die lokale Regierung nutzte die Zeit, um unter dem Leitmotiv Everyone Can Flourish („Jeder kann aufblühen“) „gesellschaftliche Resilienz zu stärken und kreative Ansätze für individuelle und kollektive Gesundheit umzusetzen“. Dies ging einher mit der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG). Die Erfahrungen während der Pandemie haben gesellschaftliche und wirtschaftliche Schwächen, aber auch Stärken deutlich gemacht. Gesundheitsbewusstsein, nachhaltige Entwicklung und sozialer Zusammenhalt wurden, so zumindest der Tenor der Nachberichterstattung, gefestigt.
Chronologie:
um -8000 Die höchsten Teile der Åland-Inseln ragen über die Meeresoberfläche
um -5000 Von Osten her ziehen nomadisierende Jäger und Fischer auf die Åland-Inseln; sie sind Träger der so genannten Kammkeramischen Kultur
um -3300 Von Westen her dringen Menschen nach Åland vor, die der Muldenkeramischen Kultur angehören, Jagd, Fischfang sowie primitiven Ackerbau betreiben underste feste Niederlassungen gründen
um -1500 Neue Einwanderer betreiben Schiffbau und errichten Hügelgräber
um -400 Eine massive Klimaverschlechterung führt zu Massenauswanderung
4./5. Jh. Neuerliche Zuwanderung von Westen her
nach 500 Rasches Bevölkerungswachstum, vor allem auf der Hauptinsel
9./10. Jh. Dichte Besiedlung auf der Hauptinsel, weitreichende Handelsverbindungen vom Norden Skandinaviens bis zum deutschen Ostseeraum bestehen
um 1000 Beginnende Christianisierung
13. Jh. Errichtung zahlreicher Kirchen; in einem Dokument über Schifffahrtslinien in der Ostsee werden erstmals die Åland-Inseln erwähnt
1249 Die Inselgruppe wird ein Teil des Königreichs Schweden
1309 Åland wird Teil des Bezirks und der Diözese Åbo
1388 Urkundliche Ersterwähnung des Schlosses Kastelholm
1442 Verlust der Handelsfreiheit
1472 Urkundliche Ersterwähnung des Klosters Kökar
1507 Dänische Truppen unter Sören Norrby zerstören Schloss Kastelholm
1521/23 Schweden und Dänen kämpfen um die Herrschaft über Åland
1556 Herzog Johan von Schweden erhält die Inselgruppe samt Åboland als Lehen
1571 Eric XIV. von Schweden und Karin Månsdotter werden auf Kastelholm interniert
13.11.1621 Die Inselgruppe wird schwedische Kronbesitzung
1634 Åland wird mit den Provinzen Åbo und Björneborg vereinigt
1638 Åland übernimmt eine Mittlerfunktion im Postverkehr zwischen Schweden und Finnland
1639 In Saltvik entsteht die erste åländische Unterrrichtsanstalt, Ålands Pedagogi
1652 In Föglö wird das erste Krankenhaus Ålands errichtet
1714 Russische Truppen besetzen und verwüsten die Åland-Inseln
1718 Die Friedensverhandlungen zwischen Russland und Schweden in Lövö (Vårdö) werden ergebnislos abgebrochen
1721 Mit dem Frieden von Nystad endet der Krieg um Åland
1742/43 Russische Truppen besetzen neuerlich die Inselgruppe
1765 Den åländischen Bauern wird das Recht auf freien Verkauf ihrer Produkte zugestanden
1795 F.W. Radloff veröffentlicht einen viel beachteten Reisebericht über Åland
1796 In Grisslehamn und Signildskär wird ein optischen Telegrafensystem eingerichtet
1808 Russische Truppen setzen sich in Kumlinge fest, werden jedoch von aufständischen Bauern vertrieben
1809 Eine verstärkte russische Armee erobert die Inselgruppe
17.9.1809 Die Inselguppe wird Teil des russischen Großherzogtums Finnland
1828 Fertigstellung des Post- und Zollgebäudes von Eckerö
1829 Beginn der Bauarbeiten an der Festung von Bomarsund
1835 In Godby wird eine Hochschule für Seefahrt gegründet
1854 Eine englisch-französische Flotte erobert und zerstört Bomarsund
1856 Bei den Pariser Friedensverhandlungen verlangt Schweden die Rückgabe Ålands; das erste åländische Schiff fährt über den Atlantik
1861 Gründung der Stadt Mariehamn nach russischen Plänen
1886 Gründung der Künstlerkolonie Önningeby um Victor Westerholm
1889 Mit der Eröffnung einer Badeanstalt in Mariehamn kommen die ersten Touristen nach Åland
1891 Mariehamn wird Hauptstadt Ålands; die erste åländische Zeitung erscheint
1895 Eröffnung der åländischen Volkshochschule
1915 Russische Truppen landen auf den demilitarisierten Inseln
20.8.1917 In einem geheimen Treffen verlangen åländische Gemeindevertreter eine Wiedervereinigung mit Schweden
1918 Nach Kämpfen zwischen Rot- und Weißgardisten auf der Inselgruppe intervenieren schwedische und deutsche Truppen
1919 Drei åländische Gesandte verhandeln bei der Friedenskonferenz von Paris über die Zukunft der Inselgruppe mit; Gründung der Ålandsbank
1920 Das Parlament Finnlands akzeptiert die Autonomie Ålands; Kämpfer für ein unabhängiges Åland werden von finnischen Behörden verhaftet
24.6.1921 Per Völkerbundsentscheid wird Åland Finnland zugesprochen
8.5.1922 Erste Wahl zum åländischen Landstring
9.6.1922 Erste Sitzung des åländischen Landstings
10.7.1922 Das Selbstverwaltungsgesetz sichert Åland weitgehende Autonomie zu
1938 Heftige Proteste der Åländer gegen schwedisch-finnische Pläne zur Militarisierung der Inselgruppe
1939 Schweden und Finnland kommen überein, das nunmeghr demilitarisierte Åland gemeinsam zu verteidigen
1941 NS-Besatzer errichten auf Åland Befestigungsanlagen
1944 Eroberung der Inselgruppe durch sowjetische Truppen
28.12.1951 Erweiterung des Selbstverwaltungsrechts, in dessen Rahmen eine Art åländischer Staatsbürgerschaft eingeführt wird
7.4.1954 Åland erhält eine eigene Flagge
1959 Eröffnung der Autofährverbindung mit Schweden
1970 Åland erhält einen eigenen Sitz im Nordischen Rat
1980 Einweihung des Gebäudes der åländischen Selbstverwaltung
1984 Prägung eigener åländischer Briefmarken
1988 Ein Zusatz zum Landskapsstyrelse bildet die Basis die weitere parlamentarische Arbeit
16.8.1991 Erneuerung des Autonomieabkommens
1993 Inkrafttreten des dritten Autonomiestatuts; die Gemeinde Sund wird Nationalpark
1995 Åland wird als autonomer Teil Finnlands Mitglied der EU
1996 Gründung der Rundfunkgesellschaft Ålands Radio och TV
1997 Eckerö wird finnische Jahresfremdenverkehrsgemeinde
2002 Einführung des Euro als neue Währung
2004 Erneuerung des Selbstverwaltungsgesetzes
2005 Air Åland nimmt den Flugverkehr nach Helsinki und Stockholm auf
Verwaltung
Åland ist eine seit dem Mittelalter zwischen Schweden, Russland und Finnland umstrittene Inselgruppe in der Ostsee. Um 1154 wurde die Inselgruppe zunächst ein Teil Schwedens. 1556 erhielt es eine eigene feudale Herrschaft. Am 13. November 1621 erhielt Aaland den Status ein Kronbesitzung. Von 27. Juni 1714 bis 30. August 1721, dann wieder von August 1742 bis 17. August 1743, erneut von 24. März 1808 bis 13. März 1809 und schließlich von 21. April bis 17. September 1809 war Aaland russisch besetzt. Anschließend wurde es Teil des russischen Großherzogtums Finnland. Im August und September 1854 war die Inselgruppe von Briten und Franzosen besetzt. Am 20. August begann die Volksbewegung zur Wiedervereinigung mit Schweden. Am 6. Dezember 1917 wurde die Inselgruppe jedoch ein Teil des unabhängigen Finnland. Von Februar bis 13. Juni 1918 besetzten die Schweden das Gebiet, ehe der Völkerbund am 24. Juni 1921 die Inselgruppe endgültig Finnland zusprach.
Seit 1920, offiziell seit 9. Juni 1922 ist Åland ein autonom län bzw. eine autonom landskap (autonome Provinz) im Gefüge der Republik Finnland. Damals erhielt Finnland die Souveränität über die Åland-Inseln, musste sich aber verpflichten, der åländischen Bevölkerung zu garantieren, dass die schwedische Sprache, Kultur, die örtlichen Gebräuche und das Selbstverwaltungssystem, das Finnland 1920 Åland angeboten hatte, zu erhalten. Der Beschluss wurde durch eine Übereinkunft zwischen Finnland und Schweden ergänzt, wo man festhält, wie diese Garantien verwirklicht werden sollen. Gleichzeitig beschloss der Verband der Nationen, dass eine Übereinkunft über die Demilitarisierung und Neutralität von Åland getroffen werden soll, damit Åland in Zukunft keine militärische Gefahr für Schweden ausmachen könne. Am 28. Dezember 1951 und noch einmal am 16. August 1991 wurde die Autonomie bekräftigt. Am 1. Januar 1993 trat eine erweiterte Autonomie in Kraft.
Herrschaftsgeschichte
- um 730 bis 1120 Wikinger-Gemeinschaften
- 1120 bis 1249 Diözese Liköping (Linköpings stift)
- 1249 bis 1556 Königreich Schweden (Konungariket Sverige)
- 1556 bis 13. November 1621 Lehensgebiet des Königreichs Schweden (Konungariket Sverige)
- 13. November 1621 bis 29. Juli 1634 Kronbesitzung des Königreichs Schweden (Konungariket Sverige)
- 29. Juli 1624 bis 27. Juni 1714 Provinz Björneborg (Björneborgs län) des Königreichs Schweden (Konungariket Sverige)
- 27. Juni 1714 bis 30. August 1721 Zarentum Russland (Russkoje zarstwo)
- 30. August 1721 bis August 1742 Provinz Björneborg (Björneborgs län) des Königreichs Schweden (Konungariket Sverige)
- August 1742 bis 17. August 1743 Russisches Kaiserreich (Rossijskaja Imperija)
- 17. August 1743 bis 22. März 1808 Provinz Björneborg (Björneborgs län) des Königreichs Schweden (Konungariket Sverige)
- 22. März bis Mai 1808 Russisches Kaiserreich (Rossijskaja Imperija)
- Mai 1808 bis 17. März 1809 Königreich Schweden (Konungariket Sverige)
- 21. April 1809 bis 6. Dezember 1917 Russisches Kaiserreich (Rossijskaja Imperija)
- 6. Dezember 1917 bis 9. Juni 1922 Provinz Aaland (Ahvenanman lääni) der Republik Finnland (Suomen tasavalta)
- seit 9. Juni 1922 Landschaft Aaland (Landskapet Åland / Ahvenanmaan maakunta) der Republik Finnland (Suomen tasavalta)
Verfassung
Das Selbstverwaltungsrecht Ålands ist in § 120 der finnischen Verfassung verankert. Die Einzelheiten sind in einem eigenen Selbstverwaltungsgesetz geregelt, das zuletzt am 16. August 1991 erneuert wurde - mit Ergänzungen vom 31. Dezember 1994 und 12. Juli 1996.
Das Åland-Parlament (Lagting) hat das Recht, Gesetze in Angelegenheiten der inneren Verwaltung, des örtlichen Wirtschaftslebens, der Sozialfürsorge sowie der inneren Ordnung zu erlassen. Dazu gehören lokale Regelungen zur öffentlichen Ordnung, aber nicht das gesamte Straf- oder Zivilrecht.
Das åländische Hembygdsrätt (deutsch ungefähr „Heimatrecht“) ist ein Status, der die dauerhafte Einwohnerschaft der autonomen Inselgruppe Åland dokumentiert. Es kann nur finnischen Staatsbürgern zugeteilt werden und erfüllt eine Funktion ähnlich einer Staatsbürgerschaft. Bestimmte Rechte sind auf Åland ausschließlich Inhabern des Hembygdsrätt vorbehalten.
Die Einwohner Ålands sind seit jeher schwedischsprachig, und die Inseln gehörten bis 1809 auch zu Schweden, aber waren administrativ dem damals auch noch zu Schweden gehörenden Finnland zugeteilt. Im Rahmen des Vertrages von Fredrikshamn wurde Finnland an Russland abgetreten, wodurch die Inseln ein Teil des Großfürstentums Finnland unter russischer Hoheit wurden. Nach der Unabhängigkeit Finnlands 1917 gab es starke Bestrebungen der åländer Bevölkerung, wieder Teil Schwedens zu werden. 1921 entschied schließlich der Völkerbund die Frage: Åland verblieb im finnischen Staatsverbund, erhielt aber weitgehende Autonomierechte, insbesondere zur Erhaltung der schwedischen Sprache auf Åland, und wurde demilitarisiert.
Das Hembygdsrätt formalisiert die sich daraus ergebenden Besonderheiten, die sich nur auf die dauerhafte Bevölkerung Ålands erstrecken und die Selbstverwaltung der Åländer garantieren sollen.
Auf Åland sind bestimmte Rechte an das Hembygdsrätt gebunden, die auch anderen finnischen Staatsbürgern verwehrt bleiben. Diese umfassen:
- Das passive und aktive Wahlrecht zum Lagting. Inhaber des Hembygdsrätt dürfen in jedem Fall auch bei der Kommunalwahl ihres Wohnorts wählen, während andere Einwohner mindestens ein Jahr lang in der Kommune gewohnt haben müssen.
- Das Recht auf Landbesitz auf Åland. Ausnahmen gibt es für nahe Angehörige, die Land auf Åland erben. Für die Ausübung eines Gewerbes kann in bestimmten Fällen auch Land erworben werden.
- Das Recht, ein Gewerbe zu betreiben. Dies kann jedoch auch in anderen Fällen zugeteilt werden, unter anderem an Personen, die schon seit 5 Jahren auf Åland leben.
Durch den demilitarisierten Status der Inseln sind Inhaber des Heimatrechts auch von der Wehrpflicht ausgenommen, sofern sie vor Vollendung des 12. Lebensjahres auf Åland gelebt haben. Jedoch kann eine Dienstpflicht als Lotse, Leuchtturmwärter oder in anderen zivilen Einrichtungen eingeführt werden. Das Hembygdsrätt kann nur finnischen Staatsbürgern erteilt werden. Es steht automatisch folgenden Personengruppen zu:
- Personen, die im Jahr 1952 seit mindestens 5 Jahren auf Åland wohnhaft waren
- Minderjährigen, bei denen ein Elternteil das Hembygdsrätt hat
Andere Berechtigte erhalten das Recht auf Antrag. Neben der finnischen Staatsbürgerschaft ist auch eine ausreichende Kenntnis der schwedischen Sprache immer eine Voraussetzung. Je nach weiteren Kriterien muss der Antragsteller eine bestimmte Zeit auf Åland wohnhaft gewesen sein, wenn er das Hembygdsrätt beantragen will:
- Ohne Wartezeit bei Personen, die dauerhaft nach Åland zurückkehren und auf Åland geboren und aufgewachsen sind.
- 3 Jahre bei Personen, die mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen: früherer Besitz des Hembygdsrätt, ein Elternteil hat das Hembygdsrätt oder hatte es früher einmal und früher schon einmal fünf Jahre auf Åland wohnhaft gewesen
- 5 Jahre für alle übrigen Personen
Bei Vorstrafen des Antragstellers kann eine längere Wartezeit bestimmt werden. Der Antrag ist gebührenpflichtig, wobei die Wiedererlangung des Hembygdrätts zu einer reduzierten Gebühr durchgeführt wird.
Der Verlust des Rechts tritt bei Verlust der finnischen Staatsbürgerschaft sowie bei dauerhaftem Wegzug aus Åland ein, derzeit nach 5 Jahren.
Legislative
Für die Beschlussfassung in Selbstverwaltungsangelegenheiten verfügt Aaland über ein eigenes Parlament, den Lagting (Landtag) sowie eine eigene Landskapsregeringen (Landschaftsregierung). Diese kann höchstens aus acht Mitgliedern bestehen und mit dem Lantråd (Regierungspräsident) als Vorsitzendem. Im Jahr 2004 wurde das Selbstverwaltungsgesetz erneuert und in diesem Zusammenhang der Name der Regierung geändert: Ålands landskapsstyrelse heißt nun Ålands landskapsregering. Aus Ålands Landschaftsregierung wird Regierung der Landschaft Åland.
Die Regierung wird vom Parlament, dem Lagting, gemäß parlamentarischen Grundsätzen, nach Verhandlungen zwischen den politischen Gruppen ausgewählt. Das Ziel bei den Verhandlungen ist, dass die Regierung eine so große Majorität wie möglich hat, aber auch Minoritätsregierungen sind erlaubt. Der Landtag wird alle vier Jahre in allgemeinen Wahlen gewählt. Die Landschaftsregierung wird vom Landtag ernannt. Als Verbindungsorgan zwischen der nationalen Regierung und der autonomen Provinz fungiert eine Ålandsdelegation (Aalandabordnung). Dieser sitzt der landshövding (Landherr) vor, der vom finnischen Präsidenten im Einvernehmen mit dem Landtag ernannt wird. Die finnische Regierung sowie der åländische Landtag entsenden jeweils zwei weitere Mitglieder.
Der Landtag besitzt in Angelegenheiten, die der Selbstverwaltung zufallen, eine eigenständige Gesetzgebungskompetenz. Zu diesen Angelegenheiten gehören praktisch alle Regelungen der Verwaltung, des örtlichen Wirtschaftslebens, der Sozialfürsorge und der inneren Ordnung. Beim finnischen Staat verbleiben die Kompetenzen in der Außenpolitik, der größte Teil des Zivil- und Strafrechts, die Organisation der Gerichte sowie Zoll- und Steuerangelegenheiten.
Inseloberhaupt
Oberste Verwalter und Regierungschefs des Landes waren bis 1918 zivile und militärische Gouverneure, seit 1922 sind es eigenständige Regierungspräsidenten.
Milistarisk Kommandanter (Militärgouverneure)
- 27 Jul 1714 - 30 Aug 1721 Fyodor Matveyevich Apraksin (1671 - 1728)
- Aug 1742 - 17 Aug 1743 Pytor Lassy
- 1808 - 1809 Prinz Pytor Ivanovich Bagration (1765 - 1812)
- Aug - Sep 1854 Sir Charles Napier [Großbritannien] (1786 - 1860)
- Feb 1918 Hugo, Greve Hamilton [Schweden]
- 13 Feb 1918 - Mai 1918 Carl August, Greve Ehrensvärd [Schweden] (Kommandant des Expeditionskorps, 1858 - 1944)
- 6 Mar - 2 Mai 1918 Hugo Karl August Meurer [Deutschland] (1869 - 1960)
Landshövding (Gouverneur)
- 1808 - 1809 Otto Reinhold Meurman [amtierend] (1750 - 1814)
Kronofogder (Kronverwalter)
- 1634 - 1650 Stephan Hansson Schoeder († 1655)
- 1650 - 1653 Johan Johansson
- 1653 - 1656 Albrecht Behm
- 1656 - 1657 Christopher Bylow
- 1657 - 1660 Olof Evertsson Håger
- 1660 - 1664 Nils Sigfridsson Wast
- 1665 - 1675 Erland Andersson Törn († 1690)
- 1675 - 1685 Jacob Rusk
- 1685 - 1694 Nicolaus Lundius
- 1695 - 1696 Johan Höök
- 1696 - 1698 Leonard Collin
- 1698 - 1714 Wilhelm Pihl (1660 - 1741)
- 1714? - 1722? Bengt Andorin (während der russischen Okkupation)
- 1722 - 1729 Wilhelm Pihl [2]
- 1729 - 23 Nov 1749 Sven Colléen (1688 - 1749)
- Jun 1743 - 16 Jun 1743 Johan Wialenius
- 1751 - 1774 Daniel Mansnerus (1712 - 1776)
- 1774 - 1781 Hans Löfman
- 1781 - 1802 Lars Jung († 1802)
- 1802 - 1811? Erik Johan Eriksson Taxell (1763 - 1841)
- 1811 - 1817 Israel Wallin (1777 - 1839)
- 13 Mai 1817 - 24 Jan 1832 Samuel Gabriel Crusell (1786 - 1832)
- 1832 - 20 Jul 1853 Adolf Fredrik von Willebrand (1796 - 1853)
- 1853 - 17 Dez 1880 Karl Oskar Lignell (1815 - 1880)
- 1881 - 16 Jun 1890 Johan Frithiof Salvén (1836 - 1890)
- 1890 - 22 Jan 1896 Alexander Stefanus Träskelin (1854 - 1896)
- 1896 - 1897 Thure Severin Granberg (1861 - 1928)
- 1898 - 13 Jul 1906 Reinhold Waldemar Blomqvist (1845 - 1906)
- 1906 - 1913 Johan Axel Bergroth (1862 - 1923)
- 1913 - 1915 Robert Optatus Silander (1861 - 1917)
- 1915 - 1916 Karl Fredrik Nummelin (1881 - 1916)
- 1917 Aarne Nyström Inha (1885 - 1921)
- 1917 - 17 Sep 1917 Robert Optatus Silander [2]
- 1917 - 1918 Emil Walter Johansson (1885 - 1960)
Landshövdinger (Gouverneure)
- 8 Feb - Apr 1918 Rudolf Wilhelm Österman (1890 - 1918)
- 9 Mar - 13 Jun 1918 Hjalmar von Bonsdorff [amtierend] (1869 - 1945)
- 13 Jun 1918 - 17 Okt 1922 William Isaksson (1866 - 1924)
- 17 Okt 1922 - 1 Jan 1938 Wilhelm Fagerlund (1852 - 1939)
- 1 Jan - 3 Nov 1938 Torsten Rothberg (1884 - 1938)
- 3 Nov - 21 Dez 1938 Walter Johansson [amtierend] (1885 - 1960)
- 21 Nov 1938 - 1 Mai 1945 Ruben Österberg (1895 - 1959)
- 14 Mai 1945 - 1 Jan 1954 Herman Koroleff (1883 - 1957)
- 1 Jan 1954 - 1 Jul 1972 Tor Brenning (1903 - 1983)
- 1 Jul 1972 - 1 Okt 1982 Martin Isaksson (1921 - 2001)
- 1 Okt 1982 - 1 Apr 1999 Henrik Gustafsson (* 1934)
- 1 Apr 1999 - 1 Apr 2023 Rolf Peter Lindbäck (* 1955)
- seit 1 Apr 2023 Marine Holm-Johansson [w] (* 1964)
Ledare av den Folkrörelse för Återförening med Svenska (Führer der Bewegung zur Wiedervereinigung mit Schweden)
- 1917 - 1919 Julius Sundblom (1865 - 1945)
Talman (Landtagssprecher)
- 9 Jun - 10 Jul 1922 Julius Sundblom [wieder eingesetzt]
Lantråder (Regierungspräsidenten)
- 10 Jul 1922 - 30 Dez 1938 Carl Björkman (1873 - 1948)
- 30 Dez 1938 - 1 Jan 1955 Victor Strandfeldt (1897 - 1962)
- 1 Jan 1955 - 28 Mar 1967 Hugo Valdemar Johansson (1900 - 1983)
- 28 Mar 1967 - 1 Jul 1972 Martin Isaksson
- 1 Jul 1972 - 1 Jan 1979 Alarik Häggblom (1914 - 1996) LPA
- 1 Jan 1979 - 20 Apr 1988 Folke Woivalin (* 1928)
- 20 Apr 1988 - 28 Nov 1991 Sune Eriksson (* 1939) LPA
- 28 Nov 1991 - 24 Nov 1995 Ragnar Erlandsson (* 1941) AC
- 24 Nov 1995 - 3 Dez 1999 Roger Jansson (* 1943) AC
- 3 Dez 1999 - 26 Nov 2007 Roger Nordlund (* 1957) AC
- 26 Nov 2007 - 25 Nov 2011 Viveka Eriksson [w] (* 1956) LpA
- 25 Nov 2011 - 25 Nov 2015 Camilla Gunell [w] (* 1970) AS
- 25 Nov 2015 - 10 Dez 2019 Katrin Sjögren [w] (* 1966) LpA
- 10 Dez 2019 - 11 Dez 2023 Veronica Thörnroos [w] (* 1962) AC
- seit 11 Dez 2023 Katrin Sjögren [w, 2] LpA
Regierung
Die aaländische Landesregierung hat neben Regierungspräsidentin und deren Stellvetreterin fünf Minister für die laut Autonomie-Vertrag eigenverantwortlich zu verwaltenden Bereiche.
Landskapregering (Landesregierung, ab Dezember 2019):
- Lantråd Veronica Thörnroos, Minister för lagberedningen
- Vicelantråd Harry Jansson, Minister för regeringskansliet
- Roger Höglund - Minister för finansavdelningen
- Annette Holmberg-Jansson - Minister för social- och miljöavdelningen
- Annika Hambrudd - Minister för utbildnings- och kulturavdelningen
- Fredrik Karlström - Minister för näringsavdelningen
- Alfons Röblom - Utvecklingsminister med ansvar för miljö-, energi-, plan-, bygg- och bostadsfrågor
- Christian Wikström - Minister för infrastrukturavdelningen
Politische Gruppierungen und Wahlen
Die in Åland tätigen politischen Parteien sind organisatorisch völlig unabhängig von den im übrigen Finnland tätigen Gruppierungen. Zu den meisten finnischen Parteien gibt es allerdings gleichnamige Entsprechungen in Åland, die den finnischen Parteien ideologisch nahestehen.
Politische Gruppierungen
- ÅD = Åländsk Demokrati (Aaländische Demokratie, nationalistisch, gegründet 2015)
- ÅF = Ålands Framtid (Future of Aland / Aalands Zukunft, nationalistisch, aktiv seit 2003)
- ÅFG = Ålands Framstegsgrupp (Aland Progress Group / Aalands Fortschrittspartei, links liberal, aktiv von 1995 bis 2007)
- ÅSD oder SOC = Ålands Socialdemokrater (Aland Social Democrats / Aalands Sozialdemokratische Partei, sozialdemokratisch, gegründet 1971 als politischer Flügel der ab 1906 entstandenen Arbeiterorganisationen)
- ÅV = Åländsk Vänster (Alandic Left / Aalands Linke, sozialistisch, aktiv von 1979 bis 1987)
- C = Åländsk Center (Aland Center / Aalands Zentrumspratei, agrarisch-liberal, gegründet 1976)
- FÅ = Fria Åland (Free Aland / Freiheit für Aaland, separatistisch, aktiv 1987)
- FS = Frisinnad Samverkan (Freeminded Co-operation / Freisinnige Zusammenarbeit, konservativ, gegründet 1967)
- GÅ = Gröna på Åland bzw. De Gröna (Greens for Aland / Grüne für Aaland, ökologisch, seit 1987 aktiv)
- HUT = Hut-Gruppen (Hut Group / Hut Gruppe)
- LIB = Liberalerna på Åland (Liberals for Aland / Liberale Aalands, liberal, gegründet 1978)
- MF = Mariehamns Framtid (Future of Mariehamn / Zukunft für Mariehamn, nur in Mariehamn aktive Gruppierung)
- M bzw. MSÅ = Moderat Samling för Åland (Moderates of Aland / Moderate Aaländer, bürgerlich, gegründet 1967)
- ObS = Obunden Samling (Non-aligned Coalition / Versammlung der Unabhängigen, konservativ, gegründet 1987)
Das Ålandische Zentrum (schwedisch Åländsk Center, meist mit C abgekürzt) ist der Name einer politischen Partei in Åland. Die Partei wurde am 13. Januar 1976 gegründet. Bei ihrer ersten Wahlteilnahme 1979 erreichte die Partei 42,3 % der Stimmen und erhielt 14 der 30 Mandate im Lagting. Seitdem sanken die Wahlergebnisse der Partei kontinuierlich, wobei sie nach wie vor zu den stärksten Parteien Ålands gehört. 2011 erhielt die Partei bei leichten Verlusten 23,6 % und wurde damit aufgrund der starken Verluste der Liberalen stärkste Kraft. Mit drei weiteren Parteien bildete sie eine Koalition und stellt seitdem mit Roger Nordlund den stellvertretenden Ministerpräsidenten. Trotz Verlusten behielt die Partei 2015 ihre 7 Sitze bei einem Stimmenanteil von 21,7 % und wurde die zweitstärkste Partei. Zu Wahlen zum finnischen Parlament, in dem Åland über einen festen Sitz verfügt, tritt das Zentrum meist in Wahlbündnissen mit anderen Parteien an. Der derzeitige Abgeordnete ist seit der Parlamentswahl 2015 das Parteimitglied Mats Löfström. Seit 1977 besitzt die Partei eine Jugendorganisation (Ungcentern) und seit 1988 mit den Centerkvinnorna auch eine Frauenorganisation.
Ålands Sozialdemokraten (schwedisch Ålands Socialdemokrater, ÅSD oder SOC) sind eine politische Partei in Åland. Im Gegensatz zu Schweden oder Finnland ist die sozialdemokratische Partei in Åland keine führende politische Kraft. Bei der vergangenen Wahl im Oktober 2011 erreichte die Partei 18,0 % der Stimmen womit sie drittstärkste Kraft im Lagting wurde. Mit Camilla Gunell stellt die Partei seit dieser Wahl die Regierungschefin Ålands. Die Partei ist traditionell stärker mit der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Schwedens verbunden als mit der Sozialdemokratischen Partei Finnlands. Gegründet wurde sie 1971. Die Arbeiterschaft auf Åland hatte sich aber seit 1906 in unterschiedlicher Form organisiert.
Ålands Zukunft (schwedisch Ålands Framtid; finnisch Ahvenanmaan tulevaisuus) ist eine separatistische und liberal-konservative politische Partei in Åland. Sie tritt für die politische Unabhängigkeit der Region vom finnischen Staat ein. Bei der jüngsten Regionalwahl im Jahr 2015 erzielte Ålands Zukunft 7,4 Prozent der Stimmen. Sie stellt damit zwei von 30 Abgeordneten im Regionalparlament Ålands.
Åland nimmt wie alle anderen Teile Finnlands an den in Finnland abgehaltenen allgemeinen Wahlen, insbesondere den Wahlen zum finnischen Parlament und zum Europäischen Parlament sowie der Direktwahl des Präsidenten teil. Bei den Wahlen zum finnischen Parlament bildet Åland einen eigenen Wahlkreis. Der autonomen Inselgruppe steht nach § 25 der finnischen Verfassung unabhängig von der Bevölkerungszahl einer der 200 Sitze im Parlament zu. Unabhängig von der Parteizugehörigkeit schließt sich der Vertreter Ålands im Parlament Finnlands regelmäßig der Fraktion der Schwedischen Volkspartei an. Seit der Wahl von 2003 wird der Sitz Ålands vom Bürgerlichen Roger Jansson eingenommen. Die seit 1999 durchgeführten Landtags- und Reichstagswahlen erbrachten folgende Ergebnisse:
| Partei | 2015 | 2011 | 2007 | 2003 | ||||
| Anteil | Mandate | Anteil | Mandate | Anteil | Mandate | Anteil | Mandate | |
| Zentrum (Åländsk Center) | 7 | 23,6 % | 7 | 23,5 % | 8 | 24,1 % | 7 | |
| Liberale (Liberalerna på Åland) | 7 | 20,3 % | 6 | 31,6 % | 10 | 24,1 % | 7 | |
| Sozialdemokraten (Ålands Socialdemokrater) | 5 | 18,5 % | 6 | 11,5 % | 3 | 19,0 % | 6 | |
| Konservative (Moderat Samling för Åland) | 5 | 13,9 % | 4 | 9,5 % | 3 | 13,6 % | 4 | |
| Unabhängige Sammlung (Obunden Samling) | 3 | 12,6 % | 4 | 11,9 % | 4 | 9,4 % | 3 | |
| Separatisten (Ålands Framtid) | 2 | 9,9 % | 3 | 8,1 % | 2 | 6,5 % | 2 | |
| Wahlvereinigung Åländische Demokratie (Valmansföreningen Åländsk demokrati) | 1 | |||||||
| Wahlvereinigung für Henrik Appelqvist (Valmansförening för Henrik Appelqvist) | 1,1 % | 0 | ||||||
| Gruppe für nachhaltige Entwicklung (Gruppen för hållbar utveckling, HUT) | 1,2 % | 0 | ||||||
| Fortschritt (Ålands Framstegsgrupp) | 3,4 % | 1 | ||||||
Justizwesen und Kriminalität
Das Rechtswesen, Gericht und Polizei, sind in Åland eine Sache autonomer Selbstbestimmung. Das Landesgericht hat seinen Sitz in Mariehamn, die Polizei ist mit eigenen Dienststellen in allen 16 Gemeinden vertreten.
Die Außenpolitik, die meisten Teile des Zivilrechts und des Strafrechts sowie die Gerichtsorganisation liegen weiterhin beim finnischen Staat. Das heißt, schwere Straftaten und grundsätzliche strafrechtliche Angelegenheiten unterliegen dem finnischen Rechtssystem, und Gerichtsverfahren werden nach finnischem Recht geführt. Die Justiz auf Åland arbeitet ausschließlich auf Schwedisch, das die Amtssprache ist.
Zur Kriminalität auf Åland gibt es in den verfügbaren Quellen keine spezifischen Zahlen. Es ist jedoch bekannt, dass Åland mit seiner überschaubaren Bevölkerung und hohen Lebensqualität als sehr sicher gilt; schwere Kriminalität ist selten. Kleinere Vergehen und Delikte werden teilweise auf lokaler Ebene geregelt, schwerwiegende Straftaten durch das finnische Justizsystem verfolgt.
Sicherheitskräfte
1921 wurde eine internationale Konvention geschlossen, derzufolge Åland demilitarisiert ist und neutral sein muss. Seitdem gibt es auf den Inseln kein Militär - auch die jungen Männer auf Åland sind vom allgemeinen Wehrdienst befreit.
Internationale Beziehungen
Åland hat seit 1970 eine eigene Vertretung im Nordischen Rat. Das Parlament wählt zwei Vertreter der Regierung als Mitglieder in den Rat. Zusammen mit den von der zentralen Verwaltungsbehörde bestimmten Vertretern bilden sie die Ålands Delegation im Nordischen Rat. Als sich Finnland 1995 der Europäischen Union anschloss, war es notwendig, dass das åländische Parlament seine Zustimmung dazu gab, damit sich auch Åland der EU anschließen würde. Das Lagting war damit einverstanden, nachdem die Åländer in zwei Volksabstimmungen dem EU Beitritt zugestimmt hatten und nachdem feststand, dass ein spezielles Protokoll das åländische Verhältnis zu den EU Gesetzen regeln würde. Gemäss dem Protokoll, das im Beitrittsvertrag von Finnland enthalten ist, steht Åland außerhalb der Steuerunion. Ausserdem erlaubt das Protokoll besondere Regeln für den Kauf von festem Eigentum und das Recht ein eigenes Unternehmen auf Åland zu betreiben. Im weiteren wird die volksrechtliche Sonderstellung von Åland im Protokoll bestätigt.
Politiker, Forscher und Journalisten aus aller Welt studieren oft Åland als ein Beispiel für eine erfolgreiche Minderheitenlösung. Die Machtverteilung zwischen Åland und dem finnischen Staat und zudem die Forderung nach Gegenseitigkeit betreffend Änderungen in der Machtverteilung, in der Heimatrechtsregelung und den Begrenzungen bezüglich Landeigentum gehören zu jenen Punkten, die Interesse wecken, wie auch die Möglichkeit Einfluss auf internationale Übereinkommen nehmen zu können. Åland wird als einzigartig betrachtet, weil einerseits die Autonomie schon so lange besteht und andererseits diese Lösung ohne einen bewaffneten Konflikt zustande kam und Åland sowohl autonom als auch demilitarisiert ist.
Was die Europäische Union betrifft, ist die Bevöälkerung Ålands zweigespalten. Sie hat die pro-europäischen Gefühle der Festlandfinnen aber nie geteilt. Das Referendum, das Finnlands Beitritt zur EU 1995 sicherte, wurde anfangs von den Insulanern abgelehnt, als ihre Sorgen über den Verkauf von zollfreien Waren an Bord der Inselfähren in Frage gestellt wurden. Die finnische Regierung erreichte in Verhandlungen mit der EU schließlich eine 'opt out'-Klausel für die Inseln bezüglich der neuen EU-Steuerrichtlinien. Nach dem positiven Volksentscheid zum EU-Beitritt in Schweden stimmte Åland schließlich am 20. November 1994 mit einer Mehrheit von 74 % ebenfalls für einen Beitritt zur EU.
Nach negativen Erfahrungen mit der EU-Bürokratie waren die Åländer jedoch so verärgert, dass sie sich dafür entschieden haben, den ursprünglichen Europäischen Verfassungsvertrag 2006 nicht zu ratifizieren - eine Tatsache, die in Finnland und im Ausland wenig Medienaufmerksamkeit bekommen hat. Riitta Myller, finnische Abgeordnete der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament, schreibt dies der Tatsache zu, dass 2006 „schon ziemlich klar war, dass die Verfassung niemals in Kraft treten würde. Deswegen war das Ratifizierungsverfahren in Åland nie Thema.“
Das Ålandsdokument (schwedisch Ålandsdokumentet) ist ein Beschluss des Nordischen Rats vom 5. September 2007, der die gleichberechtigte Mitgliedschaft der autonomen Gebiete Färöer, Grönland (beide zu Dänemark) und Åland (zu Finnland) im Nordischen Rat ermöglicht. Unter anderem können diese Länder damit die Treffen des Nordischen Ministerrats und der Arbeitsgruppen und Gremien der Nordischen Staatengemeinschaft leiten. Die Autonomiegebiete bekommen auch die Befugnis, Empfehlungen selbständig entgegenzunehmen und darauf zu antworten, sowie eigene Vorschläge zu unterbreiten.
Flagge und Wappen
Das Ålands våpen (Wappen Aalands) der Åland-Inseln wurde 1560 per königlichem Dekret bewilligt und am 18. April 1951 von der Provinzregierung für das autonome Provinz eingeführt. Es zeigt einen gelben Hirsch auf blauem Grund. Was die alte Flagge der Inselgruppe betrifft, so entdeckte man Mitte der 1960er Jahre bei Restaurationsarbeiten einer mittelalterlichen Holzskulptur, die dem schwedischen König Karl Knutsson Bonde gehörte, dass die noch vorhandenen Farbenreste auf dem königlichen Banner eine unbekannte Vorlage für die åländische Fahne waren. Mit großer Wahrscheinlichkeit können wir annehmen, dass dieses Banner im 15. Jahrhundert über Kastelholm wehte, als Karl Knutsson mit seinen Gästen nach Åland kam. Die åländische Fahne hat mit anderen Worten alte Vorfahren auf den Inseln und kann dafür jetzt überall stolz wehen, besonders am åländischen Flaggentag am ersten Sonntag im April.
Beim großen Liederfestival 1922 in Mariehamn wurde zum ersten Mal eine åländische Flagge gezeigt. Es war eine gestreifte Flagge mit drei gleich breiten Bändern, mit den Farben Blau-Gelb-Blau. Bis 1934 zeigten die Åländer immer wieder bei Festen ihre Flagge, die aus dem alten Schwedischen Reich stammte. Im Jahre 1934 kam eine allgemeine Flaggenordnung heraus und laut dieser war es verboten, andere Flaggen zu zeigen, wenn nicht auch die Staatsflagge Finnlands an einem dominierenden Platz wehte. Die Åländer mit ihren Landschaftsbeauftragten und Landrat Björkman an der Spitze ignorierten diese Anordnung. „Diese Ordnung gilt da, wo sie erlassen worden ist, also in Finnland. Auf Åland gilt sie nicht“ war man sich auf den Inseln schnell einig. Als dann ein diensteifriger Landesbeamter die åländische Flagge auf einem Fest herunter holte, holte man die Polizei. Diese konnte jedoch nichts machen und nachdem man sich in Helsingfors (Helsinki) informiert hatte, stand fest: Es war im Gesetz für Åland keine Ausnahme erlassen worden, es durfte also keine Flagge mit åländischen Wappenfarben gehisst werden, ohne die finnische Flagge gleichzeitig zu hissen.
Man fand sich damit aber nicht ab, schon kurze Zeit später, 1937, schlug der Landstingabgeordnete Herman Mattsson vor, dass eine eigene åländische Fahne ausgearbeitet werden sollte. Aufgrund des Stockholmsplan - Befestigungsanlangen für Åland Ende der 30er Jahre - wurden die Pläne erstmal auf Eis gelegt. 5 Jahre später, 1942, griff Herman Mattsson diese Frage wieder auf, in der Hoffnung, dieses Mal Unterstützung zu kriegen. Nach einer kritischen Beleuchtung von Matts Dreijer Ende 1945 schlug man schließlich ein Landschaftsgesetz bezüglich der Åländischen Flagge und des Åländischen Wappens vor. Das Gesetz blieb jedoch im Gesetzausschuss hängen und kam nicht zustande.
Das neue Självstyrelselagen (Selbstverwaltungsgesetz) von 1951 gab dem Lagting schließlich das Recht, eine eigene Flagge für die Landschaft zu gestalten. Jetzt hatte das Lagting nicht nur das Recht, eine eigene Flagge selbst zu gestalten, sondern auch über ihre Anwendung zu bestimmen. Damit war der Grundstein für ein åländisches Nationalsymbol gelegt. Im Januar 1952 erließ die Landschaftsführung das erste åländische Flaggengesetz. Die Flagge, die vorgeschlagen wurde, war ein nordisches Kreuz in Blau und Gelb. Ein blauer Hintergrund mit gelben Kreuz und in der Mitte des gelben Kreuzes ein blaues Kreuz. Das Lagting nahm das Gesetz an, die åländische Delegation verordnete das Gesetz aber das Gericht war der Ansicht, dass die Flagge der schwedischen zu ähnlich war und das Verwechslungsgefahr bestand. Der Präsident der åländischen Delegation folgte dieser Meinung und somit verfiel die Idee dieser Flagge.
Folglich kam es 1953 im Lagting zu einem Flaggenstreit. Im März kam ein neuer Vorschlag, dieses Mal mit einem blauen Kreuz auf gelben Grund. Nach der Vorstellung entbrannte eine heftige Debatte. Schließlich wurde auch dieser Vorschlag verworfen. Eine Minderheit hielt weiterhin an der alten Flagge aus dem Schwedischen Reich fest, der Blau-Gelb-Blau gestreiften Fahne. Die Mehrheit im Lagting war jedoch für eine skandinavische Kreuzflagge. So kam auch ein dritte Vorschlag rein. Er zeigt ein gelb umrandetes rotes skandinavisches Kreuz, das heißt ein Kreuz, das zur Stangenseite hin verschoben ist - alle skandinavischen Länder haben zum Zeichen der Verwandtschaft und Zusammengehörigkeit ein solches Kreuz in ihren Flaggen - auf blauem Grund. Die Flagge vereinigt die Farben der Flaggen bzw. Wappen von Finnland und Schweden. So ist deutlich die schwedische Flagge mit einem aufgelegten roten Kreuz - das finnische Wappen ist rot - zu erkennen. Dieser Vorschlag wurde schließlich mit 18 Stimmen angenommen, bei 11 Gegenstimmen. Am 31. März 1954 erkannte Finnlands Präsident Paasikivi das Flaggengesetz an. Am 3. August 1992 unterzeichnete der finnische Präsident ein Gesetz, das den Gebrauch der Flagge in amtlichen Angelegenheiten regelt. Diesem zufolge haben Schiffe, die auf Åland registriert sind, das Recht, die åländische Flagge als Seefahrtsflagge auf der ganzen Welt zu führen.
Laut Erik Tudéer war der Volkshochschullehrer L. O. Liljeström Erfinder der Flagge. Der Journalist Håkan Skogsjö, der sich den Entwurfsverlauf noch mal durch den Kopf gehen ließ, war anderer Meinung. Ein späteres Interview mit dem damaligen Vizetalmann Eliel Persson bestätigte Skogsjös Wahrnehmung. Laut Persson war es Evald Häggblom, der die Fahne entwarf, die schließlich die Abstimmung gewann. Der gleiche Vorschlag wurde gleichzeitig auch von der Volksschullehrerin Kerstin Bertell erstellt, die mehrere Möglichkeiten unter ihren Kollegen testete.
Nationale Symbole:
- Farben: blau-gelb
- Pflanze: gullviva (Schlüsselblume, primula veris)
- Tier: hjortdjur bzw. kronhjort (Hirsch, cervus)
- Fisch: gädda (Hecht, esox lucius)
- Vogel: havsörn (Seeadler, haliaeetus albicilla)
- Gestein: kalksten (Kalkstein)
- Motto: Freds öer („Inseln des Friedens“)
- Held: Julius Sundblom (Streiter für die aaländische Selbständigkeit, 1865 bis 1945)
Hymne
Aaland besitzt eine eigene Hymne. Alänningens sãng („Lied der Aaländer“) wurde 1922 offiziell angenommen. Die Musik stammt von Johan Fridolf Hagfors (1857 bis 1931), der Text von John Grandell (1892 bis 1960). Er beschreibt die herrliche Landschaft, das Mittsommernachtsfest und die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit.
Originaltext (schwedisch) Deutsche Übersetzung
1: Landet med tusende öar och skär, 1: Land mit Tausenden Inseln und Schären
danat ur havsvågors sköte. Geboren tief zwischen den Wellen
Åland, vårt Åland, vår hembygd det är. Åland, unser Åland, unsere Heimat ist es
Dig går vår längtan till möte! wir sehnen uns danach, dich zu treffen
Forngravars kummel i hängbjörkars skygd alte Gräber zwischen den Birken
tälja din tusenårs saga. Geschichten aus tausendjähriger Geschichte
Aldrig förgäta vi fädernas bygd, wir werden das Land der Ahnen nie vergessen
vart vi i fjärrled än draga egal wohin wir gehen werden
vart vi i fjärrled än draga egal wohin wir gehen werden.
2: Skönt är vårt Åland när fjärdar och sund Einsam ist unser Åland wenn Buchten und Straßen
blåna i vårljusa dagar, blau werden in den hellen Frühlingstagen
ljuvt är att vandra i skog och i lund, es ist herrlich, durch Wald und Hain zu wandern
i strändernas blommande hagar. durch die blühenden Felder an unseren Küsten
Midsommarstången mot aftonröd sky Mittsommerpfosten zum roten Himmel
reses av villiga händer, empor gehoben wird er von willigen Händen
ytterst i utskärens fiskareby weit draußen im Schärenfischerdorf
ungdomen vårdkasar tänder Leuchtfeuer werden von den Jungen entzündet
ungdomen vårdkasar tänder Leuchtfeuer werden von den Jungen entzündet.
3: Skönt är vårt Åland när vågsvallet yr Lieblich ist unser Åland, wenn der Wellenschaum
högt mot de mäktiga stupen gegen die Klippen brandet
när under stjärnhimlen kyrkfolket styr wenn unter dem Sternenhimmel die Kirchgeher
över de islagda djupen. ziehen über die eisigen Tiefen der See
Ryter än stormen, i stugornas ro auch wenn Stürme toben, im Frieden Häuser
spinnrocken sjunger sin visa wird das Lied des Spinnrads gesungen
minnet av barndomens hägnande bo die Erinnerung an eine liebevolle Kindheit
sönerna lyckligast prisa wird glücklich gepriesen von den Söhnen
sönerna lyckligast prisa. wird glücklich gepriesen von den Söhnen.
4: Aldrig har åländska kvinnor och män Niemals haben die Åländerinnen und Åländer
svikit sin stam och dess ära; die Ehre ihres Stammes hintan gestellt
ofärd oss hotat, men segervisst än Kriege drohten uns, aber siegreich doch
frihetens arvsrätt vi bära. tragen wir die Erbschaft der Freiheit
Högt skall det klinga, vårt svenska språk, Laut soll sie klingen, unsere schwedische Sprache
tala med manande stämma, gesprochen mit drängender Stimme
lysa vår väg som en flammande båk, erleuchte unsere Pfade wie ein Leuchtfeuer
visa var vi äro hemma zeig uns, wo wir hingehören
visa var vi äro hemma zeig uns, wo wir hingehören.
Englische Übersetzung
The land of thousand islands and skerries,
Born from deep beneath the waves
Åland, our Åland, our home it is
Thee we long to meet
Ancient graves beneath the birches
Tells of our thousand year history
We will never forget the land of our Fathers
No matter where we will go
No matter where we will go
Lovely is our Åland when bays and straits
Become blue in the bright days of spring
It's delightful to wander in forest and grove
In the flowered fields of our shores.
Midsummer pole to evening red sky
Is raised by willing hands
Farthest out in the skerry fisher village
Beacons are lit by the young
Beacons are lit by the young
Lovely is our Åland when the froth of waves
is whirling against the mighty precipice
When the church folks steer beneath the stars
Over the icy depths of the sea
Even when storm roars, in the cottages' peace
The song of the spinning wheel is sung
The memory of loving childhood is
Happily praised by the sons
Happily praised by the sons
Never have Alandian women and men
Let the honour of their tribe down
Warfare threatened us, but victoriously yet
We carry the heritage of freedom
Loudly shall it sound, our Swedish language
Spoken with an urging voice
Enlighten our path like a sea mark of flames
Show us where we belong
Show us where we belong
Hauptstadt
Verwaltungszentrum Aalands war vom 15. Jahrhundert an Kastelholm, schwedisch Kastelholms slott, finnisch Kastelholma. Als Baudatum dieses Schlosses wird das Jahr 1384 vermutet. Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde Kastelholm 1388 in einem Vertrag von Königin Margarethe I von Dänemark. Das Schloss stellte einen Großteil ihres Erbes dar, den sie vom Großgrundbesitzer Bo Jonsson Grip erhielt. Schloss Kastelholm war ein strategisch wichtiger Verteidigungspunkt Eine Schrift von 1525 beschrieb sie als „Schlüssel zu Schweden“, was den wichtigen Vorposten in der Verteidigung Stockholms illustriert. Die Blütezeit des Schlosses war im 15. und 16. Jahrhundert. König Johann III hielt hier seinen abgesetzten Bruder Erik XIV bis zum Herbst 1571 gefangen. Das Schloss wurde mehrfach während der Gefechte von König Karl IX 1599 im Bürgerkrieg zerstört. Die Inselgruppe wurde fortan von Stockholm aus verwaltet. Erst 1631 beseitigte man die Schäden. 1745 brannte das Schloss fast vollständig aus. Die Ruine wurde in den 1770er Jahren aufgegeben.
1809 fielen die Åland-Inseln zusammen mit Finnland an das russische Zarenreich. 1832 wurde die Festung Bomarsund erbaut, wo auch die Militärverwaltung ihren Sitz hatte. Der damalige britische Außenminister und spätere Premierminister Palmerston protestierten vergeblich dagegen. Die Festung wurde von den Russen als strategischer Punkt zur Beherrschung der nördlichen Ostsee betrachtet. Folgerichtig hielten die Briten und Schweden die Festung für eine potenzielle Bedrohung ihres Handels und ihrer Interessen in der Region.
Im Verlauf des Krimkrieges wurde die Festung 1854 durch eine überlegene Anglo-Französische Flotte zerstört. Die Russen unter General Bodisco kapitulierten am 16. August 1854, über 2200 Russen gingen in Gefangenschaft. Nach Besetzung der Inseln wurde Festung Bomarsund gesprengt. Ein Wiederaufbau nach dem Krieg war den Russen nicht erlaubt: Die Åland Convention vom 30. März 1856 zwischen Russland, Großbritannien und Frankreich untersagte die Errichtung von Befestigungsanlagen und Marinestützpunkten sowie die Stationierung von Truppen auf den Inseln. Die Vereinbarung war Teil des Pariser Friedens. Die Inselgruppe hatte nun formal kein Verwaltungszentrum mehr.
1891 wurde schließlich Mariehamn zur Hauptstadt (största stad bzw. kapunki) des Landes erklärt. Benannt ist die Ortschaft nach Maria Alexandrowna, der Gemahlin des Zaren Alexander II, der 1861 die Stadt gründete, als Finnland und Åland zum Russischen Kaiserreich gehörten. Mariehamn ist auch Hauptsitz der meisten großen åländischen Unternehmen. So haben die åländischen Reedereien Viking Line und Rederiaktiebolaget Eckerö, die Chipsfabrik Taffel sowie die Ålandsbanken hier ihren Hauptsitz.
Verwaltungsgliederung
Intern besteht die autonome Provinz Åland aus 16 kommunerna (Gemeinden). Hauptort und einzige Stadt Ålands ist Mariehamn mit 24 stadsdelar (Stadtteilen). Die 15 landkommunerna, finnisch kuntia (Landgemeinden), umfassen insgesamt 272 byar (Dörfer).
Die sechs Schärenkommunen Brändö, Kumlinge, Vårdö, Föglö, Sottunga und Kökar sind die kleinsten Gemeinden Finnlands. Sottunga gehört mit rund 130 Einwohnern zu den kleinsten Gemeinden in der Europäischen Union. Die Fläche der Inselgruppe (in km²) verteilt sich wie folgt auf die Gemeinden:
| Gemeinde | Land | Seen | Land & Seen | Meer | Insgesamt |
| Brändö | 108,1 | 0,4 | 108,5 | 1.540,0 | 1.648,5 |
| Eckerö | 107,7 | 1,5 | 109,2 | 643,6 | 752,8 |
| Finström | 123,3 | 6,9 | 130,2 | 42,3 | 172,5 |
| Föglö | 134,8 | 0,3 | 135,1 | 1.734,0 | 1.869,1 |
| Geta | 84,4 | 2,9 | 87,2 | 519,3 | 606,6 |
| Hammarland | 138,2 | 2,0 | 140,1 | 1.083,1 | 1.223,2 |
| Jomala | 142,6 | 0,8 | 143,4 | 543,7 | 687,1 |
| Kumlinge | 99,3 | 0,5 | 99,8 | 760,6 | 860,4 |
| Kökar | 63,6 | 0,4 | 63,9 | 2.101,1 | 2.165,1 |
| Lemland | 113,1 | 0,6 | 113,7 | 851,7 | 965,4 |
| Lumparland | 36,3 | 0,0 | 36,3 | 50,8 | 87,1 |
| Saltvik | 152,1 | 7,0 | 159,8 | 1.007,7 | 1.166,8 |
| Sottunga | 28,1 | 0,0 | 28,1 | 314,4 | 342,5 |
| Sund | 108,1 | 3,8 | 112,6 | 72,3 | 184,1 |
| Vårdö | 101,5 | 0,4 | 101,9 | 470,8 | 572,7 |
| Mariehamn | 11,8 | 0,0 | 11,8 | 9,0 | 20,8 |
| Åland ohne Mariehamn | 1.540,8 | 27,4 | 1.569,8 | 11.735,4 | 13.303,6 |
| - Landgemeinden | 1.005,6 | 25,4 | 1.032,5 | 4.814,5 | 5.845,4 |
| - Archipel | 535,2 | 2,0 | 537,2 | 6.920,9 | 7.458,2 |
| Åland | 1.552,6 | 27,4 | 1.581,6 | 11.744,4 | 13.324,4 |
Für Januar / März 2016 werden fiolgende Daten angegeben:
| Gemeinde | Subregion | Einwohner | Landfläche | E/km² | Binnengewässer | Wasserfläche | |
| Mariehamn | Mariehamn | 11.521 | 11,79 km² | 4,6 mi² | 977 | 0,0 km² | 9,0 km² |
| Jomala | Land | 4.646 | 142,53 km² | 55,0 mi² | 33 | 1,8 km² | 144,3 km² |
| Finström | Land | 2.529 | 123,25 km² | 47,6 mi² | 21 | 6,9 km² | 130,2 km² |
| Lemland | Land | 1.991 | 113,08 km² | 43,7 mi² | 18 | 0,9 km² | 114,1 km² |
| Saltvik | Land | 1.827 | 152,07 km² | 58,7 mi² | 12 | 7,4 km² | 159,6 km² |
| Hammarland | Land | 1.521 | 138,17 km² | 53,3 mi² | 11 | 1,9 km² | 140,3 km² |
| Sund | Land | 1.033 | 108,06 km² | 41,7 mi² | 10 | 4,3 km² | 112,5 km² |
| Eckerö | Land | 932 | 107,69 km² | 41,6 mi² | 9 | 1,5 km² | 109,2 km² |
| Föglö | Archipel | 564 | 134,78 km² | 52,0 mi² | 4 | 0,3 km² | 135,0 km² |
| Brändö | Archipel | 465 | 108,07 km² | 41,7 mi² | 4 | 0,4 km² | 108,3 km² |
| Geta | Land | 509 | 84,34 km² | 32,6 mi² | 6 | 2,9 km² | 87,5 km² |
| Vårdö | Archipel | 433 | 101,50 km² | 39,2 mi² | 4 | 0,4 km² | 102,1 km² |
| Lumparland | Land | 390 | 36,26 km² | 14,0 mi² | 11 | 0,0 km² | 36,4 km² |
| Kumlinge | Archipel | 315 | 99,26 km² | 38,3 mi² | 3 | 0,4 km² | 99,5 km² |
| Kökar | Archipel | 243 | 63,55 km² | 24,5 mi² | 4 | 0,4 km² | 64,0 km² |
| Sottunga | Archipel | 99 | 28,05 km² | 10,8 mi² | 4 | 0,0 km² | 28,1 km² |
Die Einwohnerzahlen der Gemeinden wurden swie folgt angegeben:
| Gemeinde | S 1980 | S 1990 | S 2000 | S 2010 | S 2020 | S 2024 |
| Brändö | 550 | 529 | 514 | 488 | 449 | 430 |
| Eckerö | 685 | 811 | 830 | 943 | 958 | 956 |
| Finström | 2.052 | 2.206 | 2.299 | 2.502 | 2.603 | 2.617 |
| Föglö | 608 | 606 | 595 | 580 | 526 | 502 |
| Geta | 471 | 478 | 478 | 475 | 511 | 514 |
| Hammarland | 1.196 | 1.233 | 1.351 | 1.508 | 1.599 | 1.636 |
| Jomala | 2.615 | 3.025 | 3.328 | 4.098 | 5.386 | 5.789 |
| Kökar | 304 | 296 | 296 | 259 | 225 | 227 |
| Kumlinge | 454 | 465 | 405 | 364 | 307 | 273 |
| Lemland | 954 | 1.269 | 1.585 | 1.814 | 2.114 | 2.134 |
| Lumparland | 302 | 322 | 377 | 394 | 372 | 371 |
| Mariehamn | 9.553 | 10.263 | 10.488 | 11.190 | 11.705 | 11.866 |
| Saltvik | 1.564 | 1.634 | 1.679 | 1.802 | 1.806 | 1.778 |
| Sottunga | 149 | 133 | 129 | 119 | 101 | 101 |
| Sund | 939 | 948 | 1.013 | 1.019 | 1.007 | 1.001 |
| Vårdö | 387 | 386 | 409 | 452 | 460 | 459 |
| Åland | 22.783 | 24.604 | 25.776 | 28.007 | 30.129 | 30.654 |
Verwaltungsgliederung:
16 kommunerna (Gemeinden), davon 10 auf Fasta Åland
davon 1 stad (Stadt) mit 24 stadsdelar (Stadtteilen)
15 landkommunerna / kuntia (Landgemeinden) mit 272 byar (Dörfer)
Bevölkerung
Die Bevölkerungszahl Ålands steigt seit den 1920er Jahren langsam, aber stetig an. Derzeit leben hier fast 28.000 Menschen. Konkret entwickelte sich die Bevölkerungszahl und Dichte in E/km², gemessen an der jeweiligen Landfläche Ålands, 1552,57 km² (2015), 1.553,17 km² (2016), 1.553,47 km² (2017), 1.582,71 (2020) - wie folgt.
Bevölkerungsentwicklung:
Jahr Einwohner Dichte (E/km²)
1700 5 000 3,52
1721 5 200 3,65
1750 8 000 5,62
1795 11 000 7,85
1815 12 500 8,78
1825 13 000 9,09
1850 15 800 11,10
1860 15 900 11,17
1870 17 900 12,58
1880 20 400 14,33
1890 22 100 15,53
1900 24 800 17,43
1910 21 400 15,04
1920 20 800 14,62
1930 20 100 14,12
1933 27 743 19,49
1940 21 200 14,90
1945 21 400 15,04
1949 21 700 14,95
1950 21 690 14,94
1951 21 700 14,95
1952 21 625 14,89
1953 21 550 14,84
1954 21 400 14,74
1955 21 250 14,63
1956 21 100 14,53
1957 21 100 14,53
1958 21 000 14,46
1959 21 000 14,46
1960 20 981 14,45
1961 20 950 14,43
1962 20 900 14,39
1963 20 850 14,36
1964 20 800 14,33
1965 20 750 14,29
1966 20 700 14,26
1967 20 700 14,26
1968 20 650 14,22
1969 20 600 14,19
1970 20 666 14,23
1971 21 579 14,57
1972 21 650 14,62
1973 21 700 14,65
1974 21 800 14,72
1975 21 900 14,78
1976 22 000 14,85
1977 22 150 14,95
1978 22 300 15,05
1979 22 450 15,16
1980 22 600 15,26
1981 22 783 14,68
1982 23 251 14,99
1983 23 450 15,51
1984 23 600 15,60
1985 23 780 15,73
1986 23 900 15,81
1987 24 050 15,91
1988 24 200 16,00
1989 24 350 16,10
1990 24 604 15,86
1991 24 847 16,28
1992 24 993 16,37
1993 25 102 16,44
1994 25 158 16,48
1995 25 202 16,51
1996 25 257 16,56
1997 25 392 16,63
1998 25 625 16,80
1999 25 706 16,85
2000 25 776 16,89
2001 26 008 17,03
2002 26 257 17,20
2003 26 347 17,26
2004 26 530 17,38
2005 26 678 17,48
2006 26 847 17,58
2007 26 923 17,64
2008 27 003 17,69
2009 27 734 17,88
2010 27 933 17,99
2011 27 995 18,03
2012 28 355 18,26
2013 28 666 18,46
2014 28 916 18,63
2015 28 992 18,67
2016 29 219 18,81
2017 29 489 18,98
2018 29 815 19,20
2019 29 902 19,25
2020 30 074 19,00
2021 30 286 19,14
2022 30 351 19,18
2023 30 541 19,30
2024 30 654 19,37
2025 30 625 19,35
Von 1981 bis 2001 wuchs die Bevölkerung Ålands um durchschnittlich 0,708 % pro Jahr. Das Bevölkerungswachstum ist im Wesentlichen auf Zuwanderung, vor allem aus Schweden, Finnland, Estland und Russland, zurückzuführen. Im Jahr 2003 zogen insgesamt 766 Personen zu, 667 wanderten aus. Das reale Bevölkerungswachstum ist indes rückläufig. Die Geburtenzahl nimmt seit fünf Jahrzehnten beständig ab.
Bevölkerungsaufteilung: 1997 2004
nach Geschlecht:
weiblich 12 951 51,00 % 13 428 50,61 %
männlich 12 441 49,00 % 13 102 49,39 %
nach Alter:
unter 15jährig 4 758 18,75 % 4 696 17,71 %
15 bis 64 Jahre alt 16 476 64,88 % 17 404 65,11 %
über 64jährig 4 158 16,37 % 4 430 16,58 %
nach Wohnsitz:
ländlich 14 963 58,93 % 15 818 59,62 %
städtisch 10 429 41,07 % 10 712 40,38 %
Bevölkerungsstruktur 2008:
| Gemeinde | Insgesamt | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-64 | 65-74 | 75+ | |||||||
| W | M | W | Ms | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | |
| Brändö | 231 | 287 | 27 | 41 | 32 | 49 | 35 | 37 | 75 | 100 | 25 | 32 | 37 | 28 |
| Eckerö | 455 | 466 | 77 | 73 | 59 | 77 | 74 | 90 | 145 | 141 | 44 | 53 | 56 | 32 |
| Finström | 1 252 | 1 231 | 229 | 241 | 192 | 179 | 256 | 271 | 345 | 344 | 116 | 115 | 114 | 81 |
| Föglö | 279 | 297 | 43 | 43 | 33 | 46 | 40 | 44 | 85 | 98 | 22 | 37 | 56 | 29 |
| Geta | 225 | 231 | 31 | 32 | 42 | 48 | 32 | 37 | 58 | 66 | 31 | 29 | 31 | 19 |
| Hammarland | 708 | 732 | 118 | 134 | 110 | 107 | 146 | 146 | 200 | 226 | 60 | 78 | 74 | 41 |
| Jomala | 1 894 | 2 023 | 376 | 430 | 298 | 332 | 469 | 487 | 514 | 528 | 129 | 158 | 108 | 88 |
| Kumlinge | 169 | 191 | 20 | 12 | 19 | 49 | 23 | 17 | 58 | 63 | 23 | 25 | 26 | 25 |
| Kökar | 118 | 144 | 15 | 24 | 13 | 17 | 24 | 24 | 35 | 45 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| Lemland | 855 | 928 | 183 | 208 | 111 | 137 | 194 | 186 | 249 | 269 | 67 | 80 | 51 | 48 |
| Lumparland | 189 | 198 | 34 | 37 | 18 | 23 | 33 | 40 | 68 | 62 | 21 | 26 | 15 | 10 |
| Saltvik | 867 | 886 | 147 | 154 | 119 | 140 | 167 | 172 | 259 | 270 | 69 | 85 | 106 | 65 |
| Sottunga | 62 | 53 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 21 | 23 | 5 | 6 | 16 | 6 |
| Sund | 504 | 527 | 85 | 99 | 55 | 80 | 113 | 107 | 147 | 149 | 58 | 53 | 46 | 39 |
| Vårdö | 218 | 231 | 40 | 36 | 24 | 36 | 42 | 34 | 61 | 71 | 26 | 22 | 25 | 32 |
| Mariehamn | 5 789 | 5 216 | 804 | 820 | 1 060 | 1 068 | 1 114 | 1 077 | 1 689 | 1 458 | 518 | 457 | 604 | 336 |
| Åland | 13 815 | 13 641 | 2 237 | 2 388 | 2 192 | 2 396 | 2 767 | 2 775 | 4 009 | 3 913 | 1 228 | 1 277 | 1 382 | 892 |
Die Einwohner Ålands verteilen sich derzeit auf rund 9.000 Familien und 12.000 Haushalte. Auch hier ist wie in allen anderen europäischen Staaten eine rückläufige Zahl der Personen pro Einheit festzustellen.
Haushalte:
Jahr Haushalte Bewohner Personen pro Einheit:
1970 7 227 20 531 2,841
1980 9 037 22 549 2,495
1990 10 335 24 390 2,360
1995 10 765 24 880 2,311
2000 11 074 25 499 2,303
2005 12 046 26 416 2,193
2010 12 894 27 559 2,137
2015 13 568 28 540 2,103
2022 14 380 30 351 2,111
Regionale Verteilung
In Mariehamn, der Hauptsdtadt und zugleich einzigen Stadt des Inselstaats, lebten im Jahr 2001 40,79 % der Gesamtbevölkerung, im Jahr 2007 waren es 36,17 %. In den einzelnen Gemeinden entwickelte sich die Einwohnerzahl wie folgt:
| Gemeinde | Z 1910 | Z 1950 | Z 1970 | Z 1980 | Z 1990 | S 1995 | Z 2000 | S 2005 | Z 2010 | S 2011 | S 2012 | S 2014 | S 2016 | S 2019 | Z 2020 | S 2021 |
| Brändö | 1.147 | 927 | 623 | 550 | 529 | 548 | 514 | 519 | 488 | 480 | 476 | 474 | 471 | 445 | 449 | 449 |
| Eckerö | 1.082 | 942 | 690 | 685 | 811 | 823 | 830 | 925 | 943 | 978 | 961 | 932 | 928 | 952 | 958 | 933 |
| Finström | 2.105 | 2.089 | 1.678 | 2.052 | 2.206 | 2.246 | 2.299 | 2.441 | 2.502 | 2.527 | 2.538 | 2.535 | 2.594 | 2.593 | 2.603 | 2.638 |
| Föglö | 1.457 | 1.188 | 684 | 608 | 606 | 602 | 595 | 596 | 580 | 577 | 577 | 568 | 561 | 531 | 526 | 501 |
| Geta | 969 | 775 | 471 | 471 | 478 | 461 | 478 | 444 | 475 | 492 | 495 | 494 | 499 | 496 | 511 | 505 |
| Hammarland | 1.559 | 1.454 | 1.024 | 1.196 | 1.233 | 1.283 | 1.351 | 1.384 | 1.508 | 1.526 | 1.526 | 1.531 | 1.508 | 1.583 | 1.599 | 1.619 |
| Jomala | 2.418 | 3.413 | 2.051 | 2.615 | 3.025 | 3.156 | 3.328 | 3.614 | 4.098 | 4.249 | 4.354 | 4.560 | 4.757 | 5.233 | 5.386 | 5.512 |
| Kökar | 917 | 683 | 523 | 304 | 296 | 314 | 296 | 303 | 259 | 249 | 244 | 254 | 246 | 232 | 225 | 224 |
| Kumlinge | 869 | 741 | 369 | 454 | 465 | 439 | 405 | 355 | 364 | 361 | 340 | 328 | 308 | 314 | 307 | 313 |
| Lemland | 1.615 | 1.342 | 691 | 954 | 1.269 | 1.443 | 1.585 | 1.695 | 1.814 | 1.860 | 1.881 | 1.943 | 2.012 | 2.053 | 2.114 | 2.135 |
| Lumparland | 564 | 448 | 312 | 302 | 322 | 334 | 377 | 387 | 394 | 399 | 395 | 418 | 385 | 366 | 372 | 376 |
| Mariehamn | 1.015 | 3.273 | 8.546 | 9.553 | 10.263 | 10.418 | 10.488 | 10.780 | 11.190 | 11.262 | 11.343 | 11.479 | 11.565 | 11.679 | 11.705 | 11.742 |
| Saltvik | 2.595 | 2.041 | 1.469 | 1.564 | 1.634 | 1.636 | 1.679 | 1.739 | 1.802 | 1.810 | 1.822 | 1.825 | 1.839 | 1.849 | 1.806 | 1.810 |
| Sottunga | 366 | 299 | 175 | 149 | 133 | 127 | 129 | 127 | 119 | 103 | 102 | 101 | 96 | 88 | 101 | 105 |
| Sund | 1.521 | 1.382 | 949 | 939 | 948 | 965 | 1.013 | 1.031 | 1.019 | 1.032 | 1.038 | 1.035 | 1.006 | 1.023 | 1.007 | 1.019 |
| Vårdö | 1.037 | 646 | 422 | 387 | 386 | 397 | 409 | 426 | 452 | 449 | 441 | 439 | 439 | 447 | 460 | 463 |
Volksgruppen
Die Bewohner Ålands sind zu mehr als 96 % Staatsangehörige Finnlands. Aufgrund des Selbstverwaltungsgesetzes gibt es aber parallel dazu ein sogenanntes Hembygdsrätt (Heimatrecht), das funktionell einer åländischen Staatsangehörigkeit ähnelt. An den Wahlen zum Landtag und an den Kommunalwahlen dürfen aktiv wie passiv nur Personen mit åländischem Heimatrecht teilnehmen. Auch der Erwerb von Grundeigentum auf den Inseln sowie die Aufnahme einer unternehmerischen Tätigkeit setzen in der Regel das Heimatrecht voraus. Das åländische Heimatrecht kann nur von finnischen Staatsangehörigen erworben werden, die mindestens fünf Jahre ohne Unterbrechungen in Åland gewohnt haben und der schwedischen Sprache mächtig sind.
Herkunft 2009:
Åland 18 686
Finnland 5 465
Schweden 2 040
sonstige nordische Länder 88
restliches Europa 841
sonstige 471
unbekannt 143
Staatsbürgerschaft
Finnland 25 469
Schweden 1 148
sonstige 1 117
Sprachen
Einzige offizielle Sprache Ålands ist gemäß § 36 Abs. 1 und 2 des Selbstverwaltungsgesetzes Schwedisch. Der auf Åland gesprochene Dialekt, das Åländska Svenska (Aaländisches Schwedisch), steht dem in Schweden gesprochenen Reichsschwedischen näher als dem von der schwedischsprachigen Minderheit in Finnland gesprochenen Finnlandschwedischen. Auch innerhalb des Åländischen gibt es noch einige unterschiedliche Dialekte. So sprechen die Einwohner im Westen der Inselgruppe in den Gemeinden Eckerö und Hammarland einen Dialekt, der dem Reichsschwedischen mehr ähnelt als andere åländische Dialekte. In den östlichen Schären wird ein Schwedisch mit leicht finnischem Akzent gesprochen, vor allem auf Brändö.
Der åländische Dialekt verfügt über eine Reihe von eigenständigen Worten, die es weder auf dem schwedischen Festland noch im Finnlandschwedischen gibt. Zum Beispiel inga statt inte (nicht), blystra statt vissla (pfeifen) und byka statt tvätta (waschen).
Laut offizieller Statistik hatten im Jahr 2003 insgesamt 92,93 % der Einwohner Ålands Schwedisch als Muttersprache. Eine Minderheit von 4,93 % gehörte der finnischen Sprachgruppe an. Der Rest, 2,15 %, bekannte sich zu einer anderen Sprache - allen voran englisch, estnisch, russisch, deutsch und norwegisch. Konkret sehen die Sprecherzahlen so aus:
Sprachen:
| Sprache | 1990 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||
| Svenska | 23.343 | 24 169 | 24 323 | 24 461 | 24 485 | 24 522 | 24 636 | 24 684 | 24 764 | ||||||||
| Finska | 1.128 | 1 238 | 1 271 | 1 301 | 1 298 | 1 339 | 1 344 | 1 352 | 1 367 | ||||||||
| Lettiska | 5 | 9 | 9 | 15 | 38 | 64 | 77 | 94 | |||||||||
| Rumänska | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | 29 | 46 | 87 | |||||||||
| Estniska | 23 | 32 | 47 | 57 | 60 | 79 | 94 | 102 | |||||||||
| Ryska | 30 | 26 | 33 | 46 | 50 | 54 | 66 | 73 | 84 | ||||||||
| Engelska | 51 | 69 | 73 | 80 | 78 | 77 | 82 | 80 | 88 | ||||||||
| Thai | 12 | 14 | 25 | 29 | 36 | 39 | 49 | 68 | |||||||||
| Tyska | 31 | 31 | 31 | 41 | 50 | 54 | 58 | 64 | |||||||||
| Kurdiska | 18 | 27 | 40 | 45 | 49 | 47 | 48 | 48 | |||||||||
| Persiska | 21 | 27 | 28 | 25 | 25 | 40 | 37 | 36 | 34 | ||||||||
| Polska | 8 | 11 | 13 | 13 | 17 | 24 | 27 | 34 | 40 | ||||||||
| Tagalog | 10 | 12 | 14 | 13 | 16 | 20 | 22 | 30 | |||||||||
| Norska | 39 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 40 | 40 | 37 | ||||||||
| Arabiska | 17 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 22 | |||||||||
| Litauiska | - | - | 3 | 4 | 11 | 18 | 23 | 22 | |||||||||
| Albanska | - | - | 6 | 12 | 11 | 11 | 14 | 18 | |||||||||
| Spanska | 6 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 27 | ||||||||
| Ukrainska | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||||||||
| Serbiska | - | 1 | 2 | 7 | 7 | 12 | 15 | 15 | |||||||||
| Danska | 17 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | ||||||||
| Vietnamesiska | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | |||||||||
| Ungerska | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Franska | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||||
| Serbokroatiska | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | |||||||||
| Isländska | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Portugisiska | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | |||||||||
| sonstige | 35 | 20 | 18 | 31 | 33 | 40 | 46 | 59 | 55 | ||||||||
| unbekannt | 22 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Insgesamt | 25 776 | 26 008 | 26 257 | 26 347 | 26 530 | 26 766 | 26 923 | 27 153 | |||||||||
| Anteil | |||||||||||||||||
| Svenska | 93,8 | 93,5 | 93,2 | 92,9 | 92,4 | 92,0 | 91,7 | 91,2 | |||||||||
| Finska | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| sonstige | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | |||||||||
Im Jahr 2014 gab eine Minderheit von 4,8 % der Einwohner Ålands als Muttersprache Finnisch an. Diese ist schon seit langem die mit Abstand größte Minderheitensprache; sie wies bis ungefähr 2010 mehr Muttersprachler auf als die sonstigen Sprachen zusammen. Mittlerweile machen die Muttersprachler anderer Sprachen zusammengenommen 6,9 % aus. Die derzeit (Stand Ende 2014) meistvertretenen Sprachen in dieser Gruppe sind Lettisch und Rumänisch mit je 1,0 %, gefolgt von Estnisch 0,7 %, Russisch 0,5 % und Thailändisch 0,5 %. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 59 Sprachen auf Åland registriert:
- Schwedisch: 25,986
- finnisch: 1,405
- Rumänisch: 520
- Lettisch: 443
- Estnisch: 206
- Englisch: 160
- Thai: 159
- Russisch: 158
- Deutsch: 115
- Arabisch: 107
- Tagalog: 81
- Serbokroatisch: 79
- Polnisch: 69
- Ukrainisch: 69
- Farsi: 55
- Spanisch: 55
- Albanisch: 45
- Kurdisch: 45
- Norwegisch: 42
- Portugiesisch: 32
- Litauisch: 31
- Vietnamesisch: 27
- Italienisch: 22
- Hindi: 19
- Dänisch: 17
- Chinesisch: 15
- Türkisch: 15
- Bulgarisch: 11
- Dutch: 11
- Französisch: 10
- Griechisch: 10
- Malayalam: 10
- Isländisch: 9
- Slowakisch: 8
- Swahili: 8
- Urdu: 6
- Kinyarwanda: 6
- Färöisch: 5
- Indonesisch: 4
- Katalanisch: 4
- Makedonisch: 4
- Aserbaidschanisch: 3
- Luganda: 3
- Kikuyu: 2
- Nepali: 2
- Amharisch: 1
- Armenisch: 1
- Burmesisch: 1
- Hausa: 1
- Ido: 1
- Igbo: 1
- Lingala: 1
- Malaisch: 1
- Maltesisch: 1
- Tamilisch: 1
- Tatarisch: 1
- Tschechisch: 1
- sonstige: 11
Religion
Soweit sich die Åländer zu einer Glaubensgemeinschaft bekennen, gehören sie praktisch ausschließlich der Evangelisk Lutherisk Kirkan (Evangelisch-Lutherischen Kirche) Finnlands an. Die Åland-Inseln sind seit 1923 Teil des Bistums Borgå (auch Bistum Porvoo), das die schwedischsprachigen Regionen Finnlands betreut. Die Propstei Åland des Bistums Borgå besteht aus zehn Gemeinden. Heute (Stand Ende 2014) gehören 78,3 % der Åländer dieser Kirche an. Nur eine Minderheit von 1,2 % gehört einer Freikirche oder einer anderen Glaubensgemeinschaft an (Zeugen Jehovas 0,2 %, Römisch-Katholisch 0,3 %, Griechisch-Orthodox 0,3 %, Sonstige 0,3 %).
Die Zahl der Konfessionslosen ist in den vergangenen Jahren angestiegen, von 4,7 % im Jahr 1990 über 9,4 % im Jahr 2004 auf 20,5 % im Jahr 2015.
Glaubensgemeinschaften:
2001
Lutheraner 23 950 92,09 %
sonstige Christen 140 0,54 %
Bekenntnislose 1 918 7,37 %
2005
Lutheraner 23 819 89,28 %
sonstige Christen 162 0,61 %
Bekenntnislose 2 785 10,11 %
Evangelisch Lutherische Kirche
Die Åland-Inseln gehören seit 1923 zum Bistum Porvoo, das die schwedischsprachigen Regionen Finnlands betreut. 15 der 16 Kirchen Ålands stammen aus der Zeit zwischen dem 12. bis 16. Jahrhundert. Sie gehören damit zu den ältesten Gotteshäusern Finnlands. Konkret sind dies:
- Die Brändö Kyrka ist dem heiligen Jakob geweiht, wurde 1544 erstmals erwähnt und 1893 nach größeren Umbauarbeiten neu geweiht.
- Die Föglö Kyrka besteht aus grauem Granit und nicht aus rotem wie die anderen Kirchen. Sie stammt vermutlich aus dem frühen 14. Jahrhundert.
- Die Kirche von Kumlinge besitzt einen um 1250 errichteten Altar und Kalkgemälde aus dem 15. Jahrhundert.
- Die Kirche von Kökar auf der Insel Hamnö stammt ursprünglich aus dem 13. Jahrhundert, erhielt 1784 jedoch eine Komplettrenovierung.
- Die Sottunga Kyrka wurde 1544 erstmals urkundlich erwähnt und 1730 neu gebaut.
- Die Kapelle von Vårdö stammt aus dem Mittelalter und liegt neben einem alten Postweg.
- Die Lemland Kyrka hat Dachmalereien aus der Zeit um 1290, eine 1327 geschnitzte Madonna mit Kind und zwei Kreuze aus dem 14. Jahrhundert.
- Die Kapellenkirche von Lumparland wurde 1544 erstmals erwähnt und 1728 neu gebaut.
- Die Göranskyrka von Mariehamn ist die jüngste Kirche Ålands. Ihr Grundstein wurde im September 1926 gelegt und ist mit der größten Orgel der Inselgruppe ausgestattet.
- Die Saltvik Kyrka in Kvarnbo besitzt ein Taufbecken aus dem 13. Jahrhundert und Gemälde, deren älteste 1659 geschaffen wurden.
- Die aus dem 14. Jahrhundert stammende Kirche von Sund ist mit einem 5,1 m großen Kreuz ausgestattet, das größte einer Landkirche nördlich der Alpen.
- Die mit ungewöhnlich hohen Fenstern versehene Eckerö Kyrka wurde vermutlich im 13. Jahrhundert gebaut.
- Die Finström Kyrka könnte aus dem 11. Jahrhundert stammen und wäre damit die älteste Kirche Ålands. Um 1200 jedenfalls wurde sie erstmals urkundlich genannt.
- Die Geta Kyrka dürfte um 1450 errichtet worden sein. Ihr Glockenturm steht etwas abseits, die Altargemälde wurden 1685 eingefügt.
- Die Hammarland Kyrka liegt neben einem alten Postweg und dem größten Gräberfeld der Region. Sie stammt vermutlich aus dem 13. Jahrhundert.
- Die Jomala Kyrka ist eine der ältesten Steinkirchen Finnlands. Analysen deuten auf die Periode zwischen 1250 und 1280 als Entstehungszeit hin.
Siedlungen
Åland ist in 16 Gemeinden mit insgesamt 273 Ortschaften unterteilt. „Zum sogenannten ’festen Aland’ gehören neben Mariehamn mit der gleichnamigen Hauptstadt noch Eckerö, Hammarland, Jomala, Finström, Saltvik, Geta, Sund, Lemland und Lumparland. Sie alle sind zumindest durch Brücken miteinander verbunden und werden von insgesamt rund 22.500 Personen bewohnt. Die weiter östlich gelegenen, in Tausende von Inseln zersplitterten Gemeinden des Schärengebiets heißen Vardö, Föglö, Sottunga, Kumlinge, Brändö und Kökar.“ Hier leben rund 2000 Menschen.
Mariehamn ist die einzige wirkliche Stadt der Inselgruppe. Sie war „gegründet worden, als Åland zum russischen Zarenreich gehörte, und trägt ihren Namen nach Maria, der Gattin des damaligen Zaren. Mariehamn liegt auf einer schmalen Landzunge, gewissermassen zwischen West- und Osthafen eingebettet, und ist aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage das unbestrittene wirtschaftliche, gesellschaftliche und administrative Zentrum Ålands. Rund 11.000 Einwohner, also fast die Hälfte aller Åländer, wohnen und arbeiten in der freundlichen Villenstadt mit den breiten Straßen und den vielen Grünflächen.
Außerhalb Mariehamns unterscheidet sich die aländische Siedlungsstruktur wesentlich von der in Mitteleuropa: Die Aländer wohnen nicht in Dörfern und Ortschaften, sondern bauen ihre gelben, grünen, roten und blauen Holzhäuser mit den weissen Fensterrahmen weit verstreut im Gelände - dort, wo es ihnen gerade passt: zwischen Granitfelsen, hinter Birkenhainen, an stillen Buchten. Vielfach befinden sich die Wohnhäuser weitab von der nächsten Straße, sodass häufig nur die am Straßenrand aufgestellten Briefkastenbatterien zeigen, wie dicht eine Gegend besiedelt ist.
Wohl noch am meisten der Tradition verhaftet ist das ganz im Südosten des aländischen Schärengebiets liegende Kökar. Schon die Fahrt dorthin ist ein unvergessliches Erlebnis, denn die Fähre muss auf einer genau festgelegten Fahrtroute durch ein Gewirr von Schären kurven, die teilweise noch knapp unter der Wasseroberfläche liegen und erst in ein paar Jahrhunderten durch die Landhebung hervortreten werden. Ein Strassennetz von knapp 20 km verbindet die drei Hauptinseln von Kökar und damit alle besiedelten Gebiete der kleinen Schärengemeinde. Nur noch rund 200 Menschen leben heute ständig auf diesem Archipel im Archipel. 1950 waren es 700, 1980 noch 300 Personen gewesen. Zwei bescheidene Läden gibt es hier, eine Bank, eine Schule, eine Kirche, keine Kneipe. Frägt man einen der wenigen Jugendlichen, was denn los sei auf Kökar, antwortet er unweigerlich: Nichts!“
Åland ist eine Welt für sich, jenseits der Betriebsamkeit der neoliberalen Welt. „Ein hübsches Haus und ein gepflegtes Boot - das sind die Symbole eines zufriedenen Fischerdaseins auf Aland. Wer auf die nervöse, lärmende Betriebsamkeit verzichten kann, die für uns Mitteleuropäer so kennzeichnend ist, der lebt auf den nordischen Inseln mit den federnden Moospolstern, den gerundeten Granitfelsen und den verschwiegenen Birkenhainen wie im Paradies.“ (Kappeler 1992) Im Folgenden sind die größten Ortschaften Ålands aufgelistet.
Godby ist mit rund 1300 Einwohnern die zweitgrößte Ortschaft der Inselgruppe. Sie liegt in der Gemeinde Finström, etwa 17 km nördlich der Hauptstadt Mariehamn im Norden von Fasta Åland. Es fungiert als Verwaltungszentrum der Gemeinde und bietet zahlreiche wichtige Einrichtungen wie eine Apotheke, Banken, ein Postamt, ein Gesundheitszentrum, eine Schwimmhalle sowie eine weiterführende Schule. Historisch ist Godby bekannt durch die Schlacht von Godby im Jahr 1918 während des finnischen Bürgerkriegs, die in Verbindung mit den Ereignissen rund um die Invasion Ålands im Ersten Weltkrieg steht.
Kulturell und gastronomisch bekannt ist Godby unter anderem für den Pub Stallhagen, der zur lokalen Stallhagen-Brauerei gehört und besonderes biermasseiertes Kalbfleisch serviert. Diese Brauerei und der Pub sind beliebte Anlaufpunkte für Besucher und bieten neben gutem Essen auch Veranstaltungen, wie das Fishbait Rock Festival im Juni. Darüber hinaus befindet sich in der Nähe dern Taffel Factory Shop, wo lokale Spezialitäten wie Aland-Kartoffelchips und weitere regionale Leckereien angeboten werden. Für Übernachtungsmöglichkeiten gibt es beispielsweise das Godby Vandrarhem, das neben Familienfreundlichkeit auch verschiedene Freizeitangebote wie Sauna, Fitness, Pool und Fahrradverleih bereitstellt.

Siedlungen
| Ort | Gemeinde | E 1997 | E 2011 | E 2014 | S 2011 | S 2016 | S 2019 |
| Godby | Finström / Jomala | 833 | 1.205 | 1.271 | 1.205 | 1.297 | 1.324 |
| Haraldsby | Saltvik | 235 | 252 | 244 | 252 | 244 | 240 |
| Jomala | Jomala | 210 | |||||
| Kattby | Hammarland | 353 | 342 | 361 | |||
| Kumlinge | Kumlinge | 224 | |||||
| Lemströmin kanaali | Lemström | 202 | |||||
| Mariehamn | Jomala | 10.408 | 13.204 | 13.638 | 13.204 | 14.148 | 14.631 |
| Mörby | Hammarland | 288 | 295 | 275 | |||
| Ödkarby | Saltvik / Finström | 305 | 325 | 369 | 325 | 414 | 385 |
| Prästgården | Jomala | 512 | |||||
| Rangsby | Saltvik | 278 | 284 | 278 | 295 | 335 | |
| Saltvik | Saltviuk | 210 | |||||
| Söderby | Lemland | 295 | 521 | 550 | 521 | 547 | 582 |
| Storby | Eckerö | 426 | 406 | 392 | 406 | 389 | 397 |
Verkehr
Aaland ist ein zum Meer hin orientiertes Land. Erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Straßen- und Flugverkehr ausgebaut.
Straßenverkehr
Die Inseln verfügen über ein dichtes Straßennetz mit einer Gesamtlänge von 912,4 km im Jahr 2004, wovon 723 km asphaltiert sind. Das ergibt eine Dichte von 0,6 km für alle und 0,472 km für asfaltierte Straßen. Dazu kommen noch 41,2 km reine Radwege.
Angaben in km 1980 1990 2000 2004 2007
Straßen insgesamt 888,1 895,9 912,7 912,4 916,6
davon asfaltiert 307,2 534,6 646,8 723,0 773,4
Radwege . . 25,0 41,2 54,1
Die Hauptstraßenverbindungen führen von Lummarland nach Mariehamn und von hier weiter einerseits über Hammarland und Ekcerö nach Storby, andererseits über Jomala, Godby und Finstrom nach Geta. Weitere wichtige Straßen verbinden Godby mit Sund, Vårdö und Saltvik bzw. Ödkarby. Kleinere Nebenstraßen erschließen praktisch das gesamte Hinterland. Die Verkehrsdichte ist in den letzten vier Jahrzehnten immens gewachsen. Im Jahr 2004 kamen 586 Pkws auf 1000 Einwohner, 2001 waren es 552 und 1980 bloß 349.
Fahrzeugbestand:
| Jahr | Insgesamt | Pkws | Vans | Lkws | Spez. | Busse | Motorräder | Mopeds | Traktoren | Masch. | Hänger |
| 1962 | 4.542 | 1.992 | 265 | 298 | 26 | 30 | 587 | .. | 1.314 | 4 | 26 |
| 1963 | 5.000 | 2.320 | 279 | 295 | 36 | 26 | 588 | .. | 1.422 | 6 | 28 |
| 1964 | 5.553 | 2.777 | 287 | 285 | 39 | 27 | 613 | .. | 1.480 | 11 | 34 |
| 1965 | 5.627 | 3.123 | 314 | 281 | 43 | 24 | 270 | .. | 1.514 | 23 | 35 |
| 1966 | 5.989 | 3.348 | 340 | 286 | 43 | 24 | 278 | .. | 1.590 | 36 | 44 |
| 1967 | 6.392 | 3.625 | 388 | 302 | 52 | 23 | 242 | .. | 1.662 | 43 | 55 |
| 1968 | 6.518 | 3.830 | 357 | 311 | 38 | 20 | 156 | .. | 1.693 | 42 | 71 |
| 1969 | 7.144 | 4.297 | 395 | 330 | 56 | 20 | 172 | .. | 1.717 | 51 | 106 |
| 1970 | 7.719 | 4.750 | 487 | 314 | 53 | 23 | 207 | .. | 1.710 | 50 | 125 |
| 1971 | 8.012 | 4.902 | 576 | 300 | 44 | 22 | 225 | .. | 1.735 | 53 | 155 |
| 1972 | 8.683 | 5.410 | 600 | 305 | 46 | 24 | 252 | .. | 1.791 | 60 | 195 |
| 1973 | 9.192 | 5.852 | 636 | 296 | 46 | 26 | 245 | .. | 1.802 | 67 | 222 |
| 1974 | 9.587 | 6.119 | 655 | 305 | 46 | 27 | 249 | .. | 1.861 | 73 | 252 |
| 1975 | 10.133 | 6.449 | 708 | 309 | 46 | 30 | 221 | .. | 1.974 | 76 | 320 |
| 1976 | 10.407 | 6.591 | 743 | 301 | 45 | 28 | 218 | .. | 2.004 | 82 | 395 |
| 1977 | 10.809 | 6.814 | 792 | 302 | 40 | 28 | 213 | .. | 2.089 | 87 | 444 |
| 1978 | 11.377 | 7.135 | 840 | 302 | 40 | 28 | 205 | .. | 2.157 | 92 | 578 |
| 1979 | 11.965 | 7.553 | 888 | 309 | 48 | 29 | 165 | .. | 2.178 | 96 | 699 |
| 1980 | 12.658 | 7.917 | 1.015 | 300 | 56 | 30 | 185 | .. | 2.253 | 100 | 802 |
| 1981 | 13.376 | 8.302 | 1.110 | 306 | 52 | 32 | 217 | .. | 2.335 | 107 | 915 |
| 1982 | 14.312 | 8.780 | 1.209 | 298 | 60 | 33 | 300 | .. | 2.445 | 115 | 1.072 |
| 1983 | 15.226 | 9.235 | 1.329 | 302 | 66 | 34 | 356 | .. | 2.534 | 129 | 1.241 |
| 1984 | 15.958 | 9.591 | 1.451 | 298 | 63 | 33 | 400 | .. | 2.609 | 130 | 1.383 |
| 1985 | 16.610 | 9.967 | 1.511 | 293 | 67 | 35 | 422 | .. | 2.678 | 141 | 1.496 |
| 1986 | 17.408 | 10.450 | 1.612 | 297 | 70 | 36 | 434 | .. | 2.733 | 148 | 1.628 |
| 1987 | 18.451 | 11.091 | 1.757 | 317 | 84 | 37 | 437 | .. | 2.807 | 159 | 1.762 |
| 1988 | 19.312 | 11.581 | 1.904 | 318 | 84 | 40 | 430 | .. | 2.859 | 175 | 1.921 |
| 1989 | 20.365 | 12.076 | 2.128 | 321 | 94 | 38 | 438 | .. | 2.979 | 214 | 2.077 |
| 1990 | 21.318 | 12.530 | 2.332 | 330 | 98 | 40 | 454 | .. | 3.062 | 236 | 2.236 |
| 1991 | 21.879 | 12.754 | 2.451 | 317 | 97 | 38 | 477 | .. | 3.111 | 243 | 2.391 |
| 1992 | 22.048 | 12.771 | 2.500 | 290 | 100 | 39 | 481 | .. | 3.110 | 254 | 2.503 |
| 1993 | 22.057 | 12.672 | 2.536 | 284 | 102 | 37 | 483 | .. | 3.096 | 255 | 2.592 |
| 1994 | 22.073 | 12.601 | 2.547 | 296 | 68 | 33 | 501 | .. | 3.095 | 255 | 2.677 |
| 1995 | 22.377 | 12.783 | 2.581 | 325 | 24 | 32 | 517 | .. | 3.109 | 264 | 2.742 |
| 1996 | 22.914 | 13.170 | 2.621 | 318 | 19 | 35 | 514 | .. | 3.120 | 273 | 2.844 |
| 1997 | 22.724 | 12.807 | 2.570 | 337 | 15 | 35 | 517 | .. | 3.162 | 275 | 3.006 |
| 1998 | 23.460 | 13.189 | 2.638 | 361 | 8 | 36 | 541 | .. | 3.197 | 295 | 3.195 |
| 1999 | 24.236 | 13.525 | 2.720 | 388 | 8 | 38 | 577 | .. | 3.245 | 310 | 3.425 |
| 2000 | 25.122 | 13.979 | 2.805 | 403 | 7 | 41 | 619 | .. | 3.277 | 320 | 3.671 |
| 2001 | 25.944 | 14.360 | 2.863 | 424 | 7 | 39 | 672 | .. | 3.337 | 341 | 3.901 |
| 2002 | 26.702 | 14.658 | 2.931 | 450 | 2 | 39 | 728 | .. | 3.354 | 351 | 4.189 |
| 2003 | 27.704 | 15.194 | 2.968 | 463 | 2 | 40 | 777 | .. | 3.398 | 365 | 4.497 |
| 2004 | 28.634 | 15.536 | 3.104 | 480 | 1 | 40 | 843 | .. | 3.409 | 390 | 4.831 |
| 2005 | 29.529 | 15.868 | 3.175 | 501 | 1 | 43 | 936 | .. | 3.449 | 404 | 5.152 |
| 2006 | 30.418 | 16.256 | 3.220 | 540 | 1 | 42 | 995 | .. | 3.469 | 414 | 5.481 |
| 2007 | 33.082 | 16.800 | 3.335 | 577 | .. | 43 | 1.082 | 1.505 | 3.499 | 439 | 5.802 |
| 2008 | 34.717 | 17.661 | 3.522 | 595 | .. | 46 | 1.162 | 1.580 | 3.539 | 453 | 6.159 |
| 2009 | 36.192 | 18.373 | 3.683 | 629 | .. | 43 | 1.286 | 1.655 | 3.570 | 464 | 6.489 |
Der öffentliche Verkehr innerhalb Ålands wird durch sechs Buslinien bewerkstelligt, an denen zehn- bis zwölfmal Busse in beide Richtungen verkehren. Dazu gibt es drei Nebenlinien, die zwei- bis dreimal am Tag von Bussen frequentiert werden.
- Linie 1 Mariehamn - Hammarland - Eckerö
- Linie 2 Mariehamn - Jomala - Godby - Geta
- Linie 3 Mariehamn - Godby - Saltvik
- Linie 4 Mariehamn - Godby - Sund - Vårdö
- Linie 5 Mariehamn - Lemland - Lumparland
- Linie 6 Mariehamn - Godby - Pålsböle - Emkarby - Gölby - Godby
- Hammarland Mariehamn - Östanträsk - Kattby - Skarpnåtö
- Jomala Mariehamn - Jomala - Gölby
- Söderby Vessingsboda - Söderby - Vessingsboda
Die Kfz-Kennzeichen von Åland bestehen aus einer maximal dreistelligen Buchstabenkombination, die mit ÅL beginnt und einer bis zu vierstelligen Zahl in blauer Schrift auf weißem Grund. Im oberen Teil des Kennzeichens ist das Wappen Ålands abgebildet, dahinter der Schriftzug ÅLAND und dann die Flagge Ålands. Es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Kennzeichens.
Kennzeichen für Anhänger beginnen mit ÅS gefolgt von einer meist vierstelligen Zahlenkombination. Temporäre Schilder weisen rote Schrift auf und beginnen mit ÅF. Sie werden als Klebefolie gefertigt. Nummernschilder für landwirtschaftliche Fahrzeuge zeigen blaue Schrift auf gelbem Grund.
Ältere Kennzeichen lehnen sich stark an das finnische System an und verwenden auch dessen Schriftart. Die alten Nummernschilder zeigen schwarze Schrift auf weißem Grund und keinerlei weitere Symbolik.
Die Verkehrsregeln entsprechen in etwa denen Schwedens und Finnlands. Erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist innerorts 50 km/h, außerhalb geschlossener Ortschaften 70 km/h und auf den Hauptstraßen, wo ausgeschildert, 90 km/h. Von Dezember bis mindestens Februar sind Winterreifen Pflicht, Spikes dürfen zwischen November und März verwendet werden. Innerhalb von Ortsgebieten ist Abblendlicht vorgeschrieben. Alkohol am Steuer ist bis 0,5 Promille erlaubt, bei höheren Dosen werden empfindliche Strafen verhängt. Maut- und Parkgebühren gibt es keine. Parken ist alledings nicht überall erlaubt. Wohnmobile dürfen überhaupt nur auf speziell ausgeiwesenen Plätzen abgestellt werden.
Schiffsverkehr
Bedingt durch die geografische Lage sind die Åländer und die åländische Wirtschaft stark von guten Verkehrsverbindungen abhängig. Neben dem traditionellen Hauptgewerbe der Landwirtschaft ist der Fremdenverkehr, insbesondere der Fährverkehr, in Åland zum bedeutendsten Wirtschaftszweig aufgestiegen. Begünstigt durch die Möglichkeit des zollfreiene Einkaufes produziert die Schifffahrt inzwischen 40 % des åländischen Bruttosozialproduktes. In diesem Bereich werden mehr Arbeitnehmer benötigt als auf dem åländischen Arbeitsmarkt verfügbar sind. Auf den åländischen Schiffen sind daher auch viele Arbeitnehmer aus Finnland und Schweden tätig.
Von Helsinki, Turku oder Stockholm aus fahren die großen Fähren der Reedereien Viking Line und Silja Line. Fährverbindungen bestehen auch zu den schwedischen Orten Kapellskär und Grisslehamn. Von der finnischen Seite kommt man auch mit den Schärenfähren von Vuosnainen und Galtby nach Åland. Während des Winterhalbjahrs gibt es zirka 20 Fährenabgänge pro Tag. In der Sommersaison sind es fast doppelt so viele nach Schweden und nach Finnland. Seit Frühling 2004 gibt es auch eine Fährverbindung nach Estland. Im Jahr 2000 wurden von den åländischen Fähren insgesamt 1.048.933 Passagiere befördert.
Insgesamt gibt es auf den Åland-Inseln rund zwanzig Hamnar (Häfen). Die wichtigsten sind Mariehamn, Käringsund / Storby, Svinö, Hummelvik / Vårdö, Degerby / Föglö, Sottunga, Finnö / Geta und Kumlinge. Åland verfügt über eine eigene Schiffsflotte, zu der im Jahr 2000 insgesamt 38 Schiffe mit einer Tonnage von 421.371 brt gehörten. 2004 fuhren 42 Schiffe mit zusammen 422.299 brt unter åländischer Flagge. Abseits der Häfen sorgen vier Fyrer (Leuchttürme) für einen sicheren Schiffsverkehr durch die Inselwelt.
Leuchttürme:
- Lågskär Fyr: 59°51‘ N, 19°55‘ O, erbaut 1859 (Leuchtfeuer seit 1806)
- Märket Fyr: 60°18‘ N, 19°08‘ O, erbaut 1885 (seit 1979 automatisiert)
- Rannö Fyr: 60°32‘ N, 20°12‘ O, erbaut 1962
- Sälskär Fyr: 60°25‘ N, 19°36‘ O, erbaut 1868
Aaland hat eine eigene Schiffsflotte, die hauptsächlich in Mariehamn stationiert ist.
Schiffsflotte Aalands:
| Aaland/Finnland | Fremde Flagge | |||||
| Jahr | Zahl | BRT | Zahl | BRT | ||
| 1990 | 23 | 226.500 | 29 | 735.000 | ||
| 1991 | 22 | 221.900 | 23 | 863.000 | ||
| 1992 | 26 | 285.933 | 19 | 706.000 | ||
| 1993 | 28 | 253.982 | 14 | 639.561 | ||
| 1994 | 30 | 328.406 | 13 | 588.075 | ||
| 1995 | 30 | 310.871 | 14 | 670.424 | ||
| 1996 | 30 | 317.511 | 12 | 584.895 | ||
| 1997 | 29 | 357.232 | 11 | 547.953 | ||
| 1998 | 30 | 391.324 | 13 | 644.446 | ||
| 1999 | 31 | 419.194 | 9 | 454.000 | ||
| 2000 | 30 | 414.730 | 11 | 449.000 | ||
| 2001 | 31 | 416.479 | 9 | 399.000 | ||
| 2002 | 31 | 416.397 | 14 | 468.896 | ||
| 2003 | 30 | 362.055 | 16 | 518.440 | ||
| 2004 | 33 | 416.133 | 17 | 475.200 | ||
| 2005 | 35 | 438.552 | 17 | 478.524 | ||
| 2006 | 30 | 394.177 | 20 | 555.673 | ||
| 2007 | 34 | 442.366 | 17 | 545.152 | ||
| 2008 | 37 | 541.049 | 19 | 594.281 | ||
| 2009 | 33 | 495.433 | .. | .. | ||
Flugverkehr
Der einzige Flugplatz des Landes befindet sich in Jomala nahe Mariehamn. Er wurde 1937 erbaut, 1940 für den Passagierverkehr zugelassen, in den 1960er Jahren vergrößert und 1991 generalsaniert. Im Januar 2005 wurde unter Federführung der Regierung Ålands mit breiter Unterstützung der åländischen Wirtschaft eine eigene Fluggesellschaft, Air Åland, mit Sitz in Mariehamn gegründet. Die Gesellschaft verbindet die åländischen Inseln mit Helsinki-Vantaa und Stockholm-Arlanda. Ende 2009 verfügte die Gesellschaft über zwei Flugzeuge.
Mariehamn Airport
- schwedischer Name: Mariehamn Flygplats
- finnischer Name: Maarianhaminan Lentoasema
- Code: MHQ / EFMA
- Lage: 60°07‘19” N, 19°53‘47“ O
- Seehöhe: 5,2 m (17 ft)
- Ort: bei Jomala, 3 km von Mariehamn
- Inbetriebnahme: errichtet 1937, eröffnet 1940, erneuert 1991
- Betreiber: Finavia
- Terminal: 1
- Rollfeld: 1
- Länge des Rollfeldes: 1903 m (Asfalt)
- Fluggesellschaften: 5
- Flugzeug-Standplätze: ca. 10
- Jährliche Passagierkapazität: ca. 110.000
- jährliche Frachtkapazität: ca. 900 t
- Flugfhafen-Statistik: Jahr Flugzeugbewegungen Passagiere Transfer Fracht in t Luftpost in t
1985 4 881 120 684 9 439 431,2 177,3
1986 5 305 105 254 636 364,0 121,2
1987 7 981 132 568 1 047 410,9 147,1
1988 6 169 146 955 1 043 472,6 178,5
1989 6 200 158 152 1 136 519,9 267,8
1990 5 612 157 678 140 468,0 265,8
1991 5 286 154 065 134 366,2 232,0
1992 4 422 126 973 59 317,3 227,8
1993 4 251 102 223 - 257,7 252,0
1994 3 173 102 072 - 241,3 333,9
1995 3 485 104 572 - 227,4 277,4
1996 2 233 107 154 24 199,3 422,2
1997 4 326 112 494 - 158,0 490,3
1998 4 332 118 324 - 360,0 379,0
1999 4 922 113 676 87 173,0 551,0
2000 5 032 96 539 - 253,0 377,0
2001 4 530 85 888 - 193,0 406,0
2002 3 758 64 644 10 144,0 397,0
2003 3 163 58 505 9 133,0 278,0
2004 3 103 58 353 1 220,0 162,0
2005 3 336 47 345 - 140,0 207,0
2006 3 916 64 043 - 150,0 260,0
2007 3 777 63 259 - 49,0 334,0
2008 4 349 62 110 - 218,0 230,0
2009 3 521 56 193 - 13,0 311,0
2010 48 672 -
2011 53 568 -
2012 54 797 -
2013 52 514 -
2014 52 097 -
2015 59 336 -
2016 59 544 -
2017 61 568 -
2018 1 389 54 640 -
2019 51 597 .
2020 23 962 .
Wirtschaft
Die Wurzeln des åländischen Wirtschaftslebens liegen in der Seefahrt, dem Fischfang und dem Ackerbau. Das heutige Erscheinungsbild der Wirtschaftsstruktur lässt sich fast immer auf diese Wurzeln zurückführen. Trotzdem war der Wandel von der Agrargesellschaft hin zu einem modernen, auf Dienstleistungen basierenden Markt schmerzvoll. Die freiwerdenden Arbeitskräfte im primären Sektor konnten nicht alle aufgefangen werden. Dies führte in der Nachkriegszeit bis zirka 1970 zu einer Auswanderungswelle vor allem nach Schweden. Der Fährverkehr zwischen Schweden, Finnland und Åland bildet das Rückrat der åländischen Wirtschaft. Dadurch bedingt gewann der Tourismus immer mehr an Bedeutung. Als kleine Region mit freier Wirtschaft ist Åland sehr auf Wirtschaftsbeziehungen zu den angrenzenden Regionen angewiesen.
Wegen der kapitalintensiven Schifffahrt liegt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sehr hoch, während die Einkommenssituation nicht höher liegt, als im übrigen Finnland. Das eigene Angebot an Arbeitskräften auf Åland reicht nicht aus, um den Bedarf der Seefahrt zu decken, weshalb auf åländischen Schiffen viele Arbeitnehmer aus Finnland und Schweden beschäftigt sind.
Landwirtschaft
Der Primärsektor, also Landwirtschaft und Fischerei hat trotz seiner verhältnismäßig bescheidenen wirtschaftlichen Ertragskraft eine wichtige Bedeutung in den geringbesiedelten Gebieten und im Schärengebiet. Zudem liefert er die Rohmaterialien für die wichtige Lebensmittelindustrie. Kleine Flächen und ein prädestiniertes klima haben die Orientierung der Landwirtschaft auf den Anbau von besonderen Produkten begünstigt. In diesem Zusammenhang kann man zum Beispiel Zwiebeln, Chinakohl, Zuckerrüben, Kartoffeln und Äpfel nennen.
Die traditionelle Landwirtschaft ist in neuerer Zeit in ihrer Bedeutung hinter den Dienstleistungssektor zurückgetreten, nehmen aber unverändert eine wichtige Rolle im åländischen Wirtschaftsleben ein. Im Jahr 2004 waren 5,3 % der Arbeitnehmer in der Land- oder Forstwirtschaft beschäftigt. Auch die Industrie Ålands, in welcher 9,8 % der Arbeitnehmer tätig sind, steht mehrheitlich mit der Veredelung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Fischereiprodukten in Verbindung. Von der Landfläche Ålands sind 9 % Ackerland, 4 % Weideland und 58 % Wald.
Auf den Inseln gibt es hauptsächlich Felder mit kleinem Zuschnitt. Aus diesem Grund und wegen des milden Klimas herrscht der Spezialanbau von Kartoffeln, Zwiebeln, Äpfel, Gurken, Chinakohl, Zuckerrüben usw. vor. Besonders bekannt für ihre Qualität sind die Kartoffeln. Ende der 1960er Jahre machte sich die Chips Oy Ltd eine Marktlücke zu Nutze, da bis dahin noch keine Firma in Finnland Kartoffelchips produzierte. Heute zählt die Firma mit 500 åländischen Beschäftigten zu den wichtigsten Arbeitgebern der Inseln und unterhält Produktions- und Vertriebsstätten in Norwegen, Schweden, Finnland und Estland. Neben Chips Oy Ltd gibt es noch einige weitere Betriebe zur Nahrungsmittelveredelung. Außerdem gibt es noch Betriebe zur Verarbeitung der auf den Inseln produzierten Milch. Fleisch aus der Viehhaltung wird in den 3 Schlachthöfen verarbeitet.
Die Hauptprodukte der Landwirtschaft Ålands sind Zuckerrüben, Kartoffeln, Zwiebeln, Gerste, Hafer und Weizen. In geringerer Menge werden unter anderem Chinakohl und Äpfel produziert. In der Viehwirtschaft überwiegt die Milchproduktion mit 14.433 t Jahresertrag 2004. Die Zahl der Höfe ging unterdessen stetig zurück. 1990 gab es 520, 1995 nur noch 406 bäuerliche Betriebe in Åland. Der Tierbestand beläuft sich auf insgesamt rund 120.000 Tiere.
Agrarland in ha:
| 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Agrarland insgesamt | 14.282 | 13.757 | 13.790 | 13.323 | 13.881 | 13.951 | 13.962 |
| Gras- & Weideland | 3.421 | 4.236 | 5.470 | 5.773 | 6.090 | 6.239 | 6.244 |
| Grobgetreide | 4.006 | 3.875 | 2.927 | 2.692 | 2.506 | 2.679 | 2.720 |
| Brotgetreide | 1.845 | 1.817 | 1.544 | 1.578 | 1.713 | 2.187 | 2.206 |
| Ölopflanzen | 145 | 28 | 40 | 81 | 153 | 302 | 209 |
| Zuckerrüben | 1.167 | 1.119 | 1.167 | 849 | 542 | 143 | 141 |
| Kartoffel | 851 | 779 | 748 | 836 | 862 | 866 | 879 |
| Sonstige Früchte | 1.608 | 911 | 790 | 772 | 767 | 726 | 712 |
| Brachland | 1.240 | 992 | 1.104 | 742 | 1.248 | 809 | 851 |
| Ökologischer Landbau | .. | 1.275 | 2.282 | 2.910 | 2.990 | 2.999 | 2.813 |
Landwirtschaftliche Betriebe:
1990 979
2000 713
2005 614
2006 617
2007 597
2008 589
2009 569
Tierbestand: 1995 2004
Geflügel 93 191 96 000
davon Hühner 11 900 13 185
Schafe 6 222 7 382
Rinder 7 755 7 347
Schweine 1 878 995
Pferde 143 225
Anbauproduktion in t: 2004
Zuckerrüben 44 514
Kartoffeln 15 969
Zwiebeln 5 669
Weizen 4 836
Hafer 3 312
Gerste 2 285
Chinakohl 1 902
Äpfel 1 587
Roggen 800
Fischerei
Ein wesentlicher Teil der finnischen Fischereiflotte ist auf den Åland-Inseln beheimatet. Gefangen wird hauptsächlich Hering. Während die Bedeutung der Fischerei nachlässt, haben die Fischzuchtanstalten einen Zuwachs zu verzeichnen. Einige Betriebe der fischverarbeitenden Industrie sind im Bereich der Inseln angesiedelt.
Die åländischen Fischer fuhren 2004 einen Fang von insgesamt 3300 t ein, wovon Heringe mit 2541 t den größten Anteil einnahmen. Die 36 Fischzuchten Ålands erbrachten im gleichen Jahr einen Ertrag von 3210 t. Dies kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Fischfangquote seit den 1990er Jahren stetig sinkt.
Fischproduktion in t:
2000 7200
2001 5460
2004 6510
Forstwirtschaft
Der Anteil der Holzwirtschaft ist natürlich im Vergleich zum finnischen Festland gering. Das aus den åländischen Bäumen gewonnene Holz zeichnet sich jedoch durch eine hohe Qualität aus. Es darf nicht mehr Holz geschlagen werden, als nachwachsen kann (jährlich zirka 250 000 m²). Holzschliff für finnische und schwedische Papierfabriken und Schnittholz werden exportiert. Außerdem wird der Grundstoff in åländischen Betrieben der Holzverarbeitung benötigt. Die Forstbetriebe Ålands erbrachten im Jahr 2004 einen Ertrag von 73.418 cbm Nutzholz und 143.401 cbm Festholz.
Handwerk
Besonders im maritimen Viertel Sjökvarteret in Mariehamn ist traditionelles Handwerk lebendig. Hier werden Boote nach alter Technik gebaut, Schmiede führen ihr Handwerk aus und es werden weitere traditionelle Handwerkskünste gepflegt. Besucher können nicht nur beim Bau – etwa einer hölzernen Schute – zuschauen, sondern auch Werkstätten, das Bootsbaumuseum und die Seefahrerkapelle besichtigen.
Auf Åland existiert eine lebendige Gemeinschaft von Kunsthandwerkern, schwedisch Ålands Slöjd & Konsthantverk (früher Ålands hemslöjdsförening), darunter Glasbläser, Töpfer und Weber. Viele Werkstätten und kleine Ateliers sind über die Insel verteilt und laden zum Besichtigen und Kaufen ein. Das Angebot reicht von Glas- und Keramikkunst über Wolltextilien, Stoffdrucke, Holzarbeiten bis zu Schmuck. In vielen weiteren Werkstätten und kleinen Ateliers auf den Åland-Inseln werden ebenfalls traditionelle Techniken mit modernem Design und praktischen Nutzungsmöglichkeiten verbunden.
In Mariehamn und an den Häfen gibt es attraktive Läden, die exklusive Handwerksprodukte, von Holzarbeiten bis Schmuck, anbieten. Besonders beliebt sind der Handwerksladen Salt und die Goldschmiedeboutique Guldviva im Sjökvarteret. Orte wie das Stickstugan Hantverk & Café verbinden traditionelle Handarbeit mit kulinarischem Angebot. Hier trifft man auf handgefertigte Produkte und eine kreative Atmosphäre, häufig verbunden mit lokalen Veranstaltungen und Märkten.
Das Freilichtmuseum Jan Karlsgården zeigt historische Bauernhöfe und Werkstätten wie Schmieden, zu bestimmten Zeiten finden hier Feste und Märkte mit traditionellem Handwerk statt. Auch andere Museen (Kökar Museum, Föglö-Museum) bieten Einblicke in das ländliche und handwerkliche Leben vergangener Zeiten.
Industrie
Die Wirtschaft Ålands ist durch eine hohe Quote von kleinen und mittleren Unternehmen geprägt. In der Provinz sind etwa 2600 Unternehmen tätig. Von diesen gehören etwa 700 zum primären Sektor, inklusive Nahrungsmittelproduktion. Ebenso viele gibt es im Dienstleistungsbereich, etwas weniger in der Baubranche. Der Rest, rund 600 Betriebe verteilen sich auf Handel, Transport und die herkömmliche Industrie. In etwa 90 % der Unternehmen sind weniger als zehn Arbeitnehmer beschäftigt.
Die Industrie auf Åland ist überschaubar im Vergleich zu den Industrien der Umgebung, aber sie hat für den Export dennoch eine wichtige Bedeutung. Da die Industrie in erster Linie landwirtschaftliche Produkte und Fisch veredelt, hat sie eine mittelbare Wirkung auf den Arbeitsmarkt. Auf Åland hat sich zudem eine bemerkenswerte, internationale und hochtechnologisierte Plastikindustrie angesiedelt. Außerdem gibt es auf Åland metallverarbeitende Industrie, Maschinen- und Holzwerkstätten, Buchdruckereien, Unternehmen der Informations-Technologie und Elektronikfirmen.
Die Arbeitslosenquote ist seit Jahren sehr niedrig und in den Sommermonaten oftmals die niedrigste in Europa. Die Arbeitslosenquote lag Anfang Dezember 2005 bei 2,3 %. Wegen der großen Bedeutung des Tourismus wird der Arbeitsmarkt teilweise durch sommerliche Saisonarbeitsplätze geprägt, wodurch die Arbeitslosigkeit in dieser Zeit regelmäßig am niedrigsten liegt. Konkret betrug sie 2001 1,9 %, 2002 1,8 %, 2003 1,9 % und 2004 2,3 %. Das waren zuletzt 355 Personen.
Die Beschäftigungssituation war nach der Rezession Mitte der 1990er Jahren ausgesprochen gut, was teilweise auf die geografische Lage von Åland zurückzuführen ist. Die Nähe zu den Regionen Stockholm und Helsinki hat es jungen Leuten ermöglicht, auch dann Arbeits- und Ausbildungsplätze zu finden, wenn in der Heimat eher unsichere Verhältnisse vorherrschten. Auf Åland ist die Arbeitslosigkeit schon lange sehr niedrig. Heutzutage beträgt sie 2,2 Prozent. Der langfristige Bedarf an Arbeitskräften im Gesundheitswesen sowie im Unterrichtsbereich sind auf Åland ebenso ein Problem, wie auch sonst in den nordischen Ländern.
Die Beschäftigtenstruktur Ålands entwickelte sich im letzten Jahrzehnt wie folgt:
Erwerbstätige 2002
insgesamt 15 409
Landwirtschaft und >Fischerei 709 4,60 %
Industrie, Bau und Energiewirtschaft 2 195 14,24 %
Transport und Kommunikation 4 483 29,09 %
Handel, Fremdenverkehr und Geldwesen 2 899 18,81 %
Dienstleistungen 4 746 30,80 %
sonstige 384 2,49 %
„Während es den Aländern auf dem festen Aland und besonders im Bereich der Hauptstadt Mariehamn dank Schifffahrt, Handel und Fremdenverkehr wirtschaftlich recht gut geht, kämpfen die abgelegeneren Schärengemeinden diesbezüglich mit größeren Problemen. Die traditionellen Erwerbszweige Fischerei, Land- und Forstwirtschaft sind auf dem nordischen Archipel mit viel Arbeit verbunden und der Verdienst aufgrund der langen Winter dennoch gering. Zwar ist die Landwirtschaft durch den Betrieb von großen Treibhäusern nicht mehr dermassen saisongebunden wie früher. Auch sind die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen dank maschineller Hilfe heute einfacher zu bestellen. Trotzdem verlieren die äußeren Inseln ihre jungen Leute zunehmend an Mariehamn, wo das Geschäft mit den Touristen blüht, oder gar an Finnland und Schweden mit ihren breit gefächerten Betätigungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten. So besteht heute leider die Gefahr, dass sich der aländische Archipel besonders in den peripheren Gebieten mehr und mehr entvölkert und allmählich zur reinen Feriengegend verkümmert.“ (Kappeler 1992)
Dienstleistungen
Åland ist eine kleine Gesellschaft mit einer offenen Wirtschaft, welche im großem Maße vom Austausch von Waren und Dienstleistungen mit den umliegenden Regionen abhängig ist. Die Lage von Åland zwischen zwei wachsenden Wirtschaftszentren, Südfinnland und Stockholm, bringt viele Vorteile mit sich, aber macht Åland wirtschaftlich auch abhängig von den konjunkturschwankungen zweier benachbarter Märkte. Das Unternehmertum hat auf Åland eine lange tradition. In der Region gibt es 2.100 Unternehmen, von denen 600 landwirtschaftliche Betriebe sind. Zwanzig Betriebe haben mehr als 50 Arbeitnehmer.
Dazu gehören zum Beispiel Schiffsreedereien, Banken und Versicherungen. Etwa 90 Prozent der åländischen Unternehmen haben weniger als zehn Mitarbeiter, viele sind Einpersonenfirmen. Die åländische Wirtschaft ist stark dienstleistungsorientiert, wobei der Schifffahrtssektor eine wichtige Position einnimmt. Er macht immerhin 30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes von Åland aus.
Wasserwirtschaft
Die Region verfügt über moderne Anlagen zur Aufbereitung von Trinkwasser, wie unter anderem durch den Einsatz von Ozon-Desinfektionssystemen bei Ålands Water. Diese Technik stellt sicher, dass auch während der Sommermonate, in denen sich die Inseln mit Touristen füllen, qualitativ hochwertiges Trinkwasser bereitgestellt werden kann.
Das Wasser rund um Åland ist technisch zwar Meerwasser, hat jedoch einen deutlich geringeren Salzgehalt als in anderen Ostseebereichen. Dies wirkt sich günstig auf die Artenvielfalt der Fische aus und macht Åland zu einem beliebten Angelgebiet. Die Landschaft ist durch die Landhebung nach der Eiszeit geprägt, was zahlreiche flache Gewässer und Feuchtgebiete entstehen ließ. Der jährliche Niederschlag beträgt etwa 541 mm und ist damit niedriger als auf dem finnischen oder schwedischen Festland.
Åland besitzt mit dem Lemströmskanal eine künstliche Wasserstraße, die einen wichtigen schiffbaren Zugang im Archipel darstellt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Fährverbindungen und Kabelfähren, die als alltägliche Transportmittel funktionieren.
Die Ostsee spielt eine wichtige Rolle für das lokale Klima und die Wasserversorgung. Die Regierung und lokale Unternehmen investieren zunehmend in nachhaltige Energie- und Umweltschutzprojekte, etwa im Rahmen der Initiative „Smart Energy Åland“, wobei auch der schonende Umgang mit den Wasserressourcen ein Ziel ist.
Energiewirtschaft
Åland ist in der Energieversorgung auf Importe aus Finnland und Schweden angewiesen. Auf den Inseln gibt es einige Öl- und Windkraftanlagen. Der jährliche Stromverbrauch auf den Åland-Inseln liegt bei etwa 300 GWh. Der Pro-Kopf-Verbrauch der Åländer lag im Jahr 2007 bei 9.854,3 kWh. Rund 62 MW installierte Windkraft liefern pro Jahr etwa 180 GWh und decken damit 60% des Strombedarfs. Photovoltaik-Anlagen (überwiegend auf Dächern) leisten 15 MW und produzieren etwa 12 GWh (4%). Bioenergie trägt mit 2 MW zu weiteren 3 GWh bei (1%).
Das Stromnetz ist durch Hochspannungs-Seekabel sowohl mit Schweden als auch Finnland verbunden und garantiert Versorgungssicherheit. Etwa 145 GWh werden jährlich importiert, 40 GWh exportiert. Für Notfälle existieren Reservekraftwerke (Gas- und Dieselgeneratoren). Åland arbeitet derzeit an mehreren Offshore-Windkraftprojekten wie dem Sunnavind-Projekt mit bis zu 4 GW geplanter Kapazität. Ferner ist die Integration von großtechnischer grüner Wasserstoffproduktion geplant, um sowohl die lokale Energiewende als auch die Versorgung der gesamten Ostseeregion zu unterstützen. Mit Projekten wie Smart Energy Åland und dem Einsatz von Energiespeichern (BESS) demonstriert die Insel ihre Rolle als Testlabor für ein nachhaltiges, flexibles Energiesystem. Ziel ist eine vollständige Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen und die Dekarbonisierung von Strom, Wärme und Mobilität.
Trotz finnischer Zugehörigkeit ist Åland Teil der schwedischen Strompreiszone SE3, da die Hauptanbindung weiterhin nach Schweden besteht. Das Netzmanagement erfolgt durch verschiedene lokale Unternehmen, vorrangig Kraftnät Åland (Übertragungsnetz) sowie die Versorger Ålands Elandelslag und Mariehamns Energi (Verteilnetze).
Åland positioniert sich als innovativer Vorreiter für erneuerbare Energiesysteme in Europa, durch gezielten Ausbau von Windkraft, Sonnenenergie, Wasserstoff und intelligenter Netztechnik. Die Entwicklung des Insel-Clusters zum Energy Island könnte sowohl regionalwirtschaftlicher und auch klimapolitischer „Leuchtturmcharakter“ gepriesen.
Elektrizität in GWh 1995 2000 2005 2007
Produktion 79 34 23 37
Verbrauch 211 242 266 268
Abfallwirtschaft
Im Jahr 2015 fielen in Åland insgesamt 80.100 t Müll an. Rund 75 % wurden auf der Inselgruppe entsorgt, der Rest zu 52 % nach Schweden und zu 47 % nach Finnland exportiert. Konkret entwickelte sich die Abfallsituation wie folgt:
Müll 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Müll gesamt 31 827 27 015 29 303 40 980 84 241 80 052
Müllexport 16 676 16 328 17 723 27 604 16 399 18 066
Müll in Åland 17 584 9 783 9 667 23 101 66 053 59 789
Handel
Der internationale Handel ist vor allem der Einwohner von Mariehamn ein wichtiger Wirtschaftszweig. Mehr als 60 Schiffe (mit insgesamt rund 750.000 Bruttoregistertonnen Rauminhalt) umfasst die aländische Flotte derzeit; das entspricht mehr als einem Drittel der gesamten finnischen Handelsflotte. Zum anderen ist der Fremdenverkehr von großer wirtschaftlicher Bedeutung: Mehr als eine Million ausländischer Besucher verzeichnet Aland Jahr für Jahr. Entsprechend sind die Einkaufsmöglichkeiten in Mariehamn: Das Angebot ist weit größer, als man es von einer Stadt mit 11.000 Einwohnern erwarten würde.
Åland unterhält eine eigene Handelskammer. Sie setzt sich unter anderem für die Erweiterung des souveränen Steuerrechts der Provinz für Handel und Gewerbe ein. Von den rund 2000 auf Åland tätigen Firmen sind 1100 der Handelskammer angeschlossen. Neben den etwa 20 Großbetrieben sind dies vor allem kleine Unternehmen. 85 % davon beschäftigen nur 1 bis 5 Personen.
Finanzwesen
Åland gehört mit Finnland zur Europäischen Union. Aufgrund des Protokolls Nr. 2 des Vertrages zum Beitritt Finnlands zur Europäischen Gemeinschaft ist Åland allerdings von der Anwendung der gemeinschaftlichen Vorschriften zur Angleichung der Umsatz- und Verbrauchssteuern ausgenommen. Als Konsequenz ist auf Reisen von Finnland oder Schweden nach Åland weiterhin steuerfreier Einkauf möglich. Die offizielle Währung ist wie im restlichen Finnland der Euro, unterteilt in 100 Cent, wobei allerdings nur Zehn-Cent-Stücke ausgegeben werden. Insgesamt gibt es auf der Inselgruppe 31 Finanzunternehmungen, darunter 20 Ålandsbanken, sieben Andelsbanken und vier Versicherungen.
Auch hier sind die Beziehungen zur Schiffahrt augenscheinlich. Das Versicherungswesen hat den Ursprung in der Praxis der auf mehrere Schiffe verteilten Anteile. Die Alandia Group versichert heute Schiffe im Wert von 6 Milliarden Finnmark. Åländische Versicherungen sind auch im Bereich der Freizeitboote spezialisiert. Das größte Bankhaus, die Ålandsbanken, wurde 1919 vom Segelschiffkönig Gustav Erikson gegründet. Sie jhat heute 30 Zweigstellen in Finnland und Schweden. Das zweite größere Bankunternehmen ist die Andelsbanken för Åland.Ebenfalls von Erikson gegründet wurde der der Vorläufer der Alandia Group gegründet. Als Segelschiffe aus der Mode kamen, kaufte Erikson sie billig auf und machte mit Frachttransporten ein Vermögen.
Gesundheit und Soziales
Åland bildet einen eigenen autonomen Gesundheits- und Sozialbezirk innerhalb Finnlands. In beiden Bereichen, sowohl was die Gesundheit betrifft, als auch in Bezug auf die soziale Situation gilt das Inselreich EU-weit als vorbildhaft. Die Inselgruppe verfügt über ein eigenes, gut ausgebautes öffentliches Gesundheitssystem („Ålands hälso- och sjukvård“, ÅHS), inklusive Gesundheitszentren in Mariehamn und Godby sowie ein eigenes Krankenhaus. Die medizinische Versorgung entspricht modernen europäischen Standards.
Im Jahr 2000 taten in auf der Inselgruppe insgesamt 51 praktische Ärzte Dienst, was einem Durchschnitt von 505,4 Personen pro Arzt entspricht - eine erstaunliche Dichte. Schwerwiegendere Fälle werden in zwei Krankenhäusern mit zusammen 138 Betten behandelt. Ålands Centralsjukhus (Zentralkrankenhaus) in Mariehamn verfügt über 106 Betten, dieim Jahr 2004 insgesamt 22.419 mal belegt waren. Das Grelsby Sjukhus für mentale Krankheiten hat 32 Betten, für die 8361 Nächtigungen gemeldet wurden.
Die 6016 Pensionisten des Jahres 2004 lebten im Kreise ihrer Verwandten. Familienleben hat noch einen großen Stellenwert im Leben der Bewohner Ålands.
Krankheiten
Auf Åland gibt es keine spezifischen Krankheitsrisiken, die sich grundlegend von denen des finnischen Festlands unterscheiden. Zu den relevanten Krankheiten auf Åland zählen:
- Åland-Island-Augenkrankheit: Diese sehr seltene, X-chromosomal-rezessiv vererbte Erkrankung wurde erstmals auf den Åland-Inseln beschrieben. Sie führt unter anderem zu verminderter Sehschärfe, Nystagmus, Astigmatismus, Nachtblindheit und Rotblindheit (Protanopie). Hauptmerkmal ist ein hypopigmentierter Augenhintergrund mit fortschreitender Kurzsichtigkeit. Die Erkrankung ist extrem selten, kommt aber weltweit vereinzelt vor, der Ursprung liegt jedoch auf Åland.
- FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis): Die Åland-Inseln gelten als FSME-Risikogebiet. Die Krankheit wird durch Zeckenstiche übertragen; eine Impfung gegen FSME wird deshalb für Reisende empfohlen, die sich viel in der Natur aufhalten. Weitere durch Zecken übertragene Erkrankung ist die Borreliose, für die jedoch aktuell keine Impfung existiert.
Bildung
Åland ist in Sachen Bildung völlig autonom. Die Unterrichtssprache ist in sämtlichen Schulen auf Åland Schwedisch. Die neun Jahre dauernde Grundschule, für welche die Gemeinden verantwortlich sind, vermittelt eine allgemeine Grundausbildung. Englisch ist ein obligatorisches Unterrichtsfach, während Finnisch, Französisch und Deutsch wählbare Unterrichtsfächer sind. Die Schulen auf Åland sind relativ klein. Eine geglückte Sache sind die kleinen Oberstufenschulen in den Schären. Somit können die Schüler bis zur 9. Klasse an ihrem Wohnort den Unterricht besuchen und müssen für die obligatorische Schulzeit nicht von zuhause wegziehen.
In Åland gibt es 25 Schulen; viele von ihnen haben nur 20 bis 30 Schüler. Die kleinste Schule besuchen nur drei Kinder. Auf rund 3.000 Schüler kommen etwa 300 Lehrer und 200 sonstige Bedienstete. Unterrichtssprache ist Schwedisch; Englisch wird ab der dritten Schulstufe unterrichtet. Finnisch, Französisch und Deutsch werden als Wahlfächer angeboten. „70 Prozent der Schüler lernen Finnisch als erste Fremdsprache“, berichtet Yvonne Eliasson vom åländischen Ministerium für Unterricht und Kultur. „Zwischen Schülern und Lehrern besteht ein freundschaftliches Verhältnis und die geringe Schülerzahl trägt dazu bei, dass das Bildungsniveau hoch ist“, betont Eliasson. Die Mittelschulausbildung absolvieren rund 1.000 Schüler pro Jahr. 750 weitere gehen außerhalb Ålands in weiterführende Schulen, meist in Schweden. In Mariehamn gibt es eine Fachhochschule. Die Schülerinnen und Schüler können sich ihren Stundenplan selbst zusammenstellen. Es gibt obligatorische Fächer wie Englisch und Mathematik nd Wahlfächer. Gelernt wird in Gruppen, auch Klassen übergreifend.
Das Bildungsnetz ist gut ausgebaut. Jede der 16 Kommunen verfügt über eine Grundschule, in der die Schüler die ersten neun Schuljahre und damit die gesamte Dauer der Schulpflicht verbringen. Auf Åland gibt es eine Gymnasiumsausbildung für Schiffahrt, Handel, Tourismus, Krankenpflege, Küche, Technik und Landwirtschaft, die alle für die åländische Wirtschaft von Bedeutung sind. Außerdem gibt es eine Krankenpflegeschule. Eine drei Jahre dauernde theoretische Gymnasiumsausbildung im Ålands Lyceum berechtigt zur Zulassung für Universitäts- und Hochschulstudien.
Die Zahl der Schulen ist ebenso wie die der Schüler in den letzten Jahren stark rückläufig. Im Jahr 2004 besaß Åland insgesamt 34 Grund- und Sekundarschulen. 1999 waren es noch 36.
Schulen und Schüler: 1999 2004 2014
insgesamt 36 4 207 34 3 047 36 4 491
Grundschulen 24 2 838 25 1 998 24 1 910
Sekundarschulen 12 1 369 9 1 049 10 2 091
Universität 1 390 1 490
Höhere Bildung
Alle weiterführenden Lehranstalten, insbesondere die gymnasiale Oberstufe, sind in der Hauptstadt Mariehamn konzentriert. In Mariehamn werden auch zahlreiche Berufsausbildungen angeboten. In der 2003 gegründeten Högskolan på Åland (Hochschule Aaland) können die derzeit 600 Studenten über 60 Lehrpersonen verschiedene Fachhochschulabschlüsse machen.
Für weitergehende universitäre Ausbildung müssen die Universitäten im Ausland aufgesucht werden, wobei die große Mehrheit der åländischen Studenten, rund zwei Drittel, sich für die schwedischen Hochschulen entscheidet. Die Mehrheit der Jugendlichen, die an einer Universität oder Hochschule studieren, verlassen Åland für eine gewisse Zeit, um in Schweden oder Finnland zu wohnen. Im Jahr 2004 waren dies 1.222 Personen. Für 2015 wurden folgende Zahlen angegeben:
Auswärtige Studenten:
| Gesamt | Sekundarschulen | Universitäten | Höhere Schulen | |
| Insgesamt | 1.475 | 232 | 1.172 | 71 |
| Geschlecht | ||||
| weiblich | 902 | 167 | 689 | 46 |
| männlich | 573 | 65 | 483 | 25 |
| Land | ||||
| Finnland | 426 | 65 | 344 | 17 |
| Schweden | 969 | 158 | 764 | 47 |
| andere | 80 | 9 | 64 | 7 |
| Alter | ||||
| 17-19 | 170 | 92 | 70 | 8 |
| 20-24 | 814 | 68 | 706 | 40 |
| 25-29 | 344 | 35 | 296 | 13 |
| 30+ | 147 | 37 | 100 | 10 |
Kurse zur Erwachsenen-Weiterbildung werden angeboten von Medis (Medborgarinstitutet in Mariehamn), Ålands Bildningsförbund, ABF Åland und Ålands Folkhögskola.
Bibliotheken und Archive
Die Mariehamns stadsbibliotek (Stadtbibliothek Mariehamn) ist das größte und wichtigste Bibliothekszentrum der Åland-Inseln und dient zugleich als zentrale Bibliothek für die gesamte Region. Auch die kleineren Gemeinden verfügen über eigene, meist kleinere Bibliotheken; der Großteil des Bibliothekswesens ist jedoch in Mariehamn gebündelt.
Kultur
Åland verfügt über ein – gemessen an der Einwohnerzahl – lebhaftes Kulturleben. Eswird zu einem großen Teil von Vereinen getragen, während die Verantwortung für die gesellschaftlichen Kultureinsätze zwischen der öffentlichen Hand und den Gemeinden geteilt wird. Fünfzig dieser Vereine werden aus den Erträgen der staatlichen åländischen Glücksspielgesellschaft unterstützt. Weiteren Rückhalt erhält das kulturelle Leben in Åland durch die Tätigkeit des Nordens Institus på Åland (Nordisches Åland-Institut), einer vom Nordischen Ministerrat getragenen Institution zur Förderung der åländischen Kultur. Das Institut hat unter anderem zahlreiche umfangreiche Theaterproduktionen ermöglicht, in welchen sowohl Profischauspieler wie auch Laien mitgewirkt haben. Die åländische Theaterkultur hat ihre Wurzeln in den Jugendvereinen, die gegen das Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Heute werden größere Aufführungen oft in Zusammenarbeit zwischen professionellen Artisten und Amateuren durchgeführt.
Museen
Eine wichtige Inspirationsquelle war die åländische Landschaft vor allem für die Bildkunst. Ein wichtiges Museum zu dieser Thematik ist das Önningeby-Museum, das Kunstwerke der sogenannten Önningebykolonie zeigt. Die Önningebykolonie wurde vom Künstler Victor Westerholm geleitet und war von der Zeit um die Jahrhundertwende bis zum ersten Weltkrieg aktiv. Weitere wichtige Museen Ålands sind:
- Ålands Museum in Mariehamn: Diese 1982 als „Jahresmuseums Europas“ ausgestattete Einrichtung schildert die Geschichte von der vorgeschichtlichen Zeit bis zur Neuzeit. Auf dem Lande gibt es eine große Anzahl von kleineren Sammlungen, die von großem historischen Wert sind.
- Ålands Kunstmuseum in Mariehamn: Diese 1955 geplante und 1963 eröffnete Einrichtung bietet einen profunden Überblick über das gesamte Kunstschaffen der Inselgruppe.
- Ålands Sjöfartsmuseum in der Hamngatan in Mariehamn: Dieses Schifffahrtsmuseum beschäftigt sich hauptsächlich mit der starken åländischen Schifffahrtstradition. Es zeigt wichtige Sammlungen aus der Segelschiffsepoche. Die åländische Schiffsbaukunst konnte hier bewahrt werden, indem man nach dem Vorbild älterer Modellen neue Schiffe nachbaute.
- Ålands Skolmuseum in Vårdö: 1888 grundgelegt, findet man hier einen guten Überblick über die schulische Entwicklung der Inselgruppe.
- Museigården Hermas in Enklinge in der Gemeinde Kumlinge: Dieses Museumsdorf Ålands besteht aus Holzhäusern, die großteils über hundert Jahre alt oder noch älteren Bautraditionen nachgebaut sind.
- Kann Karlsgården Friluftmuseum in der Sunds Kommun: Rund um einen Bauernhof aus dem frühen 19. Jahrhundert entstand das zweite Museumsdorf Ålands. Es beschäftigt sich vor allem mit bäuerlichen Traditionen des Archipels.
- Kastelholms Slott, ebenfalls in der Gemeinde Sund: Dieses einzige Schloss der Inselgruppe stammt in ihrem Grundkonzept aus dem 13. Jahrhundert. Es bietet heute einen kleinen Einblick in die mittelalterliche Geschichte Ålands.
- Bomarsunds Fästningsruiner in der Sunds Kommun: Die zwischen etwa 1830 und 1856 bestehende russische Festung wurde zu einem Museumsareal ausgebaut, auf dem immer wieder historische Veranstaltungen stattfinden.
- Ålands Jakt och Fiskemuseum in Eckerö: Es ist dies ein auf Jagd und Fischfang spezialisiertes Museum mit Gallerie und Shop.
- Klosterkällaren der Franciscuskapellet in Kökar auf Hamnö: Diese museumsartig ausgestaltete historische Stätte aus dem 17. Jahrhundert bietet unter anderem archäologische Schaugrabungen.
- Kronohäktet Vita Björn in der Sunds Kommun: Dieses Haus aus dem Jahr 1784 beherbergt seit 1975 ein kleines Museum.
- Langbergsöda in Saltvik: In der Nähe jener Stätte, wo die ältesten Gegenstände Ålands ausgegraben wurden, wurde – teilweise im Freien – ein Museumsbereich eingerichtet, in dem das steinzeitliche Leben auf der Inselgruppe nachgestellt ist.
- Borgboda och Idas Stuga ebenfalls in Saltvik: Hier handelt es sich um eine bemerkens- und vor allem sehenswerte archäologische Ausgrabungsstätte.
- Lemböte Kapell in Lemland: Diese in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts errichtete Kapelle ist als Gotteshaus heute nicht mehr in Gebrauch, dient aber als kleines Museum.
Neben diesen gibt es noch 25 kleinere Museen und historische Ausstellungsorte in Åland. Sie bieten kleine Einblicke in die Geschichte, Ethnologie, Spiritualität und das Brauchtum der Inselgruppe. Letzteres hat sich im Lauf der Zeit massiv verändert.
Architektur
Die Architektur Ålands weist kaum nennenswerte Eigenheiten gegenüber der finnischen und schwedischen Architektur auf. Kulturgeschichtlich bedeutsam ist aber die für finnische Verhältnisse hohe Dichte alter Bausubstanz. Da die Inselgruppe bereits früh unter dem Einfluss des Schwedischen Reiches stand, ist auf Åland eine größere Zahl mittelalterlicher Gebäude erhalten. Hierzu gehören neben der aus dem 14. Jahrhundert stammenden Burg Kastelholm, einer von nur sieben Burgen im Gebiet des heutigen Finnlands, die 13 Feldsteinkirchen des Archipels. Der mittelalterliche Kirchenbau setzte auf Åland früher ein als auf dem finnischen Festland. So ist die zwischen 1275 und 1285 errichtete Kirche von Jomala wahrscheinlich das älteste erhaltene Gebäude Finnlands. Ein ähnlich hohes Alter erreichen die Kirchen von Lemland, Sund, Hammarland, Saltvik und Eckerö. Während die restlichen mittelalterlichen Steinkirchen Finnlands der Gotik zuzurechnen sind, zeigen die ältesten åländischen Kirchen noch romanische Einflüsse. Anders als auf dem finnischen Festland verfügen die Kirchen auf Åland meist nach dem Vorbild der Landkirchen Gotlands über einen Kirchturm. Das Innere der Kirchen ist mit Seccomalereien von teils hohem künstlerischem Wert ausgeschmückt.
Bildende Kunst
Das wichtigste Zentrum für bildende Kunst ist das Åland Island Art Museum (Konstmuseum) in Mariehamn. Es zeigt Gemälde, Skulpturen und Werke lokaler Künstler und bietet einen guten Überblick über die Entwicklung und Vielfalt der åländischen Kunst. Das Museum ist zwar relativ klein, überzeugt jedoch durch eine vielfältige Sammlung regionaler Kunstschaffender und wechselnde Ausstellungen.
Die lokale Kunstszene ist von einer überschaubaren, aber aktiven Gemeinschaft geprägt. Werke spiegeln häufig Naturmotive, das Inselleben sowie ästhetische und soziale Themen wider, die mit Åland verbunden sind. Auch Fotografie spielt eine Rolle: Das Ålands Fotografiska Museum (Fotografiemuseum) beherbergt die größte Sammlung fotografischer Geräte in Skandinavien und fördert fotografische Kunst mit lokalem Bezug.
Viele Künstler und Kunsthandwerker auf den Åland-Inseln lassen sich von der unberührten Natur, Flora, Fauna und der Abgeschiedenheit inspirieren. Die Landschaft und das Licht der Schären spiegeln sich in zahlreichen Werken wider und prägen den Stil der lokalen bildenden Kunstszene. Neben Einzelkünstlern bereichern auch temporäre Ausstellungen, Kulturzentren (z.B. das Alandica Kongress- und Kulturzentrum) und Festivals das Kulturleben und schaffen Raum für zeitgenössische Kunst und Design.
Literatur
Die åländische Schärenumgebung hat schon seit jeher viele Verfasser inspiriert. Unter den åländischen Dichtern, die einem größeren Leserkreis bekannt sind, ragen Sally Salminen (1906 bis 1976), Anni Blomqvist und in letzter Zeit auch die 1947 geborene Ulla-Lena Lundberg hervor. Salminens Roman Katarina war das erste Werk einer Åländerin, das - anno 1958 - ins Deutsche übertragen wurde. Anni Blomqvist (1909 bis 1990) bietet in ihren Werken einen tiefen Einblick ins Leben der åländischen Fischer. Für Literaturinteressierte gibt es Lesungen wie etwa im Rahmen der Barnens Literaturdage.
Theater
Die Teaterföreningen von Mariehamn wurde 1914 gegründet. Das von ihr betriebene Theater war bis 1939 im Stadshus (Rathaus) untergebracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg übersiedelte es in die Nygatan. Zu ihrem Programm gehören vor allem schwedische Stücke, aber auch Werke William Shakespeare und anderer Autoren der Weltliteratur.
Film
Das älteste Kino Aalands wurde im Januar 1909 von Carl Porch im Badhotellet in Mariehamn eröffnet. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde 1920 im Stadtzentrum das Kinoteatern eröffnet. 1938 folgte ein zweites Kino, Bio-Rita, und wenig später noch ein drittes, Bio-Savoy – das einzige, das es heute noch gibt. In Mariehamn werden unterdessen mehrere Filmfestivals, darunter das bereits etablierte, alljährlich im März stattfindende VERA Filmfestival für Kurz- und Dokumentarfilme im Alandica Kultur & Kongress in Mariehamn, und das erstmals im November 2006 durchgeführte Kinder- und Jugendfilmfestival Valhalla.
Das historische Drama „Devil‘s Bride“ („Teufelsbraut“) von Saara Cantell aus dem Jahr 2016 spielt im 17. Jahrhundert auf Åland zur Zeit der Hexenverfolgung und wurde beim Toronto Female Eye Film Festival 2017 mit dem Preis für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet. Auch das Drama „Disciple“ („Schüler“) von Ulrika Bengts aus dem Jahr 2013 spielt auf Åland.
Musik und Tanz
Åland hat eine reiche volksmusikalische Tradition, die sich stark an schwedischen Praktiken anlehnt. Eine wichtige Rolle in der musikalischen Kultur Ålands nimmt das Åländs Musikinstitut ein, das rund 300 Schüler beherbergt. Auch außerhalb des Instituts sind in Åland viele Chöre und Musikgruppen tätig. Jedes Jahr werden über hundert musikalische Veranstaltungen durchgeführt, die bei Einheimischen und Gästen auf großes Interesse stoßen: ein Jazz-, Country- und Orgelfestival, verschiedene Orchesterkonzerte und volksmusikalische Programme, die auch alte skandinavische Musiktraditionen aufgreifen.
Im Sommer findet auf der Insel Föglö in Åland ein Dansbandsfestival statt, bei dem einige der größten Acts der traditionellen schwedischen „Dance Band“ auftreten. Dabei steht vor allem der Gemeinschaftstanz („dansbandmusik“) im Mittelpunkt, eine populäre Musik- und Tanzform, die zum geselligen Miteinander einlädt.
Åland feiert auch Feste wie Mittsommer, bei denen volkstümliche Musik und Tänze eine zentrale Rolle spielen. Traditionelle Tänze werden oft im Kreise der Gemeinschaft beim Mittsommerfest um die Midsommarstång (Mittsommerstab) getanzt. Daneben ist Åland Teil einer größeren nordischen Musik- und Tanzszene: Auf einer speziellen Tango-Törn-Reise von Lübeck nach Helsinki, die auch Åland-Anschlüsse hat, spielt die finnische Band Uusikuu eine Mischung aus Finntango, Swing, Jenkka und Humppa, begleitet von Tanzstunden mit professionellen Tangolehrern. Diese Musikrichtungen verbinden traditionelle nordische Rhythmen mit Tanz und lebendiger Unterhaltung. Im August gibt es auf Åland vielfältige Musikveranstaltungen mit Genres von Jazz über Klassik bis Pop, die die lebendige Musikkultur der Inseln unterstreichen.
Kleidung
Die aaländische Tracht (Åland-Tracht) ist die traditionelle Festkleidung der Åland-Inseln und spiegelt regionale Identität, Geschichte und Handwerkskunst wider. Sie gehört zur großen Vielfalt finnischer Regionaltrachten, besitzt aber eigene charakteristische Merkmale, die sie von anderen Gebieten abheben. Typisch sind lebendige Farben und aufwändige Stickereien. Die Muster orientieren sich häufig an der Natur und zeigen stilisierte Pflanzen, Tiere und geometrische Formen. Jede Region der Åland-Inseln kann eigene Details aufweisen.
Frauen tragen meist lange Röcke oder Kleider, die mit einer Schürze kombiniert werden. Dazu gehören ein aufwendig gearbeitetes Mieder und häufig eine gestickte Bluse. Abgerundet wird das Outfit mit Kopftuch oder Haube und auffälligem traditionellen Silberschmuck, wie Broschen oder Halsketten.
Die Männertracht besteht in der Regel aus langen Hosen oder Kniehosen und einer Weste, oft ergänzt durch eine Jacke. Kopfbedeckungen wie Hüte sind verbreitet. Traditionelles Schuhwerk sind Lederstiefel oder Holzschuhe. Broschen, Silberketten und aufwendig gearbeitete Verschlüsse sind zentrale Bestandteile – handgearbeiteter Silberschmuck ist für die Åland-Tracht typisch.
Die Tracht wird bei festlichen Gelegenheiten getragen, darunter Mittsommer, Kirchweih, Hochzeiten und nationale Feiertage. Auch Chöre und Trachtenvereine präsentieren sie bei kulturellen Veranstaltungen. Die Trachten spielen eine wichtige Rolle im kulturellen Selbstverständnis der Inselbewohner. Wissen zur Anfertigung und Pflege wird in Heimatvereinen und durch spezialisierte Werkstätten vermittelt. Die Erhaltung der Familientracht hat hohen Stellenwert, oft werden diese Kleidungsstücke von Generation zu Generation weitergegeben.
Kulinarik und Gastronomie
Åland ist kulinarisch eine Grenzregion. Die Küche war früher durch westfinnische Traditionen, etwa das Kochen auf offenem Feuer, geprägt. Typisch für die Inselgruppe ist das „schwere, feuchte Schwarzbrot, eine Komposition aus Roggen, Malz und Gemüse. Es schmeckt gleichzeitig herzhaft und angenehm süßlich und passt wunderbar zum heimischen Käse.“ Die Herstellung dauert „fast einen ganzen Tag. Kökar und Brändö liegen im Wettbewerb um die beste Rezeptur.“
Der aaländische pannkaka „ist kein Pfannkuchen im herkömmlichen Sinne, sondern ein in der Pfanne gebackener Reis- oder Grießkuchen, gewürzt mit einer Prise Kardamom, der mit Pflaumenkompott oder frischer Schlagsahne genossen wird.“
Bleiben als typisch für die Region das paj, ein „Mittelding zwischen Streuselküchlein und Tarte mit Früchten“ sowie das Butterbrot, smörgasbård. Dieses ist allerdings „mehr als eine durchschnittliche Platte: ein Buffet Fantasie pur mit Fisch und Marinaden, mit Roastbeef, Kaviar und frischem Grünzeug, Pasteten sowie Salaten“ (Labonde/Kuehn-Velten 2006:34).
In Åland können Einheimische und Gäste in insgesamt 70 Gasthäusern lokale und internationale Speisen zu sich nehmen: 41 Restaurants, 20 Cafés, 7 Pubs und zwei Casinos. Einige werden auch international gelobt.
Im schönen, alten Steinhaus beim Lilla Torget mitten in Mariehamn etwa liegt das neulich eröffnete Restaurant Indigo. Indigo ist ein zweiteiliges Konzept mit sowohl einem Restaurant als auch einer Loungebar. Im Restaurant, das im unteren Stock liegt, wird ein modernes A la Carte Menü serviert und in der Bar, im oberen Stock, wird ein Bistro Menü mit etwas einfacherem Essen und zu tieferen Preisen angeboten. Im zweiten Stock des gleichen Gebäudes wo auch das åländische Schiffahrtsmuseum liegt, finden Sie das ahnenreiche Restaurant Nautical. In diesem gemütlichen Ambiente können Sie klassisch zubereitetes Essen mit Aussicht über das Museumsschiff Pommern und das glitzernde Wasser im Westhafen genießen.
Im gleichen Gebäude wie das Hotel Park Alandia und mit Aussicht über die Linden in der Esplanadstrasse liegt Park Bar & Restaurant. Park ist bekannt für seine Spezialität „Russischer Kräuterochse“, die mit den traditionellen Zubehören wie: in Speck gewickelte grüne Bohnen, Rotkraut, Honigsgurke und eine kalte russische Kräutersauce serviert wird. In der Bar treten Troubadours und Livebands auf.
Das Restaurant des Hotels Arkipelag bietet eine herrliche Aussicht über die Meeresbucht Slemmern im Osthafen. Auf der Menükarte findet man sowohl internationale Geschmackserlebnisse als auch lokale Delikatessen. Arkipelag bietet auch Unterhaltung in Form eines Nachtklubs und einer Casinobar an.
Das Restaurant Pommern liegt mitten in der Stadt, im gleichen Gebäude wie das Hotel Pommern. Das Restaurant ist bekannt für seine Lunchmenüs mit echter Hausmannskost und einem feinen Salatbüfett. Abends wird ein traditionelles A la Carte Menü, das vom Mittelmeerraum inspiriert ist, angeboten. Die von der Schiffahrt beeinflusste Einrichtung im Inneren des Restaurants verbreitet eine maritime Stimmung.
Am 1. Mai 2005 wurde das Café Julius im Zentrum Mariehamns eröffnet. An diesem Tag begann auch der Verkauf des beliebten Ålandpfannkuchens. Einer der Gründe dafür ist natürlich, dass ausländische Gäste gerne die Spezialitäten der Inseln probieren. Göran Ekstrand, der Inhaber des Cafés muss gar nicht groß für seinen Pfannkuchen werben, die Gäste fragen von ganz alleine danach, sagt er. Das Café Julius serviert seinen Pfannkuchen mit Himbeermarmelade und Schlagsahne. Das unterscheidet sich ein wenig von der Tradition, denn nach dieser isst man den echten Ålandspfannkuchen mit Zwetschkencreme. Göran Ekstrand glaubt, dass der Ålandpfannkuchen deshalb so einzigartig ist, weil er frühre wahrscheinlich in jedem åländischen Haushalt zubereitet wurde. Er ist nicht durch irgendeine Form der Werbung so bekannt geworden, sondern ist, wie eine alte Tradition, fest in der åländischen Seele verwurzelt.
Wer Bier liebt, kommt um Stallhagen nicht herum. Stallhagen Pale Lager 4,7 % ist das erste åländische Bier seit 1938. Man findet es im Fass oder in Flaschen in Restaurants und Lebensmittelgeschäften. Die Brauerei selbst liegt im Stallhagen beim Königshof von Grelsby in der Gemeinde Finström, von daher stammt auch der Name des Bieres. Hier arrangiert die Ålands Brauerei für gebuchte Gruppen Besichtigungen mit einer Degustation zum Abschluss.
Festkultur
Åland hat eine ausgeprägte Festkultur. Eins der zentralen Feste ist die Midsommarafton (Mittsommernacht). Zu dieser gehören nicht nur Tanz und eine große Feier, sondern auch die Mittsommerstangen. Über 70 findet man auf Åland. Einst waren sie Symbole für Glück und Fruchtbarkeit. Der Aufbau der Stangen ist immer gleich: An der Spitze der Stange ist ein Mann erkennbar, er breitet seine Arme aus, darunter ist die aktuelle Jahreszahl zu sehen. Es fällt ein Sonnenrad auf, das beim Aufstellen nach Osten zeigt. An zwei Querstangen sind vier Segelboote zu sehen, der Baum wird zusätzlich geschmückt mit Blumen und Girlanden. Die Stangen erinnern ein wenig an einen Segelmast.
Nationalfeiertag ist der 9. Juni, der sogenannte Lagtingsdag. Er erinnert an das erste Zusammentreten des aaländischen Landtags am 9. Juni 1922. Dieser Tag gilt als Ausdruck der Eigenständigkeit der Inselgruppe, und er hat größere Bedeutung als der finnische Nationalfeiertag, der, am 6. Dezember gefeiert, als Självständighetsdagen (Selbständigkeitstag) nur eine Nebenrolle im aaländischen Festkalender spielt.
Die Valpurgsmässo-afton (Walpurgisnacht) wird auf Åland und in den anderen nordischen Ländern jedes Jahr am 30. April gefeiert. An diesem Abend versammeln sich viele Leute um ein Feuer. Es ist üblich, dass åländische Kinder zum Walpurgisabend sogenannte Maiquasten aus buntem Seidenpapier basteln. Man isst Spritzkuchen und Krapfen, und trinkt Met.
Die Gustav Vasa Dager (Gustav Wasa-Tage) am zweiten Juni-Wochenende beim Schloss Kastelholm gehen zurück ins 16. Jahrhundert. Auf dem Markt findet man Handwerk und Waren mit einem Hauch aus jener Zeit, Menschen in zeitgenössischen Kleider, Gaukler, Diebe und Soldaten mit Helmen und Hellebarden.
Die Åländsk Sjödager (Aaländische Seetage) finden üblicherweise vom 18. bis 21. Juni statt. Sie werden alljährlich im Seequartier von Mariehamn arrangiert. Der Ort ist an diesen Tagen erfüllt vom Duft des Teers und vom Glanz des glitzernden Wassers. Es handelt sich dabei um eine maritime Veranstaltung mit gemütlicher Stimmung und einem abwechslungsreichen Programm. Die Tage bieten viele Aktivitäten wie Seemannshandwerk, eine Parade mit Holzbooten und Ausflüge mit Segelfrachtbooten. An den Abenden dominiert rhythmische Tanzmusik im Seequartier.Viking Marknad (Wikingermarkt) in Saltvik ist eine festliche Veranstaltung für die ganze Familie am letzten Julki-Wochenende. Hier wimmelt es nur so von Wikingern in zeitgenössischen Kleidern, Trachten, Schmucke und Rüstungen.Das Bärgabefäst (Erntedankfest) am letzten Septemberwochenende ist eine traditionelle Herbstveranstaltung. Sie bietet Hofbesuche, frisch geerntete Produkte, echtes åländisches Handwerk und gemütliches Beisammensein an. Am Samstag werden überall auf der åländischen Hauptinsel unterschiedliche Aktivitäten arrangiert. Am Sonntag findet der traditionelle Erntemarkt beim åländischen Landwirtschaftszentrum statt.
Zum offiziellen aaländischen Festjahr gehören folgende Feiertage:
| Datum | Deutscher Name | Originalbezeichnung | Bemerkungen |
| 1. Januar | Neujahrstag | Nyårsdagen | |
| 6. Januar | Epiphany | Trettondagen | |
| 30. März | Demilitarisierungstag | Ålands demilitariseringsdag | Friedensschluss 1856 nach dem Krimkrieg |
| Ende März / Anfang April | Karfreitag | Långfredag | Freitag vor Ostersonntag |
| Ende März / Anfang April | Ostersonntag | Påskdagen | erster Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond |
| Ende März / Anfang April | Ostermontag | Annandag påsk | |
| 30. April | Walpurgisnacht | Valborgsmässoafton | |
| 1. Mai | Maifeiertag | Första maj | |
| Ende Mai / Anfang Juni | Himmelfahrtstag | Kristi himmelsfärdsdag | 39 Tage nach Ostern |
| Ende Mai / Anfang Juni | Pfingsten | Pingstdagen | 49 Tage nach Ostern |
| Ende Mai / Anfang Juni | Pfingstmontag | Annandag Pingst | 50 Tage nach Ostern |
| 9. Juni | Autonomietag | Självstyrelsedagen | Aaländischer Nationalfeiertag zur Erinnerung an die Autonomieerklärung 1922 |
| 3. Freitag im Juni | Mittsommernacht | Midsommarafton | |
| 3. Samstag im Juni | Mittsommertag | Midsommardagen | |
| 1. Samstag im November | Allerheiligen | Alla helgons dag | |
| 6. Dezember | Unabhängigkeitstag | Självständighetsdagen | Unabhängigkeit Finnlands 1917 |
| 13. Derzember | Luziatag | Luciadagen | |
| 24. Dezember | Heiliger Abend | Julafton | |
| 25. Dezember | Weihnachtstag | Juldagen | |
| 26. Dezember | Stefanitag | Annandag jul |
Medien
Eigene Medienangebote sind ein wichtiges Element der Autonomie, und Åland besitzt eine erstaunliche Mediendichte. Trotz der geringen Einwohnerzahl ist die Medienlandschaft auf den Inseln reichhaltig.
Ungefähr 60 Journalisten schreiben für zahlreiche Magazine, darunter zwei Lokalzeitungen, die 1891 gegründete Zeitung Tidningen Åland und die seit 1981 publizierte Nya Åland. Beide Zeitungen erscheinen fünfmal wöchentlich mit einer Auflage von 18.473 Stück pro Auflage im Jahr 2000.
Erst 1984 wurde auf Åland das erste åländische Fernsehprogramm gegründet. Es produziert eigene Sendungen und überträgt öffentliche schwedische ebenso wie finnische Rundfunk- und Fernsehprogramme. Zuvor standen den Åländern nur die staatlichen finnischen Programme, die auch schwedischsprachige Sendungen senden, sowie die Programme Schwedens zur Verfügung.
Im gleichen Jahr hat Radio Åland den Rundfunkbetrieb aufgenommen. Es ist bis heute der einzige rein åländische Radiosender. Daneben kann man auch schwedische Radiosender empfangen, die teilweise auch ein eigenes Lokalradio für Åland anbieten. Ausgestrahlt werden die Programme über den Sendemast in Smedsböle, dessen Spitze mit 244 m über dem Meer die höchste Stelle Ålands ist.
Der lokale Radiosender Radio Åland gehört zum Finlands Rundradio einem Radiosender in schwedischer Sprache. Seit der Neufassung des Selbstverwaltungsgesetzes 1993 gibt es auch ein kommerzielles Radioprogramm. In das Kabelnetz wird ein lokales Fernsehprogramm eingespeist. Außerdem gibt es die Möglichkeit, zahlreiche schwedische und finnische Radio- und Fernsehprogramme zu empfangen.
Kommunikation
Åland bildet seit dem Mitelalter eine Drehscheibe im Ostseeverkehr. Früh schon lief der Postverkehr von Finnland und Russland nach Schweden und Dänemark über diese Inselgruppe. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde daraus eine Systematik. Heute gibt es in den 16 Gemeinden insgesamt 21 postkontorer (Postämter). Zentrum der Postverteilung ist seit etwa 1880 Mariehamn. Die Telefonvorwahl ist 0035818.
Seit 1984 gibt es åländische Briefmarken, die jedoch von der finnischen Postverwaltung herausgegeben wurden. Mit der Revision des Selbstverwaltungsgesetzes 1993 unterhält Åland nunmehr ein eigenes Postwesen. Die Sonderstellung macht die Briefmarken für Sammler aus aller Welt interessant. Allerdings ist die åländische Postverwaltung im Gegensatz zu „Briefmarkenstaaten“ zurückhaltend bei der Herausgabe neuer Marken. Die Grenadine Islands oder St. Vincent bringen pro Jahr 500 bis 600 Marken heraus, während Åland sich mit rund 8 Marken pro Jahr beschränkt. Trotzdem betragen die Einnahmen aus den 55.000 Briefmarkenabonnenten in aller Welt 15 Millionen Finnmark bei einem Gesamtumsatz von 45 Millionen Finnmark.
Sport
Der Ålands Idrottsförbund (Sportverband der Åland-Inseln) ist der gemeinsame Dachverband für den Sport, der dem schwedischen Landessportbund oder dem finnischen Sport entspricht. Der Sportverband vertritt den åländischen Sport in allen nordischen Zusammenhängen und ist das höchste Sportgremium auf Åland.
Åland hat keine eigene Nationalmannschaft und ist selbst nicht Mitglied eines internationalen Sportverbands; sportlich gesehen gehört Åland zu Finnland. Dies gilt auch innerhalb Finnlands, wo åländische Teams an finnischen Serien teilnehmen.
Der åländische Sportverband wurde 1995 von den damaligen Sportorganisationen und auf Initiative der åländischen Provinzregierung gegründet. 1999 übernahm der Sportverband die Verteilung der Sportmittel von der åländischen Provinzregierung. Dies geschah im Zusammenhang mit einer Aktualisierung des åländischen Sportgesetzes. Nach Angaben des åländischen Sportverbands nehmen mehr als 13.500 Menschen regelmäßig am organisierten Sport teil, was den Sport zur mit Abstand größten Volksbewegung auf Åland macht.
Neben dem obersten Sportverband gibt es auf Åland rund 60 Sportvereine. Ihre Aktivitäten werden vorwiegend mit Lotteriegeldern finanziert. Die Tätigkeitsbereiche der Vereine sind sehr vielseitig und umfassen eine große Anzahl von Winter- und Sommersportarten. Die åländische Sportbewegung legt großes Gewicht auf die Jugendförederung und auf vorbeugende Massnahmen gegen Drogen und Doping. Åland ist keine eigene Sportnation, aber viele Åländer haben Finnland in sowohl Mannschafts- als auch individuellen Sportarten repräsentiert. Mehrere åländische Sportler konnten auch große internationale Erfolge feiern, unter anderem in der Leichtathletik, im Fußball, Unihockey, Segeln, Gewichtheben und Schießen.
Ebenso wie die Kultur wird auch der Breitensport in Åland aus den Mitteln der staatlichen Glücksspielgesellschaft gefördert. In der Provinz sind etwa sechzig Sportvereine aus allen Sommer- und Wintersportarten tätig. Im Fußball hat zuletzt der IFK Mariehamn für Aufsehen gesorgt, indem er 2004 in die oberste finnische Liga (Veikkausliiga) aufstieg und in der Saison 2005 auch die Klasse halten konnte. Diese Erfolgsgeschichte hat in Åland eine große Fußballbegeisterung ausgelöst. Den Zuschauerrekord im Sportplatz des Vereins, dem Idrottsparken, angegeben mit einer Kapazität von 1600 Zuschauern, erzielte man am 19. Juni 2005 mit 4505 Zuschauern.
Möglichkeiten zu sportlicher Betätigung gibt es überall auf den Åland-Inseln. Wandern, Radfahren, Segeln und Rudern sowie Langlaufen im Winter werden ergänzt durch Turnen, Schwimmen, diverse Ballspiele und athletische Sportarten. Der 1983 gegründete Åland Golf Club betreibt zwei Golfkurse. Das Mariebad in Österleden in Mariehamn ist das bekannteste der fünf öffentlichen Bäder von Åland. Und wer seine oder ihre körperlichen Leiden auf alte Art behandeln will, für den oder die gibt es Saunas in beinahe jeder Ortschaft des Landes.
Fußball
Die Fußballmannschaften der Inselgruppe - die erfolgreichsten Teams sind der 1919 gegründete IFK Mariehamn (12. Platz in der finnischen Veikkausliiga 2010) und der in der dritten Division Finnlands (Kolmonen) spielende Hammarlands IK - sind im Ålands Fotbollförbund (Aaländischer Fußballverband, kurz ÅFF) zusammengeschlossen. Er wurde im Jahr 1943 als Åland Boll District gegründet und hat derzeit insgesamt 11 Mitgliedsvereine mit insgesamt 60 Mannschaften unterschiedlicher Altersgruppen und insgesamt knapp 1000 aktiven Fußballern (Stand 2014). Die Mitgliedvereine sind:
- IF Finströms Kamraterna
- IFK Mariehamn
- Hammarlands IK
- IF Fram
- Jomala IK
- Eckerö IK
- Sunds IF
- Lemlands IF
- Ålands Fotbolldomare
- IF Östernäskamraterna
- IF Kasbergskamraterna
In der Ålands Football League spielten 2010 insgesamt 30 Mannschaften in insgesamt 4 Divisionen.
Division 1 A
Färgpytsarna | FC Blyfoten | FC Hammarudda | Fett | MIT | Teirekcalk CF | TK Ripan
Division 1 B
IFFK P-85 | Dynamo Kraft | FC Realtard | Fifan BK | IFK Old Boys | Strandnäs Stål
Division 2 A
Ex-LIF | FC Blåljus | FC Hundra | FC Quickly | FC Stolpskott | Lemländers | Lemmarna | Var är pappa
Division 2 B
Dirty Diamonds | Eckerö U | FC Guiri United | FC Hundraett | FC Offside | Ghetto | Joga Bonito | Optinova | Team Spirit
Der Ålandscupen (Åland Cup) ist die offizielle Landescupmeisterschaft des ÅFF. Sie wurde 1943 und wird vom IFK Mariehamn dominiert. Die in der höchsten finnischen Liga spielende Mannschaft hat den Ålandscupen bereits 42mal gewonnen. Die letzte andere Siegermannschaft war der IF Finströms Kamraterna im Jahr 1993.
| Jahr | Sieger | Zweiter | Resultat |
| 1943 | IFK Mariehamn | Hammarlands IK | 4 : 2 |
| 1944 | IFK Mariehamn | Bollklubben -40 | |
| 1945 | Bollklubben -40 | IFK Mariehamn | 3 : 2 |
| 1946 | IFK Mariehamn | Bollklubben -40 | 3 : 2 |
| 1947 | IFK Mariehamn | ||
| 1949 | IFK Mariehamn | IF Fram | 3 : 0 |
| 1950 | IF Fram | IFK Mariehamn | 3 : 1 |
| 1951 | IFK Mariehamn | IFFK | 5 : 2 |
| 1952 | IFK Mariehamn | IFFK | 3 : 0 |
| 1953 | IF Fram | IFFK | 4 : 3 |
| 1954 | IFFK | IFK Mariehamn | 2 : 1 |
| 1955 | IFFK | IFK Mariehamn | 4 : 0 |
| 1956 | IFK Mariehamn | IFFK | 4 : 3 |
| 1957 | IFK Mariehamn | IFK Mariehamn 2 | 5 : 0 |
| 1958 | IFK Mariehamn | IFFK | 3 : 2 |
| 1959 | IFK Mariehamn | IFFK | 3 : 2 |
| 1960 | IFFK | IFK Mariehamn | 4 : 2 |
| 1961 | IFFK | ||
| 1962 | IFFK | IFK Mariehamn | 2 : 0 |
| 1963 | IFFK | IFK Mariehamn | 5 : 4 |
| 1964 | IFK Mariehamn | IFFK | 3 : 2 |
| 1965 | IFFK | Jomala IK | 4 : 0 |
| 1966 | IFFK | Hammarlands IK | 4 : 2 |
| 1967 | IF Fram | IFK Mariehamn | 2 : 1 |
| 1968 | IFK Mariehamn | IFFK | 1 : 0 |
| 1969 | IFFK | Hammarlands IK | 2 : 1 |
| 1970 | IFK Mariehamn | IFK Mariehamn 2 | 5 : 4 |
| 1971 | IF Fram | IFK Mariehamn | 1 : 0 |
| 1972 | IFK Mariehamn | Hammarlands IK | 2 : 0 |
| 1973 | IFFK | IFK Mariehamn 2 | 3 : 1 |
| 1974 | IFK Mariehamn | IFFK | 5 : 0 |
| 1975 | IFK Mariehamn | IFFK | 4 : 3 |
| 1976 | IFK Mariehamn | IFFK | 6 : 4 |
| 1977 | IFK Mariehamn | IFFK | 4 : 3 |
| 1978 | IFK Mariehamn | Jomala IK | 4 : 1 |
| 1979 | IF Östernäskamraterna | Jomala IK | 2 : 1 |
| 1980 | IFK Mariehamn | IFFK | 3 : 0 |
| 1981 | IFK Mariehamn | Jomala IK | 7 : 0 |
| 1982 | IFK Mariehamn | Jomala IK | 2 : 0 |
| 1983 | Jomala IK | Sunds IF | 4 : 1 |
| 1984 | IFK Mariehamn | IFFK | 5 : 0 |
| 1985 | IFK Mariehamn | IFFK | 1 : 0 |
| 1986 | IFFK | IFK Mariehamn | 2 : 1 |
| 1987 | Sunds IF | Jomala IK | 2 : 1 |
| 1988 | IFK Mariehamn | IFK Mariehamn vet. | 3 : 2 |
| 1989 | IFK Mariehamn | IFFK | 3 : 1 |
| 1990 | IFFK | Sunds IF | 5 : 2 |
| 1991 | IFFK | Jomala IK | 4 : 2 |
| 1992 | Jomala IK | IFK Mariehamn | 2 : 1 |
| 1993 | IFFK | Jomala IK | 3 : 1 |
| 1994 | IFK Mariehamn | Sunds IF | 1 : 0 |
| 1995 | IFK Mariehamn | Team Åland | 6 : 2 |
| 1996 | IFK Mariehamn | Hammarlands IK | 3 : 2 |
| 1997 | IFK Mariehamn | Sunds IF | 2 : 1 |
| 1998 | IFK Mariehamn | Hammarlands IK | 2 : 1 |
| 1999 | IFK Mariehamn | Hammarlands IK | 4 : 0 |
| 2000 | IFK Mariehamn | IFK Mariehamn vet. | 6 : 0 |
| 2001 | IFK Mariehamn | Hammarlands IK | 4 : 1 |
| 2002 | IFK Mariehamn | IFFK | 2 : 1 |
| 2003 | IFK Mariehamn | IFFK | 5 : 0 |
| 2004 | IFK Mariehamn | IFK Mariehamn vet. | 2 : 1 |
| 2005 | IFK Mariehamn | Hammarlands IK | 7 : 0 |
| 2006 | IFK Mariehamn | IFFK | 2 : 0 |
| 2007 | IFK Mariehamn | IFFK | 2 : 1 |
| 2008 | IFK Mariehamn | IFFK | 5 : 1 |
| 2009 | IFK Mariehamn | Jomala IK | 9 : 4 |
| 2010 | Hammarlands IK | IFK Mariehamn | 3 : 2 |
| 2011 | SIFFK | IFK Mariehamn | 2 : 1 |
| 2012 | IFK Mariehamn | SIFFK | 3 : 1 |
Åland besitzt eine eigene Fußballnationalmannschaft, die Ålands herrlandslag i fotboll. Von der UEFA ist sie freilich nicht anerkannt ist. Nichtsdestotrotz hat das Team seit 1989 im Rahmen der Island Games zahlreiche Länderspiele absolviert, konkret gegen folgende Gegner (Stand 2020):
| Gegner | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff |
| Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 |
| Bornholm | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| Falkland Islands | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| Färöer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | −6 |
| Frøya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Gibraltar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Gotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 |
| Grönland | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | +7 |
| Guernsey | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | −2 |
| Isle of Man | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| Isle of Wight | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 |
| Jersey | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | −9 |
| Menorca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
| Öland | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| Rhodos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 |
| Saare | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 |
| Sápmi | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| Seeland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 |
| Shetland | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| Western Isles | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 |
| Ynys Môn | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | +0 |
| insgesamt | 53 | 23 | 6 | 24 | 93 | 101 | −8 |
Åland United ist ein Frauenfußballverein aus Mariehamn. Die erste Mannschaft spielt in der Naisten Liiga, der höchsten Spielklasse im finnischen Frauenfußball. Im Jahre 2004 beschlossen die Vereine Lemlands IF und IF Finströms Kamraterna in Zusammenarbeit mit dem IFK Mariehamn den Frauenfußball in Åland stärker zu fördern und zu professionalisieren. Es wurde eine gemeinsame Mannschaft gebildet, die unter dem Namen Lemlands IF in der Saison 2005 den Aufstieg in die höchste finnische Spielklasse schaffte. Mit dem Aufstieg folgte die Namensänderung in Åland United. In der Saison 2009 sicherte sich die Mannschaft vorzeitig die Meisterschaft, womit sie sich für die UEFA Women’s Champions League 2010/11 qualifizierte. Nach einem Freilos für die Qualifikationsphase scheiterte Åland United dort im Sechzehntelfinale am Titelverteidiger 1. FFC Turbine Potsdam mit 0:9 und 0:6.
Wassersport
Aaland ist ein Paradies für Kanuten. Es werden zahlreiche geführte Touren angeboten, doch können Abenteuerlustige die Schären auch auf eigene Faust ergründen. Das Badevergnügen ist meist recht erfrischend. In Mariehamn gibt es ganzjährig offenes Hallenbad mit Sauna. Die von Juni bis August nutzbaren Strände Aalands sind:
- Brändö Korsklobbsrevet
- Eckerö Degersand, Käringsund, Sandviken
- Finström Bambölevik, Färjsundet
- Föglö Sinting, Hastersboda
- Geta Hällö, Knutnäs
- Hammarland Bovik, Marsund, Öra
- Jomala Gottby sund, Småholma, Möckelö Havsbad, Möskatan
- Kumlinge Seglinge, Enklinge, Marskil
- Lemland Hellestorp, Klockarholmen
- Mariehamn Algrundet, Espholm, Lilla Holmen, Gröna Udden, Mariebad, Nabben
- Saltvik Lötö, Notplan, Kvarnboviken, Västerviken
- Sund Delvik, Bomarsund
Persönlichkeiten
Die wichtigsten aaländischen Persönlichkeiten in Geschichte und Gegenwart sind:
- Carl Björkman
- Anni Blomqvist
- Mats Gustafsson
- Janne Holmén
- Hilda Hongell
- Wilhelm Ingves
- Karl Emanuel Jansson
- Georg Kåhre
- Frans Peter von Knorring
- Nikolo Kotzev
- Ulla-Lena Lundberg
- Lars Eric Mattsson
- Anders Överström
- Joel Pettersson
- Sally Salminen
- Daniel Sjölund
- Julius Sundblom
- Fanny Sundström
- Alexander Weckström
- Kristoffer Weckström
- Tommy Wirtanen
Fremdenverkehr
Seit den frühen 1960er Jahre sind die Besucherzahlen drastisch angestiegen. Wurden 1964 noch knapp 300.000 Besucher gezählt, sind es heute mehr als zwei Millionen. An erster Stelle der Besucher stehen die Schweden vor den Finnen. Deutschland kommt nach Dänemark auf Platz 4. Der Trend geht zu Aktivferien. Die Inseln bieten in dieser Beziehung mit Fahrradfähren, Golfplätzen, Wasserflächen zum Angeln und für den Bootssport optimale Voraussetzungen. Der Tourismus konzentriert sich hauptsächlich auf die Sommermonate. Um diese Spitze etwas zu entschärfen, wird versucht, die Saison zu verlängern. Ansatzpunkte sind Golf- und Angelferien. Außerdem bieten sich die luxuriösen Fährschiffe als Ausrichtungsorte für Tagungen und Konferenzen an. Zusammen mit Kreuzfahrtangeboten versuchen die Reedereien so, ihre Schiffe auch zur Nebensaison auszulasten. Ein wesentliches Element sind die Tagesbesucher, die auch durch den Tax-Free-Verkauf an Bord der Fährschiffe angelockt werden. Dies ist Angesichts der hohen Alkohol- und Tabakpreise in den skandinavischen Länder nicht verwunderlich.
Im Jahr 2004 wurde Åland von 224.800 länger als einen Tag bleibenden Gästen besucht. Die meisten Gäste kamen mit 111.400 aus Schweden, die zweitgrößte Gruppe stellte Finnland mit 92.500 Besuchern, und an dritter Stelle liegt Deutschland mit 6.700 Gästen.
Zahl der Gäste:
1958 39 500
1960 101 000
1965 500 000
1970 480 000
1975 1 098 286
1980 1 129 586
1985 1 095 151
1990 1 569 589
1995 1 120 759
2000 1 768 804
2005 2 177 772
2010 2 173 485
2015 2 108 945
Als Unterkunftsmöglichkeiten standen 2000 insgesamt 18 Campingplätze (2006 waren es nur noch 15), 21 Hotels mit 2229 Betten, 33 Nächtigungshütten, 33 Gasthäuser und Pensionen sowie 39 Feriendörfer mit 399 Ferienhäusern zur Verfügung.
Nächtigungen 2004:
Nächtigungshütten 171 016
Hotels 167 837
Campingplätze 95 854
Gasthäuser und Pensionen 48 441
insgesamt 483 148
Die wichtigsten åländischen Hotels sind:
- Hotel Adlon in der Hamngatan in Mariehamn, die Zentrale der Ålandhotels,
- Hotel Cikada ebenfalls in der Hamngatan mit 85 Zimmern,
- Hotel Savoy in der Hamngatan im Zentrum Mariehamns,
- Kaptensgådarna ebenfalls in der Hamngatan,
- Hotel Pommern in der Norragatan in Mariehamn, speziell für deutsche Gäste,
- Passat Apartment Hotell ebenfalls in der Norragatan,
- Hotel- bzw. Best Western Hotel Arkipelag in der Strandgatan in Mariehamn,
- Ålandsresor in der Torggatan in Mariehamn,
- Hotel Esplanad in der Storagatan in Mariehamn,
- Park Alandia Hotell in der Norra Esplanadgatan in Mariehamn,
- Strandnäs Motell am Gamla Godbyvägen in Mariehamn,
- Silverskär in Saltvik,
- Eckerö Hotell och Restaurang mit 40 Zimmern und Tagungsraum,
- Hotell Elvira am Sandmovägen in Eckerö,
- Käringsundsbyn in Storby, Gemeinde Eckerö,
- Ålandshotell Havsvidden (Adlon) in Geta,
- Gullvivan auf Bornholma in Brändö,
- Bastö Hotell & Stugby in Pålsböle,
- Brudhäll Hotell och Restaurang in Kökar,
- Gäddviken Turisthotell Sands Stugby in Hammarland.
- Gäddviken Turisthotell in Sålis, Gemeinde Hammarland.
Ein- und Ausreise:
- Reisedokumente: Staatsbürger der skandinavischen Länder sowie von Ländern, die dem Schengener Abkommen beigetreten sind, benötigen keinen Reisepass, müssen aber über einen Personalausweis verfügen. Gäste, die die Staatsangehörigkeit von Ländern außerhalb der EU/EWS besitzen, sollten etwaige Visumanforderungen vor der Einreise nach Finnland oder Åland überprüfen.
- Zollbestimmungen: In Zoll- und Steuerangelegenheiten liegt Åland außerhalb der EU-Grenzen. Somit passiert man bei der Einreise nach Åland von Schweden, Finnland und Estland kommend die Zollgrenze, wo auch stichprobenartig kontrolliert wird. Bei der Einreise von Åland gelten die üblichen Tax-Free Grenzen, wie sie bei der Einreise aus Nicht-EU-Ländern auch gelten, Reisende, die von See aus in die Europäische Union einreisen, dürfen steuerfrei maximal Waren in Wert von 430 € einführen.
- Reisen mit Kfz: Führerscheine aus EU-Staaten sind in Åland gültig. Eine Grüne Karte wird empfohlen.
- Umgangsformen: Das Duzen ist in Åland weitaus verbreiteter als in Mitteleuropa und gilt als freundschaftliche und unkomplizierte Anredeform. Besucher sollten deshalb nicht erstaunt oder gar beleidigt sein, wenn sie gleich mit Du angesprochen werden.
- Trinkgeld: In Skandinavien ist es nicht üblich, Trinkgeld zu geben. Es ist üblicherweise in der Rechnung inkludiert.
- Reisezeit: Die ideale Reisezeit für die Åland-Inseln ist im Sommer Juni bis August, für Wintersportfreunde sind die Monate Januar bis März zu empfehlen.
Literatur
- wikipedia = https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C3%85land
- wikitravel = https://wikitravel.org/en/%C3%85land#:~:text=%C3%85land%20%5B1%5D%20(Finnish%3A,rather%20different%20from%20the%20mainland.
- wikivoyage = https://en.wikivoyage.org/wiki/%C3%85land
- James Barros: The Aland Islands Question. Its settlement by the League of Nations, New Haven 1968
- Norbert Burger: Die Selbstverwaltung der Alands-Inseln. Eine Studie über die Lösung einer Minderheitenfrage durch eine wirkliche Autonomie. Mit Vergleichen zur Südtirolfrage, Mondsee [1964]
- Fritz Dressler: Åland-Inseln (= Bucher’s Reisebegleiter Nr. 95), München 1994
- Birgitta Roeck Hansen: Township and territory. A study of rural land-use and settlement patterns in Aland c. A.D. 500 - 1550 (= Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in human geography 6), Stockholm 1991
- Gyrid Hägman: Den Åländska Kvinnans Historia 1700 - 1950, Mariehamn 1983
- Markus Kappeler: Aland, in: Flag of the Nations, Unterägeri 1992
- Heiner Labonde / Jessika Kuehn-Velten: Finnland – Åland-Inseln, Offenbach am Main 2006
- Eija Mäkinen: Åland und sein Sonderstatus, in: Jahrbuch des Föderalismus 6/2005, S. 350 - 362
- J. O. Söderhjelm: Demilitarisation et neutralisation des îles d'Aland en 1856 et 1921, Helsingfors 1928
- Markku Suksi: The Åland Islands in Finland, in: Council of Europe (ed.): Local self-government, territorial integrity and protection of minorities, Strasbourg 1996, S. 20 - 50
- ders.: Ålands konstitution separat bilaga med författningstexter, Åbo 2005
Reiseberichte
- Nordis: Åland. Skandinavien im Kleinformat = https://www.skandinavien.de/aland-skandinavien-im-kleinformat/
- Åland-Inseln - Filetstück zwischen Schweden und Finnland = https://www.travelita.ch/auf-nach-aland-geheimtipp/
- Åland-Inseln - Reisetipps und 10 Highlights = https://www.finnlines.com/de/reisetipp/aland-inseln/
- Mahtava: Meine zehn Reisetipps für die Åland-Inseln im Sommer (2022) = https://mahtava.de/reisetipps-aland-inseln-im-sommer.html
Videos
- Alandzie klimaty = https://www.youtube.com/watch?v=hFKPydLGZJY
- Aland, drone flight = https://www.youtube.com/watch?v=cpcwUuHfk3Y
- Åland Islands Explained = https://www.youtube.com/watch?v=J-kCdl1w8t8
- The Fight for Åland = https://www.youtube.com/watch?v=JXd1n7cA3FE
- The Åland Islands = https://www.youtube.com/watch?v=jgll53Lx5Jw
Atlas
- Åland, openstreetmap = https://www.openstreetmap.org/#map=10/60.2166/20.0583
- Åland, ADAC = https://maps.adac.de/land/aland
- Åland, Satellit = https://satellites.pro/Aland_map
- Åland, Karten = https://visitaland.com/de/reisen/karten/
Forum
Hier geht’s zum Forum: